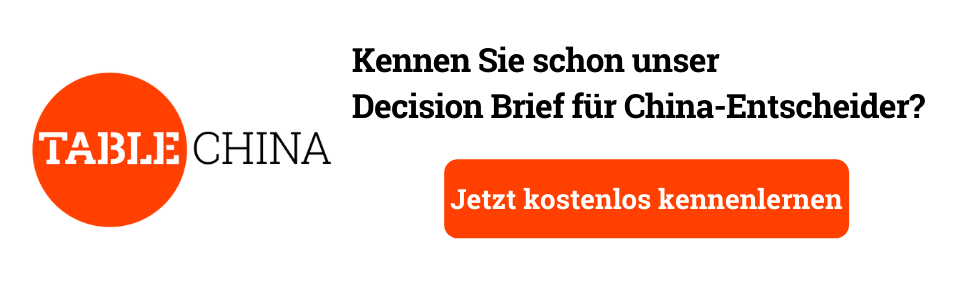der Gasstreit nimmt immer neue Wendungen. In einem Telefonat erklärte Russlands Präsident dem deutschen Bundeskanzler gestern, die Vertragspartner könnten weiter in Euro zahlen – die Gazprom-Bank konvertiere das Geld einfach in Rubel. In Berlin aber ließ man Putin abblitzen, Scholz bat lediglich um schriftliche Informationen. Im Übrigen gelte weiter der G7-Beschluss: Bezahlt werde in Dollar und Euro. Aus der Welt ist ein Lieferstopp also noch nicht. Wie sich Deutschland und andere Staaten darauf vorbereiten, lesen Sie in der Analyse von Manuel Berkel und Till Hoppe.
Zusätzlich zu den umfassenden Vorgaben zur Energieeffizienz von energieverbrauchsrelevanten Produkten will die EU nun Vorgaben zur Reparierbarkeit und Nachhaltigkeit von fast allen Produktgruppen machen. Manuel Berkel hat sich die Novelle der Ökodesign-Richtlinie, die gestern vorgestellt wurde, angesehen und erläutert, inwiefern auch Tablets und Smartphones betroffen sind.
Beim Digital Markets Act gab es kürzlich eine Einigung, beim Digital Services Act steht heute der vierte Trilog an. Ein großes Thema dabei wird die Frage sein, wer denn am Ende zuständig für die Durchsetzung der Regulierung sein und wer die Kosten dafür tragen wird. Warum das Poluter Pays-Prinzip zwar ein Lösungsweg sein kann, aber auch neue Probleme mit sich bringt, hat Falk Steiner aufgeschrieben.
Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen: Europaabgeordnete der Grünen und S&D-Fraktion haben kurz vor Ablauf der Frist Einspruch eingelegt gegen die von der EU vorgesehenen Einstufung von Atomenergie und Erdgas als “grüne” Energiearten. Mehr dazu lesen Sie in den News.
Im Standpunkt schreiben Helen Clark, Dan Smith und Margot Wallström, warum es nicht nur für die Energiesicherheit wichtig ist, so schnell wie möglich von russischem Gas und Öl loszukommen. Der Ausstieg aus den fossilen Energien und der Ausbau der Erneuerbaren Energien beuge auch Konflikten vor, denn die Folgen des Klimawandels destabilisiere am schnellsten Orte, an denen die Spannungen bereits hoch sei.

Morgen sollte die Frist des Kremls ablaufen, Russland wolle dann für Gaslieferungen nur noch Zahlungen in Rubel akzeptieren. So hatte es Staatspräsident Wladimir Putin verkündet. Gestern aber gab es ein Telefonat zwischen ihm und Bundeskanzler Olaf Scholz. Wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwochabend mitteilte, habe Putin darin gesagt, dass sich für die europäischen Vertragspartner nichts ändern werde. Die Zahlungen würden weiterhin ausschließlich in Euro ergehen und wie üblich an die Gazprom-Bank überwiesen, die nicht von den Sanktionen betroffen sei. Die Bank konvertiere dann das Geld in Rubel.
Scholz habe diesem Verfahren aber nicht zugestimmt, sondern nur um schriftliche Informationen dazu gebeten, betonte Hebestreit. Um das Gespräch habe Putin gebeten. Es bleibe dabei, dass die G7-Vereinbarung gilt: Energielieferungen werden ausschließlich in Euro oder Dollar bezahlt. So wie es die Verträge vorsehen.
Dass der Streit um die Gaszahlungen nach wie vor nicht gelöst ist, zeigte gestern auch eine Nachricht aus Brüssel. Die Kommission bereite neue Sanktionen gegen Russland vor, wie Reuters am Abend meldete. Das Ausmaß der neuen Maßnahmen hänge von Moskaus Haltung zu den Gaszahlungen in Rubel ab. Putin will sich heute mit Vertretern von Gazprom und Zentralbank treffen, um sich über den Stand der Dinge informieren zu lassen.
Für die Bundesrepublik hatte Wirtschaftsminister Robert Habeck gestern die Frühwarnstufe des “Notfallplans Gas” in Kraft gesetzt. Es gebe zwar aktuell keine Versorgungsengpässe, betonte er am Morgen. “Dennoch müssen wir die Vorsorgemaßnahmen erhöhen, um für den Fall einer Eskalation seitens Russlands gewappnet zu sein.”
In Brüssel wird damit gerechnet, dass weitere Mitgliedsstaaten es Deutschland gleichtun. Auch Österreich rief gestern die Frühwarnstufe aus, Italien und Lettland hatten dies bereits Ende Februar beziehungsweise Anfang März getan. Das niederländische Wirtschaftsministerium hingegen teilte gestern mit, man halte den Zeitpunkt dafür noch nicht gekommen. Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans sagte, die Behörde werde “sehr eng mit den Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, dass alle sich gut auf diese Lage vorbereiten können”.
Die EU-Staaten haben sich über die sogenannte SoS-Verordnung dazu verpflichtet, Vorsorge für Störungen in der Gasversorgung zu treffen. Sie mussten Präventions- und Notfallpläne erarbeiten und die benötigten Infrastrukturen schaffen, etwa um das Gas auch von West nach Ost durch die Leitungen strömen lassen zu können.
Der zentrale Plan für Deutschland ist der Notfallplan Gas. Er sieht drei Stufen vor, von denen Habeck nun die erste eingeleitet hat. Die zweite Stufe ruft einen Alarm aus, wenn eine “erhebliche Verschlechterung der Gasversorgungslage” vorliegt, die Gasversorger diese aber noch ohne staatliche Eingriffe bewältigen können.
Erst wenn der Markt die Lage nicht mehr in den Griff bekommt, greift die dritte, die “Notfallstufe”. Die Bundesnetzagentur entscheidet dann in Abstimmung mit den Netzbetreibern, welche Gasverbraucher noch versorgt werden. Bestimmte Verbrauchergruppen haben dabei Vorrang, insbesondere private Haushalte, Krankenhäuser und Gaskraftwerke, die zugleich der Wärmeversorgung von Haushalten dienen.
Wenn die nationalen Notfallmaßmaßnahmen nicht ausreichen, greift der Solidaritätsmechanismus auf EU-Ebene: Damit die schutzbedürftigen Verbraucher im vom Engpass betroffenen Land weiter versorgt werden können, sollen angrenzende Mitgliedsstaaten aushelfen. Sie sollen zunächst versuchen, zusätzliche Lieferungen von Gasversorgern zu organisieren. Gelingt das nicht, sollen sie selbst die Versorgung nicht schutzbedürftiger Kunden in ihrem Land einschränken. Die Einzelheiten, auch die Modalitäten der finanziellen Entschädigung, werden dabei in den bilateralen Verträgen festgelegt.
Über solche Solidaritätsverträge verhandelt die Bundesregierung derzeit mit sieben europäischen Staaten. Mit Italien stehe eine Unterzeichnung kurz bevor, mit Polen und Tschechien seien die Verhandlungen weit fortgeschritten, sagte gestern eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums. Mit Frankreich und den Benelux-Staaten werde der Austausch vertieft. Bereits abgeschlossen wurden Solidaritätsverträge mit Dänemark (Dezember 2020) und Österreich (Dezember 2021).
In Kreisen von Bundesregierung und EU-Kommission hieß es, man wisse schlicht nicht, ob Putin Ernst mache und die Lieferungen drossele, wenn EU und G7 auf der vertraglich vereinbarten Abrechnung in Dollar und Euro beharrten. Die Ausrufung der ersten Stufe des Notfallplans solle zuvorderst ein Signal senden. An den Kreml, aber auch an die heimische Industrie, sich für den Ernstfall vorzubereiten. Der Renew-Europaabgeordnete Andreas Glück zweifelt an Putins Entschlossenheit: “Für die russische Wirtschaft sind die Einnahmen von Energieexporten nicht zu ersetzen”.
Mit Ausrufung der Frühwarnstufe tritt ein Krisenstab beim BMWK zusammen, der aus Vertretern der Bundesnetzagentur, des Marktgebietsverantwortlichen Gas, der Fernleitungsnetzbetreiber und der Bundesländer besteht. Die Versorger müssen nun die Behörden nun regelmäßig über die Lage unterrichten.
Es sei wichtig, dass alle Beteiligten für den Fall einer Lieferunterbrechung einen klaren Fahrplan zu ihren Rechten und Pflichten hätten, sagte Kerstin Andreae, Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). “Wir müssen jetzt die Notfallstufe konkret vorbereiten, denn im Fall einer Lieferunterbrechung muss es schnell gehen.”
Die Bundesnetzagentur (BNetzA) hat bereits Vorkehrungen für einen weitgehenden Ausfall der Gaslieferungen getroffen. In den Räumen der Behörde sei ein Lagezentrum eingerichtet worden, in dem die Krisenstäbe alle nötigen Informationen und Kommunikationsmöglichkeiten im 24-Stunden-Betrieb vorfinden, teilte die Behörde mit. Für die Notfallstufe hat die BNetzA bereits jeweils 65 Fachleute für Gas- und Stromkrisenstäbe zusammengezogen und geschult. Die Aufgaben der Lastverteilung könnten demnach im Schichtenbetrieb dauerhaft durchgeführt werden. Ein gewisser Sicherheitspuffer für eventuelle Corona-bedingte Ausfälle sei ebenfalls eingeplant.
Eine abstrakte Abschaltreihenfolge von bestimmten Industriebetrieben oder anderen großen Gasverbrauchern soll es nach Darstellung der BNetzA nicht geben: “Die in einer Mangellage zu treffenden Entscheidungen sind immer Einzelfall-Entscheidungen, weil die dann geltenden Umstände von so vielen Parametern (u.a. Gasspeicherfüllmengen, Witterungsbedingungen, europäische Bedarfe, erzielte Einsparerfolge, etc.) abhängen, dass sie nicht vorherzusehen sind.” Die Agentur erarbeite jedoch Kriterien, die für die Gesamtabwägung im Einzelfall herangezogen werden können.
Eine Gasmangellage hatten die Netzagentur und das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe 2018 geübt. Im Rahmen der LÜKEX 2018 hat die BNetzA von allen größeren Gasverbrauchern in Deutschland grundlegende Informationen über deren Anschluss- und Verbrauchssituation eingeholt. Derzeit aktualisiere die Netzagentur diese Informationen mit hoher Priorität und weite dafür auch die Befragung von Unternehmen und Anschlussnetzbetreibern deutlich aus. Die gesammelten Informationen fließen in eine neue Sicherheitsplattform Gas.
Die Industrie warnt vor den weitreichenden Folgen einer Unterbrechung der Gasversorgung. “Bei umfassenden Lieferstörungen drohen Produktionsstopps mit unübersehbaren Folgen für Wachstum, Lieferketten und Beschäftigung”, sagte BDI-Präsident Siegfried Russwurm.
Ein besonders dramatisches Bild zeichnet die Chemieindustrie. “Wenn unserer Industrie das Gas ausginge, müssten wir Produktionsanlagen herunterfahren”, sagte der Chef des Branchenverbandes VCI, Christian Kullmann, der Nachrichtenagentur Reuters. “Wenn Chemieanlagen einmal heruntergefahren sind, dann stehen sie still für Wochen und Monate”, so Kullmann, der auch Chef des Spezialchemiekonzerns Evonik ist. Dann würden wenig später die Bänder in anderen Branchen wie der Autoindustrie oder dem Maschinenbau folgen: “Es gäbe einen gewaltigen Dominoeffekt durch fast alle Industrien”, warnte Kullmann, “das wäre ein industrieller Flächenbrand”. Wenn einige Ökonomen davon ausgingen, dass sich ohne Gas eine tiefe Rezession vermeiden lasse, dann seien dies “akademische Träumereien“. Von Manuel Berkel und Till Hoppe
Kern des am Mittwoch vorgestellten Pakets zur Kreislaufwirtschaft ist die Novelle der Ökodesign-Richtlinie (Europe.Table berichtete). Galten jahrelang nur Vorgaben zur Energieeffizienz für energieverbrauchsrelevante Produkte, sollen künftig fast alle Produktgruppen umfangreiche Nachhaltigkeitskriterien erfüllen – von den Recyclinganteilen der Materialien bis zur Reparierbarkeit. “Die europäischen Verbraucher erwarten zu Recht umweltfreundlichere und langlebigere Produkte. Mehr Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz bedeuten auch mehr Widerstandsfähigkeit, wenn eine Krise unsere industriellen Lieferketten unterbricht”, sagte Binnenmarktkommissar Thierry Breton.
Bis 2030 kann der neue rechtliche Rahmen laut Kommission dabei helfen, den Energiegehalt von 150 Milliarden Kubikmetern Erdgas einzusparen, was fast den Importen der EU aus Russland entspreche.
Trotz Ausweitung der Ökodesign-Richtlinie sind noch gar nicht alle energieverbrauchsrelevanten Produkte von spezifischen Regeln erfasst. Die Kommission stellte deshalb am Mittwoch auch einen Arbeitsplan für Ökodesign und Energielabel bis 2024 vor. Neue Regeln für Smartphones und Tablets sollen demnach bis Ende 2022 angenommen werden. Neben der Energieeffizienz wird es dabei auch um Aspekte der Materialeffizienz gehen: Haltbarkeit, Reparierbarkeit und Recycling.
“Das Recht auf Reparatur wird mit diesem Vorschlag endlich zur Realität, wenn zum Beispiel das Austauschen des Akkus endlich Wirklichkeit wird”, sagte der Grünen-Abgeordnete Michael Bloss. “Gleichzeitig müssen sich Hersteller endlich erklären, wieso sie intakte Ware einfach verbrennen, wenn diese zurückgesendet werden. Diese heimliche Verschwendung von Ressourcen ist untragbar und muss verboten werden. Doch der Kommissionsvorschlag verpasst diese klare Grenzziehung.”
Für Produkte der Informations- und Kommunikationstechnologie arbeitet die Kommission an einer Studie, die den gesamten Energieverbrauch betrachten soll – einschließlich der Datenübertragung, Konnektivität und dem Nutzerverhalten. Im Blick hat die Behörde auch Firm- und Software. Für Smart-Grid-fähige Elektrogeräte (Energy Smart Appliances) soll es dagegen eine freiwillige Regelung der Industrie geben, um die Interoperabilität der Geräte zu gewährleisten.
Im vierten Quartal will die Kommission außerdem die angekündigten Vorgaben für Photovoltaik-Module implementieren. Geprüft wird noch, ob es auch Grenzwerte für den CO2-Fußabdruck geben soll. Zu den aussichtsreichsten Kandidaten für neue Energievorgaben gelten außerdem Heizkörper – mit der nötigen Umstellung auf Wärmepumpen ist auch ein großflächiger Austausch der Wärmeüberträger zu erwarten.
Bis 2025 sollen zudem bestehende Regulierungen für 46 Produktgruppen wie Server überarbeitet werden. Allein 50 Terrawattstunden (TWh) Strom pro Jahr sollen neue Vorschriften für Raumheizgeräte sparen, bei Wasserpumpen sind es 40 TWh.
Neben der Information über Energielabel will die Kommission weitere Verbraucherrechte stärken und gegen Greenwashing und geplante Obsoleszenz vorgehen – also das gezielte Unbrauchbarmachen von Produkten nach einer bestimmten Zeit, obwohl keine gravierende Abnutzung vorliegt. Zu den unlauteren Geschäftspraktiken sollen künftig zählen:
Händler sollen ihre Kunden künftig außerdem über Herstellergarantien zur Haltbarkeit von Produkten informieren, die über zwei Jahre hinausgehen. Informationspflichten soll es zudem zur Reparierbarkeit von Produkten geben, zum Beispiel in Form einer eigenen Kennzahl.
Mit einer Novelle der Bauproduktenverordnung sollen Baumaterialien künftig leichter recycelbar sein. Eingeführt wird ebenfalls ein digitaler Produktpass und eine Datenbank für Bauprodukte. Gebäude sind laut Kommission für die Hälfte des Ressourcenverbrauchs in der EU verantwortlich sowie für 30 Prozent des Abfallaufkommens.
“Seit fast 10 Jahren hat sich das System der technischen Regulierung und Normung von Bauprodukten als Katalysator für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation bewiesen. Leider kommt dieses System seit einigen Jahren ins Stocken. Ich begrüße es daher, dass die Kommission heute mit der veröffentlichten Überarbeitung der Bauproduktenverordnung den seit einigen Jahren herrschenden Rückstau bei den harmonisierten Normen im Bauproduktebereich auflösen und bestehende Rechtslücken schließen will”, sagte der CSU-Abgeordnete Christian Doleschal.
“Kritisch sehe ich jedoch, dass die Kommission in ein und derselben Verordnung, die die sichere Verwendung von Bauprodukten reguliert nun auch sämtliche Nachhaltigkeitsanforderungen an Bauprodukte regelt. Das schafft nicht nur mehr Bürokratie und Überregulierung, sondern bremst auch Innovationen”, so der Abgeordnete.
Regeln will die Kommission außerdem das Ökodesign von Textilien. Dabei solle auch das Problem von Mikroplastik angegangen werden. “In drei Jahren müssen alle Mitgliedsstaaten, laut europäischem Recht, Textilien getrennt vom Hausmüll sammeln”, erläuterte die SPD-Abgeordnete Delara Burkhardt. “Die Textilstrategie kann nur erfolgreich sein und einen Mehrwert bieten, wenn die soziale Dimension mitgedacht wird. Sie muss Umweltstandards in der Textillieferkette setzen, die gleichzeitig auch Arbeitnehmer:innenrechte verpflichtend macht.”
04.04.2022 – 18:00-19:30 Uhr, online
DGAP, Roundtable France is Back
German Council on Foreign Relations (DGAP) takes stock of France’s European, foreign, and security policy under President Emmanuel Macron and clarifies their impact on the political campaign. INFO & REGISTRATION
04.04.2022 – 16:00-18:00 Uhr, online
BDI, Diskussion Umsetzung der europäischen Verbandsklagerichtlinie in deutsches Recht
Auf der Veranstaltung des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) werden Vorschläge zur Umsetzung der europäischen Verbandsklagerichtlinie in deutsches Recht im Rahmen eines Webtalks mit Rechtspolitikern und Rechtspolitikerinnen der Bundestagsfraktionen diskutiert. INFOS & ANMELDUNG
04.04.2022 – 10:00-15:00 Uhr, online
BDE, Seminar Neues ElektroG – Was ändert die Novelle 2021?
Im Jahr 2022 kommen bedeutende Änderungen für Erfassung, die Behandlung und die Wiederverwendung von Elektrogeräten auf die Entsorgungsbranche zu. Das Seminar des Bundesverbandes der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft (BDE) soll den betroffenen Betrieben die Möglichkeit geben, sich über die Neuerungen zu informieren. INFOS & ANMELDUNG
04.04.2022 – 18:00-19:30 Uhr, online
BMUV, Diskussion Rebound-Effekte als Herausforderung für eine Nachhaltige Digitalisierung
Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) möchte anhand von Fallbeispielen aufzeigen, wie Rebound-Effekte entstehen und die ökologische Bilanz verändern und wie diese begrenzt werden können. INFOS & ANMELDUNG
Eines ist DMA, DSA und KI-Verordnung gemeinsam: Ohne Durchsetzung ist ihre Wirksamkeit fraglich. Doch wie das ganz konkret geschehen soll, ist eine der heiklen Fragen. Und diese wird in jedem der Gesetzesakte unterschiedlich beantwortet. Insbesondere unter dem Eindruck von Defiziten der dezentral organisierten Durchsetzung der Datenschutzgrundverordnung durch nationale Behörden haben Parlament, Rat und Kommission die Suche nach alternativen Modellen vorangetrieben. Eine der Lehren aus der DSGVO: Wenn die Nationalstaaten ein starkes eigenes Interesse an einer schwachen Aufsichtsbehörde haben, ist die europäische Einheitlichkeit der Durchsetzung kaum zu garantieren. Das wäre für die Wirksamkeit von DSA, DMA und AI Act jedoch ein massives Problem.
Deshalb kam es in der Diskussion um den Digital Services Act zu einem ungewöhnlichen Ereignis: Das sonst so oft auf nationale Hoheit achtende Frankreich schlug vor, dass die Kommission bei geringeren Hürden als ursprünglich geplant die Aufsicht über Onlineplattformen ausüben solle. Das Ziel: Nationale Aufsichtsbehörden – im DSA Digital Services Coordinator genannt – sollen den europäischen Rechtsrahmen bei wichtigen Unternehmen auf keinen Fall kreativ auslegen können, um dem Land mit Sitz des Unternehmens oder seiner europäischen Hauptvertretung Standortvorteile zu verschaffen. Bei der DSGVO hatte sich gezeigt, dass solch ein Gebaren nur auf langen und umständlichen Wegen wieder eingefangen werden kann, wenn überhaupt.
Doch vor allem die personellen Kapazitäten für eine Aufsicht unmittelbar durch die Kommission sind begrenzt, weshalb Vizekommissionspräsidentin Margrethe Vestager das Thema überraschend am Rande des dritten DSA-Trilogs aufwarf: Wäre es nicht gut, die Beaufsichtigten für ihre Aufsicht selbst zahlen zu lassen? Immerhin gibt es hierfür bereits Präzedenzfälle – etwa im Umweltrecht, wo das sogenannte “Polluter Pays Principle” breite Anwendung findet. Und auch in der Bankenaufsicht werden die Beaufsichtigten an den Kosten hierfür beteiligt.
Ein Vorschlag der Grünen-Fraktion im EP zum DSA, das Amendment 2075, hatte die Einführung einer eigenständigen europäischen Aufsichtsbehörde vorausgesetzt, die per Polluter Pays Principle hätte refinanziert werden sollen. Eine “jährliche Aufsichtsgebühr für sehr große Onlineplattformen” hätte hier ergänzend zum von der EU bereitgestellten Budget wirksam werden sollen. Doch hierfür fand sich im Europaparlament keine Mehrheit. Dabei gibt es in der Digitalgesetzgebung der EU bereits ein Vorbild.
Das Modell der eIDAS-Verordnung wäre radikal: Dort gibt es mit dem Artikel 20 eine Regelung, bei der sogenannte qualifizierte Vertrauensdienstleister durch spezielle Konformitätsbewertungsstellen spätestens alle zwei Jahre auf Kosten der Anbieter geprüft werden müssen. Die Aufsichtsbehörden können zudem jederzeit eine Sonderprüfung veranlassen. Auch hier gilt, dass die Prüfungskosten durch die Dienstleister zu tragen sind. Die Vorgaben der eIDAS-Verordnung ließen sich leicht in den DSA übertragen.
Aber wäre das auch wünschenswert? “Wenn Aufsichtsbehörden von Strafzahlungen oder ihrem Handeln gegenüber Unternehmen profitieren, schafft das immer Probleme”, sagt Ben Wagner von der Technischen Universität Delft. Der Spezialist für Digital-Governance-Mechanismen sieht eine eigenständige europäische Durchsetzungsbehörde für die bessere Lösung an als eine Durchsetzung direkt durch die Kommission. Das Polluter Pays-Prinzip sieht er kritisch: “Besser wäre eine saubere, ordentliche Finanzierung der Behörde, die entsprechend dem tatsächlichen Aufwand gestaffelt ist.”
Überhaupt nichts von Ideen wie Polluter Pays hält der Bitkom. “Üblicherweise trägt bei Wettbewerbsbehörden der Staat bzw. die Staatengemeinschaft die Kosten der Rechtsdurchsetzung und ist bei Regelverstößen Empfänger der Bußgeldzahlungen”, sagt die Leiterin Vertrauen und Sicherheit, Rebekka Weiß. “Wir sehen keinen Grund, warum im Falle einer DSA-Aufsicht anders verfahren werden sollte.”
Aus Kommissionskreisen hieß es, dass über ein gemischtes Modell nachgedacht wird: Aus Kommissionsmitteln wäre ein Grundstock an Personal zu leisten. Die Abgaben der betreffenden Unternehmen sollten dazu, fallbezogen oder zeitlich befristet, der Heranziehung abgeordneter nationaler Experten sowie externer Unterstützung eingesetzt werden.
Er halte eine Aufsichtsgebühr grundsätzlich für eine interessante Idee, wenn damit auch ein dringend notwendiger Ausbau der Aufsichtskapazitäten auf nationaler und EU-Ebene vorangetrieben würde, sagt Julian Jaursch, Plattformregulierungsexperte bei der Stiftung Neue Verantwortung. “Auch die Finanzierung externer Fachleute, die in Beratungen und Aufsichtsentscheidungen eingebunden werden sollten, könnte dadurch sichergestellt werden.”
Allerdings könnte auch der Einsatz externer Kräfte neue Probleme mit sich bringen, wenn etwa Anwaltskanzleien zeitversetzt oder gar nur durch Chinese Walls getrennt für Regulierer und Regulierte tätig würden – und der Markt für spezialisierte Rechts- und Technikkundige ist offenkundig leergefegt. Ben Wagner von der TU Delft hegt Zweifel daran, dass die Trilog-Parteien die Aufgabengröße richtig einschätzen: “Der Kommission fehlen sowohl die Ressourcen als auch die Unabhängigkeit. Allen Akteuren ist meines Erachtens nicht bewusst, was für ein Riesenaufwand das ist.”
Julian Jaursch sieht hier ebenfalls ein Problem, und fordert aufgrund der Polluter Pays-Idee eine grundsätzlichere Diskussion unter den Verhandlern: “Wenn jetzt auf einmal gegen Ende der DSA-Verhandlung eine Aufsichtsgebühr zur Debatte steht, sollte auch die bisher geplante Aufsichtsstruktur überdacht werden und stattdessen eine spezialisierte, eigenständige EU-Plattformaufsicht in Erwägung gezogen werden.” Wenn die Aufsicht finanziell von den Unternehmen abhänge, müsse die Unabhängigkeit noch stärker garantiert werden.
Spätestens dann, wenn nicht nur die Kommission für ihre Zuständigkeiten, sondern auch die Mitgliedstaaten ihre DSA-Aufsicht über Supervisory Fees teilweise refinanzieren würde, könnte sonst ein von der DSGVO bereits bekannter Effekt eintreten: Eine Art Nichtregulierungswettbewerb der mitgliedstaatlichen Aufsichtsbehörden. Denn Unternehmen könnten jederzeit ihren Sitz in Europa verlegen, wenn ihnen die Aufsicht nicht passt. Eine Möglichkeit, das Problem zu umgehen, schlägt Julian Jaursch von der Stiftung Neue Verantwortung vor: “Wenn die EU wirklich innovativ sein wollte, würde sie große Plattformen nicht nur an den Kosten für eine EU-Aufsicht beteiligen, sondern mit einer möglichen Gebühr einen unabhängigen Fonds aufsetzen.”
Während der DMA bereits ausverhandelt ist, die Kommission soll mit etwa 80 Stellen den größten Akteuren entgegentreten, könnte das Thema beim vierten DSA-Trilog heute noch einmal eine größere Rolle spielen. Allerdings sei das Plädoyer für eine entsprechende Regelung vonseiten der Kommission reichlich spät gekommen, heißt es aus Parlamentskreisen. Allerdings sind es vor allem die Mitgliedstaaten und die Kommission, die den DSA möglichst schnell verabschieden wollen. Bei der KI-Verordnung hingegen bleibt trotz aller Eile noch ausreichend viel Zeit, um über Ausgestaltung und Lastverteilung zu debattieren.
Die Europaabgeordneten der Grünen im ECON- und ENVI-Ausschuss sowie die der S&D-Fraktion im ECON-Ausschuss haben offiziell Einspruch gegen den komplementären Delegierten Rechtsakt zur EU-Taxonomie eingelegt. Die Frist zur Eröffnung des Einspruchsverfahrens endete gestern um 17 Uhr.
Die Klassifizierung von Atomenergie und Erdgas als nachhaltig hätte automatisch in Kraft treten können, sofern im Parlament oder im Rat keine Einwände erhoben worden wären. Mit dem Einspruch der beiden Fraktionen ist das Verfahren, mit dem das Parlament zu einem späteren Zeitpunkt über den Delegierten Rechtsakt abstimmen kann, formal eingeleitet.
Nun haben die Parlamentarier:innen bis zum 30. Mai Zeit, eine Einspruchsentschließung einzureichen, der sich auch Abgeordnete anderer Fraktionen anschließen können. Die Grünen haben angekündigt, einen Entschließungsantrag auszuarbeiten, der von einem breiten fraktionsübergreifenden Bündnis mitgetragen wird.
Man werde diesen Schritt mit stichhaltigen Argumenten unterlegen, kündigte Rasmus Andresen, Grünen-Abgeordneter im ECON-Ausschuss, an. “Damit wollen wir konservative und liberale Parlamentarier:innen überzeugen, auch gegen die Taxonomie zu stimmen. Im Parlament wird die Kritik an von der Leyens Vorschlag spürbar lauter”, erklärte Andresen.
Die Koordinatoren der S&D-Fraktion werden Ende kommender Woche über eine gemeinsame Resolution entscheiden, in der der Einspruch begründet wird. Die Abstimmung über die Einspruchsentschließung im gemeinsamen ENVI/ECON-Ausschuss soll im Juni stattfinden, bevor im Juli das Plenum votiert. Für eine absolute Mehrheit, die zur Annahme des Einspruchs nötig ist, braucht es 353 Stimmen. Sollte diese nicht erreicht werden und auch aus dem Rat keine Einwände kommen, wird der Delegierte Rechtsakt rechtskräftig. luk
Russland hat am Mittwoch angedeutet, dass alle russischen Energie- und Rohstoffexporte in Rubel abgerechnet werden könnten. Damit verschärft Präsident Wladimir Putin seinen Versuch, den Westen den Schmerz der Sanktionen spüren zu lassen, die er wegen der Invasion in der Ukraine verhängt hat.
“Wenn Sie Gas wollen, finden Sie Rubel”, sagte Wolodin in einem Beitrag auf Telegram. “Außerdem wäre es richtig – wenn es für unser Land von Vorteil ist – die Liste der in Rubel bepreisten Exportprodukte zu erweitern: Dünger, Getreide, Speiseöl, Öl, Kohle, Metalle, Holz usw.”
Da sich die russische Wirtschaft in der schwersten Krise seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 befindet, schlug Putin am 23. März auf den Westen zurück und ordnete an, dass die russischen Gasexporte in Rubel bezahlt werden sollten.
Als bisher stärkstes Signal, dass Russland eine noch härtere Reaktion auf die Sanktionen des Westens vorbereiten könnte, deutete der oberste russische Gesetzgeber am Mittwoch an, dass fast alle russischen Energie- und Rohstoffexporte bald in Rubel abgerechnet werden könnten. Auf die Äußerungen von Parlamentspräsident Wjatscheslaw Wolodin angesprochen, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow: “Das ist eine Idee, an der auf jeden Fall gearbeitet werden sollte. Es kann gut sein, dass sie ausgearbeitet wird”, sagte Peskow über den Vorschlag. rtr
Die Wettbewerbsbehörden der Europäischen Union haben einem Insider zufolge eine Razzia beim russischen Erdgas-Konzern Gazprom vorgenommen. Damit will die Wettbewerbsbehörde ihre Ermittlungen zu den Gaslieferungen des Unternehmens nach Europa ausweiten. Die mit dem Vorgang vertraute Person lehnte es ab, weitere Einzelheiten zu nennen.
EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager hatte im Januar mehrere Gasunternehmen, darunter auch Gazprom, wegen Lieferengpässen befragt und Gazprom vorgeworfen, zusätzliche Produktion zurückzuhalten, die zur Senkung der steigenden Preise freigegeben werden könnten. Vestager werde wahrscheinlich das Sammeln von Informationen über die europäischen Geschäfte von Gazprom intensivieren, sagte eine Person, die mit den Überlegungen der Regulierungsbehörde vertraut ist, letzten Monat gegenüber Reuters.
Die Europäische Kommission lehnte eine Stellungnahme ab, auch Gazprom Export wollte sich nicht äußern. Bloomberg berichtete als erste über die Razzien in den Büros von Gazprom in Deutschland. Gazprom und der Kreml haben wiederholt bestritten, Gaslieferungen zurückzuhalten, und erklärt, dass alle festen und langfristigen Verpflichtungen erfüllt worden seien. rtr
Europäische Unternehmen sollen künftig einen besseren Zugang zu öffentlichen Aufträgen und Beschaffungsverfahren im Nicht-EU-Ausland erhalten. Ermöglichen soll dies das Internationale Beschaffungsinstrument (International Procurement Instrument, IPI).
Am Mittwoch haben die EU-Mitgliedstaaten im Ausschuss der Ständigen Vertreter die zwischen Europäischem Parlament und Rat der EU erzielte Einigung über den entsprechenden Verordnungsvorschlag gebilligt. Das gab das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz am Mittwoch in einer Mitteilung bekannt. Damit nimmt das Instrument nach rund zehn Jahre dauernden Verhandlungen seit der Veröffentlichung des ersten Kommissionsvorschlags eine entscheidende Hürde.
Sven Giegold, Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz sagte, die EU wolle “transparente und diskriminierungsfreie Vergabeverfahren”. Ziel des IPI ist es, Vergabemärkte in Staaten außerhalb der EU für europäische Unternehmen zu öffnen und den fairen Zugang zu Beschaffungsverfahren im Nicht-EU-Ausland zu ermöglichen.
Angebote von Unternehmen aus Staaten außerhalb der EU, die ihren Beschaffungsmarkt nur unzureichend für europäische Bieter zugänglich machen, können künftig bei Vergabeverfahren in der gesamten EU im Rahmen der Angebotswertung bewusst benachteiligt oder sogar ausgeschlossen werden.
Dadurch soll die Bereitschaft von Drittstaaten gesteigert werden, ihre Beschaffungsmärkte – etwa durch den Beitritt zu dem WTO-Beschaffungsübereinkommen GPA (Government Procurement Agreement) oder den Abschluss bilateraler Marktzugangsvereinbarungen – für Unternehmen aus der EU zu öffnen. Der Vorschlag bedarf vor dem Inkrafttreten noch der formalen Zustimmung des Europäischen Parlaments und des Rats.
Die Lufthansa und andere Airlines eines Luftfracht-Kartells sind endgültig mit ihren Klagen gegen eine Bußgeld-Entscheidung der EU-Kommission gescheitert. Geldbußen gegen Air France, KLM und andere würden aufrecht erhalten und die Klagen zurückgewiesen, teilte das EU-Gericht am Mittwoch mit.
Der Lufthansa und zwei ihrer Tochtergesellschaften war die Strafe bei der ersten Entscheidung der EU-Kommission 2010 erlassen worden, weil sie als Kronzeugen das Kartell offenbart hatten. Dennoch hatte sich die Lufthansa vor Gericht zusammen mit den anderen Airlines gegen die Entscheidung der Wettbewerbsbehörde gewehrt. Air France und KLM müssen zusammen mit gut 300 Millionen Euro die höchsten Bußgelder zahlen. Ursprünglich verhängte die EU-Kommission 790 Millionen Euro Bußgelder gegen alle Beteiligten.
Ein Dutzend Frachtfluggesellschaften hatte zwischen 1999 und 2006 Preise abgesprochen. Beteiligt waren auch noch British Airways, SAS, Japan Airlines und Cathay Pacific Airways. Den ersten Bußgeldentscheid der EU von 2010 fochten die Unternehmen erfolgreich an.
Das EU-Gericht hob ihn 2015 wegen “inhärenter Widersprüche” auf. Die Wettbewerbsbehörde verhängte die Geldstrafe mit nachgebesserter Begründung 2017 abermals, dagegen klagten alle Unternehmen erneut. Bei einigen Airlines reduzierte das Gericht jetzt die Bußgelder, zum Teil wegen Verstoßes der EU-Behörde gegen Verjährungsfristen. rtr

Die Vereinigten Staaten kündigten vor kurzem einen sofortigen Einfuhrstopp für russisches Öl und Gas an, das Vereinigte Königreich und die Europäische Union versprachen, die Importe schrittweise zu drosseln. Der Grundgedanke ist klar: Bestrafung Russlands, Verringerung seines Einflusses und Wiederherstellung des Friedens in der Ukraine. Doch falsche Entscheidungen – insbesondere die weitere Bevorzugung fossiler Brennstoffe gegenüber erneuerbaren Energien – könnten jetzt für eine weitaus weniger friedliche Zukunft sorgen.
Da einige westliche Länder sich in den letzten Jahren zu sehr von russischem Öl und Gas abhängig gemacht haben, fiel die Entscheidung, die Förderung zu reduzieren, nicht leicht. Die größere und schwierigere Entscheidung, vor der die westlichen Regierungen stehen, ist jedoch die Frage, wie sie ihre Gesamtabhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern können. Eine schmutzige Energiequelle einfach durch eine andere zu ersetzen, würde bedeuten, dass man sich mit den wachsenden Gefahren des Klimawandels erst später befassen kann – wenn überhaupt.
Angesichts des Drucks der aktuellen Ukraine-Krise wäre eine solche Kurzsichtigkeit verständlich. Die westlichen Regierungen müssen die Energielücke schließen, die durch den Stopp der russischen Importe fossiler Brennstoffe entsteht, und gleichzeitig den Schaden für die Volkswirtschaften so gering wie möglich halten. Im Moment haben sie die Öffentlichkeit auf ihrer Seite. Aber wenn die Energiekosten zu stark ansteigen oder es zu Engpässen kommt, könnte der daraus resultierende wirtschaftliche Schaden die öffentliche Unterstützung schwinden lassen.
Alternative Energiequellen müssen daher schnell in Betrieb genommen werden und eine erschwingliche, zuverlässige Versorgung gewährleisten. Und sie sollten keine neuen geopolitischen Verwicklungen schaffen, die später Probleme verursachen könnten.
Auf der kürzlich abgehaltenen jährlichen CERAWeek Energiekonferenz in Houston, Texas, schlugen die Vorstandsvorsitzenden der großen Ölkonzerne und deren Lobbyisten vor, die Öl- und Gasproduktion anzukurbeln, die Produktionsbeschränkungen aufzuheben, die Vorschriften zu lockern und die Maßnahmen zur Senkung der Kohlendioxidemissionen rückgängig zu machen. Mehrere Energieanalysten und Wirtschaftswissenschaftler haben sich dieser Linie angeschlossen.
Doch angesichts des Klimawandels, der sich schnell zu einem der Hauptgründe für die weltweite Unsicherheit entwickelt, wäre es ein tragischer Fehler, weiter auf fossile Brennstoffe zu setzen – eine Entscheidung, die die Welt in den kommenden Jahrzehnten zu einem gewalttätigeren Ort machen könnte.
Der Bericht über die Produktionslücke 2021 verdeutlicht die Diskrepanz zwischen den derzeitigen Plänen für die Produktion fossiler Brennstoffe und den Klimazusagen. Bei der derzeitigen Politik ist die globale Erwärmung auf dem besten Weg, in diesem Jahrhundert eine katastrophale Temperatur von 2,7 Grad Celsius zu erreichen. Wir müssen Bohrlöcher und Minen rasch schließen und die Produktion zurückfahren, anstatt weitere Kapazitäten zu schaffen.
Der Klimawandel macht die Welt schon jetzt gefährlicher und weniger stabil. Der jüngste Bericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC), den der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, als “Atlas des menschlichen Leids” bezeichnete, enthält eine drastische Bewertung der enormen wirtschaftlichen und menschlichen Kosten, die selbst die ersten Auswirkungen des Klimawandels, die wir jetzt erleben, verursachen. Er zeichnet ein Bild einer Zukunft, die wir vermeiden müssen.
Ein Blick auf die Schlagzeilen der letzten 12 Monate zeigt, dass Überschwemmungen, Stürme, Waldbrände, Hitzewellen und Dürreperioden Rekordwerte erreicht haben. All diese Wetterereignisse werden infolge des Klimawandels häufiger, extremer und tödlicher, und sie alle können die Wahrscheinlichkeit von Konflikten und Instabilität erhöhen. Heute sind 80 Prozent der UN-Friedenstruppen in Ländern stationiert, die als besonders gefährdet für den Klimawandel gelten. Ebenso ergab eine aktuelle Studie, dass ein Temperaturanstieg von 1 Grad Celsius mit einem 54-prozentigen Anstieg der Konflikthäufigkeit in Teilen Afrikas verbunden ist, wo nomadische Hirten und sesshafte Bauern um die schwindenden Wasservorräte und fruchtbares Land konkurrieren.
Wie der IPCC-Bericht zu Recht feststellt, destabilisieren die Folgen des Klimawandels am schnellsten Orte, an denen die Spannungen bereits hoch und die Regierungsstrukturen bereits geschwächt oder korrupt sind. Wie Untersuchungen für den kommenden “Environment of Peace”-Berichts des Stockholmer Friedensforschungsinstituts (SIPRI) zeigen, gedeihen bewaffnete extremistische Gruppen wie al-Shabaab, der Islamische Staat und Boko Haram in Regionen, die unter den schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels leiden. Sie finden Rekruten und Anhänger unter den Menschen, deren Leben und Lebensgrundlagen durch Überschwemmungen und Dürren immer prekärer geworden sind.
In unserer globalisierten, vernetzten Welt können sich die Folgen lokaler Klimaauswirkungen durch Schocks in den Versorgungsketten, übergreifende Konflikte und Massenmigrationen schnell ausbreiten. Und wie Russlands Einmarsch in die Ukraine gezeigt hat, ist die auf Regeln basierende Ordnung alarmierend zerbrechlich, sodass die einfachen Menschen mit den schrecklichen Folgen konfrontiert werden.
Die Ablehnung des Westens gegenüber russischem Öl und Gas bietet die Chance, den Übergang weg von fossilen Brennstoffen zu beschleunigen. Energieeffizienz und andere Bedarfsreduzierungen können einen Teil dieser Aufgabe übernehmen. Im Übrigen sind erneuerbare Alternativen wie Solar- und Windenergie wirtschaftlich sinnvoll. Sie sind viel schneller und sicherer zu installieren als Kernkraftwerke oder die meisten der diskutierten Alternativen für fossile Brennstoffe. Und sie setzen die Menschen nicht den Schwankungen der globalen Brennstoffmärkte aus.
Die Logik zeigt nur in eine Richtung. Nur wenn wir uns von den fossilen Brennstoffen verabschieden, wird die Welt echte Energiesicherheit erreichen – und eine Chance haben, eine friedlichere, lebenswertere und erschwinglichere Zukunft aufzubauen.
Die Autoren sind Mitglieder des Expertengremiums, das die Initiative Environment of Peace des SIPRI berät.
In Kooperation mit Project Syndicate, 2022. Aus dem Englischen von Andreas Hubig.
der Gasstreit nimmt immer neue Wendungen. In einem Telefonat erklärte Russlands Präsident dem deutschen Bundeskanzler gestern, die Vertragspartner könnten weiter in Euro zahlen – die Gazprom-Bank konvertiere das Geld einfach in Rubel. In Berlin aber ließ man Putin abblitzen, Scholz bat lediglich um schriftliche Informationen. Im Übrigen gelte weiter der G7-Beschluss: Bezahlt werde in Dollar und Euro. Aus der Welt ist ein Lieferstopp also noch nicht. Wie sich Deutschland und andere Staaten darauf vorbereiten, lesen Sie in der Analyse von Manuel Berkel und Till Hoppe.
Zusätzlich zu den umfassenden Vorgaben zur Energieeffizienz von energieverbrauchsrelevanten Produkten will die EU nun Vorgaben zur Reparierbarkeit und Nachhaltigkeit von fast allen Produktgruppen machen. Manuel Berkel hat sich die Novelle der Ökodesign-Richtlinie, die gestern vorgestellt wurde, angesehen und erläutert, inwiefern auch Tablets und Smartphones betroffen sind.
Beim Digital Markets Act gab es kürzlich eine Einigung, beim Digital Services Act steht heute der vierte Trilog an. Ein großes Thema dabei wird die Frage sein, wer denn am Ende zuständig für die Durchsetzung der Regulierung sein und wer die Kosten dafür tragen wird. Warum das Poluter Pays-Prinzip zwar ein Lösungsweg sein kann, aber auch neue Probleme mit sich bringt, hat Falk Steiner aufgeschrieben.
Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen: Europaabgeordnete der Grünen und S&D-Fraktion haben kurz vor Ablauf der Frist Einspruch eingelegt gegen die von der EU vorgesehenen Einstufung von Atomenergie und Erdgas als “grüne” Energiearten. Mehr dazu lesen Sie in den News.
Im Standpunkt schreiben Helen Clark, Dan Smith und Margot Wallström, warum es nicht nur für die Energiesicherheit wichtig ist, so schnell wie möglich von russischem Gas und Öl loszukommen. Der Ausstieg aus den fossilen Energien und der Ausbau der Erneuerbaren Energien beuge auch Konflikten vor, denn die Folgen des Klimawandels destabilisiere am schnellsten Orte, an denen die Spannungen bereits hoch sei.

Morgen sollte die Frist des Kremls ablaufen, Russland wolle dann für Gaslieferungen nur noch Zahlungen in Rubel akzeptieren. So hatte es Staatspräsident Wladimir Putin verkündet. Gestern aber gab es ein Telefonat zwischen ihm und Bundeskanzler Olaf Scholz. Wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwochabend mitteilte, habe Putin darin gesagt, dass sich für die europäischen Vertragspartner nichts ändern werde. Die Zahlungen würden weiterhin ausschließlich in Euro ergehen und wie üblich an die Gazprom-Bank überwiesen, die nicht von den Sanktionen betroffen sei. Die Bank konvertiere dann das Geld in Rubel.
Scholz habe diesem Verfahren aber nicht zugestimmt, sondern nur um schriftliche Informationen dazu gebeten, betonte Hebestreit. Um das Gespräch habe Putin gebeten. Es bleibe dabei, dass die G7-Vereinbarung gilt: Energielieferungen werden ausschließlich in Euro oder Dollar bezahlt. So wie es die Verträge vorsehen.
Dass der Streit um die Gaszahlungen nach wie vor nicht gelöst ist, zeigte gestern auch eine Nachricht aus Brüssel. Die Kommission bereite neue Sanktionen gegen Russland vor, wie Reuters am Abend meldete. Das Ausmaß der neuen Maßnahmen hänge von Moskaus Haltung zu den Gaszahlungen in Rubel ab. Putin will sich heute mit Vertretern von Gazprom und Zentralbank treffen, um sich über den Stand der Dinge informieren zu lassen.
Für die Bundesrepublik hatte Wirtschaftsminister Robert Habeck gestern die Frühwarnstufe des “Notfallplans Gas” in Kraft gesetzt. Es gebe zwar aktuell keine Versorgungsengpässe, betonte er am Morgen. “Dennoch müssen wir die Vorsorgemaßnahmen erhöhen, um für den Fall einer Eskalation seitens Russlands gewappnet zu sein.”
In Brüssel wird damit gerechnet, dass weitere Mitgliedsstaaten es Deutschland gleichtun. Auch Österreich rief gestern die Frühwarnstufe aus, Italien und Lettland hatten dies bereits Ende Februar beziehungsweise Anfang März getan. Das niederländische Wirtschaftsministerium hingegen teilte gestern mit, man halte den Zeitpunkt dafür noch nicht gekommen. Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans sagte, die Behörde werde “sehr eng mit den Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, dass alle sich gut auf diese Lage vorbereiten können”.
Die EU-Staaten haben sich über die sogenannte SoS-Verordnung dazu verpflichtet, Vorsorge für Störungen in der Gasversorgung zu treffen. Sie mussten Präventions- und Notfallpläne erarbeiten und die benötigten Infrastrukturen schaffen, etwa um das Gas auch von West nach Ost durch die Leitungen strömen lassen zu können.
Der zentrale Plan für Deutschland ist der Notfallplan Gas. Er sieht drei Stufen vor, von denen Habeck nun die erste eingeleitet hat. Die zweite Stufe ruft einen Alarm aus, wenn eine “erhebliche Verschlechterung der Gasversorgungslage” vorliegt, die Gasversorger diese aber noch ohne staatliche Eingriffe bewältigen können.
Erst wenn der Markt die Lage nicht mehr in den Griff bekommt, greift die dritte, die “Notfallstufe”. Die Bundesnetzagentur entscheidet dann in Abstimmung mit den Netzbetreibern, welche Gasverbraucher noch versorgt werden. Bestimmte Verbrauchergruppen haben dabei Vorrang, insbesondere private Haushalte, Krankenhäuser und Gaskraftwerke, die zugleich der Wärmeversorgung von Haushalten dienen.
Wenn die nationalen Notfallmaßmaßnahmen nicht ausreichen, greift der Solidaritätsmechanismus auf EU-Ebene: Damit die schutzbedürftigen Verbraucher im vom Engpass betroffenen Land weiter versorgt werden können, sollen angrenzende Mitgliedsstaaten aushelfen. Sie sollen zunächst versuchen, zusätzliche Lieferungen von Gasversorgern zu organisieren. Gelingt das nicht, sollen sie selbst die Versorgung nicht schutzbedürftiger Kunden in ihrem Land einschränken. Die Einzelheiten, auch die Modalitäten der finanziellen Entschädigung, werden dabei in den bilateralen Verträgen festgelegt.
Über solche Solidaritätsverträge verhandelt die Bundesregierung derzeit mit sieben europäischen Staaten. Mit Italien stehe eine Unterzeichnung kurz bevor, mit Polen und Tschechien seien die Verhandlungen weit fortgeschritten, sagte gestern eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums. Mit Frankreich und den Benelux-Staaten werde der Austausch vertieft. Bereits abgeschlossen wurden Solidaritätsverträge mit Dänemark (Dezember 2020) und Österreich (Dezember 2021).
In Kreisen von Bundesregierung und EU-Kommission hieß es, man wisse schlicht nicht, ob Putin Ernst mache und die Lieferungen drossele, wenn EU und G7 auf der vertraglich vereinbarten Abrechnung in Dollar und Euro beharrten. Die Ausrufung der ersten Stufe des Notfallplans solle zuvorderst ein Signal senden. An den Kreml, aber auch an die heimische Industrie, sich für den Ernstfall vorzubereiten. Der Renew-Europaabgeordnete Andreas Glück zweifelt an Putins Entschlossenheit: “Für die russische Wirtschaft sind die Einnahmen von Energieexporten nicht zu ersetzen”.
Mit Ausrufung der Frühwarnstufe tritt ein Krisenstab beim BMWK zusammen, der aus Vertretern der Bundesnetzagentur, des Marktgebietsverantwortlichen Gas, der Fernleitungsnetzbetreiber und der Bundesländer besteht. Die Versorger müssen nun die Behörden nun regelmäßig über die Lage unterrichten.
Es sei wichtig, dass alle Beteiligten für den Fall einer Lieferunterbrechung einen klaren Fahrplan zu ihren Rechten und Pflichten hätten, sagte Kerstin Andreae, Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). “Wir müssen jetzt die Notfallstufe konkret vorbereiten, denn im Fall einer Lieferunterbrechung muss es schnell gehen.”
Die Bundesnetzagentur (BNetzA) hat bereits Vorkehrungen für einen weitgehenden Ausfall der Gaslieferungen getroffen. In den Räumen der Behörde sei ein Lagezentrum eingerichtet worden, in dem die Krisenstäbe alle nötigen Informationen und Kommunikationsmöglichkeiten im 24-Stunden-Betrieb vorfinden, teilte die Behörde mit. Für die Notfallstufe hat die BNetzA bereits jeweils 65 Fachleute für Gas- und Stromkrisenstäbe zusammengezogen und geschult. Die Aufgaben der Lastverteilung könnten demnach im Schichtenbetrieb dauerhaft durchgeführt werden. Ein gewisser Sicherheitspuffer für eventuelle Corona-bedingte Ausfälle sei ebenfalls eingeplant.
Eine abstrakte Abschaltreihenfolge von bestimmten Industriebetrieben oder anderen großen Gasverbrauchern soll es nach Darstellung der BNetzA nicht geben: “Die in einer Mangellage zu treffenden Entscheidungen sind immer Einzelfall-Entscheidungen, weil die dann geltenden Umstände von so vielen Parametern (u.a. Gasspeicherfüllmengen, Witterungsbedingungen, europäische Bedarfe, erzielte Einsparerfolge, etc.) abhängen, dass sie nicht vorherzusehen sind.” Die Agentur erarbeite jedoch Kriterien, die für die Gesamtabwägung im Einzelfall herangezogen werden können.
Eine Gasmangellage hatten die Netzagentur und das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe 2018 geübt. Im Rahmen der LÜKEX 2018 hat die BNetzA von allen größeren Gasverbrauchern in Deutschland grundlegende Informationen über deren Anschluss- und Verbrauchssituation eingeholt. Derzeit aktualisiere die Netzagentur diese Informationen mit hoher Priorität und weite dafür auch die Befragung von Unternehmen und Anschlussnetzbetreibern deutlich aus. Die gesammelten Informationen fließen in eine neue Sicherheitsplattform Gas.
Die Industrie warnt vor den weitreichenden Folgen einer Unterbrechung der Gasversorgung. “Bei umfassenden Lieferstörungen drohen Produktionsstopps mit unübersehbaren Folgen für Wachstum, Lieferketten und Beschäftigung”, sagte BDI-Präsident Siegfried Russwurm.
Ein besonders dramatisches Bild zeichnet die Chemieindustrie. “Wenn unserer Industrie das Gas ausginge, müssten wir Produktionsanlagen herunterfahren”, sagte der Chef des Branchenverbandes VCI, Christian Kullmann, der Nachrichtenagentur Reuters. “Wenn Chemieanlagen einmal heruntergefahren sind, dann stehen sie still für Wochen und Monate”, so Kullmann, der auch Chef des Spezialchemiekonzerns Evonik ist. Dann würden wenig später die Bänder in anderen Branchen wie der Autoindustrie oder dem Maschinenbau folgen: “Es gäbe einen gewaltigen Dominoeffekt durch fast alle Industrien”, warnte Kullmann, “das wäre ein industrieller Flächenbrand”. Wenn einige Ökonomen davon ausgingen, dass sich ohne Gas eine tiefe Rezession vermeiden lasse, dann seien dies “akademische Träumereien“. Von Manuel Berkel und Till Hoppe
Kern des am Mittwoch vorgestellten Pakets zur Kreislaufwirtschaft ist die Novelle der Ökodesign-Richtlinie (Europe.Table berichtete). Galten jahrelang nur Vorgaben zur Energieeffizienz für energieverbrauchsrelevante Produkte, sollen künftig fast alle Produktgruppen umfangreiche Nachhaltigkeitskriterien erfüllen – von den Recyclinganteilen der Materialien bis zur Reparierbarkeit. “Die europäischen Verbraucher erwarten zu Recht umweltfreundlichere und langlebigere Produkte. Mehr Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz bedeuten auch mehr Widerstandsfähigkeit, wenn eine Krise unsere industriellen Lieferketten unterbricht”, sagte Binnenmarktkommissar Thierry Breton.
Bis 2030 kann der neue rechtliche Rahmen laut Kommission dabei helfen, den Energiegehalt von 150 Milliarden Kubikmetern Erdgas einzusparen, was fast den Importen der EU aus Russland entspreche.
Trotz Ausweitung der Ökodesign-Richtlinie sind noch gar nicht alle energieverbrauchsrelevanten Produkte von spezifischen Regeln erfasst. Die Kommission stellte deshalb am Mittwoch auch einen Arbeitsplan für Ökodesign und Energielabel bis 2024 vor. Neue Regeln für Smartphones und Tablets sollen demnach bis Ende 2022 angenommen werden. Neben der Energieeffizienz wird es dabei auch um Aspekte der Materialeffizienz gehen: Haltbarkeit, Reparierbarkeit und Recycling.
“Das Recht auf Reparatur wird mit diesem Vorschlag endlich zur Realität, wenn zum Beispiel das Austauschen des Akkus endlich Wirklichkeit wird”, sagte der Grünen-Abgeordnete Michael Bloss. “Gleichzeitig müssen sich Hersteller endlich erklären, wieso sie intakte Ware einfach verbrennen, wenn diese zurückgesendet werden. Diese heimliche Verschwendung von Ressourcen ist untragbar und muss verboten werden. Doch der Kommissionsvorschlag verpasst diese klare Grenzziehung.”
Für Produkte der Informations- und Kommunikationstechnologie arbeitet die Kommission an einer Studie, die den gesamten Energieverbrauch betrachten soll – einschließlich der Datenübertragung, Konnektivität und dem Nutzerverhalten. Im Blick hat die Behörde auch Firm- und Software. Für Smart-Grid-fähige Elektrogeräte (Energy Smart Appliances) soll es dagegen eine freiwillige Regelung der Industrie geben, um die Interoperabilität der Geräte zu gewährleisten.
Im vierten Quartal will die Kommission außerdem die angekündigten Vorgaben für Photovoltaik-Module implementieren. Geprüft wird noch, ob es auch Grenzwerte für den CO2-Fußabdruck geben soll. Zu den aussichtsreichsten Kandidaten für neue Energievorgaben gelten außerdem Heizkörper – mit der nötigen Umstellung auf Wärmepumpen ist auch ein großflächiger Austausch der Wärmeüberträger zu erwarten.
Bis 2025 sollen zudem bestehende Regulierungen für 46 Produktgruppen wie Server überarbeitet werden. Allein 50 Terrawattstunden (TWh) Strom pro Jahr sollen neue Vorschriften für Raumheizgeräte sparen, bei Wasserpumpen sind es 40 TWh.
Neben der Information über Energielabel will die Kommission weitere Verbraucherrechte stärken und gegen Greenwashing und geplante Obsoleszenz vorgehen – also das gezielte Unbrauchbarmachen von Produkten nach einer bestimmten Zeit, obwohl keine gravierende Abnutzung vorliegt. Zu den unlauteren Geschäftspraktiken sollen künftig zählen:
Händler sollen ihre Kunden künftig außerdem über Herstellergarantien zur Haltbarkeit von Produkten informieren, die über zwei Jahre hinausgehen. Informationspflichten soll es zudem zur Reparierbarkeit von Produkten geben, zum Beispiel in Form einer eigenen Kennzahl.
Mit einer Novelle der Bauproduktenverordnung sollen Baumaterialien künftig leichter recycelbar sein. Eingeführt wird ebenfalls ein digitaler Produktpass und eine Datenbank für Bauprodukte. Gebäude sind laut Kommission für die Hälfte des Ressourcenverbrauchs in der EU verantwortlich sowie für 30 Prozent des Abfallaufkommens.
“Seit fast 10 Jahren hat sich das System der technischen Regulierung und Normung von Bauprodukten als Katalysator für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation bewiesen. Leider kommt dieses System seit einigen Jahren ins Stocken. Ich begrüße es daher, dass die Kommission heute mit der veröffentlichten Überarbeitung der Bauproduktenverordnung den seit einigen Jahren herrschenden Rückstau bei den harmonisierten Normen im Bauproduktebereich auflösen und bestehende Rechtslücken schließen will”, sagte der CSU-Abgeordnete Christian Doleschal.
“Kritisch sehe ich jedoch, dass die Kommission in ein und derselben Verordnung, die die sichere Verwendung von Bauprodukten reguliert nun auch sämtliche Nachhaltigkeitsanforderungen an Bauprodukte regelt. Das schafft nicht nur mehr Bürokratie und Überregulierung, sondern bremst auch Innovationen”, so der Abgeordnete.
Regeln will die Kommission außerdem das Ökodesign von Textilien. Dabei solle auch das Problem von Mikroplastik angegangen werden. “In drei Jahren müssen alle Mitgliedsstaaten, laut europäischem Recht, Textilien getrennt vom Hausmüll sammeln”, erläuterte die SPD-Abgeordnete Delara Burkhardt. “Die Textilstrategie kann nur erfolgreich sein und einen Mehrwert bieten, wenn die soziale Dimension mitgedacht wird. Sie muss Umweltstandards in der Textillieferkette setzen, die gleichzeitig auch Arbeitnehmer:innenrechte verpflichtend macht.”
04.04.2022 – 18:00-19:30 Uhr, online
DGAP, Roundtable France is Back
German Council on Foreign Relations (DGAP) takes stock of France’s European, foreign, and security policy under President Emmanuel Macron and clarifies their impact on the political campaign. INFO & REGISTRATION
04.04.2022 – 16:00-18:00 Uhr, online
BDI, Diskussion Umsetzung der europäischen Verbandsklagerichtlinie in deutsches Recht
Auf der Veranstaltung des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) werden Vorschläge zur Umsetzung der europäischen Verbandsklagerichtlinie in deutsches Recht im Rahmen eines Webtalks mit Rechtspolitikern und Rechtspolitikerinnen der Bundestagsfraktionen diskutiert. INFOS & ANMELDUNG
04.04.2022 – 10:00-15:00 Uhr, online
BDE, Seminar Neues ElektroG – Was ändert die Novelle 2021?
Im Jahr 2022 kommen bedeutende Änderungen für Erfassung, die Behandlung und die Wiederverwendung von Elektrogeräten auf die Entsorgungsbranche zu. Das Seminar des Bundesverbandes der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft (BDE) soll den betroffenen Betrieben die Möglichkeit geben, sich über die Neuerungen zu informieren. INFOS & ANMELDUNG
04.04.2022 – 18:00-19:30 Uhr, online
BMUV, Diskussion Rebound-Effekte als Herausforderung für eine Nachhaltige Digitalisierung
Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) möchte anhand von Fallbeispielen aufzeigen, wie Rebound-Effekte entstehen und die ökologische Bilanz verändern und wie diese begrenzt werden können. INFOS & ANMELDUNG
Eines ist DMA, DSA und KI-Verordnung gemeinsam: Ohne Durchsetzung ist ihre Wirksamkeit fraglich. Doch wie das ganz konkret geschehen soll, ist eine der heiklen Fragen. Und diese wird in jedem der Gesetzesakte unterschiedlich beantwortet. Insbesondere unter dem Eindruck von Defiziten der dezentral organisierten Durchsetzung der Datenschutzgrundverordnung durch nationale Behörden haben Parlament, Rat und Kommission die Suche nach alternativen Modellen vorangetrieben. Eine der Lehren aus der DSGVO: Wenn die Nationalstaaten ein starkes eigenes Interesse an einer schwachen Aufsichtsbehörde haben, ist die europäische Einheitlichkeit der Durchsetzung kaum zu garantieren. Das wäre für die Wirksamkeit von DSA, DMA und AI Act jedoch ein massives Problem.
Deshalb kam es in der Diskussion um den Digital Services Act zu einem ungewöhnlichen Ereignis: Das sonst so oft auf nationale Hoheit achtende Frankreich schlug vor, dass die Kommission bei geringeren Hürden als ursprünglich geplant die Aufsicht über Onlineplattformen ausüben solle. Das Ziel: Nationale Aufsichtsbehörden – im DSA Digital Services Coordinator genannt – sollen den europäischen Rechtsrahmen bei wichtigen Unternehmen auf keinen Fall kreativ auslegen können, um dem Land mit Sitz des Unternehmens oder seiner europäischen Hauptvertretung Standortvorteile zu verschaffen. Bei der DSGVO hatte sich gezeigt, dass solch ein Gebaren nur auf langen und umständlichen Wegen wieder eingefangen werden kann, wenn überhaupt.
Doch vor allem die personellen Kapazitäten für eine Aufsicht unmittelbar durch die Kommission sind begrenzt, weshalb Vizekommissionspräsidentin Margrethe Vestager das Thema überraschend am Rande des dritten DSA-Trilogs aufwarf: Wäre es nicht gut, die Beaufsichtigten für ihre Aufsicht selbst zahlen zu lassen? Immerhin gibt es hierfür bereits Präzedenzfälle – etwa im Umweltrecht, wo das sogenannte “Polluter Pays Principle” breite Anwendung findet. Und auch in der Bankenaufsicht werden die Beaufsichtigten an den Kosten hierfür beteiligt.
Ein Vorschlag der Grünen-Fraktion im EP zum DSA, das Amendment 2075, hatte die Einführung einer eigenständigen europäischen Aufsichtsbehörde vorausgesetzt, die per Polluter Pays Principle hätte refinanziert werden sollen. Eine “jährliche Aufsichtsgebühr für sehr große Onlineplattformen” hätte hier ergänzend zum von der EU bereitgestellten Budget wirksam werden sollen. Doch hierfür fand sich im Europaparlament keine Mehrheit. Dabei gibt es in der Digitalgesetzgebung der EU bereits ein Vorbild.
Das Modell der eIDAS-Verordnung wäre radikal: Dort gibt es mit dem Artikel 20 eine Regelung, bei der sogenannte qualifizierte Vertrauensdienstleister durch spezielle Konformitätsbewertungsstellen spätestens alle zwei Jahre auf Kosten der Anbieter geprüft werden müssen. Die Aufsichtsbehörden können zudem jederzeit eine Sonderprüfung veranlassen. Auch hier gilt, dass die Prüfungskosten durch die Dienstleister zu tragen sind. Die Vorgaben der eIDAS-Verordnung ließen sich leicht in den DSA übertragen.
Aber wäre das auch wünschenswert? “Wenn Aufsichtsbehörden von Strafzahlungen oder ihrem Handeln gegenüber Unternehmen profitieren, schafft das immer Probleme”, sagt Ben Wagner von der Technischen Universität Delft. Der Spezialist für Digital-Governance-Mechanismen sieht eine eigenständige europäische Durchsetzungsbehörde für die bessere Lösung an als eine Durchsetzung direkt durch die Kommission. Das Polluter Pays-Prinzip sieht er kritisch: “Besser wäre eine saubere, ordentliche Finanzierung der Behörde, die entsprechend dem tatsächlichen Aufwand gestaffelt ist.”
Überhaupt nichts von Ideen wie Polluter Pays hält der Bitkom. “Üblicherweise trägt bei Wettbewerbsbehörden der Staat bzw. die Staatengemeinschaft die Kosten der Rechtsdurchsetzung und ist bei Regelverstößen Empfänger der Bußgeldzahlungen”, sagt die Leiterin Vertrauen und Sicherheit, Rebekka Weiß. “Wir sehen keinen Grund, warum im Falle einer DSA-Aufsicht anders verfahren werden sollte.”
Aus Kommissionskreisen hieß es, dass über ein gemischtes Modell nachgedacht wird: Aus Kommissionsmitteln wäre ein Grundstock an Personal zu leisten. Die Abgaben der betreffenden Unternehmen sollten dazu, fallbezogen oder zeitlich befristet, der Heranziehung abgeordneter nationaler Experten sowie externer Unterstützung eingesetzt werden.
Er halte eine Aufsichtsgebühr grundsätzlich für eine interessante Idee, wenn damit auch ein dringend notwendiger Ausbau der Aufsichtskapazitäten auf nationaler und EU-Ebene vorangetrieben würde, sagt Julian Jaursch, Plattformregulierungsexperte bei der Stiftung Neue Verantwortung. “Auch die Finanzierung externer Fachleute, die in Beratungen und Aufsichtsentscheidungen eingebunden werden sollten, könnte dadurch sichergestellt werden.”
Allerdings könnte auch der Einsatz externer Kräfte neue Probleme mit sich bringen, wenn etwa Anwaltskanzleien zeitversetzt oder gar nur durch Chinese Walls getrennt für Regulierer und Regulierte tätig würden – und der Markt für spezialisierte Rechts- und Technikkundige ist offenkundig leergefegt. Ben Wagner von der TU Delft hegt Zweifel daran, dass die Trilog-Parteien die Aufgabengröße richtig einschätzen: “Der Kommission fehlen sowohl die Ressourcen als auch die Unabhängigkeit. Allen Akteuren ist meines Erachtens nicht bewusst, was für ein Riesenaufwand das ist.”
Julian Jaursch sieht hier ebenfalls ein Problem, und fordert aufgrund der Polluter Pays-Idee eine grundsätzlichere Diskussion unter den Verhandlern: “Wenn jetzt auf einmal gegen Ende der DSA-Verhandlung eine Aufsichtsgebühr zur Debatte steht, sollte auch die bisher geplante Aufsichtsstruktur überdacht werden und stattdessen eine spezialisierte, eigenständige EU-Plattformaufsicht in Erwägung gezogen werden.” Wenn die Aufsicht finanziell von den Unternehmen abhänge, müsse die Unabhängigkeit noch stärker garantiert werden.
Spätestens dann, wenn nicht nur die Kommission für ihre Zuständigkeiten, sondern auch die Mitgliedstaaten ihre DSA-Aufsicht über Supervisory Fees teilweise refinanzieren würde, könnte sonst ein von der DSGVO bereits bekannter Effekt eintreten: Eine Art Nichtregulierungswettbewerb der mitgliedstaatlichen Aufsichtsbehörden. Denn Unternehmen könnten jederzeit ihren Sitz in Europa verlegen, wenn ihnen die Aufsicht nicht passt. Eine Möglichkeit, das Problem zu umgehen, schlägt Julian Jaursch von der Stiftung Neue Verantwortung vor: “Wenn die EU wirklich innovativ sein wollte, würde sie große Plattformen nicht nur an den Kosten für eine EU-Aufsicht beteiligen, sondern mit einer möglichen Gebühr einen unabhängigen Fonds aufsetzen.”
Während der DMA bereits ausverhandelt ist, die Kommission soll mit etwa 80 Stellen den größten Akteuren entgegentreten, könnte das Thema beim vierten DSA-Trilog heute noch einmal eine größere Rolle spielen. Allerdings sei das Plädoyer für eine entsprechende Regelung vonseiten der Kommission reichlich spät gekommen, heißt es aus Parlamentskreisen. Allerdings sind es vor allem die Mitgliedstaaten und die Kommission, die den DSA möglichst schnell verabschieden wollen. Bei der KI-Verordnung hingegen bleibt trotz aller Eile noch ausreichend viel Zeit, um über Ausgestaltung und Lastverteilung zu debattieren.
Die Europaabgeordneten der Grünen im ECON- und ENVI-Ausschuss sowie die der S&D-Fraktion im ECON-Ausschuss haben offiziell Einspruch gegen den komplementären Delegierten Rechtsakt zur EU-Taxonomie eingelegt. Die Frist zur Eröffnung des Einspruchsverfahrens endete gestern um 17 Uhr.
Die Klassifizierung von Atomenergie und Erdgas als nachhaltig hätte automatisch in Kraft treten können, sofern im Parlament oder im Rat keine Einwände erhoben worden wären. Mit dem Einspruch der beiden Fraktionen ist das Verfahren, mit dem das Parlament zu einem späteren Zeitpunkt über den Delegierten Rechtsakt abstimmen kann, formal eingeleitet.
Nun haben die Parlamentarier:innen bis zum 30. Mai Zeit, eine Einspruchsentschließung einzureichen, der sich auch Abgeordnete anderer Fraktionen anschließen können. Die Grünen haben angekündigt, einen Entschließungsantrag auszuarbeiten, der von einem breiten fraktionsübergreifenden Bündnis mitgetragen wird.
Man werde diesen Schritt mit stichhaltigen Argumenten unterlegen, kündigte Rasmus Andresen, Grünen-Abgeordneter im ECON-Ausschuss, an. “Damit wollen wir konservative und liberale Parlamentarier:innen überzeugen, auch gegen die Taxonomie zu stimmen. Im Parlament wird die Kritik an von der Leyens Vorschlag spürbar lauter”, erklärte Andresen.
Die Koordinatoren der S&D-Fraktion werden Ende kommender Woche über eine gemeinsame Resolution entscheiden, in der der Einspruch begründet wird. Die Abstimmung über die Einspruchsentschließung im gemeinsamen ENVI/ECON-Ausschuss soll im Juni stattfinden, bevor im Juli das Plenum votiert. Für eine absolute Mehrheit, die zur Annahme des Einspruchs nötig ist, braucht es 353 Stimmen. Sollte diese nicht erreicht werden und auch aus dem Rat keine Einwände kommen, wird der Delegierte Rechtsakt rechtskräftig. luk
Russland hat am Mittwoch angedeutet, dass alle russischen Energie- und Rohstoffexporte in Rubel abgerechnet werden könnten. Damit verschärft Präsident Wladimir Putin seinen Versuch, den Westen den Schmerz der Sanktionen spüren zu lassen, die er wegen der Invasion in der Ukraine verhängt hat.
“Wenn Sie Gas wollen, finden Sie Rubel”, sagte Wolodin in einem Beitrag auf Telegram. “Außerdem wäre es richtig – wenn es für unser Land von Vorteil ist – die Liste der in Rubel bepreisten Exportprodukte zu erweitern: Dünger, Getreide, Speiseöl, Öl, Kohle, Metalle, Holz usw.”
Da sich die russische Wirtschaft in der schwersten Krise seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 befindet, schlug Putin am 23. März auf den Westen zurück und ordnete an, dass die russischen Gasexporte in Rubel bezahlt werden sollten.
Als bisher stärkstes Signal, dass Russland eine noch härtere Reaktion auf die Sanktionen des Westens vorbereiten könnte, deutete der oberste russische Gesetzgeber am Mittwoch an, dass fast alle russischen Energie- und Rohstoffexporte bald in Rubel abgerechnet werden könnten. Auf die Äußerungen von Parlamentspräsident Wjatscheslaw Wolodin angesprochen, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow: “Das ist eine Idee, an der auf jeden Fall gearbeitet werden sollte. Es kann gut sein, dass sie ausgearbeitet wird”, sagte Peskow über den Vorschlag. rtr
Die Wettbewerbsbehörden der Europäischen Union haben einem Insider zufolge eine Razzia beim russischen Erdgas-Konzern Gazprom vorgenommen. Damit will die Wettbewerbsbehörde ihre Ermittlungen zu den Gaslieferungen des Unternehmens nach Europa ausweiten. Die mit dem Vorgang vertraute Person lehnte es ab, weitere Einzelheiten zu nennen.
EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager hatte im Januar mehrere Gasunternehmen, darunter auch Gazprom, wegen Lieferengpässen befragt und Gazprom vorgeworfen, zusätzliche Produktion zurückzuhalten, die zur Senkung der steigenden Preise freigegeben werden könnten. Vestager werde wahrscheinlich das Sammeln von Informationen über die europäischen Geschäfte von Gazprom intensivieren, sagte eine Person, die mit den Überlegungen der Regulierungsbehörde vertraut ist, letzten Monat gegenüber Reuters.
Die Europäische Kommission lehnte eine Stellungnahme ab, auch Gazprom Export wollte sich nicht äußern. Bloomberg berichtete als erste über die Razzien in den Büros von Gazprom in Deutschland. Gazprom und der Kreml haben wiederholt bestritten, Gaslieferungen zurückzuhalten, und erklärt, dass alle festen und langfristigen Verpflichtungen erfüllt worden seien. rtr
Europäische Unternehmen sollen künftig einen besseren Zugang zu öffentlichen Aufträgen und Beschaffungsverfahren im Nicht-EU-Ausland erhalten. Ermöglichen soll dies das Internationale Beschaffungsinstrument (International Procurement Instrument, IPI).
Am Mittwoch haben die EU-Mitgliedstaaten im Ausschuss der Ständigen Vertreter die zwischen Europäischem Parlament und Rat der EU erzielte Einigung über den entsprechenden Verordnungsvorschlag gebilligt. Das gab das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz am Mittwoch in einer Mitteilung bekannt. Damit nimmt das Instrument nach rund zehn Jahre dauernden Verhandlungen seit der Veröffentlichung des ersten Kommissionsvorschlags eine entscheidende Hürde.
Sven Giegold, Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz sagte, die EU wolle “transparente und diskriminierungsfreie Vergabeverfahren”. Ziel des IPI ist es, Vergabemärkte in Staaten außerhalb der EU für europäische Unternehmen zu öffnen und den fairen Zugang zu Beschaffungsverfahren im Nicht-EU-Ausland zu ermöglichen.
Angebote von Unternehmen aus Staaten außerhalb der EU, die ihren Beschaffungsmarkt nur unzureichend für europäische Bieter zugänglich machen, können künftig bei Vergabeverfahren in der gesamten EU im Rahmen der Angebotswertung bewusst benachteiligt oder sogar ausgeschlossen werden.
Dadurch soll die Bereitschaft von Drittstaaten gesteigert werden, ihre Beschaffungsmärkte – etwa durch den Beitritt zu dem WTO-Beschaffungsübereinkommen GPA (Government Procurement Agreement) oder den Abschluss bilateraler Marktzugangsvereinbarungen – für Unternehmen aus der EU zu öffnen. Der Vorschlag bedarf vor dem Inkrafttreten noch der formalen Zustimmung des Europäischen Parlaments und des Rats.
Die Lufthansa und andere Airlines eines Luftfracht-Kartells sind endgültig mit ihren Klagen gegen eine Bußgeld-Entscheidung der EU-Kommission gescheitert. Geldbußen gegen Air France, KLM und andere würden aufrecht erhalten und die Klagen zurückgewiesen, teilte das EU-Gericht am Mittwoch mit.
Der Lufthansa und zwei ihrer Tochtergesellschaften war die Strafe bei der ersten Entscheidung der EU-Kommission 2010 erlassen worden, weil sie als Kronzeugen das Kartell offenbart hatten. Dennoch hatte sich die Lufthansa vor Gericht zusammen mit den anderen Airlines gegen die Entscheidung der Wettbewerbsbehörde gewehrt. Air France und KLM müssen zusammen mit gut 300 Millionen Euro die höchsten Bußgelder zahlen. Ursprünglich verhängte die EU-Kommission 790 Millionen Euro Bußgelder gegen alle Beteiligten.
Ein Dutzend Frachtfluggesellschaften hatte zwischen 1999 und 2006 Preise abgesprochen. Beteiligt waren auch noch British Airways, SAS, Japan Airlines und Cathay Pacific Airways. Den ersten Bußgeldentscheid der EU von 2010 fochten die Unternehmen erfolgreich an.
Das EU-Gericht hob ihn 2015 wegen “inhärenter Widersprüche” auf. Die Wettbewerbsbehörde verhängte die Geldstrafe mit nachgebesserter Begründung 2017 abermals, dagegen klagten alle Unternehmen erneut. Bei einigen Airlines reduzierte das Gericht jetzt die Bußgelder, zum Teil wegen Verstoßes der EU-Behörde gegen Verjährungsfristen. rtr

Die Vereinigten Staaten kündigten vor kurzem einen sofortigen Einfuhrstopp für russisches Öl und Gas an, das Vereinigte Königreich und die Europäische Union versprachen, die Importe schrittweise zu drosseln. Der Grundgedanke ist klar: Bestrafung Russlands, Verringerung seines Einflusses und Wiederherstellung des Friedens in der Ukraine. Doch falsche Entscheidungen – insbesondere die weitere Bevorzugung fossiler Brennstoffe gegenüber erneuerbaren Energien – könnten jetzt für eine weitaus weniger friedliche Zukunft sorgen.
Da einige westliche Länder sich in den letzten Jahren zu sehr von russischem Öl und Gas abhängig gemacht haben, fiel die Entscheidung, die Förderung zu reduzieren, nicht leicht. Die größere und schwierigere Entscheidung, vor der die westlichen Regierungen stehen, ist jedoch die Frage, wie sie ihre Gesamtabhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern können. Eine schmutzige Energiequelle einfach durch eine andere zu ersetzen, würde bedeuten, dass man sich mit den wachsenden Gefahren des Klimawandels erst später befassen kann – wenn überhaupt.
Angesichts des Drucks der aktuellen Ukraine-Krise wäre eine solche Kurzsichtigkeit verständlich. Die westlichen Regierungen müssen die Energielücke schließen, die durch den Stopp der russischen Importe fossiler Brennstoffe entsteht, und gleichzeitig den Schaden für die Volkswirtschaften so gering wie möglich halten. Im Moment haben sie die Öffentlichkeit auf ihrer Seite. Aber wenn die Energiekosten zu stark ansteigen oder es zu Engpässen kommt, könnte der daraus resultierende wirtschaftliche Schaden die öffentliche Unterstützung schwinden lassen.
Alternative Energiequellen müssen daher schnell in Betrieb genommen werden und eine erschwingliche, zuverlässige Versorgung gewährleisten. Und sie sollten keine neuen geopolitischen Verwicklungen schaffen, die später Probleme verursachen könnten.
Auf der kürzlich abgehaltenen jährlichen CERAWeek Energiekonferenz in Houston, Texas, schlugen die Vorstandsvorsitzenden der großen Ölkonzerne und deren Lobbyisten vor, die Öl- und Gasproduktion anzukurbeln, die Produktionsbeschränkungen aufzuheben, die Vorschriften zu lockern und die Maßnahmen zur Senkung der Kohlendioxidemissionen rückgängig zu machen. Mehrere Energieanalysten und Wirtschaftswissenschaftler haben sich dieser Linie angeschlossen.
Doch angesichts des Klimawandels, der sich schnell zu einem der Hauptgründe für die weltweite Unsicherheit entwickelt, wäre es ein tragischer Fehler, weiter auf fossile Brennstoffe zu setzen – eine Entscheidung, die die Welt in den kommenden Jahrzehnten zu einem gewalttätigeren Ort machen könnte.
Der Bericht über die Produktionslücke 2021 verdeutlicht die Diskrepanz zwischen den derzeitigen Plänen für die Produktion fossiler Brennstoffe und den Klimazusagen. Bei der derzeitigen Politik ist die globale Erwärmung auf dem besten Weg, in diesem Jahrhundert eine katastrophale Temperatur von 2,7 Grad Celsius zu erreichen. Wir müssen Bohrlöcher und Minen rasch schließen und die Produktion zurückfahren, anstatt weitere Kapazitäten zu schaffen.
Der Klimawandel macht die Welt schon jetzt gefährlicher und weniger stabil. Der jüngste Bericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC), den der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, als “Atlas des menschlichen Leids” bezeichnete, enthält eine drastische Bewertung der enormen wirtschaftlichen und menschlichen Kosten, die selbst die ersten Auswirkungen des Klimawandels, die wir jetzt erleben, verursachen. Er zeichnet ein Bild einer Zukunft, die wir vermeiden müssen.
Ein Blick auf die Schlagzeilen der letzten 12 Monate zeigt, dass Überschwemmungen, Stürme, Waldbrände, Hitzewellen und Dürreperioden Rekordwerte erreicht haben. All diese Wetterereignisse werden infolge des Klimawandels häufiger, extremer und tödlicher, und sie alle können die Wahrscheinlichkeit von Konflikten und Instabilität erhöhen. Heute sind 80 Prozent der UN-Friedenstruppen in Ländern stationiert, die als besonders gefährdet für den Klimawandel gelten. Ebenso ergab eine aktuelle Studie, dass ein Temperaturanstieg von 1 Grad Celsius mit einem 54-prozentigen Anstieg der Konflikthäufigkeit in Teilen Afrikas verbunden ist, wo nomadische Hirten und sesshafte Bauern um die schwindenden Wasservorräte und fruchtbares Land konkurrieren.
Wie der IPCC-Bericht zu Recht feststellt, destabilisieren die Folgen des Klimawandels am schnellsten Orte, an denen die Spannungen bereits hoch und die Regierungsstrukturen bereits geschwächt oder korrupt sind. Wie Untersuchungen für den kommenden “Environment of Peace”-Berichts des Stockholmer Friedensforschungsinstituts (SIPRI) zeigen, gedeihen bewaffnete extremistische Gruppen wie al-Shabaab, der Islamische Staat und Boko Haram in Regionen, die unter den schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels leiden. Sie finden Rekruten und Anhänger unter den Menschen, deren Leben und Lebensgrundlagen durch Überschwemmungen und Dürren immer prekärer geworden sind.
In unserer globalisierten, vernetzten Welt können sich die Folgen lokaler Klimaauswirkungen durch Schocks in den Versorgungsketten, übergreifende Konflikte und Massenmigrationen schnell ausbreiten. Und wie Russlands Einmarsch in die Ukraine gezeigt hat, ist die auf Regeln basierende Ordnung alarmierend zerbrechlich, sodass die einfachen Menschen mit den schrecklichen Folgen konfrontiert werden.
Die Ablehnung des Westens gegenüber russischem Öl und Gas bietet die Chance, den Übergang weg von fossilen Brennstoffen zu beschleunigen. Energieeffizienz und andere Bedarfsreduzierungen können einen Teil dieser Aufgabe übernehmen. Im Übrigen sind erneuerbare Alternativen wie Solar- und Windenergie wirtschaftlich sinnvoll. Sie sind viel schneller und sicherer zu installieren als Kernkraftwerke oder die meisten der diskutierten Alternativen für fossile Brennstoffe. Und sie setzen die Menschen nicht den Schwankungen der globalen Brennstoffmärkte aus.
Die Logik zeigt nur in eine Richtung. Nur wenn wir uns von den fossilen Brennstoffen verabschieden, wird die Welt echte Energiesicherheit erreichen – und eine Chance haben, eine friedlichere, lebenswertere und erschwinglichere Zukunft aufzubauen.
Die Autoren sind Mitglieder des Expertengremiums, das die Initiative Environment of Peace des SIPRI berät.
In Kooperation mit Project Syndicate, 2022. Aus dem Englischen von Andreas Hubig.