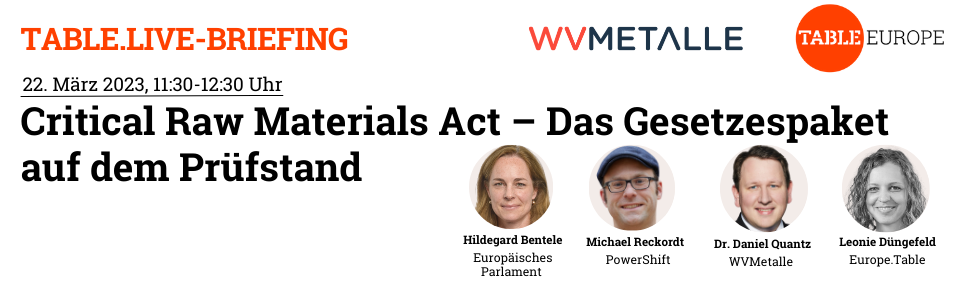Wie die FDP Flurschaden auf EU-Ebene anrichtet
Verbrenner-Streit: Trotz Kommissionsvorschlag noch keine Einigung
Neuer Fahrplan für den AI Act im Parlament
Frankreichs Parlament stimmt für Atomplan
Rat will auch regulierte Gaspreise für KMU
Rechtsausschuss fordert höhere Strafen bei Umweltkriminalität
Green Claims-Richtlinie: Umweltfußabdruck nicht geeignet
Aufsicht: Kapitalausstattung der Banken solide
Botschafter warnt Niederlande vor ASML-Beschränkungen
EuGH-Urteil: Schadenersatz-Klagen von Dieselkäufern künftig leichter
Vanessa Cann – bei KI nicht abhängen lassen
Bundesfinanzminister Christian Lindner und seine FDP sorgen derzeit nicht nur in Berlin für Wirbel – auch in Brüssel brodelt es. Meine Kollegen Stefan Braun und Till Hoppe haben aufgeschrieben, was es mit den beiden Lagern innerhalb der Partei auf sich hat.
Die Uhr tickt: Bis zum EU-Gipfel am Donnerstag soll der Streit um das Verbrenner-Aus und die Rolle von E-Fuels gelöst werden. Lukas Scheid hat aufgeschrieben, was der neue Vorschlag der Kommission beinhaltet.
Und noch eine Ankündigung: Im Table.Live-Briefing diskutiert Europe.Table-Redakteurin Leonie Düngefeld heute um 11:30 Uhr mit Hildegard Bentele (CDU), Daniel Quantz (WVMetalle) und Michael Reckordt (Powershift) über den Critical Raw Materials Act. Hier können Sie sich dafür noch anmelden.

Erst kurz vor Beginn des Treffens der Euro-Gruppe am vergangenen Montag informierte Christian Lindner seine Kollegen aus den anderen EU-Staaten: Deutschland werde die gemeinsame Erklärung zur Reform der Fiskalregeln so nicht mittragen, ließ der Bundesfinanzminister übermitteln. Die meisten anderen Minister wurden überrumpelt, schließlich hatte die Bundesregierung auf Ebene der Staatssekretäre und der EU-Botschafter dem Text noch zugestimmt.
Lindners Manöver schlug in Brüssel einige Wellen. Und genau darauf schien der FDP-Chef es auch angelegt zu haben. Es ist die Rolle, in der sich die Liberalen derzeit augenscheinlich gefallen, ob auf der heimischen Bühne in Berlin oder in Brüssel: als diejenigen, die für ihre Überzeugungen kämpfen, und dafür Koalitions- und EU-Partnern notfalls die Stirn bieten. Verkehrsminister Volker Wissing sorgt so mit seinem späten Nein zum Verbrenner-Aus 2035 seit drei Wochen für Schlagzeilen (siehe Text in dieser Ausgabe).
Dahinter steht eine harte Abwägung. Nach den letzten Wahldebakeln in Niedersachsen und fortwährend schlechten Umfragewerten, die seit Monaten rund um die Fünf-Prozent-Hürde herum schwanken, hat die Parteispitze eine Entscheidung getroffen: Die FDP muss erkennbar werden, sie muss spürbar sein, im Zweifel muss sie weh tun. Und das funktioniert nun mal am ehesten mit Provokationen, die auch als solche wahrgenommen werden.
In der Abwägung damit spielen die Gepflogenheiten des Brüsseler Betriebes, die für das Funktionieren der EU-Kompromissmaschinerie wichtig sind, offenkundig eine untergeordnete Rolle. “Es geht um Selbstbehauptung”, sagt ein langjähriger FDP-Abgeordneter, der vor der großen Niederlage 2013 schon dabei gewesen ist. Da sei in der Prioritätenliste der Überlebenswille größer als die Sensibilität für Brüssel.
Die Kritik etwa vonseiten der Grünen oder aus Paris dient in dieser Strategie eher der eigenen Profilierung als dass sie schadet. “Im Moment nimmt die deutsche Politik und auch die Interessenvertretung Deutschlands Schaden”, warnte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gestern. “Wir verlieren Debatten, wir kriegen zu wenig Unterstützung für unsere Projekte.”
Der europapolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Michael Link, hält dagegen: “Natürlich gibt es Kritik von jener Seite, die eine andere Meinung zum Verbrenner haben”, sagt er. “Aber ich kann nicht erkennen, dass Deutschland daraus ein Ansehensschaden entstanden wäre, im Gegenteil, unsere Position erfährt Unterstützung von verschiedenen Seiten.” Deutschland trage als größter Mitgliedstaat immer eine besondere Verantwortung, sich für die Konsensbildung in der EU einzusetzen. Das gelte aber ebenso für die Kommission – und die habe keinerlei Bereitschaft erkennen lassen, wie vereinbart einen Vorschlag zu E-Fuels vorzulegen.
Es ist allerdings beileibe nicht das erste Mal, dass die FDP-Minister die Entscheidungsprozesse in Europa-Themen eigenhändig und spät ins Stocken brachten.
Bei anderen Mitgliedstaaten gilt Berlin daher inzwischen schon als wenig verlässlich und schwer berechenbar. “Die Probleme in der Koalition werden so zu einem europäischen Problem”, sagt ein EU-Diplomat. Daher sei es an der Zeit, dass Kanzler Olaf Scholz einschreite. “Europa ist Chefsache, aber der Chef ist nicht da.”
Auch der Generalsekretär der Europäischen Bewegung Deutschland, Bernd Hüttemann, warnt: “Wenn man rückwirkend Vereinbarungen nach eingeübten Verhandlungen wieder infrage stellt, kann das in der Sache verständlich sein, doch hat es fatale Folgen für die Glaubwürdigkeit deutschen Regierungshandelns in der EU”.
Der deutsche EU-Botschafter Michael Clauß mahnte bereits vor Monaten in einem internen Drahtbericht, die Abstimmungsschwierigkeiten innerhalb der Bundesregierung minderten den Einfluss Deutschlands auf EU-Ebene. Dabei hatte sich die Ampelkoalition vorgenommen, die europapolitische Koordinierung innerhalb der Bundesregierung zu verbessern. Abstimmungsrunden auf mehreren Hierarchie-Ebenen sollen sicherstellen, dass strittige Fragen geklärt werden und sich Berlin so frühzeitig positionieren kann.
Doch das Ansinnen scheiterte in den ersten 15 Monaten der Koalition mehrfach. Ob es demnächst besser wird, ist fraglich. Mehrere zentrale Akteure der deutschen Europapolitik verlassen bald ihre Posten: Der zuständige Staatssekretär im Finanzministerium, Carsten Pillath, geht in den Ruhestand, sein Nachfolger Heiko Thoms hat deutlich weniger EU-Erfahrung. Im Auswärtigen Amt geht Staatssekretär Andreas Michaelis als Botschafter nach Washington, seine Nachfolge ist noch nicht entschieden. Und auch EU-Botschafter Clauß steht nach fünf Jahren in Brüssel im Sommer vor dem Absprung.
Doch ein politischer Streit wie um den Verbrennermotor lasse sich ohnehin nicht durch eine gute Koordinierung auf Beamtenebene lösen, argumentiert FDP-Politiker Link – er sei Ausdruck eines “tiefgreifenden Dissens zwischen Grünen und Liberalen beim Thema Technologieoffenheit”.
In den Reihen der Liberalen gibt es aber nach wie vor zwei Gruppen, die sich bei ihrem Blick auf die Politik nahezu diametral gegenüberstehen. Die einen halten das Funktionieren einer Koalition für einen Wert an sich. Bei schlechten Umfragen freilich werden ihre Karten schlechter gegenüber jenen, die nach Profilierung und eigenen Schlagzeilen trachten. Diese zweite Gruppe ist es, die derzeit stärker den Ton angibt – und sich bestätigt fühlen dürfte, da die FDP in aller Munde ist, in Brüssel wie in Berlin. Stefan Braun und Till Hoppe
Eine Perspektive für “E-Fuels only”-Fahrzeuge hatte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) Mitte vergangene Woche gefordert, um das vollständige Verbrenner-Aus im Jahr 2035 noch abzuwenden. Die Kommission hat bereits kurze Zeit später einen entsprechenden Entwurf für eine ergänzende Gesetzgebung vorgelegt. In dem Entwurf, der Table.Media vorliegt, wird – wie von Wissing gefordert – die bestehende Gesetzgebung zur Abgasnorm für Pkw (Euro 5 und Euro 6) aufgegriffen.
Die Kommission schlägt demnach vor, eine neue Fahrzeugkategorie zu schaffen für Fahrzeuge, die ausschließlich mit kohlenstoffneutralen Kraftstoffen (E-Fuels) betrieben werden. Diese sollen so konstruiert sein, “dass sie nicht mit anderen Arten von Kraftstoffen betrieben werden können”. Das Auto soll zudem durch ein Kraftstoffüberwachungsgerät erkennen, wenn es mit herkömmlichen Kraftstoffen betankt würde. In diesem Fall müsste das System verhindern, dass das Fahrzeug überhaupt startet. Hersteller müssten sicherstellen, dass Überwachungsgeräte und Betankungssysteme vor Manipulation geschützt sind, heißt es weiter.
Für Fahrzeughersteller dürfte das eine massive Hürde sein, solche Fahrzeuge überhaupt zu bauen, da hohe Entwicklungskosten und nur ein kleiner Absatzmarkt zu erwarten wären. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete am Dienstag aus dem Umfeld Wissings, die Bedingung der Kommission, dass Autos CO₂-neutrale Kraftstoffe von fossilen Brennstoffen unterscheiden müssten, sei für Deutschland problematisch, weil Autohersteller neue Motoren entwickeln müssten.
Das heißt, auch wenn der Kommissionsentwurf in die Richtung einer “E-Fuels only”-Lösung geht, dürfte das Verkehrsministerium Nachbesserungsbedarf sehen, um eine realistische Perspektive für E-Fuels zu schaffen. Die FDP hatte dies im Koalitionsvertrag und in einem Erwägungsgrund der überarbeiteten EU-Flottengrenzwerte reinverhandelt. Zwei der Forderungen Wissings wurden von der Kommission nicht berücksichtigt: Eine Anrechnung von “E-Fuels only”-Fahrzeugen auf die Flottengrenzwerte der Hersteller sowie die Aufnahme einer Definition für vollständig CO₂-neutrale Kraftstoffe in die Gesetzgebung der Flottengrenzwerte.
Der Spiegel berichtete am Dienstag sogar, dass Wissing den Kommissionsvorschlag bereits komplett abgelehnt habe. Auf Nachfrage von Table.Media wollte das Verkehrsministerium dies zwar nicht bestätigen, jedoch legt die Tatsache, dass noch immer keine Einigung erzielt wurde, nahe, dass der Vorschlag nicht den Vorstellungen des Ministers entspricht. “Wir sind an einer schnellen Klärung interessiert, die aber belastbar und verbindlich sein muss”, so das Ministerium. Bedeutet: Der aktuelle Vorschlag erfüllt diese Kriterien noch nicht.
Im Bundesumweltministeriums sieht man das offenbar ganz anders. “Soweit wir den Vorschlag der Kommission kennen, wäre dem Erwägungsgrund im Sinne der FDP Rechnung getragen und einer Zustimmung dürfte an sich nichts mehr im Wege stehen“, heißt es aus Kreisen des Ministeriums.
Eine weitere noch offene Frage: Aus dem Kommissionsentwurf geht nicht hervor, welche EU-Rechtsvorschrift Anwendung findet. Sollte die Kommission ihren Vorschlag über einen Durchführungsrechtsakt umsetzen wollen, müsste sie diesen mit den Mitgliedstaaten konsultieren. Bei einem delegierten Rechtsakt wäre das nicht notwendig, allerdings hätten EU-Parlament und Ministerrat die Möglichkeit, Einspruch einzulegen.
Europa-Staatsministerin Anna Lührmann (Grüne) sagte am Dienstag in Brüssel, sie gehe davon aus, dass sich das gesamte Thema vor dem am Donnerstag beginnenden EU-Gipfel lösen werde. Lührmann betonte noch einmal, man habe sich darauf verständigt, dass das Trilog-Ergebnis gelte. Zugleich unterhalte sich die Bundesregierung mit der EU-Kommission darüber, wie der Erwägungsgrund konkret umgesetzt werde. “Ich gehe davon aus, dass diese Gespräche vor dem Gipfel abgeschlossen werden.”
Die Berichterstatter für den AI Act im EU-Parlament haben einen neuen Zeitplan vorgelegt. Demnach sollen die Beratungen im April abgeschlossen werden. Bis dahin sind noch zwei weitere technische und drei politische Treffen angesetzt. Immerhin, so twitterte Kai Zenner aus dem Büro des EVP-Abgeordneten Axel Voss, haben die Verhandler inzwischen den ganzen Text und viele Erwägungsgründe durchgearbeitet.
Im technischen Meeting am Montag stand die Definition von General Purpose AI (Allzweck-KI) und die Verantwortlichkeiten entlang der Wertschöpfungskette auf der Tagesordnung. Am Dienstag ging es unter anderem um Sandboxes (KI-Reallabore) und Enforcement (Durchsetzung).
General Purpose AI (GPAI) ist in der Lage, eine Vielzahl von Aufgaben zu erledigen, während spezialisierte KI-Systeme auf bestimmte Aufgaben programmiert sind. Durch die Veröffentlichung des großen Sprachmodells ChatGPT hat das Thema stark an Aufmerksamkeit gewonnen.
Die Berichterstatter hatten als Definition vorgeschlagen: “‘general purpose AI system’ means an AI system that is trained on broad data at scale, is designed for generality of output, and can be adapted to a wide range of tasks’.” Unter anderem beanstandeten die Grünen jedoch, dass diese Definition GPAI auf die Methode Machine Learning begrenze. Dabei schließe sie andere Methoden wie Reinforcment Learning oder evolutionäre Algorithmen aus.
Während die Grünen sich eine breite Anwendbarkeit der Definition wünschen, bevorzugt die EVP eher eine engere Definition. Geeinigt haben sich die Verhandler offenbar darauf, in der Definition General Purpose AI durch ‘foundation model’ (Basismodell) zu ersetzen.
Für die Verhandler und mehr noch für Beobachter ist es schwer auszumachen, worüber tatsächlich eine finale Einigung besteht. Das liegt auch an der Verhandlungsführung der Berichterstatter Brando Benifei (S&D) und Dragoş Tudorache (Renew), die selbst Abgeordnete für gewöhnungsbedürftig halten, weil bei den Treffen jeweils nur Kommentare eingesammelt, aber keine Entscheidungen getroffen werden.
Die Termine für die kommenden politischen Treffen sind für den 29. März, den 13. April und den 19. April geplant. Der Trilog könnte dann im Mai beginnen. vis
Das französische Parlament hat am Dienstag mit großer Mehrheit für den Atominvestitionsplan der Regierung gestimmt. Der Plan zur nuklearen Erneuerung, dessen Kernstück der geplante Bau von sechs neuen Kernreaktoren ist, wurde mit 402 Ja- und 130 Nein-Stimmen angenommen. Am Montag erst unterstützten 278 Abgeordnete einen von der Opposition eingebrachten Misstrauensantrag gegen die Regierung. Damit fehlten nur neun Stimmen zu den 287 Stimmen, die für einen Sturz der Regierung erforderlich sind.
“Nach dem Senat im letzten Monat hat heute Abend auch das Unterhaus mit großer Mehrheit für den Atomplan gestimmt … das Ergebnis einer gemeinsamen Arbeit, um den Klimawandel zu bekämpfen und unsere Energiesouveränität zu garantieren”, twitterte Premierministerin Elisabeth Borne.
Präsident Emmanuel Macron will in den kommenden Wochen mit neuen Reformen die Initiative zurückgewinnen, nachdem seine Regierung beinahe an der Rentenreform gescheitert wäre. Die Kernenergie ist eines der Themen, bei denen seine Partei mit den konservativen Les Republicains und den rechtsextremen Rassemblement National auf Augenhöhe ist.
“Unser Ziel ist es, Frankreich zu einer großen kohlenstofffreien und souveränen Nation zu machen”, twitterte Energieministerin Agnès Pannier-Runacher und fügte hinzu, dies sei der erste Baustein für das “immense Projekt der Wiederbelebung unserer Atomindustrie.”
Im Wettlauf um den Bau neuer Kernkraftwerke dürften die Verwaltungsverfahren weder die Verlängerung der Laufzeit bestehender Reaktoren noch den Bau neuer Reaktoren bremsen.
Macron will mit dem Bau eines ersten EPR2-Kernreaktors der nächsten Generation noch vor dem Ende seiner zweiten fünfjährigen Amtszeit im Mai 2027 beginnen, als Teil eines 52 Milliarden Euro teuren Plans zum Bau von sechs neuen Reaktoren.
Der Plan kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Frankreich monatelang unter größeren Ausfällen seiner bestehenden Flotte von 56 Reaktoren zu leiden hatte. Dadurch sank die Atomstromproduktion auf ein 30-Jahres-Tief., während der im Bau befindliche EPR der ersten Generation im westfranzösischen Flamanville Jahre hinter dem Zeitplan und Milliarden über dem Budget liegt. rtr
Bei künftigen Energiekrisen wollen die EU-Staaten dauerhaft die Möglichkeit erhalten, niedrige Gaspreise auch für kleine und mittelständische Unternehmen festzulegen. Das geht aus dem neuesten Entwurf der schwedischen Ratspräsidentschaft zur Novelle der Gasmarkt-Richtlinie von Dienstag hervor, der Table.Media vorliegt. Der siebte Änderungsentwurf soll heute von den ständigen Vertretern der Mitgliedstaaten beraten werden.
In einem ungewöhnlichen Schritt wollen die Mitgliedstaaten in der Gasmarkt-Richtlinie festschreiben, den Mechanismus zur Preisregulierung aus der neuen Strommarkt-Richtlinie zu übernehmen. In einer Erläuterung der Präsidentschaft heißt es dazu: “Die Verweise in dem vorgeschlagenen neuen Artikel auf den Kommissionsvorschlag zum Strommarktdesign bedeuten, dass alle Änderungen an diesem Text automatisch auch im Zusammenhang mit diesem neuen Artikel der Gasrichtlinie gelten werden. Das bedeutet, dass der Inhalt dieses neuen Artikels von den legislativen Beratungen über den entsprechenden Vorschlag für das Strommarktdesign abhängen wird.”
Den Entwurf für das neue Strommarktdesign hatte die Kommission erst vergangene Woche vorgelegt. Mit ihm sollen die Mitgliedstaaten in einer Stromkrise regulierte Preise auch für KMU festlegen können. Für Haushaltskunden gibt es eine ähnliche Regelung in der Strommarkt-Richtlinie bereits. Mit der Novelle der Gasmarkt-Richtlinie sollte sie bereits auf den Gaspreis für Haushaltskunden übertragen werden. Nach dem neuesten Entwurf soll nun eine Ausweitung auf den Strompreis für KMU auch für den Gasmarkt nachvollzogen werden.
Am 28. März wollen die EU-Energieminister im Rat die allgemeine Ausrichtung zum Gasmarkt-Paket beschließen, bevor es in den Trilog geht. ber
Der Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments hat sich für eine Ausweitung der strafbaren Umweltverbrechen und für härtere Sanktionen ausgesprochen. In ihrer Sitzung am Dienstag stimmten die Mitglieder des Gremiums einstimmig für den Bericht von Antonius Manders (EVP).
“Die durch Umweltkriminalität verursachten Schäden haben tiefgreifende Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und den Zustand unseres Planeten”, sagte der niederländische Abgeordnete. Die oftmals grenzüberschreitenden Straftaten müssten auf EU-Ebene mit abschreckenden Sanktionen bekämpft werden. Dafür müsse die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsstaaten verstärkt und Justiz sowie Polizei entsprechend geschult werden, so Manders.
Konkret fordert der Ausschuss, dass Straftaten, die zum Tod oder zu schweren gesundheitlichen sowie Umweltschäden führen, mit mindestens zehn Jahren Haft bestraft werden. Unternehmen sollen bei Umweltverbrechen Bußgelder in Höhe von mindestens zehn Prozent ihres durchschnittlichen weltweiten Umsatzes der vergangenen drei Jahre zahlen. Die EU-Kommission sieht hier nur fünf Prozent vor. Außerdem sollen Firmen auch mit dem Ausschluss von öffentlichen Geldern und Lizenzentzug rechnen müssen sowie für die Wiederherstellung der Umwelt und die Entschädigung der Opfer sorgen.
Auch sprachen sich die Abgeordneten für eine Erweiterung der strafbaren Vergehen aus. Die Liste umfasst unter anderem illegalen Holzhandel, illegale Ausbeutung von Wasserressourcen, Umweltverschmutzung durch Schiffsverkehr, Verstöße gegen das EU-Chemikalienrecht, Anbau genetisch veränderter Organismen und Verhalten, das zu Waldbrand führt.
Die Straftaten sollen auch anonym gemeldet werden können. Alle zwei Jahre soll die Kommission die Umsetzung der Richtlinie durch die Mitgliedsstaaten prüfen und gegebenenfalls die Liste der Vergehen aktualisieren.
Im Dezember 2021 hatte die Europäische Kommission einen Vorschlag für eine neue Richtlinie der EU zur Bekämpfung der Umweltkriminalität vorgestellt. Hintergrund ist die stark ansteigende Zahl von Straftaten in diesem Bereich, der von Europol als ähnlich profitabel, wie der Drogenhandel eingestuft wird. Aufgrund der bislang niedrigen Sanktionen und der schweren Nachvollziehbarkeit der Vergehen sei das Feld sehr attraktiv für die Organisierte Kriminalität. til
Die Kommission will für die Bewertung der Umweltauswirkungen von Produkten, Dienstleistungen und Organisationen nicht die Methodik des Umweltfußabdrucks verwenden. Ein gestern von der französischen Nachrichtenplattform Contexte geleakter Entwurf der Green Claims-Richtlinie bezeichnet den ökologischen Fußabdruck im Vergleich zu einer früheren Version als ungeeignet. Stattdessen soll ein flexiblerer Ansatz gewählt werden. Die finale Version des Entwurfs soll heute vorgestellt werden.
“Die Methode deckt noch nicht alle relevanten Auswirkungskategorien für alle Produktgruppen ab”, heißt es in dem Dokument. Deshalb könnten sie “ein unvollständiges Bild der Umweltfreundlichkeit eines
eines Produkts im Zusammenhang mit grünen Angaben vermitteln”. Darüber hinaus würden sich viele umweltbezogene Angaben auch auf Aspekte wie die Haltbarkeit, Wiederverwendbarkeit, Reparierbarkeit, Recyclingfähigkeit und die Verwendung natürlicher Inhaltsstoffe beziehen, für die sich der ökologische Fußabdruck als alleinige Methode nicht eignen würde. Aus diesen Gründen wählt die Kommission, so erklärt sie im Dokument, nicht eine einzige Standardmethode, sondern einen flexibleren Ansatz.
Die von der Kommission entwickelte Methode des Product Environmental Footprint (PEF) sowie des Organisation Environmental Footprint (OEF) soll Unternehmen helfen, fundierte Aussagen über die Auswirkungen ihrer Produkte und ihrer Organisation zu machen. Spezifische Kategorieregeln (PEFCR, OEFSR) zielen auf die Berechnung des Umweltfußabdrucks bestimmter Produktgruppen ab. Die Kommission testet die Anwendung dieser Methodik seit einigen Jahren; im Hinblick auf die Green Claims-Richtlinie war ihre Eignung umstritten.
Die Green Claims-Richtlinie führt Mindestanforderungen an die Begründung und Kommunikation von umweltbezogenen Angaben ein. Bevor die Angaben in der kommerziellen Kommunikation verwendet werden, müssen sie außerdem durch eine dritte Instanz geprüft werden. Das Ziel ist, Verbraucherinnen vor Greenwashing zu schützen und ihnen fundierte Kaufentscheidungen auf der Grundlage glaubwürdiger Aussagen und Labels zu ermöglichen. Zudem soll die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen, die ökologisch nachhaltige Produkte und Dienstleistungen anbieten wollen, verbessert werden.
Die endgültige Fassung des Gesetzesentwurfs wird die Kommission heute Mittag gemeinsam mit dem Gesetzesvorhaben zum Recht auf Reparatur vorstellen. Verbraucherschützer erhoffen sich ein wirkungsvolles Gesetzespaket, um nachhaltigere Konsummodelle zu stärken. leo
Die Bankenbranche im Euro-Raum hat nach Angaben des EZB-Chefbankenaufsehers Andrea Enria das vergangene Jahr mit soliden Kapitalkennzahlen abgeschlossen. “Die Kapital- und Liquiditätsausstattung der Banken blieb solide und lag deutlich über den Mindestanforderungen”, sagte Enria am Dienstag im Wirtschafts- und Währungssauschuss (ECON) des EU-Parlaments in Brüssel. Zum Jahresende 2022 hat die harte Kernkapitalquote (CET 1) der Institute Enria zufolge 15,3 Prozent betragen. Noch Ende des dritten Quartals 2022 hatte sie bei 14,7 Prozent gelegen.
Auch hinsichtlich der Profitabilität der Institute wies Enria auf Fortschritte hin. Banken seien im vierten Quartal 2022 auf eine Eigenkapitalrendite (RoE) von 7,7 Prozent gekommen. Das sei das höchste Niveau seit dem Beginn der Bankenunion. Im dritten Quartal 2022 waren es 7,6 Prozent gewesen.
Enria rief zudem die Geldhäuser im Euro-Raum angesichts einer unsicheren Konjunkturlage zur Wachsamkeit auf. “Die erste Gruppe von Herausforderungen ist konjunkturell”, erklärte er. Wenn die Energiekrise nicht behoben werde, könne das Kreditrisiko bei Darlehen an Unternehmen mit stark energieabhängigen Geschäften steigen.
Zudem sei die konjunkturelle Abschwächung Ende 2022 mit einem Wiederanstieg der Zahlungsausfälle von Unternehmen einhergegangen. Daher sei erhöhte Wachsamkeit hinsichtlich einer Verschlechterung der Kreditqualität gefordert. rtr
Chinas Botschafter in den Niederlanden hat vor einer Verschlechterung der bilateralen Beziehungen gewarnt, sollte das EU-Land das geplante Export-Verbot für den Halbleiter-Maschinenhersteller ASML umsetzen. Die Niederlande würden damit auch ihre Führung in der Chiptechnologie aufs Spiel setzen, indem sie sich selbst vom größten Markt der Welt abschneiden, sagte der chinesische Botschafter Tan Jian laut dem Financieele Dagblad. Solche Beschränkungen bei der Ausfuhr wären “schlecht für China, schlecht für die Niederlande und den Welthandel und werden sich negativ auf unsere Beziehungen und die wirtschaftliche Zusammenarbeit auswirken”, sagte Tan. “Das wird nicht ohne Folgen bleiben. Ich werde nicht über Gegenmaßnahmen spekulieren, aber China wird das nicht auf die leichte Schulter nehmen.”
Anfang März hatte die Außenhandelsministerin Liesje Schreinemacher angekündigt, dass die Niederlande den Verkauf von ASML- und ASMI-Maschinen, die fortschrittliche Chips herstellen, weiter einschränken würden. Die Niederlande wollten damit “verhindern, dass niederländische Waren zu unerwünschten Endverwendungen wie dem Militäreinsatz oder in Massenvernichtungswaffen beitragen”, erklärte sie. Die Niederlanden würden damit den Chip-Sanktionen der Vereinigten Staaten folgen.
Laut Tan würde der Boykott die internationalen Handelsregeln und die Spitzenposition von ASML in der globalen Technologie untergraben. “Sie sind ein kleines Land, und Sie waren immer der Fahnenträger für den Freihandel. Sie behalten Ihren Vorsprung, indem Sie nach China verkaufen und den Erlös reinvestieren”, sagte Tan in Richtung Den Haag. Wenn China die ASML-Maschinen nicht kaufen könne, werde die Volksrepublik keine andere Wahl haben, als seine eigenen zu bauen. Amelie Richter
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) senkt die Hürden für Schadenersatz-Klagen von Diesel-Käufern bei unzulässiger Abgastechnik. Die Autobauer könnten auch dann haften, wenn sie ohne Betrugsabsicht einfach nur fahrlässig gehandelt hätten, urteilten die Luxemburger Richter am Dienstag in einem Mercedes-Fall.
Mercedes gibt sich gelassen: “Mercedes-Benz-Fahrzeuge, die von einem Rückruf betroffen waren oder sind, können nach entsprechenden Software-Updates dauerhaft weiter uneingeschränkt genutzt werden. Wie nationale Gerichte die Entscheidung des EuGH in Bezug auf das nationale Recht anwenden werden, bleibt abzuwarten”, teilte der Autohersteller am Dienstag nach dem Urteil mit.
Die Entscheidung aus Luxemburg könnte große Auswirkungen auf die deutsche Rechtsprechung haben. Denn beim Bundesgerichtshof (BGH) hatten Klägerinnen und Kläger bisher nur dann eine Chance auf Schadenersatz, wenn sie vom Hersteller bewusst und gewollt auf sittenwidrige Weise getäuscht wurden. Diese strengen Kriterien waren nur beim VW-Skandalmotor EA189 erfüllt. Dem EuGH genügt nun fahrlässiges Handeln – was sich leichter nachweisen lässt.
Die Richter in Deutschland müssen diese Vorgaben nun umsetzen. Um das EuGH-Urteil abzuwarten, hatten Gerichte aller Instanzen massenhaft Diesel-Verfahren auf Eis gelegt, bei denen es auf diese Frage ankommt. Allein beim BGH sind im Moment mehr als 1.900 Revisionen und Nichtzulassungsbeschwerden anhängig, die deutliche Mehrzahl war wegen des EuGH-Verfahrens erst einmal zurückgestellt worden. Mit dem EuGH-Urteil sind allerdings noch längst nicht alle Fragen geklärt. Offen ist zum Beispiel, wie viel Geld betroffenen Autokäufern zusteht.
Hintergrund des Verfahrens war eine Schadenersatz-Klage aus Deutschland gegen Mercedes-Benz wegen eines sogenannten Thermofensters. Thermofenster sind Teil der Motorensteuerung, die bei kühleren Temperaturen die Abgasreinigung drosseln. Autohersteller argumentieren, das sei notwendig, um den Motor zu schützen. Umweltorganisationen sehen darin hingegen ein Instrument, das dabei hilft, die Emissionen von Autos unter Testbedingungen kleiner erscheinen zu lassen, als sie es im realen Straßenverkehr sind. Der EuGH erachtet diese Thermofenster nur in ganz engen Grenzen als zulässig.
Thermofenster wurden auch von anderen Herstellern standardmäßig eingesetzt. Da sich das EuGH-Urteil auf unzulässige Abschalteinrichtungen allgemein bezieht, könnte es auch auf andere Funktionalitäten in der Abgastechnik von Diesel-Autos übertragbar sein, die derzeit von Gerichten unter die Lupe genommen werden. dpa

Beim Thema Künstliche Intelligenz (KI) geht es zu langsam voran in Deutschland und Europa – vor allem, wenn es nach Vanessa Cann geht. Die 30-Jährige ist Geschäftsführerin beim KI-Bundesverband, in dem mehr als 400 Unternehmen vernetzt sind. “KI-Startups aus Europa sollen an der Weltspitze mitspielen können”, sagt Cann. “Das ist unser Anspruch.”
Eigentlich wollte Vanessa Cann selbst in die Politik: 2016 kandidiert sie für die Grünen in Mannheim für den baden-württembergischen Landtag. Nach dem Studium der Politikwissenschaften beschäftigt sich Cann in einer Beratungsfirma mit Künstlicher Intelligenz, arbeitet für Technologieunternehmen aus dem Silicon Valley an deren Lobbying-Positionen. “Ich habe gemerkt, dass Politik und Unternehmen sehr stark aneinander vorbeireden, wenn es um KI geht“, sagt Cann. An dieser Schnittstelle arbeitet sie heute.
Die EU will Künstliche Intelligenz künftig mit dem Artificial-Intelligence-Act (kurz: AI-Act) regulieren, aktuell diskutiert das Parlament den Entwurf. Die neuen Regeln sollen KI-Technologien in Risikokategorien einordnen. Unter anderem sieht der Entwurf vor, Anwendungen wie das Social Scoring zu verbieten und Technologien mit erhöhtem Risiko stärker zu regulieren. Vanessa Cann sieht das kritisch, weil zu viele Start-ups in diese Kategorie fallen: “Die Definitionen sind zu breit gefasst”, sagt sie. Eine Studie des KI-Bundesverbands hat ergeben, dass bis zu 50 Prozent der befragten Unternehmen ihre Technologie in diese Kategorie einordnen, die Kommission hingegen geht nur von bis zu 15 Prozent aus.
Gerade für Start-ups und kleine Unternehmen hätte der AI-Act Konsequenzen: Er führt zu doppelter Regulierung und ist eine zusätzliche Belastung, sagt Cann. Für sensible Bereiche wie Medizin oder Finanzen gebe es ohnehin schon strenge Vorschriften. Ihr Vorschlag: Statt einer neuen Regulierung solle die EU lieber bestehende Branchenregeln um die Künstliche Intelligenz erweitern: “Ich glaube, es braucht den AI-Act nicht”, betont Cann. “Nun sollten wir sicherstellen, dass er Rechtsklarheit schafft und Innovation in Europa fördert.”
Denn der AI-Act kommt, nach den Verhandlungen im Parlament geht es in den Trilog mit Rat und Kommission. Vanessa Cann fordert nun eine Leitlinie zum Gesetzestext, die den Unternehmen genau erklärt, was sie tun müssen. Sie zieht Parallelen zur Datenschutzgrundverordnung (DSGVO): Als sie in Kraft getreten war, hatten viele Unternehmen Angst, etwas falsch zu machen. Jetzt sei es wichtig, dass gerade Start-ups klare Empfehlungen bekommen, damit sie keine teure Rechtsberatung in Anspruch nehmen müssen. Sonst würde es ihnen erschwert, ihre Technologie in Europa zu entwickeln.
Wie es in Zukunft in Sachen Künstlicher Intelligenz weitergeht? “Der nächste große Schritt ist die generative KI”, berichtet Cann. Damit seien sogenannte Allzweck-KI gemeint, wie beispielsweise die Software hinter ChatGPT. Europa müsse dringend auch eigene Modelle entwickeln, sagt die Geschäftsführerin des KI-Bundesverbands: “Sonst wird das nach Plattformen und Cloud-Computing die nächste Technologie, für die der Zug abgefahren ist.” Jana Hemmersmeier
Wie die FDP Flurschaden auf EU-Ebene anrichtet
Verbrenner-Streit: Trotz Kommissionsvorschlag noch keine Einigung
Neuer Fahrplan für den AI Act im Parlament
Frankreichs Parlament stimmt für Atomplan
Rat will auch regulierte Gaspreise für KMU
Rechtsausschuss fordert höhere Strafen bei Umweltkriminalität
Green Claims-Richtlinie: Umweltfußabdruck nicht geeignet
Aufsicht: Kapitalausstattung der Banken solide
Botschafter warnt Niederlande vor ASML-Beschränkungen
EuGH-Urteil: Schadenersatz-Klagen von Dieselkäufern künftig leichter
Vanessa Cann – bei KI nicht abhängen lassen
Bundesfinanzminister Christian Lindner und seine FDP sorgen derzeit nicht nur in Berlin für Wirbel – auch in Brüssel brodelt es. Meine Kollegen Stefan Braun und Till Hoppe haben aufgeschrieben, was es mit den beiden Lagern innerhalb der Partei auf sich hat.
Die Uhr tickt: Bis zum EU-Gipfel am Donnerstag soll der Streit um das Verbrenner-Aus und die Rolle von E-Fuels gelöst werden. Lukas Scheid hat aufgeschrieben, was der neue Vorschlag der Kommission beinhaltet.
Und noch eine Ankündigung: Im Table.Live-Briefing diskutiert Europe.Table-Redakteurin Leonie Düngefeld heute um 11:30 Uhr mit Hildegard Bentele (CDU), Daniel Quantz (WVMetalle) und Michael Reckordt (Powershift) über den Critical Raw Materials Act. Hier können Sie sich dafür noch anmelden.

Erst kurz vor Beginn des Treffens der Euro-Gruppe am vergangenen Montag informierte Christian Lindner seine Kollegen aus den anderen EU-Staaten: Deutschland werde die gemeinsame Erklärung zur Reform der Fiskalregeln so nicht mittragen, ließ der Bundesfinanzminister übermitteln. Die meisten anderen Minister wurden überrumpelt, schließlich hatte die Bundesregierung auf Ebene der Staatssekretäre und der EU-Botschafter dem Text noch zugestimmt.
Lindners Manöver schlug in Brüssel einige Wellen. Und genau darauf schien der FDP-Chef es auch angelegt zu haben. Es ist die Rolle, in der sich die Liberalen derzeit augenscheinlich gefallen, ob auf der heimischen Bühne in Berlin oder in Brüssel: als diejenigen, die für ihre Überzeugungen kämpfen, und dafür Koalitions- und EU-Partnern notfalls die Stirn bieten. Verkehrsminister Volker Wissing sorgt so mit seinem späten Nein zum Verbrenner-Aus 2035 seit drei Wochen für Schlagzeilen (siehe Text in dieser Ausgabe).
Dahinter steht eine harte Abwägung. Nach den letzten Wahldebakeln in Niedersachsen und fortwährend schlechten Umfragewerten, die seit Monaten rund um die Fünf-Prozent-Hürde herum schwanken, hat die Parteispitze eine Entscheidung getroffen: Die FDP muss erkennbar werden, sie muss spürbar sein, im Zweifel muss sie weh tun. Und das funktioniert nun mal am ehesten mit Provokationen, die auch als solche wahrgenommen werden.
In der Abwägung damit spielen die Gepflogenheiten des Brüsseler Betriebes, die für das Funktionieren der EU-Kompromissmaschinerie wichtig sind, offenkundig eine untergeordnete Rolle. “Es geht um Selbstbehauptung”, sagt ein langjähriger FDP-Abgeordneter, der vor der großen Niederlage 2013 schon dabei gewesen ist. Da sei in der Prioritätenliste der Überlebenswille größer als die Sensibilität für Brüssel.
Die Kritik etwa vonseiten der Grünen oder aus Paris dient in dieser Strategie eher der eigenen Profilierung als dass sie schadet. “Im Moment nimmt die deutsche Politik und auch die Interessenvertretung Deutschlands Schaden”, warnte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gestern. “Wir verlieren Debatten, wir kriegen zu wenig Unterstützung für unsere Projekte.”
Der europapolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Michael Link, hält dagegen: “Natürlich gibt es Kritik von jener Seite, die eine andere Meinung zum Verbrenner haben”, sagt er. “Aber ich kann nicht erkennen, dass Deutschland daraus ein Ansehensschaden entstanden wäre, im Gegenteil, unsere Position erfährt Unterstützung von verschiedenen Seiten.” Deutschland trage als größter Mitgliedstaat immer eine besondere Verantwortung, sich für die Konsensbildung in der EU einzusetzen. Das gelte aber ebenso für die Kommission – und die habe keinerlei Bereitschaft erkennen lassen, wie vereinbart einen Vorschlag zu E-Fuels vorzulegen.
Es ist allerdings beileibe nicht das erste Mal, dass die FDP-Minister die Entscheidungsprozesse in Europa-Themen eigenhändig und spät ins Stocken brachten.
Bei anderen Mitgliedstaaten gilt Berlin daher inzwischen schon als wenig verlässlich und schwer berechenbar. “Die Probleme in der Koalition werden so zu einem europäischen Problem”, sagt ein EU-Diplomat. Daher sei es an der Zeit, dass Kanzler Olaf Scholz einschreite. “Europa ist Chefsache, aber der Chef ist nicht da.”
Auch der Generalsekretär der Europäischen Bewegung Deutschland, Bernd Hüttemann, warnt: “Wenn man rückwirkend Vereinbarungen nach eingeübten Verhandlungen wieder infrage stellt, kann das in der Sache verständlich sein, doch hat es fatale Folgen für die Glaubwürdigkeit deutschen Regierungshandelns in der EU”.
Der deutsche EU-Botschafter Michael Clauß mahnte bereits vor Monaten in einem internen Drahtbericht, die Abstimmungsschwierigkeiten innerhalb der Bundesregierung minderten den Einfluss Deutschlands auf EU-Ebene. Dabei hatte sich die Ampelkoalition vorgenommen, die europapolitische Koordinierung innerhalb der Bundesregierung zu verbessern. Abstimmungsrunden auf mehreren Hierarchie-Ebenen sollen sicherstellen, dass strittige Fragen geklärt werden und sich Berlin so frühzeitig positionieren kann.
Doch das Ansinnen scheiterte in den ersten 15 Monaten der Koalition mehrfach. Ob es demnächst besser wird, ist fraglich. Mehrere zentrale Akteure der deutschen Europapolitik verlassen bald ihre Posten: Der zuständige Staatssekretär im Finanzministerium, Carsten Pillath, geht in den Ruhestand, sein Nachfolger Heiko Thoms hat deutlich weniger EU-Erfahrung. Im Auswärtigen Amt geht Staatssekretär Andreas Michaelis als Botschafter nach Washington, seine Nachfolge ist noch nicht entschieden. Und auch EU-Botschafter Clauß steht nach fünf Jahren in Brüssel im Sommer vor dem Absprung.
Doch ein politischer Streit wie um den Verbrennermotor lasse sich ohnehin nicht durch eine gute Koordinierung auf Beamtenebene lösen, argumentiert FDP-Politiker Link – er sei Ausdruck eines “tiefgreifenden Dissens zwischen Grünen und Liberalen beim Thema Technologieoffenheit”.
In den Reihen der Liberalen gibt es aber nach wie vor zwei Gruppen, die sich bei ihrem Blick auf die Politik nahezu diametral gegenüberstehen. Die einen halten das Funktionieren einer Koalition für einen Wert an sich. Bei schlechten Umfragen freilich werden ihre Karten schlechter gegenüber jenen, die nach Profilierung und eigenen Schlagzeilen trachten. Diese zweite Gruppe ist es, die derzeit stärker den Ton angibt – und sich bestätigt fühlen dürfte, da die FDP in aller Munde ist, in Brüssel wie in Berlin. Stefan Braun und Till Hoppe
Eine Perspektive für “E-Fuels only”-Fahrzeuge hatte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) Mitte vergangene Woche gefordert, um das vollständige Verbrenner-Aus im Jahr 2035 noch abzuwenden. Die Kommission hat bereits kurze Zeit später einen entsprechenden Entwurf für eine ergänzende Gesetzgebung vorgelegt. In dem Entwurf, der Table.Media vorliegt, wird – wie von Wissing gefordert – die bestehende Gesetzgebung zur Abgasnorm für Pkw (Euro 5 und Euro 6) aufgegriffen.
Die Kommission schlägt demnach vor, eine neue Fahrzeugkategorie zu schaffen für Fahrzeuge, die ausschließlich mit kohlenstoffneutralen Kraftstoffen (E-Fuels) betrieben werden. Diese sollen so konstruiert sein, “dass sie nicht mit anderen Arten von Kraftstoffen betrieben werden können”. Das Auto soll zudem durch ein Kraftstoffüberwachungsgerät erkennen, wenn es mit herkömmlichen Kraftstoffen betankt würde. In diesem Fall müsste das System verhindern, dass das Fahrzeug überhaupt startet. Hersteller müssten sicherstellen, dass Überwachungsgeräte und Betankungssysteme vor Manipulation geschützt sind, heißt es weiter.
Für Fahrzeughersteller dürfte das eine massive Hürde sein, solche Fahrzeuge überhaupt zu bauen, da hohe Entwicklungskosten und nur ein kleiner Absatzmarkt zu erwarten wären. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete am Dienstag aus dem Umfeld Wissings, die Bedingung der Kommission, dass Autos CO₂-neutrale Kraftstoffe von fossilen Brennstoffen unterscheiden müssten, sei für Deutschland problematisch, weil Autohersteller neue Motoren entwickeln müssten.
Das heißt, auch wenn der Kommissionsentwurf in die Richtung einer “E-Fuels only”-Lösung geht, dürfte das Verkehrsministerium Nachbesserungsbedarf sehen, um eine realistische Perspektive für E-Fuels zu schaffen. Die FDP hatte dies im Koalitionsvertrag und in einem Erwägungsgrund der überarbeiteten EU-Flottengrenzwerte reinverhandelt. Zwei der Forderungen Wissings wurden von der Kommission nicht berücksichtigt: Eine Anrechnung von “E-Fuels only”-Fahrzeugen auf die Flottengrenzwerte der Hersteller sowie die Aufnahme einer Definition für vollständig CO₂-neutrale Kraftstoffe in die Gesetzgebung der Flottengrenzwerte.
Der Spiegel berichtete am Dienstag sogar, dass Wissing den Kommissionsvorschlag bereits komplett abgelehnt habe. Auf Nachfrage von Table.Media wollte das Verkehrsministerium dies zwar nicht bestätigen, jedoch legt die Tatsache, dass noch immer keine Einigung erzielt wurde, nahe, dass der Vorschlag nicht den Vorstellungen des Ministers entspricht. “Wir sind an einer schnellen Klärung interessiert, die aber belastbar und verbindlich sein muss”, so das Ministerium. Bedeutet: Der aktuelle Vorschlag erfüllt diese Kriterien noch nicht.
Im Bundesumweltministeriums sieht man das offenbar ganz anders. “Soweit wir den Vorschlag der Kommission kennen, wäre dem Erwägungsgrund im Sinne der FDP Rechnung getragen und einer Zustimmung dürfte an sich nichts mehr im Wege stehen“, heißt es aus Kreisen des Ministeriums.
Eine weitere noch offene Frage: Aus dem Kommissionsentwurf geht nicht hervor, welche EU-Rechtsvorschrift Anwendung findet. Sollte die Kommission ihren Vorschlag über einen Durchführungsrechtsakt umsetzen wollen, müsste sie diesen mit den Mitgliedstaaten konsultieren. Bei einem delegierten Rechtsakt wäre das nicht notwendig, allerdings hätten EU-Parlament und Ministerrat die Möglichkeit, Einspruch einzulegen.
Europa-Staatsministerin Anna Lührmann (Grüne) sagte am Dienstag in Brüssel, sie gehe davon aus, dass sich das gesamte Thema vor dem am Donnerstag beginnenden EU-Gipfel lösen werde. Lührmann betonte noch einmal, man habe sich darauf verständigt, dass das Trilog-Ergebnis gelte. Zugleich unterhalte sich die Bundesregierung mit der EU-Kommission darüber, wie der Erwägungsgrund konkret umgesetzt werde. “Ich gehe davon aus, dass diese Gespräche vor dem Gipfel abgeschlossen werden.”
Die Berichterstatter für den AI Act im EU-Parlament haben einen neuen Zeitplan vorgelegt. Demnach sollen die Beratungen im April abgeschlossen werden. Bis dahin sind noch zwei weitere technische und drei politische Treffen angesetzt. Immerhin, so twitterte Kai Zenner aus dem Büro des EVP-Abgeordneten Axel Voss, haben die Verhandler inzwischen den ganzen Text und viele Erwägungsgründe durchgearbeitet.
Im technischen Meeting am Montag stand die Definition von General Purpose AI (Allzweck-KI) und die Verantwortlichkeiten entlang der Wertschöpfungskette auf der Tagesordnung. Am Dienstag ging es unter anderem um Sandboxes (KI-Reallabore) und Enforcement (Durchsetzung).
General Purpose AI (GPAI) ist in der Lage, eine Vielzahl von Aufgaben zu erledigen, während spezialisierte KI-Systeme auf bestimmte Aufgaben programmiert sind. Durch die Veröffentlichung des großen Sprachmodells ChatGPT hat das Thema stark an Aufmerksamkeit gewonnen.
Die Berichterstatter hatten als Definition vorgeschlagen: “‘general purpose AI system’ means an AI system that is trained on broad data at scale, is designed for generality of output, and can be adapted to a wide range of tasks’.” Unter anderem beanstandeten die Grünen jedoch, dass diese Definition GPAI auf die Methode Machine Learning begrenze. Dabei schließe sie andere Methoden wie Reinforcment Learning oder evolutionäre Algorithmen aus.
Während die Grünen sich eine breite Anwendbarkeit der Definition wünschen, bevorzugt die EVP eher eine engere Definition. Geeinigt haben sich die Verhandler offenbar darauf, in der Definition General Purpose AI durch ‘foundation model’ (Basismodell) zu ersetzen.
Für die Verhandler und mehr noch für Beobachter ist es schwer auszumachen, worüber tatsächlich eine finale Einigung besteht. Das liegt auch an der Verhandlungsführung der Berichterstatter Brando Benifei (S&D) und Dragoş Tudorache (Renew), die selbst Abgeordnete für gewöhnungsbedürftig halten, weil bei den Treffen jeweils nur Kommentare eingesammelt, aber keine Entscheidungen getroffen werden.
Die Termine für die kommenden politischen Treffen sind für den 29. März, den 13. April und den 19. April geplant. Der Trilog könnte dann im Mai beginnen. vis
Das französische Parlament hat am Dienstag mit großer Mehrheit für den Atominvestitionsplan der Regierung gestimmt. Der Plan zur nuklearen Erneuerung, dessen Kernstück der geplante Bau von sechs neuen Kernreaktoren ist, wurde mit 402 Ja- und 130 Nein-Stimmen angenommen. Am Montag erst unterstützten 278 Abgeordnete einen von der Opposition eingebrachten Misstrauensantrag gegen die Regierung. Damit fehlten nur neun Stimmen zu den 287 Stimmen, die für einen Sturz der Regierung erforderlich sind.
“Nach dem Senat im letzten Monat hat heute Abend auch das Unterhaus mit großer Mehrheit für den Atomplan gestimmt … das Ergebnis einer gemeinsamen Arbeit, um den Klimawandel zu bekämpfen und unsere Energiesouveränität zu garantieren”, twitterte Premierministerin Elisabeth Borne.
Präsident Emmanuel Macron will in den kommenden Wochen mit neuen Reformen die Initiative zurückgewinnen, nachdem seine Regierung beinahe an der Rentenreform gescheitert wäre. Die Kernenergie ist eines der Themen, bei denen seine Partei mit den konservativen Les Republicains und den rechtsextremen Rassemblement National auf Augenhöhe ist.
“Unser Ziel ist es, Frankreich zu einer großen kohlenstofffreien und souveränen Nation zu machen”, twitterte Energieministerin Agnès Pannier-Runacher und fügte hinzu, dies sei der erste Baustein für das “immense Projekt der Wiederbelebung unserer Atomindustrie.”
Im Wettlauf um den Bau neuer Kernkraftwerke dürften die Verwaltungsverfahren weder die Verlängerung der Laufzeit bestehender Reaktoren noch den Bau neuer Reaktoren bremsen.
Macron will mit dem Bau eines ersten EPR2-Kernreaktors der nächsten Generation noch vor dem Ende seiner zweiten fünfjährigen Amtszeit im Mai 2027 beginnen, als Teil eines 52 Milliarden Euro teuren Plans zum Bau von sechs neuen Reaktoren.
Der Plan kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Frankreich monatelang unter größeren Ausfällen seiner bestehenden Flotte von 56 Reaktoren zu leiden hatte. Dadurch sank die Atomstromproduktion auf ein 30-Jahres-Tief., während der im Bau befindliche EPR der ersten Generation im westfranzösischen Flamanville Jahre hinter dem Zeitplan und Milliarden über dem Budget liegt. rtr
Bei künftigen Energiekrisen wollen die EU-Staaten dauerhaft die Möglichkeit erhalten, niedrige Gaspreise auch für kleine und mittelständische Unternehmen festzulegen. Das geht aus dem neuesten Entwurf der schwedischen Ratspräsidentschaft zur Novelle der Gasmarkt-Richtlinie von Dienstag hervor, der Table.Media vorliegt. Der siebte Änderungsentwurf soll heute von den ständigen Vertretern der Mitgliedstaaten beraten werden.
In einem ungewöhnlichen Schritt wollen die Mitgliedstaaten in der Gasmarkt-Richtlinie festschreiben, den Mechanismus zur Preisregulierung aus der neuen Strommarkt-Richtlinie zu übernehmen. In einer Erläuterung der Präsidentschaft heißt es dazu: “Die Verweise in dem vorgeschlagenen neuen Artikel auf den Kommissionsvorschlag zum Strommarktdesign bedeuten, dass alle Änderungen an diesem Text automatisch auch im Zusammenhang mit diesem neuen Artikel der Gasrichtlinie gelten werden. Das bedeutet, dass der Inhalt dieses neuen Artikels von den legislativen Beratungen über den entsprechenden Vorschlag für das Strommarktdesign abhängen wird.”
Den Entwurf für das neue Strommarktdesign hatte die Kommission erst vergangene Woche vorgelegt. Mit ihm sollen die Mitgliedstaaten in einer Stromkrise regulierte Preise auch für KMU festlegen können. Für Haushaltskunden gibt es eine ähnliche Regelung in der Strommarkt-Richtlinie bereits. Mit der Novelle der Gasmarkt-Richtlinie sollte sie bereits auf den Gaspreis für Haushaltskunden übertragen werden. Nach dem neuesten Entwurf soll nun eine Ausweitung auf den Strompreis für KMU auch für den Gasmarkt nachvollzogen werden.
Am 28. März wollen die EU-Energieminister im Rat die allgemeine Ausrichtung zum Gasmarkt-Paket beschließen, bevor es in den Trilog geht. ber
Der Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments hat sich für eine Ausweitung der strafbaren Umweltverbrechen und für härtere Sanktionen ausgesprochen. In ihrer Sitzung am Dienstag stimmten die Mitglieder des Gremiums einstimmig für den Bericht von Antonius Manders (EVP).
“Die durch Umweltkriminalität verursachten Schäden haben tiefgreifende Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und den Zustand unseres Planeten”, sagte der niederländische Abgeordnete. Die oftmals grenzüberschreitenden Straftaten müssten auf EU-Ebene mit abschreckenden Sanktionen bekämpft werden. Dafür müsse die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsstaaten verstärkt und Justiz sowie Polizei entsprechend geschult werden, so Manders.
Konkret fordert der Ausschuss, dass Straftaten, die zum Tod oder zu schweren gesundheitlichen sowie Umweltschäden führen, mit mindestens zehn Jahren Haft bestraft werden. Unternehmen sollen bei Umweltverbrechen Bußgelder in Höhe von mindestens zehn Prozent ihres durchschnittlichen weltweiten Umsatzes der vergangenen drei Jahre zahlen. Die EU-Kommission sieht hier nur fünf Prozent vor. Außerdem sollen Firmen auch mit dem Ausschluss von öffentlichen Geldern und Lizenzentzug rechnen müssen sowie für die Wiederherstellung der Umwelt und die Entschädigung der Opfer sorgen.
Auch sprachen sich die Abgeordneten für eine Erweiterung der strafbaren Vergehen aus. Die Liste umfasst unter anderem illegalen Holzhandel, illegale Ausbeutung von Wasserressourcen, Umweltverschmutzung durch Schiffsverkehr, Verstöße gegen das EU-Chemikalienrecht, Anbau genetisch veränderter Organismen und Verhalten, das zu Waldbrand führt.
Die Straftaten sollen auch anonym gemeldet werden können. Alle zwei Jahre soll die Kommission die Umsetzung der Richtlinie durch die Mitgliedsstaaten prüfen und gegebenenfalls die Liste der Vergehen aktualisieren.
Im Dezember 2021 hatte die Europäische Kommission einen Vorschlag für eine neue Richtlinie der EU zur Bekämpfung der Umweltkriminalität vorgestellt. Hintergrund ist die stark ansteigende Zahl von Straftaten in diesem Bereich, der von Europol als ähnlich profitabel, wie der Drogenhandel eingestuft wird. Aufgrund der bislang niedrigen Sanktionen und der schweren Nachvollziehbarkeit der Vergehen sei das Feld sehr attraktiv für die Organisierte Kriminalität. til
Die Kommission will für die Bewertung der Umweltauswirkungen von Produkten, Dienstleistungen und Organisationen nicht die Methodik des Umweltfußabdrucks verwenden. Ein gestern von der französischen Nachrichtenplattform Contexte geleakter Entwurf der Green Claims-Richtlinie bezeichnet den ökologischen Fußabdruck im Vergleich zu einer früheren Version als ungeeignet. Stattdessen soll ein flexiblerer Ansatz gewählt werden. Die finale Version des Entwurfs soll heute vorgestellt werden.
“Die Methode deckt noch nicht alle relevanten Auswirkungskategorien für alle Produktgruppen ab”, heißt es in dem Dokument. Deshalb könnten sie “ein unvollständiges Bild der Umweltfreundlichkeit eines
eines Produkts im Zusammenhang mit grünen Angaben vermitteln”. Darüber hinaus würden sich viele umweltbezogene Angaben auch auf Aspekte wie die Haltbarkeit, Wiederverwendbarkeit, Reparierbarkeit, Recyclingfähigkeit und die Verwendung natürlicher Inhaltsstoffe beziehen, für die sich der ökologische Fußabdruck als alleinige Methode nicht eignen würde. Aus diesen Gründen wählt die Kommission, so erklärt sie im Dokument, nicht eine einzige Standardmethode, sondern einen flexibleren Ansatz.
Die von der Kommission entwickelte Methode des Product Environmental Footprint (PEF) sowie des Organisation Environmental Footprint (OEF) soll Unternehmen helfen, fundierte Aussagen über die Auswirkungen ihrer Produkte und ihrer Organisation zu machen. Spezifische Kategorieregeln (PEFCR, OEFSR) zielen auf die Berechnung des Umweltfußabdrucks bestimmter Produktgruppen ab. Die Kommission testet die Anwendung dieser Methodik seit einigen Jahren; im Hinblick auf die Green Claims-Richtlinie war ihre Eignung umstritten.
Die Green Claims-Richtlinie führt Mindestanforderungen an die Begründung und Kommunikation von umweltbezogenen Angaben ein. Bevor die Angaben in der kommerziellen Kommunikation verwendet werden, müssen sie außerdem durch eine dritte Instanz geprüft werden. Das Ziel ist, Verbraucherinnen vor Greenwashing zu schützen und ihnen fundierte Kaufentscheidungen auf der Grundlage glaubwürdiger Aussagen und Labels zu ermöglichen. Zudem soll die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen, die ökologisch nachhaltige Produkte und Dienstleistungen anbieten wollen, verbessert werden.
Die endgültige Fassung des Gesetzesentwurfs wird die Kommission heute Mittag gemeinsam mit dem Gesetzesvorhaben zum Recht auf Reparatur vorstellen. Verbraucherschützer erhoffen sich ein wirkungsvolles Gesetzespaket, um nachhaltigere Konsummodelle zu stärken. leo
Die Bankenbranche im Euro-Raum hat nach Angaben des EZB-Chefbankenaufsehers Andrea Enria das vergangene Jahr mit soliden Kapitalkennzahlen abgeschlossen. “Die Kapital- und Liquiditätsausstattung der Banken blieb solide und lag deutlich über den Mindestanforderungen”, sagte Enria am Dienstag im Wirtschafts- und Währungssauschuss (ECON) des EU-Parlaments in Brüssel. Zum Jahresende 2022 hat die harte Kernkapitalquote (CET 1) der Institute Enria zufolge 15,3 Prozent betragen. Noch Ende des dritten Quartals 2022 hatte sie bei 14,7 Prozent gelegen.
Auch hinsichtlich der Profitabilität der Institute wies Enria auf Fortschritte hin. Banken seien im vierten Quartal 2022 auf eine Eigenkapitalrendite (RoE) von 7,7 Prozent gekommen. Das sei das höchste Niveau seit dem Beginn der Bankenunion. Im dritten Quartal 2022 waren es 7,6 Prozent gewesen.
Enria rief zudem die Geldhäuser im Euro-Raum angesichts einer unsicheren Konjunkturlage zur Wachsamkeit auf. “Die erste Gruppe von Herausforderungen ist konjunkturell”, erklärte er. Wenn die Energiekrise nicht behoben werde, könne das Kreditrisiko bei Darlehen an Unternehmen mit stark energieabhängigen Geschäften steigen.
Zudem sei die konjunkturelle Abschwächung Ende 2022 mit einem Wiederanstieg der Zahlungsausfälle von Unternehmen einhergegangen. Daher sei erhöhte Wachsamkeit hinsichtlich einer Verschlechterung der Kreditqualität gefordert. rtr
Chinas Botschafter in den Niederlanden hat vor einer Verschlechterung der bilateralen Beziehungen gewarnt, sollte das EU-Land das geplante Export-Verbot für den Halbleiter-Maschinenhersteller ASML umsetzen. Die Niederlande würden damit auch ihre Führung in der Chiptechnologie aufs Spiel setzen, indem sie sich selbst vom größten Markt der Welt abschneiden, sagte der chinesische Botschafter Tan Jian laut dem Financieele Dagblad. Solche Beschränkungen bei der Ausfuhr wären “schlecht für China, schlecht für die Niederlande und den Welthandel und werden sich negativ auf unsere Beziehungen und die wirtschaftliche Zusammenarbeit auswirken”, sagte Tan. “Das wird nicht ohne Folgen bleiben. Ich werde nicht über Gegenmaßnahmen spekulieren, aber China wird das nicht auf die leichte Schulter nehmen.”
Anfang März hatte die Außenhandelsministerin Liesje Schreinemacher angekündigt, dass die Niederlande den Verkauf von ASML- und ASMI-Maschinen, die fortschrittliche Chips herstellen, weiter einschränken würden. Die Niederlande wollten damit “verhindern, dass niederländische Waren zu unerwünschten Endverwendungen wie dem Militäreinsatz oder in Massenvernichtungswaffen beitragen”, erklärte sie. Die Niederlanden würden damit den Chip-Sanktionen der Vereinigten Staaten folgen.
Laut Tan würde der Boykott die internationalen Handelsregeln und die Spitzenposition von ASML in der globalen Technologie untergraben. “Sie sind ein kleines Land, und Sie waren immer der Fahnenträger für den Freihandel. Sie behalten Ihren Vorsprung, indem Sie nach China verkaufen und den Erlös reinvestieren”, sagte Tan in Richtung Den Haag. Wenn China die ASML-Maschinen nicht kaufen könne, werde die Volksrepublik keine andere Wahl haben, als seine eigenen zu bauen. Amelie Richter
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) senkt die Hürden für Schadenersatz-Klagen von Diesel-Käufern bei unzulässiger Abgastechnik. Die Autobauer könnten auch dann haften, wenn sie ohne Betrugsabsicht einfach nur fahrlässig gehandelt hätten, urteilten die Luxemburger Richter am Dienstag in einem Mercedes-Fall.
Mercedes gibt sich gelassen: “Mercedes-Benz-Fahrzeuge, die von einem Rückruf betroffen waren oder sind, können nach entsprechenden Software-Updates dauerhaft weiter uneingeschränkt genutzt werden. Wie nationale Gerichte die Entscheidung des EuGH in Bezug auf das nationale Recht anwenden werden, bleibt abzuwarten”, teilte der Autohersteller am Dienstag nach dem Urteil mit.
Die Entscheidung aus Luxemburg könnte große Auswirkungen auf die deutsche Rechtsprechung haben. Denn beim Bundesgerichtshof (BGH) hatten Klägerinnen und Kläger bisher nur dann eine Chance auf Schadenersatz, wenn sie vom Hersteller bewusst und gewollt auf sittenwidrige Weise getäuscht wurden. Diese strengen Kriterien waren nur beim VW-Skandalmotor EA189 erfüllt. Dem EuGH genügt nun fahrlässiges Handeln – was sich leichter nachweisen lässt.
Die Richter in Deutschland müssen diese Vorgaben nun umsetzen. Um das EuGH-Urteil abzuwarten, hatten Gerichte aller Instanzen massenhaft Diesel-Verfahren auf Eis gelegt, bei denen es auf diese Frage ankommt. Allein beim BGH sind im Moment mehr als 1.900 Revisionen und Nichtzulassungsbeschwerden anhängig, die deutliche Mehrzahl war wegen des EuGH-Verfahrens erst einmal zurückgestellt worden. Mit dem EuGH-Urteil sind allerdings noch längst nicht alle Fragen geklärt. Offen ist zum Beispiel, wie viel Geld betroffenen Autokäufern zusteht.
Hintergrund des Verfahrens war eine Schadenersatz-Klage aus Deutschland gegen Mercedes-Benz wegen eines sogenannten Thermofensters. Thermofenster sind Teil der Motorensteuerung, die bei kühleren Temperaturen die Abgasreinigung drosseln. Autohersteller argumentieren, das sei notwendig, um den Motor zu schützen. Umweltorganisationen sehen darin hingegen ein Instrument, das dabei hilft, die Emissionen von Autos unter Testbedingungen kleiner erscheinen zu lassen, als sie es im realen Straßenverkehr sind. Der EuGH erachtet diese Thermofenster nur in ganz engen Grenzen als zulässig.
Thermofenster wurden auch von anderen Herstellern standardmäßig eingesetzt. Da sich das EuGH-Urteil auf unzulässige Abschalteinrichtungen allgemein bezieht, könnte es auch auf andere Funktionalitäten in der Abgastechnik von Diesel-Autos übertragbar sein, die derzeit von Gerichten unter die Lupe genommen werden. dpa

Beim Thema Künstliche Intelligenz (KI) geht es zu langsam voran in Deutschland und Europa – vor allem, wenn es nach Vanessa Cann geht. Die 30-Jährige ist Geschäftsführerin beim KI-Bundesverband, in dem mehr als 400 Unternehmen vernetzt sind. “KI-Startups aus Europa sollen an der Weltspitze mitspielen können”, sagt Cann. “Das ist unser Anspruch.”
Eigentlich wollte Vanessa Cann selbst in die Politik: 2016 kandidiert sie für die Grünen in Mannheim für den baden-württembergischen Landtag. Nach dem Studium der Politikwissenschaften beschäftigt sich Cann in einer Beratungsfirma mit Künstlicher Intelligenz, arbeitet für Technologieunternehmen aus dem Silicon Valley an deren Lobbying-Positionen. “Ich habe gemerkt, dass Politik und Unternehmen sehr stark aneinander vorbeireden, wenn es um KI geht“, sagt Cann. An dieser Schnittstelle arbeitet sie heute.
Die EU will Künstliche Intelligenz künftig mit dem Artificial-Intelligence-Act (kurz: AI-Act) regulieren, aktuell diskutiert das Parlament den Entwurf. Die neuen Regeln sollen KI-Technologien in Risikokategorien einordnen. Unter anderem sieht der Entwurf vor, Anwendungen wie das Social Scoring zu verbieten und Technologien mit erhöhtem Risiko stärker zu regulieren. Vanessa Cann sieht das kritisch, weil zu viele Start-ups in diese Kategorie fallen: “Die Definitionen sind zu breit gefasst”, sagt sie. Eine Studie des KI-Bundesverbands hat ergeben, dass bis zu 50 Prozent der befragten Unternehmen ihre Technologie in diese Kategorie einordnen, die Kommission hingegen geht nur von bis zu 15 Prozent aus.
Gerade für Start-ups und kleine Unternehmen hätte der AI-Act Konsequenzen: Er führt zu doppelter Regulierung und ist eine zusätzliche Belastung, sagt Cann. Für sensible Bereiche wie Medizin oder Finanzen gebe es ohnehin schon strenge Vorschriften. Ihr Vorschlag: Statt einer neuen Regulierung solle die EU lieber bestehende Branchenregeln um die Künstliche Intelligenz erweitern: “Ich glaube, es braucht den AI-Act nicht”, betont Cann. “Nun sollten wir sicherstellen, dass er Rechtsklarheit schafft und Innovation in Europa fördert.”
Denn der AI-Act kommt, nach den Verhandlungen im Parlament geht es in den Trilog mit Rat und Kommission. Vanessa Cann fordert nun eine Leitlinie zum Gesetzestext, die den Unternehmen genau erklärt, was sie tun müssen. Sie zieht Parallelen zur Datenschutzgrundverordnung (DSGVO): Als sie in Kraft getreten war, hatten viele Unternehmen Angst, etwas falsch zu machen. Jetzt sei es wichtig, dass gerade Start-ups klare Empfehlungen bekommen, damit sie keine teure Rechtsberatung in Anspruch nehmen müssen. Sonst würde es ihnen erschwert, ihre Technologie in Europa zu entwickeln.
Wie es in Zukunft in Sachen Künstlicher Intelligenz weitergeht? “Der nächste große Schritt ist die generative KI”, berichtet Cann. Damit seien sogenannte Allzweck-KI gemeint, wie beispielsweise die Software hinter ChatGPT. Europa müsse dringend auch eigene Modelle entwickeln, sagt die Geschäftsführerin des KI-Bundesverbands: “Sonst wird das nach Plattformen und Cloud-Computing die nächste Technologie, für die der Zug abgefahren ist.” Jana Hemmersmeier