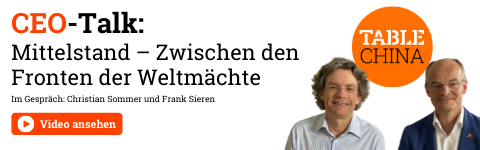die USA verlassen das Land durch die Vordertür – China kommt durch die Hintertür herein. Ganz so simpel ist die Lage in Afghanistan dann zwar doch nicht. Doch der US-Truppenabzug läuft noch, da trifft sich Außenminister Wang bereits mit einer Abordnung der Taliban. Auf der Negativseite macht er die gefürchteten Gotteskrieger damit salonfähig, auf der Positivseite wirkt er auf sie ein, sich der afghanischen Regierung unterzuordnen. Chinas Präsenz kann durchaus viel Gutes bewirken. Die neue Großmacht kommt mit einem anderen Ansatz als die Intervention der westlichen Allianz: Sie erkennt die Realität im Land an, statt von schönen Theorien auszugehen.
Wang betonte bei dem Treffen, China werde sie nie in die “inneren Angelegenheiten Afghanistans einmischen”. Eine bekannte Phrase, schließlich verlangt China die “Nichteinmischung” in seine Angelegenheiten gebetsmühlenartig von westlichen Ländern. Es handelt sich dabei um eine klassische “Tifa”, eine feststehende Wendung, die im Sprachgebrauch der chinesischen KP eine besondere Bedeutung hat. In der Kommunikation der Führung tauchen die gleichen Tifa immer wieder auf. Wir geben Ihnen in dieser Ausgabe eine kleine Einführung in die Kunst, Chinas politische Phrasen zu dekodieren. Wer einigermaßen geübt darin ist, kann sogar aus Parteitagsreden der KP ein gewisses Vergnügen ziehen. Es ließe sich sogar Tifa-Bingo spielen, denn Wortkombinationen wie die “drei kritischen Kämpfe” oder “das Konzept der fünf Entwicklungen” kommen garantiert vor.

Der Rückzug der Amerikaner aus Afghanistan läuft. Bis Ende August sollen alle US-Truppen aus dem Land am Hindukusch abgezogen sein. So will es US-Präsident Joe Biden.
Doch je weniger US-amerikanische Truppen im Land sind, desto stärker werden die im Land verbreiteten Terrorgruppen – allen voran die islamistischen Taliban. Die selbsternannten Gotteskrieger befinden sich auf dem Vormarsch. Region für Region, Bezirk um Bezirk erobern sie das Territorium von der Zentralregierung in Kabul zurück. Allein in den vergangenen zwei Monaten sollen 120 Bezirke in ihre Hände gefallen sein, darunter zuletzt auch der für China strategisch so wichtige Bezirk Wakhan in der Provinz Badakhshan. Die Taliban selbst behaupten, schon 75 Prozent des Landes unter Kontrolle zu haben. Das mag aus Propagandagründen übertrieben sein, doch fest steht: Der vergangene Monat war der tödlichste seit zwei Jahrzehnten.
Unsicherheit, Gewalt und Instabilität breiten sich aus. Und in Afghanistans Nachbarländern wächst die Sorge, all das könne sich über die Landesgrenzen hinaus ausbreiten. Vor allem in Peking wird man unruhig. “Der eigenmächtige Abzug der Amerikaner hinterlässt nur Instabilität, Chaos und Desaster”, urteilt Wang Jin, Professor an der Nordwest-Universität in Xi’an. Es handele sich um einen vollkommen unverantwortlichen Vorgang, die angrenzenden Staaten müssten das alles nun ausbaden und versuchen, die Situation in den Griff zu bekommen. Allen voran China.
Am Mittwoch traf sich denn auch Chinas Außenminister Wang Yi in Tianjin mit einer Delegation der Taliban unter Führung von Mullah Abdul Ghani Baradar. Wie wichtig China der Vorgang offenkundig ist, zeigt ein Blick zurück zum Anfang der Woche: Am Montag war noch die stellvertretende US-Außenministerin Wendy Sherman in Tianjin (China.Table berichtete). Kaum war die Amerikanerin wieder weg, kümmerte sich Wang persönlich um die Taliban.
Es sei nun wichtig, Stabilität und Sicherheit nach Afghanistan zu bringen, um die Ausbreitung von Gewalt über die Grenzen hinweg zu verhindern. “Dabei wird China eine sehr wichtige und konstruktive Rolle spielen“, kündigte Wang selbstbewusst an.
Dabei stellt der Vormarsch der Taliban vielleicht gar kein so großes Problem dar für Peking. Was für Kabul, die Amerikaner und ihre westlichen Verbündeten wahre Schreckensmeldungen sind, muss die China nicht sonderlich beunruhigen, meint Vanda Felbab-Brown. “Die Volkrepublik arbeitet seit Jahren daran, gute Beziehungen zu den Taliban aufzubauen”, sagt die Sicherheitsexpertin der Brookings Institution in Washington im Gespräch mit China.Table. Über verdeckte Kanäle habe Peking die Gotteskrieger regelrecht hofiert, Felbab-Brown spricht von einer “wine-and-dine”-Strategie. Offensichtlich mit Erfolg.
In einem Interview mit dem Newsletter “This Week in Asia” nannte der Sprecher der Taliban die China gar einen Freund. Man hoffe, dass die Volksrepublik sich am Wiederaufbau und der Entwicklung Afghanistans beteiligen werde. “Sollten die Chinesen hier investieren, werden wir natürlich auch ihre Sicherheit garantierten”, sagte Suhail Shaheen. Was der Taliban-Sprecher dann noch zu sagen hatte, wird in Peking mit besonderer Freunde vernommen worden sein. “Wir sorgen uns um die Unterdrückung von Muslimen, sei es in Palästina, in Myanmar oder in China. Aber wir werden uns nicht in die inneren Angelegenheiten Chinas einmischen“, versprach Shaheen. Mehr noch: Zukünftig werde man uigurischen Separatisten nicht mehr einen Rückzug nach Afghanistan erlauben.
Was Chinas Sicherheitsexperten bereits seit langem im Hintergrund vorbereiten, wird nun öffentlich zur Sprache gebracht. “All diese Äußerungen zeigen doch eindeutig, dass die Taliban sich langsam zu einer politischen Organisation entwickeln, die sich auf die Entwicklung Afghanistans konzentriert und sich vorbereitet, die Macht zu übernehmen”, sagt Cao Wei von der Lanzhou Universität gegenüber der Zeitung Global Times. Es scheint, als wollte China die Taliban salonfähig machen.
Vor diesem Hintergrund wird schnell klar, dass Peking weniger über die Sicherheitslage im gesamten Land besorgt ist als vielmehr im Wakhan-Korridor. Dieser schmale Landstrich befindet sich in der Provinz Badakhshan im Nordosten Afghanistans; für China es ist die strategisch wichtigste Region des Landes, schließlich verbindet jener schmale Korridor die chinesische Provinz Xinjiang mit Afghanistan.
Doch einem UN-Bericht zufolge sind just in dieser Region mehrere Hundert uigurische Kämpfer aktiv. Vor einigen Jahren wollte China deshalb in der Provinz Badakhshan eine eigene Militärbasis errichten. Doch die Pläne scheiterten – letztendlich wohl auch, weil die Regierung in Kabul die anwesenden US-Truppen nicht verprellen wollte, erklärt Sicherheitsexpertin Felbab-Brown.
Nach dem Abzug der Taliban will Peking vor allem verhindern, dass uigurische Extremisten, die seit Jahren auf Seiten der Taliban kämpfen, in Afghanistan ein sicheres Rückzugsgebiet finden. Denn immer wieder kommt es zu Anschlägen in China oder auf chinesische Ziele in der Region. Erst vor zwei Wochen wurden bei einem Anschlag auf einen Bus im Nordwesten Pakistans 13 Menschen getötet, darunter neun Chinesen. Der Bus sollte chinesische Ingenieure, Sachverständige und anderes Personal zur Baustelle des Dasu-Staudamms in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa bringen.
Afghanistan-Experte Cao Wei glaubt, dass die Sicherung der gemeinsamen Grenze mit Afghanistan eine lösbare Aufgabe darstelle. Sie ist lediglich rund 90 Kilometer lang und besteht vorwiegend aus unwegsamen Bergen. Notfalls könnte dieser kurze Abschnitt schlicht blockiert werden. China werde jedenfalls nicht die gleichen Fehler begehen, die in der Vergangenheit schon etliche Großmächte wie das britische Empire, die Sowjetunion und zuletzt die USA begangen haben: Truppen nach Afghanistan schicken. “China wird das Prinzip der Nichteinmischung in innere Angelegenheiten hochhalten. Wir werden uns auf die wirtschaftliche Entwicklung des Landes konzentrieren und uns nicht militärisch in Afghanistan engagieren”, sagt Cao.
Wirtschaftlich versucht China schon seit einiger Zeit, Afghanistan in sein Prestige-Projekt der Neuen Seidenstraße einzubinden. Eine Autobahn Peshawar-Kabul würde eine wichtige Lücke in dem Infrastrukturprojekt schließen, doch bislang scheiterten Pekings Pläne, da Kabul die Entscheider in Washington nicht verprellen wollte. Im Wakhan-Korridor baut Peking hingegen bereits mehrere Straßen. So würde man Xinjiang mit Afghanistan verbinden, von wo aus Waren und Güter über Pakistan nach Zentralasien – und schließlich Europa geliefert werden soll.
“Wenn es Peking gelingt, diese Verbindungen aufzubauen werden der Handel in der Region und die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen in Afghanistan drastisch zunehmen“, sagt Derek Grossman von der US-Denkfabrik Rand Corporation gegenüber China.Table. Experten zufolge soll Afghanistan über riesige Vorkommen an Seltenen Erden und weitere seltene Bodenschätze verfügen – Wert: mehr als eine Billion US-Dollar.
China hat also weitreichende Pläne für Afghanistan und die Region. Doch um all das möglich zu machen, müsste das Land am Hindukusch erst einmal stabilisiert werden. Politisch erfordert das allerdings einen schwierigen Balanceakt. “Offiziell unterstützt Peking die Aussöhnung zwischen der Zentralregierung in Kabul und den Kämpfern der Taliban”, sagt Grossmann. Doch China hat die aktuellen Entwicklungen im Blick – den Abzug des Kabul-Partners USA und den gleichzeitigen Vormarsch der Taliban – und sichert sich entsprechend ab. “Gleichzeitig signalisiert man ganz deutlich, dass man die Taliban auch als legitime Regierung anerkennen würde, sollte es soweit kommen”, ergänzt Grossman.
Diese Prognose des Fachmanns erfüllte sich am Mittwoch bei dem Traffen des Außenministers mit den Vertretern der Taliban. Wang Yi forderte die Gotteskrieger auf, sich von Terrorismus abzuwenden und zudem andere Terrorgruppen wie die East Turkistan Islamic Movement (ETIM) zu bekämpfen. Als “wichtige militärische Kraft sollten sie Verantwortung für ihr Land übernehmen, einen klaren Bruch mit allen terroristischen Kräften vollziehen und in den Mainstream der afghanischen Politik zurückkehren”, sagte Chinas Außenminister.
Die Verbindung zwischen China und den Taliban werde geostrategisch sehr relevant sein, prophezeit Grossman. China übt schon jetzt über die Shanghai Cooperation Organization (SCO) zunehmend Einfluss auf die Region aus. Es ist kein Zufall, dass Außenminister Wang vor dem Treffen mit den Taliban drei Länder Zentralasiens besuchte und die SCO-Mitglieder zu einer Sondersitzung über Afghanistan einlud.
Eine tiefere Zusammenarbeit mit den Taliban würde Pekings Position massiv aufwerten, ist sich Grossman sicher. “Sollte das gelingen, werden das Projekt der Neuen Seidenstraße wie auch Pekings selbst deklarierter Kampf gegen den Terrorismus der Uiguren enorm davon profitieren.“
Doch könnte Pekings wachsender Einfluss auch Probleme bedeuten. Die “All-Wetter-Freundschaft” mit Pakistan würde auf eine Probe gestellt, schließlich gilt Islamabad als einer der wichtigsten Unterstützer etlicher Terrororganisationen. Zudem würde auf die derzeit prächtigen Beziehungen mit Russland wohl ein erster Schatten fallen. Schließlich betrachtet sich Moskau als Nachfolger der Sowjetunion. Zentralasien wäre damit der eigene Hinterhof, in dem niemand die russische Autorität infrage stellen sollte. Und auch Indien ist angesichts der enger werdenden Verbindung zwischen China und den Taliban alarmiert.
Klar ist: Chinas Engagement in Afghanistan befindet sich an einem Wendepunkt. Rhetorisch schlug man zwar immer mal wieder große Töne an – vor allem mit Kritik an den USA wurde kaum gespart. Aber praktisch hielt sich Peking lange Zeit im Hintergrund. Das scheint sich nun mit dem Abzug der US-Truppen zu ändern. Ob mit oder ohne Taliban – China wittert seine Chance, das Vakuum, das die US-Truppen hinterlassen, für seine eigenen Interessen zu nutzen.
Wenn Xi Jinping eine “wichtige Rede” hält wie neulich zum 100. Jahrestag der KP China (China.Table berichtete), dann macht sich eine eigene Disziplin von Chinakundler:innen ans Suchen und Zählen. Welche feststehenden Phrasen hat Xi verwendet? Und: Wie oft kommen bestimmte festgelegte Schlüsselworte im Vergleich zur vorigen Rede vor?
Das Wort “Revolution” hat beispielsweise derzeit Konjunktur wie seit der Mao-Zeit nicht mehr. Es kommt zudem in besonders markigen Formulierungen vor wie: “Die Partei vereint und führt das chinesische Volk in blutigen Schlachten mit unnachgiebiger Entschlossenheit und erzielt großen Erfolg in der neudemokratischen Revolution.” Auch Aufzählungen von Begriffen haben oft eigene Bedeutungen, wie “der große Kampf, das große Projekt, die große Sache und der große Traum”.
Was klingt wie Kaffeesatzleserei, gibt in Wirklichkeit wertvollen Aufschluss über die Denkweise der chinesischen Führung. Denn das Spiel mit Begriffen und Phrasen ist tief in der Kultur der Partei verankert. “Die Sprache der KP Chinas ist höchst formalisiert”, sagte die Sinologin Marina Rudyak von der Universität Heidelberg am Montag in einem Vortrag am Konfuzius-Institut Leipzig. Rudyak gehört den Peking-Watchern, die sich auf professioneller Ebene auf das Spiel mit den Phrasen und Begriffen einlassen. “Durch Vorgabe der Formulierungen wird reguliert, was getan wird.” Sie beeinflussen dadurch die Realität.
Die Erforschung des Parteichinesisch der KP China lohnt sich derzeit wieder besonders. Xi Jinping sagt kein Wort spontan. Sprachliche Ausrutscher, wie sie westlichen Politiker:innen immer wieder passieren, gibt es bei ihm nicht. Seine Worte, so schräg sie zuweilen klingen mögen, haben alle eine definierte Bedeutung. Die Kader lernen diese Sprache an den Parteischulen und verstehen sie. Die Phrasen beziehen sich aufeinander und bilden ein eigenes Bedeutungsgeflecht.
Xi Jinping kann sich spontane Äußerungen schon deshalb nicht leisten, weil 90 Millionen Parteimitglieder bis in die feinsten Abstufungen hinein hinhören. Dazu kommen Sinolog:innen und Nachrichtenagenturen rund um den Globus, die sich ebenfalls ihren Reim darauf machen wollen. Die Variation einer Phrase – oder ihre Neueinführung – signalisiert nicht selten einen Politikwechsel. Das kann Strategieabteilungen in Aufruhr versetzen und die Aktienmärkte bewegen. Wenn Xi beispielsweise einen “größeren Beitrag zur Menschheitsgeschichte” ankündigt, gilt das schnell als “Abkehr von der Politik, den Ball flach zu halten”.
Beobachter:innen wie Rudyak müssen daher wachsam sein. Die meisten Reden bestehen zum großen Teil aus der immergleichen Wiederholung etablierter Phrasen, zwischen denen sich die kleinen Änderungen verbergen. Xi hat das Repertoire zwar früh in seiner Amtszeit ausgewechselt, doch seitdem hält er im Wesentlichen an einer Reihe von Grundbegriffen fest, die er immer wiederholt. Das sind zum Beispiel:
Die Liste ließe sich lang fortsetzen. Fast jedes Wort einer typischen Xi-Rede lässt sich seinem Standard-Bestand an Phrasen zuordnen. Auf Chinesisch heißen diese Wortkombinationen “Tifa” 提法: “Ausdrucksweisen, an denen festzuhalten ist”. Wer die wichtigsten Tifa kennt, findet sie praktisch in jeder Äußerung der KP China wieder.
Etwas perfide wirkt aus westlicher Sicht der Umgang mit politischen Grundbegriffen wie “Demokratie” oder “Kooperation”. Es handelt sich dabei um Tifa, unter denen Chinas Führer ganz andere Dinge verstehen als ihre westlichen Gesprächspartner. Klar: In verschiedenen Sprachen sind Begriffe nie ganz deckungsgleich, selbst wenn der eine als Übersetzung für den anderen verwendet wird. Es gibt allerdings anerkannte Definitionen von Demokratie. Mit denen hat die Verwendung des Wortes Minzhu 民主 in der KP-Sprache allerdings weniger und weniger zu tun.
Besonders kritisch sieht es Rudyak daher, wenn Persönlichkeiten aus anderen Ländern den chinesischen Sprachgebrauch übernehmen, ohne ihn zu hinterfragen. Als Beispiel nennt sie Klaus Schwab vom Weltwirtschaftsforum (World Economic Forum WEF), also der Davos-Konferenz. Schwab hat die Phrase von der “Schicksalsgemeinschaft der Menschheit” mehrfach aufgegriffen. Dabei handelt es sich um einen Lieblingsbegriff von Xi Jinping. Die offizielle deutsche Version ist eine direkte Wiedergabe von 人类命运共同体 rénlèi mìngyùn gòngtóngtǐ. Zu Schwabs Entschuldigung: Die englische Version “community with shared future for mankind” klingt ohne das schwere Wort “Schicksal”, dafür mit “Zukunft”, etwas neutraler.
Dennoch lässt sich bloß hoffen, dass Schwab weiß, was er da wiederholt. Der Begriff von der Schicksalsgemeinschaft deutet den Willen an, die westlich geprägte Ordnung durch ein chinesisches Modell von Beziehungen zu ersetzen. Daraus ergibt sich, dass die Erklärung der Menschenrechte nicht unbedingt die Basis dieser Beziehungen sein muss. Die chinesischen Staatsmedien berichten es jedenfalls immer groß, wenn Xi Jinping auch auf internationaler Bühne seinen Sprachgebrauch durchgesetzt hat.
Mit seinen ganz eigenen Begriffen macht Xi also auch international Politik. “Xiplomacy” heißt sein Stil bereits, und Sinologin Rudyak warnt davor, seinen Phrasen auf den Leim zu gehen und sich von schönen Worten einlullen zu lassen. “Die unterschiedlichen Definitionen sind den Akteuren meist nicht bewusst”, beobachtet. “Dabei sollte gerade bei so zentralen Begriffen Einigung herrschen.” Auch wenn es für westliche Politiker einfach ist, es erfreut abzuhaken, wenn Xi eine Stärkung von Demokratie, Rechtsstaat und Reformen ankündigt – er meint damit immer nur eine Stärkung des eigenen Systems:
Der Ursprung dieser besonderen Sprachkultur liegt in der Sowjetunion. In der Berichterstattung der Staatszeitungen spielte es schon eine Rolle, ob der “erste Sekretär” nicht doch als “Erster Sekretär” mit großem “E” geschrieben wurde. Um die Tifa zu verstehen, sind also nicht nur Mandarin-Kenntnisse nötig, sondern Kenntnis der besonderen KP-Codes. Uneingeweihte Chines:innen können diese Sprache ebenfalls nicht ohne Weiteres entschlüsseln. Für sie handelt es sich aber immerhin um den vertrauten politischen Wortteppich, mit dem sie aufgewachsen sind. Tatsächlich kann jedoch heutzutage auch im Westen jeder zum Eingeweihten werden: Die Staatsmedien bieten offizielle Erklärungen und Übersetzungen für die wichtigsten der wiederkehrenden Sprüche an.
Der Technikkonzern Huawei hat einen hochrangigen Manager entlassen, weil dieser Zweifel an der Sicherheit selbstfahrender Autos geäußert hat. Su Qing hat Anfang des Monats in Shanghai auf einer Veranstaltung auf die zahlreichen Unfälle beim Konkurrenten Tesla hingewiesen; wenn die KI übernehme, seien Ereignisse mit Todesfolge unvermeidlich. Der chinesische Technikkonzern fand diese Äußerungen für einen Mitarbeiter aus dem Bereich intelligenter Mobilitätslösungen inakzeptabel, berichtet Caixin.
Der Auftritt Sus hatte auf Sozialmedien die Runde gemacht. In der Überschrift des Weibo-Beitrags wurde die hohe Rate an tödlichen Unfällen bei Tesla mit “Mord” verglichen. In diese Richtung ging auch die Diskussion über das Video. Damit greift ein Huawei-Vertreter nicht nur in aller Öffentlichkeit einen Konkurrenten an, sondern weckt auch generell Zweifel an der Sicherheit der Computersteuerung für Fahrzeuge. Huawei hat bereits eine Milliarde Dollar in Technik für selbstfahrende Autos investiert. fin
Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen hat die Bevölkerung aufgefordert, sich mit dem heimisch hergestellten Corona-Impfstoff Medigen immunisieren zu lassen. Sie werde sich selbst mit dem Vakzin impfen lassen, teilte Tsai am Mittwoch in sozialen Netzwerken mit. Medigen und alle anderen in Taiwan erhältliche Corona-Impfstoffe seien sicher und wirksam, schrieb die Präsidentin.
Der Impfstoff von Medigen war am Dienstag zu den verfügbaren Optionen im Covid-Impfregistrierungssystem des Landes hinzugefügt worden. Medigen ist derzeit nur für Erwachsene ab 20 Jahren zugelassen, das Vakzin hat am 17. Juli eine Notzulassung in Taiwan bekommen. Für eine Immunisierung mit Medigen sind zwei Dosen notwendig.
Nach einer Spende von rund sechs Millionen Impfdosen aus Japan und den USA sowie kleineren Spenden aus EU-Ländern hat Taiwan seine Impfkampagne deutlich ausgeweitet. Etwa 20 Prozent der 23,5 Millionen Einwohner haben mindestens einen der zwei Impfdosen erhalten, wie lokale Medien berichteten. ari
Der einflussreiche Agrarunternehmer und Milliardär Sun Dawu ist zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden. Die Justiz in Gaobeidian sprach den 67-Jährigen am Mittwoch unter anderem wegen “Versammlung einer Menschenmenge zum Angriff auf Staatsorgane” sowie “Behinderung der Verwaltung” und “Aufwiegelung” schuldig und verurteilte ihn zu 18 Jahren Haft, wie die Nachrichtenagentur AP berichtete. Sun Dawu war demnach im vergangenen November zusammen mit Geschäftspartnern festgenommen worden, nachdem sein Unternehmen Dawu Agriculture Group in einen Landstreit mit einem staatlichen Konkurrenten verwickelt war. Die Festnahme war erfolgt, nachdem Mitarbeiter von Dawu im August 2020 versucht hatten, ein staatliches Unternehmen daran zu hindern, ein Firmengebäude abzureißen.
Dem Bericht zufolge hatte der Prozess gegen den Unternehmer im Geheimen begonnen. Sun wurde demnach auch zu einer Geldstrafe in Höhe von 3,1 Millionen Yuan (480.000 US-Dollar) verurteilt. Neben ihm seien weitere Personen zu Strafen zwischen einem und zwölf Jahren Gefängnis verurteilt worden.
Der Unternehmer und Schweinezüchter wurde 2003 landesweit bekannt, als er wegen “illegaler Spendensammlung” angeklagt wurde, nachdem er Freunde und Nachbarn um Investitionen für sein Geschäft gebeten hatte. Der Fall löste eine Welle öffentlicher Unterstützung für Sun Dawu aus. Seither lobte Sun mehrfach öffentlich Anwälte, die Menschen in Prozessen gegen den Staat vertreten. Suns Anwalt im Fall von 2003, Xu Zhiyong, verschwand dem Bericht zufolge im Februar 2020. Aktivistenkollegen sagten demnach, Xu sei des Hochverrats angeklagt worden. ari
Die erhöhten Spannungen zwischen den USA und China haben die Aussichten auf eine tiefe, weltweite technologische Kluft erhöht, die andere Länder potenziell zwingen könnte, sich für ein Lager zu entscheiden. Es gibt eine Menge düsterer Szenarien, bei denen es um eine unüberbrückbare Spaltung bei Schlüsseltechnologien geht, die ein breites Spektrum von Produkten und Dienstleistungen antreiben: von Flugzeugen und Autos bis hin zur Präzisionstechnologie im Bereich der Robotik und zu Zahlungssystemen für den elektronischen Handel. Falls sich diese Szenarien verwirklichen, werden die beiden weltgrößten Volkswirtschaften enorme Mengen an Ressourcen für einen Nullsummen-Wettlauf aufwenden, um Spitzentechnologien zu kontrollieren.
Sowohl den USA als auch China ist die zentrale Rolle der Technologie als Treiber ihrer Volkswirtschaften und der globalen Entwicklung bewusst. Sie wissen auch, dass die Beherrschung dieser Technologien und der Schutz des betreffenden geistigen Eigentums ihre nationale Sicherheit und ihren geopolitischen Einfluss stärken können – mit wichtigen Rückkopplungseffekten für ihr nachhaltiges Wachstum und ihre bleibende Resilienz.
Mittelfristig stehen die lange Dominanz der USA bei den Natur- und Ingenieurswissenschaften sowie ihre Fähigkeit zur Produktion wichtiger Komponenten stark infrage. Ein Beispiel: Obwohl die US-Unternehmen hochmoderne Halbleiter entwickeln, ist Amerikas Anteil an der weltweiten Produktion von 37 Prozent im Jahr 1990 auf lediglich 12 Prozent heute zurückgegangen.
Derweil ist China trotz aller Fortschritte bei vielen Produkten, wie etwa Computerchips und Flugzeugen, noch ein ganzes Stück vom Stand des technisch Machbaren entfernt. Zwar hat das Land bei vielen Fertigungsarten ein Ökosystem von beträchtlicher Tiefe entwickelt, und es ist in außergewöhnlicher Weise in der Lage, schnell und großmaßstäblich zu produzieren. Auch in den globalen Rankings für Patente und Forschungs- und Entwicklungsausgaben steht es weit oben. Doch ist China in vielen Bereichen anfällig. Es importiert jährlich Halbleiter im Wert von 300 Milliarden Dollar, davon rund die Hälfte für die Exportfertigung. Darüber hinaus werden für viele mit Waren verknüpfte Dienstleistungen, z. B. für in Smartphones integrierte Apps, Halbleiter benötigt.
Andere hoch entwickelte Volkswirtschaften mit der Fähigkeit zur Entwicklung oder Herstellung wichtiger Komponenten in den Halbleiter-Lieferketten, darunter Japan, Südkorea, Taiwan und die Niederlande, sind bei den Spannungen zwischen den USA und China zwischen die Fronten geraten. Für diese Länder werden neben wirtschaftlichen unweigerlich auch geopolitische Gesichtspunkte eine Rolle spielen, was sorgfältige Kalkulationen erfordert.
Das mittelfristig wahrscheinlichste Ergebnis ist angesichts der Bemühungen vieler Länder zur Verringerung ihrer Anfälligkeiten eine technologische Auseinanderentwicklung, die sich freilich in Grenzen halten wird. Mehrere US-Unternehmen bauen derzeit leistungsstarke Halbleiterfabriken, während China globale Talente rekrutiert und seine Forschung und Entwicklung im Halbleiterbereich sowie bei der zur Produktion von Halbleitern erforderlichen Software, Maschinerie und Ausrüstung verstärkt.
Andere Länder verfolgen derweil unterschiedliche Alternativen. Hierzu gehören der Abschluss von Bündnissen, um ihre Versorgung mit wichtigen Komponenten sicherzustellen, die Ausweitung ihrer Fähigkeit, eine Interoperabilität zwischen unterschiedlichen technologischen Standards zu erreichen, und die Stärkung ihres Angebots an technisch ausgereifteren Produkten und Dienstleistungen gegenüber den Weltmärkten und damit ihrer Verhandlungspositionen gegenüber den USA und China.
Längerfristig jedoch muss die Welt ehrgeiziger sein und die multilateralen Bemühungen zur Stärkung der globalen Kooperation im Technologiebereich ausweiten. Die entwickelten Volkswirtschaften und auch die Schwellenländer sollten daher mit technologischen Spannungen verbundene Fragen in einem breiteren Kontext fassen.
Zunächst einmal sollten sie sich erinnern, dass die wirtschaftliche Öffnung Wachstum und Wohlstand enorm gesteigert hat. In Asien wird dies durch die rasche wirtschaftliche Entwicklung Festlandschinas unter Beweis gestellt. Südkorea, Singapur, Taiwan und Hongkong haben es, obwohl sie kaum oder gar nicht über eigene Rohstoffvorkommen verfügen, ebenfalls geschafft, sich zu industrialisieren und zu modernisieren – teilweise dank der Globalisierung. Und eine wachsende Zahl von Entwicklungs- und Schwellenländern in Afrika, Lateinamerika und Europa bewegen sich die Einkommensleiter hinauf, indem sie Nischen erschließen und sich an globalen Wertschöpfungsketten beteiligen.
Darüber hinaus kann sich keine Volkswirtschaft – egal, wie groß oder hoch entwickelt sie ist – der Globalisierung entziehen und sicherstellen, dass sie immer die Spitzenposition bei allen Hightech-Produkten innehaben, sicher mit wichtigen Komponenten versorgt sein und zum Betrieb eines exponentiell wachsenden Netzes aus komplexen Produktionsprozessen in der Lage sein wird. Auch hierfür sind Halbleiter ein Paradebeispiel: Ihre Produktionskette ist außergewöhnlich komplex und stützt sich auf hunderte von Vorprodukten, die mittels hoch technisierter, aus aller Welt beschaffter Hilfsmittel verarbeitet und produziert werden. In diesem Sektor auch nur einen Fuß in die Tür zu bekommen erfordert enorme Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen und lange Vorlaufzeiten.
Zwar stimmt es, dass ein Land seine Anfälligkeit gegenüber ungünstigen äußeren Entwicklungen verringern kann. Doch könnten die Kosten dafür immens sein, insbesondere wenn das Ziel darin besteht, bei möglichst vielen technologischen Produkten völlig autark und kosteneffizient zu sein.
Angesichts dieser Beschränkungen sollten Länder das Ziel einer auf multilateralen Übereinkünften beruhenden Globalisierung verfolgen. Eine Priorität sollte es sein, technologische Fortschritte schneller und weiter unter entwickelten Volkswirtschaften und Schwellenmärkten zu verbreiten, um deren Anfälligkeiten zu reduzieren und mehr neue, aufstrebende Volkswirtschaften in die Lage zu versetzen, Fortschritte zu erzielen – und zwar auch durch Technologietransfer. Die politischen Entscheidungsträger sollten zudem die Reichweite ihrer Handels- und Investitionsabkommen ausweiten, um die Interessen von Unternehmen, Arbeitnehmern und Ländern zu schützen und zugleich die negativen externen Folgen des Protektionismus zu minimieren. Dies könnte u. a. die Erweiterung von Freihandelsverträgen um spezielle Kapitel zu Technologiefragen und Anhänge zum Schutz der Rechte einkommensschwacher und schutzbedürftiger Arbeitnehmer umfassen.
Derartige Entwicklungen werden sich nicht spontan entfalten. Doch ist der Unternehmenssektor womöglich in der Lage, einen konstruktiven Weg voran zu finden, ohne die nationalen Sicherheitsinteressen zu untergraben. So haben etwa im Mai die Branchenverbände der Halbleiterindustrie Chinas und der USA erklärt, dass sie eine gemeinsame Arbeitsgruppe ins Leben rufen werden. Vertreter von zehn Chipunternehmen aus jedem Land werden sich zweimal jährlich treffen, um Fragen wie Exportbeschränkungen, die Sicherheit der Lieferketten und Verschlüsselungstechnologien zu diskutieren.
Die von den USA und China verfolgte Politik wird natürlich eine Schlüsselrolle bei der Vermeidung einer bedeutenden technologischen Spaltung spielen. Doch indem sie sich aus dem chinesisch-amerikanischen Konflikt heraushält, kann die übrige Welt dazu beitragen, die Entwicklung eines neuen, vertrauensbasierten Konsenses auf Basis einer gemeinsamen Vision gemeinschaftlichen technologischen Fortschritts voranzutreiben.
Hoe Ee Khor ist Chefökonom des ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO). Suan Yong Foo ist leitender Ökonom bei AMRO. Aus dem Englischen von Jan Doolan.
Copyright: Project Syndicate, 2021.
www.project-syndicate.org
Daniel Diehl ist bei Bosch jetzt Project Lead für den Einkauf von Elektronik mit Fokus auf China. Er übt diese Tätigkeit am Standort Pfullingen aus. Zuvor war er Project Manager im Bereich Halbleiteroperationen.
Philipp Breuer hat bei Audi in Ingolstadt die Kontrolle über die Portfolio-Strategie für China übernommen. Er analysiert für den Konzern strategische Einflussfaktoren in der Region und das Wettbewerbsumfeld.
Joerg Ziegler ist bei BASF zum Director Materials Management für die New Verbund Site in Guangdong geworden. Sein Dienstsitz befindet sich am Konzernhauptquartier in Ludwigshafen.
Wolfgang Lamprecht ist jetzt bei ZF Asia Pacific der Head of Product Line Chassis Systems für die Region China. Sein Büro befindet sich in Shanghai.

Großkatzen-Pool: Sibirische Tiger tummeln sich hier an einem Wasserbecken im Waldpark des Hengdaohezi Feline Breeding Center in der nordostchinesischen Provinz Heilongjiang. Die Einrichtung ist das weltweit größte Zuchtzentrum für Sibirische Tiger. Dort leben etwa 400 Großkatzen auf 40.000 Quadratmetern. In diesem Jahr wurden bisher 30 Tigerbabys im Park geboren. Die Tiere werden dort trainiert oder auf die Auswilderung vorbereitet.
die USA verlassen das Land durch die Vordertür – China kommt durch die Hintertür herein. Ganz so simpel ist die Lage in Afghanistan dann zwar doch nicht. Doch der US-Truppenabzug läuft noch, da trifft sich Außenminister Wang bereits mit einer Abordnung der Taliban. Auf der Negativseite macht er die gefürchteten Gotteskrieger damit salonfähig, auf der Positivseite wirkt er auf sie ein, sich der afghanischen Regierung unterzuordnen. Chinas Präsenz kann durchaus viel Gutes bewirken. Die neue Großmacht kommt mit einem anderen Ansatz als die Intervention der westlichen Allianz: Sie erkennt die Realität im Land an, statt von schönen Theorien auszugehen.
Wang betonte bei dem Treffen, China werde sie nie in die “inneren Angelegenheiten Afghanistans einmischen”. Eine bekannte Phrase, schließlich verlangt China die “Nichteinmischung” in seine Angelegenheiten gebetsmühlenartig von westlichen Ländern. Es handelt sich dabei um eine klassische “Tifa”, eine feststehende Wendung, die im Sprachgebrauch der chinesischen KP eine besondere Bedeutung hat. In der Kommunikation der Führung tauchen die gleichen Tifa immer wieder auf. Wir geben Ihnen in dieser Ausgabe eine kleine Einführung in die Kunst, Chinas politische Phrasen zu dekodieren. Wer einigermaßen geübt darin ist, kann sogar aus Parteitagsreden der KP ein gewisses Vergnügen ziehen. Es ließe sich sogar Tifa-Bingo spielen, denn Wortkombinationen wie die “drei kritischen Kämpfe” oder “das Konzept der fünf Entwicklungen” kommen garantiert vor.

Der Rückzug der Amerikaner aus Afghanistan läuft. Bis Ende August sollen alle US-Truppen aus dem Land am Hindukusch abgezogen sein. So will es US-Präsident Joe Biden.
Doch je weniger US-amerikanische Truppen im Land sind, desto stärker werden die im Land verbreiteten Terrorgruppen – allen voran die islamistischen Taliban. Die selbsternannten Gotteskrieger befinden sich auf dem Vormarsch. Region für Region, Bezirk um Bezirk erobern sie das Territorium von der Zentralregierung in Kabul zurück. Allein in den vergangenen zwei Monaten sollen 120 Bezirke in ihre Hände gefallen sein, darunter zuletzt auch der für China strategisch so wichtige Bezirk Wakhan in der Provinz Badakhshan. Die Taliban selbst behaupten, schon 75 Prozent des Landes unter Kontrolle zu haben. Das mag aus Propagandagründen übertrieben sein, doch fest steht: Der vergangene Monat war der tödlichste seit zwei Jahrzehnten.
Unsicherheit, Gewalt und Instabilität breiten sich aus. Und in Afghanistans Nachbarländern wächst die Sorge, all das könne sich über die Landesgrenzen hinaus ausbreiten. Vor allem in Peking wird man unruhig. “Der eigenmächtige Abzug der Amerikaner hinterlässt nur Instabilität, Chaos und Desaster”, urteilt Wang Jin, Professor an der Nordwest-Universität in Xi’an. Es handele sich um einen vollkommen unverantwortlichen Vorgang, die angrenzenden Staaten müssten das alles nun ausbaden und versuchen, die Situation in den Griff zu bekommen. Allen voran China.
Am Mittwoch traf sich denn auch Chinas Außenminister Wang Yi in Tianjin mit einer Delegation der Taliban unter Führung von Mullah Abdul Ghani Baradar. Wie wichtig China der Vorgang offenkundig ist, zeigt ein Blick zurück zum Anfang der Woche: Am Montag war noch die stellvertretende US-Außenministerin Wendy Sherman in Tianjin (China.Table berichtete). Kaum war die Amerikanerin wieder weg, kümmerte sich Wang persönlich um die Taliban.
Es sei nun wichtig, Stabilität und Sicherheit nach Afghanistan zu bringen, um die Ausbreitung von Gewalt über die Grenzen hinweg zu verhindern. “Dabei wird China eine sehr wichtige und konstruktive Rolle spielen“, kündigte Wang selbstbewusst an.
Dabei stellt der Vormarsch der Taliban vielleicht gar kein so großes Problem dar für Peking. Was für Kabul, die Amerikaner und ihre westlichen Verbündeten wahre Schreckensmeldungen sind, muss die China nicht sonderlich beunruhigen, meint Vanda Felbab-Brown. “Die Volkrepublik arbeitet seit Jahren daran, gute Beziehungen zu den Taliban aufzubauen”, sagt die Sicherheitsexpertin der Brookings Institution in Washington im Gespräch mit China.Table. Über verdeckte Kanäle habe Peking die Gotteskrieger regelrecht hofiert, Felbab-Brown spricht von einer “wine-and-dine”-Strategie. Offensichtlich mit Erfolg.
In einem Interview mit dem Newsletter “This Week in Asia” nannte der Sprecher der Taliban die China gar einen Freund. Man hoffe, dass die Volksrepublik sich am Wiederaufbau und der Entwicklung Afghanistans beteiligen werde. “Sollten die Chinesen hier investieren, werden wir natürlich auch ihre Sicherheit garantierten”, sagte Suhail Shaheen. Was der Taliban-Sprecher dann noch zu sagen hatte, wird in Peking mit besonderer Freunde vernommen worden sein. “Wir sorgen uns um die Unterdrückung von Muslimen, sei es in Palästina, in Myanmar oder in China. Aber wir werden uns nicht in die inneren Angelegenheiten Chinas einmischen“, versprach Shaheen. Mehr noch: Zukünftig werde man uigurischen Separatisten nicht mehr einen Rückzug nach Afghanistan erlauben.
Was Chinas Sicherheitsexperten bereits seit langem im Hintergrund vorbereiten, wird nun öffentlich zur Sprache gebracht. “All diese Äußerungen zeigen doch eindeutig, dass die Taliban sich langsam zu einer politischen Organisation entwickeln, die sich auf die Entwicklung Afghanistans konzentriert und sich vorbereitet, die Macht zu übernehmen”, sagt Cao Wei von der Lanzhou Universität gegenüber der Zeitung Global Times. Es scheint, als wollte China die Taliban salonfähig machen.
Vor diesem Hintergrund wird schnell klar, dass Peking weniger über die Sicherheitslage im gesamten Land besorgt ist als vielmehr im Wakhan-Korridor. Dieser schmale Landstrich befindet sich in der Provinz Badakhshan im Nordosten Afghanistans; für China es ist die strategisch wichtigste Region des Landes, schließlich verbindet jener schmale Korridor die chinesische Provinz Xinjiang mit Afghanistan.
Doch einem UN-Bericht zufolge sind just in dieser Region mehrere Hundert uigurische Kämpfer aktiv. Vor einigen Jahren wollte China deshalb in der Provinz Badakhshan eine eigene Militärbasis errichten. Doch die Pläne scheiterten – letztendlich wohl auch, weil die Regierung in Kabul die anwesenden US-Truppen nicht verprellen wollte, erklärt Sicherheitsexpertin Felbab-Brown.
Nach dem Abzug der Taliban will Peking vor allem verhindern, dass uigurische Extremisten, die seit Jahren auf Seiten der Taliban kämpfen, in Afghanistan ein sicheres Rückzugsgebiet finden. Denn immer wieder kommt es zu Anschlägen in China oder auf chinesische Ziele in der Region. Erst vor zwei Wochen wurden bei einem Anschlag auf einen Bus im Nordwesten Pakistans 13 Menschen getötet, darunter neun Chinesen. Der Bus sollte chinesische Ingenieure, Sachverständige und anderes Personal zur Baustelle des Dasu-Staudamms in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa bringen.
Afghanistan-Experte Cao Wei glaubt, dass die Sicherung der gemeinsamen Grenze mit Afghanistan eine lösbare Aufgabe darstelle. Sie ist lediglich rund 90 Kilometer lang und besteht vorwiegend aus unwegsamen Bergen. Notfalls könnte dieser kurze Abschnitt schlicht blockiert werden. China werde jedenfalls nicht die gleichen Fehler begehen, die in der Vergangenheit schon etliche Großmächte wie das britische Empire, die Sowjetunion und zuletzt die USA begangen haben: Truppen nach Afghanistan schicken. “China wird das Prinzip der Nichteinmischung in innere Angelegenheiten hochhalten. Wir werden uns auf die wirtschaftliche Entwicklung des Landes konzentrieren und uns nicht militärisch in Afghanistan engagieren”, sagt Cao.
Wirtschaftlich versucht China schon seit einiger Zeit, Afghanistan in sein Prestige-Projekt der Neuen Seidenstraße einzubinden. Eine Autobahn Peshawar-Kabul würde eine wichtige Lücke in dem Infrastrukturprojekt schließen, doch bislang scheiterten Pekings Pläne, da Kabul die Entscheider in Washington nicht verprellen wollte. Im Wakhan-Korridor baut Peking hingegen bereits mehrere Straßen. So würde man Xinjiang mit Afghanistan verbinden, von wo aus Waren und Güter über Pakistan nach Zentralasien – und schließlich Europa geliefert werden soll.
“Wenn es Peking gelingt, diese Verbindungen aufzubauen werden der Handel in der Region und die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen in Afghanistan drastisch zunehmen“, sagt Derek Grossman von der US-Denkfabrik Rand Corporation gegenüber China.Table. Experten zufolge soll Afghanistan über riesige Vorkommen an Seltenen Erden und weitere seltene Bodenschätze verfügen – Wert: mehr als eine Billion US-Dollar.
China hat also weitreichende Pläne für Afghanistan und die Region. Doch um all das möglich zu machen, müsste das Land am Hindukusch erst einmal stabilisiert werden. Politisch erfordert das allerdings einen schwierigen Balanceakt. “Offiziell unterstützt Peking die Aussöhnung zwischen der Zentralregierung in Kabul und den Kämpfern der Taliban”, sagt Grossmann. Doch China hat die aktuellen Entwicklungen im Blick – den Abzug des Kabul-Partners USA und den gleichzeitigen Vormarsch der Taliban – und sichert sich entsprechend ab. “Gleichzeitig signalisiert man ganz deutlich, dass man die Taliban auch als legitime Regierung anerkennen würde, sollte es soweit kommen”, ergänzt Grossman.
Diese Prognose des Fachmanns erfüllte sich am Mittwoch bei dem Traffen des Außenministers mit den Vertretern der Taliban. Wang Yi forderte die Gotteskrieger auf, sich von Terrorismus abzuwenden und zudem andere Terrorgruppen wie die East Turkistan Islamic Movement (ETIM) zu bekämpfen. Als “wichtige militärische Kraft sollten sie Verantwortung für ihr Land übernehmen, einen klaren Bruch mit allen terroristischen Kräften vollziehen und in den Mainstream der afghanischen Politik zurückkehren”, sagte Chinas Außenminister.
Die Verbindung zwischen China und den Taliban werde geostrategisch sehr relevant sein, prophezeit Grossman. China übt schon jetzt über die Shanghai Cooperation Organization (SCO) zunehmend Einfluss auf die Region aus. Es ist kein Zufall, dass Außenminister Wang vor dem Treffen mit den Taliban drei Länder Zentralasiens besuchte und die SCO-Mitglieder zu einer Sondersitzung über Afghanistan einlud.
Eine tiefere Zusammenarbeit mit den Taliban würde Pekings Position massiv aufwerten, ist sich Grossman sicher. “Sollte das gelingen, werden das Projekt der Neuen Seidenstraße wie auch Pekings selbst deklarierter Kampf gegen den Terrorismus der Uiguren enorm davon profitieren.“
Doch könnte Pekings wachsender Einfluss auch Probleme bedeuten. Die “All-Wetter-Freundschaft” mit Pakistan würde auf eine Probe gestellt, schließlich gilt Islamabad als einer der wichtigsten Unterstützer etlicher Terrororganisationen. Zudem würde auf die derzeit prächtigen Beziehungen mit Russland wohl ein erster Schatten fallen. Schließlich betrachtet sich Moskau als Nachfolger der Sowjetunion. Zentralasien wäre damit der eigene Hinterhof, in dem niemand die russische Autorität infrage stellen sollte. Und auch Indien ist angesichts der enger werdenden Verbindung zwischen China und den Taliban alarmiert.
Klar ist: Chinas Engagement in Afghanistan befindet sich an einem Wendepunkt. Rhetorisch schlug man zwar immer mal wieder große Töne an – vor allem mit Kritik an den USA wurde kaum gespart. Aber praktisch hielt sich Peking lange Zeit im Hintergrund. Das scheint sich nun mit dem Abzug der US-Truppen zu ändern. Ob mit oder ohne Taliban – China wittert seine Chance, das Vakuum, das die US-Truppen hinterlassen, für seine eigenen Interessen zu nutzen.
Wenn Xi Jinping eine “wichtige Rede” hält wie neulich zum 100. Jahrestag der KP China (China.Table berichtete), dann macht sich eine eigene Disziplin von Chinakundler:innen ans Suchen und Zählen. Welche feststehenden Phrasen hat Xi verwendet? Und: Wie oft kommen bestimmte festgelegte Schlüsselworte im Vergleich zur vorigen Rede vor?
Das Wort “Revolution” hat beispielsweise derzeit Konjunktur wie seit der Mao-Zeit nicht mehr. Es kommt zudem in besonders markigen Formulierungen vor wie: “Die Partei vereint und führt das chinesische Volk in blutigen Schlachten mit unnachgiebiger Entschlossenheit und erzielt großen Erfolg in der neudemokratischen Revolution.” Auch Aufzählungen von Begriffen haben oft eigene Bedeutungen, wie “der große Kampf, das große Projekt, die große Sache und der große Traum”.
Was klingt wie Kaffeesatzleserei, gibt in Wirklichkeit wertvollen Aufschluss über die Denkweise der chinesischen Führung. Denn das Spiel mit Begriffen und Phrasen ist tief in der Kultur der Partei verankert. “Die Sprache der KP Chinas ist höchst formalisiert”, sagte die Sinologin Marina Rudyak von der Universität Heidelberg am Montag in einem Vortrag am Konfuzius-Institut Leipzig. Rudyak gehört den Peking-Watchern, die sich auf professioneller Ebene auf das Spiel mit den Phrasen und Begriffen einlassen. “Durch Vorgabe der Formulierungen wird reguliert, was getan wird.” Sie beeinflussen dadurch die Realität.
Die Erforschung des Parteichinesisch der KP China lohnt sich derzeit wieder besonders. Xi Jinping sagt kein Wort spontan. Sprachliche Ausrutscher, wie sie westlichen Politiker:innen immer wieder passieren, gibt es bei ihm nicht. Seine Worte, so schräg sie zuweilen klingen mögen, haben alle eine definierte Bedeutung. Die Kader lernen diese Sprache an den Parteischulen und verstehen sie. Die Phrasen beziehen sich aufeinander und bilden ein eigenes Bedeutungsgeflecht.
Xi Jinping kann sich spontane Äußerungen schon deshalb nicht leisten, weil 90 Millionen Parteimitglieder bis in die feinsten Abstufungen hinein hinhören. Dazu kommen Sinolog:innen und Nachrichtenagenturen rund um den Globus, die sich ebenfalls ihren Reim darauf machen wollen. Die Variation einer Phrase – oder ihre Neueinführung – signalisiert nicht selten einen Politikwechsel. Das kann Strategieabteilungen in Aufruhr versetzen und die Aktienmärkte bewegen. Wenn Xi beispielsweise einen “größeren Beitrag zur Menschheitsgeschichte” ankündigt, gilt das schnell als “Abkehr von der Politik, den Ball flach zu halten”.
Beobachter:innen wie Rudyak müssen daher wachsam sein. Die meisten Reden bestehen zum großen Teil aus der immergleichen Wiederholung etablierter Phrasen, zwischen denen sich die kleinen Änderungen verbergen. Xi hat das Repertoire zwar früh in seiner Amtszeit ausgewechselt, doch seitdem hält er im Wesentlichen an einer Reihe von Grundbegriffen fest, die er immer wiederholt. Das sind zum Beispiel:
Die Liste ließe sich lang fortsetzen. Fast jedes Wort einer typischen Xi-Rede lässt sich seinem Standard-Bestand an Phrasen zuordnen. Auf Chinesisch heißen diese Wortkombinationen “Tifa” 提法: “Ausdrucksweisen, an denen festzuhalten ist”. Wer die wichtigsten Tifa kennt, findet sie praktisch in jeder Äußerung der KP China wieder.
Etwas perfide wirkt aus westlicher Sicht der Umgang mit politischen Grundbegriffen wie “Demokratie” oder “Kooperation”. Es handelt sich dabei um Tifa, unter denen Chinas Führer ganz andere Dinge verstehen als ihre westlichen Gesprächspartner. Klar: In verschiedenen Sprachen sind Begriffe nie ganz deckungsgleich, selbst wenn der eine als Übersetzung für den anderen verwendet wird. Es gibt allerdings anerkannte Definitionen von Demokratie. Mit denen hat die Verwendung des Wortes Minzhu 民主 in der KP-Sprache allerdings weniger und weniger zu tun.
Besonders kritisch sieht es Rudyak daher, wenn Persönlichkeiten aus anderen Ländern den chinesischen Sprachgebrauch übernehmen, ohne ihn zu hinterfragen. Als Beispiel nennt sie Klaus Schwab vom Weltwirtschaftsforum (World Economic Forum WEF), also der Davos-Konferenz. Schwab hat die Phrase von der “Schicksalsgemeinschaft der Menschheit” mehrfach aufgegriffen. Dabei handelt es sich um einen Lieblingsbegriff von Xi Jinping. Die offizielle deutsche Version ist eine direkte Wiedergabe von 人类命运共同体 rénlèi mìngyùn gòngtóngtǐ. Zu Schwabs Entschuldigung: Die englische Version “community with shared future for mankind” klingt ohne das schwere Wort “Schicksal”, dafür mit “Zukunft”, etwas neutraler.
Dennoch lässt sich bloß hoffen, dass Schwab weiß, was er da wiederholt. Der Begriff von der Schicksalsgemeinschaft deutet den Willen an, die westlich geprägte Ordnung durch ein chinesisches Modell von Beziehungen zu ersetzen. Daraus ergibt sich, dass die Erklärung der Menschenrechte nicht unbedingt die Basis dieser Beziehungen sein muss. Die chinesischen Staatsmedien berichten es jedenfalls immer groß, wenn Xi Jinping auch auf internationaler Bühne seinen Sprachgebrauch durchgesetzt hat.
Mit seinen ganz eigenen Begriffen macht Xi also auch international Politik. “Xiplomacy” heißt sein Stil bereits, und Sinologin Rudyak warnt davor, seinen Phrasen auf den Leim zu gehen und sich von schönen Worten einlullen zu lassen. “Die unterschiedlichen Definitionen sind den Akteuren meist nicht bewusst”, beobachtet. “Dabei sollte gerade bei so zentralen Begriffen Einigung herrschen.” Auch wenn es für westliche Politiker einfach ist, es erfreut abzuhaken, wenn Xi eine Stärkung von Demokratie, Rechtsstaat und Reformen ankündigt – er meint damit immer nur eine Stärkung des eigenen Systems:
Der Ursprung dieser besonderen Sprachkultur liegt in der Sowjetunion. In der Berichterstattung der Staatszeitungen spielte es schon eine Rolle, ob der “erste Sekretär” nicht doch als “Erster Sekretär” mit großem “E” geschrieben wurde. Um die Tifa zu verstehen, sind also nicht nur Mandarin-Kenntnisse nötig, sondern Kenntnis der besonderen KP-Codes. Uneingeweihte Chines:innen können diese Sprache ebenfalls nicht ohne Weiteres entschlüsseln. Für sie handelt es sich aber immerhin um den vertrauten politischen Wortteppich, mit dem sie aufgewachsen sind. Tatsächlich kann jedoch heutzutage auch im Westen jeder zum Eingeweihten werden: Die Staatsmedien bieten offizielle Erklärungen und Übersetzungen für die wichtigsten der wiederkehrenden Sprüche an.
Der Technikkonzern Huawei hat einen hochrangigen Manager entlassen, weil dieser Zweifel an der Sicherheit selbstfahrender Autos geäußert hat. Su Qing hat Anfang des Monats in Shanghai auf einer Veranstaltung auf die zahlreichen Unfälle beim Konkurrenten Tesla hingewiesen; wenn die KI übernehme, seien Ereignisse mit Todesfolge unvermeidlich. Der chinesische Technikkonzern fand diese Äußerungen für einen Mitarbeiter aus dem Bereich intelligenter Mobilitätslösungen inakzeptabel, berichtet Caixin.
Der Auftritt Sus hatte auf Sozialmedien die Runde gemacht. In der Überschrift des Weibo-Beitrags wurde die hohe Rate an tödlichen Unfällen bei Tesla mit “Mord” verglichen. In diese Richtung ging auch die Diskussion über das Video. Damit greift ein Huawei-Vertreter nicht nur in aller Öffentlichkeit einen Konkurrenten an, sondern weckt auch generell Zweifel an der Sicherheit der Computersteuerung für Fahrzeuge. Huawei hat bereits eine Milliarde Dollar in Technik für selbstfahrende Autos investiert. fin
Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen hat die Bevölkerung aufgefordert, sich mit dem heimisch hergestellten Corona-Impfstoff Medigen immunisieren zu lassen. Sie werde sich selbst mit dem Vakzin impfen lassen, teilte Tsai am Mittwoch in sozialen Netzwerken mit. Medigen und alle anderen in Taiwan erhältliche Corona-Impfstoffe seien sicher und wirksam, schrieb die Präsidentin.
Der Impfstoff von Medigen war am Dienstag zu den verfügbaren Optionen im Covid-Impfregistrierungssystem des Landes hinzugefügt worden. Medigen ist derzeit nur für Erwachsene ab 20 Jahren zugelassen, das Vakzin hat am 17. Juli eine Notzulassung in Taiwan bekommen. Für eine Immunisierung mit Medigen sind zwei Dosen notwendig.
Nach einer Spende von rund sechs Millionen Impfdosen aus Japan und den USA sowie kleineren Spenden aus EU-Ländern hat Taiwan seine Impfkampagne deutlich ausgeweitet. Etwa 20 Prozent der 23,5 Millionen Einwohner haben mindestens einen der zwei Impfdosen erhalten, wie lokale Medien berichteten. ari
Der einflussreiche Agrarunternehmer und Milliardär Sun Dawu ist zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden. Die Justiz in Gaobeidian sprach den 67-Jährigen am Mittwoch unter anderem wegen “Versammlung einer Menschenmenge zum Angriff auf Staatsorgane” sowie “Behinderung der Verwaltung” und “Aufwiegelung” schuldig und verurteilte ihn zu 18 Jahren Haft, wie die Nachrichtenagentur AP berichtete. Sun Dawu war demnach im vergangenen November zusammen mit Geschäftspartnern festgenommen worden, nachdem sein Unternehmen Dawu Agriculture Group in einen Landstreit mit einem staatlichen Konkurrenten verwickelt war. Die Festnahme war erfolgt, nachdem Mitarbeiter von Dawu im August 2020 versucht hatten, ein staatliches Unternehmen daran zu hindern, ein Firmengebäude abzureißen.
Dem Bericht zufolge hatte der Prozess gegen den Unternehmer im Geheimen begonnen. Sun wurde demnach auch zu einer Geldstrafe in Höhe von 3,1 Millionen Yuan (480.000 US-Dollar) verurteilt. Neben ihm seien weitere Personen zu Strafen zwischen einem und zwölf Jahren Gefängnis verurteilt worden.
Der Unternehmer und Schweinezüchter wurde 2003 landesweit bekannt, als er wegen “illegaler Spendensammlung” angeklagt wurde, nachdem er Freunde und Nachbarn um Investitionen für sein Geschäft gebeten hatte. Der Fall löste eine Welle öffentlicher Unterstützung für Sun Dawu aus. Seither lobte Sun mehrfach öffentlich Anwälte, die Menschen in Prozessen gegen den Staat vertreten. Suns Anwalt im Fall von 2003, Xu Zhiyong, verschwand dem Bericht zufolge im Februar 2020. Aktivistenkollegen sagten demnach, Xu sei des Hochverrats angeklagt worden. ari
Die erhöhten Spannungen zwischen den USA und China haben die Aussichten auf eine tiefe, weltweite technologische Kluft erhöht, die andere Länder potenziell zwingen könnte, sich für ein Lager zu entscheiden. Es gibt eine Menge düsterer Szenarien, bei denen es um eine unüberbrückbare Spaltung bei Schlüsseltechnologien geht, die ein breites Spektrum von Produkten und Dienstleistungen antreiben: von Flugzeugen und Autos bis hin zur Präzisionstechnologie im Bereich der Robotik und zu Zahlungssystemen für den elektronischen Handel. Falls sich diese Szenarien verwirklichen, werden die beiden weltgrößten Volkswirtschaften enorme Mengen an Ressourcen für einen Nullsummen-Wettlauf aufwenden, um Spitzentechnologien zu kontrollieren.
Sowohl den USA als auch China ist die zentrale Rolle der Technologie als Treiber ihrer Volkswirtschaften und der globalen Entwicklung bewusst. Sie wissen auch, dass die Beherrschung dieser Technologien und der Schutz des betreffenden geistigen Eigentums ihre nationale Sicherheit und ihren geopolitischen Einfluss stärken können – mit wichtigen Rückkopplungseffekten für ihr nachhaltiges Wachstum und ihre bleibende Resilienz.
Mittelfristig stehen die lange Dominanz der USA bei den Natur- und Ingenieurswissenschaften sowie ihre Fähigkeit zur Produktion wichtiger Komponenten stark infrage. Ein Beispiel: Obwohl die US-Unternehmen hochmoderne Halbleiter entwickeln, ist Amerikas Anteil an der weltweiten Produktion von 37 Prozent im Jahr 1990 auf lediglich 12 Prozent heute zurückgegangen.
Derweil ist China trotz aller Fortschritte bei vielen Produkten, wie etwa Computerchips und Flugzeugen, noch ein ganzes Stück vom Stand des technisch Machbaren entfernt. Zwar hat das Land bei vielen Fertigungsarten ein Ökosystem von beträchtlicher Tiefe entwickelt, und es ist in außergewöhnlicher Weise in der Lage, schnell und großmaßstäblich zu produzieren. Auch in den globalen Rankings für Patente und Forschungs- und Entwicklungsausgaben steht es weit oben. Doch ist China in vielen Bereichen anfällig. Es importiert jährlich Halbleiter im Wert von 300 Milliarden Dollar, davon rund die Hälfte für die Exportfertigung. Darüber hinaus werden für viele mit Waren verknüpfte Dienstleistungen, z. B. für in Smartphones integrierte Apps, Halbleiter benötigt.
Andere hoch entwickelte Volkswirtschaften mit der Fähigkeit zur Entwicklung oder Herstellung wichtiger Komponenten in den Halbleiter-Lieferketten, darunter Japan, Südkorea, Taiwan und die Niederlande, sind bei den Spannungen zwischen den USA und China zwischen die Fronten geraten. Für diese Länder werden neben wirtschaftlichen unweigerlich auch geopolitische Gesichtspunkte eine Rolle spielen, was sorgfältige Kalkulationen erfordert.
Das mittelfristig wahrscheinlichste Ergebnis ist angesichts der Bemühungen vieler Länder zur Verringerung ihrer Anfälligkeiten eine technologische Auseinanderentwicklung, die sich freilich in Grenzen halten wird. Mehrere US-Unternehmen bauen derzeit leistungsstarke Halbleiterfabriken, während China globale Talente rekrutiert und seine Forschung und Entwicklung im Halbleiterbereich sowie bei der zur Produktion von Halbleitern erforderlichen Software, Maschinerie und Ausrüstung verstärkt.
Andere Länder verfolgen derweil unterschiedliche Alternativen. Hierzu gehören der Abschluss von Bündnissen, um ihre Versorgung mit wichtigen Komponenten sicherzustellen, die Ausweitung ihrer Fähigkeit, eine Interoperabilität zwischen unterschiedlichen technologischen Standards zu erreichen, und die Stärkung ihres Angebots an technisch ausgereifteren Produkten und Dienstleistungen gegenüber den Weltmärkten und damit ihrer Verhandlungspositionen gegenüber den USA und China.
Längerfristig jedoch muss die Welt ehrgeiziger sein und die multilateralen Bemühungen zur Stärkung der globalen Kooperation im Technologiebereich ausweiten. Die entwickelten Volkswirtschaften und auch die Schwellenländer sollten daher mit technologischen Spannungen verbundene Fragen in einem breiteren Kontext fassen.
Zunächst einmal sollten sie sich erinnern, dass die wirtschaftliche Öffnung Wachstum und Wohlstand enorm gesteigert hat. In Asien wird dies durch die rasche wirtschaftliche Entwicklung Festlandschinas unter Beweis gestellt. Südkorea, Singapur, Taiwan und Hongkong haben es, obwohl sie kaum oder gar nicht über eigene Rohstoffvorkommen verfügen, ebenfalls geschafft, sich zu industrialisieren und zu modernisieren – teilweise dank der Globalisierung. Und eine wachsende Zahl von Entwicklungs- und Schwellenländern in Afrika, Lateinamerika und Europa bewegen sich die Einkommensleiter hinauf, indem sie Nischen erschließen und sich an globalen Wertschöpfungsketten beteiligen.
Darüber hinaus kann sich keine Volkswirtschaft – egal, wie groß oder hoch entwickelt sie ist – der Globalisierung entziehen und sicherstellen, dass sie immer die Spitzenposition bei allen Hightech-Produkten innehaben, sicher mit wichtigen Komponenten versorgt sein und zum Betrieb eines exponentiell wachsenden Netzes aus komplexen Produktionsprozessen in der Lage sein wird. Auch hierfür sind Halbleiter ein Paradebeispiel: Ihre Produktionskette ist außergewöhnlich komplex und stützt sich auf hunderte von Vorprodukten, die mittels hoch technisierter, aus aller Welt beschaffter Hilfsmittel verarbeitet und produziert werden. In diesem Sektor auch nur einen Fuß in die Tür zu bekommen erfordert enorme Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen und lange Vorlaufzeiten.
Zwar stimmt es, dass ein Land seine Anfälligkeit gegenüber ungünstigen äußeren Entwicklungen verringern kann. Doch könnten die Kosten dafür immens sein, insbesondere wenn das Ziel darin besteht, bei möglichst vielen technologischen Produkten völlig autark und kosteneffizient zu sein.
Angesichts dieser Beschränkungen sollten Länder das Ziel einer auf multilateralen Übereinkünften beruhenden Globalisierung verfolgen. Eine Priorität sollte es sein, technologische Fortschritte schneller und weiter unter entwickelten Volkswirtschaften und Schwellenmärkten zu verbreiten, um deren Anfälligkeiten zu reduzieren und mehr neue, aufstrebende Volkswirtschaften in die Lage zu versetzen, Fortschritte zu erzielen – und zwar auch durch Technologietransfer. Die politischen Entscheidungsträger sollten zudem die Reichweite ihrer Handels- und Investitionsabkommen ausweiten, um die Interessen von Unternehmen, Arbeitnehmern und Ländern zu schützen und zugleich die negativen externen Folgen des Protektionismus zu minimieren. Dies könnte u. a. die Erweiterung von Freihandelsverträgen um spezielle Kapitel zu Technologiefragen und Anhänge zum Schutz der Rechte einkommensschwacher und schutzbedürftiger Arbeitnehmer umfassen.
Derartige Entwicklungen werden sich nicht spontan entfalten. Doch ist der Unternehmenssektor womöglich in der Lage, einen konstruktiven Weg voran zu finden, ohne die nationalen Sicherheitsinteressen zu untergraben. So haben etwa im Mai die Branchenverbände der Halbleiterindustrie Chinas und der USA erklärt, dass sie eine gemeinsame Arbeitsgruppe ins Leben rufen werden. Vertreter von zehn Chipunternehmen aus jedem Land werden sich zweimal jährlich treffen, um Fragen wie Exportbeschränkungen, die Sicherheit der Lieferketten und Verschlüsselungstechnologien zu diskutieren.
Die von den USA und China verfolgte Politik wird natürlich eine Schlüsselrolle bei der Vermeidung einer bedeutenden technologischen Spaltung spielen. Doch indem sie sich aus dem chinesisch-amerikanischen Konflikt heraushält, kann die übrige Welt dazu beitragen, die Entwicklung eines neuen, vertrauensbasierten Konsenses auf Basis einer gemeinsamen Vision gemeinschaftlichen technologischen Fortschritts voranzutreiben.
Hoe Ee Khor ist Chefökonom des ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO). Suan Yong Foo ist leitender Ökonom bei AMRO. Aus dem Englischen von Jan Doolan.
Copyright: Project Syndicate, 2021.
www.project-syndicate.org
Daniel Diehl ist bei Bosch jetzt Project Lead für den Einkauf von Elektronik mit Fokus auf China. Er übt diese Tätigkeit am Standort Pfullingen aus. Zuvor war er Project Manager im Bereich Halbleiteroperationen.
Philipp Breuer hat bei Audi in Ingolstadt die Kontrolle über die Portfolio-Strategie für China übernommen. Er analysiert für den Konzern strategische Einflussfaktoren in der Region und das Wettbewerbsumfeld.
Joerg Ziegler ist bei BASF zum Director Materials Management für die New Verbund Site in Guangdong geworden. Sein Dienstsitz befindet sich am Konzernhauptquartier in Ludwigshafen.
Wolfgang Lamprecht ist jetzt bei ZF Asia Pacific der Head of Product Line Chassis Systems für die Region China. Sein Büro befindet sich in Shanghai.

Großkatzen-Pool: Sibirische Tiger tummeln sich hier an einem Wasserbecken im Waldpark des Hengdaohezi Feline Breeding Center in der nordostchinesischen Provinz Heilongjiang. Die Einrichtung ist das weltweit größte Zuchtzentrum für Sibirische Tiger. Dort leben etwa 400 Großkatzen auf 40.000 Quadratmetern. In diesem Jahr wurden bisher 30 Tigerbabys im Park geboren. Die Tiere werden dort trainiert oder auf die Auswilderung vorbereitet.