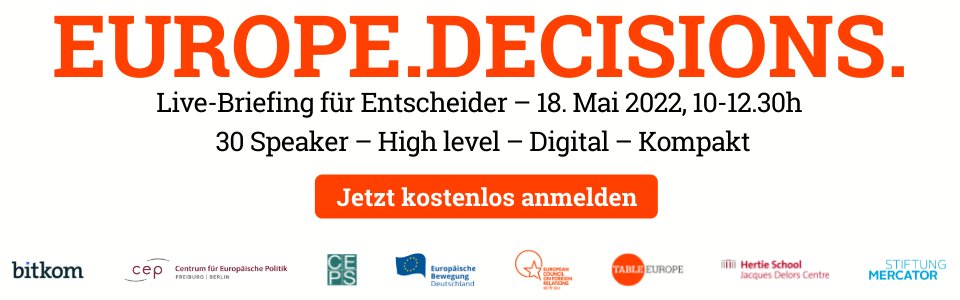“Willst Du Wohlstand? Bau zuerst die Straßen aus!” (要想富先修路). So lautet tatsächlich ein chinesisches Sprichwort. Die Wirtschaftsplaner des Landes haben sich diesen Spruch üppig zu Herzen genommen. Im vergangenen Jahrzehnt haben sie im Schnitt so um die zehntausend Kilometer Autobahnen im Jahr bauen lassen. Der Erfolg für die Infrastruktur kann sich sehen lassen.
Doch derzeit stockt die Nachfrage im Straßenbau – und das ausgerechnet in einer Zeit, in der das Wachstum von vielen Seiten bedroht ist. Darüber wundert sich Ulrich Reichert im Interview mit Frank Sieren. Reichert arbeitet für die Wirtgen-Gruppe, einen großen Hersteller von Baumaschinen. “Omikron ist im Moment der größte Bremser”, sagt Reichert. Sein Pekinger Werk ist seit März geschlossen. Seinen Kunden, also den Baufirmen, geht bereits das Geld aus.
Normalerweise würde jetzt die Regierung mit Aufträgen einspringen – doch es ist bislang nichts Konkretes passiert, sie ist erstaunlich untätig. Reichert hofft nun, dass die Führung bei der Konjunkturförderung doch noch den Hebel umlegt. Manchmal passiert das in China über Nacht. Und die Bauaufträge fließen wieder.
Über rätselhafte Untätigkeit wundern sich auch politische Beobachter in Taiwan – und zwar im Umgang mit Corona. Das Verhalten der Regierung dort ähnelt derzeit eher dem deutschen Durcheinander bei der Pandemie-Bekämpfung. In Taiwan nimmt die Fallzahl bereits merklich zu, berichtet David Demes. Doch die taiwanische Regierung hält sich nicht an ihr ursprüngliches Konzept der vorausschauenden Eindämmung. Tatsächlich läuft der Ausstieg aus den Maßnahmen weiter, ein Lockdown gilt in Taipeh als inakzeptabel.
Wer jetzt vorschnell mit der Volksrepublik vergleichen will, sollte auf die Qualität der verwendeten Impfungen achten. In Taiwan kamen vor allem Moderna, Biontech und Astrazeneca zum Einsatz. Ein großer Teil der Bevölkerung ist also vor schweren Verläufen geschützt.


Der Kölner Uli Reichert, 66, verbrachte seit Ende der 80er Jahre sein Arbeitsleben mit dem Aufbau des Chinageschäftes von Wirtgen. Die Wirtgen Group ist einer der wichtigsten Hersteller von Straßenbaumaschinen. Sie macht rund drei Milliarden Euro Umsatz. Das Unternehmen produziert in Deutschland, Brasilien, China und Indien. 2017 übernahm der US-amerikanische Landmaschinenhersteller John Deere die Wirtgen Group für 4,4 Milliarden Euro. Im Mai gibt Reichert den Posten des China CEO ab, um noch zwei Jahre in der deutschen Zentrale als Berater zu arbeiten.
Herr Reichert, Sie waren 1988 zum ersten Mal in China, haben über 30 Jahre in Hongkong und auf dem chinesischen Festland gelebt. Im Straßenbaumaschinengeschäft haben Sie den großen Aufschwung erlebt, aber auch Krisen. Wie tiefgreifend ist die gegenwärtige Krise?
Die erste große Krise in den 90er-Jahren war die Asienkrise 1997 nach der Übergabe der britischen Kronkolonie Hongkong an China. Sie hat China nur am Rand getroffen. SARS 2002 war vor allem in Hongkong ohne allzu große Auswirkungen auf China und unser Geschäft. Als 2008 die Weltfinanzkrise ausgebrochen ist, hat Peking sofort ein Konjunkturpaket von rund 400 Milliarden US-Dollar aufgelegt. Kein Einbruch für unser Geschäft. Doch als dieses Paket 2012 auslief, hatten wir von 2011 auf 2012 einen deutlichen Rückgang zu verzeichnen. Zum ersten Mal in der Zeit, in der ich in China gelebt habe. Nun kommt auf meiner Zielgeraden der zweite Einbruch auf mich zu.
Wird es genauso schlimm wie 2012?
Das kann ich natürlich jetzt noch nicht sagen, weil das Jahr ja noch nicht rum ist. Klar ist allerdings: Es wird einen deutlichen Umsatzrückgang geben. Aber ich hoffe, dass die chinesische Regierung einen wirtschaftlichen Einbruch in großem Ausmaß nicht zulässt. Erst recht nicht in 2022 vor dem so wichtigen 20. Parteitag im Herbst dieses Jahres.
Was passiert gerade?
Besser wäre zu fragen, was passiert nicht. Es wird viel weniger Infrastruktur gebaut. In einem normalen Jahr würden im März, April und Mai zahlreiche Jahresauslieferungen abgewickelt. Doch die vergangenen Monate von November bis März waren die schwächsten Auslieferungsmonate der letzten sechs Jahre. Deswegen wird 2022 ein umsatzschwächeres Jahr. Es sei denn, die Regierung legt wie 2012 plötzlich den Hebel um und gibt so richtig Gas. 2012 ging das über Nacht. Doch derzeit sind die Anzeichen, dass sich kurzfristig etwas ändert, eher verhalten. Doch eigentlich wäre viel zu tun, folgt man dem 14. Fünfjahresplan. Es gibt bereits erhebliche Verzögerungen und meine Erfahrung in der Vergangenheit war immer so, dass der Fünfjahresplan bis auf geringe Abweichungen eingehalten wurde.
Wird der Plan diesmal eventuell nicht eingehalten?
Das habe ich wiederum in den vergangenen 30 Jahren noch nicht erlebt. Es gab Pläne, da war man in den ersten beiden Jahren 30 Prozent in Rückstand. Das wurde dann jedoch stets mit viel Anstrengung wieder aufgeholt.
Welches sind die Gründe für den Stillstand?
Nun ja, Stillstand haben wir immerhin noch nicht. Aber Omikron ist im Moment der größte Bremser. Dazu kommt die global instabile Lage, das schwierige Handelsverhältnis zwischen China und den USA, die Krise im Wohnungsmarkt und so weiter. Gründe kann man genug aufzählen. Das alles lähmt die Entscheidungsfreudigkeit unserer Kunden im Moment. Hinzu kommt, dass in den letzten Jahren sehr viele Baumaschinen in den chinesischen Markt geliefert wurden, vielleicht mehr als eigentlich notwendig waren. Mit denen können die Kunden auch noch ein Jahr länger über die Runden kommen, wenn sie es wollen.
Wie wirkt sich Omikron aus?
Unsere Fabrik in Langfang bei Peking ist seit dem 10. März zu. Immerhin durften wir vor einigen Tagen zum ersten Mal Personal in die Fabrik bringen, um wenigstens fertige Maschinen auszuliefern. Diese Mitarbeiter müssen nun in der Fabrik übernachten. Das ist kein Dauerzustand. Aber Langfang scheint die Entwicklung jetzt unter Kontrolle zu haben und wir hoffen, dass bald die ersten Schritte zu einer Normalisierung stattfinden.
Wie hat sich die gegenwärtige Krise angebahnt?
Zum Beispiel hatten wir vergangenen Oktober eine Großveranstaltung geplant, bei der wir 2.000 unserer Kunden eingeladen hatten. Da hat die Verwaltung der Wirtschaftszone in Langfang uns gebeten, das noch einmal zu überdenken. Eine klare Aussage in China. Und das betrifft natürlich nicht nur uns. Hier sind viele Zulieferer für Daimler und andere namhafte Hersteller. Über 1.000 Firmen. Bei Großveranstaltungen wie zum Beispiel der Bauma in Shanghai, der internationalen Fachmesse für Baumaschinen, oder unseren hausinternen Technologietagen machen wir hohe Umsätze. Das ist im Moment leider nicht durchführbar.
Wie ist die Stimmung bei den Kunden?
Die Kunden, in der Regel Privatunternehmen, haben uns offen gesagt, sie wissen nicht, wie das Jahr wird. Sie hätten keinerlei Sicherheit über die Auftragslage. Und sie hätten noch viele Forderungen bei ihren Auftraggebern – überwiegend Staatsunternehmen. Das schlägt dann irgendwann auf uns durch. Normalerweise ist kurz vor dem chinesischen Neujahr, dieses Jahr war das Anfang Februar, die beste Zeit, Geld einzutreiben. Das hat mit einer Mischung aus Ehre und Aberglauben zu tun. Die Chinesen wollen nicht mit Schulden ins neue Jahr. Doch dieses Jahr konnten unsere Kunden gerade mal knapp 50 Prozent ihrer Forderungen eintreiben. In einigen Unternehmen ist der Cashflow fast versiegt.
Das schlägt auf die Stimmung?
Ja, man kann sich leicht ausmalen, wie die Stimmung im Land derzeit ist. Im zweiten Halbjahr 2021 schon ist der Staat voll auf die Bremse getreten. Bei kleinen Bauunternehmen geht es inzwischen um die Existenz. In diesem Bereich sind keine Ausländer betroffen. Das sind praktisch ausschließlich chinesische Unternehmen. Das vergessen die Ausländer eben leicht, wenn sie jammern, dass alles schlimmer wird. Es trifft nicht nur sie, sondern vor allem unsere chinesischen Kunden, ohne die wir hier gar nicht existieren würden.
Und die Politik ignoriert das?
Premierminister Li Keqiang hat zwar in den vergangenen Monaten immer wieder betont, die kleinen Unternehmen müssen schneller für ihre geleistete Arbeit bezahlt werden. Da haben wir gedacht: Endlich kommt jetzt die Anordnung an die Staatsfirmen. Doch seltsamerweise passiert nichts. Dabei gab es auch schon Zeiten, in denen Staatsfirmen mit Geldstrafen belegt wurden, wenn sie ihre Schulden nicht bezahlt haben. Wir in der Branche fragen uns schon: Was ist da los in Peking? Es scheint, die Entscheidungsprozesse sind vor dem 20. Parteitag der Kommunistischen Partei besonders komplex. Inzwischen glaube ich den Ankündigungen erst, wenn sie auf der Straße, bei unseren Kunden und letztendlich auch bei uns angekommen sind.
Kann man von einem Vertrauensverlust in die politische Steuerung sprechen?
Die Politik sollte jedenfalls darauf achten, glaubwürdig zu bleiben. Schwierig ist auch, dass die Provinzen nicht immer das tun, was Peking will. Das war 2008 noch anders. Da kam die Finanzhilfen über Nacht, als die Weltfinanzkrise ausbrach. Daran wird die Regierung heute natürlich gemessen. Und die Erwartungen sind hoch: Seit 2012 ging es trotz vieler Unkenrufe in den westlichen Medien immer bergauf. In den Jahren 2013 bis 2017 sind wir jedes Jahr durchschnittlich im zweistelligen Prozentbereich gewachsen. 2018 bis 2021 war das Wachstum dann auf hohem Niveau nur noch einstellig.
Eine Langfassung dieses Interviews finden Sie hier.
Weltweit galt Taiwan lange als Corona-Musterschüler. Mehr als zwei Jahre hatte die demokratische Inselrepublik die SARS-CoV-2-Epidemie in Schach gehalten und war trotz mehrerer lokaler Ausbrüche der Alpha-, Delta und Omikron-Varianten des Virus immer wieder in der Lage gewesen, die Zahl der Neuinfektionen auf null zu drücken. Anders als in der benachbarten Volksrepublik China gelang dies auch ohne starke Einschränkungen des täglichen Lebens und der persönlichen Freiheiten. Ein Vorzeigemodell für viele Befürworter einer Null-Covid-Strategie – auch in Europa. Im dritten Jahr der Pandemie scheint die jüngste Variante Omikron BA.2 nun jedoch Taiwans Verteidigungswall durchbrochen zu haben.
Am Sonntag gab der Gesundheitsminister des Landes, Chen Shih-chung, auf seiner täglichen Pressekonferenz die neuesten Infektionszahlen bekannt: 16.936 lokale Fälle. Am Donnerstag zuvor musste Chen erstmals eine fünfstellige Zahl bekanntgeben. Insgesamt haben sich in Taiwan seit Beginn der Pandemie 121.515 Personen mit dem Coronavirus angesteckt, 853 von ihnen sind mittlerweile an den Folgen der Erkrankung verstorben. Zum Vergleich: In Deutschland starben im gleichen Zeitraum mehr als 134.000 Menschen an oder mit dem Virus.
Taiwan und China haben beide mit dem hoch virulenten Omikron zu kämpfen. Während die Behörden im chinesischen Shanghai jedoch einen Lockdown anordneten, entschied man sich in Taiwan anders. Trotz der seit Mitte März langsam steigenden Infektionszahlen erfolgte Anfang April eine Abkehr von der Null-Covid-Strategie und eine Fortsetzung der Öffnung des Landes.
Die Passivität verblüfft. “Vorbereitungen weit im Voraus zu treffen” (超前部署) – das war eigentlich das Erfolgsgeheimnis des Taiwan-Modells. Bereits am 31. Dezember 2019 hatte Taiwan damit begonnen, Reisende aus dem chinesischen Wuhan noch im Flugzeug auf Symptome der damals noch namenlosen Lungenerkrankung zu untersuchen. Drei Wochen später aktivierte Taipeh dann sein Central Epidemic Command Center (CECC), eine zentrale Regierungsbehörde, die als Lehre aus der SARS-Krise 2002 geschaffen wurde, um im Notfall behördenübergreifend Kompetenzen zu bündeln. Minister Chen, dem Chef oder “Kommandeur” (指揮官) des CECC, sind für die Dauer der Pandemie alle anderen Regierungsbehörden untergeordnet.
Nach zwei Jahren relativer Ruhe hatte es in Taiwan seit Anfang des Jahres immer wieder lokale Ausbrüche der Omikron-Variante BA.2 gegeben. Bestehende Maßnahmen, wie die zehntägige Quarantäne für ankommende Reisende und die allgemeine Maskenpflicht im öffentlichen Raum, reichten offenbar nicht mehr aus, um diese noch ansteckendere Variante des Coronavirus abzuwehren. Durch die hohe Anzahl von asymptomatischen Fällen blieben viele Infektionsketten unentdeckt und positive Fälle wurden oft erst beim vorgeschriebenen Test vor dem Betreten eines Krankenhauses identifiziert.
Bei einer Strategiesitzung in der präsidialen Residenz hatte Präsidentin Tsai Ing-wen am 6. April die wichtigsten Vertreter aus Regierung, CECC und der Regierungspartei DPP zusammengerufen, um sich über die neue Richtung der nationalen Pandemiebekämpfung abzustimmen. Am Nachmittag erklärte sie dann auf Facebook, Taiwan könne weder zurück zu Null-Covid, noch wolle man “mit dem Virus leben” (與病毒共存).
Neues Ziel sei stattdessen die “Reduzierung schwerer Verläufe auf null” und die “effektive Eindämmung leichter Verläufe” (重症求清零、有效管控輕症). Das sogenannte “Neue Taiwan-Modell” solle durch eine proaktive Virusbekämpfung und eine besonnene Öffnung sowohl Wirtschaftswachstum als auch ein normales Leben für die Bürgerinnen und Bürger ermöglichen.
Doch Taiwans erfahrene Seuchenpolitiker wurden von der Virulenz von Omicron BA.2 und seine Ausbreitungsgeschwindigkeit überrascht. Die vormals umständlichen Verfahren zur Nachverfolgung und Isolierung möglicher Kontaktpersonen positiver Fälle waren während des aktuellen Ausbruchs schon bald überfordert. Im Gespräch mit China.Table erzählt Huang Yu-fen, parteilose Stadtverordnete für die Bezirke Shilin und Beitou der Hauptstadt Taipeh, dass eine ihrer Mitarbeiterinnen auch vier Tage nach ihrem positiven Testergebnis noch keine offizielle Aufforderung erhalten habe, in Quarantäne zu gehen. Der Grund: Die Mitarbeiterin ist im benachbarten New Taipei City gemeldet. Ein anderes Gesundheitsamt ist für die Ausstellung zuständig. Die Übermittlung der Daten dauert jedoch einige Zeit. Huang Yu-fen war eine der ersten Volksvertreterinnen in Taiwan, die offen über ihr positives Testergebnis gesprochen hat. Infizierte werden teilweise noch immer von der Gesellschaft stigmatisiert.
Als Reaktion auf die offensichtliche Überlastung der Gesundheitsämter wurde die Kontaktverfolgung mittlerweile vereinfacht. Minister Chen erklärte, dass in Zukunft keine Bewegungsdaten von Einzelfällen mehr veröffentlicht werden. Außerdem wurde die Quarantäne für Kontaktpersonen von zehn auf drei Tage verkürzt. Bereits an Tag vier kann man sich jetzt aus der Quarantäne freitesten.
Einziges Problem: Es mangelte zunächst an Schnelltests. Erst am vergangenen Donnerstag hatte der Staat ein System zur rationierten Ausgabe von Schnelltests zu einem vergünstigten Preis auf den Weg gebracht. In den Tagen zuvor waren die Tests fast überall ausverkauft.
Obwohl die Regierung schnell auf die neue Lage reagiert, muss sie sich doch die Frage stellen lassen, warum man sich nicht schon “weit im Voraus” auf diese Situation vorbereitet hatte. Warum ist die Produktionskapazität von Schnelltests nicht schon vor Monaten erhöht und die Verwaltungsabläufe in den Gesundheitsämtern nicht vereinfacht worden? Die Stadtverordnete Huang Yu-fen glaubt, dass zu viel Zeit mit parteipolitischen Streitereien verschwendet wurde.
Huang ist dennoch vom Erfolg des Taiwan-Modells überzeugt. “Der Erfolg unserer Strategie ‘Vorbereitungen weit im Voraus zu treffen’ liegt doch darin, dass Taiwan die gewonnene Zeit genutzt hat, die Bevölkerung vor diesem großen Ausbruch weitgehend durchzuimpfen.” Aktuell sind 80 Prozent der Menschen in Taiwan vollständig geimpft, 59 Prozent sind geboostert. In der besonders gefährdeten Altersklasse der Über-75-Jährigen ist allerdings ein gutes Fünftel der Bürger ungeimpft.
Taipehs Bürgermeister Ko Wen-je hat nun für den Fall eines zu raschen Anstiegs der Infektionszahlen die Möglichkeit eines “weichen Lockdowns” (軟封城) ins Spiel gebracht, also eine Schließung aller Schulen und Restaurants. Die Stadtverordnete Huang hält das jedoch für nur schwer umsetzbar. Im vergangenen Jahr, als Taiwan im Mai die Stufe 3 der epidemischen Notlage ausgerufen hatte, habe man keine andere Wahl gehabt. Die Impfquote sei damals noch zu niedrig gewesen. Für einen Lockdown gebe es wegen der geringen Fallsterblichkeit nur geringe Akzeptanz. So wie in Deutschland.
Während Shanghai am Sonntag die immer erfolgreichere Unterdrückung der Infektionsketten verkündet hat, steuert Peking auf weitere Maßnahmen zu. Vorerst bis Mittwoch bleibt in der Hauptstadt während der Mai-Feiertage die Präsenzgastronomie geschlossen. Das Essen gibt es nur per Lieferung nach Hause. Läden dürfe nur mit aktuellem PCR-Test betreten werden, ein Schnelltest reicht nicht. Peking meldete am Sonntag 59 neu entdeckte Infektionen.
In Shanghai ist die Zahl der neu entdeckten Fälle derweil rapide gefallen. Am Sonntag war nur noch von 7872 neuen Fällen die Rede. Mitte vergangenen Monats waren es noch über 25.000 täglich. Die Bürger der Stadt schimpfen jedoch immer lauter über die lang anhaltenden Ausgangssperren. Sie protestierten, indem sie mit Kochtöpfen an ihren Fenstern schepperten und damit in der ganzen Stadt Lärm machten. fin
Die Ukraine beruft sich auf ein Abkommen von 2013, in dem China ihr Hilfe im Fall eines Angriffs oder einer nuklearen Bedrohung zugesagt hat. Dieser Fall sei nun eingetreten, sagte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba am Samstag gegenüber chinesischen Staatsmedien. “Die Ukraine prüft derzeit die Möglichkeit, Sicherheitsgarantien von ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen zu erhalten, einschließlich China”, sagte Kuleba der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua.
Auch sonst haben Chinas gelenkte Medien am Sonntag viel über das Weltgeschehen berichtet. Ein Schwerpunkt war auch Deutschland. Viel Beachtung erhielt der angekündigte Besuch von Friedrich Merz in Kiew und die Zusage von Unterstützung durch Olaf Scholz. Vergleichsweise viel Raum nahmen Berichte über eine Petition ein, die Scholz von der Lieferung abhalten will, weil dann der Dritte Weltkrieg drohe. fin
Chipmangel und weitere Probleme mit der Teileversorgung belasten nun nicht mehr nur die deutschen Auto-, sondern auch die Fahrradhersteller. “Bei E-Bikes haben wir ein ähnliches Chipproblem wie die Autoindustrie”, zitiert die Nachrichtenagentur dpa Burkhard Stork, Geschäftsführer des Zweirad-Industrie-Verbands. “Es fehlen nicht die Akkus, sondern die Chips für die Steuerung der Batterieladung und für die Displays.”
“In Ländern mit strikten Corona-Beschränkungen wie China, Malaysia, Singapur oder Vietnam standen in den vergangenen zwei Jahren viele Werke zeitweise still, sodass Komponenten und Teile fehlten”, erläuterte Stork. “Die derzeitigen Lockdowns in China führen wieder zu Lieferverzögerungen. Deswegen müssen Produktionspläne kurzfristig geändert werden. Das geht an die Substanz auf beiden Seiten”, sagte der ZIV-Geschäftsführer zur Lage bei Fahrradherstellern und -händlern.
Dramatisch bleibt die Lage für die deutschen Autobauer. Der Branchenzeitung “Automobilwoche” zufolge werden sie wegen Problemen mit der Teileversorgung rund 700.000 Autos weniger fertigen können als zu Jahresanfang geplant. Das Medium beruft sich auf Daten des Dienstleisters IHS Markit. Besonders betroffen sei Volkswagen. Die Marke VW verliere in diesem Jahr über eine halbe Million Einheiten. Bei Mercedes fehlten am Ende des Jahres 80.000 geplante Fahrzeuge, bei BMW sogar 100.000. Diese Prognosen stehen unter dem Vorbehalt weiterer Einschränkungen in der Lieferkette durch den Krieg in der Ukraine und den Corona-Lockdown in China, heißt es. rtr/flee
Der weltgrößte Elektroautobauer Tesla muss erneut Tausende Fahrzeuge seines “Model-3” in China zurückrufen. Insgesamt handele es sich um 14.684 Wagen, die zwischen Januar 2019 und März 2022 produziert worden seien, teilte die chinesische Aufsichtsbehörde mit. Es gehe um Softwareprobleme, die unter Extrembedingungen zu Kollisionen führen könnten. Für Tesla ist es bereits der zweite Rückruf im April. Der US-Konzern musste zuvor bereits rund 128.0000 Model-3-Autos wegen potenzieller Fehler bei Halbleiterteilen in die Werkstätten ordern. rtr/nib
Die Parteiführung erwägt nun doch, mit Hilfspaketen eine zu starke Konjunkturabkühlung verhindern. “Die Covid-19- und die Ukraine-Krise bringen Risiken und Herausforderungen”, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Freitag eine Mitteilung des Politbüros. China werde der Industrie, aber auch kleinen Firmen unter die Arme greifen. Ebenso werde man eine gesunde Entwicklung des Immobilienmarktes fördern und ein stabiles Funktionieren der Kapitalmärkte gewährleisten. Damit sollen systemische Risiken abgewendet werden. Art und Umfang der Förderung sind jedoch noch unklar. Die Staatsführung kündigte an, das Wirtschaftswachstum in einem “vernünftigen Rahmen” zu halten und die sozialen und wirtschaftlichen Ziele für 2022 zu erreichen. niw/rtr

In der zentralchinesischen Großstadt Changsha, der Hauptstadt von Hunan, ist am Freitag ein Gebäude eingestürzt. Internationalen Agenturberichten zufolge befanden sich darin Wohnungen, ein Hotel und ein Kino. Die Nachrichtenagentur Xinhua spricht dagegen von einer “selbst zusammengezimmerten Konstruktion”. Dem Fernsehsender CCTV zufolge haben die Bewohner “bauliche Veränderungen” vorgenommen, die der Stabilität geschadet haben. Die Staatsanwaltschaft untersucht nun, warum die Bauaufsicht nicht eingeschritten hat. Am Sonntag hat die Polizei neun Personen festgenommen. Bisher berichten chinesische Medien von sieben Menschen, die aus den Trümmern gerettet werden konnten. Zwei bis drei Dutzend Personen werden vermisst. fin

Der vorhersehbare Zyklus der Abwärtskorrekturen der Prognosen über die weltwirtschaftlichen Aussichten hat offiziell begonnen. Das war die Botschaft des kürzlich vom Internationalen Währungsfonds (IWF) veröffentlichten halbjährlichen World Economic Outlook, der frühere Korrekturen mehrerer prominenter privater Prognoseteams bestätigt.
Die weitgehend in Reaktion auf den Krieg in der Ukraine vorgenommene Korrektur ist groß: Prognostiziert wird für 2022 nun ein deutlich geringeres weltwirtschaftliches Wachstum von 3,6 Prozent, volle 1,3 Prozentpunkte unter der nur sechs Monate zuvor abgegebenen globalen Wachstumsprognose des IWF von 4,9 Prozent. Man muss dem IWF zugutehalten, dass er mit einer bereits im Januar veröffentlichten zwischenzeitlichen Abwärtskorrektur von 0,5 Prozentpunkten vor dieser Entwicklung warnte. Trotzdem ist dies mit Blick auf die vergangenen 15 Jahre die drittgrößte Prognosesenkung im regelmäßigen sechsmonatigen Korrekturzyklus des IWF.
Als sich im April 2009 die globale Finanzkrise entfaltete, senkte der IWF seine globale Wachstumsprognose für das Jahr um 4,3 Prozentpunkte (und erwartete statt dem vor der Krise projizierten positiven Wachstum von drei Prozent also eine Kontraktion von -1,3 Prozent). Und natürlich senkte der IWF, als Anfang 2020 die COVID-19-Pandemie ausbrach, seine Wachstumsprognose für das Jahr steil um 6,4 Prozentpunkte (von vor der Pandemie projizierten 3,4 Prozent zu einer Kontraktion von minus drei Prozent). In beiden diesen früheren Fällen sagten die sehr großen Absenkungen der Prognosen eine steile weltweite Rezession vorher; tatsächlich handelte es sich um die beiden schlimmsten Rezessionen in der modernen Geschichte.
Doch glauben weder der IWF noch die meisten anderen Prognostiker, dass das aktuelle weltweite Wachstumsdefizit die Welt in eine echte Rezession stürzen wird. Der jüngste World Economic Outlook sagt eine perfekte weiche Landung der 96 Billionen Dollar schweren Weltwirtschaft vorher. Laut der jüngsten Korrektur soll sich das weltweite Wachstum 2022/23 nun komfortabel auf einem Wachstumspfad von 3,6 Prozent einpendeln; das liegt um einen Bruchteil über dem Durchschnittswert seit 1980 von 3,4 Prozent. Sehr viel weicher kann eine Landung nicht ausfallen.
Doch könnte dies aus mehreren Gründen Wunschdenken sein. Zunächst einmal waren die Prognostiker bei ihrer Extrapolation des “Zuckerhochs” des Jahres 2021 in die Zukunft übertrieben optimistisch. Der Anstieg des weltweiten Wachstums um 6,1 Prozent im Jahr 2021 war laut den bis ins Jahr 1980 zurückgehenden IWF-Statistiken die bisher steilste Erholung überhaupt. Doch folgte diese auf den steilsten je verzeichneten Absturz: einen Einbruch auf -3,1 Prozent in 2020. Genau wie Anfang 2020 die COVID-Lockdowns den größten Teil der Weltwirtschaft praktisch zum Stillstand brachten, brachte die Wiederöffnung in Verbindung mit aggressiven geld- und fiskalpolitischen Konjunkturimpulsen die Mutter aller wirtschaftlichen Erholungen hervor.
Prognostiker und Anleger extrapolieren aktuelle Trends in die Zukunft; daher ist es wichtig, sich die außergewöhnliche Volatilität der Jahre 2020/21 vor Augen zu führen, um eine klare Vorstellung davon zu erhalten, welchen Trend es fortzuschreiben gilt. Das durchschnittliche weltweite BIP-Wachstum jener zwei Jahre lag bei gerade mal 1,5 Prozent und damit deutlich unter der offiziellen globalen Rezessionsschwelle, von der weithin angenommen wird, dass sie bei etwa 2,5 Prozent liegt. Man muss nicht erwähnen, dass, wenn sich das weltwirtschaftliche Wachstum stärker in Richtung dieses grundlegenden Trends verlangsamt als hin zum Pfad der weichen Landung, eine weitere globale Rezession alles andere als abwegig ist.
Ein zweiter Grund, den optimistischen Prognosen zu misstrauen, ist, dass dem chinesischen Wachstumspolster die Luft ausgegangen ist. Chinas Wirtschaft wächst derzeit deutlich langsamer als mit dem Tempo von fast acht Prozent der Jahre 2010-2019. Die jüngste IWF-Prognose sieht das durchschnittliche chinesische Wachstum in 2022/23 bei 4,75 Prozent. Das ist kaum mehr als die Hälfte des Trends im Gefolge der globalen Finanzkrise, als ein starkes chinesisches Wachstum faktisch das Einzige war, das während des Zeitraums von 2012 bis 2016 einen Rückfall der Welt in die Rezession verhinderte. Wie damals ist eine globale Resilienz ohne eine dynamischere chinesische Volkswirtschaft höchst unwahrscheinlich.
Dieses Risiko besteht heute. Angesichts des Dreiklangs an Erschütterungen, denen China derzeit ausgesetzt ist – einer neuen COVID-19-Lockdownwelle, anhaltendem Entschuldungsdruck (insbesondere in Chinas instabilem Immobiliensektor) und aus seiner unklugen Partnerschaft mit Russland resultierenden kriegsbedingten Kollateralschäden – kann sich die Welt nicht länger auf China als Quelle der Resilienz stützen. Das gilt natürlich in beide Richtungen. Falls China sein Bekenntnis zu Russland vertieft, wird es an der Isolation seines “Komplementärs” teilhaben. Da die chinesische Wirtschaft weiterhin stark auf die übrige Welt angewiesen bleibt, könnte sich dies als Präsident Xi Jinpings größte Herausforderung erweisen.
Drittens geht der Abschwung des globalen Wachstumszyklus mit einem deutlichen Aufschwung bei den weltweiten Inflations- und Zinszyklen einher. Die Vertreter der These von der weichen Landung tun die Folgen hiervon verächtlich ab. Während die Inflation auf den höchsten Stand in 40 Jahren steigt, ist nun verantwortungsloses Gerede zu vernehmen, dass sie ihren Höchststand bereits erreicht habe – die überspannte Vorstellung, dass die Situation inzwischen so schlimm sei, dass es nur noch besser werden könne.
Dieses oberflächliche arithmetische Argument geht am Kern des Problems vorbei. Angesichts eines im März steil um 8,5 Prozent gestiegenen US-Verbraucherpreisindex besteht natürlich eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass dieses wichtige Inflationsbarometer zum Jahresende deutlich niedriger liegen wird. Aber wie viel niedriger? Ausreichend niedrig, um die US Federal Reserve vor den Folgen ihres unverantwortlichsten geldpolitischen Vorgehens seit Mitte der 1970er und Anfang der 1980er Jahre zu retten?
Man sollte nicht darauf zählen. Während sich die Fed derzeit knallhart gibt, ist Reden billig. Bisher hat sie nur 25 Basispunkte – oder gerade mal zehn Prozent – der 250 Basispunkte an kumulativer Straffung abgeliefert, die die Finanzmärkte für die nächsten sechs Monate erwarten. Und selbst wenn die Fed die erwarteten Schritte unternimmt und die Federal Funds Rate bis November auf 2,5 Prozent anhebt, dürfte der nominale Leitzins deutlich unter der Inflationsrate liegen.
Das bedeutet, dass die reale (inflationsbereinigte) Federal Funds Rate im gesamten Jahresverlauf negativ bleiben dürfte. Damit wäre der reale Leitzins dann für einen Zeitraum von 38 Monaten negativ – eine deutlich stärkere Stimulierung der Konjunktur als in früheren Phasen stark akkommodierender Geldpolitik unter Alan Greenspan, Ben Bernanke und Janet Yellen. Die Realzinsen spielen für die Bewahrung der Preisstabilität und die Steuerung des Wirtschaftswachstums eine wichtige Rolle. Und das Fazit bei der Beurteilung des globalen Wirtschaftszyklus ist, dass der Anstieg der Realzinsen noch deutlich weiter gehen muss.
All dies unterstreicht die sich innerhalb der Weltwirtschaft aufbauenden Risiken. Als ehemaliger Wall-Street-Prognostiker kann ich mich in die Denkweise der meisten Prognoseteams, einschließlich der hochtalentierten Fachleute des IWF, hineinversetzen, die glauben, alle denkbaren Risiken berücksichtigt zu haben. Die Finanzmärkte sind in diesem Fall der gleichen Meinung; sie sind überzeugt, dass eine inflationsanfällige Welt mit noch immer unglaublich akkommodierenden Notenbanken irgendwie in wunderbarer Weise sanft auf eine weiche Landung zusteuert, an die man sich noch lange erinnern wird. Aber kann dieses schon jetzt rosige Szenario ohne China wirklich funktionieren? Träumen Sie weiter.
Stephen S. Roach ist Professor an der Universität Yale und ehemaliger Chairman von Morgan Stanley Asia. Er ist der Verfasser von Unbalanced: The Codependency of America and China (Yale University Press, 2014) und des in Kürze erscheinenden Accidental Conflict: America, China, and the Clash of False Narratives (Yale University Press, November 2022). Übersetzung: Jan Doolan.
Copyright: Project Syndicate, 2022.
www.project-syndicate.org
Yu Jianhua wurde zum Parteisekretär der Allgemeinen Zollverwaltung ernannt. Zwischen 2013 und 2017 war er Chinas Botschafter bei der Welthandelsorganisation (WTO). Er leitete Verhandlungen über Freihandelsabkommen und hat Chinas Beitrittsgesuch zur Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) verantwortet.
William Ding Lei, Gründer und CEO von NetEase ist von seinen Funktionen als Direktor, Geschäftsführer und gesetzlicher Vertreter der Beijing NetEase Media Co. zurückgetreten. Die Stelle wird künftig von Li Li, CEO von NetEase Media mit Sitz auf den Kaimaninseln übernommen, wie die South China Morning Post berichtet.

Im chinesischen Straßenbild blitzen in diesen Tagen nicht mehr Schönheiten und Schönlinge mit hellem Teint auf, sondern Hellhäuter mit Coronabezug: die sogenannten “dabai”. So nämlich hat der chinesische Volksmund die medizinischen Mitarbeiter, Helfer und Ordnungshüter in weißer Schutzmontur getauft, die den mancherorts turbulenten Corona-Ausnahmezustand im Land managen.
Interessanterweise geht die Wortneuschöpfung auf einen Disneyfilm zurück, und zwar “Big Hero 6” aus dem Jahr 2014, der damals das chinesische Popcornpublikum scharenweise in die Kinosessel lockte. In Deutschland ging der Animationsstreifen unter dem Titel “Baymax – Riesiges Robowabohu” an den Start, in Anspielung an den Protagonisten des Films: ein persönlicher Gesundheitsroboter namens Baymax. Und der heißt auf Chinesisch 大白 dàbái (“großer Weißer”). Der weiße Riese im Michelin-Männchen-Look konnte dank Spezialprogrammierung sogar Karate. Der chinesische Namensvetter allerdings, der optisch tatsächlich entfernt an das Animationsoriginal erinnert, wirbelt vor allem Wattestäbchen beim PCR-Test und schleppt außerdem weiße Plastiktüten mit Lebensmitteln durch die Häuserschluchten.
Wer auf Weibo nach dem Hashtag “dabai” sucht, findet einen wilden Mix an Posts rund um die weißen Riesen. Viele User zollen dem schweißtreibenden Einsatz der Seuchenhelfer Respekt, die teils Tage lang in den weißen Kunststoffanzügen stecken. Es werden aber auch immer wieder Szenen gepostet, in denen Lockdown-müde “dabais” mit frustrierten Anwohnern (verbal oder sogar handfest) aneinandergeraten oder rigoros die angeordneten Coronamaßnahmen durchsetzen.
Das Verhältnis zu den “Helfern in Weiß” ist also gespalten. Ähnlich sieht es übrigens auch in der chinesischen Sprache aus, wenn man einmal die Farbe Weiß genauer unter die Lupe nimmt. Zum einen weckt diese nämlich positive Konnotationen, da “weiße” Haut in China bekanntlich als Schönheitsideal gilt. Ein ganzes Branchensegment (genannt 美白 měibái “Schönheitsweiß”) hat sich mit unzähligen Produkten dem Bleichen der Haut verschrieben. Kein Wunder, dass die 白富美 báifùměi (wörtlich “weiße und wohlhabende Schönheit”) Chinas Synonym für “Traumfrau” ist (das männliche Pendant heißt übrigens 高富帅 gāofùshuài – “hochgewachsener und wohlhabender Beau”).
Traditionell aber ist die Farbe Weiß in China weniger positiv besetzt. Sie gilt als Farbton von Beerdigungen und Totentrauer (白事 báishì “weiße Angelegenheit” bedeutet “Trauerangelegenheit” oder “Beerdigung”) und ist damit das Gegenstück zur Freuden-, Hochzeits- und Glücksfarbe Rot (红事 hóngshì “freudige Angelegenheit, Hochzeit” – wörtlich “rote Angelegenheit”). In der Pekingoper sind die Schurken traditionell weiß geschminkt, weshalb “Bleichgesicht” (白脸 báiliǎn) ein Synonym für “Bösewicht” ist. Das “Bleichgesicht spielen/singen” (唱白脸 chàng báiliǎn) ist ein umgangssprachlicher Ausdruck für “sich hart stellen, den Bösewicht geben”. Das kulturelle Negativimage der Farbe wurde im Laufe der Sprachentwicklung sogar grammatikalisiert. So heißt “etwas weiß tun” (bái + Verb) Dinge “umsonst/vergeblich” oder auf gut Deutsch “für die Katz” machen (zum Beispiel 白等 bái děng “vergeblich warten”, 白跑一趟 bái pǎo yī tàng “umsonst irgendwo antanzen/hinrennen”, 白做核酸检测 bái zuò hésuān jiǎncè “umsonst einen Coronatest machen”).
In diesem Sinne bleibt zu hoffen, dass das Covid-Tohuwabohu nicht umsonst war und in China bald wieder Corona-Normalität einkehrt – damit wieder “baifumei” das Straßenbild prägen und nicht mehr die “dabai”.
Verena Menzel betreibt in Peking die Online-Sprachschule New Chinese.
“Willst Du Wohlstand? Bau zuerst die Straßen aus!” (要想富先修路). So lautet tatsächlich ein chinesisches Sprichwort. Die Wirtschaftsplaner des Landes haben sich diesen Spruch üppig zu Herzen genommen. Im vergangenen Jahrzehnt haben sie im Schnitt so um die zehntausend Kilometer Autobahnen im Jahr bauen lassen. Der Erfolg für die Infrastruktur kann sich sehen lassen.
Doch derzeit stockt die Nachfrage im Straßenbau – und das ausgerechnet in einer Zeit, in der das Wachstum von vielen Seiten bedroht ist. Darüber wundert sich Ulrich Reichert im Interview mit Frank Sieren. Reichert arbeitet für die Wirtgen-Gruppe, einen großen Hersteller von Baumaschinen. “Omikron ist im Moment der größte Bremser”, sagt Reichert. Sein Pekinger Werk ist seit März geschlossen. Seinen Kunden, also den Baufirmen, geht bereits das Geld aus.
Normalerweise würde jetzt die Regierung mit Aufträgen einspringen – doch es ist bislang nichts Konkretes passiert, sie ist erstaunlich untätig. Reichert hofft nun, dass die Führung bei der Konjunkturförderung doch noch den Hebel umlegt. Manchmal passiert das in China über Nacht. Und die Bauaufträge fließen wieder.
Über rätselhafte Untätigkeit wundern sich auch politische Beobachter in Taiwan – und zwar im Umgang mit Corona. Das Verhalten der Regierung dort ähnelt derzeit eher dem deutschen Durcheinander bei der Pandemie-Bekämpfung. In Taiwan nimmt die Fallzahl bereits merklich zu, berichtet David Demes. Doch die taiwanische Regierung hält sich nicht an ihr ursprüngliches Konzept der vorausschauenden Eindämmung. Tatsächlich läuft der Ausstieg aus den Maßnahmen weiter, ein Lockdown gilt in Taipeh als inakzeptabel.
Wer jetzt vorschnell mit der Volksrepublik vergleichen will, sollte auf die Qualität der verwendeten Impfungen achten. In Taiwan kamen vor allem Moderna, Biontech und Astrazeneca zum Einsatz. Ein großer Teil der Bevölkerung ist also vor schweren Verläufen geschützt.


Der Kölner Uli Reichert, 66, verbrachte seit Ende der 80er Jahre sein Arbeitsleben mit dem Aufbau des Chinageschäftes von Wirtgen. Die Wirtgen Group ist einer der wichtigsten Hersteller von Straßenbaumaschinen. Sie macht rund drei Milliarden Euro Umsatz. Das Unternehmen produziert in Deutschland, Brasilien, China und Indien. 2017 übernahm der US-amerikanische Landmaschinenhersteller John Deere die Wirtgen Group für 4,4 Milliarden Euro. Im Mai gibt Reichert den Posten des China CEO ab, um noch zwei Jahre in der deutschen Zentrale als Berater zu arbeiten.
Herr Reichert, Sie waren 1988 zum ersten Mal in China, haben über 30 Jahre in Hongkong und auf dem chinesischen Festland gelebt. Im Straßenbaumaschinengeschäft haben Sie den großen Aufschwung erlebt, aber auch Krisen. Wie tiefgreifend ist die gegenwärtige Krise?
Die erste große Krise in den 90er-Jahren war die Asienkrise 1997 nach der Übergabe der britischen Kronkolonie Hongkong an China. Sie hat China nur am Rand getroffen. SARS 2002 war vor allem in Hongkong ohne allzu große Auswirkungen auf China und unser Geschäft. Als 2008 die Weltfinanzkrise ausgebrochen ist, hat Peking sofort ein Konjunkturpaket von rund 400 Milliarden US-Dollar aufgelegt. Kein Einbruch für unser Geschäft. Doch als dieses Paket 2012 auslief, hatten wir von 2011 auf 2012 einen deutlichen Rückgang zu verzeichnen. Zum ersten Mal in der Zeit, in der ich in China gelebt habe. Nun kommt auf meiner Zielgeraden der zweite Einbruch auf mich zu.
Wird es genauso schlimm wie 2012?
Das kann ich natürlich jetzt noch nicht sagen, weil das Jahr ja noch nicht rum ist. Klar ist allerdings: Es wird einen deutlichen Umsatzrückgang geben. Aber ich hoffe, dass die chinesische Regierung einen wirtschaftlichen Einbruch in großem Ausmaß nicht zulässt. Erst recht nicht in 2022 vor dem so wichtigen 20. Parteitag im Herbst dieses Jahres.
Was passiert gerade?
Besser wäre zu fragen, was passiert nicht. Es wird viel weniger Infrastruktur gebaut. In einem normalen Jahr würden im März, April und Mai zahlreiche Jahresauslieferungen abgewickelt. Doch die vergangenen Monate von November bis März waren die schwächsten Auslieferungsmonate der letzten sechs Jahre. Deswegen wird 2022 ein umsatzschwächeres Jahr. Es sei denn, die Regierung legt wie 2012 plötzlich den Hebel um und gibt so richtig Gas. 2012 ging das über Nacht. Doch derzeit sind die Anzeichen, dass sich kurzfristig etwas ändert, eher verhalten. Doch eigentlich wäre viel zu tun, folgt man dem 14. Fünfjahresplan. Es gibt bereits erhebliche Verzögerungen und meine Erfahrung in der Vergangenheit war immer so, dass der Fünfjahresplan bis auf geringe Abweichungen eingehalten wurde.
Wird der Plan diesmal eventuell nicht eingehalten?
Das habe ich wiederum in den vergangenen 30 Jahren noch nicht erlebt. Es gab Pläne, da war man in den ersten beiden Jahren 30 Prozent in Rückstand. Das wurde dann jedoch stets mit viel Anstrengung wieder aufgeholt.
Welches sind die Gründe für den Stillstand?
Nun ja, Stillstand haben wir immerhin noch nicht. Aber Omikron ist im Moment der größte Bremser. Dazu kommt die global instabile Lage, das schwierige Handelsverhältnis zwischen China und den USA, die Krise im Wohnungsmarkt und so weiter. Gründe kann man genug aufzählen. Das alles lähmt die Entscheidungsfreudigkeit unserer Kunden im Moment. Hinzu kommt, dass in den letzten Jahren sehr viele Baumaschinen in den chinesischen Markt geliefert wurden, vielleicht mehr als eigentlich notwendig waren. Mit denen können die Kunden auch noch ein Jahr länger über die Runden kommen, wenn sie es wollen.
Wie wirkt sich Omikron aus?
Unsere Fabrik in Langfang bei Peking ist seit dem 10. März zu. Immerhin durften wir vor einigen Tagen zum ersten Mal Personal in die Fabrik bringen, um wenigstens fertige Maschinen auszuliefern. Diese Mitarbeiter müssen nun in der Fabrik übernachten. Das ist kein Dauerzustand. Aber Langfang scheint die Entwicklung jetzt unter Kontrolle zu haben und wir hoffen, dass bald die ersten Schritte zu einer Normalisierung stattfinden.
Wie hat sich die gegenwärtige Krise angebahnt?
Zum Beispiel hatten wir vergangenen Oktober eine Großveranstaltung geplant, bei der wir 2.000 unserer Kunden eingeladen hatten. Da hat die Verwaltung der Wirtschaftszone in Langfang uns gebeten, das noch einmal zu überdenken. Eine klare Aussage in China. Und das betrifft natürlich nicht nur uns. Hier sind viele Zulieferer für Daimler und andere namhafte Hersteller. Über 1.000 Firmen. Bei Großveranstaltungen wie zum Beispiel der Bauma in Shanghai, der internationalen Fachmesse für Baumaschinen, oder unseren hausinternen Technologietagen machen wir hohe Umsätze. Das ist im Moment leider nicht durchführbar.
Wie ist die Stimmung bei den Kunden?
Die Kunden, in der Regel Privatunternehmen, haben uns offen gesagt, sie wissen nicht, wie das Jahr wird. Sie hätten keinerlei Sicherheit über die Auftragslage. Und sie hätten noch viele Forderungen bei ihren Auftraggebern – überwiegend Staatsunternehmen. Das schlägt dann irgendwann auf uns durch. Normalerweise ist kurz vor dem chinesischen Neujahr, dieses Jahr war das Anfang Februar, die beste Zeit, Geld einzutreiben. Das hat mit einer Mischung aus Ehre und Aberglauben zu tun. Die Chinesen wollen nicht mit Schulden ins neue Jahr. Doch dieses Jahr konnten unsere Kunden gerade mal knapp 50 Prozent ihrer Forderungen eintreiben. In einigen Unternehmen ist der Cashflow fast versiegt.
Das schlägt auf die Stimmung?
Ja, man kann sich leicht ausmalen, wie die Stimmung im Land derzeit ist. Im zweiten Halbjahr 2021 schon ist der Staat voll auf die Bremse getreten. Bei kleinen Bauunternehmen geht es inzwischen um die Existenz. In diesem Bereich sind keine Ausländer betroffen. Das sind praktisch ausschließlich chinesische Unternehmen. Das vergessen die Ausländer eben leicht, wenn sie jammern, dass alles schlimmer wird. Es trifft nicht nur sie, sondern vor allem unsere chinesischen Kunden, ohne die wir hier gar nicht existieren würden.
Und die Politik ignoriert das?
Premierminister Li Keqiang hat zwar in den vergangenen Monaten immer wieder betont, die kleinen Unternehmen müssen schneller für ihre geleistete Arbeit bezahlt werden. Da haben wir gedacht: Endlich kommt jetzt die Anordnung an die Staatsfirmen. Doch seltsamerweise passiert nichts. Dabei gab es auch schon Zeiten, in denen Staatsfirmen mit Geldstrafen belegt wurden, wenn sie ihre Schulden nicht bezahlt haben. Wir in der Branche fragen uns schon: Was ist da los in Peking? Es scheint, die Entscheidungsprozesse sind vor dem 20. Parteitag der Kommunistischen Partei besonders komplex. Inzwischen glaube ich den Ankündigungen erst, wenn sie auf der Straße, bei unseren Kunden und letztendlich auch bei uns angekommen sind.
Kann man von einem Vertrauensverlust in die politische Steuerung sprechen?
Die Politik sollte jedenfalls darauf achten, glaubwürdig zu bleiben. Schwierig ist auch, dass die Provinzen nicht immer das tun, was Peking will. Das war 2008 noch anders. Da kam die Finanzhilfen über Nacht, als die Weltfinanzkrise ausbrach. Daran wird die Regierung heute natürlich gemessen. Und die Erwartungen sind hoch: Seit 2012 ging es trotz vieler Unkenrufe in den westlichen Medien immer bergauf. In den Jahren 2013 bis 2017 sind wir jedes Jahr durchschnittlich im zweistelligen Prozentbereich gewachsen. 2018 bis 2021 war das Wachstum dann auf hohem Niveau nur noch einstellig.
Eine Langfassung dieses Interviews finden Sie hier.
Weltweit galt Taiwan lange als Corona-Musterschüler. Mehr als zwei Jahre hatte die demokratische Inselrepublik die SARS-CoV-2-Epidemie in Schach gehalten und war trotz mehrerer lokaler Ausbrüche der Alpha-, Delta und Omikron-Varianten des Virus immer wieder in der Lage gewesen, die Zahl der Neuinfektionen auf null zu drücken. Anders als in der benachbarten Volksrepublik China gelang dies auch ohne starke Einschränkungen des täglichen Lebens und der persönlichen Freiheiten. Ein Vorzeigemodell für viele Befürworter einer Null-Covid-Strategie – auch in Europa. Im dritten Jahr der Pandemie scheint die jüngste Variante Omikron BA.2 nun jedoch Taiwans Verteidigungswall durchbrochen zu haben.
Am Sonntag gab der Gesundheitsminister des Landes, Chen Shih-chung, auf seiner täglichen Pressekonferenz die neuesten Infektionszahlen bekannt: 16.936 lokale Fälle. Am Donnerstag zuvor musste Chen erstmals eine fünfstellige Zahl bekanntgeben. Insgesamt haben sich in Taiwan seit Beginn der Pandemie 121.515 Personen mit dem Coronavirus angesteckt, 853 von ihnen sind mittlerweile an den Folgen der Erkrankung verstorben. Zum Vergleich: In Deutschland starben im gleichen Zeitraum mehr als 134.000 Menschen an oder mit dem Virus.
Taiwan und China haben beide mit dem hoch virulenten Omikron zu kämpfen. Während die Behörden im chinesischen Shanghai jedoch einen Lockdown anordneten, entschied man sich in Taiwan anders. Trotz der seit Mitte März langsam steigenden Infektionszahlen erfolgte Anfang April eine Abkehr von der Null-Covid-Strategie und eine Fortsetzung der Öffnung des Landes.
Die Passivität verblüfft. “Vorbereitungen weit im Voraus zu treffen” (超前部署) – das war eigentlich das Erfolgsgeheimnis des Taiwan-Modells. Bereits am 31. Dezember 2019 hatte Taiwan damit begonnen, Reisende aus dem chinesischen Wuhan noch im Flugzeug auf Symptome der damals noch namenlosen Lungenerkrankung zu untersuchen. Drei Wochen später aktivierte Taipeh dann sein Central Epidemic Command Center (CECC), eine zentrale Regierungsbehörde, die als Lehre aus der SARS-Krise 2002 geschaffen wurde, um im Notfall behördenübergreifend Kompetenzen zu bündeln. Minister Chen, dem Chef oder “Kommandeur” (指揮官) des CECC, sind für die Dauer der Pandemie alle anderen Regierungsbehörden untergeordnet.
Nach zwei Jahren relativer Ruhe hatte es in Taiwan seit Anfang des Jahres immer wieder lokale Ausbrüche der Omikron-Variante BA.2 gegeben. Bestehende Maßnahmen, wie die zehntägige Quarantäne für ankommende Reisende und die allgemeine Maskenpflicht im öffentlichen Raum, reichten offenbar nicht mehr aus, um diese noch ansteckendere Variante des Coronavirus abzuwehren. Durch die hohe Anzahl von asymptomatischen Fällen blieben viele Infektionsketten unentdeckt und positive Fälle wurden oft erst beim vorgeschriebenen Test vor dem Betreten eines Krankenhauses identifiziert.
Bei einer Strategiesitzung in der präsidialen Residenz hatte Präsidentin Tsai Ing-wen am 6. April die wichtigsten Vertreter aus Regierung, CECC und der Regierungspartei DPP zusammengerufen, um sich über die neue Richtung der nationalen Pandemiebekämpfung abzustimmen. Am Nachmittag erklärte sie dann auf Facebook, Taiwan könne weder zurück zu Null-Covid, noch wolle man “mit dem Virus leben” (與病毒共存).
Neues Ziel sei stattdessen die “Reduzierung schwerer Verläufe auf null” und die “effektive Eindämmung leichter Verläufe” (重症求清零、有效管控輕症). Das sogenannte “Neue Taiwan-Modell” solle durch eine proaktive Virusbekämpfung und eine besonnene Öffnung sowohl Wirtschaftswachstum als auch ein normales Leben für die Bürgerinnen und Bürger ermöglichen.
Doch Taiwans erfahrene Seuchenpolitiker wurden von der Virulenz von Omicron BA.2 und seine Ausbreitungsgeschwindigkeit überrascht. Die vormals umständlichen Verfahren zur Nachverfolgung und Isolierung möglicher Kontaktpersonen positiver Fälle waren während des aktuellen Ausbruchs schon bald überfordert. Im Gespräch mit China.Table erzählt Huang Yu-fen, parteilose Stadtverordnete für die Bezirke Shilin und Beitou der Hauptstadt Taipeh, dass eine ihrer Mitarbeiterinnen auch vier Tage nach ihrem positiven Testergebnis noch keine offizielle Aufforderung erhalten habe, in Quarantäne zu gehen. Der Grund: Die Mitarbeiterin ist im benachbarten New Taipei City gemeldet. Ein anderes Gesundheitsamt ist für die Ausstellung zuständig. Die Übermittlung der Daten dauert jedoch einige Zeit. Huang Yu-fen war eine der ersten Volksvertreterinnen in Taiwan, die offen über ihr positives Testergebnis gesprochen hat. Infizierte werden teilweise noch immer von der Gesellschaft stigmatisiert.
Als Reaktion auf die offensichtliche Überlastung der Gesundheitsämter wurde die Kontaktverfolgung mittlerweile vereinfacht. Minister Chen erklärte, dass in Zukunft keine Bewegungsdaten von Einzelfällen mehr veröffentlicht werden. Außerdem wurde die Quarantäne für Kontaktpersonen von zehn auf drei Tage verkürzt. Bereits an Tag vier kann man sich jetzt aus der Quarantäne freitesten.
Einziges Problem: Es mangelte zunächst an Schnelltests. Erst am vergangenen Donnerstag hatte der Staat ein System zur rationierten Ausgabe von Schnelltests zu einem vergünstigten Preis auf den Weg gebracht. In den Tagen zuvor waren die Tests fast überall ausverkauft.
Obwohl die Regierung schnell auf die neue Lage reagiert, muss sie sich doch die Frage stellen lassen, warum man sich nicht schon “weit im Voraus” auf diese Situation vorbereitet hatte. Warum ist die Produktionskapazität von Schnelltests nicht schon vor Monaten erhöht und die Verwaltungsabläufe in den Gesundheitsämtern nicht vereinfacht worden? Die Stadtverordnete Huang Yu-fen glaubt, dass zu viel Zeit mit parteipolitischen Streitereien verschwendet wurde.
Huang ist dennoch vom Erfolg des Taiwan-Modells überzeugt. “Der Erfolg unserer Strategie ‘Vorbereitungen weit im Voraus zu treffen’ liegt doch darin, dass Taiwan die gewonnene Zeit genutzt hat, die Bevölkerung vor diesem großen Ausbruch weitgehend durchzuimpfen.” Aktuell sind 80 Prozent der Menschen in Taiwan vollständig geimpft, 59 Prozent sind geboostert. In der besonders gefährdeten Altersklasse der Über-75-Jährigen ist allerdings ein gutes Fünftel der Bürger ungeimpft.
Taipehs Bürgermeister Ko Wen-je hat nun für den Fall eines zu raschen Anstiegs der Infektionszahlen die Möglichkeit eines “weichen Lockdowns” (軟封城) ins Spiel gebracht, also eine Schließung aller Schulen und Restaurants. Die Stadtverordnete Huang hält das jedoch für nur schwer umsetzbar. Im vergangenen Jahr, als Taiwan im Mai die Stufe 3 der epidemischen Notlage ausgerufen hatte, habe man keine andere Wahl gehabt. Die Impfquote sei damals noch zu niedrig gewesen. Für einen Lockdown gebe es wegen der geringen Fallsterblichkeit nur geringe Akzeptanz. So wie in Deutschland.
Während Shanghai am Sonntag die immer erfolgreichere Unterdrückung der Infektionsketten verkündet hat, steuert Peking auf weitere Maßnahmen zu. Vorerst bis Mittwoch bleibt in der Hauptstadt während der Mai-Feiertage die Präsenzgastronomie geschlossen. Das Essen gibt es nur per Lieferung nach Hause. Läden dürfe nur mit aktuellem PCR-Test betreten werden, ein Schnelltest reicht nicht. Peking meldete am Sonntag 59 neu entdeckte Infektionen.
In Shanghai ist die Zahl der neu entdeckten Fälle derweil rapide gefallen. Am Sonntag war nur noch von 7872 neuen Fällen die Rede. Mitte vergangenen Monats waren es noch über 25.000 täglich. Die Bürger der Stadt schimpfen jedoch immer lauter über die lang anhaltenden Ausgangssperren. Sie protestierten, indem sie mit Kochtöpfen an ihren Fenstern schepperten und damit in der ganzen Stadt Lärm machten. fin
Die Ukraine beruft sich auf ein Abkommen von 2013, in dem China ihr Hilfe im Fall eines Angriffs oder einer nuklearen Bedrohung zugesagt hat. Dieser Fall sei nun eingetreten, sagte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba am Samstag gegenüber chinesischen Staatsmedien. “Die Ukraine prüft derzeit die Möglichkeit, Sicherheitsgarantien von ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen zu erhalten, einschließlich China”, sagte Kuleba der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua.
Auch sonst haben Chinas gelenkte Medien am Sonntag viel über das Weltgeschehen berichtet. Ein Schwerpunkt war auch Deutschland. Viel Beachtung erhielt der angekündigte Besuch von Friedrich Merz in Kiew und die Zusage von Unterstützung durch Olaf Scholz. Vergleichsweise viel Raum nahmen Berichte über eine Petition ein, die Scholz von der Lieferung abhalten will, weil dann der Dritte Weltkrieg drohe. fin
Chipmangel und weitere Probleme mit der Teileversorgung belasten nun nicht mehr nur die deutschen Auto-, sondern auch die Fahrradhersteller. “Bei E-Bikes haben wir ein ähnliches Chipproblem wie die Autoindustrie”, zitiert die Nachrichtenagentur dpa Burkhard Stork, Geschäftsführer des Zweirad-Industrie-Verbands. “Es fehlen nicht die Akkus, sondern die Chips für die Steuerung der Batterieladung und für die Displays.”
“In Ländern mit strikten Corona-Beschränkungen wie China, Malaysia, Singapur oder Vietnam standen in den vergangenen zwei Jahren viele Werke zeitweise still, sodass Komponenten und Teile fehlten”, erläuterte Stork. “Die derzeitigen Lockdowns in China führen wieder zu Lieferverzögerungen. Deswegen müssen Produktionspläne kurzfristig geändert werden. Das geht an die Substanz auf beiden Seiten”, sagte der ZIV-Geschäftsführer zur Lage bei Fahrradherstellern und -händlern.
Dramatisch bleibt die Lage für die deutschen Autobauer. Der Branchenzeitung “Automobilwoche” zufolge werden sie wegen Problemen mit der Teileversorgung rund 700.000 Autos weniger fertigen können als zu Jahresanfang geplant. Das Medium beruft sich auf Daten des Dienstleisters IHS Markit. Besonders betroffen sei Volkswagen. Die Marke VW verliere in diesem Jahr über eine halbe Million Einheiten. Bei Mercedes fehlten am Ende des Jahres 80.000 geplante Fahrzeuge, bei BMW sogar 100.000. Diese Prognosen stehen unter dem Vorbehalt weiterer Einschränkungen in der Lieferkette durch den Krieg in der Ukraine und den Corona-Lockdown in China, heißt es. rtr/flee
Der weltgrößte Elektroautobauer Tesla muss erneut Tausende Fahrzeuge seines “Model-3” in China zurückrufen. Insgesamt handele es sich um 14.684 Wagen, die zwischen Januar 2019 und März 2022 produziert worden seien, teilte die chinesische Aufsichtsbehörde mit. Es gehe um Softwareprobleme, die unter Extrembedingungen zu Kollisionen führen könnten. Für Tesla ist es bereits der zweite Rückruf im April. Der US-Konzern musste zuvor bereits rund 128.0000 Model-3-Autos wegen potenzieller Fehler bei Halbleiterteilen in die Werkstätten ordern. rtr/nib
Die Parteiführung erwägt nun doch, mit Hilfspaketen eine zu starke Konjunkturabkühlung verhindern. “Die Covid-19- und die Ukraine-Krise bringen Risiken und Herausforderungen”, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Freitag eine Mitteilung des Politbüros. China werde der Industrie, aber auch kleinen Firmen unter die Arme greifen. Ebenso werde man eine gesunde Entwicklung des Immobilienmarktes fördern und ein stabiles Funktionieren der Kapitalmärkte gewährleisten. Damit sollen systemische Risiken abgewendet werden. Art und Umfang der Förderung sind jedoch noch unklar. Die Staatsführung kündigte an, das Wirtschaftswachstum in einem “vernünftigen Rahmen” zu halten und die sozialen und wirtschaftlichen Ziele für 2022 zu erreichen. niw/rtr

In der zentralchinesischen Großstadt Changsha, der Hauptstadt von Hunan, ist am Freitag ein Gebäude eingestürzt. Internationalen Agenturberichten zufolge befanden sich darin Wohnungen, ein Hotel und ein Kino. Die Nachrichtenagentur Xinhua spricht dagegen von einer “selbst zusammengezimmerten Konstruktion”. Dem Fernsehsender CCTV zufolge haben die Bewohner “bauliche Veränderungen” vorgenommen, die der Stabilität geschadet haben. Die Staatsanwaltschaft untersucht nun, warum die Bauaufsicht nicht eingeschritten hat. Am Sonntag hat die Polizei neun Personen festgenommen. Bisher berichten chinesische Medien von sieben Menschen, die aus den Trümmern gerettet werden konnten. Zwei bis drei Dutzend Personen werden vermisst. fin

Der vorhersehbare Zyklus der Abwärtskorrekturen der Prognosen über die weltwirtschaftlichen Aussichten hat offiziell begonnen. Das war die Botschaft des kürzlich vom Internationalen Währungsfonds (IWF) veröffentlichten halbjährlichen World Economic Outlook, der frühere Korrekturen mehrerer prominenter privater Prognoseteams bestätigt.
Die weitgehend in Reaktion auf den Krieg in der Ukraine vorgenommene Korrektur ist groß: Prognostiziert wird für 2022 nun ein deutlich geringeres weltwirtschaftliches Wachstum von 3,6 Prozent, volle 1,3 Prozentpunkte unter der nur sechs Monate zuvor abgegebenen globalen Wachstumsprognose des IWF von 4,9 Prozent. Man muss dem IWF zugutehalten, dass er mit einer bereits im Januar veröffentlichten zwischenzeitlichen Abwärtskorrektur von 0,5 Prozentpunkten vor dieser Entwicklung warnte. Trotzdem ist dies mit Blick auf die vergangenen 15 Jahre die drittgrößte Prognosesenkung im regelmäßigen sechsmonatigen Korrekturzyklus des IWF.
Als sich im April 2009 die globale Finanzkrise entfaltete, senkte der IWF seine globale Wachstumsprognose für das Jahr um 4,3 Prozentpunkte (und erwartete statt dem vor der Krise projizierten positiven Wachstum von drei Prozent also eine Kontraktion von -1,3 Prozent). Und natürlich senkte der IWF, als Anfang 2020 die COVID-19-Pandemie ausbrach, seine Wachstumsprognose für das Jahr steil um 6,4 Prozentpunkte (von vor der Pandemie projizierten 3,4 Prozent zu einer Kontraktion von minus drei Prozent). In beiden diesen früheren Fällen sagten die sehr großen Absenkungen der Prognosen eine steile weltweite Rezession vorher; tatsächlich handelte es sich um die beiden schlimmsten Rezessionen in der modernen Geschichte.
Doch glauben weder der IWF noch die meisten anderen Prognostiker, dass das aktuelle weltweite Wachstumsdefizit die Welt in eine echte Rezession stürzen wird. Der jüngste World Economic Outlook sagt eine perfekte weiche Landung der 96 Billionen Dollar schweren Weltwirtschaft vorher. Laut der jüngsten Korrektur soll sich das weltweite Wachstum 2022/23 nun komfortabel auf einem Wachstumspfad von 3,6 Prozent einpendeln; das liegt um einen Bruchteil über dem Durchschnittswert seit 1980 von 3,4 Prozent. Sehr viel weicher kann eine Landung nicht ausfallen.
Doch könnte dies aus mehreren Gründen Wunschdenken sein. Zunächst einmal waren die Prognostiker bei ihrer Extrapolation des “Zuckerhochs” des Jahres 2021 in die Zukunft übertrieben optimistisch. Der Anstieg des weltweiten Wachstums um 6,1 Prozent im Jahr 2021 war laut den bis ins Jahr 1980 zurückgehenden IWF-Statistiken die bisher steilste Erholung überhaupt. Doch folgte diese auf den steilsten je verzeichneten Absturz: einen Einbruch auf -3,1 Prozent in 2020. Genau wie Anfang 2020 die COVID-Lockdowns den größten Teil der Weltwirtschaft praktisch zum Stillstand brachten, brachte die Wiederöffnung in Verbindung mit aggressiven geld- und fiskalpolitischen Konjunkturimpulsen die Mutter aller wirtschaftlichen Erholungen hervor.
Prognostiker und Anleger extrapolieren aktuelle Trends in die Zukunft; daher ist es wichtig, sich die außergewöhnliche Volatilität der Jahre 2020/21 vor Augen zu führen, um eine klare Vorstellung davon zu erhalten, welchen Trend es fortzuschreiben gilt. Das durchschnittliche weltweite BIP-Wachstum jener zwei Jahre lag bei gerade mal 1,5 Prozent und damit deutlich unter der offiziellen globalen Rezessionsschwelle, von der weithin angenommen wird, dass sie bei etwa 2,5 Prozent liegt. Man muss nicht erwähnen, dass, wenn sich das weltwirtschaftliche Wachstum stärker in Richtung dieses grundlegenden Trends verlangsamt als hin zum Pfad der weichen Landung, eine weitere globale Rezession alles andere als abwegig ist.
Ein zweiter Grund, den optimistischen Prognosen zu misstrauen, ist, dass dem chinesischen Wachstumspolster die Luft ausgegangen ist. Chinas Wirtschaft wächst derzeit deutlich langsamer als mit dem Tempo von fast acht Prozent der Jahre 2010-2019. Die jüngste IWF-Prognose sieht das durchschnittliche chinesische Wachstum in 2022/23 bei 4,75 Prozent. Das ist kaum mehr als die Hälfte des Trends im Gefolge der globalen Finanzkrise, als ein starkes chinesisches Wachstum faktisch das Einzige war, das während des Zeitraums von 2012 bis 2016 einen Rückfall der Welt in die Rezession verhinderte. Wie damals ist eine globale Resilienz ohne eine dynamischere chinesische Volkswirtschaft höchst unwahrscheinlich.
Dieses Risiko besteht heute. Angesichts des Dreiklangs an Erschütterungen, denen China derzeit ausgesetzt ist – einer neuen COVID-19-Lockdownwelle, anhaltendem Entschuldungsdruck (insbesondere in Chinas instabilem Immobiliensektor) und aus seiner unklugen Partnerschaft mit Russland resultierenden kriegsbedingten Kollateralschäden – kann sich die Welt nicht länger auf China als Quelle der Resilienz stützen. Das gilt natürlich in beide Richtungen. Falls China sein Bekenntnis zu Russland vertieft, wird es an der Isolation seines “Komplementärs” teilhaben. Da die chinesische Wirtschaft weiterhin stark auf die übrige Welt angewiesen bleibt, könnte sich dies als Präsident Xi Jinpings größte Herausforderung erweisen.
Drittens geht der Abschwung des globalen Wachstumszyklus mit einem deutlichen Aufschwung bei den weltweiten Inflations- und Zinszyklen einher. Die Vertreter der These von der weichen Landung tun die Folgen hiervon verächtlich ab. Während die Inflation auf den höchsten Stand in 40 Jahren steigt, ist nun verantwortungsloses Gerede zu vernehmen, dass sie ihren Höchststand bereits erreicht habe – die überspannte Vorstellung, dass die Situation inzwischen so schlimm sei, dass es nur noch besser werden könne.
Dieses oberflächliche arithmetische Argument geht am Kern des Problems vorbei. Angesichts eines im März steil um 8,5 Prozent gestiegenen US-Verbraucherpreisindex besteht natürlich eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass dieses wichtige Inflationsbarometer zum Jahresende deutlich niedriger liegen wird. Aber wie viel niedriger? Ausreichend niedrig, um die US Federal Reserve vor den Folgen ihres unverantwortlichsten geldpolitischen Vorgehens seit Mitte der 1970er und Anfang der 1980er Jahre zu retten?
Man sollte nicht darauf zählen. Während sich die Fed derzeit knallhart gibt, ist Reden billig. Bisher hat sie nur 25 Basispunkte – oder gerade mal zehn Prozent – der 250 Basispunkte an kumulativer Straffung abgeliefert, die die Finanzmärkte für die nächsten sechs Monate erwarten. Und selbst wenn die Fed die erwarteten Schritte unternimmt und die Federal Funds Rate bis November auf 2,5 Prozent anhebt, dürfte der nominale Leitzins deutlich unter der Inflationsrate liegen.
Das bedeutet, dass die reale (inflationsbereinigte) Federal Funds Rate im gesamten Jahresverlauf negativ bleiben dürfte. Damit wäre der reale Leitzins dann für einen Zeitraum von 38 Monaten negativ – eine deutlich stärkere Stimulierung der Konjunktur als in früheren Phasen stark akkommodierender Geldpolitik unter Alan Greenspan, Ben Bernanke und Janet Yellen. Die Realzinsen spielen für die Bewahrung der Preisstabilität und die Steuerung des Wirtschaftswachstums eine wichtige Rolle. Und das Fazit bei der Beurteilung des globalen Wirtschaftszyklus ist, dass der Anstieg der Realzinsen noch deutlich weiter gehen muss.
All dies unterstreicht die sich innerhalb der Weltwirtschaft aufbauenden Risiken. Als ehemaliger Wall-Street-Prognostiker kann ich mich in die Denkweise der meisten Prognoseteams, einschließlich der hochtalentierten Fachleute des IWF, hineinversetzen, die glauben, alle denkbaren Risiken berücksichtigt zu haben. Die Finanzmärkte sind in diesem Fall der gleichen Meinung; sie sind überzeugt, dass eine inflationsanfällige Welt mit noch immer unglaublich akkommodierenden Notenbanken irgendwie in wunderbarer Weise sanft auf eine weiche Landung zusteuert, an die man sich noch lange erinnern wird. Aber kann dieses schon jetzt rosige Szenario ohne China wirklich funktionieren? Träumen Sie weiter.
Stephen S. Roach ist Professor an der Universität Yale und ehemaliger Chairman von Morgan Stanley Asia. Er ist der Verfasser von Unbalanced: The Codependency of America and China (Yale University Press, 2014) und des in Kürze erscheinenden Accidental Conflict: America, China, and the Clash of False Narratives (Yale University Press, November 2022). Übersetzung: Jan Doolan.
Copyright: Project Syndicate, 2022.
www.project-syndicate.org
Yu Jianhua wurde zum Parteisekretär der Allgemeinen Zollverwaltung ernannt. Zwischen 2013 und 2017 war er Chinas Botschafter bei der Welthandelsorganisation (WTO). Er leitete Verhandlungen über Freihandelsabkommen und hat Chinas Beitrittsgesuch zur Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) verantwortet.
William Ding Lei, Gründer und CEO von NetEase ist von seinen Funktionen als Direktor, Geschäftsführer und gesetzlicher Vertreter der Beijing NetEase Media Co. zurückgetreten. Die Stelle wird künftig von Li Li, CEO von NetEase Media mit Sitz auf den Kaimaninseln übernommen, wie die South China Morning Post berichtet.

Im chinesischen Straßenbild blitzen in diesen Tagen nicht mehr Schönheiten und Schönlinge mit hellem Teint auf, sondern Hellhäuter mit Coronabezug: die sogenannten “dabai”. So nämlich hat der chinesische Volksmund die medizinischen Mitarbeiter, Helfer und Ordnungshüter in weißer Schutzmontur getauft, die den mancherorts turbulenten Corona-Ausnahmezustand im Land managen.
Interessanterweise geht die Wortneuschöpfung auf einen Disneyfilm zurück, und zwar “Big Hero 6” aus dem Jahr 2014, der damals das chinesische Popcornpublikum scharenweise in die Kinosessel lockte. In Deutschland ging der Animationsstreifen unter dem Titel “Baymax – Riesiges Robowabohu” an den Start, in Anspielung an den Protagonisten des Films: ein persönlicher Gesundheitsroboter namens Baymax. Und der heißt auf Chinesisch 大白 dàbái (“großer Weißer”). Der weiße Riese im Michelin-Männchen-Look konnte dank Spezialprogrammierung sogar Karate. Der chinesische Namensvetter allerdings, der optisch tatsächlich entfernt an das Animationsoriginal erinnert, wirbelt vor allem Wattestäbchen beim PCR-Test und schleppt außerdem weiße Plastiktüten mit Lebensmitteln durch die Häuserschluchten.
Wer auf Weibo nach dem Hashtag “dabai” sucht, findet einen wilden Mix an Posts rund um die weißen Riesen. Viele User zollen dem schweißtreibenden Einsatz der Seuchenhelfer Respekt, die teils Tage lang in den weißen Kunststoffanzügen stecken. Es werden aber auch immer wieder Szenen gepostet, in denen Lockdown-müde “dabais” mit frustrierten Anwohnern (verbal oder sogar handfest) aneinandergeraten oder rigoros die angeordneten Coronamaßnahmen durchsetzen.
Das Verhältnis zu den “Helfern in Weiß” ist also gespalten. Ähnlich sieht es übrigens auch in der chinesischen Sprache aus, wenn man einmal die Farbe Weiß genauer unter die Lupe nimmt. Zum einen weckt diese nämlich positive Konnotationen, da “weiße” Haut in China bekanntlich als Schönheitsideal gilt. Ein ganzes Branchensegment (genannt 美白 měibái “Schönheitsweiß”) hat sich mit unzähligen Produkten dem Bleichen der Haut verschrieben. Kein Wunder, dass die 白富美 báifùměi (wörtlich “weiße und wohlhabende Schönheit”) Chinas Synonym für “Traumfrau” ist (das männliche Pendant heißt übrigens 高富帅 gāofùshuài – “hochgewachsener und wohlhabender Beau”).
Traditionell aber ist die Farbe Weiß in China weniger positiv besetzt. Sie gilt als Farbton von Beerdigungen und Totentrauer (白事 báishì “weiße Angelegenheit” bedeutet “Trauerangelegenheit” oder “Beerdigung”) und ist damit das Gegenstück zur Freuden-, Hochzeits- und Glücksfarbe Rot (红事 hóngshì “freudige Angelegenheit, Hochzeit” – wörtlich “rote Angelegenheit”). In der Pekingoper sind die Schurken traditionell weiß geschminkt, weshalb “Bleichgesicht” (白脸 báiliǎn) ein Synonym für “Bösewicht” ist. Das “Bleichgesicht spielen/singen” (唱白脸 chàng báiliǎn) ist ein umgangssprachlicher Ausdruck für “sich hart stellen, den Bösewicht geben”. Das kulturelle Negativimage der Farbe wurde im Laufe der Sprachentwicklung sogar grammatikalisiert. So heißt “etwas weiß tun” (bái + Verb) Dinge “umsonst/vergeblich” oder auf gut Deutsch “für die Katz” machen (zum Beispiel 白等 bái děng “vergeblich warten”, 白跑一趟 bái pǎo yī tàng “umsonst irgendwo antanzen/hinrennen”, 白做核酸检测 bái zuò hésuān jiǎncè “umsonst einen Coronatest machen”).
In diesem Sinne bleibt zu hoffen, dass das Covid-Tohuwabohu nicht umsonst war und in China bald wieder Corona-Normalität einkehrt – damit wieder “baifumei” das Straßenbild prägen und nicht mehr die “dabai”.
Verena Menzel betreibt in Peking die Online-Sprachschule New Chinese.