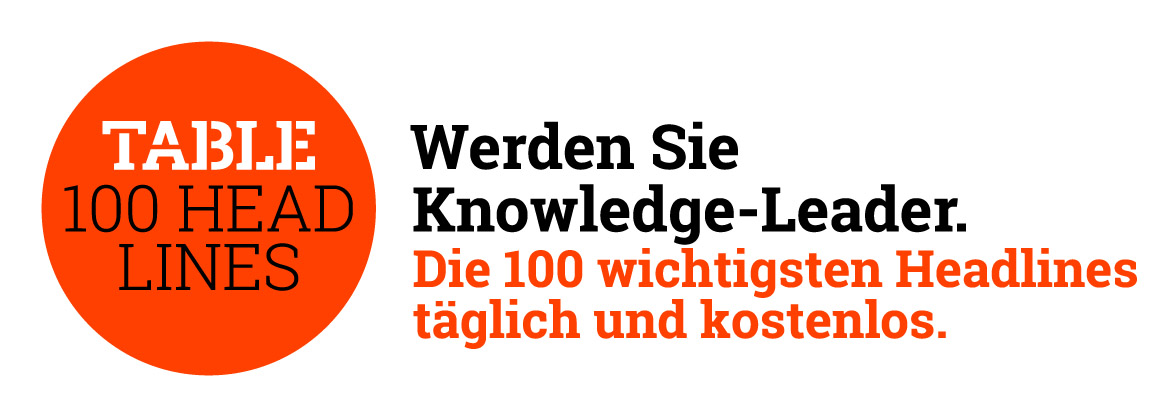der Transrapid galt als Beleg deutscher Innovations- und Ingenieurskunst, bevor er zum Milliardengrab und politischen Desaster wurde und schließlich im Emsland in einer menschlichen Tragödie endete. China hat die Magnetschwebetechnik seither weiterentwickelt und plant nun mehrere Hochgeschwindigkeitsstrecken. Um das ambitionierte Projekt voranzutreiben, prüft der Staatskonzern CRRC nun, mit deutschen und europäischen Partnern zusammenzuarbeiten und die einstige Transrapid-Teststrecke in Lathen zu revitalisieren. Eine erste Anfrage im Emsland wurde China.Table bestätigt, Frank Sieren hat die Einzelheiten.
Scheinbar völlig unberührt von internationaler Kritik beendeten die chinesischen “Volksvertreter” den Nationalen Volkskongress 2021 gestern mit dem Beschluss, für die politischen Gremien in Hongkong in Zukunft nur noch “patriotische”, heißt Peking-treue, Abgeordnete zuzulassen. Marcel Grzanna ordnet diesen Anschlag auf die Demokratie ein. Man darf gespannt sein, wie der Vorgang das amerikanisch-chinesische Außenminister-Treffen am kommenden Donnerstag in Alaska beeinflussen wird.
Wie die chinesische Regierung seit Jahrzehnten den Vorwurf der “Verletzung der Gefühle des chinesischen Volkes” zur Durchsetzung außenpolitischer Interessen einsetzt – und vor allem: wie erfolgreich sie damit ist – seziert Johnny Erling heute. Auch Angela Merkel wurde der Vorwurf einst gemacht. Doch längst ist sie zur “lao pengyou”, einer “altehrwürdigen Freundin des chinesischen Volkes” geworden.

Unter der Regie des staatlichen Eisenbahnkonzerns China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) wurden in den letzten Jahren zwei Transrapid-Prototypen entwickelt. Einer der Züge mit dem Namen CRRC 600, der aus sechs Elementen besteht, ist eine Weiterentwicklung des Transrapid TR08, der damals von ThyssenKrupp hergestellt wurde. Es wird nicht schneller als 600 Kilometer pro Stunde fahren können.
Der zweite Zug wird von der Southwest Jiaotong University Chengdu und CRRC entwickelt. Es könnte ein sogenannter Hyperloop-Zug werden, der auch über 1000 Kilometer pro Stunde fährt.
Der größte technische Unterschied: Der Hyperloop ist ein Transrapid 2.0, der in einer wahrscheinlich durchsichtigen Acryl-Röhre fahren soll, in der ein Vakuum erzeugt wird. Damit hat der Zug keinen Luftwiderstand zu überwinden. Anders sind die hohen Geschwindigkeiten, die denen eines Flugzeuges entsprechen, technisch nicht zu erreichen.
Die Magnetschwebetechnik wurde vom chinesischen Ministerium für Wissenschaft und Technologie bereits 2002 als Schlüsseltechnologie eingestuft. Insgesamt sind seitdem über 30 chinesische Unternehmen und Forschungseinrichtungen unter der Führung von CRRC an dem Projekt beteiligt.
Die CRRC ist der größte Zughersteller der Welt und einer der größten Industriekonzerne. Das in Shanghai und Hongkong Börsen-gelistete Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von rund 20 Milliarden Euro.
Nachdem die Zentralregierung entschieden hat, die Magnetschwebe-Technologie in großem Umfang zu nutzen, steht die CRRC nun unter erheblichem Erfolgsdruck. Denn bis spätestens 2030 sollen mehrere tausend Kilometer Magnetschwebebahn in China gebaut werden. Die beiden wichtigsten Strecken sind Peking – Guangzhou – Shenzhen und Shanghai – Guangzhou – Shenzhen. Es ist geplant, in gut dreieinhalb Stunden von Peking nach Shenzhen reisen zu können. Der Flug dauert zweieinhalb Stunden. Innerhalb von nur zweieinhalb Stunden soll der Transrapid 2.0 von Guangzhou nach Shanghai schweben. Schon heute verfügt China über das größte konventionelle Hochgeschwindigkeitsnetz der Welt mit Zügen, die gut 300 Kilometer pro Stunde fahren.
Aber auch eine kürzere Strecke von knapp 200 Kilometern Länge in die neue Verwaltungsstadt Xiongan, in der Nähe von Peking, ist geplant. Sie gilt als eines der wichtigsten Projekte von Staats- und Parteichef Xi Jinping. Es soll ein Pendlerzug mit Hyperloop-Technik werden, der 800 Kilometer pro Stunde fährt.
Um die Technologie auf diesen Strecken alltagstauglich zu machen, haben die Chinesen sie weiterentwickelt. Das Vorhaben ist Teil der Klimastrategie, die Staatpräsident Xi Jinping im Herbst 2020 verkündet hat und deren Ziel es ist, China bis 2060 klimaneutral zu machen.
Damit das Schnellzug-Projekt vorankommt, plant CRRC die Technologie mit europäischen Partnern, wie etwa Thyssen-Krupp, Knorr-Bremse oder Beckhoff, weiterzuentwickeln und für die Tests die deutsche Teststrecke in Lathen zu revitalisieren.
Im Zentrum der europäisch-chinesischen Zusammenarbeit stünde Hardt Hyperloop, ein holländisches Startup, an dem auch der deutsche Investor Frank Thelen mit einem zweistelligen Millionenbetrag beteiligt ist. Die CRRC und Hardt sind bereits im Gespräch. Hardt ist, ebenfalls mit Unterstützung deutscher Zulieferer, in einigen Entwicklungsbereichen weiter als CRRC – zum Beispiel bei elektronischen Weichen, den Röhren, Vakuumpumpen oder der Bremstechnologie.
In Las Vegas gibt es ein ähnliches Projekt, finanziert unter anderem von Richard Bransons Virgin Group. Die Chinesen haben sich jedoch aus politischen Gründen entschieden erst einmal nicht mit den Amerikanern zusammenzuarbeiten.
Ralf Effenberger, Geschäftsführer der INTIS GmbH und Leiter der Transrapid Versuchsanlage Emsland, hat gegenüber China.Table bestätigt, dass ihm die CRRC-Anfrage bezüglich Lathen bekannt ist. “Damit die Anlage wieder in Betrieb genommen werden kann, muss durch sie auch ein nationales Interesse verfolgt werden, so sieht es das Gesetz vor”, erläutert Effenberger. “Da zahlreiche deutsche Unternehmen von dem Projekt profitieren würden, ist dieser Fall sicherlich gegeben.” Es sei geradezu “eine Win-Win-Situation”. Heute würden so große Projekte nicht mehr von einem Unternehmen oder einer Nation alleine entwickelt. Die Teststrecke in Lathen könnte ein Beispiel dafür werden “wie globale Kooperation zur Erschließung einer neuen klimafreundlicheren Transporttechnologie funktionieren kann.”
Ob die chinesisch-europäische Kooperation mit einer wiederbelebten Teststrecke in Lathen am Ende wirklich funktioniert? Parallel zu dem Vorstoß der CRRC in Lathen hat der Abgeordnete Yang Jun, der die Stadt Qingdao vertritt, im Nationalen Volkskongress in dieser Woche einen Antrag gestellt, eine 150 Kilometer lange Teststrecke von der Küstenstadt Qingdao nach Ri Zhao zu bauen.
Die Anlage in Emden war nach dem Stopp des Transrapid-Projektes in Deutschland weiter als Touristenattraktion in Betrieb, bis sie 2006 nach einem schweren Unfall mit 23 Toten stillgelegt wurde.
“Es ist möglich, die Anlage innerhalb von maximal 18 Monaten wieder betriebsfähig zu kriegen”, sagt Effenberger. Das sei allerdings nur eine erste Schätzung. Denkbar sei auch die Anlage noch auszubauen.
Parallel zu den Überlegungen einer Teststrecke in Deutschland gibt es bereits eine erste Übereinkunft der Southwest Jiaotong Universität in Chengdu, mit der Universität in Oldenburg und der Fachhochschule Emden-Leer eng zusammenzuarbeiten. Die Universitäten sind in ihren jeweiligen Ländern führend in der Magnetschwebetechnik.
Zudem hat die CRRC bereits im Mai vergangenen Jahres das Lokomotivenwerk Vosslow in Kiel gekauft. Dies könnte der europäische Standort von CRRC werden. Es ist jedenfalls geplant, dass die Züge auch eine europäische Zulassung bekommen sollen und auch in Europa produziert werden soll. Schon im März 2016 hat die CRRC die sächsische Firma Cideon erworben – den Angaben zufolge der erste Kauf der Chinesen in Europa. Das Bautzener Unternehmen bietet etwa die technische Neuentwicklung, Modernisierung oder Umrüstung von Schienenfahrzeugen an.
Für Lathen spricht aus Sicht der Chinesen vor allem, dass die Züge leicht dorthin zu transportieren sind. Sie würden per RoRo-Schiff von China bis nach Bremerhaven transportiert und von dort weiter durch den Weser-Ems-Kanal bis zum Hafen Doerpe, der rund vier Kilometer von Lathen entfernt ist.
2003 hatten Bundeskanzler Gerhard Schröder und der damalige chinesische Ministerpräsidenten Zhu Rongji eine kommerzielle Teststrecke in Shanghai eröffnet. Die Transrapid-Technologie war ursprünglich von Thyssen-Krupp und Siemens entwickelt worden, wobei Siemens von Anfang an mehr Interesse hatte, die klassische Rad-Schiene-Technik des ICE nach China zu verkaufen, weil bei diesen Zügen mehr zu verdienen war. Inzwischen ist China das einzige Land der Welt, das fast 20 Jahre Alltagserfahrung mit der Magnetschwebetechnik mit über 90 Millionen Passagieren hat.
15.03.2021, 5:00-6.30 PM (EST)
Webinar, SOAS London: Aspects of Defense Industrialization in China, 1949-1989. Anmeldung
16.03.2021, 19:00-20:30 Uhr
Clubhouse, Stiftung Asienhaus: Digitalisierung, Zensur und Zivilgesellschaft in China. Mehr
17.03.2021, 10:00-11:00 AM (EST)
Vortrag, Harvard Center for Chinese Studies: Qing Yang – A Ready-to-Implement Carbon-Negative Option to Help China Achieve Carbon Neutrality: Biochar with Biofuels Mehr
17.03.2021, 19:00-20:30 Uhr
Vortrag, KI Nürnberg-Erlangen: Chinas volkswirtschaftliche Neu-Ausrichtung von Markus Taube Mehr
17.03.2021, 12:30-1:45 Pm (EST)
Webinar, Harvard Center for Chinese Studies: How the Democratic States are Responding to China’s Political Interference Activities. Mehr
18.03.2021, 9:00-11:30 Uhr
Vortrag, AHK Taiwan: Zusammenarbeit mit Taiwan bei Blockchain und Künstliche Intelligenz mit Taiwans Digitalministerin Audrey Tang. Anmeldung
18.03.2021, 9:30-10:30 Uhr
Vortrag, Merics: China´s Social Credit System in 2021. Mehr
18.03.2021, 13:00-14:00 Uhr
Vortrag, Uni-Göttingen: China´s R-AI-se: The Digital New Silk Road and China´s Global AI Dreams Mehr
18.03.201, 18:30 Uhr
Vortrag, KI Hamburg: Die Welt als gemeinschaftlicher Besitz – China zwischen Konfuzianismus, Marxismus und Demokratie. Anmeldung
18.-24.03.2021
Filmfest, KI Erlangen-Nürnberg: 6. Chinesisches Filmfestival: Unruhestand? – Altern in China. Mehr
Der Dolchstoß für Hongkongs verbliebene demokratische Strukturen wurde begleitet von einem langen Applaus der politisch Verantwortlichen. 2895 Delegierte des Nationalen Volkskongresses (NVP) in Peking hatten am Donnerstag für die vorgelegte Wahlrechtsreform gestimmt, die aus dem ehemals wettbewerbsorientierten Hongkonger Regierungssystem endgültig eine obrigkeitshörige Attrappe im Sinne der Volksrepublik China macht.
Die pro-demokratische Tageszeitung Apple Daily stellte fest, dass keine andere Entscheidung des chinesischen Parlaments an diesem Tag mit mehr Beifall durch das Plenum bedacht wurde als jene, die Hongkongs Opposition in die Bedeutungslosigkeit verbannt. Das nahezu einstimmige Ergebnis mit nur einer Enthaltung stellte sogar die Verabschiedung des Nationalen Sicherheitsgesetzes vor einem Jahr an Ort und Stelle in den Schatten. Damals stimmten sechs Delegierte dagegen.
“Die Regierung Hongkongs und ich stehen fest hinter dieser Entscheidung und wollen aus tiefstem Herzen unsere Dankbarkeit ausdrücken”, kommentierte Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam das Resultat der Abstimmung, die ebensowenig auf demokratischen Grundsätzen beruhte wie die künftige Wahl des Hongkonger Legislativrats, dem gesetzgebenden Organ der früheren britischen Kronkolonie. Es gehe nicht darum, die Opposition auszublenden, sondern darum, sicherzustellen, dass Hongkong in Zukunft von Patrioten regiert würde, erklärte Lam. Sie schloss sich damit der Forderung aus Peking an, dass Exekutive, Legislative und Judikative Hongkongs sich nur noch aus “wahren Patrioten” zusammensetzen dürfe. Um das zu gewährleisten, führte die Stadt sogar ein neues Gesetz ein, das Amtsträgern einen Eid abverlangt, patriotisch – und damit im Geiste der Kommunistischen Partei – zu handeln. Was patriotisch ist, bestimmt die Partei. Wer das Gesetz bricht, verliert seinen Posten.
Im pro-demokratischen Lager wurde die Abstimmung mit Bedauern zur Kenntnis genommen. “Es ist ein sehr trauriger Beschluss für Hongkong. Ich glaube, dass die künftigen Mitglieder des Legislativrats immer weniger die Bürger der Stadt repräsentieren werden. Stattdessen werden es Loyalisten sein, denen die Hände gebunden sind und die in keinster Weise die Menschen in Hongkong vertreten werden”, sagte Lo Kin-hei, Vorsitzender der Demokratischen Partei.
Das schon seit Jahren ausgehöhlte demokratische Wahlsystem Hongkongs wurde durch den Nationalen Volkskongress jetzt noch einmal so umgebaut, dass Peking keine Angst mehr vor bösen Überraschungen zu haben braucht. “Schlupflöcher” seien damit gestopft worden, die von jenen genutzt werden könnte, die Hongkong schaden wollten, hieß es. Kernpunkte der Reform sind die personelle Aufstockung zweier Gremien. Zum einen wird der Ausschuss, der Regierungschef oder -chefin wählt, von 1200 auf 1500 Wahlberechtigte aufgestockt. Gleichzeitig wird auch die Mitgliederzahl des Parlaments, also des Legislativrats, von 70 auf 90 erhöht. Was nach formellen Änderungen ohne Einfluss auf dem Wahlausgang klingt, ist in Wahrheit eine Erweiterung des Pekinger Einflusses auf die Besetzung der Gremien. Denn die zusätzlichen Sitze beider Organe werden vorab aus Peking mit Wunschkandidaten besetzt. Demokratisch erzielte Mehrheiten der Opposition sind so gut wie ausgeschlossen, solange Pekings organisierte Stimmen tun, was die Partei von ihnen erwartet.
Die Bedeutung von Bezirkswahlen in der Stadt wird somit weiter minimiert. Im Herbst 2019 hatten demokratische Politiker im Zuge der monatelangen Protestbewegung gegen Pekings Einfluss auf die Stadt mehr als 80 Prozent aller Sitze in den Kommunen gewonnen und damit zahlreiche Stimmen für die Wahl des Regierungschefs erobert. Die Opposition hatte sich sogar eine Minimalchance ausgemalt, eine Mehrheit im Legislativrat zu erringen, die Regierungschefin Lam zu Verhängnis hätte werden können. Dazu hätte es lediglich der zweimaligen Ablehnung ihres Haushalts bedurft. Die Wahlen zum Legislativrat waren dann aber in den Herbst dieses Jahres verlegt worden. offiziell wegen der Corona-Pandemie. Oppositionspolitiker glauben jedoch, dass die Hongkonger Regierung sich Zeit verschaffen wollte, um bis zur Neuansetzung der Wahl die Rahmenbedingungen zu ihren Gunsten zu modellieren. Das ist durch den Beschluss in Peking nun geschehen.
Auch in Deutschland löste die Abstimmung Reaktionen aus. Frank Schwabe, menschenrechtspolitischer Sprecher der SPD im Deutschen Bundestag, sagte China.Table: “Die chinesische Regierung versucht, mit dieser Reform zu vollenden, was sie schon vor einer Weile begonnen hat. Nämlich entgegen ihrer vertraglichen Zusagen die totale politische Kontrolle in der Stadt zu übernehmen. Konsequent will sie alle verbliebenen Spuren demokratischer Strukturen verwischen. Diese Wahlrechtsreform ist ein weiterer herber Schlag für die Opposition in Hongkong.” 1997 war die Stadt von den Briten nach 100-jähriger Kolonialzeit an die Volksrepublik übergeben worden. Der Rückgabe-Vertrag beinhaltete die Vereinbarung über eine weitgehende Autonomie der Stadt bis 2047, inklusive eines universellen Wahlrechts.
So weit ist es jedoch nie gekommen. Heute ist Hongkong viel weiter entfernt von einem universellen Wahlrecht als es 1997 der Fall war. Dennoch schenkt die politische Führung der Stadt den Bürgern keinen reinen Wein ein, sondern verkauft ihre Abkehr von demokratischen Elementen als Beitrag zum Aufbau einer freien Gesellschaft. Carrie Lams Vorgänger Leung Chun-ying hatte vor wenigen Tagen in einem Interview mit der South China Morning Post behauptet, dass die Wahlrechtsform überhaupt erst die Grundlage dafür schaffe, dass ein universelles Wahlrecht möglich werde. Die zunehmend autoritären Strukturen in der Stadt widersprechen jedoch dieser Aussage.
Didi Kirsten Tatlow, Senior Fellow im Asien-Programm der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin, ist in Hongkong geboren und aufgewachsen. Sie spricht von einer “politischen Säuberung”. Alle Stimmen, die nicht im Einklang mit Pekings Linie liegen, sollen zum Schweigen gebracht werden, glaubt Tatlow. “Es ist eine Tragödie ansehen zu müssen, wie so Vieles, was Hongkong als liberale Metropole über viele Jahrzehnte ausgemacht hat, jetzt durch autoritäre Pekinger Politik zerstört wird.”
Als Konsequenz aus den Entwicklungen der vergangenen Jahre hatte die Heritage Foundation, eine US-Denkfabrik, die Stadt bereits aus ihrem globalen Index ökonomischer Freiheit gestrichen und sie stattdessen erstmals der Volksrepublik zugeordnet. Dabei hatte Hongkong bis 2019 25 Jahre lang sogar an der Spitze der Liste gestanden, ehe die Stadt im Vorjahr von Singapur abgelöst wurde. Was die neue autoritäre Linie der Gesetzgeber für Hongkong als Finanzzentrum und Wirtschaftsstandort bedeutet, darüber streiten beide Lager ohnehin. Pekings Fürsprecher erwarten einen Zuwachs an Neumissionen am örtlichen Aktienmarkt, der besonders für jene Unternehmen attraktiv sein soll, die aus Staaten stammen, die sich an der chinesischen Belt-and-Road-Initiative, gemeinhin als neue Seidenstraße bezeichnet, beteiligen. Skeptiker erwarten dagegen einen Rückzug zahlreicher Firmen von den Finanzmärkten der Stadt.
Konsequenzen drohen jedoch zumindest den führenden politischen Köpfen der Stadt. US-Außenminister Antony Blinken hatte kurz vor der Abstimmung in Peking bereits weitere Sanktionen gegen jene angekündigt, “die für repressive Maßnahmen in Hongkong verantwortlich sind.” Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hatte ebenfalls vorab erklärt, dass Brüssel bereit sei, zusätzliche Schritte zu unternehmen. Details dazu nannte er bisher nicht.
Die politische Stimmung zwischen China und den USA mag so schlecht sein, wie seit Jahrzehnten nicht. Doch das ändert nichts daran, dass viele Pekinger es in diesen Tagen kaum erwarten können, bis endlich die neuste Attraktion der Hauptstadt eröffnet: Wie chinesische Staatsmedien berichten, steht im Stadtteil Tongzhou nach nicht einmal drei Jahren Bauzeit im Mai die Eröffnung des ersten Universal Studio Theme Parks auf dem chinesischen Festland bevor. Tests der neuen Anlage laufen bereits auf Hochtouren. Auch die Website des neuen Parks ist schon online.
Das Timing könnte kaum besser sein. Weil China die Corona-Pandemie weitestgehend im Griff hat, nimmt der heimische Tourismus wieder kräftig fahrt auf. Gleichzeitig sind Reisen ins Ausland noch keine Option, weshalb ein neues Angebot wie der Universal-Park in Peking vom ersten Tag an mit einem gewaltigen Ansturm rechnen kann.
Um einen der nach den Disney-Ressorts berühmtesten Vergnügungsparks der Welt zu besuchen, mussten Chinesen bisher entweder nach Singapur, Osaka in Japan oder Kalifornien reisen, wo das Filmstudio Universal 1964 seinen ersten Themenpark eröffnete, um die Helden seiner Filme zu promoten.
Wie an den anderen Standorten erwarten Besucher in Peking nicht nur aufregende Achterbahn-Fahrten, sondern auch Bühnen-Shows und über 80 Restaurants. Zu den Highlights gehören Themenwelten wie das Kung Fu Panda Land of Awesomeness, Transformers: Metrobase, ein Minion Land, The Wizarding World of Harry Potter und die Jurassic World.
Dass Universal im Joint Venture mit chinesischen Partnern in Peking auf einer Fläche von 400 Hektar seinen bisher größten Park gebaut hat, ist kein Zufall. Der Konzern hat genaubeobachtet, wie ungemein erfolgreich Konkurrent Disney seit seiner Eröffnung 2016 in Shanghai ist. Allein im vergangenen Jahr verzeichnete Disney dort rund elf Millionen Besucher. Universal hofft in Peking auf zehn Millionen Gästen pro Jahr.
Einigen chinesischen Politikern passt es zwar gar nicht, wie der Rivale USA sich mit seiner verführerischen Softpower ins Land schleicht. Als Disney in Shanghai seine Tore öffnete, gab ein bekannter Unternehmer diesen Hardlinern eine Stimme – allerdings aus ganz eigenen geschäftlichen Interessen. Der Gründer der Wanda Gruppe, Wang Jianlin, polterte damals in einem Fernsehinterview, dass Disney in China “nichts zu suchen” habe. Die Tage von Mickey Maus und Donald Duck seien längst vorbei und sein Konzern werde Disney schon bald “besiegen”.
Wang war damals dabei, seinen Immobilienkonzern Wanda in den größten Unterhaltungskonzern des Landes umzurüsten. Finanzielle Schwierigkeiten zwangen Wanda jedoch später, die eigenen Parks abzustoßen.
Nationalismus hin – chinesische Werte her: Die Chinesen lieben ihre westlichen Filmhelden. Das bekommt nun auch Universal Studio bereits Wochen vor der geplanten Eröffnung zu spüren. So berichtete die staatliche Zeitung “Global Times” von einem Sturm der Entrüstung, als Universal ankündigte, dass künftig auch einige bekannte Computerspiel-Charaktere des chinesischen Tencent-Konzerns im neuen Park vertreten sein soll. Man besuche den Park nicht, um Tencent-Figuren zu sehen, sondern die bekannten Universal-Helden, zitierte die Zeitung chinesische Internetnutzer. Gregor Koppenburg/Jörn Petring
Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat die im Fünfjahresplan Chinas festgelegten Ansätze für den internationalen Handel als nicht ausreichend kritisiert. “Die deutsche Industrie vermisst im 14. Fünf-Jahres-Plan eindeutige Signale für einen echten Kurswechsel in Richtung Offenheit und Marktwirtschaft“, so BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. Gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen ausländischen Investoren und chinesischen Staatsbetrieben seien nicht gegeben und auf mittlere Sicht nicht erwartbar.
Beim von Peking im Fünfjahresplan versprochenen besseren Schutz des geistigen Eigentums zeigt sich der BDI skeptisch. Chinas Bestrebungen nach mehr Eigenständigkeit und die staatliche Förderung von Zukunftsbranchen drohen die Konkurrenz für deutsche Unternehmen auf dem Weltmarkt zu erhöhen, so die Einschätzung des Verbands.
Auch die “Lage der Menschenrechte in Xinjiang und die politische Situation in Hongkong belasten die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen” und trübten die Unterzeichnung des Investitionsabkommens zwischen China und der EU (CAI), schreibt der BDI. China müsse die Vorwürfe zu Menschenrechtsverletzungen aufklären und der internationalen Gemeinschaft Einblick in die Verhältnisse vor Ort gewähren, fordert der Verband. Das geplante EU-Lieferkettengesetz sieht der BDI kritisch, da es zu “erhöhten Spannungen mit China führen” könne.
Chancen sieht der BDI für deutsche Unternehmen, die dazu beitragen, “die industrielle Basis Chinas aufzuwerten”, also Maschinen und High-Tech-Güter zu liefern. Auch die von Peking angekündigten Steuersenkungen und Abschreibungsmöglichkeiten bei Ausgaben für Forschung und Entwicklung sowie die “verbesserte und günstigere Versorgung in den Bereichen Energie und Kommunikation” begrüßt der Verband.
Insgesamt lobt der BDI den Abschluss der CAI-Verhandlungen. Der Verband fordert die EU auch auf, ein “leistungsfähiges Anti-Subventionsinstrument” zu verabschieden. Diese Maßnahme würde es der EU ermöglichen, gegen Marktverzerrungen durch chinesische Staatssubventionen vorzugehen. Auch den Abschluss des seit Jahren geplanten Internationalen Beschaffungsinstrument (IPI) der EU fordert der BDI. Das Instrument wird seit 2012 auf EU-Ebene diskutiert und soll zur gegenseitigen Öffnung der öffentlichen Beschaffungsmärkte mit Drittländern führen. nib
Nun ist es also Gewissheit: Die Top-Außenpolitiker der USA und Chinas werden am Donnerstag kommender Woche in Anchorage im US-Bundesstaat Alaska zusammentreffen. Die Außenministerien beider Staaten bestätigten das Treffen, über das in dieser Woche als erstes die Hongkonger South China Morning Post berichtet hatte. Daran teilnehmen sollen von US-Seite Außenminister Antony Blinken und der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan. Aus China kommen der höchste Außenpolitiker der Kommunistischen Partei und ehemalige Außenminister Yang Jiechi (offiziell “Direktor des Büros der Zentralen Kommission für Auswärtige Angelegenheiten”), sowie der aktuelle Außenminister und Staatsrat Wang Yi.
US-Präsident Joe Biden hatte im Februar bereits mit Chinas Präsident Xi Jinping telefoniert. Das Treffen in Alaska aber wird der erste persönliche Kontakt auf höchster Ebene sein.
Wie schnell dieses Treffen organisiert wurde, ist durchaus überraschend. Das hohe Tempo zeigt sich schon darin, dass beide Seiten nicht einmal Zeit hatten, das Treffen zu namentlich zu definieren. Während die chinesische Seite von einem “strategischen Dialog” sprach, betonte US-Außenminister Blinken, es sei zunächst kein strategischer Dialog – denn es gebe “zu diesem Zeitpunkt keine Pläne für eine Serie von Folgetreffen”. Dazu müsse es greifbare Fortschritte bei den für die USA wichtigen Themen geben. Blinken stufte das Treffen vor dem US-Kongress als Gelegenheit ein, die Sorgen Washingtons “in sehr offenen Worten darzulegen”. Das Außenministerium teilte nur in dürren Worten mit, man werde “über eine Reihe von Themen” sprechen. Redebedarf gibt es zu vielen Punkten: Handel, Technologie, Werte, Menschenrechte, Hongkong und Xinjiang sind nur einige davon.
Chinas Ministerpräsident Li Keqiang warb gestern vor Journalisten für eine konstruktive Beziehung beider Seiten. China und die USA hätten weitreichende gemeinsame Interessen, sagte Li. Man könne in vielen Bereichen zusammenarbeiten. Außenamtssprecher Zhao Lijian forderte die USA derweil auf, das “Kalte-Kriegs-Denken” aufzugeben und aufzuhören, sich in Chinas innere Angelegenheiten einzumischen.
Der US-Seite sei es wichtig gewesen, dass die erste Begegnung auf amerikanischem Boden und nach Konsultationen mit Verbündeten in Asien und Europa stattfinde, sagte Regierungssprecherin Jen Psaki. Dass China dem zugestimmt hat, zeigt, wie wichtig auch Peking die Wiederaufnahme des Gesprächsfadens ist. ck
Der chinesische Verband der Halbleiterindustrie (CSIA) hat die Gründung einer Arbeitsgruppe mit seinem US-Gegenpart, der Semiconductor Industry Association (SIA), bekanntgegeben. Beide Verbände wollen sich halbjährlich treffen, um sich gegenseitig über Technologie- und Handelsbeschränkungen auf dem Laufenden zu halten, wie es in einem Statement der CSIA heißt. Auch wolle man sich über Exportkontrollen, die Sicherheit der Lieferketten und Verschlüsselungsthemen austauschen sowie zu Bereichen, die beide Seiten betreffen, politische Empfehlungen ausarbeiten. An den halbjährlichen Treffen sollen jeweils zehn Mitgliedsfirmen der beiden Verbände teilnehmen. Ein Termin für das erste Treffen wurde bisher nicht bekanntgegeben.
Die Kooperation zwischen den Verbänden sei dringend nötig, sagte ein führender Berater der Consultingfirma Intralink zu Bloomberg: “Es wäre eine Katastrophe, wenn zwei Halbleiterwelten entstehen würden, deren Produkte nicht kompatibel wären oder es keine Standards gibt.”
Die Gründung der Arbeitsgruppe erfolgt inmitten von Spekulationen, dass die US-Regierung bestimmte Handelsbeschränkungen gegen chinesische Halbleiterfirmen lockern könnte, um den weltweiten Mangel an Chips zu lindern, wie die South China Morning Post berichtet.
Der Mangel an Chips und die Abhängigkeiten von wenigen Lieferländern haben sowohl in China, den USA als auch Europa zu verstärkten Bemühungen zum Aufbau einheimischer Produktionskapazitäten geführt. China will bis 2025 etwa 70 Prozent seines Chipbedarfs aus eigener Herstellung decken. Bisher importiert das Land noch jährlich Halbleiter im Wert von 300 Milliarden US-Dollar. Erst vergangene Woche hatte Premier Li Keqiang massive Investitionen in die Chipindustrie angekündigt. Im letzten Jahr wurden nur knapp 16 Prozent der in China verkauften Chips im Land selbst produziert.
Die US-Industrie hingegen fordert eine höhere staatliche Förderung der einheimischen Produktion, um die Versorgung zu sichern und den Technologie-Vorsprung gegenüber China zu halten, wie die Financial Times berichtete. Auch die EU-Kommission verfolgt Pläne, dass der Wirtschaftsraum bis 2030 eigene hochentwickelte Halbleiter produzieren soll. Bis dahin sollen mindestens 20 Prozent der Weltproduktion wertmäßig innerhalb der EU stattfinden. Das wäre eine Verdopplung zum aktuellen Wert.
Derzeit entfallen auf die EU, USA (12 Prozent) und China (16 Prozent) zusammen 38 Prozent der weltweiten Chipproduktion, während Südkorea und Taiwan 43 Prozent der weltweiten Produktionskapazität aufweisen. nib

Das Klima zwischen den USA und China als unterkühlt zu bezeichnen, ist ein klassisches Understatement. Derzeit sehen fast neun von zehn US-Bürgern (89 Prozent) in der Volksrepublik eine unfreundliche Wettbewerberin und Feindin, aber keine Partnerin. Das fand eine repräsentative Online-Umfrage des Washingtoner Instituts für Meinungsforschung Pew Research Center heraus, die zeitgleich mit der Eröffnung des Volkskongresses erschien. Pew nutzte bei seiner Befragung auch einen “Temperaturmesser”. Für 67 Prozent hätten sich ihre China-Gefühle “abgekühlt”, während es 2018 erst 46 Prozent waren. Fast jeder vierte Bürger (24 Prozent) gab eisige null Grad an, fast dreimal mehr als es 2018 waren.
Der emotionale Temperartursturz wirkt wie eine Retourkutsche, auf die von Peking regelmäßig gegenüber dem Ausland gemachten Vorwürfe, die “Gefühle des chinesischen Volkes verletzt zu haben.” (伤害中国人民的感情). Mit dieser Formel drischt es auf Staaten, Unternehmen, Einzelpersonen oder Institutionen aller Art ein, von denen sich Chinas Regierung auf die Füße getreten fühlt. Es sei, wie der “Economist” meinte, ein Schachzug der Partei, um sich im Ausland einmischen zu können. Dabei wird das chinesische Volk nicht befragt, ob es sich beleidigt fühlt. Pekings Außenministerium und seine Parteimedien entscheiden stellvertretend, wann, wie, wo und von wem seine “Gefühle” verletzt werden.
1959 druckte die Volkszeitung erstmals die Formel als Warnung an Neu-Delhi, weil indische Truppen im Himalaya chinesisch beanspruchtes Terrain überschritten hätten. David Bandursky vom China Media Project untersuchte 143 Beispiele, wo die Volkszeitung zwischen 1959 und 2015 das Label, “die Gefühle des chinesischen Volkes verletzt zu haben” dem Ausland aufklebte. 51-mal wurde Japan verwarnt, 35-mal die USA. “Nach 1978 an wurde der Slogan zum festen Bestandteil des politischen Diskurses der Partei.”
Seit Peking außenpolitisch offensiver seine Interessen vertritt und dazu die Wirtschaftsmuskeln spielen lässt, passiert es immer öfter, dass sich die Gebrandmarkten aus Angst vor Sanktionen zur öffentlichen Entschuldigung genötigt fühlen. 2018 leistete der Autokonzern Mercedes Benz bei der chinesischen Botschaft in Berlin Abbitte, nachdem er in einem Werbespot den (nur in China politisch geächteten) Dalai Lama zitiert hatte. Der italienischen Luxusmarke Dolce&Gabbana (D&G) wurde ein witzig gemeintes Video zum Verhängnis, das eine mit Stäbchen Pizza essende Chinesin zeigte. Peking empfand den Spot zutiefst diskriminierend. D&G musste Modenschauen absagen, seine China-Umsätze fielen. Die nationalistische “Global Times” triumphierte: “Fakten zeigen, dass die Verletzung der nationalen Gefühle des chinesischen Volkes vom Markt bestraft wird und die 1,3 Milliarden Menschen des Landes entscheiden.”
Am pauschalen Vorwurf änderte sich seit 60 Jahren nichts. Nur die Zahl der an verletzten Gefühlen leidenden Chinesen musste nach jedem Volkszählung aktualisiert werden. 1959 waren es 670 Millionen Menschen. Im August 1980 warf Xinhua dem damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan vor, er habe “die Gefühle von einer Milliarden Menschen tief verletzt”, weil er ein Verbindungsbüro der US-Regierung auf Taiwan einrichten wollte. Wer im Ausland kritisch über Chinas drei T-Tabus (Taiwan, Tibet und Tiananmen) spricht, verletzt automatisch die Gefühle des chinesischen Volkes.
Im Jahr 2000 waren 1,2 Milliarden Menschen beleidigt, nachdem Schweden seinen Literatur-Nobelpreises an den in Frankreich lebenden Dissidenten Gao Xingjian verlieh. 2012 verletzte laut Xinhua Japan die Gefühle von 1,3 Milliarden Chinesen, als sich im September 2012 Chinas Inselstreit mit Japan zuspitzte, wem die Diaoyu (Senkaku)-Inseln im ostchinesischen Meer gehören.
Auf der Liste der Gefühlsverletzer stehen oder standen Hollywoodstars von Richard Gere bis Brad Pitt (wegen Tibet), Sänger aus Taiwan und K-Pop-Bands wie BTS aus Südkorea, die nordamerikanische Basketballliga (NBA), Hotelketten oder Fluggesellschaften. Wikipedia trug entsprechende Beispiele aus aller Welt zusammen. Die Bertelsmann-Stiftung erklärte auf einem Schaubild, wie Chinas Regierung ihren Vorwurf zu “einem mächtigen Werkzeug machte, um ausländische Institutionen zu zwingen, sich Pekings ideologischen Postulaten zu unterwerfen.”.
Im September 2007 traf die Pekinger Empfindlichkeit Kanzlerin Angela Merkel, als sie in Berlin den Dalai Lama traf und “die Gefühle des chinesischen Volkes und die beiderseitigen Beziehungen verletzte und schwerwiegend unterminierte”. Weil Frau Merkel danach aber jedes Jahr China besuchte und nie wieder den Dalai Lama traf, wurde sie wieder zur “lao pengyou”, der “altehrwürdigen Freundin des chinesischen Volkes” (中国人民的老朋友).
Lao pengyou zu sein ist der Gegenpart zum Gefühle-Trampler. Politiker und Wirtschaftsführer, die mindestens dreimal China besuchten, haben Anspruch darauf. Die Ausnahme von der Regel war Henry Kissinger, der alle Führer Chinas von Mao Zedong bis Xi Jinping traf. Weil Peking ihn brauchte, nannten ihn Mao und sein Premier Zhou Enlai schon bei ihrem zweiten Treffen “alten Freund.” Kissinger notierte in seinem Buch “China”: Peking “schmeichelt den Besuchern, indem es sie als ‘alte Freunde’ begrüßt. Wodurch man es ihnen schwer macht, zu widersprechen und in Konfrontation zu gehen.”
Freundschaft, so Kissinger werde nicht als “persönliche Eigenschaft” gesehen, sondern als “langfristige kulturelle, nationale oder historische Bande” geknüpft. Chinas Führung hätte sich im Umgang mit Fremden “ein wenig von der traditionellen Behandlung der Barbaren bewahrt.”
Im Umkehrschluss bedeutet es, dass die so tief verletzten Gefühle des chinesischen Volkes im Nu verheilen, sobald der angebliche Verursacher Peking wieder nützlich erscheint. Oder gar nicht erst aufkommen, wenn sich alle zusammentun, um dem kalkulierten Druck zu widerstehen.

Ein 39 Jahre alter Bauer und Nudelmacher ist in China unverhofft zum Social-Media-Star geworden: Cheng Yunfu erlangte Internet-Ruhm, weil er seine handgezogenen Nudeln bereits seit 15 Jahren für den gleichbleibenden Preis von drei Yuan – gut 40 Cent – auf einem Markt in seiner Heimatprovinz Shandong verkauft, wie mehrere Medien berichteten. In einem Video, das in sozialen Medien wie Kuaishou geteilt wurde, erklärt Cheng, dass er den Preis nicht erhöht habe, weil sich die Dorfbewohner sonst die Nudelsuppe nicht mehr leisten könnten.
Begeistert von Cheng fluteten Schaulustige und Fans das kleine Dorf Matihe – plötzlich wurde seine Kochkunst von Hunderten Menschen gefilmt. Einige hätten live neben ihm mit der Handykamera gestreamt, berichtete Cheng der South China Morning Post. Der Ruhm über Nacht war für Cheng demnach zu Beginn zu viel des Guten. Mittlerweile habe er sich aber daran gewöhnt und wolle seine Bekanntheit nutzen, um seinem Dorf zu helfen und zahlende Kundschaft dorthin zu bringen. Er sei froh, dass das Dorf diese Chance nun habe, auch wenn er gar nicht berühmt sein möchte, sagte Cheng dem Bericht zufolge.

der Transrapid galt als Beleg deutscher Innovations- und Ingenieurskunst, bevor er zum Milliardengrab und politischen Desaster wurde und schließlich im Emsland in einer menschlichen Tragödie endete. China hat die Magnetschwebetechnik seither weiterentwickelt und plant nun mehrere Hochgeschwindigkeitsstrecken. Um das ambitionierte Projekt voranzutreiben, prüft der Staatskonzern CRRC nun, mit deutschen und europäischen Partnern zusammenzuarbeiten und die einstige Transrapid-Teststrecke in Lathen zu revitalisieren. Eine erste Anfrage im Emsland wurde China.Table bestätigt, Frank Sieren hat die Einzelheiten.
Scheinbar völlig unberührt von internationaler Kritik beendeten die chinesischen “Volksvertreter” den Nationalen Volkskongress 2021 gestern mit dem Beschluss, für die politischen Gremien in Hongkong in Zukunft nur noch “patriotische”, heißt Peking-treue, Abgeordnete zuzulassen. Marcel Grzanna ordnet diesen Anschlag auf die Demokratie ein. Man darf gespannt sein, wie der Vorgang das amerikanisch-chinesische Außenminister-Treffen am kommenden Donnerstag in Alaska beeinflussen wird.
Wie die chinesische Regierung seit Jahrzehnten den Vorwurf der “Verletzung der Gefühle des chinesischen Volkes” zur Durchsetzung außenpolitischer Interessen einsetzt – und vor allem: wie erfolgreich sie damit ist – seziert Johnny Erling heute. Auch Angela Merkel wurde der Vorwurf einst gemacht. Doch längst ist sie zur “lao pengyou”, einer “altehrwürdigen Freundin des chinesischen Volkes” geworden.

Unter der Regie des staatlichen Eisenbahnkonzerns China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) wurden in den letzten Jahren zwei Transrapid-Prototypen entwickelt. Einer der Züge mit dem Namen CRRC 600, der aus sechs Elementen besteht, ist eine Weiterentwicklung des Transrapid TR08, der damals von ThyssenKrupp hergestellt wurde. Es wird nicht schneller als 600 Kilometer pro Stunde fahren können.
Der zweite Zug wird von der Southwest Jiaotong University Chengdu und CRRC entwickelt. Es könnte ein sogenannter Hyperloop-Zug werden, der auch über 1000 Kilometer pro Stunde fährt.
Der größte technische Unterschied: Der Hyperloop ist ein Transrapid 2.0, der in einer wahrscheinlich durchsichtigen Acryl-Röhre fahren soll, in der ein Vakuum erzeugt wird. Damit hat der Zug keinen Luftwiderstand zu überwinden. Anders sind die hohen Geschwindigkeiten, die denen eines Flugzeuges entsprechen, technisch nicht zu erreichen.
Die Magnetschwebetechnik wurde vom chinesischen Ministerium für Wissenschaft und Technologie bereits 2002 als Schlüsseltechnologie eingestuft. Insgesamt sind seitdem über 30 chinesische Unternehmen und Forschungseinrichtungen unter der Führung von CRRC an dem Projekt beteiligt.
Die CRRC ist der größte Zughersteller der Welt und einer der größten Industriekonzerne. Das in Shanghai und Hongkong Börsen-gelistete Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von rund 20 Milliarden Euro.
Nachdem die Zentralregierung entschieden hat, die Magnetschwebe-Technologie in großem Umfang zu nutzen, steht die CRRC nun unter erheblichem Erfolgsdruck. Denn bis spätestens 2030 sollen mehrere tausend Kilometer Magnetschwebebahn in China gebaut werden. Die beiden wichtigsten Strecken sind Peking – Guangzhou – Shenzhen und Shanghai – Guangzhou – Shenzhen. Es ist geplant, in gut dreieinhalb Stunden von Peking nach Shenzhen reisen zu können. Der Flug dauert zweieinhalb Stunden. Innerhalb von nur zweieinhalb Stunden soll der Transrapid 2.0 von Guangzhou nach Shanghai schweben. Schon heute verfügt China über das größte konventionelle Hochgeschwindigkeitsnetz der Welt mit Zügen, die gut 300 Kilometer pro Stunde fahren.
Aber auch eine kürzere Strecke von knapp 200 Kilometern Länge in die neue Verwaltungsstadt Xiongan, in der Nähe von Peking, ist geplant. Sie gilt als eines der wichtigsten Projekte von Staats- und Parteichef Xi Jinping. Es soll ein Pendlerzug mit Hyperloop-Technik werden, der 800 Kilometer pro Stunde fährt.
Um die Technologie auf diesen Strecken alltagstauglich zu machen, haben die Chinesen sie weiterentwickelt. Das Vorhaben ist Teil der Klimastrategie, die Staatpräsident Xi Jinping im Herbst 2020 verkündet hat und deren Ziel es ist, China bis 2060 klimaneutral zu machen.
Damit das Schnellzug-Projekt vorankommt, plant CRRC die Technologie mit europäischen Partnern, wie etwa Thyssen-Krupp, Knorr-Bremse oder Beckhoff, weiterzuentwickeln und für die Tests die deutsche Teststrecke in Lathen zu revitalisieren.
Im Zentrum der europäisch-chinesischen Zusammenarbeit stünde Hardt Hyperloop, ein holländisches Startup, an dem auch der deutsche Investor Frank Thelen mit einem zweistelligen Millionenbetrag beteiligt ist. Die CRRC und Hardt sind bereits im Gespräch. Hardt ist, ebenfalls mit Unterstützung deutscher Zulieferer, in einigen Entwicklungsbereichen weiter als CRRC – zum Beispiel bei elektronischen Weichen, den Röhren, Vakuumpumpen oder der Bremstechnologie.
In Las Vegas gibt es ein ähnliches Projekt, finanziert unter anderem von Richard Bransons Virgin Group. Die Chinesen haben sich jedoch aus politischen Gründen entschieden erst einmal nicht mit den Amerikanern zusammenzuarbeiten.
Ralf Effenberger, Geschäftsführer der INTIS GmbH und Leiter der Transrapid Versuchsanlage Emsland, hat gegenüber China.Table bestätigt, dass ihm die CRRC-Anfrage bezüglich Lathen bekannt ist. “Damit die Anlage wieder in Betrieb genommen werden kann, muss durch sie auch ein nationales Interesse verfolgt werden, so sieht es das Gesetz vor”, erläutert Effenberger. “Da zahlreiche deutsche Unternehmen von dem Projekt profitieren würden, ist dieser Fall sicherlich gegeben.” Es sei geradezu “eine Win-Win-Situation”. Heute würden so große Projekte nicht mehr von einem Unternehmen oder einer Nation alleine entwickelt. Die Teststrecke in Lathen könnte ein Beispiel dafür werden “wie globale Kooperation zur Erschließung einer neuen klimafreundlicheren Transporttechnologie funktionieren kann.”
Ob die chinesisch-europäische Kooperation mit einer wiederbelebten Teststrecke in Lathen am Ende wirklich funktioniert? Parallel zu dem Vorstoß der CRRC in Lathen hat der Abgeordnete Yang Jun, der die Stadt Qingdao vertritt, im Nationalen Volkskongress in dieser Woche einen Antrag gestellt, eine 150 Kilometer lange Teststrecke von der Küstenstadt Qingdao nach Ri Zhao zu bauen.
Die Anlage in Emden war nach dem Stopp des Transrapid-Projektes in Deutschland weiter als Touristenattraktion in Betrieb, bis sie 2006 nach einem schweren Unfall mit 23 Toten stillgelegt wurde.
“Es ist möglich, die Anlage innerhalb von maximal 18 Monaten wieder betriebsfähig zu kriegen”, sagt Effenberger. Das sei allerdings nur eine erste Schätzung. Denkbar sei auch die Anlage noch auszubauen.
Parallel zu den Überlegungen einer Teststrecke in Deutschland gibt es bereits eine erste Übereinkunft der Southwest Jiaotong Universität in Chengdu, mit der Universität in Oldenburg und der Fachhochschule Emden-Leer eng zusammenzuarbeiten. Die Universitäten sind in ihren jeweiligen Ländern führend in der Magnetschwebetechnik.
Zudem hat die CRRC bereits im Mai vergangenen Jahres das Lokomotivenwerk Vosslow in Kiel gekauft. Dies könnte der europäische Standort von CRRC werden. Es ist jedenfalls geplant, dass die Züge auch eine europäische Zulassung bekommen sollen und auch in Europa produziert werden soll. Schon im März 2016 hat die CRRC die sächsische Firma Cideon erworben – den Angaben zufolge der erste Kauf der Chinesen in Europa. Das Bautzener Unternehmen bietet etwa die technische Neuentwicklung, Modernisierung oder Umrüstung von Schienenfahrzeugen an.
Für Lathen spricht aus Sicht der Chinesen vor allem, dass die Züge leicht dorthin zu transportieren sind. Sie würden per RoRo-Schiff von China bis nach Bremerhaven transportiert und von dort weiter durch den Weser-Ems-Kanal bis zum Hafen Doerpe, der rund vier Kilometer von Lathen entfernt ist.
2003 hatten Bundeskanzler Gerhard Schröder und der damalige chinesische Ministerpräsidenten Zhu Rongji eine kommerzielle Teststrecke in Shanghai eröffnet. Die Transrapid-Technologie war ursprünglich von Thyssen-Krupp und Siemens entwickelt worden, wobei Siemens von Anfang an mehr Interesse hatte, die klassische Rad-Schiene-Technik des ICE nach China zu verkaufen, weil bei diesen Zügen mehr zu verdienen war. Inzwischen ist China das einzige Land der Welt, das fast 20 Jahre Alltagserfahrung mit der Magnetschwebetechnik mit über 90 Millionen Passagieren hat.
15.03.2021, 5:00-6.30 PM (EST)
Webinar, SOAS London: Aspects of Defense Industrialization in China, 1949-1989. Anmeldung
16.03.2021, 19:00-20:30 Uhr
Clubhouse, Stiftung Asienhaus: Digitalisierung, Zensur und Zivilgesellschaft in China. Mehr
17.03.2021, 10:00-11:00 AM (EST)
Vortrag, Harvard Center for Chinese Studies: Qing Yang – A Ready-to-Implement Carbon-Negative Option to Help China Achieve Carbon Neutrality: Biochar with Biofuels Mehr
17.03.2021, 19:00-20:30 Uhr
Vortrag, KI Nürnberg-Erlangen: Chinas volkswirtschaftliche Neu-Ausrichtung von Markus Taube Mehr
17.03.2021, 12:30-1:45 Pm (EST)
Webinar, Harvard Center for Chinese Studies: How the Democratic States are Responding to China’s Political Interference Activities. Mehr
18.03.2021, 9:00-11:30 Uhr
Vortrag, AHK Taiwan: Zusammenarbeit mit Taiwan bei Blockchain und Künstliche Intelligenz mit Taiwans Digitalministerin Audrey Tang. Anmeldung
18.03.2021, 9:30-10:30 Uhr
Vortrag, Merics: China´s Social Credit System in 2021. Mehr
18.03.2021, 13:00-14:00 Uhr
Vortrag, Uni-Göttingen: China´s R-AI-se: The Digital New Silk Road and China´s Global AI Dreams Mehr
18.03.201, 18:30 Uhr
Vortrag, KI Hamburg: Die Welt als gemeinschaftlicher Besitz – China zwischen Konfuzianismus, Marxismus und Demokratie. Anmeldung
18.-24.03.2021
Filmfest, KI Erlangen-Nürnberg: 6. Chinesisches Filmfestival: Unruhestand? – Altern in China. Mehr
Der Dolchstoß für Hongkongs verbliebene demokratische Strukturen wurde begleitet von einem langen Applaus der politisch Verantwortlichen. 2895 Delegierte des Nationalen Volkskongresses (NVP) in Peking hatten am Donnerstag für die vorgelegte Wahlrechtsreform gestimmt, die aus dem ehemals wettbewerbsorientierten Hongkonger Regierungssystem endgültig eine obrigkeitshörige Attrappe im Sinne der Volksrepublik China macht.
Die pro-demokratische Tageszeitung Apple Daily stellte fest, dass keine andere Entscheidung des chinesischen Parlaments an diesem Tag mit mehr Beifall durch das Plenum bedacht wurde als jene, die Hongkongs Opposition in die Bedeutungslosigkeit verbannt. Das nahezu einstimmige Ergebnis mit nur einer Enthaltung stellte sogar die Verabschiedung des Nationalen Sicherheitsgesetzes vor einem Jahr an Ort und Stelle in den Schatten. Damals stimmten sechs Delegierte dagegen.
“Die Regierung Hongkongs und ich stehen fest hinter dieser Entscheidung und wollen aus tiefstem Herzen unsere Dankbarkeit ausdrücken”, kommentierte Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam das Resultat der Abstimmung, die ebensowenig auf demokratischen Grundsätzen beruhte wie die künftige Wahl des Hongkonger Legislativrats, dem gesetzgebenden Organ der früheren britischen Kronkolonie. Es gehe nicht darum, die Opposition auszublenden, sondern darum, sicherzustellen, dass Hongkong in Zukunft von Patrioten regiert würde, erklärte Lam. Sie schloss sich damit der Forderung aus Peking an, dass Exekutive, Legislative und Judikative Hongkongs sich nur noch aus “wahren Patrioten” zusammensetzen dürfe. Um das zu gewährleisten, führte die Stadt sogar ein neues Gesetz ein, das Amtsträgern einen Eid abverlangt, patriotisch – und damit im Geiste der Kommunistischen Partei – zu handeln. Was patriotisch ist, bestimmt die Partei. Wer das Gesetz bricht, verliert seinen Posten.
Im pro-demokratischen Lager wurde die Abstimmung mit Bedauern zur Kenntnis genommen. “Es ist ein sehr trauriger Beschluss für Hongkong. Ich glaube, dass die künftigen Mitglieder des Legislativrats immer weniger die Bürger der Stadt repräsentieren werden. Stattdessen werden es Loyalisten sein, denen die Hände gebunden sind und die in keinster Weise die Menschen in Hongkong vertreten werden”, sagte Lo Kin-hei, Vorsitzender der Demokratischen Partei.
Das schon seit Jahren ausgehöhlte demokratische Wahlsystem Hongkongs wurde durch den Nationalen Volkskongress jetzt noch einmal so umgebaut, dass Peking keine Angst mehr vor bösen Überraschungen zu haben braucht. “Schlupflöcher” seien damit gestopft worden, die von jenen genutzt werden könnte, die Hongkong schaden wollten, hieß es. Kernpunkte der Reform sind die personelle Aufstockung zweier Gremien. Zum einen wird der Ausschuss, der Regierungschef oder -chefin wählt, von 1200 auf 1500 Wahlberechtigte aufgestockt. Gleichzeitig wird auch die Mitgliederzahl des Parlaments, also des Legislativrats, von 70 auf 90 erhöht. Was nach formellen Änderungen ohne Einfluss auf dem Wahlausgang klingt, ist in Wahrheit eine Erweiterung des Pekinger Einflusses auf die Besetzung der Gremien. Denn die zusätzlichen Sitze beider Organe werden vorab aus Peking mit Wunschkandidaten besetzt. Demokratisch erzielte Mehrheiten der Opposition sind so gut wie ausgeschlossen, solange Pekings organisierte Stimmen tun, was die Partei von ihnen erwartet.
Die Bedeutung von Bezirkswahlen in der Stadt wird somit weiter minimiert. Im Herbst 2019 hatten demokratische Politiker im Zuge der monatelangen Protestbewegung gegen Pekings Einfluss auf die Stadt mehr als 80 Prozent aller Sitze in den Kommunen gewonnen und damit zahlreiche Stimmen für die Wahl des Regierungschefs erobert. Die Opposition hatte sich sogar eine Minimalchance ausgemalt, eine Mehrheit im Legislativrat zu erringen, die Regierungschefin Lam zu Verhängnis hätte werden können. Dazu hätte es lediglich der zweimaligen Ablehnung ihres Haushalts bedurft. Die Wahlen zum Legislativrat waren dann aber in den Herbst dieses Jahres verlegt worden. offiziell wegen der Corona-Pandemie. Oppositionspolitiker glauben jedoch, dass die Hongkonger Regierung sich Zeit verschaffen wollte, um bis zur Neuansetzung der Wahl die Rahmenbedingungen zu ihren Gunsten zu modellieren. Das ist durch den Beschluss in Peking nun geschehen.
Auch in Deutschland löste die Abstimmung Reaktionen aus. Frank Schwabe, menschenrechtspolitischer Sprecher der SPD im Deutschen Bundestag, sagte China.Table: “Die chinesische Regierung versucht, mit dieser Reform zu vollenden, was sie schon vor einer Weile begonnen hat. Nämlich entgegen ihrer vertraglichen Zusagen die totale politische Kontrolle in der Stadt zu übernehmen. Konsequent will sie alle verbliebenen Spuren demokratischer Strukturen verwischen. Diese Wahlrechtsreform ist ein weiterer herber Schlag für die Opposition in Hongkong.” 1997 war die Stadt von den Briten nach 100-jähriger Kolonialzeit an die Volksrepublik übergeben worden. Der Rückgabe-Vertrag beinhaltete die Vereinbarung über eine weitgehende Autonomie der Stadt bis 2047, inklusive eines universellen Wahlrechts.
So weit ist es jedoch nie gekommen. Heute ist Hongkong viel weiter entfernt von einem universellen Wahlrecht als es 1997 der Fall war. Dennoch schenkt die politische Führung der Stadt den Bürgern keinen reinen Wein ein, sondern verkauft ihre Abkehr von demokratischen Elementen als Beitrag zum Aufbau einer freien Gesellschaft. Carrie Lams Vorgänger Leung Chun-ying hatte vor wenigen Tagen in einem Interview mit der South China Morning Post behauptet, dass die Wahlrechtsform überhaupt erst die Grundlage dafür schaffe, dass ein universelles Wahlrecht möglich werde. Die zunehmend autoritären Strukturen in der Stadt widersprechen jedoch dieser Aussage.
Didi Kirsten Tatlow, Senior Fellow im Asien-Programm der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin, ist in Hongkong geboren und aufgewachsen. Sie spricht von einer “politischen Säuberung”. Alle Stimmen, die nicht im Einklang mit Pekings Linie liegen, sollen zum Schweigen gebracht werden, glaubt Tatlow. “Es ist eine Tragödie ansehen zu müssen, wie so Vieles, was Hongkong als liberale Metropole über viele Jahrzehnte ausgemacht hat, jetzt durch autoritäre Pekinger Politik zerstört wird.”
Als Konsequenz aus den Entwicklungen der vergangenen Jahre hatte die Heritage Foundation, eine US-Denkfabrik, die Stadt bereits aus ihrem globalen Index ökonomischer Freiheit gestrichen und sie stattdessen erstmals der Volksrepublik zugeordnet. Dabei hatte Hongkong bis 2019 25 Jahre lang sogar an der Spitze der Liste gestanden, ehe die Stadt im Vorjahr von Singapur abgelöst wurde. Was die neue autoritäre Linie der Gesetzgeber für Hongkong als Finanzzentrum und Wirtschaftsstandort bedeutet, darüber streiten beide Lager ohnehin. Pekings Fürsprecher erwarten einen Zuwachs an Neumissionen am örtlichen Aktienmarkt, der besonders für jene Unternehmen attraktiv sein soll, die aus Staaten stammen, die sich an der chinesischen Belt-and-Road-Initiative, gemeinhin als neue Seidenstraße bezeichnet, beteiligen. Skeptiker erwarten dagegen einen Rückzug zahlreicher Firmen von den Finanzmärkten der Stadt.
Konsequenzen drohen jedoch zumindest den führenden politischen Köpfen der Stadt. US-Außenminister Antony Blinken hatte kurz vor der Abstimmung in Peking bereits weitere Sanktionen gegen jene angekündigt, “die für repressive Maßnahmen in Hongkong verantwortlich sind.” Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hatte ebenfalls vorab erklärt, dass Brüssel bereit sei, zusätzliche Schritte zu unternehmen. Details dazu nannte er bisher nicht.
Die politische Stimmung zwischen China und den USA mag so schlecht sein, wie seit Jahrzehnten nicht. Doch das ändert nichts daran, dass viele Pekinger es in diesen Tagen kaum erwarten können, bis endlich die neuste Attraktion der Hauptstadt eröffnet: Wie chinesische Staatsmedien berichten, steht im Stadtteil Tongzhou nach nicht einmal drei Jahren Bauzeit im Mai die Eröffnung des ersten Universal Studio Theme Parks auf dem chinesischen Festland bevor. Tests der neuen Anlage laufen bereits auf Hochtouren. Auch die Website des neuen Parks ist schon online.
Das Timing könnte kaum besser sein. Weil China die Corona-Pandemie weitestgehend im Griff hat, nimmt der heimische Tourismus wieder kräftig fahrt auf. Gleichzeitig sind Reisen ins Ausland noch keine Option, weshalb ein neues Angebot wie der Universal-Park in Peking vom ersten Tag an mit einem gewaltigen Ansturm rechnen kann.
Um einen der nach den Disney-Ressorts berühmtesten Vergnügungsparks der Welt zu besuchen, mussten Chinesen bisher entweder nach Singapur, Osaka in Japan oder Kalifornien reisen, wo das Filmstudio Universal 1964 seinen ersten Themenpark eröffnete, um die Helden seiner Filme zu promoten.
Wie an den anderen Standorten erwarten Besucher in Peking nicht nur aufregende Achterbahn-Fahrten, sondern auch Bühnen-Shows und über 80 Restaurants. Zu den Highlights gehören Themenwelten wie das Kung Fu Panda Land of Awesomeness, Transformers: Metrobase, ein Minion Land, The Wizarding World of Harry Potter und die Jurassic World.
Dass Universal im Joint Venture mit chinesischen Partnern in Peking auf einer Fläche von 400 Hektar seinen bisher größten Park gebaut hat, ist kein Zufall. Der Konzern hat genaubeobachtet, wie ungemein erfolgreich Konkurrent Disney seit seiner Eröffnung 2016 in Shanghai ist. Allein im vergangenen Jahr verzeichnete Disney dort rund elf Millionen Besucher. Universal hofft in Peking auf zehn Millionen Gästen pro Jahr.
Einigen chinesischen Politikern passt es zwar gar nicht, wie der Rivale USA sich mit seiner verführerischen Softpower ins Land schleicht. Als Disney in Shanghai seine Tore öffnete, gab ein bekannter Unternehmer diesen Hardlinern eine Stimme – allerdings aus ganz eigenen geschäftlichen Interessen. Der Gründer der Wanda Gruppe, Wang Jianlin, polterte damals in einem Fernsehinterview, dass Disney in China “nichts zu suchen” habe. Die Tage von Mickey Maus und Donald Duck seien längst vorbei und sein Konzern werde Disney schon bald “besiegen”.
Wang war damals dabei, seinen Immobilienkonzern Wanda in den größten Unterhaltungskonzern des Landes umzurüsten. Finanzielle Schwierigkeiten zwangen Wanda jedoch später, die eigenen Parks abzustoßen.
Nationalismus hin – chinesische Werte her: Die Chinesen lieben ihre westlichen Filmhelden. Das bekommt nun auch Universal Studio bereits Wochen vor der geplanten Eröffnung zu spüren. So berichtete die staatliche Zeitung “Global Times” von einem Sturm der Entrüstung, als Universal ankündigte, dass künftig auch einige bekannte Computerspiel-Charaktere des chinesischen Tencent-Konzerns im neuen Park vertreten sein soll. Man besuche den Park nicht, um Tencent-Figuren zu sehen, sondern die bekannten Universal-Helden, zitierte die Zeitung chinesische Internetnutzer. Gregor Koppenburg/Jörn Petring
Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat die im Fünfjahresplan Chinas festgelegten Ansätze für den internationalen Handel als nicht ausreichend kritisiert. “Die deutsche Industrie vermisst im 14. Fünf-Jahres-Plan eindeutige Signale für einen echten Kurswechsel in Richtung Offenheit und Marktwirtschaft“, so BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. Gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen ausländischen Investoren und chinesischen Staatsbetrieben seien nicht gegeben und auf mittlere Sicht nicht erwartbar.
Beim von Peking im Fünfjahresplan versprochenen besseren Schutz des geistigen Eigentums zeigt sich der BDI skeptisch. Chinas Bestrebungen nach mehr Eigenständigkeit und die staatliche Förderung von Zukunftsbranchen drohen die Konkurrenz für deutsche Unternehmen auf dem Weltmarkt zu erhöhen, so die Einschätzung des Verbands.
Auch die “Lage der Menschenrechte in Xinjiang und die politische Situation in Hongkong belasten die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen” und trübten die Unterzeichnung des Investitionsabkommens zwischen China und der EU (CAI), schreibt der BDI. China müsse die Vorwürfe zu Menschenrechtsverletzungen aufklären und der internationalen Gemeinschaft Einblick in die Verhältnisse vor Ort gewähren, fordert der Verband. Das geplante EU-Lieferkettengesetz sieht der BDI kritisch, da es zu “erhöhten Spannungen mit China führen” könne.
Chancen sieht der BDI für deutsche Unternehmen, die dazu beitragen, “die industrielle Basis Chinas aufzuwerten”, also Maschinen und High-Tech-Güter zu liefern. Auch die von Peking angekündigten Steuersenkungen und Abschreibungsmöglichkeiten bei Ausgaben für Forschung und Entwicklung sowie die “verbesserte und günstigere Versorgung in den Bereichen Energie und Kommunikation” begrüßt der Verband.
Insgesamt lobt der BDI den Abschluss der CAI-Verhandlungen. Der Verband fordert die EU auch auf, ein “leistungsfähiges Anti-Subventionsinstrument” zu verabschieden. Diese Maßnahme würde es der EU ermöglichen, gegen Marktverzerrungen durch chinesische Staatssubventionen vorzugehen. Auch den Abschluss des seit Jahren geplanten Internationalen Beschaffungsinstrument (IPI) der EU fordert der BDI. Das Instrument wird seit 2012 auf EU-Ebene diskutiert und soll zur gegenseitigen Öffnung der öffentlichen Beschaffungsmärkte mit Drittländern führen. nib
Nun ist es also Gewissheit: Die Top-Außenpolitiker der USA und Chinas werden am Donnerstag kommender Woche in Anchorage im US-Bundesstaat Alaska zusammentreffen. Die Außenministerien beider Staaten bestätigten das Treffen, über das in dieser Woche als erstes die Hongkonger South China Morning Post berichtet hatte. Daran teilnehmen sollen von US-Seite Außenminister Antony Blinken und der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan. Aus China kommen der höchste Außenpolitiker der Kommunistischen Partei und ehemalige Außenminister Yang Jiechi (offiziell “Direktor des Büros der Zentralen Kommission für Auswärtige Angelegenheiten”), sowie der aktuelle Außenminister und Staatsrat Wang Yi.
US-Präsident Joe Biden hatte im Februar bereits mit Chinas Präsident Xi Jinping telefoniert. Das Treffen in Alaska aber wird der erste persönliche Kontakt auf höchster Ebene sein.
Wie schnell dieses Treffen organisiert wurde, ist durchaus überraschend. Das hohe Tempo zeigt sich schon darin, dass beide Seiten nicht einmal Zeit hatten, das Treffen zu namentlich zu definieren. Während die chinesische Seite von einem “strategischen Dialog” sprach, betonte US-Außenminister Blinken, es sei zunächst kein strategischer Dialog – denn es gebe “zu diesem Zeitpunkt keine Pläne für eine Serie von Folgetreffen”. Dazu müsse es greifbare Fortschritte bei den für die USA wichtigen Themen geben. Blinken stufte das Treffen vor dem US-Kongress als Gelegenheit ein, die Sorgen Washingtons “in sehr offenen Worten darzulegen”. Das Außenministerium teilte nur in dürren Worten mit, man werde “über eine Reihe von Themen” sprechen. Redebedarf gibt es zu vielen Punkten: Handel, Technologie, Werte, Menschenrechte, Hongkong und Xinjiang sind nur einige davon.
Chinas Ministerpräsident Li Keqiang warb gestern vor Journalisten für eine konstruktive Beziehung beider Seiten. China und die USA hätten weitreichende gemeinsame Interessen, sagte Li. Man könne in vielen Bereichen zusammenarbeiten. Außenamtssprecher Zhao Lijian forderte die USA derweil auf, das “Kalte-Kriegs-Denken” aufzugeben und aufzuhören, sich in Chinas innere Angelegenheiten einzumischen.
Der US-Seite sei es wichtig gewesen, dass die erste Begegnung auf amerikanischem Boden und nach Konsultationen mit Verbündeten in Asien und Europa stattfinde, sagte Regierungssprecherin Jen Psaki. Dass China dem zugestimmt hat, zeigt, wie wichtig auch Peking die Wiederaufnahme des Gesprächsfadens ist. ck
Der chinesische Verband der Halbleiterindustrie (CSIA) hat die Gründung einer Arbeitsgruppe mit seinem US-Gegenpart, der Semiconductor Industry Association (SIA), bekanntgegeben. Beide Verbände wollen sich halbjährlich treffen, um sich gegenseitig über Technologie- und Handelsbeschränkungen auf dem Laufenden zu halten, wie es in einem Statement der CSIA heißt. Auch wolle man sich über Exportkontrollen, die Sicherheit der Lieferketten und Verschlüsselungsthemen austauschen sowie zu Bereichen, die beide Seiten betreffen, politische Empfehlungen ausarbeiten. An den halbjährlichen Treffen sollen jeweils zehn Mitgliedsfirmen der beiden Verbände teilnehmen. Ein Termin für das erste Treffen wurde bisher nicht bekanntgegeben.
Die Kooperation zwischen den Verbänden sei dringend nötig, sagte ein führender Berater der Consultingfirma Intralink zu Bloomberg: “Es wäre eine Katastrophe, wenn zwei Halbleiterwelten entstehen würden, deren Produkte nicht kompatibel wären oder es keine Standards gibt.”
Die Gründung der Arbeitsgruppe erfolgt inmitten von Spekulationen, dass die US-Regierung bestimmte Handelsbeschränkungen gegen chinesische Halbleiterfirmen lockern könnte, um den weltweiten Mangel an Chips zu lindern, wie die South China Morning Post berichtet.
Der Mangel an Chips und die Abhängigkeiten von wenigen Lieferländern haben sowohl in China, den USA als auch Europa zu verstärkten Bemühungen zum Aufbau einheimischer Produktionskapazitäten geführt. China will bis 2025 etwa 70 Prozent seines Chipbedarfs aus eigener Herstellung decken. Bisher importiert das Land noch jährlich Halbleiter im Wert von 300 Milliarden US-Dollar. Erst vergangene Woche hatte Premier Li Keqiang massive Investitionen in die Chipindustrie angekündigt. Im letzten Jahr wurden nur knapp 16 Prozent der in China verkauften Chips im Land selbst produziert.
Die US-Industrie hingegen fordert eine höhere staatliche Förderung der einheimischen Produktion, um die Versorgung zu sichern und den Technologie-Vorsprung gegenüber China zu halten, wie die Financial Times berichtete. Auch die EU-Kommission verfolgt Pläne, dass der Wirtschaftsraum bis 2030 eigene hochentwickelte Halbleiter produzieren soll. Bis dahin sollen mindestens 20 Prozent der Weltproduktion wertmäßig innerhalb der EU stattfinden. Das wäre eine Verdopplung zum aktuellen Wert.
Derzeit entfallen auf die EU, USA (12 Prozent) und China (16 Prozent) zusammen 38 Prozent der weltweiten Chipproduktion, während Südkorea und Taiwan 43 Prozent der weltweiten Produktionskapazität aufweisen. nib

Das Klima zwischen den USA und China als unterkühlt zu bezeichnen, ist ein klassisches Understatement. Derzeit sehen fast neun von zehn US-Bürgern (89 Prozent) in der Volksrepublik eine unfreundliche Wettbewerberin und Feindin, aber keine Partnerin. Das fand eine repräsentative Online-Umfrage des Washingtoner Instituts für Meinungsforschung Pew Research Center heraus, die zeitgleich mit der Eröffnung des Volkskongresses erschien. Pew nutzte bei seiner Befragung auch einen “Temperaturmesser”. Für 67 Prozent hätten sich ihre China-Gefühle “abgekühlt”, während es 2018 erst 46 Prozent waren. Fast jeder vierte Bürger (24 Prozent) gab eisige null Grad an, fast dreimal mehr als es 2018 waren.
Der emotionale Temperartursturz wirkt wie eine Retourkutsche, auf die von Peking regelmäßig gegenüber dem Ausland gemachten Vorwürfe, die “Gefühle des chinesischen Volkes verletzt zu haben.” (伤害中国人民的感情). Mit dieser Formel drischt es auf Staaten, Unternehmen, Einzelpersonen oder Institutionen aller Art ein, von denen sich Chinas Regierung auf die Füße getreten fühlt. Es sei, wie der “Economist” meinte, ein Schachzug der Partei, um sich im Ausland einmischen zu können. Dabei wird das chinesische Volk nicht befragt, ob es sich beleidigt fühlt. Pekings Außenministerium und seine Parteimedien entscheiden stellvertretend, wann, wie, wo und von wem seine “Gefühle” verletzt werden.
1959 druckte die Volkszeitung erstmals die Formel als Warnung an Neu-Delhi, weil indische Truppen im Himalaya chinesisch beanspruchtes Terrain überschritten hätten. David Bandursky vom China Media Project untersuchte 143 Beispiele, wo die Volkszeitung zwischen 1959 und 2015 das Label, “die Gefühle des chinesischen Volkes verletzt zu haben” dem Ausland aufklebte. 51-mal wurde Japan verwarnt, 35-mal die USA. “Nach 1978 an wurde der Slogan zum festen Bestandteil des politischen Diskurses der Partei.”
Seit Peking außenpolitisch offensiver seine Interessen vertritt und dazu die Wirtschaftsmuskeln spielen lässt, passiert es immer öfter, dass sich die Gebrandmarkten aus Angst vor Sanktionen zur öffentlichen Entschuldigung genötigt fühlen. 2018 leistete der Autokonzern Mercedes Benz bei der chinesischen Botschaft in Berlin Abbitte, nachdem er in einem Werbespot den (nur in China politisch geächteten) Dalai Lama zitiert hatte. Der italienischen Luxusmarke Dolce&Gabbana (D&G) wurde ein witzig gemeintes Video zum Verhängnis, das eine mit Stäbchen Pizza essende Chinesin zeigte. Peking empfand den Spot zutiefst diskriminierend. D&G musste Modenschauen absagen, seine China-Umsätze fielen. Die nationalistische “Global Times” triumphierte: “Fakten zeigen, dass die Verletzung der nationalen Gefühle des chinesischen Volkes vom Markt bestraft wird und die 1,3 Milliarden Menschen des Landes entscheiden.”
Am pauschalen Vorwurf änderte sich seit 60 Jahren nichts. Nur die Zahl der an verletzten Gefühlen leidenden Chinesen musste nach jedem Volkszählung aktualisiert werden. 1959 waren es 670 Millionen Menschen. Im August 1980 warf Xinhua dem damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan vor, er habe “die Gefühle von einer Milliarden Menschen tief verletzt”, weil er ein Verbindungsbüro der US-Regierung auf Taiwan einrichten wollte. Wer im Ausland kritisch über Chinas drei T-Tabus (Taiwan, Tibet und Tiananmen) spricht, verletzt automatisch die Gefühle des chinesischen Volkes.
Im Jahr 2000 waren 1,2 Milliarden Menschen beleidigt, nachdem Schweden seinen Literatur-Nobelpreises an den in Frankreich lebenden Dissidenten Gao Xingjian verlieh. 2012 verletzte laut Xinhua Japan die Gefühle von 1,3 Milliarden Chinesen, als sich im September 2012 Chinas Inselstreit mit Japan zuspitzte, wem die Diaoyu (Senkaku)-Inseln im ostchinesischen Meer gehören.
Auf der Liste der Gefühlsverletzer stehen oder standen Hollywoodstars von Richard Gere bis Brad Pitt (wegen Tibet), Sänger aus Taiwan und K-Pop-Bands wie BTS aus Südkorea, die nordamerikanische Basketballliga (NBA), Hotelketten oder Fluggesellschaften. Wikipedia trug entsprechende Beispiele aus aller Welt zusammen. Die Bertelsmann-Stiftung erklärte auf einem Schaubild, wie Chinas Regierung ihren Vorwurf zu “einem mächtigen Werkzeug machte, um ausländische Institutionen zu zwingen, sich Pekings ideologischen Postulaten zu unterwerfen.”.
Im September 2007 traf die Pekinger Empfindlichkeit Kanzlerin Angela Merkel, als sie in Berlin den Dalai Lama traf und “die Gefühle des chinesischen Volkes und die beiderseitigen Beziehungen verletzte und schwerwiegend unterminierte”. Weil Frau Merkel danach aber jedes Jahr China besuchte und nie wieder den Dalai Lama traf, wurde sie wieder zur “lao pengyou”, der “altehrwürdigen Freundin des chinesischen Volkes” (中国人民的老朋友).
Lao pengyou zu sein ist der Gegenpart zum Gefühle-Trampler. Politiker und Wirtschaftsführer, die mindestens dreimal China besuchten, haben Anspruch darauf. Die Ausnahme von der Regel war Henry Kissinger, der alle Führer Chinas von Mao Zedong bis Xi Jinping traf. Weil Peking ihn brauchte, nannten ihn Mao und sein Premier Zhou Enlai schon bei ihrem zweiten Treffen “alten Freund.” Kissinger notierte in seinem Buch “China”: Peking “schmeichelt den Besuchern, indem es sie als ‘alte Freunde’ begrüßt. Wodurch man es ihnen schwer macht, zu widersprechen und in Konfrontation zu gehen.”
Freundschaft, so Kissinger werde nicht als “persönliche Eigenschaft” gesehen, sondern als “langfristige kulturelle, nationale oder historische Bande” geknüpft. Chinas Führung hätte sich im Umgang mit Fremden “ein wenig von der traditionellen Behandlung der Barbaren bewahrt.”
Im Umkehrschluss bedeutet es, dass die so tief verletzten Gefühle des chinesischen Volkes im Nu verheilen, sobald der angebliche Verursacher Peking wieder nützlich erscheint. Oder gar nicht erst aufkommen, wenn sich alle zusammentun, um dem kalkulierten Druck zu widerstehen.

Ein 39 Jahre alter Bauer und Nudelmacher ist in China unverhofft zum Social-Media-Star geworden: Cheng Yunfu erlangte Internet-Ruhm, weil er seine handgezogenen Nudeln bereits seit 15 Jahren für den gleichbleibenden Preis von drei Yuan – gut 40 Cent – auf einem Markt in seiner Heimatprovinz Shandong verkauft, wie mehrere Medien berichteten. In einem Video, das in sozialen Medien wie Kuaishou geteilt wurde, erklärt Cheng, dass er den Preis nicht erhöht habe, weil sich die Dorfbewohner sonst die Nudelsuppe nicht mehr leisten könnten.
Begeistert von Cheng fluteten Schaulustige und Fans das kleine Dorf Matihe – plötzlich wurde seine Kochkunst von Hunderten Menschen gefilmt. Einige hätten live neben ihm mit der Handykamera gestreamt, berichtete Cheng der South China Morning Post. Der Ruhm über Nacht war für Cheng demnach zu Beginn zu viel des Guten. Mittlerweile habe er sich aber daran gewöhnt und wolle seine Bekanntheit nutzen, um seinem Dorf zu helfen und zahlende Kundschaft dorthin zu bringen. Er sei froh, dass das Dorf diese Chance nun habe, auch wenn er gar nicht berühmt sein möchte, sagte Cheng dem Bericht zufolge.