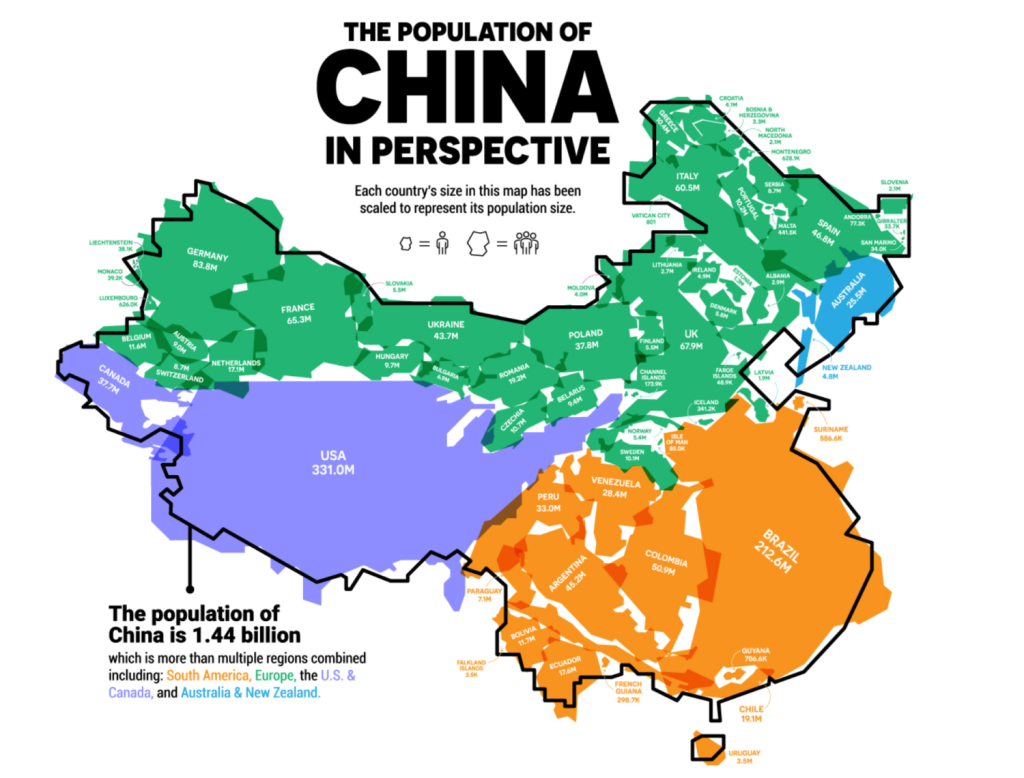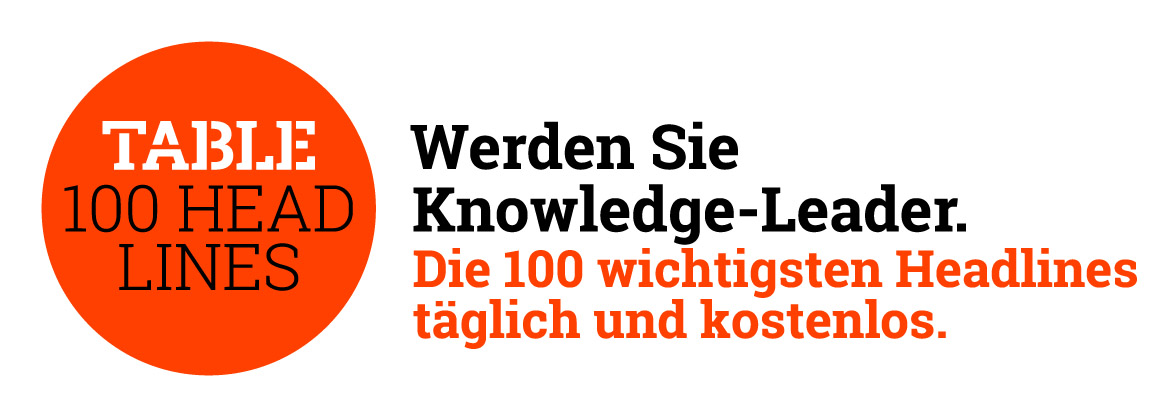der Ton ist gesetzt. Mehr als dreißig Jahre nach dem Massaker auf dem Tiananmen-Platz sanktioniert die EU erstmals Verantwortliche in China für Menschenrechtsverletzungen – an der uigurischen Minderheit in Xinjiang – und zwar gemeinsam mit den Vereinigten Staaten, Kanada und Großbritannien. Es ist ein klares Bekenntnis der westlichen Welt für Menschlichkeit und Freiheit – und ein deutlich vernehmbares Zeichen an Peking: Diese Werte sind nicht verhandelbar.
Dass Peking nur wenige Minuten nach dem Beschluss der EU-Außenminister zu Gegensanktionen gegriffen hat, werden die Europäer antizipiert haben. Alles andere wäre naiv, nachdem China erst am Freitag in Alaska sehr deutlich gemacht hat, dass es jede Kritik an Xinjiang als Einmischung in innere Angelegenheiten wertet. Amelie Richter hat die Ereignisse dieses diplomatisch explosiven Montags und wirft einen ersten Blick auf mögliche Folgen. Denn eines ist ja klar: Der Ton dieses Tages wird Auswirkungen auch auf die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Europa und China haben.
Empfehlen möchte ich Ihnen dazu ganz besonders die Ergebnisse der Recherchen von Marcel Grzanna, der Antworten darauf gefunden hat, warum nur knapp über der Hälfte der sechzig an der Studie “The Uyghur Genocide” des Newlines Institute beteiligten Wissenschaftler bereit waren, ihren Namen unter das Paper zu setzen.

Sichtlich verärgert betrat EU-Chefdiplomat Josep Borrell gestern das Podium für seine Pressekonferenz nach dem EU-Außenministertreffen. Innerhalb nur weniger Stunden hatte sich das Verhältnis zwischen der Europäischen Union und China rabenschwarz verdüstert: Nach Bekanntgabe der bereits erwarteten EU-Sanktionen gegen vier chinesische Beamte und eine Organisation erfolgte die – nicht weniger erwartete – Antwort aus Peking. Mit deren Ausmaß hatte in Brüssel aber wohl niemand gerechnet – China holte zum Sanktions-Rundumschlag gegen alle europäischen Stimmen aus, die Peking schon lange ein Dorn im Auge waren.
Die Strafmaßnahmen richten sich gegen europäische Politiker, Wissenschaftler und Organisationen, darunter die deutschen Europa-Abgeordneten Reinhard Bütikofer (Grüne) und Michael Gahler (CDU), den Anthropologen Adrian Zenz sowie den führenden deutschen China-Think-tank, das Merics-Institut. Insgesamt zehn Personen und vier “Entitäten” stehen auf der Sanktions-Liste aus Zhongnanhai, die eine bisher nie dagewesene diplomatische Eskalation zwischen der EU und China darstellt.
Das könnte nun auch Konsequenzen für den generellen Ansatz Brüssels gegenüber der Volksrepublik haben. Das Vorgehen Chinas sei “inakzeptabel”, sagte EU-Chefdiplomat Borrell, der in dieser Woche beim Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs einen Fortschrittsbericht zur China-Strategie vorstellen wird. “Ich will nicht sagen, dass die jüngsten Ereignisse diesen Ansatz obsolet machen”, so Borrell. “Aber man kann sagen, die Herangehensweise ist nicht mehr aktuell.” Borrells erwarteter Bericht ist die Fortsetzung der EU-China-Strategie aus dem Jahr 2019, die vor allem wegen der erstmaligen Erwähnung der “systematischen Rivalität” bekannt ist. Die Sanktionen Chinas hätten nun “eine neue Atmosphäre, eine neue Situation” geschaffen, über die beim EU-Gipfel definitiv gesprochen werde, so Borrell.
Neben den deutschen Europa-Abgeordneten Bütikofer und Gahler verhängt China auch Sanktionen gegen den Vorsitzenden des Menschenrechtsausschusses des EU-Parlaments, Raphaël Glucksmann, den bulgarischen EU-Parlamentarier Ilhan Kyuchyuk and die slowakische EU-Politikerin Miriam Lexmann. Ebenso der Menschenrechtsausschuss des Europaparlaments und das Politische und Sicherheitspolitische Komitee (PSK) der EU, ein Gremium von Diplomaten mit Botschafter-Rang, das im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik arbeitet, stehen auf der Liste. Ob die Sanktionen alle jeweiligen Mitglieder oder die Gremien als Gesamtes treffen, ließ Peking offen.
EU-Parlamentspräsident David Sassoli erklärte, der Schritt werde Konsequenzen haben. Der direkte Schlag gegen Europa-Abgeordnete könnte nun das ohnehin umstrittene Investitionsabkommen CAI gefährden – denn das Europaparlament muss diesem zustimmen. Ein für heute geplantes Treffen der Monitoring-Gruppe des Handelsausschusses, die über das CAI sprechen wollte, wurde kurzerhand abgesagt, wie aus EU-Kreisen bekannt wurde.
Auch Abgeordnete aus nationalen Parlamenten von EU-Staaten sind von Chinas Sanktionen betroffen: Der Niederländer Sjoerd Wiemer Sjoerdsma, der Belgier Samuel Cogolati sowie die litauische Politikerin Dovilė Šakalienė. In den drei Parlamenten gab es zuletzt Mehrheiten für Resolutionen gegen Chinas Vorgehen in Xinjiang. Der renommierte China-Forscher Björn Jerdén, Direktor des Swedish National China Centre, findet sich auf der Sanktionsliste, ebenso die dänische Nichtregierungsorganisation Alliance of Democracies Foundation.
“Den Betroffenen und ihren Familien ist es verboten, das chinesische Festland, Hongkong und Macau zu betreten”, teilte das chinesische Außenministerium mit. Außerdem dürften mit ihnen verbundene Unternehmen und Institutionen keine Geschäfte mit China tätigen. Peking verurteilte die europäischen Sanktionen scharf. Diese beruhten auf “nichts als Lügen und Desinformation”. Die EU greife damit grob in die inneren Angelegenheiten Chinas ein und verstoße gegen das Völkerrecht. Peking warf Brüssel eine “scheinheilige Praxis der Doppelmoral” vor und forderte eine Rücknahme der Strafmaßnahmen.
Bundesaußenminister Heiko Maas verurteilte die Sanktionen Chinas. Dass diese Parlamentarier und Wissenschaftler träfen, sei “völlig unverständlich” und “nicht akzeptabel”, so Maas. Die EU habe Personen sanktioniert, die gegen Menschenrechte verstoßen hätten, sagte Maas in Brüssel. China habe wiederum Parlamentarier und Organisationen als Ziel genommen. Ihm sei bisher nicht bekannt, dass einzelne EU-Länder wegen des Verhalten Pekings nun das CAI in Frage stellten, fügte Maas indes an.
Er sei “schon seit geraumer Zeit Hauptziel der chinesischen Regierung”, sagte Adrian Zenz China.Table nach Bekanntwerden der Sanktionen gegen ihn. Bisher sei er “als Handlanger der US-Regierung verleumdet” worden. Dass er nun im Zusammenhang mit den EU-Sanktionen Strafmaßnahmen ausgesetzt sei, überrasche ihn, so Zenz, der nach eigenen Angaben bereits seit 2019 aus Sicherheitsgründen nicht mehr in China arbeiten kann. Die EU-Sanktionen gegen China seien “gut und notwendig” – die Gegensanktionen aus Peking nun “ein rein symbolischer Akt”, so der Anthropologe.
Es sei “naiv” von der EU-Kommission gewesen, wirtschaftliche Fragen des CAI und Menschenrechtsfragen voneinander trennen zu wollen. Nun zeige sich, dass das nicht funktioniere, sagt Zenz. Die EU müsse klar machen, dass ein solches Abkommen nur zustande kommen könne, “wenn sich Peking verpflichtet, die Menschenrechte zu wahren und keine Form von Zwangsarbeit zulasse.”
Der von den Sanktionen betroffene Europa-Abgeordnete Michael Gahler, der auch außenpolitischer Sprecher der EVP-Fraktion ist, bedauerte, dass der Menschenrechtsausschuss des EU-Parlaments aufgeführt ist. “Dadurch wird der Dialog mit Vertretern der Volksrepublik natürlich erschwert und belastet”, so Gahler zu China.Table. Dass auch das Merics-Institut auf die Sanktionsliste komme, “sollte all den Universitäten und Think-Tanks zu denken geben, die sich über Konfuzius-Institute oder chinesische Unternehmen vom chinesischen Staat mitfinanzieren lassen”, so der CDU-Politiker.
“Die chinesische Führung ist offenbar nicht mehr damit zufrieden, nur in der Volksrepublik einschließlich Hongkong die Meinungsfreiheit zu unterdrücken, sondern man will jetzt auch Menschen in Europa durch Einschüchterung davon abhalten, offen die brutalen Menschenrechtsverbrechen in China zu kritisieren”, sagte der Grünen-Europaabgeordneter und Vorsitzender der China-Delegation des EU-Parlaments, Reinhard Bütikofer. “Das wird aber nach hinten losgehen.”
Auf Twitter erklärten sich mehrere EU-Abgeordnete, darunter EVP-Fraktionschef Manfred Weber und der Vorsitzende des Handelsausschusses, Bernd Lange, mit ihren Parlamentskollegen solidarisch. Merics wies die Vorwürfe aus Peking zurück und bedauerte die Entscheidung. “Als unabhängiges Forschungsinstitut wollen wir zu einem besseren und differenzierten Verständnis Chinas beitragen”, erklärte das Institut mit Sitz in Berlin in einer Mitteilung.
Die EU hatte sich bereits vergangenen Woche auf Sanktionen gegen vier Personen und eine Organisation im Zusammenhang mit Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang verständigt. Abgesegnet wurde die Liste gestern Vormittag beim Treffen der EU-Außenminister: Sie treffen Zhu Hailun, den ehemaligen stellvertretenden Vorsitzenden der KP Chinas in Xinjiang, sowie Wang Junzheng, Parteisekretär des Xinjiang Produktions- und Aufbaukorps (Xinjiang Production and Construction Corps. XPCC), einer wirtschaftlichen und paramilitärischen Organisationseinheit in Xinjiang, die der Zentralregierung in Peking unterstellt ist. Laut EU ist sie auch für die Verwaltung von Haftzentren zuständig.
Die EU-Sanktionen treffen außerdem Wang Mingshan, Mitglied des Ständigen Ausschusses der KP Chinas Xinjiang und Chen Mingguo, Direktor des Xinjiang Public Security Bureau (PSB), der regionalen Sicherheitsbehörde in der Provinz. Alle Einzelpersonen seien verantwortlich für schwere Menschenrechtsverletzungen, indem sie den Unterdrückungsapparat in Xinjiang mitgestalteten und umsetzten, hieß es in der EU-Erklärung.
Das zu XPCC gehörige PSB wurde zudem separat als Organisation mit auf die Sanktionsliste gesetzt. Dieses sei “verantwortlich für schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen in China, insbesondere für weitreichende willkürliche Inhaftierungen und erniedrigende Behandlung von Uiguren und Menschen aus anderen muslimischen ethnischen Minderheiten”, hieß es in der Begründung.
Das PSB sei zudem verantwortlich für Verstöße gegen Religions- oder Glaubensfreiheit und die Umsetzung “eines umfassenden Überwachungs-, Haft- und Indoktrinationsprogramms”. Uiguren und Menschen aus anderen muslimischen ethnischen Minderheiten seien systematisch als Zwangsarbeitskräfte eingesetzt worden, insbesondere auf Baumwollfeldern.
Für die Betroffenen gilt ein Einreiseverbot für die EU, außerdem werden ihre Vermögen eingefroren. Zudem dürfen sie keine finanziellen Mittel oder wirtschaftliche Unterstützung aus der Europäischen Union von Organisationen oder Einzelpersonen bekommen. Das PSB, Zhu Hailun und Wang Mingshan wurden im vergangenen Juli bereits von der US-Regierung mit Strafmaßnahmen belegt. Auf der US-Sanktionsliste findet sich auch Chen Quanguo, Chef der KP Chinas in Xinjiang – auf der EU-Liste fehlt Chen Quanguo, was Beobachtern zufolge eine Sanktions-Eskalation mit Peking hätte vermeiden sollen.
Es sind die ersten Sanktionen gegen China wegen Menschenrechtsverstößen seit der gewaltsamen Niederschlagung der Proteste auf dem Pekinger Tiananmen-Platz im Jahr 1989. Seit damals gilt ein Waffenembargo. Im Juli vergangenen Jahres hatte die EU Strafmaßnahmen wegen Cyber-Angriffen verhängt, betroffen waren zwei Chinesen und eine chinesische Firma.
Nur wenige Stunden nach der Bekanntgabe der EU-Sanktionsliste legten die USA, Kanada und Großbritannien in einem abgesprochenen Schritt nach: Washington verhängte erneut Sanktionen gegen China – diesmal gegen Wang Junzheng und Chen Mingguo, die sich beide auch auf der europäischen Liste finden. Fast zeitgleich gab auch Großbritannien Strafmaßnahmen bekannt. London belegte dabei dieselben vier Personen und eine Organisation wie die EU, die gleiche Entscheidung gab auch Ottawa bekannt. US-Außenminister Antony Blinken wird diese Woche in Brüssel erwartet, um EU-Kommissionspräsidentin Ursula Von der Leyen zu treffen.
Themen mit außergewöhnlicher Sprengkraft verlangen von Wissenschaftlern eine außergewöhnliche Handhabe. Wenige Wochen vor der Veröffentlichung von “The Uyghur Genocide”, einer Studie des Newlines Institute in Washington griff ihr Initiator, Azeem Ibrahim, entgegen seiner Gewohnheit Dutzende Male zum Telefon, um seine Mitstreiter zu kontaktieren. Das brisante Papier beschäftigt sich mit den Menschenrechtsverbrechen an der Minderheit der Uiguren in der autonomen Region Xinjiang durch die chinesische Regierung. Ihrahim rief rund 60 Kolleginnen und Kollegen an, die mit ihrer Arbeit und ihren Namen zur Entstehung des Papiers beigetragen hatten. Allen stellte er die gleiche Frage: “Unterzeichnest Du?”
Ibrahim wusste um die Brisanz des Gutachtens, das Todesfälle, Folter und Geburtenkontrolle in Xinjiang gemäß der UN-Konvention von 1948 bewertet und zu dem Schluss kommt: Ja, es ist ein Genozid. Und tatsächlich zogen zahlreiche Wissenschaftler ihre Namen zurück. Manche offenbar deshalb, weil sie im Laufe von acht Monaten, die die Arbeit verschlang, neue Jobs angetreten hatten und in ihren neuen Funktionen Interessenkonflikte drohten. Auf zwei Europäer sei laut Ibrahim durch die chinesischen Botschaften in ihren Heimatländern bereits vor Veröffentlichung Druck ausgeübt worden, so dass sich die Betroffenen gegen ihre Unterschrift entschieden hätten. Es heißt, das geschah auch aus Furcht vor politisch motivierten Abgängen zahlungskräftiger Auslandschinesen aus ihren Bildungseinrichtungen.
“Mich so intensiv rückzuversichern, habe ich bei anderen Arbeiten noch nie getan. Aber die Situation ist eine besondere. China übt viel Macht in der Welt aus, und wir sehen, zu was Peking in der Lage ist“, sagt Ibrahim im Gespräch mit China.Table. Der 45-Jährige ist Direktor für Sonderinitiativen des Newlines Institute, einer 2019 in Washington gegründete Denkfabrik, und als solcher erprobt mit heftigen Gegenreaktionen auf chinakritische Studien. Newlines hatte Ende Dezember eine Arbeit des deutschen Wissenschaftlers Adrian Zenz veröffentlicht, die umfassende und starke Indizien für Zwangsarbeit in Xinjiang vorlegte.
Auch Zenz hat an dem neuen Papier mitgearbeitet. Seine minutiöse Arbeit sorgte in der Vergangenheit dafür, dass Peking die Existenz von Lagern zur Umerziehung von Uiguren nicht mehr leugnen konnte. Gegen Zenz laufen Klagen von chinesischen Unternehmen, weil er durch angebliche “Lügen” ihre Geschäfte geschädigt haben soll. Dennoch steht sein Name wie der eines weiteren deutschen Forschers unter dem Papier.
Rainer Schulze ist Professor für Moderne Europäische Geschichte mit Schwerpunkt Menschenrechte an der Universität Essex. Bislang hat der Forscher “noch nichts gehört”, dass er von chinesischer Seite in irgendeiner Weise “angegangen” worden ist. Aber er suche auch nicht danach, teilte er China.Table in einer schriftlichen Stellungnahme mit. “Allerdings war und ist mir klar, dass ich mit meiner Unterschrift alle Reisepläne für China, die ich eventuell irgendwann haben könnte, besser fallen lasse – aber das ist dann eben so.” Seine Unterschrift sei ihm eine Ehre und eine Selbstverständlichkeit gewesen.
Insgesamt blieben 33 Namen unter der Studie übrig. Alle anderen hat Ibrahim lediglich mit dem US-Fernsehsender CNN geteilt, allerdings unter der Voraussetzung der Geheimhaltung. Alle Unterzeichner müssen derweil davon ausgehen, spätestens jetzt zu unerwünschten Personen in der Volksrepublik erklärt zu werden. Chinas Staatsmedien versuchen, auch die Glaubwürdigkeit des Newlines Institute zu diskreditieren, indem sie ihm Voreingenommenheit nachweisen wollen. Die Teilnahme von Zenz halten sie zudem für ein Indiz dafür, dass die Studie nur dazu dient, China zu diffamieren. Dabei gehört Zenz zu denjenigen, die die Beweislage sogar für dünn halten, wenn es um den Begriff “Genozid” geht, wie er in einem Interview mit der NZZ am Freitag klarstellte.
Ende vergangener Woche machte derweil Amnesty International mit einem Bericht namens “Hearts and Lives broken – The Nightmare of Uyghur Families Separated by Repression” auf die Situation in Xinjiang aufmerksam. Für den Report sprach die Organisation mit uigurischen Elternpaaren, die aus Xinjiang fliehen und ihre Kinder in China zurücklassen mussten.
Auch die Amnesty-Mitarbeiter kennen die Taktiken der chinesischen Regierung, wenn es ihr darum geht, Vorwürfe aus dem Ausland zu kontern. “Amnesty International ist immer wieder mit dem Vorwurf der Voreingenommenheit konfrontiert, vor allem von Seiten repressiv agierender Regierungen. Unsere Antwort darauf ist: Wir dokumentieren die Verletzung internationaler anerkannter Menschenrechte auf Basis von Fakten“, sagt Theresa Bergmann, Asienreferentin bei Amnesty Deutschland. In der Volksrepublik darf die Organisation derweil nicht operieren. Stattdessen hat sie ein Büro in Hongkong. Dessen Mitarbeiter wurden in der Vergangenheit bereits mehrfach behördlich vorgeladen und für ihre Arbeit kritisiert.
Zu einem Dialog seien die Chinesen nach Ansicht von Bergmann nicht bereit. “Die chinesische Seite wird immer aggressiver, und wir stellen eine Verhärtung der Fronten fest. Peking bemüht sich gar nicht mehr darum, die Vorwürfe zu entkräften, sondern reagiert nur noch mit Gegenvorwürfen. Die Möglichkeiten, um miteinander ins Gespräch zu kommen, werden immer weniger.”
Initiator Ibrahim war auf Angriffe seitens der Chinesen vorbereitet. Er holte sehr bewusst hochrangige Akademiker und Forscher aus der ganzen Welt ins Boot, um zu verhindern, dass die chinesische Regierung das Papier als westliche Schmierschrift denunzieren kann. Neben Nordamerikanern, Australiern und Europäern beteiligten sich auch Experten aus Afrika und Asien, beispielsweise Adejoké Babington-Ashaye, Menschenrechtsanwältin aus Nigeria, Chief Charles A. Taku aus Kamerun, Anwalt am Internationalen Strafgerichtshof ICC in Den Haag, Djaouida Siaci aus Algerien, Juristin mit dem Schwerpunkt Mittlerer Osten, oder Kim Beng Phar, Gründer des Forums Strategic Pan Indo-Pacific Arena aus Malaysia, dessen Name in einer zweiten Fassung des Papiers gestrichen worden ist. Eine pakistanische Forscherin wird derweil auf eigenen Wunsch namentlich nicht erwähnt, wie Ibrahim sagt.
Weitere Namen hochrangiger Unterstützer sind David Scheffer, der unter dem früheren US-Präsidenten Bill Clinton als Ambassador-at-large for Global Criminal Justice arbeitete, dazu Allan Rock, einst kanadischer UN-Botschafter, sowie die schottische Kronanwältin (QC) Baronesse Helena Ann Kennedy, gleichzeitig Labour-Abgeordnete im britischen House of Lords, oder der frühere kanadische Justizminister Irwin Cotler.
Ibrahim verzichtete darauf, nach konkreten Gründen zu fragen, wenn sich jemand gegen die Unterzeichnung entschied, geschweige denn jemanden vom Gegenteil zu überzeugen. “Manche”, sagt er, “sind sich einfach bewusst geworden, dass die Wirkung dieser Studie deutlich größer werden könnte, als wir es antizipiert hatten. Sie waren nicht gewillt, sich dem zu erwartenden Druck auszusetzen.”
Ausgangspunkt für seine Auswahl an Mitwirkenden war Ibrahims Netzwerk, das er über seine Forschung an der Verfolgung der Rohingyas in Myanmar gestrickt hatte. Er selbst ist Muslim, in Schottland als Sohn eines pakistanischen Ehepaares geboren und aufgewachsen. Heute hält er sowohl die britische wie auch die US-Staatsbürgerschaft. Seine persönliche Motivation sei es gewesen, endlich einen Beitrag zu leisten, ganz gleich ob die Verbrechen in Xinjiang der Bezeichnung Genozid gerecht würden oder nicht. “Es wird so viel Zeit in der Welt darauf verschwendet, diese Debatte zu führen, statt endlich etwas gegen die Vorgänge in Xinjiang zu unternehmen”, sagt Ibrahim. Es sei dennoch in vielerlei Hinsicht irrelevant, ob es ein Genozid ist oder nicht, weil “es wohl wenige Stimmen außerhalb Chinas gibt, die grundsätzlich bestreiten würden, dass die Verbrechen immer noch stattfinden.” Mit der Studie hofft er, neue Impulse für schnellere Entscheidungen durch die Politik setzen zu können.
Das Newlines Institute wurde 2019 von Ahmed Alwani gegründet. Auf der Internsetseite stellt Alwani sich als Geschäftsmann vor, der im Norden des US-Bundesstaates Virginia lebt und “in Geflügel, Immobilien und den Erziehungs-/Fortbildungssektor” investiert hat. Er ist Mitglied in Gremien mehrerer Non-Profit-Organisationen. 2018 wurde er Vizepräsident des Instituts für Islamische Ideen in Virginia, das sich für bessere Bildungschancen in muslimischen Gesellschaften einsetzt. Schon 1990 machte er seinen Ingenieurs-Abschluss an der George Washington University. Das Newlines Institute sei “unparteiisch”, versicht Alwani, der gleichzeitig Präsident der Fairfax University of America (FXUA) ist. Die private Einrichtung hieß 2019 noch Virginia International University (VIU) und galt als verknüpft zur Gülen-Bewegung um den Türken Fethullah Gülen, der in den USA im Exil lebt.
Trotz Pandemie und einem angespannten politischen Klima zwischen den USA und China haben die fünf größten US-Banken im vergangenen Jahr Milliarden von Dollar nach China gepumpt. Nachdem die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ihren 50-Billionen-Dollar-Finanzmarkt, zu dem auch Vermögensverwalter und Versicherer gehören, weiter geöffnet hatte, investierten Goldman Sachs, Citigroup, JP Morgan, die Bank of America und Morgan Stanley 2020 zusammen rund 78 Milliarden US-Dollar in China – ein Anstieg von 10 Prozent gegenüber 2019. Das ist so viel wie noch nie.
Bereits im Frühjahr 2020, auf dem Höhepunkt der Coronakrise, hob Chinas Börsenaufsicht die Beschränkungen für ausländische Beteiligungen in den Bereichen Bankwesen, Wertpapiere, Termingeschäfte und Fondsverwaltung auf. Davor hatten sich ausländische Banken einzeln mit maximal 20 Prozent an einem chinesischen Institut beteiligen dürfen – die Grenze für Konsortien lag bei 25 Prozent. Beschränkungen für die Qualifikation der Anteilseigner – etwa den Umfang der Vermögenswerte und die Betriebsdauer – wurden verringert.
Goldman Sachs steigerte seinen China-Einsatz im vergangenen Jahr daraufhin um 33 Prozent auf 17,5 Milliarden US-Dollar. Auch gab das Unternehmen bekannt, seine Belegschaft in China in den nächsten fünf Jahren auf 600 Mitarbeiter verdoppeln zu wollen. Das Gesamtengagement von JP Morgan stieg im Dezember 2020 um 10,4 Prozent auf 21,2 Milliarden US-Dollar. JP Morgan hatte seinen Anteil an seinem chinesischen Wertpapier-Joint-Venture Ende letzten Jahres auf 71 Prozent erhöhen können. Damit ist JP Morgan die erste ausländische Bank der Geschichte der Volksrepublik, die ihr Joint-Venture kontrolliert.
Zudem hat die US-Bank erklärt, für 410 Millionen US-Dollar einen Anteil von 10 Prozent an der Vermögenstochter der China Merchants Bank zu übernehmen.
Das Gesamtengagement der Citigroup in China stieg ab dem vierten Quartal 2020 um 16,6 Prozent auf 21,8 Milliarden US-Dollar. Dabei macht China erst 1,3 Prozent des weltweiten Engagements von Citi aus.
Das Nettoengagement von Morgan Stanley in China ging Ende Dezember 2020 gegenüber dem Vorjahr dagegen um fast fünf Prozent auf 3,9 Milliarden US-Dollar zurück, da es weniger Kredite vergeben und weniger Kreditzusagen verzeichnen konnte. Morgan Stanley hält einen 51-prozentigen Anteil an seinem Joint Venture in China, während der Partner Huaxin Securities die restlichen 49 Prozent hält. Ebenfalls zurückgefahren wurden die Investitionen der Bank of America, deren Nettoengagement in China im Dezember 2020 um 13,9 Prozent auf 13,4 Milliarden US-Dollar zurückging. Dennoch sind die Amerikaner insgesamt präsenter als je zuvor. Die nach Blackrock zweitgrößte Vermögensverwaltungsgesellschaft der Welt, Vanguard, beschloss ihren Asien-Hauptsitz nach Shanghai zu verlegen. Ein deutliches Zeichen des Unternehmens, das insgesamt 7,2 Billionen US-Dollar von 30 Millionen Investoren verwaltet. In China arbeitet Vanguard eng mit der Alipay-App von Alibaba zusammen. Das Geschäft läuft so gut, dass sie kürzlich darauf verzichtet haben, eine eigene Fund-Management-Lizenz zu beantragen.
Auch europäische Banken spielen eine größere Rolle in China. Die HSBC Holdings PLC mit Hauptsitz in London hat erklärt, sich künftig verstärkt auf Asien zu konzentrieren und in der Region, einschließlich China, mindestens sechs Milliarden US-Dollar zu investieren. Die britische Großbank erhielt bereits grünes Licht, um die volle Kontrolle über ihre chinesische Lebensversicherungssparte zu übernehmen. Die Schweizer UBS Group AG wiederum will ihre Präsenz in China in drei bis fünf Jahren verdoppelt haben. Auch Credit Suisse kündigte jüngst an, das eigene China-Engagement massiv ausweiten zu wollen.
Der Anleihe- als auch der Aktienmarkt Chinas sind längst zu groß, um ignoriert zu werden. Die Banken sind “von Chinas starker Wirtschaftsleistung angezogen wie Motten von Flammen”, sagt Brock Silvers, Chief Investment Officer bei Kaiyuan Capital. Die ausländischen Player haben es dabei vor allem auch auf die wachsende Mittelschicht abgesehen. Nach Angaben der Beratungsfirma Oliver Wyman soll das investierbare Vermögen chinesischer Privatkunden von derzeit 24 Milliarden Dollar bis zum Jahr 2023 auf 41 Milliarden Dollar steigen.
Peking möchte durch die Öffnung wiederum die Kreditnachfrage bei den eigenen Banken reduzieren. Die günstigen Kredite insbesondere bei staatlichen Banken hatten in den vergangenen Jahrzehnten dazu beigetragen, die Wirtschaft anzukurbeln. Gleichzeitig stieg die Schuldenlast. Während der Corona-Krise wies die Regierung die Banken noch einmal an, mehr Kredite zu genehmigen, um die Wirtschaft nach dem Stillstand wieder anzukurbeln.
Dabei profitierte Peking auch von der höheren Präsenz der Ausländer. Im Oktober schrieb die South China Morning Post: “Während die Federal Reserve und andere große Zentralbanken in großem Umfang Geld drucken, um die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt zu stützen, registriert China einen ständigen Mittelzufluss in die Anleihe- und Aktienmärkte und in Investitionsprojekte.” Dies erlaubt es der Zentralbank, eine konservative Geldpolitik zu fahren und seine Leitzinsen relativ hoch zu belassen – was wiederum noch mehr Geld anzieht und dabei hilft, die negativen Folgen der ökonomischen Abkopplungsversuche der US-Regierung abzufedern. Für die ausländischen Banken lockten mit der schnellen Erholung der chinesischen Wirtschaft wiederum attraktive Renditeaussichten am Aktienmarkt.
Die Öffnung der Finanzmärkte schafft darüber hinaus die Bedingungen, um die Landeswährung Renminbi zu einer weltweit akzeptierten Handels- und Reservewährung aufzubauen. Und Peking weiß natürlich auch, dass US-Sanktionen in Zukunft umso schwieriger durchsetzbar sein werden, desto enger die beiden Finanzmärkte miteinander verzahnt sind. Mit der Öffnung seiner Märkte macht Peking die Wallstreet zum Lobbyisten chinesischer Interessen in Washington.
Die chinesischen Behörden öffnen die Märkte kontrolliert und schrittweise. Das regulatorische Umfeld bleibt dabei jedoch nach wie vor streng und auch einigermaßen unberechenbar. Auch deshalb verzichten viele ausländische Banken noch darauf, die Mehrheit ihrer Joint-Ventures in China zu übernehmen: Ihre chinesischen Partner können die Marktentwicklungen und die Reaktion der Regierung oft besser und schneller deuten – vor allem auch die politischen.
Wie stark der Staat im Ernstfall eingreift, zeigte zuletzt der kurzfristig abgesagte Börsengang von Alibabas Finanzarm Ant Financial. Mit einem Restrukturierungsplan soll das in Hangzhou ansässige Unternehmen nun in eine Finanzholdinggesellschaft umgewandelt werden. Damit wird es ähnlichen Kapitalanforderungen unterliegen wie chinesische Banken. Die Nation bleibe wachsam, um sicherzustellen, dass China seine “finanzielle Souveränität” beibehält, erklärte Staats- und Parteichef Xi Jinping. China wird die Kontrolle über die Wirtschaft des Landes nicht völlig den Marktkräften überlassen, den internationalen schon gar nicht.
Michael Kovrig wurde am Montag wegen Spionagevorwürfen in Peking vor Gericht gestellt. Der ehemalige kanadische Diplomat Kovrig ist seit über zwei Jahren in China inhaftiert und teilt dieses Schicksal mit dem ebenfalls kanadischen Michael Spavor.
Beide wurden im vergangenen Sommer wegen Spionage angeklagt. Wie auch schon bei Spavor wurde die Öffentlichkeit von Kovrigs Verhandlung mit der Begründung ausgeschlossen, dass es sich um einen sogenannten “Fall nationaler Sicherheit” handle. Spavor stand am vergangenen Freitag in der nordostchinesischen Stadt Dandong vor Gericht, seine Verhandlung endete nach zwei Stunden ohne Urteil. Auch im Fall Kovrig wurde am Montag kein Urteil gefällt.
“Er wurde willkürlich inhaftiert“, sagte Jim Nickel der stellvertretende Gesandte der kanadischen Botschaft in Peking am Montag zum Prozess von Michael Kovrig. Diplomaten aus 26 Ländern, darunter Deutschland, wie auch Journalisten versuchten vergeblich Zutritt zum Gerichtsgebäude zu bekommen. Nickel kritisierte, dass das Gerichtsverfahren gegen Kovrig nicht transparent und die Botschaft deswegen sehr beunruhigt sei. Kanada fordert die “sofortige Freilassung” seiner beiden Staatsbürger.
China hatte Kovrig und Spavor am 10. Dezember 2018 festgenommen, nachdem Meng Wanzhou, die Finanzchefin des Telekommunikationsausrüsters Huawei während einer Zwischenlandung in Vancouver auf Ersuchen der USA neun Tage zuvor festgesetzt worden war. Die USA werfen Meng, der Tochter des Huawei-Gründers Ren Zhengfei, vor, gegen Iran-Sanktionen verstoßen zu haben und fordern ihre Auslieferung. Seitdem steht Meng in Vancouver unter Hausarrest. Ihr droht bei einer Verurteilung in den USA eine lange Haftstrafe.
Lange Haft könnte auch den beiden Kanadiern in China drohen. Kanadas Premierminister Justin Trudeau spricht von “Geiseldiplomatie” und sieht die Festnahmen von Kovrig und Spavor als eine Vergeltungsaktion der Chinesen.
Guy Saint-Jacques, ehemaliger kanadischer Botschafter in China, sagte dem kanadischen Fernsehsender CTV zu den Prozessen: “Das ist alles abgekartet. Es ist ein Schwindel.” Er rechne mit einem Schuldspruch. niw
Russlands Außenminister Sergej Lawrow schlug China eine stärkere Zusammenarbeit vor, um sich gegen US-Sanktionen zu wehren. Die beiden Länder sollten in den Bereichen Wissenschaft und Technologie kooperieren, um ihre Eigenständigkeit zu stärken, so Lawrow in einem Interview mit dem chinesischen Staatsfernsehen kurz vor einem zweitägigen Austausch mit Chinas Außenminister Wang Yi. Weiter schlug Lawrow vor, die Abhängigkeit vom US-Dollar im internationalen Handel zu reduzieren und von “westlich-kontrollierten Zahlungssystemen” unabhängiger zu werden, wie die South China Morning Post berichtet.
Eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums erklärte am gestrigen Montag lediglich, China und Russland unterstützten sich “fest in Fragen, die die Kerninteressen des jeweils anderen betreffen“. Zur Agenda des Treffens zwischen Lawrow und Wang machte sie keine detaillierteren Angaben.
Russland steht seit 2014 wegen der Annexion der Krim unter Sanktionen. Laut SCMP will das US-Handelsministerium die Sanktionen gegen einige Exporte nach Russland aufgrund der Vergiftung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny weiter verschärfen. Zuvor hatte das US-Außenministerium neue Sanktionen gegen China wegen der Überarbeitung des Wahlsystems in Hongkong verkündet (China.Table berichtete). Am gestrigen Montag veröffentlichte auch die EU ihre Sanktionen wegen Menschenrechtsverletzungen an den Uiguren in Xinjiang. nib
Der japanische Industrieroboterhersteller Fanuc will 240 Millionen US-Dollar in sein Werk in Shanghai investieren. Die Investition soll durch einen Joint Venture mit Shanghai Electric Group zustande kommen. Fanucs Standort in Shanghai soll dabei von 340.000 Quadratmeter um das Fünffache anwachsen und die neuen Anlagen sollen 2023 in Betrieb gehen.
Laut dem chinesischen Forschungsunternehmen MIR ist Fanuc mit einem Anteil von zwölf Prozent am Industrierobotermarkt in China schon seit 2019 der größte Anbieter. Durch die angekündigte Investition versucht Fanuc diese Position zu verteidigen und seinen Abstand zu Wettbewerbern wie ABB (elf Prozent) und Yaskawa Electric (acht Prozent) zu vergrößern, so das Wirtschaftsportal Caixin.
Der Schweizer Technologiekonzern ABB plant noch in diesem Jahr ein Produktionswerk in Shanghai zu eröffnen und investierte dafür 150 Millionen US-Dollar. Yaskawa, ein japanischer Technologielieferant im Bereich Robotik, Antriebs- und Steuerungstechnik baut derweil an einem neuen Werk neben einem schon bestehenden in der Provinz Jiangsu, das rund 50 Millionen US-Dollar kosten wird und in dem im kommenden Geschäftsjahr die Produktion beginnen soll.
Seit 2019 hat die Volksrepublik mit mehr als 780.000 Industrierobotern weltweit die meisten Einheiten im Einsatz, zeigen Daten der International Federation of Robotics. Peking möchte bis 2025 den heimischen Marktanteil seiner Roboterhersteller von derzeit 30-40 Prozent auf 70 Prozent erhöhen. niw

Eine Frage des Diskurses: Was meint Chinas Präsident und Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas (KP Chinas) Xi Jinping, wenn er von Rechtsstaatlichkeit spricht? Wie definiert die chinesische Führung Multilateralismus? Wussten Sie, dass zu den sozialistischen Grundwerten Chinas Demokratie und Freiheit gehören? Was ist das Dokument Nr. 9 und warum lehnt es universelle Werte ab? Und was ist mit “einer Schicksalsgemeinschaft der Menschheit” gemeint?
Das im Vorfeld des Nationalen Volkskongresses erschienene Decoding China Dictionary beantwortet diese Fragen. Zusammengestellt von einer Gruppe ausgewiesenen Chinaexpert:innen, erklärt es Schlüsselbegriffe der internationalen Beziehungen und Entwicklungszusammenarbeit, die in China und Europa sehr unterschiedlich interpretiert werden. Es richtet sich an politische Entscheidungsträger:innen und Institutionen in Europa, die im Dialog und Austausch mit China stehen, sowie an alle China-Interessierte, und soll ein informierteres und fundierteres Engagement mit China ermöglichen.
Chinas Aufstieg zur globalen Macht verschiebt die globalen Gleichgewichte. Unter der Führung Xi Jinpings hat Peking die seit Deng Xiaoping geltende Maxime der zurückhaltenden Außenpolitik aufgegeben. China tritt nun aktiv auf globalen Bühnen auf und nimmt vermehrt Einfluss auf die Gestaltung internationaler Spielregeln.
Chinesische Ideen finden zunehmend Eingang in UN-Dokumente, in denen internationale Normen und Prinzipien wie Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte oder Demokratie mit neuer Bedeutung und “chinesischen Charakteristiken” versehen werden. Wenn Menschenrechtsbelange angesprochen werden, wirft China den Kritisierenden “Politisierung” und eine “imperialistische” oder “Kalte-Kriegs-Mentalität” vor. Stattdessen fordert es “Demokratie” in internationalen Beziehungen und eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit auf Basis “gemeinsamer Interessen”. Den universellen Menschenrechten stellt es eine Rechtehierarchie entgegen, an deren Spitze das “Recht auf Entwicklung” steht.
Solche konzeptionellen Rahmungen sind kein Zufall, sondern das Ergebnis koordinierter Initiativen der chinesischen Führung, ein eigenes chinesisches Diskurssystem zu entwickeln und seine diskursive Macht auszubauen. Im Ausland beklagen chinesische Diplomat:innen oft, dass der Westen China missversteht. Xi selbst betont immer wieder, dass die Geschichte Chinas “gut erzählt” und Chinas Diskursmacht gestärkt werden muss, um ein günstiges Klima der internationalen öffentlichen Meinung zu schaffen.
Die chinesische Führung unternimmt international erhebliche Anstrengungen, um ein “richtiges Verständnis” von China zu fördern, d.h. eines, das mit den Prioritäten des chinesischen Parteistaats übereinstimmt. Dieser hat Propaganda schon immer als ein wichtiges Instrument erachtet. Darin spielen “korrekte Formulierungen”, in Chinesisch tifa 提法, eine zentrale Rolle, denn indem die Partei bestimmte Formulierungen verbietet und andere vorschreibt, reguliert sie was gesagt und geschrieben wird – und damit auch, was getan wird. Außenstehenden mögen tifa wie leere Worthülsen erscheinen: Selbst in Festlandchina weiß kaum jemand, was hinter einem Begriff wie “Schicksalsgemeinschaft der Menschheit” steckt. Dennoch wirkt die Taktik, denn westliche Akteure beginnen, die Formulierungen zu übernehmen – ohne zu wissen, was dahintersteckt.
Der Gründer des Weltwirtschaftsforums Klaus Schwab dankte Xi Jinping beim diesjährigen Forum für die Ermahnung, dass “wir alle Teil einer Schicksalsgemeinschaft sind“. Xi hatte in seiner Rede davon gesprochen, dass “am Multilateralismus festzuhalten und den Aufbau einer Schicksalsgemeinschaft der Menschheit voranzutreiben” der einzige Weg zur Lösung der komplexen Probleme von heute sei. Von Multilateralismus spricht Xi generell sehr oft, und Chinas Staatsmedien bezeichnen das Land als den “Champion des Multilateralismus”.
Nur zeigt die Analyse des Parteidiskurses, dass sich Pekings Perspektive auf Multilateralismus von der westlichen unterscheidet. Während Multilateralismus eigentlich für allgemeinverbindliche Normen und Standards steht, erachtet Peking das bestehende regelbasierte multilaterale System für nicht “fair und gerecht”, sondern “den engen Interessen einer kleinen Gruppe (westlicher Staaten) dienend.” In seinem Bericht vor dem 19. Parteitag der KPCh beschrieb Xi seine Vision des Multilateralismus als “Dialog ohne Konfrontation, Partnerschaft ohne Allianzen”, also internationale Kooperation ohne allgemeinverbindliche Regeln, sondern auf Basis von bilateralen Konsultationen. Der von Xi vielfach beschworene Multilateralismus ist in Wirklichkeit ein Multi-Bilateralismus. Genau dieser verbirgt sich hinter der “Schicksalsgemeinschaft” für die Schwab Xi lobte.
Der Aufstieg Chinas zu einer Weltmacht in einer multipolaren Welt bedeutet einen zunehmenden Wettbewerb um internationale Werte und Normen. Die regelbasierte Weltordnung und der Multilateralismus beruhen auf einem globalen Konsens über die Definition der Normen, die das internationale System untermauern.
Wenn die Bedeutung von Begriffen wie Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, Demokratie und Souveränität unscharf wird, werden internationale Normen untergraben. Eine informierte Auseinandersetzung mit China setzt daher voraus, dass europäische Akteur:innen in der Lage sind, die offiziellen chinesischen Bedeutungen der Kernbegriffe und -konzepte der internationalen Beziehungen zu verstehen. Das Decoding China Dictionary soll hierfür als Referenz für Strategieentwicklung und Kommunikation mit chinesischen Partner:innen dienen.
Marina Rudyak ist Sinologin am Institut für Sinologie der Universität Heidelberg. Ihre Forschungsschwerpunkte sind die chinesische Entwicklungspolitik sowie die kodierte Kommunikation in der chinesischen Politik.

Frank Haugwitz pendelt seit über einem Jahr durch Südostasien – unfreiwillig, denn er wurde auf einer Dienstreise im November 2019 vom Corona-Virus überrascht. Aktuell ist er in Singapur, davor einige Monate in Thailand. Tatsächlich lebt und arbeitet der 55-jährige in Peking. Doch seit Beginn der Pandemie ist man in China sehr streng, was die Einreise von Ausländern angeht.
Dabei arbeitet Haugwitz mittlerweile seit 20 Jahren in China, inzwischen als Seniorberater bei Apricum, einer weltweit agierenden Beratungsagentur, die sich spezialisiert hat, Unternehmen bei Projekten im Bereich der Erneuerbaren Energien zu unterstützen. Trotz seiner aktuellen Situation wirkt Haugwitz sehr entspannt: “Ich sitze quasi im mobilen Home-Office. Das ist das Angenehme an meinem Job, dass ich in der aktuellen Situation nicht unbedingt physische Präsenz vor Ort zeigen muss. Es lässt sich so ganz gut bewerkstelligen.” Außerdem sei er nicht der einzige Expat, der gerade in der Situation ist, nicht zurück nach China zu kommen.
Es hilft sicherlich, dass Haugwitz es aufgrund seiner Arbeit sowieso gewohnt ist, viel zu reisen: “Der Markt der Erneuerbaren ist sich ja nicht nur auf China begrenzt, sondern betrifft ja die ganze Region. Deswegen war ich auch vor Corona beruflich zwischen sieben und acht Monaten im Jahr unterwegs.” Haugwitz ist gelernter Maschinenbaumechaniker. Nachdem er als Mittzwanziger Asien mit dem Rucksack bereiste (China ließ er damals übrigens aus), entschied er sich im zweiten Bildungsweg, Wirtschaftssprachen und Unternehmensführung zu studieren.
Dass der sprachliche Schwerpunkt auf Sinologie lag, war mehr Zufall als bewusste Entscheidung. Was das Wirtschaftliche anging, legte Haugwitz bereits während des Studiums den Schwerpunkt auf Umwelt und Energie, und ein erster China-Aufenthalt in der Abteilung für Umwelt und Energie der deutschen Handelskammer folgte. “Nach dem Abschluss meines Diploms 2002 bin ich dann direkt aus Deutschland ausgereist und habe in Peking chinesische Regierungseinrichtungen beim Thema Solarenergie beraten.” Später stieg er dann um auf Unternehmensberatung.
Zwischendrin beriet er als EU-Manager für Erneuerbare Energien europäische Unternehmen und Institutionen in der Zusammenarbeit mit chinesischen Partnern. Das war vor gut zehn Jahren. Seither hat er auch oft in Deutschland zum chinesischen Markt für Erneuerbare Vorträge gehalten. In Deutschland galt China lange als exotisch und besonders die brummende Solar-Branche sah keinen Bedarf das Risiko einzugehen, in China zu investieren. Ein Fehler, findet Haugwitz, der die rasante Entwicklung und auch die Chancen der Technologie in China seit Beginn miterlebte: “Zu Beginn war Photovoltaik nur ein Thema, wenn es um dezentrale Stromversorgung ging. Also besonders im ländlichen Westchina.”
Mittlerweile hätten die Chinesen, was das Technologische angeht, durchaus aufgeschlossen. Was auch daran lag, dass die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission den Industriesektor ordentlich ankurbelte, während man in Deutschland und Europa den Markt wirken ließ. Dieses Wettrennen macht die Branche für Haugwitz auch nach zwanzig Jahren immer noch attraktiv: “Die Solarindustrie ist eine spannende Geschichte. Langweilig? Nie!” David Renke
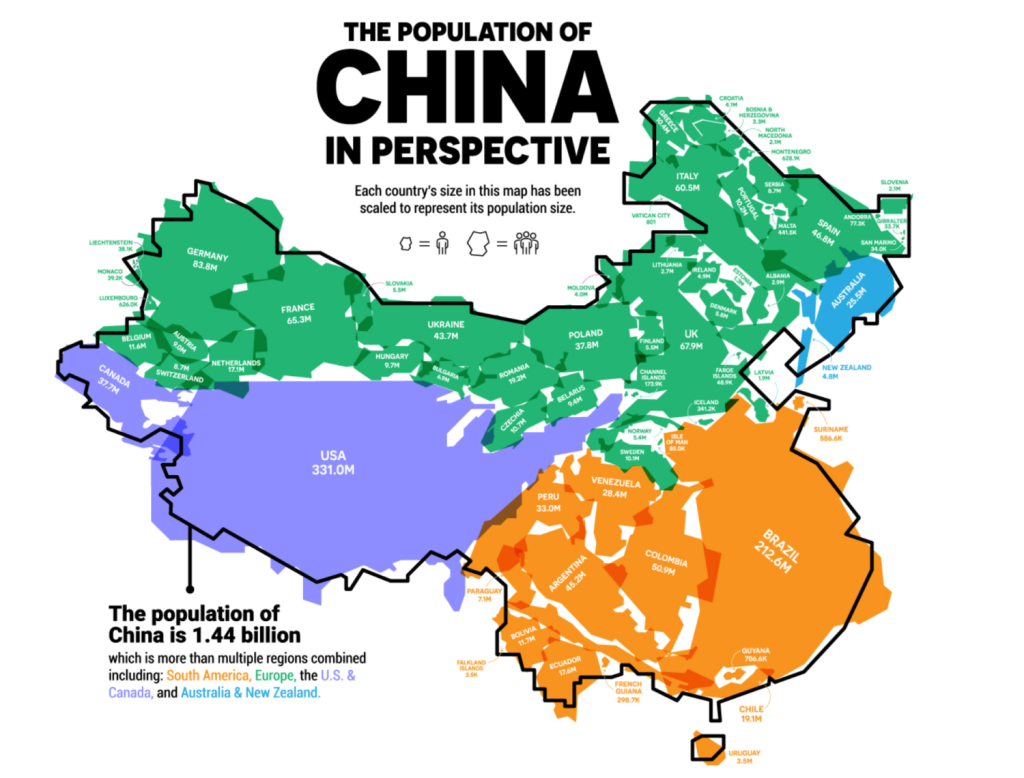
der Ton ist gesetzt. Mehr als dreißig Jahre nach dem Massaker auf dem Tiananmen-Platz sanktioniert die EU erstmals Verantwortliche in China für Menschenrechtsverletzungen – an der uigurischen Minderheit in Xinjiang – und zwar gemeinsam mit den Vereinigten Staaten, Kanada und Großbritannien. Es ist ein klares Bekenntnis der westlichen Welt für Menschlichkeit und Freiheit – und ein deutlich vernehmbares Zeichen an Peking: Diese Werte sind nicht verhandelbar.
Dass Peking nur wenige Minuten nach dem Beschluss der EU-Außenminister zu Gegensanktionen gegriffen hat, werden die Europäer antizipiert haben. Alles andere wäre naiv, nachdem China erst am Freitag in Alaska sehr deutlich gemacht hat, dass es jede Kritik an Xinjiang als Einmischung in innere Angelegenheiten wertet. Amelie Richter hat die Ereignisse dieses diplomatisch explosiven Montags und wirft einen ersten Blick auf mögliche Folgen. Denn eines ist ja klar: Der Ton dieses Tages wird Auswirkungen auch auf die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Europa und China haben.
Empfehlen möchte ich Ihnen dazu ganz besonders die Ergebnisse der Recherchen von Marcel Grzanna, der Antworten darauf gefunden hat, warum nur knapp über der Hälfte der sechzig an der Studie “The Uyghur Genocide” des Newlines Institute beteiligten Wissenschaftler bereit waren, ihren Namen unter das Paper zu setzen.

Sichtlich verärgert betrat EU-Chefdiplomat Josep Borrell gestern das Podium für seine Pressekonferenz nach dem EU-Außenministertreffen. Innerhalb nur weniger Stunden hatte sich das Verhältnis zwischen der Europäischen Union und China rabenschwarz verdüstert: Nach Bekanntgabe der bereits erwarteten EU-Sanktionen gegen vier chinesische Beamte und eine Organisation erfolgte die – nicht weniger erwartete – Antwort aus Peking. Mit deren Ausmaß hatte in Brüssel aber wohl niemand gerechnet – China holte zum Sanktions-Rundumschlag gegen alle europäischen Stimmen aus, die Peking schon lange ein Dorn im Auge waren.
Die Strafmaßnahmen richten sich gegen europäische Politiker, Wissenschaftler und Organisationen, darunter die deutschen Europa-Abgeordneten Reinhard Bütikofer (Grüne) und Michael Gahler (CDU), den Anthropologen Adrian Zenz sowie den führenden deutschen China-Think-tank, das Merics-Institut. Insgesamt zehn Personen und vier “Entitäten” stehen auf der Sanktions-Liste aus Zhongnanhai, die eine bisher nie dagewesene diplomatische Eskalation zwischen der EU und China darstellt.
Das könnte nun auch Konsequenzen für den generellen Ansatz Brüssels gegenüber der Volksrepublik haben. Das Vorgehen Chinas sei “inakzeptabel”, sagte EU-Chefdiplomat Borrell, der in dieser Woche beim Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs einen Fortschrittsbericht zur China-Strategie vorstellen wird. “Ich will nicht sagen, dass die jüngsten Ereignisse diesen Ansatz obsolet machen”, so Borrell. “Aber man kann sagen, die Herangehensweise ist nicht mehr aktuell.” Borrells erwarteter Bericht ist die Fortsetzung der EU-China-Strategie aus dem Jahr 2019, die vor allem wegen der erstmaligen Erwähnung der “systematischen Rivalität” bekannt ist. Die Sanktionen Chinas hätten nun “eine neue Atmosphäre, eine neue Situation” geschaffen, über die beim EU-Gipfel definitiv gesprochen werde, so Borrell.
Neben den deutschen Europa-Abgeordneten Bütikofer und Gahler verhängt China auch Sanktionen gegen den Vorsitzenden des Menschenrechtsausschusses des EU-Parlaments, Raphaël Glucksmann, den bulgarischen EU-Parlamentarier Ilhan Kyuchyuk and die slowakische EU-Politikerin Miriam Lexmann. Ebenso der Menschenrechtsausschuss des Europaparlaments und das Politische und Sicherheitspolitische Komitee (PSK) der EU, ein Gremium von Diplomaten mit Botschafter-Rang, das im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik arbeitet, stehen auf der Liste. Ob die Sanktionen alle jeweiligen Mitglieder oder die Gremien als Gesamtes treffen, ließ Peking offen.
EU-Parlamentspräsident David Sassoli erklärte, der Schritt werde Konsequenzen haben. Der direkte Schlag gegen Europa-Abgeordnete könnte nun das ohnehin umstrittene Investitionsabkommen CAI gefährden – denn das Europaparlament muss diesem zustimmen. Ein für heute geplantes Treffen der Monitoring-Gruppe des Handelsausschusses, die über das CAI sprechen wollte, wurde kurzerhand abgesagt, wie aus EU-Kreisen bekannt wurde.
Auch Abgeordnete aus nationalen Parlamenten von EU-Staaten sind von Chinas Sanktionen betroffen: Der Niederländer Sjoerd Wiemer Sjoerdsma, der Belgier Samuel Cogolati sowie die litauische Politikerin Dovilė Šakalienė. In den drei Parlamenten gab es zuletzt Mehrheiten für Resolutionen gegen Chinas Vorgehen in Xinjiang. Der renommierte China-Forscher Björn Jerdén, Direktor des Swedish National China Centre, findet sich auf der Sanktionsliste, ebenso die dänische Nichtregierungsorganisation Alliance of Democracies Foundation.
“Den Betroffenen und ihren Familien ist es verboten, das chinesische Festland, Hongkong und Macau zu betreten”, teilte das chinesische Außenministerium mit. Außerdem dürften mit ihnen verbundene Unternehmen und Institutionen keine Geschäfte mit China tätigen. Peking verurteilte die europäischen Sanktionen scharf. Diese beruhten auf “nichts als Lügen und Desinformation”. Die EU greife damit grob in die inneren Angelegenheiten Chinas ein und verstoße gegen das Völkerrecht. Peking warf Brüssel eine “scheinheilige Praxis der Doppelmoral” vor und forderte eine Rücknahme der Strafmaßnahmen.
Bundesaußenminister Heiko Maas verurteilte die Sanktionen Chinas. Dass diese Parlamentarier und Wissenschaftler träfen, sei “völlig unverständlich” und “nicht akzeptabel”, so Maas. Die EU habe Personen sanktioniert, die gegen Menschenrechte verstoßen hätten, sagte Maas in Brüssel. China habe wiederum Parlamentarier und Organisationen als Ziel genommen. Ihm sei bisher nicht bekannt, dass einzelne EU-Länder wegen des Verhalten Pekings nun das CAI in Frage stellten, fügte Maas indes an.
Er sei “schon seit geraumer Zeit Hauptziel der chinesischen Regierung”, sagte Adrian Zenz China.Table nach Bekanntwerden der Sanktionen gegen ihn. Bisher sei er “als Handlanger der US-Regierung verleumdet” worden. Dass er nun im Zusammenhang mit den EU-Sanktionen Strafmaßnahmen ausgesetzt sei, überrasche ihn, so Zenz, der nach eigenen Angaben bereits seit 2019 aus Sicherheitsgründen nicht mehr in China arbeiten kann. Die EU-Sanktionen gegen China seien “gut und notwendig” – die Gegensanktionen aus Peking nun “ein rein symbolischer Akt”, so der Anthropologe.
Es sei “naiv” von der EU-Kommission gewesen, wirtschaftliche Fragen des CAI und Menschenrechtsfragen voneinander trennen zu wollen. Nun zeige sich, dass das nicht funktioniere, sagt Zenz. Die EU müsse klar machen, dass ein solches Abkommen nur zustande kommen könne, “wenn sich Peking verpflichtet, die Menschenrechte zu wahren und keine Form von Zwangsarbeit zulasse.”
Der von den Sanktionen betroffene Europa-Abgeordnete Michael Gahler, der auch außenpolitischer Sprecher der EVP-Fraktion ist, bedauerte, dass der Menschenrechtsausschuss des EU-Parlaments aufgeführt ist. “Dadurch wird der Dialog mit Vertretern der Volksrepublik natürlich erschwert und belastet”, so Gahler zu China.Table. Dass auch das Merics-Institut auf die Sanktionsliste komme, “sollte all den Universitäten und Think-Tanks zu denken geben, die sich über Konfuzius-Institute oder chinesische Unternehmen vom chinesischen Staat mitfinanzieren lassen”, so der CDU-Politiker.
“Die chinesische Führung ist offenbar nicht mehr damit zufrieden, nur in der Volksrepublik einschließlich Hongkong die Meinungsfreiheit zu unterdrücken, sondern man will jetzt auch Menschen in Europa durch Einschüchterung davon abhalten, offen die brutalen Menschenrechtsverbrechen in China zu kritisieren”, sagte der Grünen-Europaabgeordneter und Vorsitzender der China-Delegation des EU-Parlaments, Reinhard Bütikofer. “Das wird aber nach hinten losgehen.”
Auf Twitter erklärten sich mehrere EU-Abgeordnete, darunter EVP-Fraktionschef Manfred Weber und der Vorsitzende des Handelsausschusses, Bernd Lange, mit ihren Parlamentskollegen solidarisch. Merics wies die Vorwürfe aus Peking zurück und bedauerte die Entscheidung. “Als unabhängiges Forschungsinstitut wollen wir zu einem besseren und differenzierten Verständnis Chinas beitragen”, erklärte das Institut mit Sitz in Berlin in einer Mitteilung.
Die EU hatte sich bereits vergangenen Woche auf Sanktionen gegen vier Personen und eine Organisation im Zusammenhang mit Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang verständigt. Abgesegnet wurde die Liste gestern Vormittag beim Treffen der EU-Außenminister: Sie treffen Zhu Hailun, den ehemaligen stellvertretenden Vorsitzenden der KP Chinas in Xinjiang, sowie Wang Junzheng, Parteisekretär des Xinjiang Produktions- und Aufbaukorps (Xinjiang Production and Construction Corps. XPCC), einer wirtschaftlichen und paramilitärischen Organisationseinheit in Xinjiang, die der Zentralregierung in Peking unterstellt ist. Laut EU ist sie auch für die Verwaltung von Haftzentren zuständig.
Die EU-Sanktionen treffen außerdem Wang Mingshan, Mitglied des Ständigen Ausschusses der KP Chinas Xinjiang und Chen Mingguo, Direktor des Xinjiang Public Security Bureau (PSB), der regionalen Sicherheitsbehörde in der Provinz. Alle Einzelpersonen seien verantwortlich für schwere Menschenrechtsverletzungen, indem sie den Unterdrückungsapparat in Xinjiang mitgestalteten und umsetzten, hieß es in der EU-Erklärung.
Das zu XPCC gehörige PSB wurde zudem separat als Organisation mit auf die Sanktionsliste gesetzt. Dieses sei “verantwortlich für schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen in China, insbesondere für weitreichende willkürliche Inhaftierungen und erniedrigende Behandlung von Uiguren und Menschen aus anderen muslimischen ethnischen Minderheiten”, hieß es in der Begründung.
Das PSB sei zudem verantwortlich für Verstöße gegen Religions- oder Glaubensfreiheit und die Umsetzung “eines umfassenden Überwachungs-, Haft- und Indoktrinationsprogramms”. Uiguren und Menschen aus anderen muslimischen ethnischen Minderheiten seien systematisch als Zwangsarbeitskräfte eingesetzt worden, insbesondere auf Baumwollfeldern.
Für die Betroffenen gilt ein Einreiseverbot für die EU, außerdem werden ihre Vermögen eingefroren. Zudem dürfen sie keine finanziellen Mittel oder wirtschaftliche Unterstützung aus der Europäischen Union von Organisationen oder Einzelpersonen bekommen. Das PSB, Zhu Hailun und Wang Mingshan wurden im vergangenen Juli bereits von der US-Regierung mit Strafmaßnahmen belegt. Auf der US-Sanktionsliste findet sich auch Chen Quanguo, Chef der KP Chinas in Xinjiang – auf der EU-Liste fehlt Chen Quanguo, was Beobachtern zufolge eine Sanktions-Eskalation mit Peking hätte vermeiden sollen.
Es sind die ersten Sanktionen gegen China wegen Menschenrechtsverstößen seit der gewaltsamen Niederschlagung der Proteste auf dem Pekinger Tiananmen-Platz im Jahr 1989. Seit damals gilt ein Waffenembargo. Im Juli vergangenen Jahres hatte die EU Strafmaßnahmen wegen Cyber-Angriffen verhängt, betroffen waren zwei Chinesen und eine chinesische Firma.
Nur wenige Stunden nach der Bekanntgabe der EU-Sanktionsliste legten die USA, Kanada und Großbritannien in einem abgesprochenen Schritt nach: Washington verhängte erneut Sanktionen gegen China – diesmal gegen Wang Junzheng und Chen Mingguo, die sich beide auch auf der europäischen Liste finden. Fast zeitgleich gab auch Großbritannien Strafmaßnahmen bekannt. London belegte dabei dieselben vier Personen und eine Organisation wie die EU, die gleiche Entscheidung gab auch Ottawa bekannt. US-Außenminister Antony Blinken wird diese Woche in Brüssel erwartet, um EU-Kommissionspräsidentin Ursula Von der Leyen zu treffen.
Themen mit außergewöhnlicher Sprengkraft verlangen von Wissenschaftlern eine außergewöhnliche Handhabe. Wenige Wochen vor der Veröffentlichung von “The Uyghur Genocide”, einer Studie des Newlines Institute in Washington griff ihr Initiator, Azeem Ibrahim, entgegen seiner Gewohnheit Dutzende Male zum Telefon, um seine Mitstreiter zu kontaktieren. Das brisante Papier beschäftigt sich mit den Menschenrechtsverbrechen an der Minderheit der Uiguren in der autonomen Region Xinjiang durch die chinesische Regierung. Ihrahim rief rund 60 Kolleginnen und Kollegen an, die mit ihrer Arbeit und ihren Namen zur Entstehung des Papiers beigetragen hatten. Allen stellte er die gleiche Frage: “Unterzeichnest Du?”
Ibrahim wusste um die Brisanz des Gutachtens, das Todesfälle, Folter und Geburtenkontrolle in Xinjiang gemäß der UN-Konvention von 1948 bewertet und zu dem Schluss kommt: Ja, es ist ein Genozid. Und tatsächlich zogen zahlreiche Wissenschaftler ihre Namen zurück. Manche offenbar deshalb, weil sie im Laufe von acht Monaten, die die Arbeit verschlang, neue Jobs angetreten hatten und in ihren neuen Funktionen Interessenkonflikte drohten. Auf zwei Europäer sei laut Ibrahim durch die chinesischen Botschaften in ihren Heimatländern bereits vor Veröffentlichung Druck ausgeübt worden, so dass sich die Betroffenen gegen ihre Unterschrift entschieden hätten. Es heißt, das geschah auch aus Furcht vor politisch motivierten Abgängen zahlungskräftiger Auslandschinesen aus ihren Bildungseinrichtungen.
“Mich so intensiv rückzuversichern, habe ich bei anderen Arbeiten noch nie getan. Aber die Situation ist eine besondere. China übt viel Macht in der Welt aus, und wir sehen, zu was Peking in der Lage ist“, sagt Ibrahim im Gespräch mit China.Table. Der 45-Jährige ist Direktor für Sonderinitiativen des Newlines Institute, einer 2019 in Washington gegründete Denkfabrik, und als solcher erprobt mit heftigen Gegenreaktionen auf chinakritische Studien. Newlines hatte Ende Dezember eine Arbeit des deutschen Wissenschaftlers Adrian Zenz veröffentlicht, die umfassende und starke Indizien für Zwangsarbeit in Xinjiang vorlegte.
Auch Zenz hat an dem neuen Papier mitgearbeitet. Seine minutiöse Arbeit sorgte in der Vergangenheit dafür, dass Peking die Existenz von Lagern zur Umerziehung von Uiguren nicht mehr leugnen konnte. Gegen Zenz laufen Klagen von chinesischen Unternehmen, weil er durch angebliche “Lügen” ihre Geschäfte geschädigt haben soll. Dennoch steht sein Name wie der eines weiteren deutschen Forschers unter dem Papier.
Rainer Schulze ist Professor für Moderne Europäische Geschichte mit Schwerpunkt Menschenrechte an der Universität Essex. Bislang hat der Forscher “noch nichts gehört”, dass er von chinesischer Seite in irgendeiner Weise “angegangen” worden ist. Aber er suche auch nicht danach, teilte er China.Table in einer schriftlichen Stellungnahme mit. “Allerdings war und ist mir klar, dass ich mit meiner Unterschrift alle Reisepläne für China, die ich eventuell irgendwann haben könnte, besser fallen lasse – aber das ist dann eben so.” Seine Unterschrift sei ihm eine Ehre und eine Selbstverständlichkeit gewesen.
Insgesamt blieben 33 Namen unter der Studie übrig. Alle anderen hat Ibrahim lediglich mit dem US-Fernsehsender CNN geteilt, allerdings unter der Voraussetzung der Geheimhaltung. Alle Unterzeichner müssen derweil davon ausgehen, spätestens jetzt zu unerwünschten Personen in der Volksrepublik erklärt zu werden. Chinas Staatsmedien versuchen, auch die Glaubwürdigkeit des Newlines Institute zu diskreditieren, indem sie ihm Voreingenommenheit nachweisen wollen. Die Teilnahme von Zenz halten sie zudem für ein Indiz dafür, dass die Studie nur dazu dient, China zu diffamieren. Dabei gehört Zenz zu denjenigen, die die Beweislage sogar für dünn halten, wenn es um den Begriff “Genozid” geht, wie er in einem Interview mit der NZZ am Freitag klarstellte.
Ende vergangener Woche machte derweil Amnesty International mit einem Bericht namens “Hearts and Lives broken – The Nightmare of Uyghur Families Separated by Repression” auf die Situation in Xinjiang aufmerksam. Für den Report sprach die Organisation mit uigurischen Elternpaaren, die aus Xinjiang fliehen und ihre Kinder in China zurücklassen mussten.
Auch die Amnesty-Mitarbeiter kennen die Taktiken der chinesischen Regierung, wenn es ihr darum geht, Vorwürfe aus dem Ausland zu kontern. “Amnesty International ist immer wieder mit dem Vorwurf der Voreingenommenheit konfrontiert, vor allem von Seiten repressiv agierender Regierungen. Unsere Antwort darauf ist: Wir dokumentieren die Verletzung internationaler anerkannter Menschenrechte auf Basis von Fakten“, sagt Theresa Bergmann, Asienreferentin bei Amnesty Deutschland. In der Volksrepublik darf die Organisation derweil nicht operieren. Stattdessen hat sie ein Büro in Hongkong. Dessen Mitarbeiter wurden in der Vergangenheit bereits mehrfach behördlich vorgeladen und für ihre Arbeit kritisiert.
Zu einem Dialog seien die Chinesen nach Ansicht von Bergmann nicht bereit. “Die chinesische Seite wird immer aggressiver, und wir stellen eine Verhärtung der Fronten fest. Peking bemüht sich gar nicht mehr darum, die Vorwürfe zu entkräften, sondern reagiert nur noch mit Gegenvorwürfen. Die Möglichkeiten, um miteinander ins Gespräch zu kommen, werden immer weniger.”
Initiator Ibrahim war auf Angriffe seitens der Chinesen vorbereitet. Er holte sehr bewusst hochrangige Akademiker und Forscher aus der ganzen Welt ins Boot, um zu verhindern, dass die chinesische Regierung das Papier als westliche Schmierschrift denunzieren kann. Neben Nordamerikanern, Australiern und Europäern beteiligten sich auch Experten aus Afrika und Asien, beispielsweise Adejoké Babington-Ashaye, Menschenrechtsanwältin aus Nigeria, Chief Charles A. Taku aus Kamerun, Anwalt am Internationalen Strafgerichtshof ICC in Den Haag, Djaouida Siaci aus Algerien, Juristin mit dem Schwerpunkt Mittlerer Osten, oder Kim Beng Phar, Gründer des Forums Strategic Pan Indo-Pacific Arena aus Malaysia, dessen Name in einer zweiten Fassung des Papiers gestrichen worden ist. Eine pakistanische Forscherin wird derweil auf eigenen Wunsch namentlich nicht erwähnt, wie Ibrahim sagt.
Weitere Namen hochrangiger Unterstützer sind David Scheffer, der unter dem früheren US-Präsidenten Bill Clinton als Ambassador-at-large for Global Criminal Justice arbeitete, dazu Allan Rock, einst kanadischer UN-Botschafter, sowie die schottische Kronanwältin (QC) Baronesse Helena Ann Kennedy, gleichzeitig Labour-Abgeordnete im britischen House of Lords, oder der frühere kanadische Justizminister Irwin Cotler.
Ibrahim verzichtete darauf, nach konkreten Gründen zu fragen, wenn sich jemand gegen die Unterzeichnung entschied, geschweige denn jemanden vom Gegenteil zu überzeugen. “Manche”, sagt er, “sind sich einfach bewusst geworden, dass die Wirkung dieser Studie deutlich größer werden könnte, als wir es antizipiert hatten. Sie waren nicht gewillt, sich dem zu erwartenden Druck auszusetzen.”
Ausgangspunkt für seine Auswahl an Mitwirkenden war Ibrahims Netzwerk, das er über seine Forschung an der Verfolgung der Rohingyas in Myanmar gestrickt hatte. Er selbst ist Muslim, in Schottland als Sohn eines pakistanischen Ehepaares geboren und aufgewachsen. Heute hält er sowohl die britische wie auch die US-Staatsbürgerschaft. Seine persönliche Motivation sei es gewesen, endlich einen Beitrag zu leisten, ganz gleich ob die Verbrechen in Xinjiang der Bezeichnung Genozid gerecht würden oder nicht. “Es wird so viel Zeit in der Welt darauf verschwendet, diese Debatte zu führen, statt endlich etwas gegen die Vorgänge in Xinjiang zu unternehmen”, sagt Ibrahim. Es sei dennoch in vielerlei Hinsicht irrelevant, ob es ein Genozid ist oder nicht, weil “es wohl wenige Stimmen außerhalb Chinas gibt, die grundsätzlich bestreiten würden, dass die Verbrechen immer noch stattfinden.” Mit der Studie hofft er, neue Impulse für schnellere Entscheidungen durch die Politik setzen zu können.
Das Newlines Institute wurde 2019 von Ahmed Alwani gegründet. Auf der Internsetseite stellt Alwani sich als Geschäftsmann vor, der im Norden des US-Bundesstaates Virginia lebt und “in Geflügel, Immobilien und den Erziehungs-/Fortbildungssektor” investiert hat. Er ist Mitglied in Gremien mehrerer Non-Profit-Organisationen. 2018 wurde er Vizepräsident des Instituts für Islamische Ideen in Virginia, das sich für bessere Bildungschancen in muslimischen Gesellschaften einsetzt. Schon 1990 machte er seinen Ingenieurs-Abschluss an der George Washington University. Das Newlines Institute sei “unparteiisch”, versicht Alwani, der gleichzeitig Präsident der Fairfax University of America (FXUA) ist. Die private Einrichtung hieß 2019 noch Virginia International University (VIU) und galt als verknüpft zur Gülen-Bewegung um den Türken Fethullah Gülen, der in den USA im Exil lebt.
Trotz Pandemie und einem angespannten politischen Klima zwischen den USA und China haben die fünf größten US-Banken im vergangenen Jahr Milliarden von Dollar nach China gepumpt. Nachdem die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ihren 50-Billionen-Dollar-Finanzmarkt, zu dem auch Vermögensverwalter und Versicherer gehören, weiter geöffnet hatte, investierten Goldman Sachs, Citigroup, JP Morgan, die Bank of America und Morgan Stanley 2020 zusammen rund 78 Milliarden US-Dollar in China – ein Anstieg von 10 Prozent gegenüber 2019. Das ist so viel wie noch nie.
Bereits im Frühjahr 2020, auf dem Höhepunkt der Coronakrise, hob Chinas Börsenaufsicht die Beschränkungen für ausländische Beteiligungen in den Bereichen Bankwesen, Wertpapiere, Termingeschäfte und Fondsverwaltung auf. Davor hatten sich ausländische Banken einzeln mit maximal 20 Prozent an einem chinesischen Institut beteiligen dürfen – die Grenze für Konsortien lag bei 25 Prozent. Beschränkungen für die Qualifikation der Anteilseigner – etwa den Umfang der Vermögenswerte und die Betriebsdauer – wurden verringert.
Goldman Sachs steigerte seinen China-Einsatz im vergangenen Jahr daraufhin um 33 Prozent auf 17,5 Milliarden US-Dollar. Auch gab das Unternehmen bekannt, seine Belegschaft in China in den nächsten fünf Jahren auf 600 Mitarbeiter verdoppeln zu wollen. Das Gesamtengagement von JP Morgan stieg im Dezember 2020 um 10,4 Prozent auf 21,2 Milliarden US-Dollar. JP Morgan hatte seinen Anteil an seinem chinesischen Wertpapier-Joint-Venture Ende letzten Jahres auf 71 Prozent erhöhen können. Damit ist JP Morgan die erste ausländische Bank der Geschichte der Volksrepublik, die ihr Joint-Venture kontrolliert.
Zudem hat die US-Bank erklärt, für 410 Millionen US-Dollar einen Anteil von 10 Prozent an der Vermögenstochter der China Merchants Bank zu übernehmen.
Das Gesamtengagement der Citigroup in China stieg ab dem vierten Quartal 2020 um 16,6 Prozent auf 21,8 Milliarden US-Dollar. Dabei macht China erst 1,3 Prozent des weltweiten Engagements von Citi aus.
Das Nettoengagement von Morgan Stanley in China ging Ende Dezember 2020 gegenüber dem Vorjahr dagegen um fast fünf Prozent auf 3,9 Milliarden US-Dollar zurück, da es weniger Kredite vergeben und weniger Kreditzusagen verzeichnen konnte. Morgan Stanley hält einen 51-prozentigen Anteil an seinem Joint Venture in China, während der Partner Huaxin Securities die restlichen 49 Prozent hält. Ebenfalls zurückgefahren wurden die Investitionen der Bank of America, deren Nettoengagement in China im Dezember 2020 um 13,9 Prozent auf 13,4 Milliarden US-Dollar zurückging. Dennoch sind die Amerikaner insgesamt präsenter als je zuvor. Die nach Blackrock zweitgrößte Vermögensverwaltungsgesellschaft der Welt, Vanguard, beschloss ihren Asien-Hauptsitz nach Shanghai zu verlegen. Ein deutliches Zeichen des Unternehmens, das insgesamt 7,2 Billionen US-Dollar von 30 Millionen Investoren verwaltet. In China arbeitet Vanguard eng mit der Alipay-App von Alibaba zusammen. Das Geschäft läuft so gut, dass sie kürzlich darauf verzichtet haben, eine eigene Fund-Management-Lizenz zu beantragen.
Auch europäische Banken spielen eine größere Rolle in China. Die HSBC Holdings PLC mit Hauptsitz in London hat erklärt, sich künftig verstärkt auf Asien zu konzentrieren und in der Region, einschließlich China, mindestens sechs Milliarden US-Dollar zu investieren. Die britische Großbank erhielt bereits grünes Licht, um die volle Kontrolle über ihre chinesische Lebensversicherungssparte zu übernehmen. Die Schweizer UBS Group AG wiederum will ihre Präsenz in China in drei bis fünf Jahren verdoppelt haben. Auch Credit Suisse kündigte jüngst an, das eigene China-Engagement massiv ausweiten zu wollen.
Der Anleihe- als auch der Aktienmarkt Chinas sind längst zu groß, um ignoriert zu werden. Die Banken sind “von Chinas starker Wirtschaftsleistung angezogen wie Motten von Flammen”, sagt Brock Silvers, Chief Investment Officer bei Kaiyuan Capital. Die ausländischen Player haben es dabei vor allem auch auf die wachsende Mittelschicht abgesehen. Nach Angaben der Beratungsfirma Oliver Wyman soll das investierbare Vermögen chinesischer Privatkunden von derzeit 24 Milliarden Dollar bis zum Jahr 2023 auf 41 Milliarden Dollar steigen.
Peking möchte durch die Öffnung wiederum die Kreditnachfrage bei den eigenen Banken reduzieren. Die günstigen Kredite insbesondere bei staatlichen Banken hatten in den vergangenen Jahrzehnten dazu beigetragen, die Wirtschaft anzukurbeln. Gleichzeitig stieg die Schuldenlast. Während der Corona-Krise wies die Regierung die Banken noch einmal an, mehr Kredite zu genehmigen, um die Wirtschaft nach dem Stillstand wieder anzukurbeln.
Dabei profitierte Peking auch von der höheren Präsenz der Ausländer. Im Oktober schrieb die South China Morning Post: “Während die Federal Reserve und andere große Zentralbanken in großem Umfang Geld drucken, um die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt zu stützen, registriert China einen ständigen Mittelzufluss in die Anleihe- und Aktienmärkte und in Investitionsprojekte.” Dies erlaubt es der Zentralbank, eine konservative Geldpolitik zu fahren und seine Leitzinsen relativ hoch zu belassen – was wiederum noch mehr Geld anzieht und dabei hilft, die negativen Folgen der ökonomischen Abkopplungsversuche der US-Regierung abzufedern. Für die ausländischen Banken lockten mit der schnellen Erholung der chinesischen Wirtschaft wiederum attraktive Renditeaussichten am Aktienmarkt.
Die Öffnung der Finanzmärkte schafft darüber hinaus die Bedingungen, um die Landeswährung Renminbi zu einer weltweit akzeptierten Handels- und Reservewährung aufzubauen. Und Peking weiß natürlich auch, dass US-Sanktionen in Zukunft umso schwieriger durchsetzbar sein werden, desto enger die beiden Finanzmärkte miteinander verzahnt sind. Mit der Öffnung seiner Märkte macht Peking die Wallstreet zum Lobbyisten chinesischer Interessen in Washington.
Die chinesischen Behörden öffnen die Märkte kontrolliert und schrittweise. Das regulatorische Umfeld bleibt dabei jedoch nach wie vor streng und auch einigermaßen unberechenbar. Auch deshalb verzichten viele ausländische Banken noch darauf, die Mehrheit ihrer Joint-Ventures in China zu übernehmen: Ihre chinesischen Partner können die Marktentwicklungen und die Reaktion der Regierung oft besser und schneller deuten – vor allem auch die politischen.
Wie stark der Staat im Ernstfall eingreift, zeigte zuletzt der kurzfristig abgesagte Börsengang von Alibabas Finanzarm Ant Financial. Mit einem Restrukturierungsplan soll das in Hangzhou ansässige Unternehmen nun in eine Finanzholdinggesellschaft umgewandelt werden. Damit wird es ähnlichen Kapitalanforderungen unterliegen wie chinesische Banken. Die Nation bleibe wachsam, um sicherzustellen, dass China seine “finanzielle Souveränität” beibehält, erklärte Staats- und Parteichef Xi Jinping. China wird die Kontrolle über die Wirtschaft des Landes nicht völlig den Marktkräften überlassen, den internationalen schon gar nicht.
Michael Kovrig wurde am Montag wegen Spionagevorwürfen in Peking vor Gericht gestellt. Der ehemalige kanadische Diplomat Kovrig ist seit über zwei Jahren in China inhaftiert und teilt dieses Schicksal mit dem ebenfalls kanadischen Michael Spavor.
Beide wurden im vergangenen Sommer wegen Spionage angeklagt. Wie auch schon bei Spavor wurde die Öffentlichkeit von Kovrigs Verhandlung mit der Begründung ausgeschlossen, dass es sich um einen sogenannten “Fall nationaler Sicherheit” handle. Spavor stand am vergangenen Freitag in der nordostchinesischen Stadt Dandong vor Gericht, seine Verhandlung endete nach zwei Stunden ohne Urteil. Auch im Fall Kovrig wurde am Montag kein Urteil gefällt.
“Er wurde willkürlich inhaftiert“, sagte Jim Nickel der stellvertretende Gesandte der kanadischen Botschaft in Peking am Montag zum Prozess von Michael Kovrig. Diplomaten aus 26 Ländern, darunter Deutschland, wie auch Journalisten versuchten vergeblich Zutritt zum Gerichtsgebäude zu bekommen. Nickel kritisierte, dass das Gerichtsverfahren gegen Kovrig nicht transparent und die Botschaft deswegen sehr beunruhigt sei. Kanada fordert die “sofortige Freilassung” seiner beiden Staatsbürger.
China hatte Kovrig und Spavor am 10. Dezember 2018 festgenommen, nachdem Meng Wanzhou, die Finanzchefin des Telekommunikationsausrüsters Huawei während einer Zwischenlandung in Vancouver auf Ersuchen der USA neun Tage zuvor festgesetzt worden war. Die USA werfen Meng, der Tochter des Huawei-Gründers Ren Zhengfei, vor, gegen Iran-Sanktionen verstoßen zu haben und fordern ihre Auslieferung. Seitdem steht Meng in Vancouver unter Hausarrest. Ihr droht bei einer Verurteilung in den USA eine lange Haftstrafe.
Lange Haft könnte auch den beiden Kanadiern in China drohen. Kanadas Premierminister Justin Trudeau spricht von “Geiseldiplomatie” und sieht die Festnahmen von Kovrig und Spavor als eine Vergeltungsaktion der Chinesen.
Guy Saint-Jacques, ehemaliger kanadischer Botschafter in China, sagte dem kanadischen Fernsehsender CTV zu den Prozessen: “Das ist alles abgekartet. Es ist ein Schwindel.” Er rechne mit einem Schuldspruch. niw
Russlands Außenminister Sergej Lawrow schlug China eine stärkere Zusammenarbeit vor, um sich gegen US-Sanktionen zu wehren. Die beiden Länder sollten in den Bereichen Wissenschaft und Technologie kooperieren, um ihre Eigenständigkeit zu stärken, so Lawrow in einem Interview mit dem chinesischen Staatsfernsehen kurz vor einem zweitägigen Austausch mit Chinas Außenminister Wang Yi. Weiter schlug Lawrow vor, die Abhängigkeit vom US-Dollar im internationalen Handel zu reduzieren und von “westlich-kontrollierten Zahlungssystemen” unabhängiger zu werden, wie die South China Morning Post berichtet.
Eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums erklärte am gestrigen Montag lediglich, China und Russland unterstützten sich “fest in Fragen, die die Kerninteressen des jeweils anderen betreffen“. Zur Agenda des Treffens zwischen Lawrow und Wang machte sie keine detaillierteren Angaben.
Russland steht seit 2014 wegen der Annexion der Krim unter Sanktionen. Laut SCMP will das US-Handelsministerium die Sanktionen gegen einige Exporte nach Russland aufgrund der Vergiftung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny weiter verschärfen. Zuvor hatte das US-Außenministerium neue Sanktionen gegen China wegen der Überarbeitung des Wahlsystems in Hongkong verkündet (China.Table berichtete). Am gestrigen Montag veröffentlichte auch die EU ihre Sanktionen wegen Menschenrechtsverletzungen an den Uiguren in Xinjiang. nib
Der japanische Industrieroboterhersteller Fanuc will 240 Millionen US-Dollar in sein Werk in Shanghai investieren. Die Investition soll durch einen Joint Venture mit Shanghai Electric Group zustande kommen. Fanucs Standort in Shanghai soll dabei von 340.000 Quadratmeter um das Fünffache anwachsen und die neuen Anlagen sollen 2023 in Betrieb gehen.
Laut dem chinesischen Forschungsunternehmen MIR ist Fanuc mit einem Anteil von zwölf Prozent am Industrierobotermarkt in China schon seit 2019 der größte Anbieter. Durch die angekündigte Investition versucht Fanuc diese Position zu verteidigen und seinen Abstand zu Wettbewerbern wie ABB (elf Prozent) und Yaskawa Electric (acht Prozent) zu vergrößern, so das Wirtschaftsportal Caixin.
Der Schweizer Technologiekonzern ABB plant noch in diesem Jahr ein Produktionswerk in Shanghai zu eröffnen und investierte dafür 150 Millionen US-Dollar. Yaskawa, ein japanischer Technologielieferant im Bereich Robotik, Antriebs- und Steuerungstechnik baut derweil an einem neuen Werk neben einem schon bestehenden in der Provinz Jiangsu, das rund 50 Millionen US-Dollar kosten wird und in dem im kommenden Geschäftsjahr die Produktion beginnen soll.
Seit 2019 hat die Volksrepublik mit mehr als 780.000 Industrierobotern weltweit die meisten Einheiten im Einsatz, zeigen Daten der International Federation of Robotics. Peking möchte bis 2025 den heimischen Marktanteil seiner Roboterhersteller von derzeit 30-40 Prozent auf 70 Prozent erhöhen. niw

Eine Frage des Diskurses: Was meint Chinas Präsident und Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas (KP Chinas) Xi Jinping, wenn er von Rechtsstaatlichkeit spricht? Wie definiert die chinesische Führung Multilateralismus? Wussten Sie, dass zu den sozialistischen Grundwerten Chinas Demokratie und Freiheit gehören? Was ist das Dokument Nr. 9 und warum lehnt es universelle Werte ab? Und was ist mit “einer Schicksalsgemeinschaft der Menschheit” gemeint?
Das im Vorfeld des Nationalen Volkskongresses erschienene Decoding China Dictionary beantwortet diese Fragen. Zusammengestellt von einer Gruppe ausgewiesenen Chinaexpert:innen, erklärt es Schlüsselbegriffe der internationalen Beziehungen und Entwicklungszusammenarbeit, die in China und Europa sehr unterschiedlich interpretiert werden. Es richtet sich an politische Entscheidungsträger:innen und Institutionen in Europa, die im Dialog und Austausch mit China stehen, sowie an alle China-Interessierte, und soll ein informierteres und fundierteres Engagement mit China ermöglichen.
Chinas Aufstieg zur globalen Macht verschiebt die globalen Gleichgewichte. Unter der Führung Xi Jinpings hat Peking die seit Deng Xiaoping geltende Maxime der zurückhaltenden Außenpolitik aufgegeben. China tritt nun aktiv auf globalen Bühnen auf und nimmt vermehrt Einfluss auf die Gestaltung internationaler Spielregeln.
Chinesische Ideen finden zunehmend Eingang in UN-Dokumente, in denen internationale Normen und Prinzipien wie Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte oder Demokratie mit neuer Bedeutung und “chinesischen Charakteristiken” versehen werden. Wenn Menschenrechtsbelange angesprochen werden, wirft China den Kritisierenden “Politisierung” und eine “imperialistische” oder “Kalte-Kriegs-Mentalität” vor. Stattdessen fordert es “Demokratie” in internationalen Beziehungen und eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit auf Basis “gemeinsamer Interessen”. Den universellen Menschenrechten stellt es eine Rechtehierarchie entgegen, an deren Spitze das “Recht auf Entwicklung” steht.
Solche konzeptionellen Rahmungen sind kein Zufall, sondern das Ergebnis koordinierter Initiativen der chinesischen Führung, ein eigenes chinesisches Diskurssystem zu entwickeln und seine diskursive Macht auszubauen. Im Ausland beklagen chinesische Diplomat:innen oft, dass der Westen China missversteht. Xi selbst betont immer wieder, dass die Geschichte Chinas “gut erzählt” und Chinas Diskursmacht gestärkt werden muss, um ein günstiges Klima der internationalen öffentlichen Meinung zu schaffen.
Die chinesische Führung unternimmt international erhebliche Anstrengungen, um ein “richtiges Verständnis” von China zu fördern, d.h. eines, das mit den Prioritäten des chinesischen Parteistaats übereinstimmt. Dieser hat Propaganda schon immer als ein wichtiges Instrument erachtet. Darin spielen “korrekte Formulierungen”, in Chinesisch tifa 提法, eine zentrale Rolle, denn indem die Partei bestimmte Formulierungen verbietet und andere vorschreibt, reguliert sie was gesagt und geschrieben wird – und damit auch, was getan wird. Außenstehenden mögen tifa wie leere Worthülsen erscheinen: Selbst in Festlandchina weiß kaum jemand, was hinter einem Begriff wie “Schicksalsgemeinschaft der Menschheit” steckt. Dennoch wirkt die Taktik, denn westliche Akteure beginnen, die Formulierungen zu übernehmen – ohne zu wissen, was dahintersteckt.
Der Gründer des Weltwirtschaftsforums Klaus Schwab dankte Xi Jinping beim diesjährigen Forum für die Ermahnung, dass “wir alle Teil einer Schicksalsgemeinschaft sind“. Xi hatte in seiner Rede davon gesprochen, dass “am Multilateralismus festzuhalten und den Aufbau einer Schicksalsgemeinschaft der Menschheit voranzutreiben” der einzige Weg zur Lösung der komplexen Probleme von heute sei. Von Multilateralismus spricht Xi generell sehr oft, und Chinas Staatsmedien bezeichnen das Land als den “Champion des Multilateralismus”.
Nur zeigt die Analyse des Parteidiskurses, dass sich Pekings Perspektive auf Multilateralismus von der westlichen unterscheidet. Während Multilateralismus eigentlich für allgemeinverbindliche Normen und Standards steht, erachtet Peking das bestehende regelbasierte multilaterale System für nicht “fair und gerecht”, sondern “den engen Interessen einer kleinen Gruppe (westlicher Staaten) dienend.” In seinem Bericht vor dem 19. Parteitag der KPCh beschrieb Xi seine Vision des Multilateralismus als “Dialog ohne Konfrontation, Partnerschaft ohne Allianzen”, also internationale Kooperation ohne allgemeinverbindliche Regeln, sondern auf Basis von bilateralen Konsultationen. Der von Xi vielfach beschworene Multilateralismus ist in Wirklichkeit ein Multi-Bilateralismus. Genau dieser verbirgt sich hinter der “Schicksalsgemeinschaft” für die Schwab Xi lobte.
Der Aufstieg Chinas zu einer Weltmacht in einer multipolaren Welt bedeutet einen zunehmenden Wettbewerb um internationale Werte und Normen. Die regelbasierte Weltordnung und der Multilateralismus beruhen auf einem globalen Konsens über die Definition der Normen, die das internationale System untermauern.
Wenn die Bedeutung von Begriffen wie Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, Demokratie und Souveränität unscharf wird, werden internationale Normen untergraben. Eine informierte Auseinandersetzung mit China setzt daher voraus, dass europäische Akteur:innen in der Lage sind, die offiziellen chinesischen Bedeutungen der Kernbegriffe und -konzepte der internationalen Beziehungen zu verstehen. Das Decoding China Dictionary soll hierfür als Referenz für Strategieentwicklung und Kommunikation mit chinesischen Partner:innen dienen.
Marina Rudyak ist Sinologin am Institut für Sinologie der Universität Heidelberg. Ihre Forschungsschwerpunkte sind die chinesische Entwicklungspolitik sowie die kodierte Kommunikation in der chinesischen Politik.

Frank Haugwitz pendelt seit über einem Jahr durch Südostasien – unfreiwillig, denn er wurde auf einer Dienstreise im November 2019 vom Corona-Virus überrascht. Aktuell ist er in Singapur, davor einige Monate in Thailand. Tatsächlich lebt und arbeitet der 55-jährige in Peking. Doch seit Beginn der Pandemie ist man in China sehr streng, was die Einreise von Ausländern angeht.
Dabei arbeitet Haugwitz mittlerweile seit 20 Jahren in China, inzwischen als Seniorberater bei Apricum, einer weltweit agierenden Beratungsagentur, die sich spezialisiert hat, Unternehmen bei Projekten im Bereich der Erneuerbaren Energien zu unterstützen. Trotz seiner aktuellen Situation wirkt Haugwitz sehr entspannt: “Ich sitze quasi im mobilen Home-Office. Das ist das Angenehme an meinem Job, dass ich in der aktuellen Situation nicht unbedingt physische Präsenz vor Ort zeigen muss. Es lässt sich so ganz gut bewerkstelligen.” Außerdem sei er nicht der einzige Expat, der gerade in der Situation ist, nicht zurück nach China zu kommen.
Es hilft sicherlich, dass Haugwitz es aufgrund seiner Arbeit sowieso gewohnt ist, viel zu reisen: “Der Markt der Erneuerbaren ist sich ja nicht nur auf China begrenzt, sondern betrifft ja die ganze Region. Deswegen war ich auch vor Corona beruflich zwischen sieben und acht Monaten im Jahr unterwegs.” Haugwitz ist gelernter Maschinenbaumechaniker. Nachdem er als Mittzwanziger Asien mit dem Rucksack bereiste (China ließ er damals übrigens aus), entschied er sich im zweiten Bildungsweg, Wirtschaftssprachen und Unternehmensführung zu studieren.
Dass der sprachliche Schwerpunkt auf Sinologie lag, war mehr Zufall als bewusste Entscheidung. Was das Wirtschaftliche anging, legte Haugwitz bereits während des Studiums den Schwerpunkt auf Umwelt und Energie, und ein erster China-Aufenthalt in der Abteilung für Umwelt und Energie der deutschen Handelskammer folgte. “Nach dem Abschluss meines Diploms 2002 bin ich dann direkt aus Deutschland ausgereist und habe in Peking chinesische Regierungseinrichtungen beim Thema Solarenergie beraten.” Später stieg er dann um auf Unternehmensberatung.
Zwischendrin beriet er als EU-Manager für Erneuerbare Energien europäische Unternehmen und Institutionen in der Zusammenarbeit mit chinesischen Partnern. Das war vor gut zehn Jahren. Seither hat er auch oft in Deutschland zum chinesischen Markt für Erneuerbare Vorträge gehalten. In Deutschland galt China lange als exotisch und besonders die brummende Solar-Branche sah keinen Bedarf das Risiko einzugehen, in China zu investieren. Ein Fehler, findet Haugwitz, der die rasante Entwicklung und auch die Chancen der Technologie in China seit Beginn miterlebte: “Zu Beginn war Photovoltaik nur ein Thema, wenn es um dezentrale Stromversorgung ging. Also besonders im ländlichen Westchina.”
Mittlerweile hätten die Chinesen, was das Technologische angeht, durchaus aufgeschlossen. Was auch daran lag, dass die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission den Industriesektor ordentlich ankurbelte, während man in Deutschland und Europa den Markt wirken ließ. Dieses Wettrennen macht die Branche für Haugwitz auch nach zwanzig Jahren immer noch attraktiv: “Die Solarindustrie ist eine spannende Geschichte. Langweilig? Nie!” David Renke