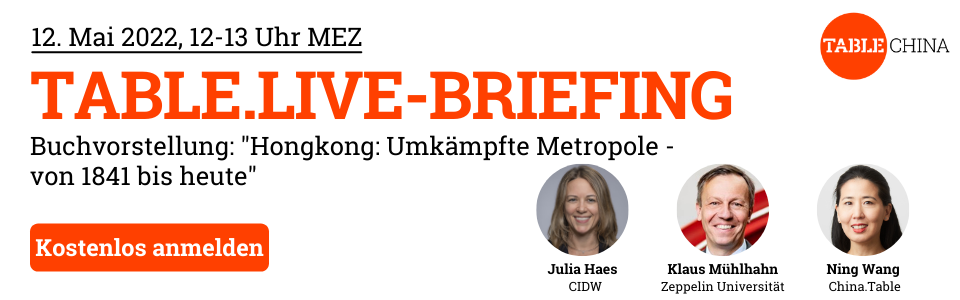die Lage in Peking ist weiter ernst und kompliziert, wie es am Montag die Stadtverwaltung umschreibt. 50 neue Fälle – vor allem im Bezirk Shunyi – bedeuten weitere Massentests für die Pekinger. Und auch in Shanghai werden die Einschränkungen wieder verschärft. Ganz anders präsentiert sich die Lage in Hongkong. Unser Autorenteam hat sich die Corona-Politik in der Sonderverwaltungszone genauer angeschaut – und das Ergebnis könnte kaum unterschiedlicher sein: Statt Lockdowns wie auf dem chinesischen Festland, will Hongkongs neuer Regierungschef John Lee zügig die Grenzen wieder öffnen. Die paradoxe Folge dieser zwei unterschiedlichen Politikansätze: Einreisen aus dem fernen Europa wären dann einfacher als aus dem nahen Festland.
Derweil hat meine Kollegin Ning Wang eine Begleiterscheinung des Shanghaier Lockdowns aufgegriffen und ist dabei auf ein massives Problem der chinesischen Führung gestoßen: die Sicherung der Lebensmittelversorgung. Während in Shanghai die Versorgung mit Essen und Trinken vor allem an den strikten Corona-Maßnahmen der Behörden scheitert, droht auch landesweit eine massive Versorgungskrise mit Lebensmitteln. Der Grund: Chinas Böden sind verseucht mit Schwermetallen, Plastik oder Phosphor. Die Gründe dafür sind vor allem vom Menschen verursacht. Ning Wang zeigt, dass Chinas Behörden das Problem durchaus erkannt haben – ihre Maßnahmen sind allerdings von atemberaubender Schlichtheit.
Viele neue Erkenntnisse bei der Lektüre wünscht


Raus aus dem Dilemma: In seiner Siegesrede am Sonntag hat Hongkongs künftiger Regierungschef John Lee deutlich gemacht, wo die Prioritäten nach seinem Amtsantritt am 1. Juli liegen sollen. Lee und seine neue Mannschaft wollen versuchen, Hongkong schnellstmöglich aus der für die Wirtschaft schädlichen Corona-Isolation zu befreien. Ein Unterfangen, an dem auch die noch amtierende Regierung unter Carrie Lam arbeitet, aber bislang noch keinen Erfolg vermelden konnte.
Seit mehr als zwei Jahren gelten die strengen Maßnahmen, die jede Reise für Hongkonger zu einer Tortur machen. Trips ins Ausland ziehen nach der Rückkehr eine lange Hotel-Isolation in Hongkong nach sich. Nicht einmal Reisen ins benachbarte Shenzhen auf dem chinesischen Festland sind ohne Quarantäne möglich. Zahlreiche Hongkonger waren phasenweise sogar aus ihrer Heimat regelrecht ausgesperrt. Immer wieder wurden kurzfristig Flug- und Einreiseverbote verhängt, die es unmöglich machten, aus vom Coronavirus besonders hart getroffenen Ländern zurückzukommen. Für Touristen und Geschäftsreisende ohne Hongkonger Staatsbürgerschaft war die Stadt bis vor wenigen Tagen sogar komplett dicht.
Die Situation verlangt nicht nur den Menschen vieles ab, auch die wirtschaftliche Produktivität leidet massiv. Unternehmen und ausländische Handelskammern üben Druck auf die Regierung aus, indem sie immer wieder fordern, die Regeln endlich zu lockern.
Und tatsächlich: Anders als auf dem chinesischen Festland, wo die Regierung konsequent an ihrer umstrittenen Null-Covid-Politik festhält, versucht Hongkong, mit größerer Flexibilität eine Rückkehr in die Normalität erreichen. Sie ließ Omikron mehr oder minder durch die Stadt rauschen, ohne panikartig aufgrund der Infektionszahlen die Bevölkerung komplett und monatelang einzusperren. Die Entwicklung scheint die Wahl der Mittel zu rechtfertigen: Die Fallzahlen in Hongkong gingen von mehr als 70.000 Infektionen pro Tag auf zuletzt weniger als 300 zurück.
Als Sonderverwaltungszone genießt Hongkong deutlich mehr Selbstbestimmungsrechte als etwa Shanghai. Auch dort versuchte die Lokalregierung, einen harten Lockdown zu verhindern. Doch Peking sprach ein Machtwort, was zur Folge hatte, dass die Shanghaier Behörden nun Millionen Menschen seit mehr als einem Monat in ihren Wohnungen und Wohnblöcken isoliert. Während Staatsmedien vergangene Woche bereits “Licht am Ende des Tunnels” wähnten, zerstörte eine neue Direktive der Verwaltung am Wochenende die aufkeimende Hoffnung. (China.Table berichtete)
Als im Februar in Hongkong die Corona-Fälle in die Höhe schnellten, sah es zunächst ähnlich düster aus. In Windeseile wurden Container-Lager errichtet, in denen Kontaktpersonen und Infizierte untergebracht werden sollten. Auch gab es Pläne für mehrere Runden von Zwangs-Massentests. Sich im Falle einer Infektion vor einer Einweisung ins Corona-Lager zu schützen, wäre nicht möglich gewesen. Doch dazu kam es nicht mehr. Die Regierung machte keine Anstalten, zu einer Null-Corona-Politik zurückzukehren. Stattdessen erfolgte eine 180-Grad-Wende: Inzwischen sind Restaurants, Kinos, Fitnessstudios und Schwimmbäder wieder weitestgehend normal geöffnet.
Ganz anders entwickelt sich die Lage in Peking. “Die Corona-Situation ist kompliziert und ernst”, sagte ein Sprecher der Stadtverwaltung am Montag. Zu Wochenbeginn wurden wieder 50 neue Fälle diagnostiziert, ein Großteil davon im nördlichen Bezirk Shunyi. Es sei nicht gelungen, Kontaktketten zu brechen, hieß es. Die Kontrollen müssten erhöht werden. Für Dienstag ist der Beginn einer neuen Runde Massentests in insgesamt 17 Bezirken angekündigt.
Kinos oder Fitnessclubs bleiben geschlossen, auch zentrale Parkanlagen sind bis auf Weiteres gesperrt. Betreuung und Unterricht in Kindergärten, Grund- und Mittelschulen finden seit Mitte vergangener Woche nur noch online statt. In Chaoyang und Shunyi ist der öffentliche Nahverkehr ausgesetzt. Ab Donnerstag müssen Bürger:innen ein aktuelles, negatives PCR-Testresultat vorlegen, um öffentliche Einrichtungen betreten zu dürfen.
Erleichterungen dagegen in Hongkong: Zum ersten Mal seit zwei Jahren dürfen wieder Besucher aus dem Ausland in die Stadt reisen. Die Dauer der Hotel-Quarantäne wurde von 14 Tagen auf nur noch sieben Tage verkürzt. Erste Forderungen werden bereits laut, dass diese Quarantäne auch in der eigenen Wohnung verbracht werden kann. Auch die Flugverbote, die für Airlines bisher verhängt wurden, wenn in einem Flieger zu viele positiv Getestete saßen, sollen wesentlich dosierter verhängt werden.
Der gewählte Regierungsschef John Lee spricht zwar noch nicht offen davon, dass Hongkong künftig mit dem Virus leben solle. Klar scheint jedoch, dass die bisherige Corona-Politik Geschichte ist. Hieß es bisher stets, dass die Öffnung zum chinesischen Festland zuerst erfolgen müsse, spricht Lee nun nur noch allgemein von einer “Öffnung der Grenzen” – gemeint ist also, Hongkong gegebenenfalls zunächst aus seiner internationalen Abschottung zu befreien und das Festland warten zu lassen.
Nach seinem Wahlerfolg sagte John Lee jedenfalls: “Ich bin mir der Notwendigkeit sehr bewusst, Hongkong für die Welt zugänglich zu machen. Und es ist auch wichtig, dass Hongkong normale Reisen mit dem Festland wieder aufnehmen kann.” Und zwar in dieser Reihenfolge. Jörn Petring/ Gregor Koppenburg

Es war nur eine Randnotiz in den unzähligen Nachrichten über die chaotische Lebensmittelversorgung der Menschen in Shanghai. In mehreren Stadtteilen klagten Bewohner über Bauchschmerzen und Durchfall, nachdem sie Lebensmittel verzehrt hatten, die ihnen von den Behörden zugeteilt worden waren. Schnell kamen bei den Großstädtern in China Erinnerungen an verunreinigte Lebensmittel wie Milch, Öl und Gemüse auf. In den sozialen Medien ist immer wieder von der Gier der Lebensmittel-Unternehmen zu lesen, die das Leben der Menschen aufs Spiel setzten, damit die Bilanzen stimmen. Die Zensur lässt das so stehen, weil es auch Peking nutzt und von tieferen Problemen ablenkt.
Laut einer von der Chinese Academy of Engineering im Jahr 2020 durchgeführten Studie sollen schätzungsweise zwölf Millionen Tonnen des jährlich angebauten Gemüses durch Schwermetalle im Boden belastet sein. Hauptfaktoren sind dabei Rückstände aus industriellen Abwässern und Tierfutter.
Oft wird außer Acht gelassen, dass die Hauptvoraussetzung für sichere Lebensmittel gesunde Böden sind. Damit die landwirtschaftliche Produktion “saubere” Lebensmittel wie Gemüse, Mais oder Reis zur weiteren Verarbeitung ernten kann, benötigt sie schlicht Agrarflächen, deren Böden nicht kontaminiert sind. Und hierzu gibt es klare Vorgaben der Behörden.
“Für China ist die effiziente Nutzung natürlicher Ressourcen ein dringendes Anliegen, da seine landwirtschaftliche Nutzfläche vergleichsweise klein ist, um die größte Bevölkerung der Welt zu ernähren”, schreibt Lea Siebert in einer aktuellen Analyse zur Bodenkontaminierung in China vom Deutsch-Chinesischen Agrarzentrum (DCZ), die vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) unterstützt wurde.
Etwa 135 Millionen Hektar (Wald- und Grasflächen nicht einberechnet) der rund 645 Millionen Hektar Land werden in der Volksrepublik landwirtschaftlich genutzt. Das sind 0,09 Hektar pro Einwohner. Im Vergleich dazu sind es 0,14 in Deutschland und sogar 0,22 in der Europäischen Union. Laut einem Bericht der Weltbank seien von Chinas Nutzflächen inzwischen rund 20 Prozent belastet. In den Achtziger Jahren betrug der Anteil verseuchter Böden gerade mal fünf Prozent.
Entsprechend dringender entwickelt sich das Problem der Lebensmittelknappheit im eigenen Land. Um die Lücken zu stopfen, muss die Volksrepublik zunehmend große Mengen aus anderen Teilen der Welt importieren. Das schafft Abhängigkeit, die Peking eigentlich verhindern will (China.Table berichtete), weil die Regierung eine geostrategische Gefahr in dieser Konstellation erkennt.
Doch es fehlt an der notwendigen Transparenz, um überhaupt den Zustand der Böden in China richtig einschätzen zu können. Zwar gab es in der Vergangenheit eine Reihe von entsprechenden Studien, allerdings waren diese häufig auf bestimmte Regionen oder Schadstoffe reduzierte Meta-Analysen.
Der bisher umfassendste Ansatz ist die Nationale Erhebung zur Bodenbelastung, die zwischen 2005 und 2013 durchgeführt wurde. Der veröffentlichte Bericht enthält jedoch nur Statistiken über die prozentualen Verschmutzungsgrade. Detaillierte oder standortspezifische Daten sind hingegen nicht öffentlich gemacht worden, kritisiert das Deutsch-Chinesische Agrarzentrum (DCZ).
Mehrere aktuelle Studien zeigen, dass die bisherigen Schritte zur Bekämpfung der Bodenverseuchung kaum vorzeigbare Verbesserungen oder gar Lösungen hervorgebracht haben. Bereits 2013 kündigte der damalige Minister für Land und Ressourcen, Wang Shiyuan, einen langfristigen Plan zur Sanierung der Flächen an und sicherte zudem Ausgaben in Milliardenhöhe zu. Doch getan hat sich wenig, und wohin die Gelder geflossen sind, bleibt für Außenstehende unklar.
Auch rund zehn Jahre später scheint die Dringlichkeit des Themas noch immer nicht bei den Beteiligten angekommen zu sein. So riskieren zwei Drittel der befragten Unternehmen laut einer aktuellen Studie des Finanznachrichtendienstleisters Caixin, dass die von ihnen bewirtschafteten Böden durch chemische oder giftige Substanzen kontaminiert werden. Wissenschaftler eines englisch-chinesischen Projekts haben zudem herausgefunden, dass viele Bauern zur Maximierung ihrer Ernte viel zu viel Dünger und Pestizide einsetzen. Diese gelangen dann meist direkt ins Grundwasser, weil die große Menge von den Pflanzen schlicht nicht mehr aufgenommen werden kann.
Da 66 Millionen Hektar Ackerland in China – fast 50 Prozent der Gesamtfläche – bewässert werden, trägt auch die schlechte Wasserqualität entscheidend zur Bodenbelastung bei. Zudem lassen chemische und organische Schadstoffe die Böden versauern, wodurch der ph-Wert in den Böden sinkt. In einem derartigen ph-Milieu nehmen Pflanzen jedoch verstärkt Schadstoffe auf, was wiederum dazu führt, dass die Ernten mit Schwermetallen belastet sind – die dann in der weiteren Nahrungskette den Konsumenten schädigen.
Dabei sind sich Chinas Wissenschaftler dessen durchaus bewusst – und äußern ihre Sorgen: “Erhöhte Stickstoff-, Phosphor- und Treibhausgasemissionen überschreiten Sicherheitsgrenzen. Gegenwärtig ist China das Land mit den größten eingesetzten Mengen an chemischen Düngemitteln und Pestiziden weltweit“, sagt Kong Xiangbin, Professor am Institut für Bodenwissenschaften und -technologie an der China Agricultural University. Der Einsatz von Stickstoffdünger in China mache 33 Prozent der globalen Gesamtmenge aus, beim Phosphatdünger seien es 36 Prozent. “Im Jahr 2018 betrug der Verbrauch von Stickstoff und Phosphor 8,214 Millionen Tonnen beziehungsweise 2,138 Millionen Tonnen und übertraf damit die Sicherheitsgrenzen bei weitem”, heißt es in Kongs Studie.
Dabei ist die Kontaminierung von Böden im Agrarbereich keineswegs nur ein chinesisches Problem, wie die DCZ-Studie zeigt. Zum Vergleich: In Europa sind Schwermetalle für etwa 35 Prozent der Bodenverschmutzungen verantwortlich, gefolgt von Mineralölen mit 24 Prozent.
Böden im Agrarbereich sind zwar auch durch natürliche Erosionen belastet. Die meisten direkten Verschmutzungen werden allerdings durch menschliche Eingriffe in der Landwirtschaft verursacht. Übermäßiger Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden spielt dabei eine große Rolle, aber auch die Rückstände von Kunststofffolien, die davor schützen sollen, dass Wind und Wetter oder Tiere die Saat beschädigen.
1994 nutzten Chinas Bauern rund 426.300 Tonnen dieser Folien. 2020 waren es schon 2,389 Millionen Tonnen. Das Problem: Die Folien werden oft an den Feldrändern entsorgt, sodass Plastikreste in den Böden gefunden werden, was dann wieder die Bodenfeuchtigkeit und somit auch das Wachstum der dort gepflanzten Saat negativ verändert.
Hinzu kommen indirekte Verschmutzungen, beispielsweise resultierend aus Überschwemmungen oder hervorgerufen durch sogenannte atmosphärische Ablagerung, die der Kohleverbrauch in der Volksrepublik fördert: 2018 betrug der Kohleverbrauch insgesamt 3,97 Milliarden Tonnen. Diese Menge enthält ca. 51.600 Tonnen Blei, 38.300 Tonnen Arsen, 1.100 Tonnen Cadmium und 750 Tonnen Quecksilber. Diese gewaltigen Mengen lagern sich in der Atmosphäre ab und gelangen durch die Schwerkraft oder – schneller – durch Regenfälle auf und in die Böden.
Das Umweltministerium hat vergangenes Jahr ein umfassendes Handbuch herausgegeben, um die Bodenkontaminierung einzudämmen. Die drei Schwerpunkte der Empfehlungen an die Unternehmen lauten “kein Leck, keine Vermehrung und Früherkennung“. Doch die Vorschläge kommen nicht nur reichlich spät. In ihrer Schlichtheit zeigen sie auch, wie weit die Behörden von der Praxis entfernt sind. Mitarbeit: Renxiu Zhao.
Chinas Exportwachstum ist wie erwartet zurückgegangen. Im April betrug der Anstieg nur noch 3,9 Prozent, wie die Zollverwaltung in Peking am Montag mitteilte. Es handelte sich um den niedrigsten Wert seit dem ersten Corona-Jahr 2020. Im März lag das Plus noch bei 14,7 Prozent. Nach den Lockdowns in Shanghai und anderen wirtschaftsstarken Regionen hatten Ökonomen jedoch fest mit schwächeren Zahlen gerechnet (China.Table berichtete). Auch erhebliche Auswirkungen auf den Handel waren zu erwarten.
In den Zoll-Daten verbergen sich andererseits überraschend gute Nachrichten. China Einfuhren blieben trotz der zahlreichen Krisen ungefähr gleich. Die Lockdowns und die anderen Unsicherheiten haben noch nicht zu einem Absturz der Gesamtkonjunktur geführt. Für Mai erwarten Ökonomen allerdings eine erhebliche Eintrübung, weil sich die negativen Effekte mit der Zeit gegenseitig verstärken. Wenn Omikron sich also weiter verbreitet und zudem Shanghai noch lange im Griff hält, kann sich die Lage rasch verschlechtern. Das merken dann auch die Handelspartner deutlich. Die Importe aus Deutschland gaben um zehn Prozent nach.
Besondere Aufmerksamkeit galt am Montag auch Chinas Handel mit Russland. Dort zeigte sich im April ein gemischtes Bild. Ins Auge sticht zunächst ein Rückgang der chinesischen Exporte nach Russland. Im Vorjahresvergleich fiel die Nachfrage aus dem sanktionierten Nachbarland um 26 Prozent. Mit Beginn der Strafen ist der starke Exporttrend von China nach Russland zusammengebrochen. Diese Entwicklung spiegelt die generelle Wirtschafts- und Zahlungsschwäche im Land Wladimir Putins wider.
Zugleich aber hat Russland in China durchaus einen aufnahmebereiten Markt für die eigenen Waren gefunden: Chinas Import stieg um 57 Prozent. Es handelt sich vor allem um Rohstoffe. Mangels zusätzlicher Pipelines stieg die Einfuhr von russischem Öl jedoch nur um vier Prozent. Es muss per Schiff angeliefert werden. Da zugleich die Nachfrage nach Kraftstoff in China um ein Fünftel gesunken ist, stiegen auf der anderen Seite Chinas Energie-Exporte in andere Weltgegenden. Das bedeutet: China leitet indirekt russisches Öl auf den Weltmarkt weiter. fin

Chinas Aufsichtsbehörden haben Minderjährigen das Live-Streaming (直播, zhíbò) im Internet verboten. Damit wolle man “ihre körperliche und geistige Gesundheit” schützen, heißt es in der entsprechenden Erklärung.
Dabei wird die Gruppe der Minderjährigen aufgeteilt: Personen unter 16 Jahren wird jegliches Live-Streaming verboten, während Benutzer zwischen 16 und 18 Jahren die Erlaubnis ihrer Eltern oder Erziehungsberechtigten einholen müssen, bevor sie live gehen können. Weiter heißt es in der Erklärung: “Internetplattformen sollten die Pflicht zur Registrierung des echten Namens strikt umsetzen und das Angebot von Geldspende-Funktionen für Minderjährige wie Bargeldaufladung, Geschenkkauf und Online-Zahlung verbieten.”
Die neuen Bestimmungen wurden am Samstag von vier Aufsichtsbehörden herausgegeben – darunter die National Radio and Television Administration und die Cyberspace Administration of China (CAC).
Wie die Hongkonger “South China Morning Post” berichtet, wollen die Aufsichtsbehörden darüber hinaus, dass Chinas Technologie-Unternehmen ihren “Jugendmodus” verbessern. Es handelt sich hierbei um eine Funktion, die im vergangenen Jahr eingeführt wurde, um Teenager vor Spielsucht und “unangemessenen” Inhalten zu schützen. Seit 2018 gibt es beispielsweise auch eine Schwarze Liste für Influencer, die vermeintlich schlechten Einfluss auf die Gesellschaft und vor allem auf Chinas Jugend ausüben.
Nun werden die Plattformen aufgefordert, spezielle Zensurteams für Jugendinhalte einzusetzen. Zudem müssen die Benutzeraktivitäten im Jugendmodus nach 22 Uhr eingestellt werden, um “sicherzustellen, dass sie genug Zeit zum Ausruhen haben”. Es sind die jüngsten Maßnahmen der Regierung, mit der Peking Minderjährige im Cyberspace besser schützen will.
Sollten die neuen Regeln von den Technologie-Unternehmen nicht umgesetzt werden, drohen die Behörden mit drastischen Maßnahmen, angefangen vom Aussetzen der Geldspende-Funktion bis hin zur kompletten Schließung des Live-Streaming-Geschäfts einzelner Unternehmen. rad
Die G7-Außenminister haben die Ernennung von John Lee zum neuen Regierungschef in Hongkong kritisiert. “Wir sind zutiefst besorgt über diese stetige Aushöhlung der politischen und bürgerlichen Rechte und der Autonomie Hongkongs“, teilten die Außenministerien der G7-Industriestaaten am Montag mit. “Wir fordern den neuen Chef der Exekutive nachdrücklich auf, die im Grundgesetz verankerten geschützten Rechte und Freiheiten in Hongkong zu achten und dafür zu sorgen, dass das Gerichtssystem die Rechtsstaatlichkeit aufrechterhält.” Zu den G7 gehören neben Deutschland auch Frankreich, Italien, Kanada, Japan, die USA und Großbritannien.
Lee hatte am Sonntag 1.416 Stimmen des Peking-nahen Wahlausschusses erhalten und folgt damit ab 1. Juli Carrie Lam als Regierungschef in Hongkong (China.Table berichtete). Es gab keinen Gegenkandidaten gegen den 64-Jährigen. Das derzeitige Nominierungsverfahren und die Ernennung stünden “in krassem Gegensatz zum Ziel des allgemeinen Wahlrechts”, teilten die G7 mit. Dadurch würde den Hongkongern die Möglichkeit genommen, sich legitim vertreten zu lassen. Der Vorgang sei ein Teil eines “fortgesetzten Angriffs auf den politischen Pluralismus und die Grundfreiheiten” in Hongkong.
Mit Glückwünschen überhäufte derweil ein Teil der Wirtschaft den künftigen Regierungschef. In örtlichen Zeitungen hatten zahlreiche ortsansässige Firmen am Montag Anzeigen geschaltet – unter anderem die Wirtschaftsprüfer KPMG, Deloitte, EY und PwC. Die Montagsausgabe der Tageszeitung Ta Kung Pao war insgesamt 100 Seiten stark. 85 davon waren Glückwunsch-Anzeigen.
Auch die Mischkonzerne Swire und Jardine Matheson zählten zu den Gratulanten. Beide Firmen hatten ebenso wie die Banken HSBC und Standard Chartered die Einführung des Nationalen Sicherheitsgesetzes für Hongkong befürwortet. Das Gesetz gilt als Basis für die zunehmende Erosion der Rechtsstaatlichkeit Hongkongs. ari /grz
Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping haben sich am Montag über den russischen Angriff auf die Ukraine und seine Auswirkungen unter anderem auf die globale Nahrungsmittelversorgung und Energiesicherheit ausgetauscht. Außerdem sei es in der Videokonferenz um “die Entwicklung und die Konsequenzen der Covid-19-Pandemie, eine vertiefte Kooperation beim Klimaschutz, die Energietransformation sowie die EU-China-Beziehungen” gegangen. Zudem sei über eine weitere Vertiefung der bilateralen Beziehungen und über die Zusammenarbeit im Wirtschaftsbereich gesprochen worden, so die Bundesregierung in einer sehr kurzen Mitteilung.
Wesentlich ausführlicher ging die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua auf das Gespräch ein. Der chinesischen Version zufolge versicherten sich die beiden Spitzenpolitiker, wie wichtig die deutsch-chinesischen Beziehungen seien. Xi betonte demzufolge die Wichtigkeit von Stabilität in unsicheren Zeiten. Deutschland sei ein Land mit erheblichem Einfluss. China und Deutschland unterhielten Beziehungen von hoher Qualität. Das sei das Ergebnis von “gegenseitigen Verpflichtungen zur Win-Win-Kooperation”. China halte an seinem Wunsch nach engerer Zusammenarbeit fest.
Xi sagte zu Scholz, dass beide Seiten für Multilateralismus, die Rolle der Vereinten Nationen und die Aufrechterhaltung von Normen in internationalen Beziehungen stehen. Er ermahnte Europa, sich seiner historischen Verantwortung für Stabilität bewusst zu sein und selbst für seine Sicherheit zu sorgen. Der Austausch zum Thema Ukraine mit Scholz sei “freimütig” gewesen. China stehe “auf der Seite des Friedens” und arbeite “auf seine Weise” auf Entspannung hin.
Eine wichtige Botschaft ergibt sich bereits aus Länge und Wortwahl der beiden konkurrierenden Mitteilungen. Das Kanzleramt zeigte sich schmallippig und wollte Hinweise auf einen freundlichen Umgang vermeiden – schließlich hängen dicke Differenzen bezüglich der Haltung zur Invasion zwischen EU und China. Die lange Agenturmeldung von chinesische Seite erweckte dagegen den Eindruck eines langen, freundlichen Austauschs im diplomatischen Normalbetrieb.
Xis Mahnung an Europa, für Stabilität zu sorgen und selbst für die eigene Sicherheit zu sorgen, enthielt weitere Botschaften. “Verantwortung” und “Stabilität” sind als Aufforderung zu verstehen, die Ukraine nicht mit Waffen zu versorgen und Russland gewähren zu lassen. Mit dem Aufruf zu europäischer Eigenständigkeit wiederum meint Xi Jinping eine Abkehr von den USA und eine Lockerung demokratischer Bündnisstrukturen. Ein solcher Kurs würde potenziell Chinas Einfluss erhöhen.
Am Sonntag erst hatte SPD-Chef Lars Klingbeil in einem Interview mit dem Fernsehsender Phoenix zu einem anderen Auftreten im Umgang mit der Volksrepublik aufgerufen. Politik und Wirtschaft hätten im Falle Russland stets auf einen politischen Konsens mit Moskau gedrungen. Das sei ein Fehler gewesen, gestand Klingbeil ein und zog daraus den Schluss, dass man China gegenüber “heute anders auftreten und kritischer sein” müsse. China hat die russische Invasion der Ukraine nicht verurteilt, sondern schiebt die Schuld für den Krieg auf die USA und die Nato. grz/fin
Taiwan ist zum zweiten globalen Covid-19-Gipfel eingeladen worden. Das sagte Taiwans Außenminister Joseph Wu am Montag. Bei dem Treffen handelt es sich eine virtuelle Veranstaltung, die in dieser Woche von US-Präsident Joe Biden mitveranstaltet werden soll.
Wu sagte allerdings nicht, wer für Taiwan teilnehmen wird. Sollte es Präsidentin Tsai Ing-wen sein, würde das sicherlich scharfe Proteste aus Peking hervorrufen. Denn China beansprucht die Souveränität über die selbstverwaltete Insel. “Wir werden dieses Jahr an der Veranstaltung teilnehmen und haben auch den Teilnehmer für den Gipfel festgelegt”, sagte Wu am Montag bei einer Anhörung zur Legislative. Um wen es sich handelt, wolle man allerdings erst nach der Veranstaltung bekannt geben. So habe man es im vergangenen Jahr gehandhabt und so sei es auch dieses Mal von den Organisatoren gefordert worden. Im vergangenen Jahr hatte Taiwans ehemaliger Vizepräsident Chen Chien-jen auf dem virtuellen Weltgipfel teilgenommen.
Peking war auf dem ersten Corona-Gipfel nicht vertreten, gegen Taiwans Teilnahme hatte Peking allerdings lautstark protestiert. Ob China in diesem Jahr an der Veranstaltung teilnehmen wird, ist nicht bekannt.
Dem Weißen Haus zufolge wird der zweite globale Covid-19-Gipfel voraussichtlich am Donnerstag stattfinden. Die Teilnehmer sollen ihre Bemühungen zur Beendigung der Pandemie erörtern und sich auf künftige Gesundheitsbedrohungen vorbereiten. “Das Auftauchen und die Verbreitung neuer Varianten wie Omikron haben die Notwendigkeit einer Strategie zur weltweiten Kontrolle von Covid-19 klargemacht”, hieß es aus dem Weißen Haus. rad

Ist Niao Wu am Ziel? Was für eine Frage. Natürlich nicht. Niemals. Zwar hat die 35-jährige Architektin schon für BMW in Shanghai das Innovationszentrum errichtet, bei der Boston Consulting Group einen Turbo eingelegt und 2021 in München ihr Start-up Onyo gegründet. Mit dem vermittelt sie nachhaltig produzierte Arbeitsmöbel für daheim – auf Leasingbasis. “Homeoffice-as-a-Service” wirbt sie. Aber für Wu ist stets der Weg das Ziel. “Besser werden, stärker werden”, sagt sie. “Und der Gesellschaft etwas zurückgeben.” So beschreibt die quirlige Frau ihren inneren Motor, der sie aus Haining in der ostchinesischen Provinz Zhejiang und später in deren Hauptstadt Hangzhou zu ihrem heutigen Wohnort München führte.
“Ich stamme aus einer Familie, die in der Kulturrevolution viel gelitten hat”, sagt Wu. Ein Großvater verlor im Straflager sein Leben, der andere war Journalist und Sekretär in der taiwanesischen Regierung. Das bekam Wus Vater zu spüren. “Er durfte seiner Leidenschaft, der traditionellen Malerei, beruflich nicht nachgehen und wurde Lehrer.” Im Privaten tuschte, formte und kalligraphierte er, die Mutter – eine Buchhalterin – hielt das Geld zusammen. “Sie war die rationale Figur in meinem Leben.” Doch ihre Kindheit bestand fast nur aus Kunst. “Ich habe die ersten Jahre meines Lebens praktisch nur gemalt, mehr nicht.”
Zugleich prägte ihr Vater das junge Mädchen mit seiner Konsequenz. “Im Leben wird einem nichts geschenkt, man muss es sich erarbeiten” – diese Lektion kam an. Als alle noch schliefen, musste Niao Wu um fünf Uhr aufstehen, wurde im Dunkeln zum Kung-Fu-Meister geschickt. “Ich habe es gehasst”, sagt sie. Erst heute treibt sie wieder Kampfsport, Taekwondo, ganz freiwillig.
Architektur als Studienfach sei eine logische Wahl gewesen. “Ich war gut in Mathe und Physik und liebte die Kunst.” Ihr Schulabschluss sei der zehnt- oder elftbeste der Stadt gewesen. Deshalb durfte sie sich an der Zhejiang Universität in Hangzhou einschreiben – bis heute ist die Tech-Metropole am Westsee ihre chinesische Lieblingsstadt. Als sich nach zweieinhalb Jahren über eine neue Uni-Partnerschaft zur TU München ein Studentenaustausch ergab, ergatterte Wu einen der fünf Plätze. Deutsch hatte sie da schon im Abendkurs gelernt.
“Ich genoss das Strukturierte an der deutschen Universität, alles hatte Hand und Fuß”, schwärmt sie. Schnell stand fest: Sie bleibt. Ihr Studium startete sie von Grund auf neu. “Meine Professoren in Hangzhou haben meinen Entschluss verstanden.” Ihr Diplom legte sie 2014 mit den Schwerpunkten Bautechnik und Baukonstruktion ab. “Wenn man schon in Deutschland Architektur studiert, dann Hardcore.” Sie meint damit die Entscheidung, sich tiefgehend mit den Fundamenten der Architektur befassen zu wollen. Die trainierte Präzision komme ihr beim Gründen zugute, sagt Wu. “Das Logische, der Umgang mit Zahlen, die Struktur: In einer jungen Firma geht es auch darum, ein Baugerüst aufzustellen.”
Ihre erste Berufsstation in München begann mit einer Absage. Beworben hatte sie sich für das globale Traineeprogramm bei BMW, kam unter die letzten vier Kandidaten, doch wurde enttäuscht: “Ich passe nicht zu der Kultur”, zitiert sie die Begründung. Ein Jurymitglied aber, BMW-Hauptabteilungsleiter, erkannte ihr Potenzial und stellte sie bei sich im Team an. Dass sie sowohl die chinesische als auch die deutsche Kultur kennt, wird zum Trumpf, als ihr die bauliche Errichtung des Shanghai Zentrums für Forschung und Entwicklung des deutschen Autobauers anvertraut wurde. “Es war mein Baby, von der ersten Nutzeranforderung, über Grundstücksauswahl bis zur Koordination der Gewerke.” Später übernahm sie auch in Peking das Projektmanagement beim Bau des dortigen Forschungszentrums.
Trotz der anspruchsvollen Aufgaben verspürte sie nach gut drei Jahren einen alarmierenden Stillstand. “Die Welt da draußen bewegt sich so schnell, im Konzern herrscht Windstille. Man geht dreimal am Tag Kaffee trinken, es ist so bequem.” Sie nutzte ein BMW-Acceleratorprogramm und entwarf im Team kühne Batteriepläne. “Auch dort: Auf dem Papier alles schön, doch an echter Umsetzung hat niemand Interesse.” Der Entschluss wuchs: Sie wollte Unternehmerin werden. BWL-Kurse nahm sie an Wochenenden, landete kurz bei der Unternehmensberatung BCG. Nach diesem neunmonatigen “Crashkurs”, wie sie sagt, flog ihr die Geschäftsidee zu.
Onyo entstand in der Corona-Phase, als die BCG-Beraterin ins Homeoffice geschickt wurde. “Ich konnte mir daheim meinen Arbeitsplatz gut einrichten, aber in meinem Umfeld taten sich viele schwer damit.” Es fehlten Kompetenz und Muße. Küchentisch und Funzelbeleuchtung wurden zum gesundheitsgefährdenden Standard. “Ich finde eindeutig, dass die Arbeitgeber in der Pflicht stehen, beim jetzt aufkommenden hybriden Arbeiten ihre Leute mit ergonomischem Mobiliar zu unterstützen – und nicht buchstäblich auf ihrem Rücken zu sparen”, sagt Wu. Gemeinsam mit Jens Wöhrle, einem Ex-Banker und Softwareprofi, setzt sie ihre Vision um. “Wir statten Mitarbeiter:innen mit hochwertigen und nachhaltigen Produkten individuell aus, ohne dass sich der Arbeitgeber um Beschaffung, Logistik oder Versicherung kümmern muss.”
Ihr Leben als “chinesische Immigrantin der ersten Generation”, wie sie es empfindet, sei “nicht immer unkompliziert”. Es scheint, als nehme sie stets einen Schritt Abstand, um sich selbst zu betrachten. Als eine Wandlerin zwischen den Kulturen, motivierte Kosmopolitin und Angehörige einer Generation, die verstanden hat, dass es genau auf sie ankommt. Ihre Mutter konnte sie seit drei Jahren nicht besuchen, das sei hart. Ob sie China ansonsten vermisse? “Nicht brennend”, sagt sie. “Hier in München und auch digital gibt es so viele tolle Ausstellungen zur chinesischen Kultur – das gibt mir viel.” Stefan Merx
Rayman Zhang ist bei Investment-Unternehmen CBRE zum Leiter für Advisory & Transaction für das chinesische Festland befördert worden. Zhang war 2012 in das Unternehmen eingetreten. Davor hatte er unter anderem beim US-amerikanischen Gewerbeimmobilien-Beratungsunternehmen Cushman & Wakefield gearbeitet.

Von Corona-Impfungen für Katzen ist bislang nichts bekannt, also muss Schutzkleidung her. Auf Taobao findet man die bekannten Corona-Schutzanzüge der “Weißen Riesen” nun auch für das kleine Haustier. Für 67 Yuan ein Schnäppchen. Allerdings wird für die Wirksamkeit wohl keine Garantie übernommen.
die Lage in Peking ist weiter ernst und kompliziert, wie es am Montag die Stadtverwaltung umschreibt. 50 neue Fälle – vor allem im Bezirk Shunyi – bedeuten weitere Massentests für die Pekinger. Und auch in Shanghai werden die Einschränkungen wieder verschärft. Ganz anders präsentiert sich die Lage in Hongkong. Unser Autorenteam hat sich die Corona-Politik in der Sonderverwaltungszone genauer angeschaut – und das Ergebnis könnte kaum unterschiedlicher sein: Statt Lockdowns wie auf dem chinesischen Festland, will Hongkongs neuer Regierungschef John Lee zügig die Grenzen wieder öffnen. Die paradoxe Folge dieser zwei unterschiedlichen Politikansätze: Einreisen aus dem fernen Europa wären dann einfacher als aus dem nahen Festland.
Derweil hat meine Kollegin Ning Wang eine Begleiterscheinung des Shanghaier Lockdowns aufgegriffen und ist dabei auf ein massives Problem der chinesischen Führung gestoßen: die Sicherung der Lebensmittelversorgung. Während in Shanghai die Versorgung mit Essen und Trinken vor allem an den strikten Corona-Maßnahmen der Behörden scheitert, droht auch landesweit eine massive Versorgungskrise mit Lebensmitteln. Der Grund: Chinas Böden sind verseucht mit Schwermetallen, Plastik oder Phosphor. Die Gründe dafür sind vor allem vom Menschen verursacht. Ning Wang zeigt, dass Chinas Behörden das Problem durchaus erkannt haben – ihre Maßnahmen sind allerdings von atemberaubender Schlichtheit.
Viele neue Erkenntnisse bei der Lektüre wünscht


Raus aus dem Dilemma: In seiner Siegesrede am Sonntag hat Hongkongs künftiger Regierungschef John Lee deutlich gemacht, wo die Prioritäten nach seinem Amtsantritt am 1. Juli liegen sollen. Lee und seine neue Mannschaft wollen versuchen, Hongkong schnellstmöglich aus der für die Wirtschaft schädlichen Corona-Isolation zu befreien. Ein Unterfangen, an dem auch die noch amtierende Regierung unter Carrie Lam arbeitet, aber bislang noch keinen Erfolg vermelden konnte.
Seit mehr als zwei Jahren gelten die strengen Maßnahmen, die jede Reise für Hongkonger zu einer Tortur machen. Trips ins Ausland ziehen nach der Rückkehr eine lange Hotel-Isolation in Hongkong nach sich. Nicht einmal Reisen ins benachbarte Shenzhen auf dem chinesischen Festland sind ohne Quarantäne möglich. Zahlreiche Hongkonger waren phasenweise sogar aus ihrer Heimat regelrecht ausgesperrt. Immer wieder wurden kurzfristig Flug- und Einreiseverbote verhängt, die es unmöglich machten, aus vom Coronavirus besonders hart getroffenen Ländern zurückzukommen. Für Touristen und Geschäftsreisende ohne Hongkonger Staatsbürgerschaft war die Stadt bis vor wenigen Tagen sogar komplett dicht.
Die Situation verlangt nicht nur den Menschen vieles ab, auch die wirtschaftliche Produktivität leidet massiv. Unternehmen und ausländische Handelskammern üben Druck auf die Regierung aus, indem sie immer wieder fordern, die Regeln endlich zu lockern.
Und tatsächlich: Anders als auf dem chinesischen Festland, wo die Regierung konsequent an ihrer umstrittenen Null-Covid-Politik festhält, versucht Hongkong, mit größerer Flexibilität eine Rückkehr in die Normalität erreichen. Sie ließ Omikron mehr oder minder durch die Stadt rauschen, ohne panikartig aufgrund der Infektionszahlen die Bevölkerung komplett und monatelang einzusperren. Die Entwicklung scheint die Wahl der Mittel zu rechtfertigen: Die Fallzahlen in Hongkong gingen von mehr als 70.000 Infektionen pro Tag auf zuletzt weniger als 300 zurück.
Als Sonderverwaltungszone genießt Hongkong deutlich mehr Selbstbestimmungsrechte als etwa Shanghai. Auch dort versuchte die Lokalregierung, einen harten Lockdown zu verhindern. Doch Peking sprach ein Machtwort, was zur Folge hatte, dass die Shanghaier Behörden nun Millionen Menschen seit mehr als einem Monat in ihren Wohnungen und Wohnblöcken isoliert. Während Staatsmedien vergangene Woche bereits “Licht am Ende des Tunnels” wähnten, zerstörte eine neue Direktive der Verwaltung am Wochenende die aufkeimende Hoffnung. (China.Table berichtete)
Als im Februar in Hongkong die Corona-Fälle in die Höhe schnellten, sah es zunächst ähnlich düster aus. In Windeseile wurden Container-Lager errichtet, in denen Kontaktpersonen und Infizierte untergebracht werden sollten. Auch gab es Pläne für mehrere Runden von Zwangs-Massentests. Sich im Falle einer Infektion vor einer Einweisung ins Corona-Lager zu schützen, wäre nicht möglich gewesen. Doch dazu kam es nicht mehr. Die Regierung machte keine Anstalten, zu einer Null-Corona-Politik zurückzukehren. Stattdessen erfolgte eine 180-Grad-Wende: Inzwischen sind Restaurants, Kinos, Fitnessstudios und Schwimmbäder wieder weitestgehend normal geöffnet.
Ganz anders entwickelt sich die Lage in Peking. “Die Corona-Situation ist kompliziert und ernst”, sagte ein Sprecher der Stadtverwaltung am Montag. Zu Wochenbeginn wurden wieder 50 neue Fälle diagnostiziert, ein Großteil davon im nördlichen Bezirk Shunyi. Es sei nicht gelungen, Kontaktketten zu brechen, hieß es. Die Kontrollen müssten erhöht werden. Für Dienstag ist der Beginn einer neuen Runde Massentests in insgesamt 17 Bezirken angekündigt.
Kinos oder Fitnessclubs bleiben geschlossen, auch zentrale Parkanlagen sind bis auf Weiteres gesperrt. Betreuung und Unterricht in Kindergärten, Grund- und Mittelschulen finden seit Mitte vergangener Woche nur noch online statt. In Chaoyang und Shunyi ist der öffentliche Nahverkehr ausgesetzt. Ab Donnerstag müssen Bürger:innen ein aktuelles, negatives PCR-Testresultat vorlegen, um öffentliche Einrichtungen betreten zu dürfen.
Erleichterungen dagegen in Hongkong: Zum ersten Mal seit zwei Jahren dürfen wieder Besucher aus dem Ausland in die Stadt reisen. Die Dauer der Hotel-Quarantäne wurde von 14 Tagen auf nur noch sieben Tage verkürzt. Erste Forderungen werden bereits laut, dass diese Quarantäne auch in der eigenen Wohnung verbracht werden kann. Auch die Flugverbote, die für Airlines bisher verhängt wurden, wenn in einem Flieger zu viele positiv Getestete saßen, sollen wesentlich dosierter verhängt werden.
Der gewählte Regierungsschef John Lee spricht zwar noch nicht offen davon, dass Hongkong künftig mit dem Virus leben solle. Klar scheint jedoch, dass die bisherige Corona-Politik Geschichte ist. Hieß es bisher stets, dass die Öffnung zum chinesischen Festland zuerst erfolgen müsse, spricht Lee nun nur noch allgemein von einer “Öffnung der Grenzen” – gemeint ist also, Hongkong gegebenenfalls zunächst aus seiner internationalen Abschottung zu befreien und das Festland warten zu lassen.
Nach seinem Wahlerfolg sagte John Lee jedenfalls: “Ich bin mir der Notwendigkeit sehr bewusst, Hongkong für die Welt zugänglich zu machen. Und es ist auch wichtig, dass Hongkong normale Reisen mit dem Festland wieder aufnehmen kann.” Und zwar in dieser Reihenfolge. Jörn Petring/ Gregor Koppenburg

Es war nur eine Randnotiz in den unzähligen Nachrichten über die chaotische Lebensmittelversorgung der Menschen in Shanghai. In mehreren Stadtteilen klagten Bewohner über Bauchschmerzen und Durchfall, nachdem sie Lebensmittel verzehrt hatten, die ihnen von den Behörden zugeteilt worden waren. Schnell kamen bei den Großstädtern in China Erinnerungen an verunreinigte Lebensmittel wie Milch, Öl und Gemüse auf. In den sozialen Medien ist immer wieder von der Gier der Lebensmittel-Unternehmen zu lesen, die das Leben der Menschen aufs Spiel setzten, damit die Bilanzen stimmen. Die Zensur lässt das so stehen, weil es auch Peking nutzt und von tieferen Problemen ablenkt.
Laut einer von der Chinese Academy of Engineering im Jahr 2020 durchgeführten Studie sollen schätzungsweise zwölf Millionen Tonnen des jährlich angebauten Gemüses durch Schwermetalle im Boden belastet sein. Hauptfaktoren sind dabei Rückstände aus industriellen Abwässern und Tierfutter.
Oft wird außer Acht gelassen, dass die Hauptvoraussetzung für sichere Lebensmittel gesunde Böden sind. Damit die landwirtschaftliche Produktion “saubere” Lebensmittel wie Gemüse, Mais oder Reis zur weiteren Verarbeitung ernten kann, benötigt sie schlicht Agrarflächen, deren Böden nicht kontaminiert sind. Und hierzu gibt es klare Vorgaben der Behörden.
“Für China ist die effiziente Nutzung natürlicher Ressourcen ein dringendes Anliegen, da seine landwirtschaftliche Nutzfläche vergleichsweise klein ist, um die größte Bevölkerung der Welt zu ernähren”, schreibt Lea Siebert in einer aktuellen Analyse zur Bodenkontaminierung in China vom Deutsch-Chinesischen Agrarzentrum (DCZ), die vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) unterstützt wurde.
Etwa 135 Millionen Hektar (Wald- und Grasflächen nicht einberechnet) der rund 645 Millionen Hektar Land werden in der Volksrepublik landwirtschaftlich genutzt. Das sind 0,09 Hektar pro Einwohner. Im Vergleich dazu sind es 0,14 in Deutschland und sogar 0,22 in der Europäischen Union. Laut einem Bericht der Weltbank seien von Chinas Nutzflächen inzwischen rund 20 Prozent belastet. In den Achtziger Jahren betrug der Anteil verseuchter Böden gerade mal fünf Prozent.
Entsprechend dringender entwickelt sich das Problem der Lebensmittelknappheit im eigenen Land. Um die Lücken zu stopfen, muss die Volksrepublik zunehmend große Mengen aus anderen Teilen der Welt importieren. Das schafft Abhängigkeit, die Peking eigentlich verhindern will (China.Table berichtete), weil die Regierung eine geostrategische Gefahr in dieser Konstellation erkennt.
Doch es fehlt an der notwendigen Transparenz, um überhaupt den Zustand der Böden in China richtig einschätzen zu können. Zwar gab es in der Vergangenheit eine Reihe von entsprechenden Studien, allerdings waren diese häufig auf bestimmte Regionen oder Schadstoffe reduzierte Meta-Analysen.
Der bisher umfassendste Ansatz ist die Nationale Erhebung zur Bodenbelastung, die zwischen 2005 und 2013 durchgeführt wurde. Der veröffentlichte Bericht enthält jedoch nur Statistiken über die prozentualen Verschmutzungsgrade. Detaillierte oder standortspezifische Daten sind hingegen nicht öffentlich gemacht worden, kritisiert das Deutsch-Chinesische Agrarzentrum (DCZ).
Mehrere aktuelle Studien zeigen, dass die bisherigen Schritte zur Bekämpfung der Bodenverseuchung kaum vorzeigbare Verbesserungen oder gar Lösungen hervorgebracht haben. Bereits 2013 kündigte der damalige Minister für Land und Ressourcen, Wang Shiyuan, einen langfristigen Plan zur Sanierung der Flächen an und sicherte zudem Ausgaben in Milliardenhöhe zu. Doch getan hat sich wenig, und wohin die Gelder geflossen sind, bleibt für Außenstehende unklar.
Auch rund zehn Jahre später scheint die Dringlichkeit des Themas noch immer nicht bei den Beteiligten angekommen zu sein. So riskieren zwei Drittel der befragten Unternehmen laut einer aktuellen Studie des Finanznachrichtendienstleisters Caixin, dass die von ihnen bewirtschafteten Böden durch chemische oder giftige Substanzen kontaminiert werden. Wissenschaftler eines englisch-chinesischen Projekts haben zudem herausgefunden, dass viele Bauern zur Maximierung ihrer Ernte viel zu viel Dünger und Pestizide einsetzen. Diese gelangen dann meist direkt ins Grundwasser, weil die große Menge von den Pflanzen schlicht nicht mehr aufgenommen werden kann.
Da 66 Millionen Hektar Ackerland in China – fast 50 Prozent der Gesamtfläche – bewässert werden, trägt auch die schlechte Wasserqualität entscheidend zur Bodenbelastung bei. Zudem lassen chemische und organische Schadstoffe die Böden versauern, wodurch der ph-Wert in den Böden sinkt. In einem derartigen ph-Milieu nehmen Pflanzen jedoch verstärkt Schadstoffe auf, was wiederum dazu führt, dass die Ernten mit Schwermetallen belastet sind – die dann in der weiteren Nahrungskette den Konsumenten schädigen.
Dabei sind sich Chinas Wissenschaftler dessen durchaus bewusst – und äußern ihre Sorgen: “Erhöhte Stickstoff-, Phosphor- und Treibhausgasemissionen überschreiten Sicherheitsgrenzen. Gegenwärtig ist China das Land mit den größten eingesetzten Mengen an chemischen Düngemitteln und Pestiziden weltweit“, sagt Kong Xiangbin, Professor am Institut für Bodenwissenschaften und -technologie an der China Agricultural University. Der Einsatz von Stickstoffdünger in China mache 33 Prozent der globalen Gesamtmenge aus, beim Phosphatdünger seien es 36 Prozent. “Im Jahr 2018 betrug der Verbrauch von Stickstoff und Phosphor 8,214 Millionen Tonnen beziehungsweise 2,138 Millionen Tonnen und übertraf damit die Sicherheitsgrenzen bei weitem”, heißt es in Kongs Studie.
Dabei ist die Kontaminierung von Böden im Agrarbereich keineswegs nur ein chinesisches Problem, wie die DCZ-Studie zeigt. Zum Vergleich: In Europa sind Schwermetalle für etwa 35 Prozent der Bodenverschmutzungen verantwortlich, gefolgt von Mineralölen mit 24 Prozent.
Böden im Agrarbereich sind zwar auch durch natürliche Erosionen belastet. Die meisten direkten Verschmutzungen werden allerdings durch menschliche Eingriffe in der Landwirtschaft verursacht. Übermäßiger Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden spielt dabei eine große Rolle, aber auch die Rückstände von Kunststofffolien, die davor schützen sollen, dass Wind und Wetter oder Tiere die Saat beschädigen.
1994 nutzten Chinas Bauern rund 426.300 Tonnen dieser Folien. 2020 waren es schon 2,389 Millionen Tonnen. Das Problem: Die Folien werden oft an den Feldrändern entsorgt, sodass Plastikreste in den Böden gefunden werden, was dann wieder die Bodenfeuchtigkeit und somit auch das Wachstum der dort gepflanzten Saat negativ verändert.
Hinzu kommen indirekte Verschmutzungen, beispielsweise resultierend aus Überschwemmungen oder hervorgerufen durch sogenannte atmosphärische Ablagerung, die der Kohleverbrauch in der Volksrepublik fördert: 2018 betrug der Kohleverbrauch insgesamt 3,97 Milliarden Tonnen. Diese Menge enthält ca. 51.600 Tonnen Blei, 38.300 Tonnen Arsen, 1.100 Tonnen Cadmium und 750 Tonnen Quecksilber. Diese gewaltigen Mengen lagern sich in der Atmosphäre ab und gelangen durch die Schwerkraft oder – schneller – durch Regenfälle auf und in die Böden.
Das Umweltministerium hat vergangenes Jahr ein umfassendes Handbuch herausgegeben, um die Bodenkontaminierung einzudämmen. Die drei Schwerpunkte der Empfehlungen an die Unternehmen lauten “kein Leck, keine Vermehrung und Früherkennung“. Doch die Vorschläge kommen nicht nur reichlich spät. In ihrer Schlichtheit zeigen sie auch, wie weit die Behörden von der Praxis entfernt sind. Mitarbeit: Renxiu Zhao.
Chinas Exportwachstum ist wie erwartet zurückgegangen. Im April betrug der Anstieg nur noch 3,9 Prozent, wie die Zollverwaltung in Peking am Montag mitteilte. Es handelte sich um den niedrigsten Wert seit dem ersten Corona-Jahr 2020. Im März lag das Plus noch bei 14,7 Prozent. Nach den Lockdowns in Shanghai und anderen wirtschaftsstarken Regionen hatten Ökonomen jedoch fest mit schwächeren Zahlen gerechnet (China.Table berichtete). Auch erhebliche Auswirkungen auf den Handel waren zu erwarten.
In den Zoll-Daten verbergen sich andererseits überraschend gute Nachrichten. China Einfuhren blieben trotz der zahlreichen Krisen ungefähr gleich. Die Lockdowns und die anderen Unsicherheiten haben noch nicht zu einem Absturz der Gesamtkonjunktur geführt. Für Mai erwarten Ökonomen allerdings eine erhebliche Eintrübung, weil sich die negativen Effekte mit der Zeit gegenseitig verstärken. Wenn Omikron sich also weiter verbreitet und zudem Shanghai noch lange im Griff hält, kann sich die Lage rasch verschlechtern. Das merken dann auch die Handelspartner deutlich. Die Importe aus Deutschland gaben um zehn Prozent nach.
Besondere Aufmerksamkeit galt am Montag auch Chinas Handel mit Russland. Dort zeigte sich im April ein gemischtes Bild. Ins Auge sticht zunächst ein Rückgang der chinesischen Exporte nach Russland. Im Vorjahresvergleich fiel die Nachfrage aus dem sanktionierten Nachbarland um 26 Prozent. Mit Beginn der Strafen ist der starke Exporttrend von China nach Russland zusammengebrochen. Diese Entwicklung spiegelt die generelle Wirtschafts- und Zahlungsschwäche im Land Wladimir Putins wider.
Zugleich aber hat Russland in China durchaus einen aufnahmebereiten Markt für die eigenen Waren gefunden: Chinas Import stieg um 57 Prozent. Es handelt sich vor allem um Rohstoffe. Mangels zusätzlicher Pipelines stieg die Einfuhr von russischem Öl jedoch nur um vier Prozent. Es muss per Schiff angeliefert werden. Da zugleich die Nachfrage nach Kraftstoff in China um ein Fünftel gesunken ist, stiegen auf der anderen Seite Chinas Energie-Exporte in andere Weltgegenden. Das bedeutet: China leitet indirekt russisches Öl auf den Weltmarkt weiter. fin

Chinas Aufsichtsbehörden haben Minderjährigen das Live-Streaming (直播, zhíbò) im Internet verboten. Damit wolle man “ihre körperliche und geistige Gesundheit” schützen, heißt es in der entsprechenden Erklärung.
Dabei wird die Gruppe der Minderjährigen aufgeteilt: Personen unter 16 Jahren wird jegliches Live-Streaming verboten, während Benutzer zwischen 16 und 18 Jahren die Erlaubnis ihrer Eltern oder Erziehungsberechtigten einholen müssen, bevor sie live gehen können. Weiter heißt es in der Erklärung: “Internetplattformen sollten die Pflicht zur Registrierung des echten Namens strikt umsetzen und das Angebot von Geldspende-Funktionen für Minderjährige wie Bargeldaufladung, Geschenkkauf und Online-Zahlung verbieten.”
Die neuen Bestimmungen wurden am Samstag von vier Aufsichtsbehörden herausgegeben – darunter die National Radio and Television Administration und die Cyberspace Administration of China (CAC).
Wie die Hongkonger “South China Morning Post” berichtet, wollen die Aufsichtsbehörden darüber hinaus, dass Chinas Technologie-Unternehmen ihren “Jugendmodus” verbessern. Es handelt sich hierbei um eine Funktion, die im vergangenen Jahr eingeführt wurde, um Teenager vor Spielsucht und “unangemessenen” Inhalten zu schützen. Seit 2018 gibt es beispielsweise auch eine Schwarze Liste für Influencer, die vermeintlich schlechten Einfluss auf die Gesellschaft und vor allem auf Chinas Jugend ausüben.
Nun werden die Plattformen aufgefordert, spezielle Zensurteams für Jugendinhalte einzusetzen. Zudem müssen die Benutzeraktivitäten im Jugendmodus nach 22 Uhr eingestellt werden, um “sicherzustellen, dass sie genug Zeit zum Ausruhen haben”. Es sind die jüngsten Maßnahmen der Regierung, mit der Peking Minderjährige im Cyberspace besser schützen will.
Sollten die neuen Regeln von den Technologie-Unternehmen nicht umgesetzt werden, drohen die Behörden mit drastischen Maßnahmen, angefangen vom Aussetzen der Geldspende-Funktion bis hin zur kompletten Schließung des Live-Streaming-Geschäfts einzelner Unternehmen. rad
Die G7-Außenminister haben die Ernennung von John Lee zum neuen Regierungschef in Hongkong kritisiert. “Wir sind zutiefst besorgt über diese stetige Aushöhlung der politischen und bürgerlichen Rechte und der Autonomie Hongkongs“, teilten die Außenministerien der G7-Industriestaaten am Montag mit. “Wir fordern den neuen Chef der Exekutive nachdrücklich auf, die im Grundgesetz verankerten geschützten Rechte und Freiheiten in Hongkong zu achten und dafür zu sorgen, dass das Gerichtssystem die Rechtsstaatlichkeit aufrechterhält.” Zu den G7 gehören neben Deutschland auch Frankreich, Italien, Kanada, Japan, die USA und Großbritannien.
Lee hatte am Sonntag 1.416 Stimmen des Peking-nahen Wahlausschusses erhalten und folgt damit ab 1. Juli Carrie Lam als Regierungschef in Hongkong (China.Table berichtete). Es gab keinen Gegenkandidaten gegen den 64-Jährigen. Das derzeitige Nominierungsverfahren und die Ernennung stünden “in krassem Gegensatz zum Ziel des allgemeinen Wahlrechts”, teilten die G7 mit. Dadurch würde den Hongkongern die Möglichkeit genommen, sich legitim vertreten zu lassen. Der Vorgang sei ein Teil eines “fortgesetzten Angriffs auf den politischen Pluralismus und die Grundfreiheiten” in Hongkong.
Mit Glückwünschen überhäufte derweil ein Teil der Wirtschaft den künftigen Regierungschef. In örtlichen Zeitungen hatten zahlreiche ortsansässige Firmen am Montag Anzeigen geschaltet – unter anderem die Wirtschaftsprüfer KPMG, Deloitte, EY und PwC. Die Montagsausgabe der Tageszeitung Ta Kung Pao war insgesamt 100 Seiten stark. 85 davon waren Glückwunsch-Anzeigen.
Auch die Mischkonzerne Swire und Jardine Matheson zählten zu den Gratulanten. Beide Firmen hatten ebenso wie die Banken HSBC und Standard Chartered die Einführung des Nationalen Sicherheitsgesetzes für Hongkong befürwortet. Das Gesetz gilt als Basis für die zunehmende Erosion der Rechtsstaatlichkeit Hongkongs. ari /grz
Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping haben sich am Montag über den russischen Angriff auf die Ukraine und seine Auswirkungen unter anderem auf die globale Nahrungsmittelversorgung und Energiesicherheit ausgetauscht. Außerdem sei es in der Videokonferenz um “die Entwicklung und die Konsequenzen der Covid-19-Pandemie, eine vertiefte Kooperation beim Klimaschutz, die Energietransformation sowie die EU-China-Beziehungen” gegangen. Zudem sei über eine weitere Vertiefung der bilateralen Beziehungen und über die Zusammenarbeit im Wirtschaftsbereich gesprochen worden, so die Bundesregierung in einer sehr kurzen Mitteilung.
Wesentlich ausführlicher ging die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua auf das Gespräch ein. Der chinesischen Version zufolge versicherten sich die beiden Spitzenpolitiker, wie wichtig die deutsch-chinesischen Beziehungen seien. Xi betonte demzufolge die Wichtigkeit von Stabilität in unsicheren Zeiten. Deutschland sei ein Land mit erheblichem Einfluss. China und Deutschland unterhielten Beziehungen von hoher Qualität. Das sei das Ergebnis von “gegenseitigen Verpflichtungen zur Win-Win-Kooperation”. China halte an seinem Wunsch nach engerer Zusammenarbeit fest.
Xi sagte zu Scholz, dass beide Seiten für Multilateralismus, die Rolle der Vereinten Nationen und die Aufrechterhaltung von Normen in internationalen Beziehungen stehen. Er ermahnte Europa, sich seiner historischen Verantwortung für Stabilität bewusst zu sein und selbst für seine Sicherheit zu sorgen. Der Austausch zum Thema Ukraine mit Scholz sei “freimütig” gewesen. China stehe “auf der Seite des Friedens” und arbeite “auf seine Weise” auf Entspannung hin.
Eine wichtige Botschaft ergibt sich bereits aus Länge und Wortwahl der beiden konkurrierenden Mitteilungen. Das Kanzleramt zeigte sich schmallippig und wollte Hinweise auf einen freundlichen Umgang vermeiden – schließlich hängen dicke Differenzen bezüglich der Haltung zur Invasion zwischen EU und China. Die lange Agenturmeldung von chinesische Seite erweckte dagegen den Eindruck eines langen, freundlichen Austauschs im diplomatischen Normalbetrieb.
Xis Mahnung an Europa, für Stabilität zu sorgen und selbst für die eigene Sicherheit zu sorgen, enthielt weitere Botschaften. “Verantwortung” und “Stabilität” sind als Aufforderung zu verstehen, die Ukraine nicht mit Waffen zu versorgen und Russland gewähren zu lassen. Mit dem Aufruf zu europäischer Eigenständigkeit wiederum meint Xi Jinping eine Abkehr von den USA und eine Lockerung demokratischer Bündnisstrukturen. Ein solcher Kurs würde potenziell Chinas Einfluss erhöhen.
Am Sonntag erst hatte SPD-Chef Lars Klingbeil in einem Interview mit dem Fernsehsender Phoenix zu einem anderen Auftreten im Umgang mit der Volksrepublik aufgerufen. Politik und Wirtschaft hätten im Falle Russland stets auf einen politischen Konsens mit Moskau gedrungen. Das sei ein Fehler gewesen, gestand Klingbeil ein und zog daraus den Schluss, dass man China gegenüber “heute anders auftreten und kritischer sein” müsse. China hat die russische Invasion der Ukraine nicht verurteilt, sondern schiebt die Schuld für den Krieg auf die USA und die Nato. grz/fin
Taiwan ist zum zweiten globalen Covid-19-Gipfel eingeladen worden. Das sagte Taiwans Außenminister Joseph Wu am Montag. Bei dem Treffen handelt es sich eine virtuelle Veranstaltung, die in dieser Woche von US-Präsident Joe Biden mitveranstaltet werden soll.
Wu sagte allerdings nicht, wer für Taiwan teilnehmen wird. Sollte es Präsidentin Tsai Ing-wen sein, würde das sicherlich scharfe Proteste aus Peking hervorrufen. Denn China beansprucht die Souveränität über die selbstverwaltete Insel. “Wir werden dieses Jahr an der Veranstaltung teilnehmen und haben auch den Teilnehmer für den Gipfel festgelegt”, sagte Wu am Montag bei einer Anhörung zur Legislative. Um wen es sich handelt, wolle man allerdings erst nach der Veranstaltung bekannt geben. So habe man es im vergangenen Jahr gehandhabt und so sei es auch dieses Mal von den Organisatoren gefordert worden. Im vergangenen Jahr hatte Taiwans ehemaliger Vizepräsident Chen Chien-jen auf dem virtuellen Weltgipfel teilgenommen.
Peking war auf dem ersten Corona-Gipfel nicht vertreten, gegen Taiwans Teilnahme hatte Peking allerdings lautstark protestiert. Ob China in diesem Jahr an der Veranstaltung teilnehmen wird, ist nicht bekannt.
Dem Weißen Haus zufolge wird der zweite globale Covid-19-Gipfel voraussichtlich am Donnerstag stattfinden. Die Teilnehmer sollen ihre Bemühungen zur Beendigung der Pandemie erörtern und sich auf künftige Gesundheitsbedrohungen vorbereiten. “Das Auftauchen und die Verbreitung neuer Varianten wie Omikron haben die Notwendigkeit einer Strategie zur weltweiten Kontrolle von Covid-19 klargemacht”, hieß es aus dem Weißen Haus. rad

Ist Niao Wu am Ziel? Was für eine Frage. Natürlich nicht. Niemals. Zwar hat die 35-jährige Architektin schon für BMW in Shanghai das Innovationszentrum errichtet, bei der Boston Consulting Group einen Turbo eingelegt und 2021 in München ihr Start-up Onyo gegründet. Mit dem vermittelt sie nachhaltig produzierte Arbeitsmöbel für daheim – auf Leasingbasis. “Homeoffice-as-a-Service” wirbt sie. Aber für Wu ist stets der Weg das Ziel. “Besser werden, stärker werden”, sagt sie. “Und der Gesellschaft etwas zurückgeben.” So beschreibt die quirlige Frau ihren inneren Motor, der sie aus Haining in der ostchinesischen Provinz Zhejiang und später in deren Hauptstadt Hangzhou zu ihrem heutigen Wohnort München führte.
“Ich stamme aus einer Familie, die in der Kulturrevolution viel gelitten hat”, sagt Wu. Ein Großvater verlor im Straflager sein Leben, der andere war Journalist und Sekretär in der taiwanesischen Regierung. Das bekam Wus Vater zu spüren. “Er durfte seiner Leidenschaft, der traditionellen Malerei, beruflich nicht nachgehen und wurde Lehrer.” Im Privaten tuschte, formte und kalligraphierte er, die Mutter – eine Buchhalterin – hielt das Geld zusammen. “Sie war die rationale Figur in meinem Leben.” Doch ihre Kindheit bestand fast nur aus Kunst. “Ich habe die ersten Jahre meines Lebens praktisch nur gemalt, mehr nicht.”
Zugleich prägte ihr Vater das junge Mädchen mit seiner Konsequenz. “Im Leben wird einem nichts geschenkt, man muss es sich erarbeiten” – diese Lektion kam an. Als alle noch schliefen, musste Niao Wu um fünf Uhr aufstehen, wurde im Dunkeln zum Kung-Fu-Meister geschickt. “Ich habe es gehasst”, sagt sie. Erst heute treibt sie wieder Kampfsport, Taekwondo, ganz freiwillig.
Architektur als Studienfach sei eine logische Wahl gewesen. “Ich war gut in Mathe und Physik und liebte die Kunst.” Ihr Schulabschluss sei der zehnt- oder elftbeste der Stadt gewesen. Deshalb durfte sie sich an der Zhejiang Universität in Hangzhou einschreiben – bis heute ist die Tech-Metropole am Westsee ihre chinesische Lieblingsstadt. Als sich nach zweieinhalb Jahren über eine neue Uni-Partnerschaft zur TU München ein Studentenaustausch ergab, ergatterte Wu einen der fünf Plätze. Deutsch hatte sie da schon im Abendkurs gelernt.
“Ich genoss das Strukturierte an der deutschen Universität, alles hatte Hand und Fuß”, schwärmt sie. Schnell stand fest: Sie bleibt. Ihr Studium startete sie von Grund auf neu. “Meine Professoren in Hangzhou haben meinen Entschluss verstanden.” Ihr Diplom legte sie 2014 mit den Schwerpunkten Bautechnik und Baukonstruktion ab. “Wenn man schon in Deutschland Architektur studiert, dann Hardcore.” Sie meint damit die Entscheidung, sich tiefgehend mit den Fundamenten der Architektur befassen zu wollen. Die trainierte Präzision komme ihr beim Gründen zugute, sagt Wu. “Das Logische, der Umgang mit Zahlen, die Struktur: In einer jungen Firma geht es auch darum, ein Baugerüst aufzustellen.”
Ihre erste Berufsstation in München begann mit einer Absage. Beworben hatte sie sich für das globale Traineeprogramm bei BMW, kam unter die letzten vier Kandidaten, doch wurde enttäuscht: “Ich passe nicht zu der Kultur”, zitiert sie die Begründung. Ein Jurymitglied aber, BMW-Hauptabteilungsleiter, erkannte ihr Potenzial und stellte sie bei sich im Team an. Dass sie sowohl die chinesische als auch die deutsche Kultur kennt, wird zum Trumpf, als ihr die bauliche Errichtung des Shanghai Zentrums für Forschung und Entwicklung des deutschen Autobauers anvertraut wurde. “Es war mein Baby, von der ersten Nutzeranforderung, über Grundstücksauswahl bis zur Koordination der Gewerke.” Später übernahm sie auch in Peking das Projektmanagement beim Bau des dortigen Forschungszentrums.
Trotz der anspruchsvollen Aufgaben verspürte sie nach gut drei Jahren einen alarmierenden Stillstand. “Die Welt da draußen bewegt sich so schnell, im Konzern herrscht Windstille. Man geht dreimal am Tag Kaffee trinken, es ist so bequem.” Sie nutzte ein BMW-Acceleratorprogramm und entwarf im Team kühne Batteriepläne. “Auch dort: Auf dem Papier alles schön, doch an echter Umsetzung hat niemand Interesse.” Der Entschluss wuchs: Sie wollte Unternehmerin werden. BWL-Kurse nahm sie an Wochenenden, landete kurz bei der Unternehmensberatung BCG. Nach diesem neunmonatigen “Crashkurs”, wie sie sagt, flog ihr die Geschäftsidee zu.
Onyo entstand in der Corona-Phase, als die BCG-Beraterin ins Homeoffice geschickt wurde. “Ich konnte mir daheim meinen Arbeitsplatz gut einrichten, aber in meinem Umfeld taten sich viele schwer damit.” Es fehlten Kompetenz und Muße. Küchentisch und Funzelbeleuchtung wurden zum gesundheitsgefährdenden Standard. “Ich finde eindeutig, dass die Arbeitgeber in der Pflicht stehen, beim jetzt aufkommenden hybriden Arbeiten ihre Leute mit ergonomischem Mobiliar zu unterstützen – und nicht buchstäblich auf ihrem Rücken zu sparen”, sagt Wu. Gemeinsam mit Jens Wöhrle, einem Ex-Banker und Softwareprofi, setzt sie ihre Vision um. “Wir statten Mitarbeiter:innen mit hochwertigen und nachhaltigen Produkten individuell aus, ohne dass sich der Arbeitgeber um Beschaffung, Logistik oder Versicherung kümmern muss.”
Ihr Leben als “chinesische Immigrantin der ersten Generation”, wie sie es empfindet, sei “nicht immer unkompliziert”. Es scheint, als nehme sie stets einen Schritt Abstand, um sich selbst zu betrachten. Als eine Wandlerin zwischen den Kulturen, motivierte Kosmopolitin und Angehörige einer Generation, die verstanden hat, dass es genau auf sie ankommt. Ihre Mutter konnte sie seit drei Jahren nicht besuchen, das sei hart. Ob sie China ansonsten vermisse? “Nicht brennend”, sagt sie. “Hier in München und auch digital gibt es so viele tolle Ausstellungen zur chinesischen Kultur – das gibt mir viel.” Stefan Merx
Rayman Zhang ist bei Investment-Unternehmen CBRE zum Leiter für Advisory & Transaction für das chinesische Festland befördert worden. Zhang war 2012 in das Unternehmen eingetreten. Davor hatte er unter anderem beim US-amerikanischen Gewerbeimmobilien-Beratungsunternehmen Cushman & Wakefield gearbeitet.

Von Corona-Impfungen für Katzen ist bislang nichts bekannt, also muss Schutzkleidung her. Auf Taobao findet man die bekannten Corona-Schutzanzüge der “Weißen Riesen” nun auch für das kleine Haustier. Für 67 Yuan ein Schnäppchen. Allerdings wird für die Wirksamkeit wohl keine Garantie übernommen.