der Rückzug aus Afghanistan hat sich zur Katastrophe entwickelt und offenbart die Defizite der amerikanischen Zentralasien-Politik. Auch Deutschland als Bündnispartner hängt tief mit drin in dem Desaster. Das große Nachbarland China wiederum brüstet sich, den Verlauf der Ereignisse vorausgesehen und die Stärke der Taliban realistisch eingeschätzt zu haben. Amerikas Niedergang beginnt nun in Afghanistan – so sieht es Peking.
Zwar will auch China kein Emirat der Taliban als Nachbarn, ist aber in der Region auf jeden Fall besser vernetzt als die USA. Und: Peking legt in der Außenpolitik rein pragmatische Maßstäbe an. Die Nichteinmischung, die das Land von anderen verlangt, praktiziert es seinerseits in Afghanistan. Wenn die Taliban faktisch regieren, dann sieht die chinesische Außenpolitik sie eben als Herrscher des Landes an. Welche unheilvolle Botschaft China aus diesen Ereignissen für Taiwan ableitet, analysiert Michael Radunski.
Der Pragmatismus der chinesischen Politik bedeutet zugleich, im Handelskrieg mit den USA hart zu bleiben. Konkret bewirkt das eine Blockade für die potenziell größte Übernahme in der Halbleiterbranche. Der amerikanische Chip-Hersteller Nvidia will den britischen Chipdesign-Dienstleister ARM kaufen. China ist aber strikt dagegen: Die Konzentration in der westlichen Halbleiterbranche gefährdet die Belieferung von Elektroriesen wie Huawei. Und Peking hat durchaus Mitspracherecht, schließlich müssen Kartellbehörden auf allen Kontinenten zustimmen.

Hu Xijin kann am Montag seine Freude kaum verbergen. “Chinesische Internetnutzer machen Witze darüber, dass die Machtübergabe in Afghanistan sogar noch reibungsloser abläuft als die Übergabe der Präsidentschaft in den Vereinigten Staaten”, twittert der Chefredakteur der chinesischen Zeitung Global Times.
Genüsslich verweist seine Zeitung auf zynische Kommentare, die auf Online-Plattformen wie Sina Weibo zu lesen sind: “Der 20-jährige Krieg endet wie ein Witz. Amerikanische Soldaten sind für nichts gestorben, die Taliban sind zurück und der einzige Unterschied ist, dass noch mehr Menschen gestorben sind und die amerikanischen Steuerzahler ihr Geld verschwendet haben.” An anderer Stelle heißt es: “Jene Menschen, die noch immer an die USA glauben, werden nie ihre Lektion lernen. Sie wurden von den Amerikanern zurückgelassen wie Müll.“
Der offizielle Meinungsartikel der Global Times verspottete die USA derweil als “Papiertiger”. “Ein Land so mächtig wie die USA kann in 20 Jahren nicht einmal die afghanischen Taliban besiegen, die von außen so gut wie keine Hilfe erhalten haben.” Und so kommen die Redakteure zu dem Schluss: “Die Niederlage der USA ist eine klarere Demonstration ihrer Hilflosigkeit, als es der Vietnam-Krieg je war – die USA sind in der Tat ein Papiertiger.”
Die aktuellen Entwicklungen in Afghanistan nähren diese Sichtweise. In Windeseile erobern die Taliban das ganze Land, die von den USA ausgerüsteten und trainierten Regierungstruppen leisten kaum Widerstand. Während US-Hubschrauber vom Dach der amerikanischen Botschaft in Kabul das diplomatische Personal retten, versuchen am Flughafen Tausende Menschen verzweifelt, einen Platz in einem der wenigen Evakuierungsflüge zu bekommen. Derweil tauchen aus den von den Taliban eroberten Gebieten schon erste Meldungen auf, die von Vergeltungsmorden und anderen brutalen Praktiken der Taliban berichten.
In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchten die USA, sich der Unterstützung Chinas im Umgang mit den Taliban zu versichern. In einem Telefonat hat US-Außenminister Antony Blinken die Möglichkeiten ausgelotet, doch noch eine “weiche Landung” Afghanistans herbeizuführen. China hat das nicht rundheraus abgelehnt, verlangte als Gegenleistung jedoch Zugeständnisse in der Handelspolitik. Beide Seiten waren sich jedoch einig, dass eine humanitäre Katastrophe zu vermeiden sei.
Angesichts dieser dramatischen Lage liegt Chinas Priorität als direktes Nachbarland darauf, wieder Stabilität in Afghanistan herzustellen – und dabei vor allem im Wakhan-Korridor. Dabei handelt es sich um einen schmalen Landstrich in der Provinz Badakhshan im Nordosten Afghanistans. Dieser verbindet die chinesische Region Xinjiang mit Afghanistan. Er ist daher die für China die strategisch wichtigste Region des Landes.
Einem UN-Bericht zufolge sind in dieser Region mehrere Hundert uigurische Kämpfer aktiv, weshalb Peking jahrelang eng mit der Regierung in Kabul zusammenarbeitete und dabei half, eine spezielle Brigade aufzubauen, um die Sicherheit in jenem Grenzgebiet zu steigern. Dass es sich für China darbei allerdings nur um eine rein pragmatische Zusammenarbeit handelte, wird in diesen Wochen deutlich: Kaum verliert die Regierung in Kabul ihre Macht, spricht Peking eben mit den Taliban.
So traf sich Chinas Außenminister Wang Yi vor nicht einmal drei Wochen in Tianjin mit einer Delegation der Taliban unter Führung von Mullah Abdul Ghani Baradar. Wang ließ sich dabei explizit zusichern, dass die Taliban den uigurischen Kämpfern oder anderen Gruppen nicht mehr erlauben, sich nach Afghanistan zurückzuziehen oder von afghanischem Boden aus Anschläge gegen China zu planen und durchzuführen.
Bemerkenswert ist der Zeitpunkt jenes Treffens: Es fand noch vor Beginn der großen Taliban-Offensive statt. In jenen Tagen schickten die radikalen Islamisten etliche Delegationen in die angrenzenden Nachbarländer. Doch weder in Russland noch im Iran wurden sie derart glamourös und ranghoch empfangen wie von China. (China.Table berichtete).
Chinas Staatsmedien publizierten schon fast freundschaftlich anmutende Fotos, die Außenminister Wang Yi Schulter an Schulter neben den Vertretern der radikal-islamischen Bewegung zeigen. Im Nachhinein scheint es, als wollte man damit die eigene Bevölkerung behutsam auf das immer wahrscheinlicher werdende Szenario vorbereiten, dass Peking in nicht allzu ferner Zukunft die Taliban als legitimes Regime in Afghanistan anerkennen werde.
Damals noch waren die Geheimdienste der USA fest überzeugt, dass nach dem angekündigten Rückzug der US-Truppen die afghanische Regierung die rivalisierenden Taliban mindestens sechs Monate unter Kontrolle halten würden. China war deutlich besser informiert: Hinter vorgehaltener Hand wurde im Außenministerium in Peking schon damals erzählt, dass der Siegeszug der Taliban unmittelbar bevorstehe.
Und so war China deutlich besser auf den Vormarsch der Taliban vorbereitet als die USA und ihre westlichen Verbündeten. Während sie in höchster Not und vollkommen unvorbereitet am Montag ihre Botschaften evakuierten, kündigte Chinas diplomatische Vertretung in Kabul an, man werden selbstverständlich die Botschaft geöffnet lassen und wie gewohnt die Arbeit fortsetzen.
Beobachter sehen hier die Fortsetzung einer Politik, die sich schon länger abgezeichnet hat. “Die Volksrepublik arbeitet seit Jahren daran, gute Beziehungen zu den Taliban aufzubauen”, sagt Regionalexpertin Vanda Felbab-Brown von der Brookings Institution in Washington im Gespräch mit dem China.Table. Über verdeckte Kanäle habe Peking die Gotteskrieger regelrecht hofiert, erklärt die Wissenschaftlerin. Das zahlt sich nun aus.
Chinas Außenministerium erklärte am Montag, man sei zu “freundlichen Beziehungen” mit den neuen Machthabern in Afghanistan bereit. “China respektiert das Recht des afghanischen Volkes, unabhängig sein eigenes Schicksal zu entscheiden und ist bereit, freundliche und kooperative Beziehungen mit Afghanistan” zu unterhalten, sagte Außenamtssprecherin Hua Chunying in Peking.
Geht es nach Peking, soll es bei diesen freundlichen Beziehungen vor allem um wirtschaftliche Aspekte gehen. Schon heute ist China größter Auslandsinvestor im Land, man finanziert unter anderem die Öl- und Gasförderung. Darüber hinaus versucht Peking schon seit einiger Zeit, Afghanistan in sein Prestige-Projekt der Neuen Seidenstraße einzubinden. Eine Autobahn Peshawar-Kabul könnte eine wichtige Lücke in dem Infrastrukturprojekt schließen, doch bislang scheiterten Pekings Pläne, da Kabul die Entscheider in Washington nicht verprellen wollte.
Im Wakhan-Korridor baut Peking bereits mehrere Straßen. So würde man Xinjiang mit Afghanistan verbinden, von wo aus Waren und Güter über Pakistan nach Zentralasien – und schließlich Europa geliefert werden soll. “Wenn es Peking gelingt, diese Verbindungen aufzubauen, werden der Handel in der Region und die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen in Afghanistan drastisch zunehmen“, sagt Derek Grossman von der US-Denkfabrik Rand Corporation gegenüber China.Table. Experten zufolge soll Afghanistan über riesige Vorkommen an Seltenen Erden und weitere seltene Bodenschätze verfügen – Wert: mehr als eine Billion US-Dollar.
Doch Chinas wirtschaftliche Ambitionen haben klare Grenzen. So betonte die Global Times am Montag ausdrücklich, dass die Volksrepublik nicht die gleichen Fehler begehen werde, die in der Vergangenheit schon etliche Großmächte wie das britische Empire, die Sowjetunion und zuletzt die USA begangen haben: Truppen nach Afghanistan schicken. “China ist in einer relativ komfortablen Situation. Das Prinzip der Nichteinmischung in innere Angelegenheiten anderer Länder ist seit jeher das Leitprinzip der chinesischen Außenpolitik”, heißt es in der staatlichen Zeitung.
Auch Regionalbeobachter Zhang Junhua vom European Institute for Asian Studies in Brüssel stellt klar: “Peking wird sich nicht die Last aufbürden, sich tief in die afghanische Politik reinziehen zu lassen”, so der China-Experte gegenüber China.Table. Er sieht zwei mögliche Szenarien, wie Peking seinen Einfluss in Afghanistan erhöhen könnte – ohne in die Untiefen der nationalen Politik hineingezogen zu werden: über die Shanghai Security Organisation (SCO) oder über eine bilaterale Zusammenarbeit mit Russland.
Allerdings seien beide Optionen mit Schwierigkeiten verbunden. “Die Mitglieder der SCO verfolgen in Afghanistan sehr unterschiedliche Eigeninteressen”, erklärt Zhang. Vor allem Indien sei fest entschlossen, eine Zusammenarbeit der Taliban mit Pakistan und China unter allen Umständen zu verhindern. Delhi befürchte eine geopolitische Einkreisung. Das Problem an der bilateralen Lösung mit Russland ist laut Zhang, dass sich Russland trotz der aktuell guten Beziehungen mit China in Zentralasien nach wie vor als Vor- und Schutzmacht betrachte und dort den Einfluss Chinas möglichst gering halten wolle. Schnell wird klar: Wachsender Einfluss bedeutet für Peking auch neue Probleme.
Unter anderem deshalb grenzt sich China explizit vom Westen ab – und verzichtet bei seinen Plänen auf einen moralischen Werteüberbau, wie ihn die westlichen Verbündeten mit den Schlagworten Demokratie, Menschenrechte und freie Wahlen propagiert hatten.
Lin Minwang, Südasienexperte der Fudan-Universität in Shanghai, bringt Pekings Einstellung hinsichtlich der Taliban und der aktuellen Lage in Afghanistan treffend auf den Punkt: “Wir sind da ganz pragmatisch. Wie sie ihr Land regieren wollen, ist weitgehend ihre Sache”, sagte er der Nachrichtenagentur Reuters.
Ohnehin ist die Sicherheitslage in Afghanistan noch derart undurchsichtig, so dass Prognosen über die weitere Entwicklung schwierig sind. Wichtiger für die Strategen in Peking mag denn auch an diesem Tag ein anderer Punkt sein.
Schiebt man den ätzenden Zynismus und den beißenden Spott der Kommentarspalten zur Seite, wird der Blick frei auf eine andere, viel weitreichendere Botschaft, die in all den Zeilen mitschwingt und sich vor allem an Amerikas Verbündete richtet: Das Scheitern der US-Intervention in Afghanistan zeigt, dass der Führungsstärke Washingtons nicht mehr vertraut werden könne. Schon verweist die Global Times in diesem Zusammenhang auf Taiwan, wo man sich jetzt doch ernsthafte Sorgen machen sollte.
Es steht zu vermuten, dass nur wenige Einheizer im Dunstkreis der Global Times zu einer derart großen gedanklichen Akrobatik fähig sind, von den Ereignissen in Kabul eine direkte Verbindung nach Taipeh zu ziehen. Aber die dahinterstehende Botschaft ist klar und deutlich: Washingtons Sicherheitsgarantien zählen nichts mehr. Sollte sich diese Ansicht durchsetzen, würden die USA weit mehr verlieren als ihren Einfluss in Afghanistan.
Der wohl wichtigste Hightech-Deal des Jahres geht in die heiße Phase. Mit dem Ende der Brüsseler Sommerpause in zwei Wochen dürfte der US-Chiphersteller Nvidia die Übernahme des britischen Chipdesigners ARM bei der EU-Kommission zur wettbewerbsrechtlichen Prüfung anmelden. Zuvor könnte sich noch die britische Regierung äußern: Digitalminister Oliver Dowden wertet derzeit einen Bericht der Marktaufsicht CMA aus, der auch Folgen für die nationale Sicherheit des Vereinigten Königreichs beleuchtet. Doch scheitern wird das Großprojekt aller Wahrscheinlichkeit nach am Widerstand Chinas.
Doch warum ist Peking gegen den Deal? Chinesische Chiphersteller wie Hisilicon und SMIC nutzen ARM-Designs ebenso wie der Telekommunikationausrüster Huawei. Große Teil der Elektronikindustrie Chinas sind darauf angewiesen, Zugriff auf die IP-Rechte des Unternehmens zu haben. Eine Übernahme ARMs durch das US-Unternehmen Nvidia würde die Branche daher verwundbar machen für Tech-Sanktionen Washingtons. Die Behörden in China werden sich den Fall daher sehr genau anschauen.
Damit die Übernahme in allen Märkten wirksam werden kann, in denen bislang beide Unternehmen tätig sind, müssen die Kartellbehörden dort jeweils einzeln zustimmen. Auch eine Trennung nur vor Ort umgeht dieses international übliche Vorgehen nicht. China kann den Deal also blockieren – oder eine Entscheidung einfach aussitzen. Im März kommenden Jahres verstreicht eine wichtige Frist, nach der ein Abschluss der Übernahme als unwahrscheinlich gilt.
Prozessoren mit ARM-Technologie stecken in fast jedem Smartphone und vielen anderen Endgeräten. Die ARM-Designs sind effizient und stromsparend und daher gerade bei mobilen Anwendungen den Prozessoren von Intel und AMD überlegen. In Deutschland ist ARM trotzdem nur Wenigen ein Begriff; das Unternehmen hat hierzulande nur eine kleine Software-Tochter in der Nähe Münchens. Der Verkauf eines britischen Unternehmens durch den japanischen Eigner Softbank an den US-Konzern Nvidia scheint daher wiederum die Interessen Deutschlands und der EU kaum zu berühren. Doch der Eindruck täuscht:
China verdankt seine entscheidende Rolle auch einem Vertrag zwischen Nvidia und ARM-Verkäufer Softbank. Wenn die Genehmigungen im September 2022 noch ausstehen, dürfen Nvidia und ARM laut einer Übereinkunft beider Partner auch andere Optionen verfolgen. Falls China bis dahin nicht entscheidet, platzt der Deal also voraussichtlich.
Nvidia-CEO Jensen Huang wird auch gegenüber den Kartellbehörden viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, dass er den technischen Vorsprung von ARM-Entwicklungen nicht zuerst für eigene Nvidia-Produkte nutzt. “Das wäre eigentlich naheliegend für ein Unternehmen, das auf dem Gebiet originäre Geschäftsinteressen verfolgt”, sagt Kleinhans. Nvidia versucht, diese Bedenken zu zerstreuen und verspricht, “am offenen Lizenzmodell festzuhalten”. Sämtliche technischen Weiterentwicklungen würden den ARM-Lizenznehmern zur Verfügung gestellt, versicherte Huang, der gebürtiger Taiwaner ist.
Derzeit gibt es keinen Grund für Peking, sich für die Übernahme offen zu zeigen. Der neue US-Präsident Joe Biden hat die Handelspolitik seines Vorgängers nicht zurückgenommen, sondern sogar noch weitergetrieben (China.Table berichtete). Der Handelskrieg könnte sich noch lange hinziehen und in immer härtere Runden gehen.
Sämtliche chinesischen Akteure haben den Deal von Anfang an abgelehnt. “Die Regulatoren sollten ‘Nein’ zur Übernahme von ARM durch Nvidia sagen”, titelte die Staatszeitung “Global Times” im vergangenen Jahr. Das Staatsorgan zog dabei eine Verbindung zum US-Vorgehen gegen die Video-App Tiktok aus China. Dieses zeige, wie aggressiv die USA ihre Technik-Vorherrschaft verteidigten. Warum sollte Peking sich da willfährig zeigen?
Großbritannien, die Heimat von ARM, sucht derweil seit dem Brexit weltweit Handelsmöglichkeiten. China hat sich hier offensiv angeboten. Die Chancen, auch angesichts des Handelskrieg mit den USA weiter Geschäfte mit den Briten machen zu können und Zugriff auf ARM-Designs zu behalten, sind also hoch.
Und es gibt zudem ganz praktische Gründe für ein Nein Pekings: Da ARM und Nvidia bislang in verschiedenen Ländern zuhause sind, kann ARM seine Chip-Architekturen auch dort bereitstellen, wo Nvidia auf Druck der US-Behörden schon nicht mehr liefern darf. Auch der in China durchaus einflussreiche Mobilfunkausrüster und Handyhersteller Huawei hat sich deshalb gegen die Fusion ausgesprochen. Huawei nutzt Produkte des britischen Unternehmens: Der von Huawei auf breiter Front verwendete Kirin-Prozessor für Mobiltelefone basiert beispielsweise auf einem Chip-Design von ARM. Und Huawei wird durch die USA wie kaum ein anderes Unternehmen aus China von wichtigen Lieferketten ausgeschlossen.
Auch europäische Chiphersteller beobachten den Deal mit Argusaugen. Firmen wie Infineon und NXP hängen von ARM-IP ab. Experten halten es daher für unwahrscheinlich, dass die Kommission bereits in der ersten Prüfphase freigeben werde. Dafür seien klar zugeschnittene Zugeständnisse wie Verkäufe von Firmenteilen nötig, die in diesem Falle schwer zu erkennen seien, sagt ein Kartellrechtler, der sich nicht namentlich zitieren lassen will.
In der EU steht das Genehmigungsverfahren derweil noch am Anfang. Bislang haben die beiden Unternehmen den Deal noch nicht offiziell bei der EU-Kommission zur Prüfung angemeldet, wie eine Sprecherin der Behörde bestätigt. Dass sich die Pre-Notification-Phase so lange hinzieht, deutet darauf hin, dass die EU-Wettbewerbshüter bereits im Vorfeld ungewöhnlich viele Fragen übermittelt haben.
Peking und Brüssel könnten allerdings vor einem gemeinsamen Problem stehen: Der derzeitige Eigner Softbank will seine Anteile an ARM auf jeden Fall versilbern. Und derzeit ist vollkommen offen, ob ein anderer Käufer angenehmer als Nvidia sein würde. Till Hoppe/Finn Mayer-Kuckuk
Neue Regeln des Ministeriums für Industrie und Informationstechnik sehen vor, dass Autohersteller Rechenschaft über die Daten ablegen sollen, die ihre vernetzten Fahrzeuge sammeln. Das berichtet das Wirtschaftsportal Caixin. Die anstehende Verschärfung der Vorschriften gilt als Teil der groß angelegten Neuordnung der Technik-Branchen hin zu mehr Regelhaftigkeit. Ein zentraler Punkt ist dabei der Speicherort. Die Firmen müssen einen Antrag inklusive Begründung stellen, wenn die Kundendaten das Land verlassen sollen. Eine Genehmigung ist ebenfalls für jedes Software-Update nötig, das drahtlos aufgespielt wird. Ein weiterer Punkt: Statt des amerikanischen Ortungssystems GPS sollen die Autos mit dem chinesischen Gegenstück Beidou navigieren. fin
China hat einen leichten Anstieg der Arbeitslosenquote verzeichnet. Laut neuen Daten des Nationalen Statistikamtes in Peking legte sie im Juli von 5 Prozent auf 5,1 Prozent zu. Die Veränderung mag minimal erscheinen, doch Chinas Arbeitslosenzahl ist im Allgemeinen sehr stabil, weshalb Ökonomen auch auf kleine Ausschläge achten. Auch an der zweitgrößten Volkswirtschaft geht die Kombination aus Starkregen, immer neuen Runden der Pandemie und Störungen in der Containerlogistik nicht spurlos vorbei (China.Table berichtete).
Chinas Wirtschaft ist im Juli zwar weiter gewachsen – der Anstieg der Indikatoren ist jedoch unter den Erwartungen geblieben. So haben die Einzelhandelsumsätze um 8,5 Prozent zugelegt, während Analysten der Deutschen Bank ein Plus von 10,9 Prozent erwartet hatten. Auch die Industrieproduktion blieb mit einem Anstieg von 6,4 Prozent deutlich unter dem prognostizierten Wert von 7,9 Prozent. Die Deutsche Bank hat daher ihre Wachstumsvorhersage für das Gesamtjahr heruntergeschraubt. fin
In Nordostchina haben Regierungsbeamte im Zusammenhang mit Steuerermittlungen das Management einer der größten privaten Ölraffinerien Chinas übernommen. Ein Team unter der Leitung von Beamten der Stadt Panjin in Liaoning wurde zur Leitung der in finanziellen Schwierigkeiten steckenden Liaoning Bora Enterprise Group eingesetzt. Das Team versuche, Bora zu restrukturieren und damit einen Zusammenbruch zu verhindern, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf ungenannte informierte Quellen.
Die laufenden Ermittlungen wegen nicht gezahlter Steuern in großer Höhe könnten demnach zu hohen Geldstrafen für Bora und in der Folge einer Insolvenz führen. Bora besitzt eine Rohölverarbeitungskapazität von mehr als 20 Millionen Tonnen pro Jahr. Ein Zusammenbruch Boras würde aufgrund ihrer der Größe des Betriebs zu vielen Entlassungen führen und ein finanzielles Risiko auch für die Stadt Panjin selbst darstellen.
Derzeit läuft ein Crackdown gegen die vormals nur lasch regulierten privaten Raffinerien, die es neben Liaoning vor allem in der Küstenprovinz Shandong gibt. Die Stadt Panjin ist mittendrin: Gleich mehreren Firmen dort werden Steuerhinterziehung – etwa durch Missbrauch von Schlupflöchern – oder Verstöße gegen Umweltschutzvorschriften vorgeworfen. Auch in Shandong mussten die privaten Raffinerien Anfang des Monats geloben, alle Vorschriften strikt einzuhalten.
Private Raffinerien machen laut Bloomberg ein Viertel der gesamten Ölverarbeitungskapazität Chinas aus. Sie sind damit seit einer Liberalisierung des Sektors zu einer echten Konkurrenz der staatlichen Ölgiganten aufgestiegen. Die Zentralregierung kürzte dieses Jahr allerdings die Rohöl-Importquote der Privaten. Das könnte ihr Wachstum vorerst ausbremsen. ck
Der jüngste Corona-Ausbruch in China scheint aufgrund der strikten Kontrollmaßnahmen allmählich unter Kontrolle. Die Nationale Gesundheitskommission meldete am Montag noch 51 neue Fälle von Covid-19-Erkrankungen, darunter 13 lokale und 38 importierte Infektionen. Fälle ohne Symptome nahmen ebenfalls ab – es gab 17 importierte und drei lokale Fälle. Diese werden in China nicht als bestätigte Infektionsfälle eingestuft. Rätsel gaben am Wochenende derweil drei asymptomatische Fälle in Xinjiang auf: Die Betroffenen waren nach einem Bericht der China Daily während der vergangenen 14 Tage nicht außerhalb der Region gewesen und hatten auch keinen Kontakt zu Infizierten gehabt.
Der in Nanjing vor etwa einem Monat bemerkte Ausbruch der Delta-Variante hatte sich vor allem auf die Provinzen Jiangsu und Henan konzentriert. In diesen Regionen erließ die Regierung strenge Quarantäneregeln und testete bis heute mehr als 90 Millionen Menschen. Nach europäischen Maßstäben ist der Ausbruch ohnehin eher klein: Insgesamt infizierten sich in Jiangsu bisher 802 Menschen, davon mit 552 die meisten in der Yangtse-Stadt Yangzhou.
In Henan hat der Corona-Ausbruch derweil bereits personelle Konsequenzen nach sich gezogen. Fünf Beamte im betroffenen Landkreis Yucheng – darunter der stellvertretende Kreisleiter – wurden nach einem Bericht der South China Morning Post aufgrund von mangehafter Koordination der Seuchenbekämpfung ihres Amtes enthoben. In Henan liegen noch gut 200 Covid-Patient:innen im Krankenhaus. ck
Die Volksrepublik hat 286 Kooperationen mit ausländischen Universitäten beendet. Wie die South China Morning Post am Montag berichtete, stellte das Bildungsministerium eine Liste der beendeten Programme auf seine App. Betroffen sind renommierte Institutionen wie die City University London, die New York University und die University of Hong Kong. So endet beispielsweise nun das gemeinsame Bachelor-Programm für Mechanical Design and Automatisierung der Harbin University of Science and Technology und der City University London. Das Aus für die Programme sei im Rahmen einer routinemäßigen Bewertung der Kooperationsvereinbarungen erfolgt, so die Zeitung. Eine offizielle Begründung gab es demnach nicht.
Erst vor knapp einem Monat hatte Peking harte neue Regeln für private Bildungsunternehmen erlassen – die unter anderem keine Profite mehr erwirtschaften oder Investitionen aus dem Ausland annehmen dürfen (China.Table berichtete). Es gebe in der Volksrepublik daher Sorgen vor einem weitreichenden Vorgehen gegen den gesamten Bildungssektor, so die South China Morning Post in dem Artikel. Seit 2004 reguliert Peking chinesisch-ausländische Bildungskooperationen und prüft deren Inhalte. Immer wieder mal wurden seitdem Programme gestoppt. ck
´
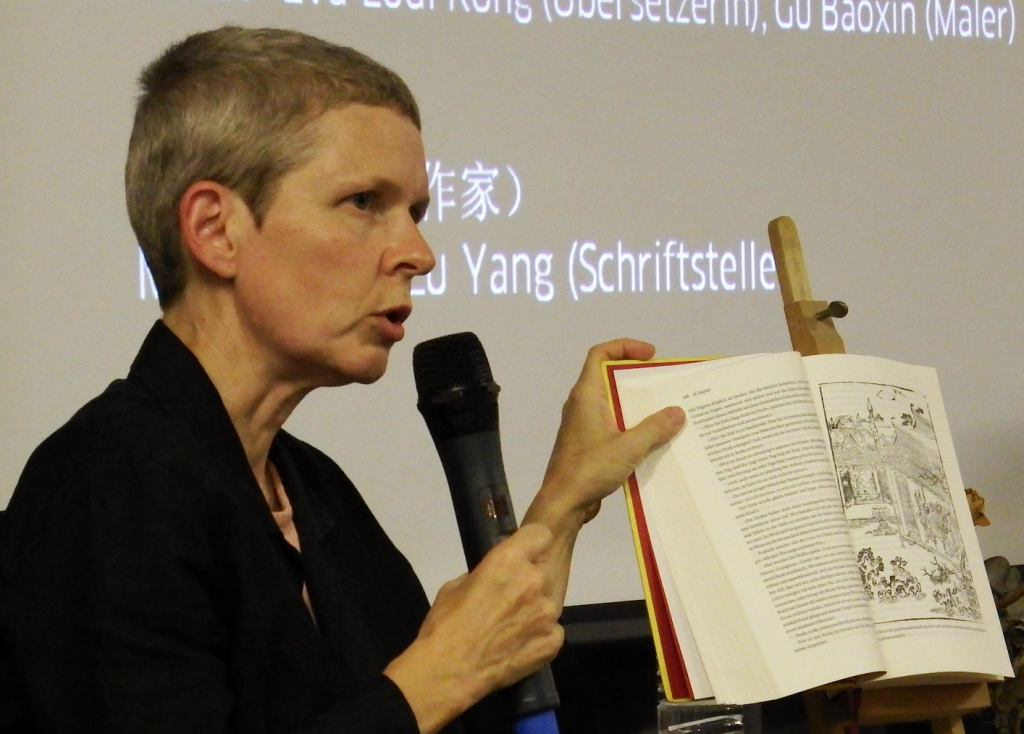
Ganze 17 Jahre arbeitete Eva Lüdi Kong an der deutschen Übersetzung von “Die Reise in den Westen”, einem der vier großen Klassiker der chinesischen Literatur. Für die Kultur Ostasiens war das Werk ähnlich wegweisend wie einst Dantes “Göttliche Komödie” für Europa. Wohl auch deshalb hatte es vor Lüdi Kong niemand gewagt, den epochalen Roman vollständig ins Deutsche zu übertragen. “Zu ambitioniert”, erklärten dann auch die Verlage, bei denen die heute 52-jährige Schweizerin anklopfte. Trotzdem arbeitete die Sinologin, die Anfang der 90er-Jahre im Alter von 21 erstmals nach China kam, unermüdlich weiter – einem Gefühl der “inneren Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit” folgend, wie sie sagt.
Neben ihrer Arbeit als Dolmetscherin und Universitäts-Dozentin im ostchinesischen Hangzhou fand Lüdi Kong sich immer wieder am Schreibtisch wieder, um den Helden des im 16. Jahrhundert niedergeschriebenen Romans nachzuspüren. “Wenn es möglich war, konnte ich tagelang daran sitzen und die Geschichten übersetzend miterleben. Abends hatte ich das Gefühl, einen unheimlich bewegten Tag hinter mir zu haben – bis ich merkte, dass sich ja alles nur im Buch abgespielt hatte.”
Im Jahr 2017 bekam Lüdi Kong für das 1.300 Seiten dicke Mammutprojekt den Deutschen Buchpreis verliehen. Im renommierten Reclam-Verlag erschien 2019 die 6. Auflage. “Ich wäre aus damaliger Sicht durchaus zufrieden gewesen mit ein paar hundert Lesern und einem Dutzend freundlicher Feedbacks”, sagt die Übersetzerin bescheiden. “Einen Erfolg hätte ich nie erwartet.” Vor allem wollte sie, dass “chinesische Literatur aus dem “Sinologie-Käfig” herauskommt und “zu einem selbstverständlichen Bestandteil der Weltliteratur wird“, sagt sie heute.
Der Epos, der die Reisegeschichte eines Mönchs mit chinesischen Volkssagen und Themen des Buddhismus und Daoismus verquickt, gehört nicht nur zum Kanon der vier klassischen Romane Chinas, sondern ist in ganz Ostasien ein fundamentaler Bestandteil der Populärkultur. Filme, Computerspiele und Mangas wie “Dragonball” basieren auf dem Werk. Den Affenkönig Sun Wukong kennt jedes Kind. Der strahlende Held mit den vielen Charakterschwächen ist auch Eva Lüdi Kongs Lieblingsfigur aus dem Roman. “Er ist der freie Geist, der kompromisslos zu sich selbst steht. So verkörpert er auch eine heimliche Sehnsucht, die sich durch die ganze Geschichte Chinas zieht: die Sehnsucht, sich nicht unterwerfen zu müssen. In der streng hierarchisch geordneten Gesellschaft war das faktisch kaum möglich – es sei denn bei offenen Rebellionen”.
Das Gewissen des Individuums ist ein Thema, das Lüdi Kong auch nach dem Abschluss ihrer großen Übersetzungsarbeit weiter beschäftigt. Seit Ende 2019 arbeitet sie an einer Sammlung von Textzeugnissen, die von der Antike bis in die Ming-Dynastie das Thema “Herrschaft und Dissens in China” anhand von historischen Dokumenten untersuchen. “Die Texte stammen von berühmten Persönlichkeiten wie Qu Yuan, Sima Qian oder Ji Kang und zeugen von großer Aufrichtigkeit im Wunsch nach Verbesserung der sozialen Gerechtigkeit.”
Gerade das Einstehen für menschliche Werte habe diese historischen Persönlichkeiten zu Opfern intriganter Ränkespiele im herrschenden Machtgefüge gemacht, resümiert Lüdi Kong. “Sie hätten sich konform verhalten und sich vor der Autorität ducken können, um ungeschoren davonzukommen. Doch sie entschieden sich dafür, der Stimme ihres Gewissens zu folgen. Der unglaubliche Mut, bei allen Repressionen zu sich selbst zu stehen, hat ihnen zu allen Zeiten große Verehrung eingebracht.”
Während ihrer Arbeit an den Texten brach in Wuhan das Corona-Virus aus. Ärzte und andere Whistleblower standen nun ebenfalls vor der Wahl, mit unliebsamen Wahrheiten an die Öffentlichkeit zu gehen oder sie für sich zu behalten. Nachdem einige per Anordnung zum Schweigen gebracht oder gar verhaftet wurden, dämmerte Lüdi Kong, dass sich die Geschichte vor ihren Augen wiederholte. “Die Parallelen zu den alten Texten waren faszinierend”, sagt sie. “Das Einstehen einiger mutiger Persönlichkeiten für Offenheit, für soziale Verbesserungen und Gerechtigkeit drückte dieselbe Haltung aus wie sie aus den alten Schriftzeugnissen spricht.”
Aus dem Gefühl, diesen Stimmen Gehör zu verschaffen, erstellte Lüdi Kong nebenbei einen YouTube-Kanal mit dem Titel “Chinas freie Stimmen”. Dort übersetzt sie kritische Zwischenrufe aus China, etwa jenen der Professorin Cai Xia oder des vom Staat geächteten Kampfsportlers Xu Xiaodong, ins Deutsche. “Man kommt mit so einer Arbeit an eine unsichtbare Grenze, an der man früher oder später genau dieselbe Entscheidung treffen muss, die bereits Qu Yuan formuliert hat”, räumt Lüdi Kong ein: “Soll ich ohne Vorbehalte sagen, was ich denke, obschon ich mich damit in Gefahr bringe?”
Auch die europäische Politik stünde vor ähnlichen Fragen, sagt Lüdi Kong, die seit 2016 wieder in der Schweiz lebt: “Sollen wir lieber schweigend über Missstände hinwegsehen, um uns den Marktzugang nicht zu verderben?” Den Begriff “Dissident” mag die studierte Sinologin dennoch nicht, weil er bestimmte Persönlichkeiten wie Ai Weiwei überdimensioniert habe. Für sie geht es in ihrer Arbeit auch nicht vornehmlich um Kritik am chinesischen Staat, sondern eine kritische Reflexion der chinesischen Kultur, um die wir heute nicht mehr herumkommen. Fabian Peltsch
Allen Lee wird einer der CEOs von Shanghai Biren Intelligent Technology, einem Entwickler von KI-Chips. Das Unternehmen hat Lee von der chinesischen Forschungsabteilung des US-Chipherstellers AMD abgeworben. Lee hatte 19 Jahre lang für AMD gearbeitet.
Zheng Shaoping tritt als Chairman von Antong Holdings 安通控股, einem Logistik-Dienstleister, zurück. Der 58-jährige ist weiterhin Chairman von mehreren Firmen aus der Frachtbranche, darunter Shanghai Port, China Merchants Port Holding oder Ningbo Zhoushan Port.

In Shanghai hat es am Montag geregnet. Kein Starkregen, aber ein kräftiger Sommerregen mit örtlichen Gewittern. Während in Deutschland ebenfalls wieder Tiefdruckgebiete mit reichlich Niederschlag durchziehen, zeigt das Wetter-Radar auch in Ostasien wieder mehr Regenfelder.
der Rückzug aus Afghanistan hat sich zur Katastrophe entwickelt und offenbart die Defizite der amerikanischen Zentralasien-Politik. Auch Deutschland als Bündnispartner hängt tief mit drin in dem Desaster. Das große Nachbarland China wiederum brüstet sich, den Verlauf der Ereignisse vorausgesehen und die Stärke der Taliban realistisch eingeschätzt zu haben. Amerikas Niedergang beginnt nun in Afghanistan – so sieht es Peking.
Zwar will auch China kein Emirat der Taliban als Nachbarn, ist aber in der Region auf jeden Fall besser vernetzt als die USA. Und: Peking legt in der Außenpolitik rein pragmatische Maßstäbe an. Die Nichteinmischung, die das Land von anderen verlangt, praktiziert es seinerseits in Afghanistan. Wenn die Taliban faktisch regieren, dann sieht die chinesische Außenpolitik sie eben als Herrscher des Landes an. Welche unheilvolle Botschaft China aus diesen Ereignissen für Taiwan ableitet, analysiert Michael Radunski.
Der Pragmatismus der chinesischen Politik bedeutet zugleich, im Handelskrieg mit den USA hart zu bleiben. Konkret bewirkt das eine Blockade für die potenziell größte Übernahme in der Halbleiterbranche. Der amerikanische Chip-Hersteller Nvidia will den britischen Chipdesign-Dienstleister ARM kaufen. China ist aber strikt dagegen: Die Konzentration in der westlichen Halbleiterbranche gefährdet die Belieferung von Elektroriesen wie Huawei. Und Peking hat durchaus Mitspracherecht, schließlich müssen Kartellbehörden auf allen Kontinenten zustimmen.

Hu Xijin kann am Montag seine Freude kaum verbergen. “Chinesische Internetnutzer machen Witze darüber, dass die Machtübergabe in Afghanistan sogar noch reibungsloser abläuft als die Übergabe der Präsidentschaft in den Vereinigten Staaten”, twittert der Chefredakteur der chinesischen Zeitung Global Times.
Genüsslich verweist seine Zeitung auf zynische Kommentare, die auf Online-Plattformen wie Sina Weibo zu lesen sind: “Der 20-jährige Krieg endet wie ein Witz. Amerikanische Soldaten sind für nichts gestorben, die Taliban sind zurück und der einzige Unterschied ist, dass noch mehr Menschen gestorben sind und die amerikanischen Steuerzahler ihr Geld verschwendet haben.” An anderer Stelle heißt es: “Jene Menschen, die noch immer an die USA glauben, werden nie ihre Lektion lernen. Sie wurden von den Amerikanern zurückgelassen wie Müll.“
Der offizielle Meinungsartikel der Global Times verspottete die USA derweil als “Papiertiger”. “Ein Land so mächtig wie die USA kann in 20 Jahren nicht einmal die afghanischen Taliban besiegen, die von außen so gut wie keine Hilfe erhalten haben.” Und so kommen die Redakteure zu dem Schluss: “Die Niederlage der USA ist eine klarere Demonstration ihrer Hilflosigkeit, als es der Vietnam-Krieg je war – die USA sind in der Tat ein Papiertiger.”
Die aktuellen Entwicklungen in Afghanistan nähren diese Sichtweise. In Windeseile erobern die Taliban das ganze Land, die von den USA ausgerüsteten und trainierten Regierungstruppen leisten kaum Widerstand. Während US-Hubschrauber vom Dach der amerikanischen Botschaft in Kabul das diplomatische Personal retten, versuchen am Flughafen Tausende Menschen verzweifelt, einen Platz in einem der wenigen Evakuierungsflüge zu bekommen. Derweil tauchen aus den von den Taliban eroberten Gebieten schon erste Meldungen auf, die von Vergeltungsmorden und anderen brutalen Praktiken der Taliban berichten.
In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchten die USA, sich der Unterstützung Chinas im Umgang mit den Taliban zu versichern. In einem Telefonat hat US-Außenminister Antony Blinken die Möglichkeiten ausgelotet, doch noch eine “weiche Landung” Afghanistans herbeizuführen. China hat das nicht rundheraus abgelehnt, verlangte als Gegenleistung jedoch Zugeständnisse in der Handelspolitik. Beide Seiten waren sich jedoch einig, dass eine humanitäre Katastrophe zu vermeiden sei.
Angesichts dieser dramatischen Lage liegt Chinas Priorität als direktes Nachbarland darauf, wieder Stabilität in Afghanistan herzustellen – und dabei vor allem im Wakhan-Korridor. Dabei handelt es sich um einen schmalen Landstrich in der Provinz Badakhshan im Nordosten Afghanistans. Dieser verbindet die chinesische Region Xinjiang mit Afghanistan. Er ist daher die für China die strategisch wichtigste Region des Landes.
Einem UN-Bericht zufolge sind in dieser Region mehrere Hundert uigurische Kämpfer aktiv, weshalb Peking jahrelang eng mit der Regierung in Kabul zusammenarbeitete und dabei half, eine spezielle Brigade aufzubauen, um die Sicherheit in jenem Grenzgebiet zu steigern. Dass es sich für China darbei allerdings nur um eine rein pragmatische Zusammenarbeit handelte, wird in diesen Wochen deutlich: Kaum verliert die Regierung in Kabul ihre Macht, spricht Peking eben mit den Taliban.
So traf sich Chinas Außenminister Wang Yi vor nicht einmal drei Wochen in Tianjin mit einer Delegation der Taliban unter Führung von Mullah Abdul Ghani Baradar. Wang ließ sich dabei explizit zusichern, dass die Taliban den uigurischen Kämpfern oder anderen Gruppen nicht mehr erlauben, sich nach Afghanistan zurückzuziehen oder von afghanischem Boden aus Anschläge gegen China zu planen und durchzuführen.
Bemerkenswert ist der Zeitpunkt jenes Treffens: Es fand noch vor Beginn der großen Taliban-Offensive statt. In jenen Tagen schickten die radikalen Islamisten etliche Delegationen in die angrenzenden Nachbarländer. Doch weder in Russland noch im Iran wurden sie derart glamourös und ranghoch empfangen wie von China. (China.Table berichtete).
Chinas Staatsmedien publizierten schon fast freundschaftlich anmutende Fotos, die Außenminister Wang Yi Schulter an Schulter neben den Vertretern der radikal-islamischen Bewegung zeigen. Im Nachhinein scheint es, als wollte man damit die eigene Bevölkerung behutsam auf das immer wahrscheinlicher werdende Szenario vorbereiten, dass Peking in nicht allzu ferner Zukunft die Taliban als legitimes Regime in Afghanistan anerkennen werde.
Damals noch waren die Geheimdienste der USA fest überzeugt, dass nach dem angekündigten Rückzug der US-Truppen die afghanische Regierung die rivalisierenden Taliban mindestens sechs Monate unter Kontrolle halten würden. China war deutlich besser informiert: Hinter vorgehaltener Hand wurde im Außenministerium in Peking schon damals erzählt, dass der Siegeszug der Taliban unmittelbar bevorstehe.
Und so war China deutlich besser auf den Vormarsch der Taliban vorbereitet als die USA und ihre westlichen Verbündeten. Während sie in höchster Not und vollkommen unvorbereitet am Montag ihre Botschaften evakuierten, kündigte Chinas diplomatische Vertretung in Kabul an, man werden selbstverständlich die Botschaft geöffnet lassen und wie gewohnt die Arbeit fortsetzen.
Beobachter sehen hier die Fortsetzung einer Politik, die sich schon länger abgezeichnet hat. “Die Volksrepublik arbeitet seit Jahren daran, gute Beziehungen zu den Taliban aufzubauen”, sagt Regionalexpertin Vanda Felbab-Brown von der Brookings Institution in Washington im Gespräch mit dem China.Table. Über verdeckte Kanäle habe Peking die Gotteskrieger regelrecht hofiert, erklärt die Wissenschaftlerin. Das zahlt sich nun aus.
Chinas Außenministerium erklärte am Montag, man sei zu “freundlichen Beziehungen” mit den neuen Machthabern in Afghanistan bereit. “China respektiert das Recht des afghanischen Volkes, unabhängig sein eigenes Schicksal zu entscheiden und ist bereit, freundliche und kooperative Beziehungen mit Afghanistan” zu unterhalten, sagte Außenamtssprecherin Hua Chunying in Peking.
Geht es nach Peking, soll es bei diesen freundlichen Beziehungen vor allem um wirtschaftliche Aspekte gehen. Schon heute ist China größter Auslandsinvestor im Land, man finanziert unter anderem die Öl- und Gasförderung. Darüber hinaus versucht Peking schon seit einiger Zeit, Afghanistan in sein Prestige-Projekt der Neuen Seidenstraße einzubinden. Eine Autobahn Peshawar-Kabul könnte eine wichtige Lücke in dem Infrastrukturprojekt schließen, doch bislang scheiterten Pekings Pläne, da Kabul die Entscheider in Washington nicht verprellen wollte.
Im Wakhan-Korridor baut Peking bereits mehrere Straßen. So würde man Xinjiang mit Afghanistan verbinden, von wo aus Waren und Güter über Pakistan nach Zentralasien – und schließlich Europa geliefert werden soll. “Wenn es Peking gelingt, diese Verbindungen aufzubauen, werden der Handel in der Region und die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen in Afghanistan drastisch zunehmen“, sagt Derek Grossman von der US-Denkfabrik Rand Corporation gegenüber China.Table. Experten zufolge soll Afghanistan über riesige Vorkommen an Seltenen Erden und weitere seltene Bodenschätze verfügen – Wert: mehr als eine Billion US-Dollar.
Doch Chinas wirtschaftliche Ambitionen haben klare Grenzen. So betonte die Global Times am Montag ausdrücklich, dass die Volksrepublik nicht die gleichen Fehler begehen werde, die in der Vergangenheit schon etliche Großmächte wie das britische Empire, die Sowjetunion und zuletzt die USA begangen haben: Truppen nach Afghanistan schicken. “China ist in einer relativ komfortablen Situation. Das Prinzip der Nichteinmischung in innere Angelegenheiten anderer Länder ist seit jeher das Leitprinzip der chinesischen Außenpolitik”, heißt es in der staatlichen Zeitung.
Auch Regionalbeobachter Zhang Junhua vom European Institute for Asian Studies in Brüssel stellt klar: “Peking wird sich nicht die Last aufbürden, sich tief in die afghanische Politik reinziehen zu lassen”, so der China-Experte gegenüber China.Table. Er sieht zwei mögliche Szenarien, wie Peking seinen Einfluss in Afghanistan erhöhen könnte – ohne in die Untiefen der nationalen Politik hineingezogen zu werden: über die Shanghai Security Organisation (SCO) oder über eine bilaterale Zusammenarbeit mit Russland.
Allerdings seien beide Optionen mit Schwierigkeiten verbunden. “Die Mitglieder der SCO verfolgen in Afghanistan sehr unterschiedliche Eigeninteressen”, erklärt Zhang. Vor allem Indien sei fest entschlossen, eine Zusammenarbeit der Taliban mit Pakistan und China unter allen Umständen zu verhindern. Delhi befürchte eine geopolitische Einkreisung. Das Problem an der bilateralen Lösung mit Russland ist laut Zhang, dass sich Russland trotz der aktuell guten Beziehungen mit China in Zentralasien nach wie vor als Vor- und Schutzmacht betrachte und dort den Einfluss Chinas möglichst gering halten wolle. Schnell wird klar: Wachsender Einfluss bedeutet für Peking auch neue Probleme.
Unter anderem deshalb grenzt sich China explizit vom Westen ab – und verzichtet bei seinen Plänen auf einen moralischen Werteüberbau, wie ihn die westlichen Verbündeten mit den Schlagworten Demokratie, Menschenrechte und freie Wahlen propagiert hatten.
Lin Minwang, Südasienexperte der Fudan-Universität in Shanghai, bringt Pekings Einstellung hinsichtlich der Taliban und der aktuellen Lage in Afghanistan treffend auf den Punkt: “Wir sind da ganz pragmatisch. Wie sie ihr Land regieren wollen, ist weitgehend ihre Sache”, sagte er der Nachrichtenagentur Reuters.
Ohnehin ist die Sicherheitslage in Afghanistan noch derart undurchsichtig, so dass Prognosen über die weitere Entwicklung schwierig sind. Wichtiger für die Strategen in Peking mag denn auch an diesem Tag ein anderer Punkt sein.
Schiebt man den ätzenden Zynismus und den beißenden Spott der Kommentarspalten zur Seite, wird der Blick frei auf eine andere, viel weitreichendere Botschaft, die in all den Zeilen mitschwingt und sich vor allem an Amerikas Verbündete richtet: Das Scheitern der US-Intervention in Afghanistan zeigt, dass der Führungsstärke Washingtons nicht mehr vertraut werden könne. Schon verweist die Global Times in diesem Zusammenhang auf Taiwan, wo man sich jetzt doch ernsthafte Sorgen machen sollte.
Es steht zu vermuten, dass nur wenige Einheizer im Dunstkreis der Global Times zu einer derart großen gedanklichen Akrobatik fähig sind, von den Ereignissen in Kabul eine direkte Verbindung nach Taipeh zu ziehen. Aber die dahinterstehende Botschaft ist klar und deutlich: Washingtons Sicherheitsgarantien zählen nichts mehr. Sollte sich diese Ansicht durchsetzen, würden die USA weit mehr verlieren als ihren Einfluss in Afghanistan.
Der wohl wichtigste Hightech-Deal des Jahres geht in die heiße Phase. Mit dem Ende der Brüsseler Sommerpause in zwei Wochen dürfte der US-Chiphersteller Nvidia die Übernahme des britischen Chipdesigners ARM bei der EU-Kommission zur wettbewerbsrechtlichen Prüfung anmelden. Zuvor könnte sich noch die britische Regierung äußern: Digitalminister Oliver Dowden wertet derzeit einen Bericht der Marktaufsicht CMA aus, der auch Folgen für die nationale Sicherheit des Vereinigten Königreichs beleuchtet. Doch scheitern wird das Großprojekt aller Wahrscheinlichkeit nach am Widerstand Chinas.
Doch warum ist Peking gegen den Deal? Chinesische Chiphersteller wie Hisilicon und SMIC nutzen ARM-Designs ebenso wie der Telekommunikationausrüster Huawei. Große Teil der Elektronikindustrie Chinas sind darauf angewiesen, Zugriff auf die IP-Rechte des Unternehmens zu haben. Eine Übernahme ARMs durch das US-Unternehmen Nvidia würde die Branche daher verwundbar machen für Tech-Sanktionen Washingtons. Die Behörden in China werden sich den Fall daher sehr genau anschauen.
Damit die Übernahme in allen Märkten wirksam werden kann, in denen bislang beide Unternehmen tätig sind, müssen die Kartellbehörden dort jeweils einzeln zustimmen. Auch eine Trennung nur vor Ort umgeht dieses international übliche Vorgehen nicht. China kann den Deal also blockieren – oder eine Entscheidung einfach aussitzen. Im März kommenden Jahres verstreicht eine wichtige Frist, nach der ein Abschluss der Übernahme als unwahrscheinlich gilt.
Prozessoren mit ARM-Technologie stecken in fast jedem Smartphone und vielen anderen Endgeräten. Die ARM-Designs sind effizient und stromsparend und daher gerade bei mobilen Anwendungen den Prozessoren von Intel und AMD überlegen. In Deutschland ist ARM trotzdem nur Wenigen ein Begriff; das Unternehmen hat hierzulande nur eine kleine Software-Tochter in der Nähe Münchens. Der Verkauf eines britischen Unternehmens durch den japanischen Eigner Softbank an den US-Konzern Nvidia scheint daher wiederum die Interessen Deutschlands und der EU kaum zu berühren. Doch der Eindruck täuscht:
China verdankt seine entscheidende Rolle auch einem Vertrag zwischen Nvidia und ARM-Verkäufer Softbank. Wenn die Genehmigungen im September 2022 noch ausstehen, dürfen Nvidia und ARM laut einer Übereinkunft beider Partner auch andere Optionen verfolgen. Falls China bis dahin nicht entscheidet, platzt der Deal also voraussichtlich.
Nvidia-CEO Jensen Huang wird auch gegenüber den Kartellbehörden viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, dass er den technischen Vorsprung von ARM-Entwicklungen nicht zuerst für eigene Nvidia-Produkte nutzt. “Das wäre eigentlich naheliegend für ein Unternehmen, das auf dem Gebiet originäre Geschäftsinteressen verfolgt”, sagt Kleinhans. Nvidia versucht, diese Bedenken zu zerstreuen und verspricht, “am offenen Lizenzmodell festzuhalten”. Sämtliche technischen Weiterentwicklungen würden den ARM-Lizenznehmern zur Verfügung gestellt, versicherte Huang, der gebürtiger Taiwaner ist.
Derzeit gibt es keinen Grund für Peking, sich für die Übernahme offen zu zeigen. Der neue US-Präsident Joe Biden hat die Handelspolitik seines Vorgängers nicht zurückgenommen, sondern sogar noch weitergetrieben (China.Table berichtete). Der Handelskrieg könnte sich noch lange hinziehen und in immer härtere Runden gehen.
Sämtliche chinesischen Akteure haben den Deal von Anfang an abgelehnt. “Die Regulatoren sollten ‘Nein’ zur Übernahme von ARM durch Nvidia sagen”, titelte die Staatszeitung “Global Times” im vergangenen Jahr. Das Staatsorgan zog dabei eine Verbindung zum US-Vorgehen gegen die Video-App Tiktok aus China. Dieses zeige, wie aggressiv die USA ihre Technik-Vorherrschaft verteidigten. Warum sollte Peking sich da willfährig zeigen?
Großbritannien, die Heimat von ARM, sucht derweil seit dem Brexit weltweit Handelsmöglichkeiten. China hat sich hier offensiv angeboten. Die Chancen, auch angesichts des Handelskrieg mit den USA weiter Geschäfte mit den Briten machen zu können und Zugriff auf ARM-Designs zu behalten, sind also hoch.
Und es gibt zudem ganz praktische Gründe für ein Nein Pekings: Da ARM und Nvidia bislang in verschiedenen Ländern zuhause sind, kann ARM seine Chip-Architekturen auch dort bereitstellen, wo Nvidia auf Druck der US-Behörden schon nicht mehr liefern darf. Auch der in China durchaus einflussreiche Mobilfunkausrüster und Handyhersteller Huawei hat sich deshalb gegen die Fusion ausgesprochen. Huawei nutzt Produkte des britischen Unternehmens: Der von Huawei auf breiter Front verwendete Kirin-Prozessor für Mobiltelefone basiert beispielsweise auf einem Chip-Design von ARM. Und Huawei wird durch die USA wie kaum ein anderes Unternehmen aus China von wichtigen Lieferketten ausgeschlossen.
Auch europäische Chiphersteller beobachten den Deal mit Argusaugen. Firmen wie Infineon und NXP hängen von ARM-IP ab. Experten halten es daher für unwahrscheinlich, dass die Kommission bereits in der ersten Prüfphase freigeben werde. Dafür seien klar zugeschnittene Zugeständnisse wie Verkäufe von Firmenteilen nötig, die in diesem Falle schwer zu erkennen seien, sagt ein Kartellrechtler, der sich nicht namentlich zitieren lassen will.
In der EU steht das Genehmigungsverfahren derweil noch am Anfang. Bislang haben die beiden Unternehmen den Deal noch nicht offiziell bei der EU-Kommission zur Prüfung angemeldet, wie eine Sprecherin der Behörde bestätigt. Dass sich die Pre-Notification-Phase so lange hinzieht, deutet darauf hin, dass die EU-Wettbewerbshüter bereits im Vorfeld ungewöhnlich viele Fragen übermittelt haben.
Peking und Brüssel könnten allerdings vor einem gemeinsamen Problem stehen: Der derzeitige Eigner Softbank will seine Anteile an ARM auf jeden Fall versilbern. Und derzeit ist vollkommen offen, ob ein anderer Käufer angenehmer als Nvidia sein würde. Till Hoppe/Finn Mayer-Kuckuk
Neue Regeln des Ministeriums für Industrie und Informationstechnik sehen vor, dass Autohersteller Rechenschaft über die Daten ablegen sollen, die ihre vernetzten Fahrzeuge sammeln. Das berichtet das Wirtschaftsportal Caixin. Die anstehende Verschärfung der Vorschriften gilt als Teil der groß angelegten Neuordnung der Technik-Branchen hin zu mehr Regelhaftigkeit. Ein zentraler Punkt ist dabei der Speicherort. Die Firmen müssen einen Antrag inklusive Begründung stellen, wenn die Kundendaten das Land verlassen sollen. Eine Genehmigung ist ebenfalls für jedes Software-Update nötig, das drahtlos aufgespielt wird. Ein weiterer Punkt: Statt des amerikanischen Ortungssystems GPS sollen die Autos mit dem chinesischen Gegenstück Beidou navigieren. fin
China hat einen leichten Anstieg der Arbeitslosenquote verzeichnet. Laut neuen Daten des Nationalen Statistikamtes in Peking legte sie im Juli von 5 Prozent auf 5,1 Prozent zu. Die Veränderung mag minimal erscheinen, doch Chinas Arbeitslosenzahl ist im Allgemeinen sehr stabil, weshalb Ökonomen auch auf kleine Ausschläge achten. Auch an der zweitgrößten Volkswirtschaft geht die Kombination aus Starkregen, immer neuen Runden der Pandemie und Störungen in der Containerlogistik nicht spurlos vorbei (China.Table berichtete).
Chinas Wirtschaft ist im Juli zwar weiter gewachsen – der Anstieg der Indikatoren ist jedoch unter den Erwartungen geblieben. So haben die Einzelhandelsumsätze um 8,5 Prozent zugelegt, während Analysten der Deutschen Bank ein Plus von 10,9 Prozent erwartet hatten. Auch die Industrieproduktion blieb mit einem Anstieg von 6,4 Prozent deutlich unter dem prognostizierten Wert von 7,9 Prozent. Die Deutsche Bank hat daher ihre Wachstumsvorhersage für das Gesamtjahr heruntergeschraubt. fin
In Nordostchina haben Regierungsbeamte im Zusammenhang mit Steuerermittlungen das Management einer der größten privaten Ölraffinerien Chinas übernommen. Ein Team unter der Leitung von Beamten der Stadt Panjin in Liaoning wurde zur Leitung der in finanziellen Schwierigkeiten steckenden Liaoning Bora Enterprise Group eingesetzt. Das Team versuche, Bora zu restrukturieren und damit einen Zusammenbruch zu verhindern, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf ungenannte informierte Quellen.
Die laufenden Ermittlungen wegen nicht gezahlter Steuern in großer Höhe könnten demnach zu hohen Geldstrafen für Bora und in der Folge einer Insolvenz führen. Bora besitzt eine Rohölverarbeitungskapazität von mehr als 20 Millionen Tonnen pro Jahr. Ein Zusammenbruch Boras würde aufgrund ihrer der Größe des Betriebs zu vielen Entlassungen führen und ein finanzielles Risiko auch für die Stadt Panjin selbst darstellen.
Derzeit läuft ein Crackdown gegen die vormals nur lasch regulierten privaten Raffinerien, die es neben Liaoning vor allem in der Küstenprovinz Shandong gibt. Die Stadt Panjin ist mittendrin: Gleich mehreren Firmen dort werden Steuerhinterziehung – etwa durch Missbrauch von Schlupflöchern – oder Verstöße gegen Umweltschutzvorschriften vorgeworfen. Auch in Shandong mussten die privaten Raffinerien Anfang des Monats geloben, alle Vorschriften strikt einzuhalten.
Private Raffinerien machen laut Bloomberg ein Viertel der gesamten Ölverarbeitungskapazität Chinas aus. Sie sind damit seit einer Liberalisierung des Sektors zu einer echten Konkurrenz der staatlichen Ölgiganten aufgestiegen. Die Zentralregierung kürzte dieses Jahr allerdings die Rohöl-Importquote der Privaten. Das könnte ihr Wachstum vorerst ausbremsen. ck
Der jüngste Corona-Ausbruch in China scheint aufgrund der strikten Kontrollmaßnahmen allmählich unter Kontrolle. Die Nationale Gesundheitskommission meldete am Montag noch 51 neue Fälle von Covid-19-Erkrankungen, darunter 13 lokale und 38 importierte Infektionen. Fälle ohne Symptome nahmen ebenfalls ab – es gab 17 importierte und drei lokale Fälle. Diese werden in China nicht als bestätigte Infektionsfälle eingestuft. Rätsel gaben am Wochenende derweil drei asymptomatische Fälle in Xinjiang auf: Die Betroffenen waren nach einem Bericht der China Daily während der vergangenen 14 Tage nicht außerhalb der Region gewesen und hatten auch keinen Kontakt zu Infizierten gehabt.
Der in Nanjing vor etwa einem Monat bemerkte Ausbruch der Delta-Variante hatte sich vor allem auf die Provinzen Jiangsu und Henan konzentriert. In diesen Regionen erließ die Regierung strenge Quarantäneregeln und testete bis heute mehr als 90 Millionen Menschen. Nach europäischen Maßstäben ist der Ausbruch ohnehin eher klein: Insgesamt infizierten sich in Jiangsu bisher 802 Menschen, davon mit 552 die meisten in der Yangtse-Stadt Yangzhou.
In Henan hat der Corona-Ausbruch derweil bereits personelle Konsequenzen nach sich gezogen. Fünf Beamte im betroffenen Landkreis Yucheng – darunter der stellvertretende Kreisleiter – wurden nach einem Bericht der South China Morning Post aufgrund von mangehafter Koordination der Seuchenbekämpfung ihres Amtes enthoben. In Henan liegen noch gut 200 Covid-Patient:innen im Krankenhaus. ck
Die Volksrepublik hat 286 Kooperationen mit ausländischen Universitäten beendet. Wie die South China Morning Post am Montag berichtete, stellte das Bildungsministerium eine Liste der beendeten Programme auf seine App. Betroffen sind renommierte Institutionen wie die City University London, die New York University und die University of Hong Kong. So endet beispielsweise nun das gemeinsame Bachelor-Programm für Mechanical Design and Automatisierung der Harbin University of Science and Technology und der City University London. Das Aus für die Programme sei im Rahmen einer routinemäßigen Bewertung der Kooperationsvereinbarungen erfolgt, so die Zeitung. Eine offizielle Begründung gab es demnach nicht.
Erst vor knapp einem Monat hatte Peking harte neue Regeln für private Bildungsunternehmen erlassen – die unter anderem keine Profite mehr erwirtschaften oder Investitionen aus dem Ausland annehmen dürfen (China.Table berichtete). Es gebe in der Volksrepublik daher Sorgen vor einem weitreichenden Vorgehen gegen den gesamten Bildungssektor, so die South China Morning Post in dem Artikel. Seit 2004 reguliert Peking chinesisch-ausländische Bildungskooperationen und prüft deren Inhalte. Immer wieder mal wurden seitdem Programme gestoppt. ck
´
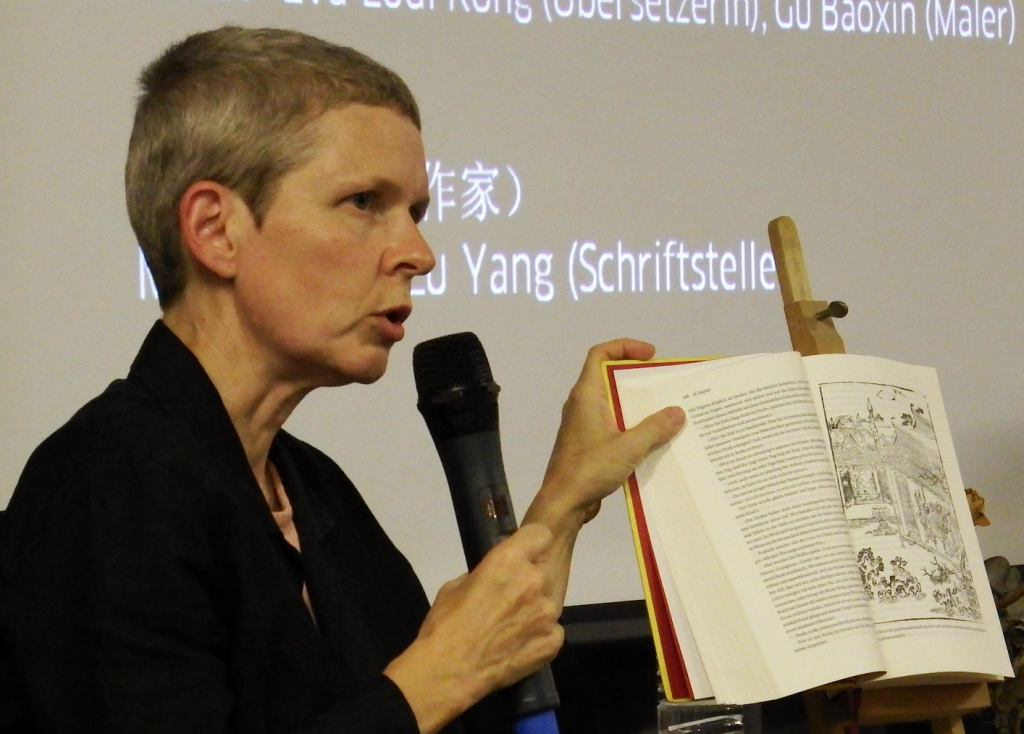
Ganze 17 Jahre arbeitete Eva Lüdi Kong an der deutschen Übersetzung von “Die Reise in den Westen”, einem der vier großen Klassiker der chinesischen Literatur. Für die Kultur Ostasiens war das Werk ähnlich wegweisend wie einst Dantes “Göttliche Komödie” für Europa. Wohl auch deshalb hatte es vor Lüdi Kong niemand gewagt, den epochalen Roman vollständig ins Deutsche zu übertragen. “Zu ambitioniert”, erklärten dann auch die Verlage, bei denen die heute 52-jährige Schweizerin anklopfte. Trotzdem arbeitete die Sinologin, die Anfang der 90er-Jahre im Alter von 21 erstmals nach China kam, unermüdlich weiter – einem Gefühl der “inneren Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit” folgend, wie sie sagt.
Neben ihrer Arbeit als Dolmetscherin und Universitäts-Dozentin im ostchinesischen Hangzhou fand Lüdi Kong sich immer wieder am Schreibtisch wieder, um den Helden des im 16. Jahrhundert niedergeschriebenen Romans nachzuspüren. “Wenn es möglich war, konnte ich tagelang daran sitzen und die Geschichten übersetzend miterleben. Abends hatte ich das Gefühl, einen unheimlich bewegten Tag hinter mir zu haben – bis ich merkte, dass sich ja alles nur im Buch abgespielt hatte.”
Im Jahr 2017 bekam Lüdi Kong für das 1.300 Seiten dicke Mammutprojekt den Deutschen Buchpreis verliehen. Im renommierten Reclam-Verlag erschien 2019 die 6. Auflage. “Ich wäre aus damaliger Sicht durchaus zufrieden gewesen mit ein paar hundert Lesern und einem Dutzend freundlicher Feedbacks”, sagt die Übersetzerin bescheiden. “Einen Erfolg hätte ich nie erwartet.” Vor allem wollte sie, dass “chinesische Literatur aus dem “Sinologie-Käfig” herauskommt und “zu einem selbstverständlichen Bestandteil der Weltliteratur wird“, sagt sie heute.
Der Epos, der die Reisegeschichte eines Mönchs mit chinesischen Volkssagen und Themen des Buddhismus und Daoismus verquickt, gehört nicht nur zum Kanon der vier klassischen Romane Chinas, sondern ist in ganz Ostasien ein fundamentaler Bestandteil der Populärkultur. Filme, Computerspiele und Mangas wie “Dragonball” basieren auf dem Werk. Den Affenkönig Sun Wukong kennt jedes Kind. Der strahlende Held mit den vielen Charakterschwächen ist auch Eva Lüdi Kongs Lieblingsfigur aus dem Roman. “Er ist der freie Geist, der kompromisslos zu sich selbst steht. So verkörpert er auch eine heimliche Sehnsucht, die sich durch die ganze Geschichte Chinas zieht: die Sehnsucht, sich nicht unterwerfen zu müssen. In der streng hierarchisch geordneten Gesellschaft war das faktisch kaum möglich – es sei denn bei offenen Rebellionen”.
Das Gewissen des Individuums ist ein Thema, das Lüdi Kong auch nach dem Abschluss ihrer großen Übersetzungsarbeit weiter beschäftigt. Seit Ende 2019 arbeitet sie an einer Sammlung von Textzeugnissen, die von der Antike bis in die Ming-Dynastie das Thema “Herrschaft und Dissens in China” anhand von historischen Dokumenten untersuchen. “Die Texte stammen von berühmten Persönlichkeiten wie Qu Yuan, Sima Qian oder Ji Kang und zeugen von großer Aufrichtigkeit im Wunsch nach Verbesserung der sozialen Gerechtigkeit.”
Gerade das Einstehen für menschliche Werte habe diese historischen Persönlichkeiten zu Opfern intriganter Ränkespiele im herrschenden Machtgefüge gemacht, resümiert Lüdi Kong. “Sie hätten sich konform verhalten und sich vor der Autorität ducken können, um ungeschoren davonzukommen. Doch sie entschieden sich dafür, der Stimme ihres Gewissens zu folgen. Der unglaubliche Mut, bei allen Repressionen zu sich selbst zu stehen, hat ihnen zu allen Zeiten große Verehrung eingebracht.”
Während ihrer Arbeit an den Texten brach in Wuhan das Corona-Virus aus. Ärzte und andere Whistleblower standen nun ebenfalls vor der Wahl, mit unliebsamen Wahrheiten an die Öffentlichkeit zu gehen oder sie für sich zu behalten. Nachdem einige per Anordnung zum Schweigen gebracht oder gar verhaftet wurden, dämmerte Lüdi Kong, dass sich die Geschichte vor ihren Augen wiederholte. “Die Parallelen zu den alten Texten waren faszinierend”, sagt sie. “Das Einstehen einiger mutiger Persönlichkeiten für Offenheit, für soziale Verbesserungen und Gerechtigkeit drückte dieselbe Haltung aus wie sie aus den alten Schriftzeugnissen spricht.”
Aus dem Gefühl, diesen Stimmen Gehör zu verschaffen, erstellte Lüdi Kong nebenbei einen YouTube-Kanal mit dem Titel “Chinas freie Stimmen”. Dort übersetzt sie kritische Zwischenrufe aus China, etwa jenen der Professorin Cai Xia oder des vom Staat geächteten Kampfsportlers Xu Xiaodong, ins Deutsche. “Man kommt mit so einer Arbeit an eine unsichtbare Grenze, an der man früher oder später genau dieselbe Entscheidung treffen muss, die bereits Qu Yuan formuliert hat”, räumt Lüdi Kong ein: “Soll ich ohne Vorbehalte sagen, was ich denke, obschon ich mich damit in Gefahr bringe?”
Auch die europäische Politik stünde vor ähnlichen Fragen, sagt Lüdi Kong, die seit 2016 wieder in der Schweiz lebt: “Sollen wir lieber schweigend über Missstände hinwegsehen, um uns den Marktzugang nicht zu verderben?” Den Begriff “Dissident” mag die studierte Sinologin dennoch nicht, weil er bestimmte Persönlichkeiten wie Ai Weiwei überdimensioniert habe. Für sie geht es in ihrer Arbeit auch nicht vornehmlich um Kritik am chinesischen Staat, sondern eine kritische Reflexion der chinesischen Kultur, um die wir heute nicht mehr herumkommen. Fabian Peltsch
Allen Lee wird einer der CEOs von Shanghai Biren Intelligent Technology, einem Entwickler von KI-Chips. Das Unternehmen hat Lee von der chinesischen Forschungsabteilung des US-Chipherstellers AMD abgeworben. Lee hatte 19 Jahre lang für AMD gearbeitet.
Zheng Shaoping tritt als Chairman von Antong Holdings 安通控股, einem Logistik-Dienstleister, zurück. Der 58-jährige ist weiterhin Chairman von mehreren Firmen aus der Frachtbranche, darunter Shanghai Port, China Merchants Port Holding oder Ningbo Zhoushan Port.

In Shanghai hat es am Montag geregnet. Kein Starkregen, aber ein kräftiger Sommerregen mit örtlichen Gewittern. Während in Deutschland ebenfalls wieder Tiefdruckgebiete mit reichlich Niederschlag durchziehen, zeigt das Wetter-Radar auch in Ostasien wieder mehr Regenfelder.
