durch die Aufkündigung des Getreideabkommens mit der Ukraine und Angriffen auf Hafenanlagen für den Export hat Moskau auch seinen bisher gewogenen Partner Peking düpiert. Die Ukraine ist traditionell ein wichtiger Agrarpartner für China. Das hat Russland offenbar nicht bedacht. Noch vor kurzem hatte Chinas stellvertretender Handelsminister seinen ukrainischen Amtskollegen in Peking empfangen, um über die Ausweitung der Getreideexporte nach China zu sprechen. Daraus wird nun erstmal nichts.
Die Stimmung dürfte in Peking also bescheiden sein, zumal China in diesem Jahr aufgrund von Wetterextremen einen erhöhten Bedarf an Getreide-Importen hat. Ob es durch die Vorgänge Risse in Chinas Beziehungen zu Russland geben wird, sei noch offen, schreibt Christiane Kühl. Bisher zeigt Peking zwar einen gewissen Ärger, aber keine harte Reaktion. Die Zeit läuft jedenfalls ab, um das Abkommen noch zu retten.
Unangenehm überrascht hat China auch der Tropensturm Doksuri. Teile Pekings stehen unter Wasser, Autos wurden von den Fluten mitgerissen. Menschen müssen mithilfe von Baggerschaufeln aus dem Schlamm gerettet werden. Solche brutalen Wetterphänomene werden die großen Städte in Zukunft häufiger heimsuchen, prophezeien Klimaforscher. Deshalb wird es immer wichtiger, schnellere Vorhersagen über Wetterumbrüche zu treffen. Künstliche Intelligenz könnte die bisherigen Modelle revolutionieren, schreibt Frank Sieren. Er hat sich “Pangu Weather”, eine neuartige, von Huawei Cloud entwickelte Vorhersage-Technologie genauer angesehen.


Seit dem 17. Juli stehen die Getreideterminals im Hafen von Odessa still. Russland hat seine Drohungen wahr gemacht und dieses Mal das Getreideabkommen tatsächlich auslaufen lassen, das der Ukraine die Ausfuhr von Weizen, Mais und anderen Produkten über das Schwarze Meer ermöglicht hatte.
Viele Augen richten sich nun auf China und die Türkei, den größten und drittgrößten Abnehmer ukrainischen Getreides aus dem abgelaufenen Abkommen. Beide haben großes Interesse daran, das Abkommen wieder in Kraft zu setzen. Doch bisher sind Versuche des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, seinen Amtskollegen Wladimir Putin zu erreichen, fehlgeschlagen. “Ich glaube, Putin vertraut Erdogan nicht mehr so sehr wie früher”, zitierte das Wall Street Journal den türkischen Ex-Diplomaten Gulru Gezer, der einst in Moskau stationiert war. Bislang hatte der türkische Präsident wie kein anderer zwischen den verfeindeten Seiten lavieren können.
Und China? Peking steht Russland näher als die Türkei, doch sind bisher keine chinesischen Versuche bekannt, Putin hinter den Kulissen umzustimmen. Immerhin forderte China ebenso wie die USA, die Vereinten Nationen und andere Russland öffentlich auf, zu dem Deal zurückzukehren. Man hoffe, dass das Abkommen wieder “vollständig” umgesetzt werde, teilte Peking mit. Staatsmedien berichteten mit demselben Tenor.
Bislang lässt sich aus dem wenigen, was aus China zu hören ist, keine finale Position erkennen. Hält China stoisch weiter zu Russland, obwohl es direkt negativ betroffen ist? Oder sind die mit dem Aus des Abkommens verbundenen Probleme und Kosten für Peking der eine Tropfen zu viel?
Chinas UN-Botschafter Geng Shuang betonte vor dem UN-Sicherheitsrat, dass der Deal angesichts seiner Bedeutung für die weltweite Ernährungssicherheit dringend wieder umgesetzt werden sollte. Seine Rede war gespickt mit den üblichen Floskeln, nur ein Satz ließ auf mögliche Verärgerung schließen: “Die Lage vor Ort in der Ukraine ist weiter eskaliert, und wichtige zivile Infrastrukturen wurden angegriffen”, so Geng. Moskaus Attacken auf ukrainische Anlagen zum Lebensmittelexport hätten Sorge über die weltweite Ernährungssicherheit ausgelöst, kritisiert sogar der Staatssender CGTN.
China ist trotz aller Bemühungen um Selbstversorgung auf Lebensmittel aus dem Ausland angewiesen; knapp ein Viertel des Getreides (24,2 Prozent) im Rahmen des Abkommen ging in die Volksrepublik. Russische Angriffe auf ukrainische Schwarzmeerhäfen direkt nach dem Aus des Abkommens hatten rund 60.000 Tonnen Getreide, die auf ein Schiff nach China verladen werden sollten, getroffen und teilweise zerstört. Das berichtete das Wall Street Journal unter Berufung auf den ukrainischen Getreidehändler Kernel, der die Ladung verkauft hatte. Bei einem Angriff auf Odessa wurde zudem das chinesische Generalkonsulat in der Stadt beschädigt. Ärger wäre also durchaus plausibel.
Das maßgeblich von der Türkei vermittelte Getreideabkommen war zudem einer der wenigen diplomatischen Erfolge seit Kriegsbeginn gewesen. Es ermöglichte der Ukraine seit 2022 die Ausfuhr von über 32 Millionen Tonnen Getreide. Im Gegenzug befreite es die russischen Agrar- und Düngemittelausfuhren von den Sanktionen der USA und der EU. Laut dem UN-Nahrungsmittelpreisindex sind die Lebensmittelpreise durch den Deal weltweit um 11,6 Prozent gesunken. Davon profitierte neben armen Entwicklungsländern vor allem China. Mit dem Aus des Abkommens schadet Moskau also seinem wichtigsten Partner.
Neben China sind vor allem Länder in Afrika und im Nahen Osten auf die ukrainischen Lebensmittelexporte angewiesen, darunter viele, zu denen Peking traditionell gute Beziehungen pflegt. Ob sich diese Länder zusammentun, um Moskau zum Einlenken zu drängen, ist ungewiss – aber nicht ausgeschlossen. Russland hat zwar angekündigt, dass es das entgangene ukrainische Getreide auf den Weltmärkten ersetzen werde. Auf einem kürzlichen Russland-Afrika-Gipfel hatte Putin die angereisten Spitzenpolitiker des Kontinents allerdings nicht wirklich überzeugen können, dass Russland die von ihm verschuldeten Probleme lösen werde.
Chinas alt-neuer Außenminister Wang Yi landete mitten in der Krise um das Abkommen in Ankara, um seinen Amtskollegen Hakan Fidan und Präsident Erdogan zu treffen. Über konkrete Inhalte der Gespräche ist nichts bekannt – wohl aber, dass man über das Getreideabkommen sprach.
Die Ukraine ist traditionell ein wichtiger Agrarpartner für China. So war das Land vor dem Krieg der wichtigste Maislieferant der Volksrepublik. 2016 baute die COFCO-Gruppe, Chinas größter Agrarkonzern, im Hafen von Mykolajiw am Schwarzen Meer einen Umschlagterminal für Getreide und Ölsaaten. 2017 stellten chinesische Ingenieure laut einer Studie der US-Denkfabrik Council on Foreign Relations (CFR) die Modernisierung des Hafens Yuzhny bei Odessa fertig, der für die Getreideexporte im Rahmen des Abkommens genutzt worden war. Das Getreide aus dem Abkommen sei China so wichtig, dass es den Deal sogar als separaten Punkt in seinen 12-Punkte-Friedensplan für die Ukraine aufgenommen habe, schreibt Alexandra Prokopenko vom Carnegie Russia Eurasia Center.
Noch vor kurzem hatte Chinas stellvertretender Handelsminister Ling Ji seinen ukrainischen Amtskollegen Taras Kachka in Peking empfangen, um über die Ausweitung der Getreideexporte nach China zu sprechen. Kachka war der erste hochrangige Besucher aus dem angegriffenen Land seit Kriegsbeginn. China wolle in Zukunft mehr “hochwertige Produkte” aus der Ukraine importieren, erklärte Peking anschließend.
Nun muss China umdisponieren, so wie schon in den Monaten zwischen Kriegsbeginn und der Unterzeichnung des Abkommens. Damals habe China fast seinen gesamten Mais aus den USA bezogen, sagt Joseph Glauber vom International Food Policy Research Institute in Washington. “Ende 2022 dann änderte China seine Einfuhrbestimmungen, um Maiseinfuhren aus Brasilien zuzulassen. Das dürfte dazu beitragen, den nun erwarteten Rückgang der Einfuhren aus der Ukraine auszugleichen”, so Glauber zu Table.Media.
Russland exportiert kaum Mais, verfügt aber über Weizenreserven. “Es ist der weltgrößte Weizenexporteur, und China könnte russischen Weizen zur Verwendung als Tierfutter kaufen“, sagt Glauber. China verwende den Großteil seiner Weizenimporte als Tierfutter. Weitere potenzielle Futterlieferanten seien Kanada (Gerste und Weizen), Argentinien (Mais und Weizen), Australien (Gerste und Weizen) und wiederum die USA (Mais, Hirse, Weizen).
China hat aufgrund von Wetterextremen möglicherweise bald einen erhöhten Bedarf an Importen. Auf eine lange Hitzewelle folgten Starkregen und gerade erst der Taifun Doksuri. “In Teilen Nord- und Zentralchinas haben die Setzlinge aufgrund der Hitzewellen seit Ende letzten Monats Anzeichen von schwachem Wachstum gezeigt, was die Herbsternte vor große Herausforderungen stellt”, warnte das Agrarministerium Anfang Juli. Das heißt, die Herbsternte ist in Gefahr – und die macht 75 Prozent von Chinas jährlicher Getreideproduktion aus. Schon die Ernte des Sommergetreides lag um 0,9 Prozent niedriger als im Vorjahr, was nach Angaben des Nationalen Statistikamts vor allem an anhaltenden Regenfällen direkt auf den reifen Weizen in der Kornkammer-Provinz Henan lag. Auch die Qualität könnte laut Glauber unter dem Regen gelitten haben.
Die Zeit läuft ab, um das Abkommen noch zu retten. Bisher besteht Russland darauf, dass die staatliche Russische Landwirtschaftsbank wieder an das internationale Zahlungssystem SWIFT angeschlossen wird. Die UNO hat dagegen einen Kompromiss vorgeschlagen: Eine Tochtergesellschaft der Bank soll an das System angeschlossen werden.
Ab September wird sich die ukrainische Getreideernte in den Lagern stapeln. Alternative Exportrouten über Rumänien oder Polen sind logistisch schwierig und aufgrund unterschiedlicher Hygienevorschriften bürokratisch kompliziert, auch für China. Peking hat also eigentlich keine Zeit, auf eine ferne Lösung zu hoffen, sondern hätte allen Grund, selbst in Moskau aktiv zu werden.
Forscher von Huawei Cloud, einer Geschäftseinheit von Huawei in Shenzhen, haben eine auf Künstlicher Intelligenz basierende Wettervorhersage-Software namens “Pangu Weather” entwickelt, die eine 10.000 Mal höhere Geschwindigkeit bei mindestens gleicher Genauigkeit erreichen soll als die besten herkömmlichen Vorhersage-Methoden. Die Ergebnisse stünden demnach in Sekunden zur Verfügung.
Nature, eine der weltweit führenden Wissenschaftszeitschriften, veröffentlichte Anfang Juli die von Huawei-Forschern verfasste Studie zur Technologie hinter der nach einem mythologischen Wesen benannten “Pangu”-Technologie. Alle Beiträge der Zeitschrift werden von einem Team unabhängiger Wissenschaftler gegengecheckt, bevor sie für veröffentlichungswert befunden werden. Auch die US-amerikanische MIT Technology Review hat bereits über “Pangu” berichtet. Das führende Schweizer Fachmagazin Netzwoche spricht deshalb von einem “Ritterschlag für Huawei”. Und die ebenfalls deutschsprachige IT-Welt nennt die Software eine “bahnbrechende Leistung”.
Schnellere Vorhersagen gelten auch deshalb als wichtig, weil die Menschen im Zuge des Klimawandels immer häufiger von verheerenden Wetterumbrüchen überrascht werden können. “Die beeindruckende Genauigkeit und Zuverlässigkeit eröffnet gerade bei Extremwettersituationen und damit verbundenen Gefahrenlagen präzise Vorhersagen und eine bessere Vorbereitung”, so Lingxi Xie, leitender Forscher bei Huawei. Er räumt aber auch gleich die größte Schwäche seiner Entwicklung ein: Künstliche Intelligenz könne beispielsweise die Richtung von Taifunen sehr genau bestimmen, aber deren Intensität verlässlich vorauszusagen, sei noch schwierig. “Die KI tendiert dazu, extreme Wetterentwicklungen zu unterschätzen”, sagt Xie.
Immerhin: Im Mai 2023 habe Pangu die Zugbahn des Taifuns Mawar laut einer Pressemitteilung von Huawei fünf Tage vor seinem Eintreffen in den östlichen Gewässern Taiwans so präzise vorhergesagt wie nie zuvor. Mawar war neben dem immer noch wütenden Doksuri der stärkste tropischer Taifun der ersten Jahreshälfte.
Im direkten Wettbewerb mit einem der weltweit führenden konventionellen Wettervorhersage-Systeme – dem des European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), mit Sitz in England, Italien und Bonn -, habe das Huawei-Programm vor allem durch “seine unglaubliche Geschwindigkeit” gepunktet. Das ECMWF verfügt über das umfangreichste Wetterarchiv der Welt und über eines der größten Supercomputer-Systeme. Dass “Pangu-Weather” an das EZMW-Modell herankomme, sei beeindruckend, resümiert der Physiker Peter Dueben in der Neuen Zürcher Zeitung. Er ist als Koordinator für KI und Maschine Learning am ECMWF tätig. Seit gestern kann man “Pangu” auf der Webseite der ECMWF für zehn Tage kostenlos ausprobieren. Auch eine Vergleichsstudie steht auf der Website. Das Ergebnis in Bezug auf “Pangu”: “Sehr vielversprechend.”
Die “Pangu”-Forscher haben Wetterdaten aus 43 Jahren in einem Deep-Learning-Verfahren aufbereiten lassen, also historische Wetterdaten mit modernen Modellen verknüpft, die in Sekunden genaue Vorhersagen machen. Die bisher genutzten Verfahren brauchten dafür Stunden. Während sie Wetterparameter wie Luftdruck, Temperatur oder Windgeschwindigkeit eines nach dem anderen berechnen müssen, gelingt das dem neuen Verfahren gleichzeitig.
Laut Huawei laufe “Pangu Weather” auch bestens auf herkömmlichen Desktop-Computern. “Das bedeutet, dass jeder in der meteorologischen Gemeinschaft diese Modelle jetzt nach Belieben testen kann”, zitiert der Konzern einen wissenschaftlichen Gutachter von Nature. Einer, der das bereits gemacht hat und nicht an den Huawei-Forschungen beteiligt war, ist Oliver Fuhrer. Er ist der Chef der Abteilung für numerische Vorhersage bei MeteoSwiss, dem Schweizer Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie. Die MIT Technology Review zitiert ihn mit den Worten, “Pangu-Weather” sei “aufregend”, weil “es viel schneller ist” und in der Lage sei, “Entwicklungen vorherzusagen, die so nicht in den ursprünglichen Trainingsdaten angelegt waren”.
Natürlich ist Huawei nicht die einzige Forschungsinstitution, die sich damit beschäftigt, das Wetter in Zeiten des Klimawandels vorherzusagen. Auch Nvidias “FourcastNet” und “GraphCast” von Googles DeepMind gehören dazu. Die größte Schwäche von KI-Verfahren, die auf historischen Wetterdaten basieren, sieht Peter Dueben vom ECMWF im Klimawandel selbst. “Wenn das Eis der Arktis plötzlich verschwindet, weiß niemand, was ein Modell wie Huaweis ‘Pangu’ dann macht.” Denn mit diesen Daten sei es nicht trainiert worden. Die klimatischen Folgen lassen sich aber auch mit den konventionellen Modellen kaum präzise voraussagen. Dass die Folgen dramatisch werden, darf allerdings schon heute als sicher gelten.

Chinas Nordosten ist weiterhin stark von Regenfällen und dessen Folgen betroffen. Rund 9.000 Rettungskräfte sind nach dem verheerenden Unwetter der vergangenen Tage nach Zhuozhou in der Provinz Hebei entsandt worden. Zhuozhou liegt am Zusammenfluss mehrerer Flüsse und ist eine der am stärksten von Sturm Doksuri getroffenen Städte, da das Hochwasser laut staatlichen Medien flussabwärts wanderte und Wohngebiete überflutete. Die überflutete Fläche soll demnach mehr als doppelt so groß sein wie Paris, auch fast 650 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche sind betroffen.
Weitere Rettungsteams seien aus den benachbarten Provinzen Henan und Shanxi angereist, um bei den Aufräumarbeiten in Zhuozhou zu helfen, wie der staatliche Sender CCTV berichtete. Mindestens 20 Menschen sind in den überschwemmten Regionen ums Leben gekommen. Mehr als 134.000 Menschen mussten ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Die Provinzbehörden hielten am Mittwoch am Ausnahmezustand fest.
Mehrere chinesische Tech-Unternehmen sagten Spenden in Höhe von mehreren Hundert Millionen Yuan für Betroffene zu. So erklärte ByteDance am Mittwoch, dass der Konzern 100 Millionen Yuan (13,9 Millionen US-Dollar) spenden werde, um Katastrophenhilfe in überschwemmten Gebieten zu leisten. Das Unternehmen teilte zudem mit, es habe durch Hashtags und Livestreams in seiner Kurzvideo-App Douyin dabei geholfen, sieben vermisste Personen zu finden. Auch Tencent Holdings und der E-Commerce-Riese Alibaba kündigten Millionen-Spenden an. rtr
Mit einem Paket von Steuererleichterungen will die chinesische Regierung die unter den Corona-Nachwehen leidenden kleinen Unternehmen unterstützen. Betriebe mit einem monatlichen Umsatz von weniger als 100.000 Yuan (12.737 Euro) sollen für vier weitere Jahre von der Mehrwertsteuer befreit bleiben, wie das Finanzministerium ankündigt. Wer bislang einen Satz von drei Prozent auf steuerpflichtige Umsätze zahle, brauche künftig nur noch ein Prozent an den Fiskus abzuführen.
Auch will Peking die Finanzierung für kleinere Betriebe durch steuerliche Anreize erleichtern. Zinserträge aus Kleinstkrediten von Banken sollen ebenfalls bis Ende 2027 von der Mehrwertsteuer befreit werden, wie das Ministerium weiter ankündigte. Sie sollen für Unternehmen mit einem Kreditvolumen von höchstens zehn Millionen Yuan gelten. Zudem werden Start-ups aus der Technologie-Branche gefördert: Unternehmen mit nicht mehr als 300 Mitarbeitern und einem Bruttovermögen und Jahresumsatz von jeweils höchstens 50 Millionen Yuan sollen demnach bis Ende 2027 ebenfalls in den Genuss steuerlicher Vergünstigungen kommen.
Die Maßnahmen kommen einen Tag, nachdem Industrie- und Finanzministerium, Finanz- und Wertpapieraufsichtsbehörden sowie Zentralbank neue Hilfen für kleinere Unternehmen in Aussicht gestellt hatten. Peking hofft, auf diese Weise die schwächelnde Konjunktur anzukurbeln. rtr
Chinas Ausbau von Wind- und Solarenergie ist prozentual im ersten Halbjahr 2023 weitaus schneller gestiegen als die Produktion von fossilen Energieträgern. Das berichtete der Informationsdienst Carbon Brief am Dienstag unter Berufung auf die Nationale Energiebehörde (NEA) und Staatsmedien. Nach NEA-Daten sei die inländische Produktion von Rohkohle, Erdöl und Erdgas gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4,4 Prozent, 2,1 Prozent beziehungsweise. 5,4 Prozent gestiegen. In diesem Zeitraum habe der Zuwachs an installierter Kapazität erneuerbarer Energien landesweit um 98,3 Prozent höher gelegen als im Vorjahr. Insgesamt wurden zwischen Januar und Juni demnach 109 Gigawatt (GW) Kapazität neu installiert. Auch wenn es sich hier nicht um einen direkten Vergleich handelt, zeigen die Zahlen doch einen klaren Trend auf.
Laut NEA erreichte zudem die Nutzungsrate der installierten Windkraftkapazität im ersten Halbjahr landesweit 96,7 Prozent. Bei der Fotovoltaik lag die Quote bei 98,2 Prozent. In manchen Regionen wie Peking, Shanghai, Jiangsu oder Zhejiang werden sogar 100 Prozent der erneuerbaren Kapazitäten tatsächlich genutzt. Diese Quote war in früheren Jahren deutlich niedriger gewesen. Fortschritte meldete die NEA laut China Daily auch beim Aufbau von Energiespeichern für die Erneuerbaren. Im ersten Halbjahr habe die installierte Kapazität neu in Betrieb genommener Energiespeicherprojekte bei 8.630 GW gelegen und damit einen neuen Höchststand erreicht. Solche Speicher sind wichtig, um Energie für Tage vorzuhalten, an denen es wenig Wind oder Sonnenschein gibt. ck
Der Staatsrat hat am Montag den Bau von sechs neuen Kernkraftwerksblöcken genehmigt. Laut der staatlichen Zeitung China Daily handelt es sich dabei um Erweiterungen des Kernkraftwerks Ningde in der südostchinesischen Provinz Fujian, des Kernkraftwerks Shidao Bay in der ostchinesischen Provinz Shandong sowie des Kernkraftwerks Xudabu in der nordwestchinesischen Provinz Liaoning.
Es ist das erste Mal in diesem Jahr, dass die Regierung grünes Licht für neue Kernkraftprojekte gegeben hat. Presseberichten in China zufolge werden die Gesamtinvestitionen für die neuen Blöcke auf umgerechnet rund 15 Milliarden Euro geschätzt. Die vier neuen Blöcke in Ningde und Shidao Bay werden nach Angaben der China General Nuclear Power Group mit der Hualong One- oder HPR1000-Druckwasserreaktor-Technologie betrieben. Der Hualong One ist ein im Inland entwickelter Kernreaktor der dritten Generation. fpe
Chinas Cyberspace-Regulierungsbehörde CAC möchte den Smartphone-Konsum von Kindern generell beschränken. Die Behörde legte am Mittwoch Reformvorschläge für den Zugang zum Internet und die Nutzungszeit von Smartphones vor. Anbieter der Geräte sollen sogenannte Minor-Mode-Programme einführen, die Nutzern unter 18 Jahren zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr morgens den Zugriff auf das Internet verbieten.
Auch Nutzungsfristen für Smartphones waren Teil des Vorschlags: Nutzer im Alter von 16 bis 18 Jahren sollen zwei Stunden am Tag, Kinder im Alter von acht bis 16 Jahren eine Stunde und Kinder unter acht Jahren acht Minuten Nutzungszeit bekommen. Eltern sollen der Behörde zufolge jedoch ein Mitspracherecht haben und das Zeitlimit verändern können. Chinas Regierung arbeitet derzeit an verschiedenen Plänen, um gegen Suchtverhalten bei der Nutzung von Videospielen und smarten Devices bei Kindern vorzugehen. rtr
Seit Dienstag fliegt Air China wieder täglich zwischen München und der chinesischen Hauptstadt Peking. Das teilte der Münchner Flughafen mit. “Nach über drei Jahren Pause ist auch der letzte asiatische Langstrecken-Carrier nach der Pandemie wieder zum Münchner Flughafen zurückgekehrt”, heißt es in einer Pressemitteilung des “Franz Josef Strauß”-Flughafens.
Zum Einsatz kommen demnach Langstreckenflugzeuge vom Typ Boeing 777-300ER. Die Verbindung war am 23. März 2020 aufgrund der Corona-Pandemie eingestellt worden. Air China darf das Territorium Russlands überfliegen, was westlichen Airlines seit dem Ukraine-Krieg aufgrund gegenseitiger Sperren nicht möglich ist. Daher sind die Verbindungen mit chinesischen Airlines derzeit deutlich schneller als mit europäischen Carriern. Zum Comeback gab es bei der Ankunft und beim Abflug der Maschinen für alle Fluggäste Lebkuchenherzen. fpe
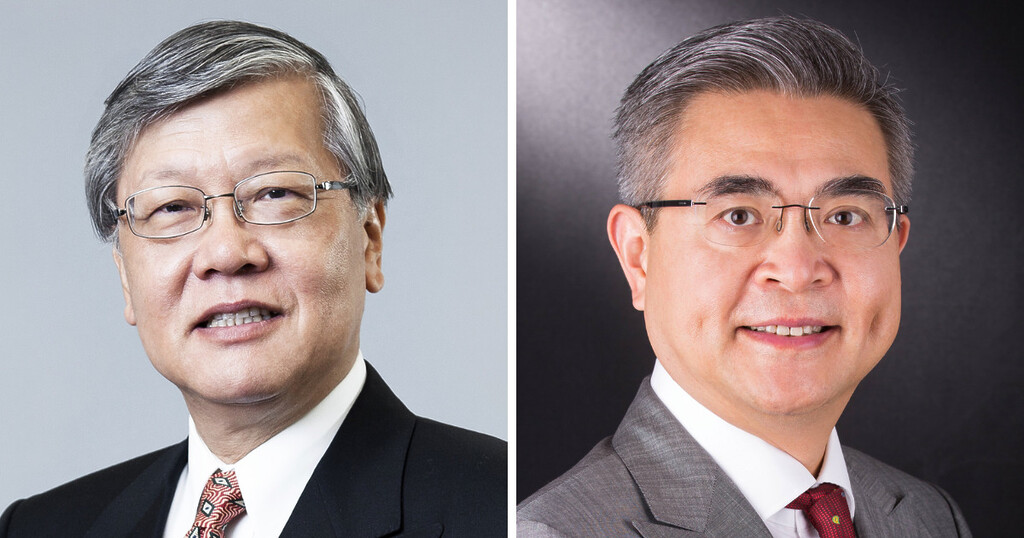
Werden die Vereinigten Staaten in der neuen Weltordnung an dritter Stelle stehen? So argumentiert der ehemalige Journalist Hugh Peyman in seinem neu erscheinenden Buch. Chinas Wirtschaft habe diejenige der USA in mancherlei Hinsicht bereits überholt, und bis Mitte des Jahrhunderts werde dies auch Indien gelingen. Außerdem meint er, “der Rest” (die anderen Länder) werde den Westen immer stärker herausfordern – und der Westen werde diese Länder weiterhin unterschätzen.
Peyman ist natürlich nicht der erste, der den Aufstieg von Ländern vorhersagt, die nicht dem geopolitischen Westen (einschließlich Japan) angehören. Bereits 2007 wusste der britische Ökonom Angus Maddison, dass Chinas BIP dasjenige der USA (kaufkraftbereinigt zu Dollarpreisen von 1990) bald überholen und Indien an die dritte Stelle aufrücken würde. Und die OECD schätzt, Indien werde die USA beim BIP bis 2050 überholen, und das gemeinsame BIP von China, Indien und Indonesien werde bis 2060 116,7 Billionen Dollar (49 Prozent der weltweiten Summe) betragen, was dem Dreifachen der US-Wirtschaft entspricht.
Dies käme nicht wirklich überraschend – insbesondere, weil in den nichtwestlichen Ländern viel mehr Menschen leben. Wie Peyman betont, haben China und Indien jeweils viermal so viel Einwohner wie die USA, also, selbst wenn sie nur ein Viertel des amerikanischen Pro-Kopf-Einkommens erwirtschaften, wäre ihr gemeinsames BIP doppelt so groß wie das der USA. Wie er es ausdrückt: “Die Bevölkerungszahl bestimmt, dass der Westen nur zehn Prozent und der Rest 90 Prozent ist.”
Sicherlich hat der Westen hinsichtlich seines BIP bereits häufiger oberhalb seiner Gewichtsklasse gekämpft. 1950 lebten dort (einschließlich Japan) nur 22,4 Prozent der Weltbevölkerung, aber es wurden 59,9 Prozent des weltweiten BIP erwirtschaftet. In Asien (ohne Japan) war dieser Wert nur 15,4 Prozent, obwohl dort 51,4 Prozent der Weltbevölkerung lebten.
Diese Diskrepanz kann unter anderem auf die Industrielle Revolution zurückgeführt werden, die dem Westen (gemeinsam mit der kolonialen Ausbeutung) erhebliche wirtschaftliche Vorteile verschafft hatte. 1820 war das Verhältnis noch viel ausgeglichener: Auf Asien (ohne Japan) fielen damals 65,2 Prozent der Weltbevölkerung und 56,4 Prozent des globalen BIP.
Mitte dieses Jahrhunderts wird allerdings die Bevölkerung des “Rests” 3,8-mal größer sein als diejenige des Westens (einschließlich Japan), und sein BIP wird 1,7-mal höher sein. Wie Peyman bemerkt, haben zunehmende Investitionen in diese restlichen Länder – nicht zuletzt im Ausbildungsbereich – eine wichtige Rolle dabei gespielt, die Produktivität zu steigern sowie die Produktion und das Einkommen auf globaler Ebene zu fördern.
Und solche Investitionen werden sich weiterhin lohnen. Das McKinsey Global Institute hat letztes Jahr prognostiziert, in der neuen multipolaren Weltordnung könnte die “Technologie in den Vordergrund des geopolitischen Wettbewerbs” rücken. Angesichts dessen, dass das Humankapital – gemeinsam mit der Governance – entscheidend dazu beiträgt, technologische Fortschritte in Produktivitätswachstum zu verwandeln, hat Asien einen Vorteil: Bis 2030 werden über 70 Prozent der Absolventen der MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) in den gesamten G20-Ländern auf diesem Kontinent leben. Allein in China werden es 35 Prozent sein, und in Indien 27 Prozent.
Außerdem mag “der Rest” bei den innovativsten Forschungsbereichen zwar im Rückstand liegen, aber er hat gezeigt, dass er mithilfe westlicher Innovationen Waren und Dienstleistungen für Endbenutzer produzieren kann. Peyman hat selbst in chinesischen Städten gelebt und chinesische Firmen untersucht. Diese Erfahrungen bringt er in seine Beschreibung des chinesischen Übergangs zur Modernität ein – eines Wandels, der in unterschiedlichem Maße auch in den anderen “restlichen” Ländern stattfindet. Für jede Warnung, China werde unter dem Gewicht einer schnell alternden Bevölkerung, überbordendem Autoritarismus, einem massiven Schuldenüberhang und langsamem Wachstum zusammenbrechen, gibt Peyman in seinem Buch ein Gegenbeispiel, wie das Land seine Größe, sein Unternehmertum und seine Innovationen erfolgreich dazu nutzt, seine Ziele und Interessen zu erreichen.
Leider, so beklagt sich Peyman, sind die USA immer noch “von ihrer Vormachtstellung geblendet”, was sie “ihren Machtverlust nur langsam erkennen” lässt. Tatsächlich scheinen die meisten Westler davon auszugehen, der “Rest” sei in seiner Vielfalt so unterschiedlich, dass er die Länder, die die Weltordnung lang dominiert haben, nicht wirklich langfristig herausfordern könnte.
Aber Länder wie China, Indien, Indonesien, Singapur oder Südkorea haben bereits bewiesen, dass sie, wenn sie die Möglichkeit bekommen, hinsichtlich der Produktion, des Exports, der Infrastrukturinvestitionen und der Governance mindestens so kompetent sind wie viele ihrer westlichen Konkurrenten. Einige der größten Unternehmen im Westen werden von indischen Managern geführt. Und viele westliche Länder sind bei ihrem Versuch, “soziale Harmonie, allgemeinen Wohlstand und öffentliche Gesundheit zu Hause” zu erreichen, gescheitert.
Selbst wenn der Westen erkennt, dass er immer schwächer wird, wird der Anpassungsprozess laut Peyman nicht leicht sein. Angesichts dessen, dass die überwiegende Mehrheit der Weltbevölkerung in anderen Ländern lebt, werden diese ihren “Ausschluss von der globalen Entscheidungsfindung” nicht mehr länger akzeptieren. “Der Rest” will den Westen dabei nicht explizit ausschließen, aber er will sich entscheidend daran beteiligen, die – vom Westen aufgestellten – globalen Spielregeln für das einundzwanzigste Jahrhundert zu ändern.
Zum Schluss drängt Peyman US-Präsident Joe Biden und den chinesischen Präsidenten Xi Jinping (die Anführer des Westens und der “Restländer”), zu einer “großen Übereinkunft” zu kommen – ähnlich der von Richard Nixon und Mao Zedong Anfang der 1970er. Eine solche Übereinkunft würde die Zusammenarbeit bei den großen Problemen unserer Zeit – wie in erster Linie dem Klimawandel – verbessern und gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit verheerender Konflikte verringern.
Aber eine Übereinkunft muss es auch zwischen den Staaten, deren Macht wächst, und den Marktkräften geben, die immer schwächer werden. Finden auf unilateraler Basis plötzlich politische Veränderungen wie die Einführung oder Verschärfung von Sanktionen statt, wird dadurch die Geschäftstätigkeit von Privatunternehmen gestört und ihre Profitabilität untergraben. Um inmitten geopolitischer Spannungen die wirtschaftliche Dynamik beizubehalten, müssen die Regeln für Handel und Investitionen des privaten Sektors geklärt und respektiert werden – einschließlich der “roten Linien” im Bereich der nationalen Sicherheit. Das Land, das solche Regeln bereitstellen kann, wird die neue Weltordnung prägen, auch wenn es hinsichtlich BIP oder Bevölkerungszahl nicht das größte ist.
Aus dem Englischen von Harald Eckhoff
Andrew Sheng ist Distinguished Fellow am Asia Global Institute der Universität von Hongkong. Xiao Geng, ist Vorsitzender des Hongkong-Instituts für Internationales Finanzwesen und Professor und Direktor des Institute of Policy and Practice am Finance Institute der Chinesischen Universität von Hongkong in Shenzhen.
Copyright: Project Syndicate, 2023.
www.project-syndicate.org
James Chater wird neuer Ostasien-Korrespondent für die Deutsche Welle. Chater war zuvor unter anderem für Taiwan Plus News tätig. Er wohnt in Taipeh.
Liu Liehong ist offiziell als CEO und Vorstandsvorsitzender des staatlichen Kommunikationsunternehmens Unicom zurückgetreten. Bereits im Frühjahr war bekannt geworden, dass Liu neuer Chef der Nationalen Datenbehörde werden soll.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Um diese Tiere gibt es derzeit Diskussionen im chinesischen Social Web. Sind die Malaienbären im Zoo von Hangzhou echt – oder etwa doch nur gemeine Menschen in einem Kostüm? Anlass für den Verdacht waren die Bewegungen der Bären, die gerne sehr menschlich auf zwei Hintertatzen stehen. Der Zoo sah sich nun genötigt, in einem offiziellen Statement die wahre Bärenidentität zu bestätigen.
durch die Aufkündigung des Getreideabkommens mit der Ukraine und Angriffen auf Hafenanlagen für den Export hat Moskau auch seinen bisher gewogenen Partner Peking düpiert. Die Ukraine ist traditionell ein wichtiger Agrarpartner für China. Das hat Russland offenbar nicht bedacht. Noch vor kurzem hatte Chinas stellvertretender Handelsminister seinen ukrainischen Amtskollegen in Peking empfangen, um über die Ausweitung der Getreideexporte nach China zu sprechen. Daraus wird nun erstmal nichts.
Die Stimmung dürfte in Peking also bescheiden sein, zumal China in diesem Jahr aufgrund von Wetterextremen einen erhöhten Bedarf an Getreide-Importen hat. Ob es durch die Vorgänge Risse in Chinas Beziehungen zu Russland geben wird, sei noch offen, schreibt Christiane Kühl. Bisher zeigt Peking zwar einen gewissen Ärger, aber keine harte Reaktion. Die Zeit läuft jedenfalls ab, um das Abkommen noch zu retten.
Unangenehm überrascht hat China auch der Tropensturm Doksuri. Teile Pekings stehen unter Wasser, Autos wurden von den Fluten mitgerissen. Menschen müssen mithilfe von Baggerschaufeln aus dem Schlamm gerettet werden. Solche brutalen Wetterphänomene werden die großen Städte in Zukunft häufiger heimsuchen, prophezeien Klimaforscher. Deshalb wird es immer wichtiger, schnellere Vorhersagen über Wetterumbrüche zu treffen. Künstliche Intelligenz könnte die bisherigen Modelle revolutionieren, schreibt Frank Sieren. Er hat sich “Pangu Weather”, eine neuartige, von Huawei Cloud entwickelte Vorhersage-Technologie genauer angesehen.


Seit dem 17. Juli stehen die Getreideterminals im Hafen von Odessa still. Russland hat seine Drohungen wahr gemacht und dieses Mal das Getreideabkommen tatsächlich auslaufen lassen, das der Ukraine die Ausfuhr von Weizen, Mais und anderen Produkten über das Schwarze Meer ermöglicht hatte.
Viele Augen richten sich nun auf China und die Türkei, den größten und drittgrößten Abnehmer ukrainischen Getreides aus dem abgelaufenen Abkommen. Beide haben großes Interesse daran, das Abkommen wieder in Kraft zu setzen. Doch bisher sind Versuche des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, seinen Amtskollegen Wladimir Putin zu erreichen, fehlgeschlagen. “Ich glaube, Putin vertraut Erdogan nicht mehr so sehr wie früher”, zitierte das Wall Street Journal den türkischen Ex-Diplomaten Gulru Gezer, der einst in Moskau stationiert war. Bislang hatte der türkische Präsident wie kein anderer zwischen den verfeindeten Seiten lavieren können.
Und China? Peking steht Russland näher als die Türkei, doch sind bisher keine chinesischen Versuche bekannt, Putin hinter den Kulissen umzustimmen. Immerhin forderte China ebenso wie die USA, die Vereinten Nationen und andere Russland öffentlich auf, zu dem Deal zurückzukehren. Man hoffe, dass das Abkommen wieder “vollständig” umgesetzt werde, teilte Peking mit. Staatsmedien berichteten mit demselben Tenor.
Bislang lässt sich aus dem wenigen, was aus China zu hören ist, keine finale Position erkennen. Hält China stoisch weiter zu Russland, obwohl es direkt negativ betroffen ist? Oder sind die mit dem Aus des Abkommens verbundenen Probleme und Kosten für Peking der eine Tropfen zu viel?
Chinas UN-Botschafter Geng Shuang betonte vor dem UN-Sicherheitsrat, dass der Deal angesichts seiner Bedeutung für die weltweite Ernährungssicherheit dringend wieder umgesetzt werden sollte. Seine Rede war gespickt mit den üblichen Floskeln, nur ein Satz ließ auf mögliche Verärgerung schließen: “Die Lage vor Ort in der Ukraine ist weiter eskaliert, und wichtige zivile Infrastrukturen wurden angegriffen”, so Geng. Moskaus Attacken auf ukrainische Anlagen zum Lebensmittelexport hätten Sorge über die weltweite Ernährungssicherheit ausgelöst, kritisiert sogar der Staatssender CGTN.
China ist trotz aller Bemühungen um Selbstversorgung auf Lebensmittel aus dem Ausland angewiesen; knapp ein Viertel des Getreides (24,2 Prozent) im Rahmen des Abkommen ging in die Volksrepublik. Russische Angriffe auf ukrainische Schwarzmeerhäfen direkt nach dem Aus des Abkommens hatten rund 60.000 Tonnen Getreide, die auf ein Schiff nach China verladen werden sollten, getroffen und teilweise zerstört. Das berichtete das Wall Street Journal unter Berufung auf den ukrainischen Getreidehändler Kernel, der die Ladung verkauft hatte. Bei einem Angriff auf Odessa wurde zudem das chinesische Generalkonsulat in der Stadt beschädigt. Ärger wäre also durchaus plausibel.
Das maßgeblich von der Türkei vermittelte Getreideabkommen war zudem einer der wenigen diplomatischen Erfolge seit Kriegsbeginn gewesen. Es ermöglichte der Ukraine seit 2022 die Ausfuhr von über 32 Millionen Tonnen Getreide. Im Gegenzug befreite es die russischen Agrar- und Düngemittelausfuhren von den Sanktionen der USA und der EU. Laut dem UN-Nahrungsmittelpreisindex sind die Lebensmittelpreise durch den Deal weltweit um 11,6 Prozent gesunken. Davon profitierte neben armen Entwicklungsländern vor allem China. Mit dem Aus des Abkommens schadet Moskau also seinem wichtigsten Partner.
Neben China sind vor allem Länder in Afrika und im Nahen Osten auf die ukrainischen Lebensmittelexporte angewiesen, darunter viele, zu denen Peking traditionell gute Beziehungen pflegt. Ob sich diese Länder zusammentun, um Moskau zum Einlenken zu drängen, ist ungewiss – aber nicht ausgeschlossen. Russland hat zwar angekündigt, dass es das entgangene ukrainische Getreide auf den Weltmärkten ersetzen werde. Auf einem kürzlichen Russland-Afrika-Gipfel hatte Putin die angereisten Spitzenpolitiker des Kontinents allerdings nicht wirklich überzeugen können, dass Russland die von ihm verschuldeten Probleme lösen werde.
Chinas alt-neuer Außenminister Wang Yi landete mitten in der Krise um das Abkommen in Ankara, um seinen Amtskollegen Hakan Fidan und Präsident Erdogan zu treffen. Über konkrete Inhalte der Gespräche ist nichts bekannt – wohl aber, dass man über das Getreideabkommen sprach.
Die Ukraine ist traditionell ein wichtiger Agrarpartner für China. So war das Land vor dem Krieg der wichtigste Maislieferant der Volksrepublik. 2016 baute die COFCO-Gruppe, Chinas größter Agrarkonzern, im Hafen von Mykolajiw am Schwarzen Meer einen Umschlagterminal für Getreide und Ölsaaten. 2017 stellten chinesische Ingenieure laut einer Studie der US-Denkfabrik Council on Foreign Relations (CFR) die Modernisierung des Hafens Yuzhny bei Odessa fertig, der für die Getreideexporte im Rahmen des Abkommens genutzt worden war. Das Getreide aus dem Abkommen sei China so wichtig, dass es den Deal sogar als separaten Punkt in seinen 12-Punkte-Friedensplan für die Ukraine aufgenommen habe, schreibt Alexandra Prokopenko vom Carnegie Russia Eurasia Center.
Noch vor kurzem hatte Chinas stellvertretender Handelsminister Ling Ji seinen ukrainischen Amtskollegen Taras Kachka in Peking empfangen, um über die Ausweitung der Getreideexporte nach China zu sprechen. Kachka war der erste hochrangige Besucher aus dem angegriffenen Land seit Kriegsbeginn. China wolle in Zukunft mehr “hochwertige Produkte” aus der Ukraine importieren, erklärte Peking anschließend.
Nun muss China umdisponieren, so wie schon in den Monaten zwischen Kriegsbeginn und der Unterzeichnung des Abkommens. Damals habe China fast seinen gesamten Mais aus den USA bezogen, sagt Joseph Glauber vom International Food Policy Research Institute in Washington. “Ende 2022 dann änderte China seine Einfuhrbestimmungen, um Maiseinfuhren aus Brasilien zuzulassen. Das dürfte dazu beitragen, den nun erwarteten Rückgang der Einfuhren aus der Ukraine auszugleichen”, so Glauber zu Table.Media.
Russland exportiert kaum Mais, verfügt aber über Weizenreserven. “Es ist der weltgrößte Weizenexporteur, und China könnte russischen Weizen zur Verwendung als Tierfutter kaufen“, sagt Glauber. China verwende den Großteil seiner Weizenimporte als Tierfutter. Weitere potenzielle Futterlieferanten seien Kanada (Gerste und Weizen), Argentinien (Mais und Weizen), Australien (Gerste und Weizen) und wiederum die USA (Mais, Hirse, Weizen).
China hat aufgrund von Wetterextremen möglicherweise bald einen erhöhten Bedarf an Importen. Auf eine lange Hitzewelle folgten Starkregen und gerade erst der Taifun Doksuri. “In Teilen Nord- und Zentralchinas haben die Setzlinge aufgrund der Hitzewellen seit Ende letzten Monats Anzeichen von schwachem Wachstum gezeigt, was die Herbsternte vor große Herausforderungen stellt”, warnte das Agrarministerium Anfang Juli. Das heißt, die Herbsternte ist in Gefahr – und die macht 75 Prozent von Chinas jährlicher Getreideproduktion aus. Schon die Ernte des Sommergetreides lag um 0,9 Prozent niedriger als im Vorjahr, was nach Angaben des Nationalen Statistikamts vor allem an anhaltenden Regenfällen direkt auf den reifen Weizen in der Kornkammer-Provinz Henan lag. Auch die Qualität könnte laut Glauber unter dem Regen gelitten haben.
Die Zeit läuft ab, um das Abkommen noch zu retten. Bisher besteht Russland darauf, dass die staatliche Russische Landwirtschaftsbank wieder an das internationale Zahlungssystem SWIFT angeschlossen wird. Die UNO hat dagegen einen Kompromiss vorgeschlagen: Eine Tochtergesellschaft der Bank soll an das System angeschlossen werden.
Ab September wird sich die ukrainische Getreideernte in den Lagern stapeln. Alternative Exportrouten über Rumänien oder Polen sind logistisch schwierig und aufgrund unterschiedlicher Hygienevorschriften bürokratisch kompliziert, auch für China. Peking hat also eigentlich keine Zeit, auf eine ferne Lösung zu hoffen, sondern hätte allen Grund, selbst in Moskau aktiv zu werden.
Forscher von Huawei Cloud, einer Geschäftseinheit von Huawei in Shenzhen, haben eine auf Künstlicher Intelligenz basierende Wettervorhersage-Software namens “Pangu Weather” entwickelt, die eine 10.000 Mal höhere Geschwindigkeit bei mindestens gleicher Genauigkeit erreichen soll als die besten herkömmlichen Vorhersage-Methoden. Die Ergebnisse stünden demnach in Sekunden zur Verfügung.
Nature, eine der weltweit führenden Wissenschaftszeitschriften, veröffentlichte Anfang Juli die von Huawei-Forschern verfasste Studie zur Technologie hinter der nach einem mythologischen Wesen benannten “Pangu”-Technologie. Alle Beiträge der Zeitschrift werden von einem Team unabhängiger Wissenschaftler gegengecheckt, bevor sie für veröffentlichungswert befunden werden. Auch die US-amerikanische MIT Technology Review hat bereits über “Pangu” berichtet. Das führende Schweizer Fachmagazin Netzwoche spricht deshalb von einem “Ritterschlag für Huawei”. Und die ebenfalls deutschsprachige IT-Welt nennt die Software eine “bahnbrechende Leistung”.
Schnellere Vorhersagen gelten auch deshalb als wichtig, weil die Menschen im Zuge des Klimawandels immer häufiger von verheerenden Wetterumbrüchen überrascht werden können. “Die beeindruckende Genauigkeit und Zuverlässigkeit eröffnet gerade bei Extremwettersituationen und damit verbundenen Gefahrenlagen präzise Vorhersagen und eine bessere Vorbereitung”, so Lingxi Xie, leitender Forscher bei Huawei. Er räumt aber auch gleich die größte Schwäche seiner Entwicklung ein: Künstliche Intelligenz könne beispielsweise die Richtung von Taifunen sehr genau bestimmen, aber deren Intensität verlässlich vorauszusagen, sei noch schwierig. “Die KI tendiert dazu, extreme Wetterentwicklungen zu unterschätzen”, sagt Xie.
Immerhin: Im Mai 2023 habe Pangu die Zugbahn des Taifuns Mawar laut einer Pressemitteilung von Huawei fünf Tage vor seinem Eintreffen in den östlichen Gewässern Taiwans so präzise vorhergesagt wie nie zuvor. Mawar war neben dem immer noch wütenden Doksuri der stärkste tropischer Taifun der ersten Jahreshälfte.
Im direkten Wettbewerb mit einem der weltweit führenden konventionellen Wettervorhersage-Systeme – dem des European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), mit Sitz in England, Italien und Bonn -, habe das Huawei-Programm vor allem durch “seine unglaubliche Geschwindigkeit” gepunktet. Das ECMWF verfügt über das umfangreichste Wetterarchiv der Welt und über eines der größten Supercomputer-Systeme. Dass “Pangu-Weather” an das EZMW-Modell herankomme, sei beeindruckend, resümiert der Physiker Peter Dueben in der Neuen Zürcher Zeitung. Er ist als Koordinator für KI und Maschine Learning am ECMWF tätig. Seit gestern kann man “Pangu” auf der Webseite der ECMWF für zehn Tage kostenlos ausprobieren. Auch eine Vergleichsstudie steht auf der Website. Das Ergebnis in Bezug auf “Pangu”: “Sehr vielversprechend.”
Die “Pangu”-Forscher haben Wetterdaten aus 43 Jahren in einem Deep-Learning-Verfahren aufbereiten lassen, also historische Wetterdaten mit modernen Modellen verknüpft, die in Sekunden genaue Vorhersagen machen. Die bisher genutzten Verfahren brauchten dafür Stunden. Während sie Wetterparameter wie Luftdruck, Temperatur oder Windgeschwindigkeit eines nach dem anderen berechnen müssen, gelingt das dem neuen Verfahren gleichzeitig.
Laut Huawei laufe “Pangu Weather” auch bestens auf herkömmlichen Desktop-Computern. “Das bedeutet, dass jeder in der meteorologischen Gemeinschaft diese Modelle jetzt nach Belieben testen kann”, zitiert der Konzern einen wissenschaftlichen Gutachter von Nature. Einer, der das bereits gemacht hat und nicht an den Huawei-Forschungen beteiligt war, ist Oliver Fuhrer. Er ist der Chef der Abteilung für numerische Vorhersage bei MeteoSwiss, dem Schweizer Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie. Die MIT Technology Review zitiert ihn mit den Worten, “Pangu-Weather” sei “aufregend”, weil “es viel schneller ist” und in der Lage sei, “Entwicklungen vorherzusagen, die so nicht in den ursprünglichen Trainingsdaten angelegt waren”.
Natürlich ist Huawei nicht die einzige Forschungsinstitution, die sich damit beschäftigt, das Wetter in Zeiten des Klimawandels vorherzusagen. Auch Nvidias “FourcastNet” und “GraphCast” von Googles DeepMind gehören dazu. Die größte Schwäche von KI-Verfahren, die auf historischen Wetterdaten basieren, sieht Peter Dueben vom ECMWF im Klimawandel selbst. “Wenn das Eis der Arktis plötzlich verschwindet, weiß niemand, was ein Modell wie Huaweis ‘Pangu’ dann macht.” Denn mit diesen Daten sei es nicht trainiert worden. Die klimatischen Folgen lassen sich aber auch mit den konventionellen Modellen kaum präzise voraussagen. Dass die Folgen dramatisch werden, darf allerdings schon heute als sicher gelten.

Chinas Nordosten ist weiterhin stark von Regenfällen und dessen Folgen betroffen. Rund 9.000 Rettungskräfte sind nach dem verheerenden Unwetter der vergangenen Tage nach Zhuozhou in der Provinz Hebei entsandt worden. Zhuozhou liegt am Zusammenfluss mehrerer Flüsse und ist eine der am stärksten von Sturm Doksuri getroffenen Städte, da das Hochwasser laut staatlichen Medien flussabwärts wanderte und Wohngebiete überflutete. Die überflutete Fläche soll demnach mehr als doppelt so groß sein wie Paris, auch fast 650 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche sind betroffen.
Weitere Rettungsteams seien aus den benachbarten Provinzen Henan und Shanxi angereist, um bei den Aufräumarbeiten in Zhuozhou zu helfen, wie der staatliche Sender CCTV berichtete. Mindestens 20 Menschen sind in den überschwemmten Regionen ums Leben gekommen. Mehr als 134.000 Menschen mussten ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Die Provinzbehörden hielten am Mittwoch am Ausnahmezustand fest.
Mehrere chinesische Tech-Unternehmen sagten Spenden in Höhe von mehreren Hundert Millionen Yuan für Betroffene zu. So erklärte ByteDance am Mittwoch, dass der Konzern 100 Millionen Yuan (13,9 Millionen US-Dollar) spenden werde, um Katastrophenhilfe in überschwemmten Gebieten zu leisten. Das Unternehmen teilte zudem mit, es habe durch Hashtags und Livestreams in seiner Kurzvideo-App Douyin dabei geholfen, sieben vermisste Personen zu finden. Auch Tencent Holdings und der E-Commerce-Riese Alibaba kündigten Millionen-Spenden an. rtr
Mit einem Paket von Steuererleichterungen will die chinesische Regierung die unter den Corona-Nachwehen leidenden kleinen Unternehmen unterstützen. Betriebe mit einem monatlichen Umsatz von weniger als 100.000 Yuan (12.737 Euro) sollen für vier weitere Jahre von der Mehrwertsteuer befreit bleiben, wie das Finanzministerium ankündigt. Wer bislang einen Satz von drei Prozent auf steuerpflichtige Umsätze zahle, brauche künftig nur noch ein Prozent an den Fiskus abzuführen.
Auch will Peking die Finanzierung für kleinere Betriebe durch steuerliche Anreize erleichtern. Zinserträge aus Kleinstkrediten von Banken sollen ebenfalls bis Ende 2027 von der Mehrwertsteuer befreit werden, wie das Ministerium weiter ankündigte. Sie sollen für Unternehmen mit einem Kreditvolumen von höchstens zehn Millionen Yuan gelten. Zudem werden Start-ups aus der Technologie-Branche gefördert: Unternehmen mit nicht mehr als 300 Mitarbeitern und einem Bruttovermögen und Jahresumsatz von jeweils höchstens 50 Millionen Yuan sollen demnach bis Ende 2027 ebenfalls in den Genuss steuerlicher Vergünstigungen kommen.
Die Maßnahmen kommen einen Tag, nachdem Industrie- und Finanzministerium, Finanz- und Wertpapieraufsichtsbehörden sowie Zentralbank neue Hilfen für kleinere Unternehmen in Aussicht gestellt hatten. Peking hofft, auf diese Weise die schwächelnde Konjunktur anzukurbeln. rtr
Chinas Ausbau von Wind- und Solarenergie ist prozentual im ersten Halbjahr 2023 weitaus schneller gestiegen als die Produktion von fossilen Energieträgern. Das berichtete der Informationsdienst Carbon Brief am Dienstag unter Berufung auf die Nationale Energiebehörde (NEA) und Staatsmedien. Nach NEA-Daten sei die inländische Produktion von Rohkohle, Erdöl und Erdgas gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4,4 Prozent, 2,1 Prozent beziehungsweise. 5,4 Prozent gestiegen. In diesem Zeitraum habe der Zuwachs an installierter Kapazität erneuerbarer Energien landesweit um 98,3 Prozent höher gelegen als im Vorjahr. Insgesamt wurden zwischen Januar und Juni demnach 109 Gigawatt (GW) Kapazität neu installiert. Auch wenn es sich hier nicht um einen direkten Vergleich handelt, zeigen die Zahlen doch einen klaren Trend auf.
Laut NEA erreichte zudem die Nutzungsrate der installierten Windkraftkapazität im ersten Halbjahr landesweit 96,7 Prozent. Bei der Fotovoltaik lag die Quote bei 98,2 Prozent. In manchen Regionen wie Peking, Shanghai, Jiangsu oder Zhejiang werden sogar 100 Prozent der erneuerbaren Kapazitäten tatsächlich genutzt. Diese Quote war in früheren Jahren deutlich niedriger gewesen. Fortschritte meldete die NEA laut China Daily auch beim Aufbau von Energiespeichern für die Erneuerbaren. Im ersten Halbjahr habe die installierte Kapazität neu in Betrieb genommener Energiespeicherprojekte bei 8.630 GW gelegen und damit einen neuen Höchststand erreicht. Solche Speicher sind wichtig, um Energie für Tage vorzuhalten, an denen es wenig Wind oder Sonnenschein gibt. ck
Der Staatsrat hat am Montag den Bau von sechs neuen Kernkraftwerksblöcken genehmigt. Laut der staatlichen Zeitung China Daily handelt es sich dabei um Erweiterungen des Kernkraftwerks Ningde in der südostchinesischen Provinz Fujian, des Kernkraftwerks Shidao Bay in der ostchinesischen Provinz Shandong sowie des Kernkraftwerks Xudabu in der nordwestchinesischen Provinz Liaoning.
Es ist das erste Mal in diesem Jahr, dass die Regierung grünes Licht für neue Kernkraftprojekte gegeben hat. Presseberichten in China zufolge werden die Gesamtinvestitionen für die neuen Blöcke auf umgerechnet rund 15 Milliarden Euro geschätzt. Die vier neuen Blöcke in Ningde und Shidao Bay werden nach Angaben der China General Nuclear Power Group mit der Hualong One- oder HPR1000-Druckwasserreaktor-Technologie betrieben. Der Hualong One ist ein im Inland entwickelter Kernreaktor der dritten Generation. fpe
Chinas Cyberspace-Regulierungsbehörde CAC möchte den Smartphone-Konsum von Kindern generell beschränken. Die Behörde legte am Mittwoch Reformvorschläge für den Zugang zum Internet und die Nutzungszeit von Smartphones vor. Anbieter der Geräte sollen sogenannte Minor-Mode-Programme einführen, die Nutzern unter 18 Jahren zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr morgens den Zugriff auf das Internet verbieten.
Auch Nutzungsfristen für Smartphones waren Teil des Vorschlags: Nutzer im Alter von 16 bis 18 Jahren sollen zwei Stunden am Tag, Kinder im Alter von acht bis 16 Jahren eine Stunde und Kinder unter acht Jahren acht Minuten Nutzungszeit bekommen. Eltern sollen der Behörde zufolge jedoch ein Mitspracherecht haben und das Zeitlimit verändern können. Chinas Regierung arbeitet derzeit an verschiedenen Plänen, um gegen Suchtverhalten bei der Nutzung von Videospielen und smarten Devices bei Kindern vorzugehen. rtr
Seit Dienstag fliegt Air China wieder täglich zwischen München und der chinesischen Hauptstadt Peking. Das teilte der Münchner Flughafen mit. “Nach über drei Jahren Pause ist auch der letzte asiatische Langstrecken-Carrier nach der Pandemie wieder zum Münchner Flughafen zurückgekehrt”, heißt es in einer Pressemitteilung des “Franz Josef Strauß”-Flughafens.
Zum Einsatz kommen demnach Langstreckenflugzeuge vom Typ Boeing 777-300ER. Die Verbindung war am 23. März 2020 aufgrund der Corona-Pandemie eingestellt worden. Air China darf das Territorium Russlands überfliegen, was westlichen Airlines seit dem Ukraine-Krieg aufgrund gegenseitiger Sperren nicht möglich ist. Daher sind die Verbindungen mit chinesischen Airlines derzeit deutlich schneller als mit europäischen Carriern. Zum Comeback gab es bei der Ankunft und beim Abflug der Maschinen für alle Fluggäste Lebkuchenherzen. fpe
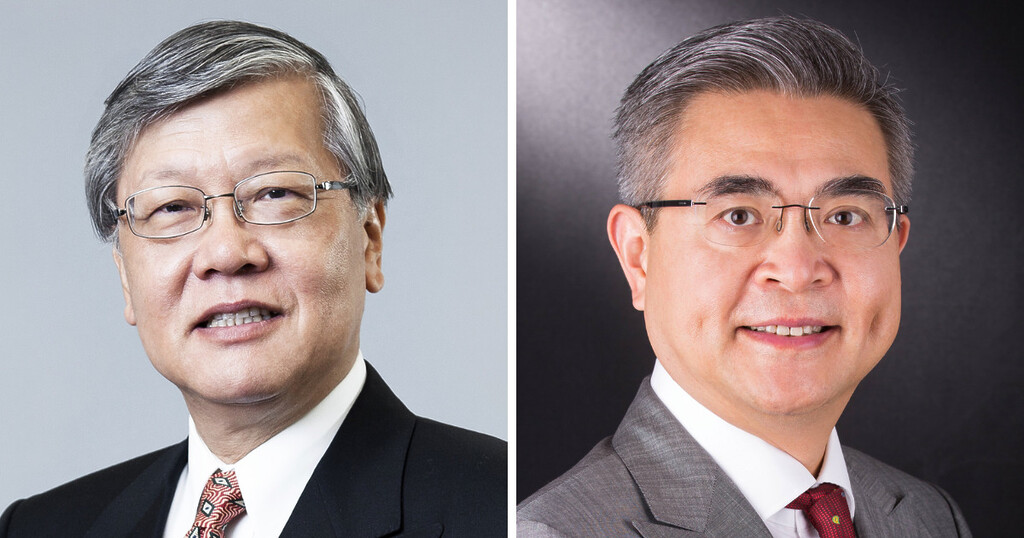
Werden die Vereinigten Staaten in der neuen Weltordnung an dritter Stelle stehen? So argumentiert der ehemalige Journalist Hugh Peyman in seinem neu erscheinenden Buch. Chinas Wirtschaft habe diejenige der USA in mancherlei Hinsicht bereits überholt, und bis Mitte des Jahrhunderts werde dies auch Indien gelingen. Außerdem meint er, “der Rest” (die anderen Länder) werde den Westen immer stärker herausfordern – und der Westen werde diese Länder weiterhin unterschätzen.
Peyman ist natürlich nicht der erste, der den Aufstieg von Ländern vorhersagt, die nicht dem geopolitischen Westen (einschließlich Japan) angehören. Bereits 2007 wusste der britische Ökonom Angus Maddison, dass Chinas BIP dasjenige der USA (kaufkraftbereinigt zu Dollarpreisen von 1990) bald überholen und Indien an die dritte Stelle aufrücken würde. Und die OECD schätzt, Indien werde die USA beim BIP bis 2050 überholen, und das gemeinsame BIP von China, Indien und Indonesien werde bis 2060 116,7 Billionen Dollar (49 Prozent der weltweiten Summe) betragen, was dem Dreifachen der US-Wirtschaft entspricht.
Dies käme nicht wirklich überraschend – insbesondere, weil in den nichtwestlichen Ländern viel mehr Menschen leben. Wie Peyman betont, haben China und Indien jeweils viermal so viel Einwohner wie die USA, also, selbst wenn sie nur ein Viertel des amerikanischen Pro-Kopf-Einkommens erwirtschaften, wäre ihr gemeinsames BIP doppelt so groß wie das der USA. Wie er es ausdrückt: “Die Bevölkerungszahl bestimmt, dass der Westen nur zehn Prozent und der Rest 90 Prozent ist.”
Sicherlich hat der Westen hinsichtlich seines BIP bereits häufiger oberhalb seiner Gewichtsklasse gekämpft. 1950 lebten dort (einschließlich Japan) nur 22,4 Prozent der Weltbevölkerung, aber es wurden 59,9 Prozent des weltweiten BIP erwirtschaftet. In Asien (ohne Japan) war dieser Wert nur 15,4 Prozent, obwohl dort 51,4 Prozent der Weltbevölkerung lebten.
Diese Diskrepanz kann unter anderem auf die Industrielle Revolution zurückgeführt werden, die dem Westen (gemeinsam mit der kolonialen Ausbeutung) erhebliche wirtschaftliche Vorteile verschafft hatte. 1820 war das Verhältnis noch viel ausgeglichener: Auf Asien (ohne Japan) fielen damals 65,2 Prozent der Weltbevölkerung und 56,4 Prozent des globalen BIP.
Mitte dieses Jahrhunderts wird allerdings die Bevölkerung des “Rests” 3,8-mal größer sein als diejenige des Westens (einschließlich Japan), und sein BIP wird 1,7-mal höher sein. Wie Peyman bemerkt, haben zunehmende Investitionen in diese restlichen Länder – nicht zuletzt im Ausbildungsbereich – eine wichtige Rolle dabei gespielt, die Produktivität zu steigern sowie die Produktion und das Einkommen auf globaler Ebene zu fördern.
Und solche Investitionen werden sich weiterhin lohnen. Das McKinsey Global Institute hat letztes Jahr prognostiziert, in der neuen multipolaren Weltordnung könnte die “Technologie in den Vordergrund des geopolitischen Wettbewerbs” rücken. Angesichts dessen, dass das Humankapital – gemeinsam mit der Governance – entscheidend dazu beiträgt, technologische Fortschritte in Produktivitätswachstum zu verwandeln, hat Asien einen Vorteil: Bis 2030 werden über 70 Prozent der Absolventen der MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) in den gesamten G20-Ländern auf diesem Kontinent leben. Allein in China werden es 35 Prozent sein, und in Indien 27 Prozent.
Außerdem mag “der Rest” bei den innovativsten Forschungsbereichen zwar im Rückstand liegen, aber er hat gezeigt, dass er mithilfe westlicher Innovationen Waren und Dienstleistungen für Endbenutzer produzieren kann. Peyman hat selbst in chinesischen Städten gelebt und chinesische Firmen untersucht. Diese Erfahrungen bringt er in seine Beschreibung des chinesischen Übergangs zur Modernität ein – eines Wandels, der in unterschiedlichem Maße auch in den anderen “restlichen” Ländern stattfindet. Für jede Warnung, China werde unter dem Gewicht einer schnell alternden Bevölkerung, überbordendem Autoritarismus, einem massiven Schuldenüberhang und langsamem Wachstum zusammenbrechen, gibt Peyman in seinem Buch ein Gegenbeispiel, wie das Land seine Größe, sein Unternehmertum und seine Innovationen erfolgreich dazu nutzt, seine Ziele und Interessen zu erreichen.
Leider, so beklagt sich Peyman, sind die USA immer noch “von ihrer Vormachtstellung geblendet”, was sie “ihren Machtverlust nur langsam erkennen” lässt. Tatsächlich scheinen die meisten Westler davon auszugehen, der “Rest” sei in seiner Vielfalt so unterschiedlich, dass er die Länder, die die Weltordnung lang dominiert haben, nicht wirklich langfristig herausfordern könnte.
Aber Länder wie China, Indien, Indonesien, Singapur oder Südkorea haben bereits bewiesen, dass sie, wenn sie die Möglichkeit bekommen, hinsichtlich der Produktion, des Exports, der Infrastrukturinvestitionen und der Governance mindestens so kompetent sind wie viele ihrer westlichen Konkurrenten. Einige der größten Unternehmen im Westen werden von indischen Managern geführt. Und viele westliche Länder sind bei ihrem Versuch, “soziale Harmonie, allgemeinen Wohlstand und öffentliche Gesundheit zu Hause” zu erreichen, gescheitert.
Selbst wenn der Westen erkennt, dass er immer schwächer wird, wird der Anpassungsprozess laut Peyman nicht leicht sein. Angesichts dessen, dass die überwiegende Mehrheit der Weltbevölkerung in anderen Ländern lebt, werden diese ihren “Ausschluss von der globalen Entscheidungsfindung” nicht mehr länger akzeptieren. “Der Rest” will den Westen dabei nicht explizit ausschließen, aber er will sich entscheidend daran beteiligen, die – vom Westen aufgestellten – globalen Spielregeln für das einundzwanzigste Jahrhundert zu ändern.
Zum Schluss drängt Peyman US-Präsident Joe Biden und den chinesischen Präsidenten Xi Jinping (die Anführer des Westens und der “Restländer”), zu einer “großen Übereinkunft” zu kommen – ähnlich der von Richard Nixon und Mao Zedong Anfang der 1970er. Eine solche Übereinkunft würde die Zusammenarbeit bei den großen Problemen unserer Zeit – wie in erster Linie dem Klimawandel – verbessern und gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit verheerender Konflikte verringern.
Aber eine Übereinkunft muss es auch zwischen den Staaten, deren Macht wächst, und den Marktkräften geben, die immer schwächer werden. Finden auf unilateraler Basis plötzlich politische Veränderungen wie die Einführung oder Verschärfung von Sanktionen statt, wird dadurch die Geschäftstätigkeit von Privatunternehmen gestört und ihre Profitabilität untergraben. Um inmitten geopolitischer Spannungen die wirtschaftliche Dynamik beizubehalten, müssen die Regeln für Handel und Investitionen des privaten Sektors geklärt und respektiert werden – einschließlich der “roten Linien” im Bereich der nationalen Sicherheit. Das Land, das solche Regeln bereitstellen kann, wird die neue Weltordnung prägen, auch wenn es hinsichtlich BIP oder Bevölkerungszahl nicht das größte ist.
Aus dem Englischen von Harald Eckhoff
Andrew Sheng ist Distinguished Fellow am Asia Global Institute der Universität von Hongkong. Xiao Geng, ist Vorsitzender des Hongkong-Instituts für Internationales Finanzwesen und Professor und Direktor des Institute of Policy and Practice am Finance Institute der Chinesischen Universität von Hongkong in Shenzhen.
Copyright: Project Syndicate, 2023.
www.project-syndicate.org
James Chater wird neuer Ostasien-Korrespondent für die Deutsche Welle. Chater war zuvor unter anderem für Taiwan Plus News tätig. Er wohnt in Taipeh.
Liu Liehong ist offiziell als CEO und Vorstandsvorsitzender des staatlichen Kommunikationsunternehmens Unicom zurückgetreten. Bereits im Frühjahr war bekannt geworden, dass Liu neuer Chef der Nationalen Datenbehörde werden soll.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Um diese Tiere gibt es derzeit Diskussionen im chinesischen Social Web. Sind die Malaienbären im Zoo von Hangzhou echt – oder etwa doch nur gemeine Menschen in einem Kostüm? Anlass für den Verdacht waren die Bewegungen der Bären, die gerne sehr menschlich auf zwei Hintertatzen stehen. Der Zoo sah sich nun genötigt, in einem offiziellen Statement die wahre Bärenidentität zu bestätigen.
