am kommenden Montag beginnt in München die Mobilitäts-Messe IAA. Die ehrwürdige Veranstaltung mit Wurzeln im Jahr 1897 hat heute ein ganz entscheidendes Problem: Automessen funktionieren eigentlich nur noch in China. Das sagt der Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer im Interview mit dem China.Table. Dort haben die Hersteller noch echtes Interesse daran, Fahrzeug-Neuheiten zu präsentieren. Zudem behalten die Messen in Peking und Shanghai ihren Fokus aufs Autos. Die IAA findet dagegen als vielfältige Spaßveranstaltung rund um das Thema Mobilität statt. Da können die Leute auch zum Oktoberfest gehen, findet Dudenhöffer. Die IAA manövriert sich auf diese Weise weiter ins Abseits.
Doch damit enden die schlechten Nachrichten für die deutsche Autobranche noch nicht. Anlässlich der IAA blicken wir auf die Angreifer aus China. Lange belächelt, sind sie inzwischen zum Teil sogar überlegene Konkurrenz, analysiert unser Team in Peking. Vor allem BYD sticht hier heraus. Das neue E-Auto des Konzerns aus Shenzhen lässt den vergleichbaren Modellen von Volkswagen kaum Marktchancen. Es kostet nur ein Drittel und kann aus Sicht der Verbraucher das Gleiche.
Im Gesamtbild sind Chinas Automodelle elektrischer, vernetzter und günstiger als die deutsche Konkurrenz. Und sie sind smarter. Auch Europa und die USA haben zwar eine starke KI-Forschung, doch China ist schneller darin, ihre Anwendungen ins Kfz zu bringen.
Das Thema KI in China greift auch der ehemalige Google-Chef Eric Schmidt in seinem heutigen Gastbeitrag auf. Schmidt leitet derzeit eine neue KI-Kontrollkommission in den USA und hat auch Zugang zu vertraulichen Informationen. Er warnt: Das autoritär regierte China setzt Standards und kann sie auch anderen aufdrücken.


Herr Dudenhöffer, kommende Woche beginnt die IAA – erstmals in München. Was wird neu und anders sein als die bisherige in Frankfurt?
Ferdinand Dudenhöffer: Das Auto steht nicht mehr im Mittelpunkt, sondern auch öffentliche Verkehrsmittel, Fluggeräte und Fahrräder werden Thema auf der IAA sein. Auch eine Oldtimer-Ausstellung soll es geben, zudem Veranstaltungen in der Innenstadt. Es handelt sich also nicht mehr nur um eine klassische Messe, sondern eher um ein Event mit Volksfestcharakter.
Das klingt nach einem populären Format.
Der Zuspruch unter den Automobilherstellern hält sich aber in Grenzen. Die großen deutschen Autobauer sind natürlich dabei. Aber schon Opel fehlt und bis auf Hyundai, Renault und paar junge chinesische Autofirmen werden auch die meisten großen internationalen Autohersteller München fern bleiben. Wenn Autos nicht die Hauptrolle einnehmen, stellt sich für viele internationale Autohersteller offensichtlich die Frage, warum sie noch kommen sollen. Automessen müssen sich für sie rechnen. Gute Laune an den Ständen reicht ihnen nicht.
Ausrichter der IAA ist der Verband der Autoindustrie (VDA). Und der müsste doch am besten wissen, was die Bedürfnisse seiner Mitglieder sind?
Automessen im klassischen Sinn haben ausgedient. Im Zuge des Elektro-Trends haben Messen wie Battery Days, Power Days, oder eigene Produktvorstellungen wie die von Tesla die Show gestohlen. Die Detroit Motorshow ist tot. Auch der Autosalon in Genf braucht einen neuen Ansatz. Außer in China. Dort sind Automessen weiter ein Erfolgsträger.
Wie ist das zu erklären?
China ist schon seit geraumer Zeit der mit Abstand wichtigste und größte Automarkt der Welt. Und der Markt in der Volksrepublik wird weiter wachsen. Um mitzuhalten, müssen die Autohersteller jede Gelegenheit nutzen sich zu präsentieren. Ansonsten entsteht dort der Eindruck, dass man nicht präsent ist. Hinzu kommt, dass die Auto China es nicht nötig hat, ihr Themenspektrum zu erweitern. Durch das große Angebot an unterschiedlichen und auch einheimischen Autobauern, die vor allem bei den Themen Elektromobilität und autonomes Fahren enorm viel zu bieten haben, hat die Auto China jede Menge Interessantes zu bieten.
Klassische Automessen sind nicht mehr angesagt. Die IAA erweitert sein Themenspektrum auf Mobilität im Allgemeinen. In den Verkaufszahlen spiegelt sich das nicht wider. Der PKW-Bestand hat zuletzt sogar deutlich zugenommen. Wie passt das zusammen?
Ja, man sieht, dass das Auto gerade in Corona-Zeiten erheblich an Bedeutung gewonnen hat gegenüber öffentlichen Verkehrsmitteln. Und das dürfte auch erst mal der Trend bleiben. Virologen betonen schließlich, dass wir langfristig mit dem Virus leben müssen. Wir sehen das im Freizeitbereich. Caravans und andere Reisemobile erleben einen nie erwarteten Boom. Ich glaube, die IAA setzt zu stark auf populäre Themen, die vor der Pandemie aktuell waren oder allenfalls hierzulande angesagt sind, etwa die Sharing-Welt, die Erneuerung der Bahn, der Fahrradboom.
Das spiegelt aber nicht den weltweiten Trend wider. Es gibt eine große Neugierde auf Entwicklungen beim Elektroauto und autonomen Fahren. Ich glaube, beim Verband der IAA hat man diese Attraktivität nicht in allen Facetten gesehen, sondern hat Themen gewählt, die nicht alle den Nerv der Zeit treffen. Trends wie Reisemobile oder Facts und Infos zu Virenschutz im Auto wären spannend. Wenn ich mich für eine Veranstaltung entscheide, brauche ich ein Thema, das mich interessiert und nicht verwaschene Vielfalt. Die IAA bräuchte eine klarere Fokussierung.
Autonomes Fahren steht in München auf dem Programm.
Die deutschen Autobauer haben das Thema auf dem Schirm. Aber die Trends, das muss man ganz ehrlich sagen, werden derzeit im Silicon Valley und noch stärker in China gesetzt. In Shanghai und Peking gibt es mehr als 500 Kilometer lange Teststrecken. Selbst autonom fahrende LKWs werden dort schon ausprobiert. Das allein wäre ein eigenständiges Thema gewesen, das die ganze Messe bestimmen könnte.
Wenn ich sie allerdings auch mit Fahrrädern und Oldtimern vermenge, stellt sich die Frage: Wenn ich was über autonomes Fahren wissen will, erfahre ich das wirklich bei der IAA? Oder kriege ich ein Potpourri vorgesetzt von allem, was ein bisschen von allem ist? Da kann ich gleich zum Oktoberfest gehen. Die Gamescom in Köln zeigt wie man das machen kann und dort stellt man ja auch nicht das “Mensch-Ärgere-Dich-Nicht”-Spiel oder historische Brettspiele vor.
Ist dieses Potpourri womöglich Ausdruck davon, dass die deutschen Autobauer in diesen Bereichen nicht führend sind?
Dieser Mix an Themen drückt eher aus, dass es keine Strategie gibt, die alle gleichzeitig verfolgen. Bei Volkswagen setzt Vorstandschef Herbert Diess nun voll auf Elektromobilität. Andere Autobauer wie BMW sind vorsichtiger und sagen: Wir brauchen noch lange den Verbrennungsmotor. In dieser Dissonanz befindet sich auch die IAA.
Einer Studie des VDA zufolge gehen zwar mehr als 80 Prozent der befragten deutschen Autozulieferer davon aus, dass sich die Elektromobilität als neuer Standard durchsetzen wird, 88 Prozent rechnen aber erst 2030 oder später mit einer vollständigen Ablösung des Verbrennungsmotors.
Wer derart gelassen mit dem Thema umgeht, hat ein großes Risiko, dass es ihn übermorgen nicht mehr gibt.
Wie erklären Sie sich diese Gelassenheit?
Das ist je nach Zulieferer unterschiedlich. Wer Sitze herstellt, Scheiben oder Reifen, den tangiert die Umwälzung nur wenig. Betroffen sind die Zulieferer, die Abgasanlagen oder andere Teile für Verbrennungsmotoren herstellen. Die Großen haben die richtigen Weichen gestellt. Continental etwa hat den Bereich Antriebstechnik ausgegliedert. Firmen, wie Bosch werden in Zukunft Geschäfte verlieren, weil sie das Batteriegeschäft nicht können. Einen Teil dieser Umsatzeinbrüche werden sie jedoch mit der Entwicklung von IT und Software auffangen. BASF und andere Chemiekonzerne werden zu den Gewinnern gehören, weil ihre Substanzen für die Batterieherstellung benötigt werden. Das Problem sind die eher kleinen Firmen, die immer noch glauben, das Gewitter werde schon nicht so schlimm wie im Wetterbericht angekündigt.
Noch sind deutsche Autos in China sehr beliebt. Allein im ersten Halbjahr haben sie Rekordabsätze gemeldet. Bei der Elektromobilität hinken sie aber hinterher, zumal die chinesischen Autobauer äußerst innovativ sind.
Um Volkswagen und Daimler mache ich mir wenig Sorgen. Sie setzen voll auf elektrische Fahrzeuge, entwickeln Betriebssysteme, um die Fahrzeug-Software auch selbst zu beherrschen. Die Deutschen sind die größten Premium-Autobauer der Welt. Tesla holt in diesem Segment zwar auf. Doch der VW-Konzern mit Audi und Porsche und auch Daimler sind gut aufgestellt. BMW muss sich ran halten, kann es aber auch schaffen. Sie alle haben erkannt, dass in China die Zukunft der deutschen Autoindustrie liegt, nicht in Europa.
Mit dem Elektroauto ID.4 hatte VW in China einen eher schwierigen Start.
Beim Elektroauto spreizt sich der Markt in China derzeit. Die Chinesen kaufen entweder teure SUVs und Limousinen wie Tesla oder preisgünstige Kleinautos. Der ID.3 ist zwischendrin positioniert. Der Mini EV von Hong Guang etwa ist das meistverkaufte Elektroauto in China und umgerechnet für weniger als 4.000 Euro zu haben. Ich denke, VW wird mit den nächsten Karosserie-Varianten Marktanteile zurückholen.
Und wie sind die chinesischen Autobauer aufgestellt?
Sie holen massiv auf und werden auch nach Europa kommen. In Osteuropa sind sie bereits, punkten vor allem mit günstigen Fahrzeugen. Mit der Übernahme von Volvo durch Geely ist ein chinesisches Unternehmen auch in Westeuropa schon präsent. Und Geely ist ja auch bei Daimler mit zehn Prozent beteiligt. Der nächste Smart wird von Geely gebaut und nach Europa kommen. Die Unternehmen wachsen zusammen mit noch stärkerem chinesischem Akzent.
Die deutschen Autobauer werden chinesisch?
Das sind sie längst. VW, Audi, BMW und Mercedes bauen Autos nach chinesischem Geschmack, längere Abstände zum Beispiel. Und das wird so weitergehen. Der größte Markt entscheidet über den Standard. 2030 werden in China mehr als 30 Millionen Autos verkauft. Das ist doppelt so viel wie in Europa. Nur wer in China eine führende Position hat, wird noch zur Spitze gehören.
Die Deutschen sind zwar gut aufgestellt, müssen aber aufpassen: Toyota greift an, ebenso GM. Der chinesische Markt wird nicht mehr der sein, was er in der Vergangenheit war. Dort wird man nicht mehr mit einer ruhigen Gangart trotzdem gute Gewinne einfahren. Der Wettbewerb wird massiv zunehmen. VW und Daimler haben zuletzt gezeigt, dass sie sich neu erfinden können. Das ist das eigentliche Erfolgsrezept.
Ferdinand Dudenhöffer ist Deutschland renommiertester Experte der Automobilwirtschaft, was ihm den Ruf als “Autopapst” einbrachte. Bis 2020 war er Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Universität Duisburg-Essen. Inzwischen leitet er das privatwirtschaftlich betriebene Forschungsinstitut CAR-Center Automotive Research in Duisburg.

Deutsche Automanager dürften in den letzten eineinhalb Jahren mit sehr gemischten Gefühlen auf China geblickt haben. Zwar hat ihnen das Geschäft in der Volksrepublik während der Corona-Krise die Bilanz gerettet. Gleichzeitig mussten Volkswagen, Daimler und BMW jedoch hinnehmen, dass trotz eigener Modell-Offensiven das Geschäft mit E-Autos dort weiterhin fest in der Hand chinesischer Hersteller liegt. Sie standen Jahre früher als die Deutschen in den Startlöchern und scheinen nicht bereit zu sein, ihren Vorsprung im eigenen Heimatmarkt wieder abzugeben.
Im vergangenen Jahr verfügten 6,3 Prozent aller verkauften Autos in China über einen elektrischen Antrieb. In diesem Jahr, so schätzt das Analyse-Unternehmen Canalys, sollen rund 1,9 Millionen E-Autos an chinesische Kunden ausgeliefert werden – dann wären bereits neun Prozent aller Neuwagen in China elektrisch unterwegs. Nährboden für die chinesische E-Autoindustrie ist ein milliardenschwerer Plan der Regierung in Peking, die auf einen massiven Ausbau der Elektromobilität setzt. Hohe Subventionen und gleichzeitige Beschränkungen für Benziner auf den Straßen haben dazu beigetragen, dass dem E-Auto in China schneller der Weg bereitet werden konnte, als in Europa.
Fest steht jedoch: Ein Patentrezept auf Erfolg gibt es dabei nicht. Die Geschäftsmodelle der chinesischen Angreifer könnten diverser kaum ausfallen. Das im Juli zum elften Mal in Folge meistverkaufte E-Auto des Monats war keine Luxuskarosse, sondern das Mini-E-Mobil Wuling Hongguang, ein Stromer für den schmalen Geldbeutel. Den Erfolg verdankt das Unternehmen auch seiner schnellen Anpassungsfähigkeit an den Markt. “Die Mentalität unseres Unternehmens ist es, alles zu produzieren, was die Leute brauchen”, sagte Wulings Marketingchef Zhang Yiqin in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg. Als klar war, dass der kleine Elektro-Flitzer vor allem bei jungen Frauen gut ankommt, reagierte Zhang prompt und heuerte für sein Team noch mehr weibliche Mitarbeiter an, um Werbung und Marketing zu entwickeln.
Doch die chinesischen Hersteller können längst nicht nur billig. Die größten Innovationstreiber sind junge Unternehmen, die ausschließlich auf Elektro setzen. Viele von ihnen verzeichnen bereits erstaunliche Absatzerfolge: Der Hersteller Nio hat die Zahl seiner ausgelieferten Fahrzeuge im vergangenen Jahr auf knapp 44.000 verdoppelt, beim heimischen Konkurrenten Xpeng waren es 27.000; bei Li Auto rollten gleich im ersten Produktionsjahr mehr als 32.000 Autos aus der Fabrik.
Im Vergleich zu den 500.000 Autos, die der amerikanische E-Pionier Tesla im vergangenen Jahr weltweit verkaufte, wirken diese Zahlen bescheiden. Doch die Erwartungen sind gewaltig, auch bei Investoren. Nio wird an der Börse bereits ähnlich hoch bewertet wie die Branchengröße BMW. Und auch Great Wall Motor, SAIC, BYD, Geely und Xpeng zählen bereits zu den 20 weltweit wertvollsten, börsennotierten Automarken.
Seit Anfang des Jahres hat sich der Aktienwert des Shenzhener E-Autoherstellers BYD fast versiebenfacht und steigt weiter. Allein in der Woche vom 28. Juli legte die BYD-Aktie um über 40 Prozent zu und erreichte am 9. August ihr Allzeithoch.
Batterien von BYD gehören in der Mischung aus Sicherheit, Reichweite und Kosten zu den besten der Welt. Und mit dem Modell “Dolphin” traut sich BYD als erster chinesischer Hersteller mit einem international wettbewerbsfähigen Produkt im Kleinwagensegment anzugreifen. Das ist nicht weniger als eine direkte Attacke auf die ID-Reihe von Volkswagen, die wesentlich teurer ist.
Der Dolphin wurde im April auf der Autoshow in Shanghai erstmals vorgestellt. Er ist seit dem 13. August im Vorverkauf erhältlich, die ersten Fahrzeuge werden in diesen Tagen ausgeliefert. Der Stromer hat ungewöhnliche Abmessungen. Er ist mit seinen gut vier Metern Länge, 1,80 Meter Breite und 1,60 Meter Höhe je nach Ausführung zwischen 15 und 30 Zentimeter kürzer als der Golf, gleichzeitig jedoch 15 Zentimeter höher. Das bedeutet: Er passt in kleinere Parklücken und fühlt sich innen dennoch großräumig und luftig an. Mit 2.700 Millimetern Radstand ist er nur wenig kürzer als der VW ID.4 mit 2.770 Millimetern, jedoch 18 cm kürzer als der Tesla Model 3. Elon Musk hat bereits ein kleineres Modell angekündigt.
Die Formensprache des Dolphin orientiert sich an der “Ästhetik des Ozeans”. Gestaltet hat ihn BYD-Designchef Wolfgang Egger, der von Audi kommt. Die Fahrzeuge sollen ein junges, urbanes Lebensgefühl aussstrahlen, fernab der Lieblosigkeit, mit der BYDs chinesische E-Auto-Wettbewerber ihre Kleinwagen präsentieren. Ein Design-Clou sind die Heckleuchten. “Sie übernehmen optische Strukturen aus der Ming-Zeit”, erläutert Egger. Damit lässt sich dieses Auto auch von hinten sofort wiedererkennen.
Auch die Infotechnik passt: Der Dolphin ist mit einem drehbaren 13-Zoll-Bildschirm ausgestattet. Er macht also einem mittelgroßen Notebook Konkurrenz. Und: Das Auto lässt sich mittels Smartphone öffnen. Der kleine BYD-Stromer hat zudem eine Wärmepumpe, die es ermöglicht, batterieschonend die Abwärme des Autos zur Beheizung der Fahrzeuge zu verwenden. Das ist vor allem für den Norden Chinas wichtig, wo es im Winter sibirisch kalt wird.
Den neuen Zwerg von BYD gibt es in drei Varianten mit einer Reichweite von 300 bis 400 Kilometern, die Zahlen sind allerdings nach chinesischer Norm gerechnet. Besonders attraktiv sind die Ladezeiten. Innerhalb einer halben Stunde lässt sich die Batterie wieder weitgehend füllen. Bei BYD ist man überzeugt, dass auch in China das Zeitalter der Kompaktfahrzeuge anbricht, vor allem in den Metropolen.
Vorerst wird es den Dolphin nur in China geben. Die ersten Autos von BYD sind allerdings schon in Europa erhältlich. In diesem Sommer wurden die ersten 100 Exemplare des vergleichsweise konventionellen E-SUV Tang in den Pilot-Markt Norwegen geschickt. “Die Menschen empfangen Autos aus China nicht mit offenen Armen”, weiß Isbrand Ho, der Europa-Chef von BYD in Rotterdam. “Deswegen müssen unsere Autos besonders gut sein. Und unser Service noch besser.” BYD müsse im Fall von Problemen dem Kunden zeigen, dass man für ihn da sei. Deshalb lasse sich BYD nicht unter Druck setzen mit einem Markteintritt nach Europa. “Wenn wir scheitern, heißt es nicht: BYD ist gescheitert, sondern chinesische Autos sind gescheitert”, glaubt Ho. “Wir haben diesbezüglich eine große Verantwortung. Es wird nicht einfach, die Marke zu etablieren.” Deshalb ist noch nicht klar, wie schnell die Fahrzeuge auch in anderen EU-Märkten zu haben sind. Und vor allem, wann der Dolphin auf den Heimatmarkt des ID.3 kommt.
Während der Dolphin gerade ist in den Verkauf gegangen ist, generiert das Unternehmen mit seinem etablierten Modell Han bereits sehr erfolgreich Marktanteil und Umsatz. Das Auto, das vor Extras strotzt und gut aussieht, gibt es für umgerechnet 33.000 Euro. Zum Vergleich: Der Tesla S schafft mit einer Batterieladung rund 650 Kilometer. Zwar beschleunigt er eine Sekunde schneller als der Han, kostet jedoch umgerechnet knapp 77.000 Euro.
Derzeit zeichnet sich auch ab, dass die chinesischen Elektroautos zumindest auf ihrem Heimatmarkt deutlich besser laufen als die neue deutsche Konkurrenz. Im Juli hat VW immerhin schon 5.800 ID.3s verkauft. Das waren zwar deutlich mehr als im Juni mit nur fast 3.000 Stück. Doch Nio und Xpeng haben jeweils rund 8.000 Fahrzeuge verkauft. BYD ist sogar über 50.000 Fahrzeuge los geworden. Also knapp neunmal so viele wie VW. Im Vergleich zum Vorjahr ist es BYD gelungen, die Verkäufe zu verdreifachen.
Klar ist schon jetzt: Es wird hart für VW & Co. Nach dem Abzug der staatlichen Subventionen zahlen die Kunden in China umgerechnet zwischen 12.600 und 16.300 Euro für den Dolphin, der wertiger und pfiffiger aussieht. Der Startpreis für den ID.4 in der kleinen Version beträgt hingegen schon 25.000 Euro. Die von der Ausstattung her mit dem Dolphin vergleichbare Edition des ID.4 kostet sogar rund 36.000 Euro, also mehr als das doppelte. Es kann durchaus sein, dass in puncto Sicherheit und Qualität VW höhere Standards hat. Doch die Frage ist: Will der Kunde das für ein Stadtauto bezahlen? Der ID.3 kommt überhaupt erst Ende des Jahres nach China.
Das Marketing des ID.4 ist ebenfalls verunglückt: Die Zahl vier klingt im Chinesischen wie das Wort Tod. In den nächsten Monaten wird sich an den Verkaufszahlen zeigen, welches der beiden Autos besser einschlägt, nachdem der ID.4 ein paar Monate Vorsprung hat. Auf dieses Duell wird die Branche schauen.
Bei BYD denkt man schon an die nächsten Schritte: Inzwischen mehren sich Gerüchte, das BYD im ersten Quartal 2021 eine neue Premiummarke mit eigenem Händlernetz startet. Noch in diesem Jahr soll Gerüchten zufolge ein neues Oberklasseauto auf den Markt kommen. Damit würde BYD das gesamte Spektrum abdecken.
Immer mehr internationale Experten bescheinigen den Chinesen, ihre Hausaufgaben gemacht zu haben und Autos von höchster Qualität zu bauen. So erhielt der chinesische Hersteller Aiways, der seinen Elektro-SUV U5 mittlerweile auch in Deutschland anbietet, kürzlich sogar vom ADAC einen Ritterschlag: “Der Aiways U5 beweist, dass Autos, die in China gebaut werden, schon lange nicht mehr billig im Sinne von qualitativ minderwertig sein müssen”, so die ADAC-Experten. Das chinesische Auto bewege sich etwa im Vergleich mit dem Konkurrenzprodukt EQC von Mercedes in vielen Disziplinen auf Augenhöhe, schneide in mancher Hinsicht sogar besser ab – und koste nur halb so viel.
Auch Experten der Unternehmensberatung McKinsey haben etliche Made-in-China-Mobile auseinandergenommen, um deren Leistungsstärke zu ermitteln. Das Ergebnis: “Die in China hergestellten Modelle unserer Untersuchung überflügeln internationale Autobauer an zwei Fronten: bei Bedienung und Kundenerlebnis (durch bessere Vernetzung) und bei der Batterietechnik.” Die Fahrzeuge hätten mit “massiven technologischen Verbesserungen” in den vergangenen zwei Jahren deutlich aufgeholt.
Doch nicht nur Technologie macht den Unterschied. Auch bei ihren Vertriebsmodellen zeigen sich die Chinesen smart. Geely etwa setzt bei seinen Europaplänen auf ein Abo-Konzept: In Deutschland, Schweden, Frankreich, Spanien, den Niederlanden und Belgien gibt es Autos der jungen Konzernmarke Lynk & Co für 500 Euro im Monat, Steuer, Versicherung, Wartung und Reifenwechsel inklusive. Große Wahlmöglichkeiten gibt es für die Konsumenten in diesem Fall nicht: blau oder schwarz. Hybrid oder Plug-in-Technik, bei der Akkus sowohl über den Verbrennungsmotor als auch per Kabel geladen werden können. Das war es auch schon mit den Optionen. Mit dieser Einfachheit will Geely vor allem bei jungen Fahrern punkten.
Nio präsentiert seine Fahrzeuge dagegen in China und wohl bald auch in Europa über sogenannte Nio Houses, in denen es neben Wohnzimmer, Küche und Bibliothek auch Spielflächen für Kinder gibt. Das erste House außerhalb Chinas entsteht derzeit in Oslo, Nio will es im September auf 2.000 Quadratmetern im Zentrum der Hauptstadt Norwegens eröffnen. Frank Sieren/Gregor Koppenburg/Joern Petring
Um Wohnraum in den Städten Chinas bezahlbarer zu machen, dürfen künftig die Kosten für Mietwohnungen jährlich höchstens um fünf Prozent steigen. “Neue Stadtbewohner und junge Menschen haben erst seit relativ kurzer Zeit gearbeitet und verfügen nur über ein geringes Einkommen, sodass sie kaum in der Lage sind, ein Haus zu kaufen oder Miete zu zahlen”, erklärte der stellvertretende Wohnungsbauminister Ni Hong am Mittwoch. In den Großstädten gehören 70 Prozent der Zugezogenen und vor allem junge Leute zum Kreis der Mieter.
Peking hatte zuletzt auch die Hypothekenzinsen in den Großstädten erhöht und gleichzeitig versprochen, den Bau von staatlich subventionierten Mietwohnungen zu beschleunigen. In Anlehnung an Staats- und Parteichef Xi Jinpings Worte, dass “Wohnen zum Leben da ist und nicht zur Spekulation” hatten die Behörden begonnen, die Finanzierungsmodelle von Bauentwicklern genauer unter die Lupe zu nehmen. Sie haben auch die Preise von Immobilien, die neu auf den Markt kommen, analysiert.
Die Regulierung passt ins Gesamtbild des neuen Kurses, sozialer zu werden. “Chinas Immobiliensektor war eine der größten Ursachen für Unzufriedenheit und die Regierung ist fest entschlossen, die Preise zu kontrollieren, damit sie nicht zu sozialen Unruhen führen, sagte Liao Ming, Gründungspartner der Investmentgesellschaft Prospect Avenue Capital aus Peking, gegenüber Bloomberg. “Die Maßnahmen spiegeln die politischen Eindämmungen im Bildungsbereich wider, da sie darauf abzielen, die öffentliche Angst vor Ungleichheit zu lindern” (China.Table berichtete).
Zuletzt hatten sich die Wohnkosten in den Städten allein in den Monaten Juli und Juni um jeweils über zehn Prozent verteuert, wie Daten der Nationalen Statistikbehörde zeigen. In der Hauptstadt Peking und der Wirtschaftsmetropole Shenzhen wurden in diesem Jahr Schritte eingeleitet, um das Angebot an Mietwohnungen zu erhöhen. In den vergangenen Monaten haben mehrere Großstädte auch neue Vorschriften zur Vermietung von Wohnungen geplant. Die Maßnahmen zielen auf die Stärkung der Rechte für Mieter und die Minderung der Höhe der Kautionen ab, die ein Vermieter fordern darf. Ab Oktober gilt eine Steuererleichterung für Mietwohnungsunternehmen, so China Daily. niw
Seit Mittwoch macht Chinas Maritime Safety Administration für ausländische Schiffe eine Meldepflicht im Südchinesischen Meer geltend. Demnach sollen die Schiffe dazu verpflichtet werden, detaillierte Informationen an die chinesischen Behörden zu übermitteln, wenn sie in Gewässer eintreten, die Peking als Teil seines Territoriums reklamiert. Internationale Beobachter halten diese Meldepflicht für rechtswidrig.
Betroffen sind U-Boote, Nuklearschiffe, Tanker und alle Schiffe, die China als eine Bedrohung für die Sicherheit seines Seeverkehrs ansieht. Nach Vorstellung der Seesicherheitsbehörde sollen die vermeintlichen Eindringlinge ab sofort sich und ihre Ladung identifizieren, wenn sie die besagten Zonen kreuzen.
Die Volksrepublik China nimmt große Teile des Südchinesischen Meeres für sich in Anspruch und erklärt vergleichbare Interessen der Anrainerstaaten für irrelevant. Atolle und Sandbänke, tausende Kilometer entfernt von der eigenen Südküste, hat die Regierung zu chinesischem Grund und Boden erklärt. Um ihren Anspruch deutlich zu machen, schüttet die Volksrepublik künstliche Inseln auf und bebaut sie mit Militärbasen und kleinen Siedlungen.
Damit versucht die Regionalmacht, Fakten zu schaffen, ehe sie sich mit den Anrainerstaaten auf einen Verhaltenskodex einigt, dessen Implementierung seit einer Weile diskutiert und auch von den USA unterstützt wird. Bereits 2016 hatte der Internationale Gerichtshof in Den Haag Chinas Gebietsansprüche für unrechtmäßig erklärt. Peking fühlt sich an die Rechtsprechung jedoch nicht gebunden. Experten halten es wegen der fehlenden Rechtsgrundlage für äußerst unwahrscheinlich, dass sich andere Staaten, vornehmlich die USA, an die chinesische Forderung halten werden. grz
Ein Gericht in Hongkong hat am Dienstag weitere Urteile gegen pro-demokratische Aktivisten und ehemalige Politiker gesprochen. Im Mittelpunkt des Verfahrens standen die Ereignisse rund um eine nicht genehmigte Demonstration am 20. Oktober 2019. Damals hatte die Civil Human Rights Front (CHRF) zu einem Aufmarsch gegen ein öffentliches Maskenverbot und Polizeigewalt aufgerufen, dem geschätzte 350.000 Menschen gefolgt waren.
Die Demonstration verlief friedlich, bis im späteren Verlauf ein Bruchteil der Demonstranten die Polizei in Tsim Sha Tsui auf der Halbinsel Kowloon mit Molotow-Cocktails angriff und erhebliche Schäden anrichtete. Sieben Organisatoren der Veranstaltung wurden nun zur Verantwortung für die Eskalation gezogen und mit Haftstrafen von elf bis 16 Monaten belegt.
Die längsten Strafen erhielten die früheren Parlamentarier Leung Kwok-hung, genannt “Long Hair”, und Albert Ho Chun-yan. Sechs der sieben Angeklagten saßen bereits vor dem Richterspruch wegen anderer Vergehen im Zusammenhang mit der Protestbewegung in Haft und müssen nach dem Absitzen ihre neuen Strafen antreten.
Die CHRF wurde derweil vor wenigen Wochen aufgelöst, weil der Druck seit Einführung des Nationalen Sicherheitsgesetzes in Hongkong auf politische Organisationen mit pro-demokratischen Zielen immens gewachsen ist. Das Sicherheitsgesetz gibt Ermittlern und Justiz seit Juli vergangenen Jahres ein wirkungsvolles Werkzeug an die Hand, mit dem unter dem Deckmantel rechtsstaatlicher Prinzipien politischer Dissens hart bestraft werden kann (China.Table berichtete). Zurzeit warten 47 Oppositionelle auf ihren Prozess wegen Verstößen gegen das Sicherheitsgesetz. grz
Die Europäische Union möchte mit neu geschaffenen Vorgaben für den europäischen Markt auch China dazu bewegen, sich im Bereich der öffentlichen Beschaffung zu öffnen. Es müsse Gegenseitigkeit und Wettbewerbsgleichheit herbeigeführt werden, betonten mehrere EU-Abgeordnete am Mittwoch bei der Vorstellung des entsprechenden Berichts über das “International Procurement Instrument” (IPI) im Ausschuss für internationalen Handel. Während bei öffentlichen Ausschreibungen für Unternehmen aus Drittländern innerhalb der EU “Tür und Tor” offen stünden, wollten manche Handelspartner ihre Türe gar nicht öffnen, kritisierte der CDU-Europapolitiker Daniel Caspary, der federführend für die Ausarbeitung der Position des EU-Parlaments zu IPI ist. Es müsse eine Möglichkeit geben, besser Druck machen zu können, “wo wir nicht zum Zuge kommen”, so Caspary.
Die Abgeordneten des Ausschusses und mehrere Interessensvertreter aus dem Beschaffungswesen sprachen sich bei der Vorstellung gegen den von den EU-Mitgliedsstaaten vorgeschlagenen Preisanpassungsmechanismus aus. Sie forderten, dass durch das IPI eine Möglichkeit geschaffen werden müsse, um staatlich geförderte Unternehmen aus der Volksrepublik von Ausschreibungen ganz ausschließen zu können.
Der Vorschlag der EU-Mitgliedsstaaten sieht derzeit einen Preisaufschlag vor, wenn ein aus China abgegebenes Angebot zu billig ist. In der Position des Europaparlaments ist zudem die Freigabe für Ausnahmen aus dem IPI bei der EU-Kommission in Brüssel gelagert, die EU-Staaten wollen, dass diese Kompetenz bei den Mitgliedsländern liegt. Der Bericht bedarf nun einer Mehrheit im EU-Parlament, Ende des Jahres ist Caspary zufolge mit einer Abstimmung im Plenum zu rechnen. Danach erfolgt der Trilog mit der Kommission und dem Rat.
Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten stimmte am Mittwoch zudem erstmals über einen Berichtsentwurf über die Beziehungen zwischen der EU und Taiwan ab. In dem Papier wird unter anderem die Unterzeichnung eines offiziellen Partnerschaftsabkommens und eine Folgenabschätzung für ein bilaterales Investitionsabkommen gefordert. In dem Bericht wird China zudem aufgefordert, “von destabilisierenden Handlungen gegenüber Taiwan abzulassen”. Taiwan soll zudem als regionale Wirtschaftsmacht in die anstehende Strategie für den indopazifischen Raum, die derzeit vom Europäischen Auswärtigen Dienst ausgearbeitet wird, aufgenommen werden. Der Berichtsentwurf wurde im Ausschuss mit großer Mehrheit angenommen. Wann der Bericht im Plenum abgestimmt wird, war noch nicht klar. ari
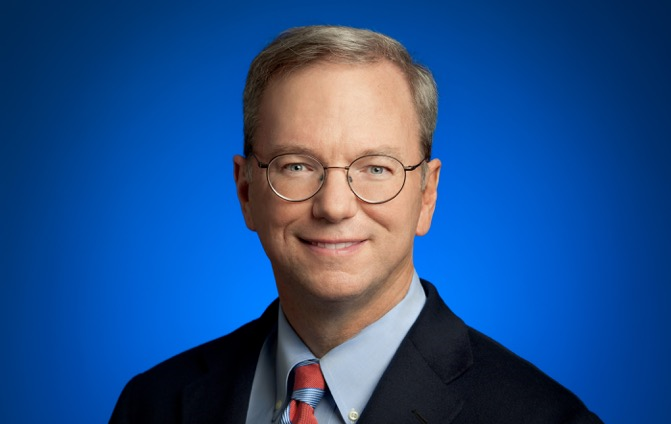
Die Welt fängt gerade erst an, sich damit auseinanderzusetzen, wie tiefgreifend die KI-Revolution sein wird. KI-Technologien werden Wellen des Fortschritts in den Bereichen kritische Infrastruktur, Handel, Transport, Gesundheit, Bildung, Finanzmärkte, Nahrungsmittelproduktion und ökologische Nachhaltigkeit auslösen. Die erfolgreiche Einführung von künstlicher Intelligenz wird die Wirtschaft vorantreiben, die Gesellschaft umgestalten und bestimmen, welche Länder die Regeln für das kommende Jahrhundert festlegen.
Diese sich bietende Chance fällt mit einem Moment der strategischen Verwundbarkeit zusammen. US-Präsident Joe Biden hat gesagt, dass sich Amerika in einem “langfristigen strategischen Wettbewerb mit China” befinde, womit er Recht hat. Verwundbar sind jedoch nicht nur die Vereinigten Staaten, sondern auch die gesamte demokratische Welt, denn die KI-Revolution untermauert den aktuellen Wertekampf zwischen Demokratie und Autoritarismus. Wir müssen beweisen, dass Demokratien in einer Ära der technologischen Revolution erfolgreich sein können.
China ist jetzt ein gleichwertiger technologischer Konkurrent. Es ist organisiert, mit Ressourcen ausgestattet und entschlossen, diesen Technologiewettbewerb zu gewinnen und die globale Ordnung zugunsten seiner eigenen begrenzten Interessen umzugestalten. KI und andere aufkommende Technologien sind von zentraler Bedeutung für Chinas Bemühungen, seinen globalen Einfluss auszuweiten, die wirtschaftliche und militärische Macht der USA zu übertreffen und die Stabilität im eigenen Land zu sichern. China führt einen zentral gesteuerten systematischen Plan aus, um durch Spionage, Anwerbung von Talenten, Technologietransfer und Investitionen KI-Wissen aus dem Ausland zu gewinnen.
Chinas Einsatz von künstlicher Intelligenz im eigenen Land ist für Gesellschaften, die individuelle Freiheit und Menschenrechte schätzen, äußerst bedenklich. Der Einsatz von KI als Instrument der Unterdrückung, Überwachung und sozialen Kontrolle im eigenen Land wird auch ins Ausland exportiert. China finanziert massive digitale Infrastrukturprojekte auf der ganzen Welt und versucht gleichzeitig, globale Standards zu setzen, die autoritäre Werte widerspiegeln. Seine Technologie wird zur sozialen Kontrolle und zur Unterdrückung abweichender Meinungen eingesetzt.
Um es klar zu sagen: Der strategische Wettbewerb mit China bedeutet nicht, dass wir nicht mit China zusammenarbeiten sollten, wo es sinnvoll ist. Die USA und die demokratische Welt müssen weiterhin mit China in Bereichen wie der Gesundheitsversorgung und dem Klimawandel zusammenarbeiten. Es wäre kein gangbarer Weg, den Handel und die Zusammenarbeit mit China einzustellen.
Chinas schnelles Wachstum und seine Konzentration auf soziale Kontrolle haben sein techno-autoritäres Modell für autokratische Regierungen attraktiv und für fragile Demokratien und Entwicklungsländer verlockend gemacht. Es muss noch viel getan werden, um sicherzustellen, dass die USA und die demokratische Welt wirtschaftlich tragfähige Technologie mit Diplomatie, Auslandshilfe und Sicherheitskooperation verbinden können, um mit Chinas exportiertem digitalen Autoritarismus zu konkurrieren.
Die USA und andere demokratische Länder holen bei der Vorbereitung auf diesen globalen Technologiewettbewerb auf. Am 13. Juli 2021 veranstaltete die Nationale Sicherheitskommission für künstliche Intelligenz (NSCAI) einen globalen Gipfel für neue Technologien, der einen wichtigen komparativen Vorteil der USA und unserer Partner auf der ganzen Welt aufzeigte: das breite Netzwerk von Allianzen zwischen demokratischen Ländern, das auf gemeinsamen Werten, der Achtung der Rechtsstaatlichkeit und der Anerkennung der grundlegenden Menschenrechte beruht.
Letztendlich ist der globale Technologiewettbewerb ein Wettbewerb der Werte. Gemeinsam mit Verbündeten und Partnern können wir bestehende Rahmenbedingungen stärken und neue erkunden, um die Plattformen, Standards und Normen von morgen zu gestalten und sicherzustellen, dass sie unsere Grundsätze widerspiegeln. Der Ausbau unserer globalen Führungsrolle in den Bereichen technologische Forschung, Entwicklung, Governance und Plattformen wird die Demokratien der Welt in die beste Lage versetzen, neue Chancen zu nutzen und sich gegen Schwachstellen zu schützen. Nur wenn wir bei der Entwicklung von KI weiterhin führend bleiben, können wir Standards für die verantwortungsvolle Entwicklung und Nutzung dieser wichtigen Technologie setzen.
Der Abschlussbericht der NSCAI enthält einen Fahrplan für die demokratische internationale Gemeinschaft, um diesen Wettbewerb zu gewinnen.
Erstens muss die demokratische Welt die bestehenden internationalen Strukturen – einschließlich der NATO, der OECD, der G7 und der Europäischen Union – nutzen, um die Bemühungen zur Bewältigung aller mit KI und neuen Technologien verbundenen Herausforderungen zu intensivieren. In diesem Zusammenhang ist die derzeitige G7-Präsidentschaft des Vereinigten Königreichs mit ihrer soliden Technologieagenda und ihren Bemühungen um eine verstärkte Zusammenarbeit bei einer Reihe von digitalen Initiativen ermutigend. Die Entscheidung der G7, Australien, Indien, Südkorea und Südafrika einzubeziehen, spiegelt die wichtige Erkenntnis wider, dass wir demokratische Länder aus aller Welt in diese Bemühungen einbeziehen müssen.
Ebenso ist der neu ins Leben gerufene Handels- und Technologierat zwischen den USA und der EU (der in vielerlei Hinsicht die Forderung der NSCAI nach einem strategischen Dialog zwischen den USA und der EU über aufkommende Technologien widerspiegelt) ein vielversprechender Mechanismus, um die größten Handelspartner und Volkswirtschaften der Welt zusammenzubringen.
Zweitens brauchen wir neue Strukturen, wie z. B. die Vierergruppe – die USA, Indien, Japan und Australien -, um den Dialog über KI und neue Technologien und deren Auswirkungen auszuweiten und die Zusammenarbeit in den Bereichen Normenentwicklung, Telekommunikationsinfrastruktur, Biotechnologie und Lieferketten zu verbessern. Die Vierergruppe kann als Grundlage für eine breitere Zusammenarbeit in der indo-pazifischen Region zwischen Regierung und Industrie dienen.
Und drittens müssen wir mit unseren Verbündeten und Partnern zusätzliche Allianzen rund um KI und künftige Technologieplattformen aufbauen. Die NSCAI hat zur Gründung einer Koalition entwickelter Demokratien aufgerufen, um die Politik und die Maßnahmen im Bereich der KI und neuer Technologien in sieben kritischen Bereichen zu synchronisieren:
Dieser Schwung kann nur durch Zusammenarbeit aufrechterhalten werden. Partnerschaften – zwischen Regierungen, mit dem Privatsektor und mit der Wissenschaft – sind ein entscheidender asymmetrischer Vorteil, den die USA und die demokratische Welt gegenüber unseren Konkurrenten haben. Wie die jüngsten Ereignisse in Afghanistan gezeigt haben, sind die Fähigkeiten der USA für verbündete Operationen nach wie vor unverzichtbar, aber die USA müssen mehr tun, um Verbündete für eine gemeinsame Sache zu gewinnen. Diese Ära des strategischen Wettbewerbs verspricht, unsere Welt zu verändern. Wir können diesen Wandel entweder gestalten oder von ihm mitgerissen werden.
Wir wissen heute, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz in allen Lebensbereichen zunehmen wird, da sich das Innovationstempo weiter beschleunigt. Wir wissen auch, dass unsere Gegner entschlossen sind, die Fähigkeiten der KI gegen uns einzusetzen. Jetzt müssen wir handeln.
Die Grundsätze, die wir aufstellen, die Investitionen, die wir tätigen, die Anwendungen für die nationale Sicherheit, die wir einsetzen, die Organisationen, die wir umgestalten, die Partnerschaften, die wir schmieden, die Koalitionen, die wir bilden, und die Talente, die wir fördern, werden den strategischen Kurs für Amerika und die demokratische Welt bestimmen. Demokratien müssen investieren, was immer nötig ist, um die Führung im globalen Technologiewettbewerb zu behalten, um KI verantwortungsvoll zu nutzen, um freie Menschen und freie Gesellschaften zu verteidigen und um die Grenzen der Wissenschaft zum Wohle der gesamten Menschheit zu erweitern.
Die künstliche Intelligenz wird die Welt neu ordnen und den Lauf der Menschheitsgeschichte verändern. Die demokratische Welt muss diesen Prozess anführen.
Eric Schmidt, ehemaliger CEO und Vorsitzender von Google/Alphabet, ist Vorsitzender der National Security Commission on Artificial Intelligence. Übersetzung: Andreas Hubig
Copyright: Project Syndicate, 2021.
www.project-syndicate.org
Linda Gao ist neue Geschäftsführerin des Automobilunternehmens Inalfa Roof Systems. Vorher hat sie sechs Jahre lang das Geschäft von Inalfa in China aufgebaut. Gao hat mehr als 20 Jahre in der Automobilindustrie gearbeitet und soll in ihrer neuen Rolle das Transformationsprogramm des Unternehmens als Vorlage für die langfristigen Wachstumspläne auf dem weltweiten Automobilmarkt leiten. Inalfa Roof Systems stellt weltweit für nahezu alle großen Auto- und Lkw-Hersteller die Dachsysteme her. Das Unternehmen ist Teil der BHAP-Gruppe, die zu den größten Zulieferern von Automobilteilen in China gehören.
Mads Fink Eriksen ist neues Vorstandsmitglied der Schuhmarke Ecco. Bisher war er seit 2020 CFO der Ecco-Gruppe. Er arbeitet seit zehn Jahren bei Ecco, zunächst in China, gefolgt von mehreren Jahren in Singapur in der globalen Produktionszentrale des Unternehmens. 2018 zog es ihn nach Australien, wo er die Vertriebsorganisation von Ecco erfolgreich umstrukturierte. Ecco hatte vor der Pandemie eine Hightech-Lederfabrik in Xiamen, China eröffnet. Die Umsätze in China sind zuletzt besonders stark um über zehn Prozent auf 248 Millionen Euro gestiegen, während sie in Europa um sieben Prozent zurückgingen.

Eine Medaille zum Schulbeginn bekommen Grundschüler in Guangzhou. Zum 1. September hat das neue Schuljahr begonnen. In einigen Provinzen dürfen Kinder von ungeimpften Eltern zwar noch nicht zurück in den Unterricht. Aber auch Kinder zwischen 12 und 17 Jahren sind in manchen Gegenden im Land noch vom Unterricht ausgeschlossen, solange sie noch ungeimpft sind. China ist eines der Länder, die seinen heimischen Impfstoff für Kinder ab drei Jahren freigegeben hat. Da, wo die Schule startet, müssen die Kinder im Unterricht Masken tragen.
am kommenden Montag beginnt in München die Mobilitäts-Messe IAA. Die ehrwürdige Veranstaltung mit Wurzeln im Jahr 1897 hat heute ein ganz entscheidendes Problem: Automessen funktionieren eigentlich nur noch in China. Das sagt der Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer im Interview mit dem China.Table. Dort haben die Hersteller noch echtes Interesse daran, Fahrzeug-Neuheiten zu präsentieren. Zudem behalten die Messen in Peking und Shanghai ihren Fokus aufs Autos. Die IAA findet dagegen als vielfältige Spaßveranstaltung rund um das Thema Mobilität statt. Da können die Leute auch zum Oktoberfest gehen, findet Dudenhöffer. Die IAA manövriert sich auf diese Weise weiter ins Abseits.
Doch damit enden die schlechten Nachrichten für die deutsche Autobranche noch nicht. Anlässlich der IAA blicken wir auf die Angreifer aus China. Lange belächelt, sind sie inzwischen zum Teil sogar überlegene Konkurrenz, analysiert unser Team in Peking. Vor allem BYD sticht hier heraus. Das neue E-Auto des Konzerns aus Shenzhen lässt den vergleichbaren Modellen von Volkswagen kaum Marktchancen. Es kostet nur ein Drittel und kann aus Sicht der Verbraucher das Gleiche.
Im Gesamtbild sind Chinas Automodelle elektrischer, vernetzter und günstiger als die deutsche Konkurrenz. Und sie sind smarter. Auch Europa und die USA haben zwar eine starke KI-Forschung, doch China ist schneller darin, ihre Anwendungen ins Kfz zu bringen.
Das Thema KI in China greift auch der ehemalige Google-Chef Eric Schmidt in seinem heutigen Gastbeitrag auf. Schmidt leitet derzeit eine neue KI-Kontrollkommission in den USA und hat auch Zugang zu vertraulichen Informationen. Er warnt: Das autoritär regierte China setzt Standards und kann sie auch anderen aufdrücken.


Herr Dudenhöffer, kommende Woche beginnt die IAA – erstmals in München. Was wird neu und anders sein als die bisherige in Frankfurt?
Ferdinand Dudenhöffer: Das Auto steht nicht mehr im Mittelpunkt, sondern auch öffentliche Verkehrsmittel, Fluggeräte und Fahrräder werden Thema auf der IAA sein. Auch eine Oldtimer-Ausstellung soll es geben, zudem Veranstaltungen in der Innenstadt. Es handelt sich also nicht mehr nur um eine klassische Messe, sondern eher um ein Event mit Volksfestcharakter.
Das klingt nach einem populären Format.
Der Zuspruch unter den Automobilherstellern hält sich aber in Grenzen. Die großen deutschen Autobauer sind natürlich dabei. Aber schon Opel fehlt und bis auf Hyundai, Renault und paar junge chinesische Autofirmen werden auch die meisten großen internationalen Autohersteller München fern bleiben. Wenn Autos nicht die Hauptrolle einnehmen, stellt sich für viele internationale Autohersteller offensichtlich die Frage, warum sie noch kommen sollen. Automessen müssen sich für sie rechnen. Gute Laune an den Ständen reicht ihnen nicht.
Ausrichter der IAA ist der Verband der Autoindustrie (VDA). Und der müsste doch am besten wissen, was die Bedürfnisse seiner Mitglieder sind?
Automessen im klassischen Sinn haben ausgedient. Im Zuge des Elektro-Trends haben Messen wie Battery Days, Power Days, oder eigene Produktvorstellungen wie die von Tesla die Show gestohlen. Die Detroit Motorshow ist tot. Auch der Autosalon in Genf braucht einen neuen Ansatz. Außer in China. Dort sind Automessen weiter ein Erfolgsträger.
Wie ist das zu erklären?
China ist schon seit geraumer Zeit der mit Abstand wichtigste und größte Automarkt der Welt. Und der Markt in der Volksrepublik wird weiter wachsen. Um mitzuhalten, müssen die Autohersteller jede Gelegenheit nutzen sich zu präsentieren. Ansonsten entsteht dort der Eindruck, dass man nicht präsent ist. Hinzu kommt, dass die Auto China es nicht nötig hat, ihr Themenspektrum zu erweitern. Durch das große Angebot an unterschiedlichen und auch einheimischen Autobauern, die vor allem bei den Themen Elektromobilität und autonomes Fahren enorm viel zu bieten haben, hat die Auto China jede Menge Interessantes zu bieten.
Klassische Automessen sind nicht mehr angesagt. Die IAA erweitert sein Themenspektrum auf Mobilität im Allgemeinen. In den Verkaufszahlen spiegelt sich das nicht wider. Der PKW-Bestand hat zuletzt sogar deutlich zugenommen. Wie passt das zusammen?
Ja, man sieht, dass das Auto gerade in Corona-Zeiten erheblich an Bedeutung gewonnen hat gegenüber öffentlichen Verkehrsmitteln. Und das dürfte auch erst mal der Trend bleiben. Virologen betonen schließlich, dass wir langfristig mit dem Virus leben müssen. Wir sehen das im Freizeitbereich. Caravans und andere Reisemobile erleben einen nie erwarteten Boom. Ich glaube, die IAA setzt zu stark auf populäre Themen, die vor der Pandemie aktuell waren oder allenfalls hierzulande angesagt sind, etwa die Sharing-Welt, die Erneuerung der Bahn, der Fahrradboom.
Das spiegelt aber nicht den weltweiten Trend wider. Es gibt eine große Neugierde auf Entwicklungen beim Elektroauto und autonomen Fahren. Ich glaube, beim Verband der IAA hat man diese Attraktivität nicht in allen Facetten gesehen, sondern hat Themen gewählt, die nicht alle den Nerv der Zeit treffen. Trends wie Reisemobile oder Facts und Infos zu Virenschutz im Auto wären spannend. Wenn ich mich für eine Veranstaltung entscheide, brauche ich ein Thema, das mich interessiert und nicht verwaschene Vielfalt. Die IAA bräuchte eine klarere Fokussierung.
Autonomes Fahren steht in München auf dem Programm.
Die deutschen Autobauer haben das Thema auf dem Schirm. Aber die Trends, das muss man ganz ehrlich sagen, werden derzeit im Silicon Valley und noch stärker in China gesetzt. In Shanghai und Peking gibt es mehr als 500 Kilometer lange Teststrecken. Selbst autonom fahrende LKWs werden dort schon ausprobiert. Das allein wäre ein eigenständiges Thema gewesen, das die ganze Messe bestimmen könnte.
Wenn ich sie allerdings auch mit Fahrrädern und Oldtimern vermenge, stellt sich die Frage: Wenn ich was über autonomes Fahren wissen will, erfahre ich das wirklich bei der IAA? Oder kriege ich ein Potpourri vorgesetzt von allem, was ein bisschen von allem ist? Da kann ich gleich zum Oktoberfest gehen. Die Gamescom in Köln zeigt wie man das machen kann und dort stellt man ja auch nicht das “Mensch-Ärgere-Dich-Nicht”-Spiel oder historische Brettspiele vor.
Ist dieses Potpourri womöglich Ausdruck davon, dass die deutschen Autobauer in diesen Bereichen nicht führend sind?
Dieser Mix an Themen drückt eher aus, dass es keine Strategie gibt, die alle gleichzeitig verfolgen. Bei Volkswagen setzt Vorstandschef Herbert Diess nun voll auf Elektromobilität. Andere Autobauer wie BMW sind vorsichtiger und sagen: Wir brauchen noch lange den Verbrennungsmotor. In dieser Dissonanz befindet sich auch die IAA.
Einer Studie des VDA zufolge gehen zwar mehr als 80 Prozent der befragten deutschen Autozulieferer davon aus, dass sich die Elektromobilität als neuer Standard durchsetzen wird, 88 Prozent rechnen aber erst 2030 oder später mit einer vollständigen Ablösung des Verbrennungsmotors.
Wer derart gelassen mit dem Thema umgeht, hat ein großes Risiko, dass es ihn übermorgen nicht mehr gibt.
Wie erklären Sie sich diese Gelassenheit?
Das ist je nach Zulieferer unterschiedlich. Wer Sitze herstellt, Scheiben oder Reifen, den tangiert die Umwälzung nur wenig. Betroffen sind die Zulieferer, die Abgasanlagen oder andere Teile für Verbrennungsmotoren herstellen. Die Großen haben die richtigen Weichen gestellt. Continental etwa hat den Bereich Antriebstechnik ausgegliedert. Firmen, wie Bosch werden in Zukunft Geschäfte verlieren, weil sie das Batteriegeschäft nicht können. Einen Teil dieser Umsatzeinbrüche werden sie jedoch mit der Entwicklung von IT und Software auffangen. BASF und andere Chemiekonzerne werden zu den Gewinnern gehören, weil ihre Substanzen für die Batterieherstellung benötigt werden. Das Problem sind die eher kleinen Firmen, die immer noch glauben, das Gewitter werde schon nicht so schlimm wie im Wetterbericht angekündigt.
Noch sind deutsche Autos in China sehr beliebt. Allein im ersten Halbjahr haben sie Rekordabsätze gemeldet. Bei der Elektromobilität hinken sie aber hinterher, zumal die chinesischen Autobauer äußerst innovativ sind.
Um Volkswagen und Daimler mache ich mir wenig Sorgen. Sie setzen voll auf elektrische Fahrzeuge, entwickeln Betriebssysteme, um die Fahrzeug-Software auch selbst zu beherrschen. Die Deutschen sind die größten Premium-Autobauer der Welt. Tesla holt in diesem Segment zwar auf. Doch der VW-Konzern mit Audi und Porsche und auch Daimler sind gut aufgestellt. BMW muss sich ran halten, kann es aber auch schaffen. Sie alle haben erkannt, dass in China die Zukunft der deutschen Autoindustrie liegt, nicht in Europa.
Mit dem Elektroauto ID.4 hatte VW in China einen eher schwierigen Start.
Beim Elektroauto spreizt sich der Markt in China derzeit. Die Chinesen kaufen entweder teure SUVs und Limousinen wie Tesla oder preisgünstige Kleinautos. Der ID.3 ist zwischendrin positioniert. Der Mini EV von Hong Guang etwa ist das meistverkaufte Elektroauto in China und umgerechnet für weniger als 4.000 Euro zu haben. Ich denke, VW wird mit den nächsten Karosserie-Varianten Marktanteile zurückholen.
Und wie sind die chinesischen Autobauer aufgestellt?
Sie holen massiv auf und werden auch nach Europa kommen. In Osteuropa sind sie bereits, punkten vor allem mit günstigen Fahrzeugen. Mit der Übernahme von Volvo durch Geely ist ein chinesisches Unternehmen auch in Westeuropa schon präsent. Und Geely ist ja auch bei Daimler mit zehn Prozent beteiligt. Der nächste Smart wird von Geely gebaut und nach Europa kommen. Die Unternehmen wachsen zusammen mit noch stärkerem chinesischem Akzent.
Die deutschen Autobauer werden chinesisch?
Das sind sie längst. VW, Audi, BMW und Mercedes bauen Autos nach chinesischem Geschmack, längere Abstände zum Beispiel. Und das wird so weitergehen. Der größte Markt entscheidet über den Standard. 2030 werden in China mehr als 30 Millionen Autos verkauft. Das ist doppelt so viel wie in Europa. Nur wer in China eine führende Position hat, wird noch zur Spitze gehören.
Die Deutschen sind zwar gut aufgestellt, müssen aber aufpassen: Toyota greift an, ebenso GM. Der chinesische Markt wird nicht mehr der sein, was er in der Vergangenheit war. Dort wird man nicht mehr mit einer ruhigen Gangart trotzdem gute Gewinne einfahren. Der Wettbewerb wird massiv zunehmen. VW und Daimler haben zuletzt gezeigt, dass sie sich neu erfinden können. Das ist das eigentliche Erfolgsrezept.
Ferdinand Dudenhöffer ist Deutschland renommiertester Experte der Automobilwirtschaft, was ihm den Ruf als “Autopapst” einbrachte. Bis 2020 war er Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Universität Duisburg-Essen. Inzwischen leitet er das privatwirtschaftlich betriebene Forschungsinstitut CAR-Center Automotive Research in Duisburg.

Deutsche Automanager dürften in den letzten eineinhalb Jahren mit sehr gemischten Gefühlen auf China geblickt haben. Zwar hat ihnen das Geschäft in der Volksrepublik während der Corona-Krise die Bilanz gerettet. Gleichzeitig mussten Volkswagen, Daimler und BMW jedoch hinnehmen, dass trotz eigener Modell-Offensiven das Geschäft mit E-Autos dort weiterhin fest in der Hand chinesischer Hersteller liegt. Sie standen Jahre früher als die Deutschen in den Startlöchern und scheinen nicht bereit zu sein, ihren Vorsprung im eigenen Heimatmarkt wieder abzugeben.
Im vergangenen Jahr verfügten 6,3 Prozent aller verkauften Autos in China über einen elektrischen Antrieb. In diesem Jahr, so schätzt das Analyse-Unternehmen Canalys, sollen rund 1,9 Millionen E-Autos an chinesische Kunden ausgeliefert werden – dann wären bereits neun Prozent aller Neuwagen in China elektrisch unterwegs. Nährboden für die chinesische E-Autoindustrie ist ein milliardenschwerer Plan der Regierung in Peking, die auf einen massiven Ausbau der Elektromobilität setzt. Hohe Subventionen und gleichzeitige Beschränkungen für Benziner auf den Straßen haben dazu beigetragen, dass dem E-Auto in China schneller der Weg bereitet werden konnte, als in Europa.
Fest steht jedoch: Ein Patentrezept auf Erfolg gibt es dabei nicht. Die Geschäftsmodelle der chinesischen Angreifer könnten diverser kaum ausfallen. Das im Juli zum elften Mal in Folge meistverkaufte E-Auto des Monats war keine Luxuskarosse, sondern das Mini-E-Mobil Wuling Hongguang, ein Stromer für den schmalen Geldbeutel. Den Erfolg verdankt das Unternehmen auch seiner schnellen Anpassungsfähigkeit an den Markt. “Die Mentalität unseres Unternehmens ist es, alles zu produzieren, was die Leute brauchen”, sagte Wulings Marketingchef Zhang Yiqin in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg. Als klar war, dass der kleine Elektro-Flitzer vor allem bei jungen Frauen gut ankommt, reagierte Zhang prompt und heuerte für sein Team noch mehr weibliche Mitarbeiter an, um Werbung und Marketing zu entwickeln.
Doch die chinesischen Hersteller können längst nicht nur billig. Die größten Innovationstreiber sind junge Unternehmen, die ausschließlich auf Elektro setzen. Viele von ihnen verzeichnen bereits erstaunliche Absatzerfolge: Der Hersteller Nio hat die Zahl seiner ausgelieferten Fahrzeuge im vergangenen Jahr auf knapp 44.000 verdoppelt, beim heimischen Konkurrenten Xpeng waren es 27.000; bei Li Auto rollten gleich im ersten Produktionsjahr mehr als 32.000 Autos aus der Fabrik.
Im Vergleich zu den 500.000 Autos, die der amerikanische E-Pionier Tesla im vergangenen Jahr weltweit verkaufte, wirken diese Zahlen bescheiden. Doch die Erwartungen sind gewaltig, auch bei Investoren. Nio wird an der Börse bereits ähnlich hoch bewertet wie die Branchengröße BMW. Und auch Great Wall Motor, SAIC, BYD, Geely und Xpeng zählen bereits zu den 20 weltweit wertvollsten, börsennotierten Automarken.
Seit Anfang des Jahres hat sich der Aktienwert des Shenzhener E-Autoherstellers BYD fast versiebenfacht und steigt weiter. Allein in der Woche vom 28. Juli legte die BYD-Aktie um über 40 Prozent zu und erreichte am 9. August ihr Allzeithoch.
Batterien von BYD gehören in der Mischung aus Sicherheit, Reichweite und Kosten zu den besten der Welt. Und mit dem Modell “Dolphin” traut sich BYD als erster chinesischer Hersteller mit einem international wettbewerbsfähigen Produkt im Kleinwagensegment anzugreifen. Das ist nicht weniger als eine direkte Attacke auf die ID-Reihe von Volkswagen, die wesentlich teurer ist.
Der Dolphin wurde im April auf der Autoshow in Shanghai erstmals vorgestellt. Er ist seit dem 13. August im Vorverkauf erhältlich, die ersten Fahrzeuge werden in diesen Tagen ausgeliefert. Der Stromer hat ungewöhnliche Abmessungen. Er ist mit seinen gut vier Metern Länge, 1,80 Meter Breite und 1,60 Meter Höhe je nach Ausführung zwischen 15 und 30 Zentimeter kürzer als der Golf, gleichzeitig jedoch 15 Zentimeter höher. Das bedeutet: Er passt in kleinere Parklücken und fühlt sich innen dennoch großräumig und luftig an. Mit 2.700 Millimetern Radstand ist er nur wenig kürzer als der VW ID.4 mit 2.770 Millimetern, jedoch 18 cm kürzer als der Tesla Model 3. Elon Musk hat bereits ein kleineres Modell angekündigt.
Die Formensprache des Dolphin orientiert sich an der “Ästhetik des Ozeans”. Gestaltet hat ihn BYD-Designchef Wolfgang Egger, der von Audi kommt. Die Fahrzeuge sollen ein junges, urbanes Lebensgefühl aussstrahlen, fernab der Lieblosigkeit, mit der BYDs chinesische E-Auto-Wettbewerber ihre Kleinwagen präsentieren. Ein Design-Clou sind die Heckleuchten. “Sie übernehmen optische Strukturen aus der Ming-Zeit”, erläutert Egger. Damit lässt sich dieses Auto auch von hinten sofort wiedererkennen.
Auch die Infotechnik passt: Der Dolphin ist mit einem drehbaren 13-Zoll-Bildschirm ausgestattet. Er macht also einem mittelgroßen Notebook Konkurrenz. Und: Das Auto lässt sich mittels Smartphone öffnen. Der kleine BYD-Stromer hat zudem eine Wärmepumpe, die es ermöglicht, batterieschonend die Abwärme des Autos zur Beheizung der Fahrzeuge zu verwenden. Das ist vor allem für den Norden Chinas wichtig, wo es im Winter sibirisch kalt wird.
Den neuen Zwerg von BYD gibt es in drei Varianten mit einer Reichweite von 300 bis 400 Kilometern, die Zahlen sind allerdings nach chinesischer Norm gerechnet. Besonders attraktiv sind die Ladezeiten. Innerhalb einer halben Stunde lässt sich die Batterie wieder weitgehend füllen. Bei BYD ist man überzeugt, dass auch in China das Zeitalter der Kompaktfahrzeuge anbricht, vor allem in den Metropolen.
Vorerst wird es den Dolphin nur in China geben. Die ersten Autos von BYD sind allerdings schon in Europa erhältlich. In diesem Sommer wurden die ersten 100 Exemplare des vergleichsweise konventionellen E-SUV Tang in den Pilot-Markt Norwegen geschickt. “Die Menschen empfangen Autos aus China nicht mit offenen Armen”, weiß Isbrand Ho, der Europa-Chef von BYD in Rotterdam. “Deswegen müssen unsere Autos besonders gut sein. Und unser Service noch besser.” BYD müsse im Fall von Problemen dem Kunden zeigen, dass man für ihn da sei. Deshalb lasse sich BYD nicht unter Druck setzen mit einem Markteintritt nach Europa. “Wenn wir scheitern, heißt es nicht: BYD ist gescheitert, sondern chinesische Autos sind gescheitert”, glaubt Ho. “Wir haben diesbezüglich eine große Verantwortung. Es wird nicht einfach, die Marke zu etablieren.” Deshalb ist noch nicht klar, wie schnell die Fahrzeuge auch in anderen EU-Märkten zu haben sind. Und vor allem, wann der Dolphin auf den Heimatmarkt des ID.3 kommt.
Während der Dolphin gerade ist in den Verkauf gegangen ist, generiert das Unternehmen mit seinem etablierten Modell Han bereits sehr erfolgreich Marktanteil und Umsatz. Das Auto, das vor Extras strotzt und gut aussieht, gibt es für umgerechnet 33.000 Euro. Zum Vergleich: Der Tesla S schafft mit einer Batterieladung rund 650 Kilometer. Zwar beschleunigt er eine Sekunde schneller als der Han, kostet jedoch umgerechnet knapp 77.000 Euro.
Derzeit zeichnet sich auch ab, dass die chinesischen Elektroautos zumindest auf ihrem Heimatmarkt deutlich besser laufen als die neue deutsche Konkurrenz. Im Juli hat VW immerhin schon 5.800 ID.3s verkauft. Das waren zwar deutlich mehr als im Juni mit nur fast 3.000 Stück. Doch Nio und Xpeng haben jeweils rund 8.000 Fahrzeuge verkauft. BYD ist sogar über 50.000 Fahrzeuge los geworden. Also knapp neunmal so viele wie VW. Im Vergleich zum Vorjahr ist es BYD gelungen, die Verkäufe zu verdreifachen.
Klar ist schon jetzt: Es wird hart für VW & Co. Nach dem Abzug der staatlichen Subventionen zahlen die Kunden in China umgerechnet zwischen 12.600 und 16.300 Euro für den Dolphin, der wertiger und pfiffiger aussieht. Der Startpreis für den ID.4 in der kleinen Version beträgt hingegen schon 25.000 Euro. Die von der Ausstattung her mit dem Dolphin vergleichbare Edition des ID.4 kostet sogar rund 36.000 Euro, also mehr als das doppelte. Es kann durchaus sein, dass in puncto Sicherheit und Qualität VW höhere Standards hat. Doch die Frage ist: Will der Kunde das für ein Stadtauto bezahlen? Der ID.3 kommt überhaupt erst Ende des Jahres nach China.
Das Marketing des ID.4 ist ebenfalls verunglückt: Die Zahl vier klingt im Chinesischen wie das Wort Tod. In den nächsten Monaten wird sich an den Verkaufszahlen zeigen, welches der beiden Autos besser einschlägt, nachdem der ID.4 ein paar Monate Vorsprung hat. Auf dieses Duell wird die Branche schauen.
Bei BYD denkt man schon an die nächsten Schritte: Inzwischen mehren sich Gerüchte, das BYD im ersten Quartal 2021 eine neue Premiummarke mit eigenem Händlernetz startet. Noch in diesem Jahr soll Gerüchten zufolge ein neues Oberklasseauto auf den Markt kommen. Damit würde BYD das gesamte Spektrum abdecken.
Immer mehr internationale Experten bescheinigen den Chinesen, ihre Hausaufgaben gemacht zu haben und Autos von höchster Qualität zu bauen. So erhielt der chinesische Hersteller Aiways, der seinen Elektro-SUV U5 mittlerweile auch in Deutschland anbietet, kürzlich sogar vom ADAC einen Ritterschlag: “Der Aiways U5 beweist, dass Autos, die in China gebaut werden, schon lange nicht mehr billig im Sinne von qualitativ minderwertig sein müssen”, so die ADAC-Experten. Das chinesische Auto bewege sich etwa im Vergleich mit dem Konkurrenzprodukt EQC von Mercedes in vielen Disziplinen auf Augenhöhe, schneide in mancher Hinsicht sogar besser ab – und koste nur halb so viel.
Auch Experten der Unternehmensberatung McKinsey haben etliche Made-in-China-Mobile auseinandergenommen, um deren Leistungsstärke zu ermitteln. Das Ergebnis: “Die in China hergestellten Modelle unserer Untersuchung überflügeln internationale Autobauer an zwei Fronten: bei Bedienung und Kundenerlebnis (durch bessere Vernetzung) und bei der Batterietechnik.” Die Fahrzeuge hätten mit “massiven technologischen Verbesserungen” in den vergangenen zwei Jahren deutlich aufgeholt.
Doch nicht nur Technologie macht den Unterschied. Auch bei ihren Vertriebsmodellen zeigen sich die Chinesen smart. Geely etwa setzt bei seinen Europaplänen auf ein Abo-Konzept: In Deutschland, Schweden, Frankreich, Spanien, den Niederlanden und Belgien gibt es Autos der jungen Konzernmarke Lynk & Co für 500 Euro im Monat, Steuer, Versicherung, Wartung und Reifenwechsel inklusive. Große Wahlmöglichkeiten gibt es für die Konsumenten in diesem Fall nicht: blau oder schwarz. Hybrid oder Plug-in-Technik, bei der Akkus sowohl über den Verbrennungsmotor als auch per Kabel geladen werden können. Das war es auch schon mit den Optionen. Mit dieser Einfachheit will Geely vor allem bei jungen Fahrern punkten.
Nio präsentiert seine Fahrzeuge dagegen in China und wohl bald auch in Europa über sogenannte Nio Houses, in denen es neben Wohnzimmer, Küche und Bibliothek auch Spielflächen für Kinder gibt. Das erste House außerhalb Chinas entsteht derzeit in Oslo, Nio will es im September auf 2.000 Quadratmetern im Zentrum der Hauptstadt Norwegens eröffnen. Frank Sieren/Gregor Koppenburg/Joern Petring
Um Wohnraum in den Städten Chinas bezahlbarer zu machen, dürfen künftig die Kosten für Mietwohnungen jährlich höchstens um fünf Prozent steigen. “Neue Stadtbewohner und junge Menschen haben erst seit relativ kurzer Zeit gearbeitet und verfügen nur über ein geringes Einkommen, sodass sie kaum in der Lage sind, ein Haus zu kaufen oder Miete zu zahlen”, erklärte der stellvertretende Wohnungsbauminister Ni Hong am Mittwoch. In den Großstädten gehören 70 Prozent der Zugezogenen und vor allem junge Leute zum Kreis der Mieter.
Peking hatte zuletzt auch die Hypothekenzinsen in den Großstädten erhöht und gleichzeitig versprochen, den Bau von staatlich subventionierten Mietwohnungen zu beschleunigen. In Anlehnung an Staats- und Parteichef Xi Jinpings Worte, dass “Wohnen zum Leben da ist und nicht zur Spekulation” hatten die Behörden begonnen, die Finanzierungsmodelle von Bauentwicklern genauer unter die Lupe zu nehmen. Sie haben auch die Preise von Immobilien, die neu auf den Markt kommen, analysiert.
Die Regulierung passt ins Gesamtbild des neuen Kurses, sozialer zu werden. “Chinas Immobiliensektor war eine der größten Ursachen für Unzufriedenheit und die Regierung ist fest entschlossen, die Preise zu kontrollieren, damit sie nicht zu sozialen Unruhen führen, sagte Liao Ming, Gründungspartner der Investmentgesellschaft Prospect Avenue Capital aus Peking, gegenüber Bloomberg. “Die Maßnahmen spiegeln die politischen Eindämmungen im Bildungsbereich wider, da sie darauf abzielen, die öffentliche Angst vor Ungleichheit zu lindern” (China.Table berichtete).
Zuletzt hatten sich die Wohnkosten in den Städten allein in den Monaten Juli und Juni um jeweils über zehn Prozent verteuert, wie Daten der Nationalen Statistikbehörde zeigen. In der Hauptstadt Peking und der Wirtschaftsmetropole Shenzhen wurden in diesem Jahr Schritte eingeleitet, um das Angebot an Mietwohnungen zu erhöhen. In den vergangenen Monaten haben mehrere Großstädte auch neue Vorschriften zur Vermietung von Wohnungen geplant. Die Maßnahmen zielen auf die Stärkung der Rechte für Mieter und die Minderung der Höhe der Kautionen ab, die ein Vermieter fordern darf. Ab Oktober gilt eine Steuererleichterung für Mietwohnungsunternehmen, so China Daily. niw
Seit Mittwoch macht Chinas Maritime Safety Administration für ausländische Schiffe eine Meldepflicht im Südchinesischen Meer geltend. Demnach sollen die Schiffe dazu verpflichtet werden, detaillierte Informationen an die chinesischen Behörden zu übermitteln, wenn sie in Gewässer eintreten, die Peking als Teil seines Territoriums reklamiert. Internationale Beobachter halten diese Meldepflicht für rechtswidrig.
Betroffen sind U-Boote, Nuklearschiffe, Tanker und alle Schiffe, die China als eine Bedrohung für die Sicherheit seines Seeverkehrs ansieht. Nach Vorstellung der Seesicherheitsbehörde sollen die vermeintlichen Eindringlinge ab sofort sich und ihre Ladung identifizieren, wenn sie die besagten Zonen kreuzen.
Die Volksrepublik China nimmt große Teile des Südchinesischen Meeres für sich in Anspruch und erklärt vergleichbare Interessen der Anrainerstaaten für irrelevant. Atolle und Sandbänke, tausende Kilometer entfernt von der eigenen Südküste, hat die Regierung zu chinesischem Grund und Boden erklärt. Um ihren Anspruch deutlich zu machen, schüttet die Volksrepublik künstliche Inseln auf und bebaut sie mit Militärbasen und kleinen Siedlungen.
Damit versucht die Regionalmacht, Fakten zu schaffen, ehe sie sich mit den Anrainerstaaten auf einen Verhaltenskodex einigt, dessen Implementierung seit einer Weile diskutiert und auch von den USA unterstützt wird. Bereits 2016 hatte der Internationale Gerichtshof in Den Haag Chinas Gebietsansprüche für unrechtmäßig erklärt. Peking fühlt sich an die Rechtsprechung jedoch nicht gebunden. Experten halten es wegen der fehlenden Rechtsgrundlage für äußerst unwahrscheinlich, dass sich andere Staaten, vornehmlich die USA, an die chinesische Forderung halten werden. grz
Ein Gericht in Hongkong hat am Dienstag weitere Urteile gegen pro-demokratische Aktivisten und ehemalige Politiker gesprochen. Im Mittelpunkt des Verfahrens standen die Ereignisse rund um eine nicht genehmigte Demonstration am 20. Oktober 2019. Damals hatte die Civil Human Rights Front (CHRF) zu einem Aufmarsch gegen ein öffentliches Maskenverbot und Polizeigewalt aufgerufen, dem geschätzte 350.000 Menschen gefolgt waren.
Die Demonstration verlief friedlich, bis im späteren Verlauf ein Bruchteil der Demonstranten die Polizei in Tsim Sha Tsui auf der Halbinsel Kowloon mit Molotow-Cocktails angriff und erhebliche Schäden anrichtete. Sieben Organisatoren der Veranstaltung wurden nun zur Verantwortung für die Eskalation gezogen und mit Haftstrafen von elf bis 16 Monaten belegt.
Die längsten Strafen erhielten die früheren Parlamentarier Leung Kwok-hung, genannt “Long Hair”, und Albert Ho Chun-yan. Sechs der sieben Angeklagten saßen bereits vor dem Richterspruch wegen anderer Vergehen im Zusammenhang mit der Protestbewegung in Haft und müssen nach dem Absitzen ihre neuen Strafen antreten.
Die CHRF wurde derweil vor wenigen Wochen aufgelöst, weil der Druck seit Einführung des Nationalen Sicherheitsgesetzes in Hongkong auf politische Organisationen mit pro-demokratischen Zielen immens gewachsen ist. Das Sicherheitsgesetz gibt Ermittlern und Justiz seit Juli vergangenen Jahres ein wirkungsvolles Werkzeug an die Hand, mit dem unter dem Deckmantel rechtsstaatlicher Prinzipien politischer Dissens hart bestraft werden kann (China.Table berichtete). Zurzeit warten 47 Oppositionelle auf ihren Prozess wegen Verstößen gegen das Sicherheitsgesetz. grz
Die Europäische Union möchte mit neu geschaffenen Vorgaben für den europäischen Markt auch China dazu bewegen, sich im Bereich der öffentlichen Beschaffung zu öffnen. Es müsse Gegenseitigkeit und Wettbewerbsgleichheit herbeigeführt werden, betonten mehrere EU-Abgeordnete am Mittwoch bei der Vorstellung des entsprechenden Berichts über das “International Procurement Instrument” (IPI) im Ausschuss für internationalen Handel. Während bei öffentlichen Ausschreibungen für Unternehmen aus Drittländern innerhalb der EU “Tür und Tor” offen stünden, wollten manche Handelspartner ihre Türe gar nicht öffnen, kritisierte der CDU-Europapolitiker Daniel Caspary, der federführend für die Ausarbeitung der Position des EU-Parlaments zu IPI ist. Es müsse eine Möglichkeit geben, besser Druck machen zu können, “wo wir nicht zum Zuge kommen”, so Caspary.
Die Abgeordneten des Ausschusses und mehrere Interessensvertreter aus dem Beschaffungswesen sprachen sich bei der Vorstellung gegen den von den EU-Mitgliedsstaaten vorgeschlagenen Preisanpassungsmechanismus aus. Sie forderten, dass durch das IPI eine Möglichkeit geschaffen werden müsse, um staatlich geförderte Unternehmen aus der Volksrepublik von Ausschreibungen ganz ausschließen zu können.
Der Vorschlag der EU-Mitgliedsstaaten sieht derzeit einen Preisaufschlag vor, wenn ein aus China abgegebenes Angebot zu billig ist. In der Position des Europaparlaments ist zudem die Freigabe für Ausnahmen aus dem IPI bei der EU-Kommission in Brüssel gelagert, die EU-Staaten wollen, dass diese Kompetenz bei den Mitgliedsländern liegt. Der Bericht bedarf nun einer Mehrheit im EU-Parlament, Ende des Jahres ist Caspary zufolge mit einer Abstimmung im Plenum zu rechnen. Danach erfolgt der Trilog mit der Kommission und dem Rat.
Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten stimmte am Mittwoch zudem erstmals über einen Berichtsentwurf über die Beziehungen zwischen der EU und Taiwan ab. In dem Papier wird unter anderem die Unterzeichnung eines offiziellen Partnerschaftsabkommens und eine Folgenabschätzung für ein bilaterales Investitionsabkommen gefordert. In dem Bericht wird China zudem aufgefordert, “von destabilisierenden Handlungen gegenüber Taiwan abzulassen”. Taiwan soll zudem als regionale Wirtschaftsmacht in die anstehende Strategie für den indopazifischen Raum, die derzeit vom Europäischen Auswärtigen Dienst ausgearbeitet wird, aufgenommen werden. Der Berichtsentwurf wurde im Ausschuss mit großer Mehrheit angenommen. Wann der Bericht im Plenum abgestimmt wird, war noch nicht klar. ari
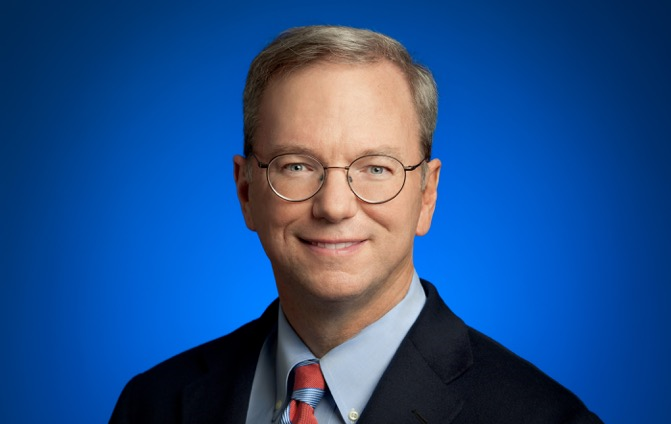
Die Welt fängt gerade erst an, sich damit auseinanderzusetzen, wie tiefgreifend die KI-Revolution sein wird. KI-Technologien werden Wellen des Fortschritts in den Bereichen kritische Infrastruktur, Handel, Transport, Gesundheit, Bildung, Finanzmärkte, Nahrungsmittelproduktion und ökologische Nachhaltigkeit auslösen. Die erfolgreiche Einführung von künstlicher Intelligenz wird die Wirtschaft vorantreiben, die Gesellschaft umgestalten und bestimmen, welche Länder die Regeln für das kommende Jahrhundert festlegen.
Diese sich bietende Chance fällt mit einem Moment der strategischen Verwundbarkeit zusammen. US-Präsident Joe Biden hat gesagt, dass sich Amerika in einem “langfristigen strategischen Wettbewerb mit China” befinde, womit er Recht hat. Verwundbar sind jedoch nicht nur die Vereinigten Staaten, sondern auch die gesamte demokratische Welt, denn die KI-Revolution untermauert den aktuellen Wertekampf zwischen Demokratie und Autoritarismus. Wir müssen beweisen, dass Demokratien in einer Ära der technologischen Revolution erfolgreich sein können.
China ist jetzt ein gleichwertiger technologischer Konkurrent. Es ist organisiert, mit Ressourcen ausgestattet und entschlossen, diesen Technologiewettbewerb zu gewinnen und die globale Ordnung zugunsten seiner eigenen begrenzten Interessen umzugestalten. KI und andere aufkommende Technologien sind von zentraler Bedeutung für Chinas Bemühungen, seinen globalen Einfluss auszuweiten, die wirtschaftliche und militärische Macht der USA zu übertreffen und die Stabilität im eigenen Land zu sichern. China führt einen zentral gesteuerten systematischen Plan aus, um durch Spionage, Anwerbung von Talenten, Technologietransfer und Investitionen KI-Wissen aus dem Ausland zu gewinnen.
Chinas Einsatz von künstlicher Intelligenz im eigenen Land ist für Gesellschaften, die individuelle Freiheit und Menschenrechte schätzen, äußerst bedenklich. Der Einsatz von KI als Instrument der Unterdrückung, Überwachung und sozialen Kontrolle im eigenen Land wird auch ins Ausland exportiert. China finanziert massive digitale Infrastrukturprojekte auf der ganzen Welt und versucht gleichzeitig, globale Standards zu setzen, die autoritäre Werte widerspiegeln. Seine Technologie wird zur sozialen Kontrolle und zur Unterdrückung abweichender Meinungen eingesetzt.
Um es klar zu sagen: Der strategische Wettbewerb mit China bedeutet nicht, dass wir nicht mit China zusammenarbeiten sollten, wo es sinnvoll ist. Die USA und die demokratische Welt müssen weiterhin mit China in Bereichen wie der Gesundheitsversorgung und dem Klimawandel zusammenarbeiten. Es wäre kein gangbarer Weg, den Handel und die Zusammenarbeit mit China einzustellen.
Chinas schnelles Wachstum und seine Konzentration auf soziale Kontrolle haben sein techno-autoritäres Modell für autokratische Regierungen attraktiv und für fragile Demokratien und Entwicklungsländer verlockend gemacht. Es muss noch viel getan werden, um sicherzustellen, dass die USA und die demokratische Welt wirtschaftlich tragfähige Technologie mit Diplomatie, Auslandshilfe und Sicherheitskooperation verbinden können, um mit Chinas exportiertem digitalen Autoritarismus zu konkurrieren.
Die USA und andere demokratische Länder holen bei der Vorbereitung auf diesen globalen Technologiewettbewerb auf. Am 13. Juli 2021 veranstaltete die Nationale Sicherheitskommission für künstliche Intelligenz (NSCAI) einen globalen Gipfel für neue Technologien, der einen wichtigen komparativen Vorteil der USA und unserer Partner auf der ganzen Welt aufzeigte: das breite Netzwerk von Allianzen zwischen demokratischen Ländern, das auf gemeinsamen Werten, der Achtung der Rechtsstaatlichkeit und der Anerkennung der grundlegenden Menschenrechte beruht.
Letztendlich ist der globale Technologiewettbewerb ein Wettbewerb der Werte. Gemeinsam mit Verbündeten und Partnern können wir bestehende Rahmenbedingungen stärken und neue erkunden, um die Plattformen, Standards und Normen von morgen zu gestalten und sicherzustellen, dass sie unsere Grundsätze widerspiegeln. Der Ausbau unserer globalen Führungsrolle in den Bereichen technologische Forschung, Entwicklung, Governance und Plattformen wird die Demokratien der Welt in die beste Lage versetzen, neue Chancen zu nutzen und sich gegen Schwachstellen zu schützen. Nur wenn wir bei der Entwicklung von KI weiterhin führend bleiben, können wir Standards für die verantwortungsvolle Entwicklung und Nutzung dieser wichtigen Technologie setzen.
Der Abschlussbericht der NSCAI enthält einen Fahrplan für die demokratische internationale Gemeinschaft, um diesen Wettbewerb zu gewinnen.
Erstens muss die demokratische Welt die bestehenden internationalen Strukturen – einschließlich der NATO, der OECD, der G7 und der Europäischen Union – nutzen, um die Bemühungen zur Bewältigung aller mit KI und neuen Technologien verbundenen Herausforderungen zu intensivieren. In diesem Zusammenhang ist die derzeitige G7-Präsidentschaft des Vereinigten Königreichs mit ihrer soliden Technologieagenda und ihren Bemühungen um eine verstärkte Zusammenarbeit bei einer Reihe von digitalen Initiativen ermutigend. Die Entscheidung der G7, Australien, Indien, Südkorea und Südafrika einzubeziehen, spiegelt die wichtige Erkenntnis wider, dass wir demokratische Länder aus aller Welt in diese Bemühungen einbeziehen müssen.
Ebenso ist der neu ins Leben gerufene Handels- und Technologierat zwischen den USA und der EU (der in vielerlei Hinsicht die Forderung der NSCAI nach einem strategischen Dialog zwischen den USA und der EU über aufkommende Technologien widerspiegelt) ein vielversprechender Mechanismus, um die größten Handelspartner und Volkswirtschaften der Welt zusammenzubringen.
Zweitens brauchen wir neue Strukturen, wie z. B. die Vierergruppe – die USA, Indien, Japan und Australien -, um den Dialog über KI und neue Technologien und deren Auswirkungen auszuweiten und die Zusammenarbeit in den Bereichen Normenentwicklung, Telekommunikationsinfrastruktur, Biotechnologie und Lieferketten zu verbessern. Die Vierergruppe kann als Grundlage für eine breitere Zusammenarbeit in der indo-pazifischen Region zwischen Regierung und Industrie dienen.
Und drittens müssen wir mit unseren Verbündeten und Partnern zusätzliche Allianzen rund um KI und künftige Technologieplattformen aufbauen. Die NSCAI hat zur Gründung einer Koalition entwickelter Demokratien aufgerufen, um die Politik und die Maßnahmen im Bereich der KI und neuer Technologien in sieben kritischen Bereichen zu synchronisieren:
Dieser Schwung kann nur durch Zusammenarbeit aufrechterhalten werden. Partnerschaften – zwischen Regierungen, mit dem Privatsektor und mit der Wissenschaft – sind ein entscheidender asymmetrischer Vorteil, den die USA und die demokratische Welt gegenüber unseren Konkurrenten haben. Wie die jüngsten Ereignisse in Afghanistan gezeigt haben, sind die Fähigkeiten der USA für verbündete Operationen nach wie vor unverzichtbar, aber die USA müssen mehr tun, um Verbündete für eine gemeinsame Sache zu gewinnen. Diese Ära des strategischen Wettbewerbs verspricht, unsere Welt zu verändern. Wir können diesen Wandel entweder gestalten oder von ihm mitgerissen werden.
Wir wissen heute, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz in allen Lebensbereichen zunehmen wird, da sich das Innovationstempo weiter beschleunigt. Wir wissen auch, dass unsere Gegner entschlossen sind, die Fähigkeiten der KI gegen uns einzusetzen. Jetzt müssen wir handeln.
Die Grundsätze, die wir aufstellen, die Investitionen, die wir tätigen, die Anwendungen für die nationale Sicherheit, die wir einsetzen, die Organisationen, die wir umgestalten, die Partnerschaften, die wir schmieden, die Koalitionen, die wir bilden, und die Talente, die wir fördern, werden den strategischen Kurs für Amerika und die demokratische Welt bestimmen. Demokratien müssen investieren, was immer nötig ist, um die Führung im globalen Technologiewettbewerb zu behalten, um KI verantwortungsvoll zu nutzen, um freie Menschen und freie Gesellschaften zu verteidigen und um die Grenzen der Wissenschaft zum Wohle der gesamten Menschheit zu erweitern.
Die künstliche Intelligenz wird die Welt neu ordnen und den Lauf der Menschheitsgeschichte verändern. Die demokratische Welt muss diesen Prozess anführen.
Eric Schmidt, ehemaliger CEO und Vorsitzender von Google/Alphabet, ist Vorsitzender der National Security Commission on Artificial Intelligence. Übersetzung: Andreas Hubig
Copyright: Project Syndicate, 2021.
www.project-syndicate.org
Linda Gao ist neue Geschäftsführerin des Automobilunternehmens Inalfa Roof Systems. Vorher hat sie sechs Jahre lang das Geschäft von Inalfa in China aufgebaut. Gao hat mehr als 20 Jahre in der Automobilindustrie gearbeitet und soll in ihrer neuen Rolle das Transformationsprogramm des Unternehmens als Vorlage für die langfristigen Wachstumspläne auf dem weltweiten Automobilmarkt leiten. Inalfa Roof Systems stellt weltweit für nahezu alle großen Auto- und Lkw-Hersteller die Dachsysteme her. Das Unternehmen ist Teil der BHAP-Gruppe, die zu den größten Zulieferern von Automobilteilen in China gehören.
Mads Fink Eriksen ist neues Vorstandsmitglied der Schuhmarke Ecco. Bisher war er seit 2020 CFO der Ecco-Gruppe. Er arbeitet seit zehn Jahren bei Ecco, zunächst in China, gefolgt von mehreren Jahren in Singapur in der globalen Produktionszentrale des Unternehmens. 2018 zog es ihn nach Australien, wo er die Vertriebsorganisation von Ecco erfolgreich umstrukturierte. Ecco hatte vor der Pandemie eine Hightech-Lederfabrik in Xiamen, China eröffnet. Die Umsätze in China sind zuletzt besonders stark um über zehn Prozent auf 248 Millionen Euro gestiegen, während sie in Europa um sieben Prozent zurückgingen.

Eine Medaille zum Schulbeginn bekommen Grundschüler in Guangzhou. Zum 1. September hat das neue Schuljahr begonnen. In einigen Provinzen dürfen Kinder von ungeimpften Eltern zwar noch nicht zurück in den Unterricht. Aber auch Kinder zwischen 12 und 17 Jahren sind in manchen Gegenden im Land noch vom Unterricht ausgeschlossen, solange sie noch ungeimpft sind. China ist eines der Länder, die seinen heimischen Impfstoff für Kinder ab drei Jahren freigegeben hat. Da, wo die Schule startet, müssen die Kinder im Unterricht Masken tragen.
