lange wurde sie erwartet, vergangene Woche hat die Regierung sie endlich veröffentlicht: die nationale China-Strategie. Mindestens genauso spannend wie deren Inhalte ist die Frage, wie sie aufgenommen und interpretiert werden. Merics-Direktor Mikko Huotari ordnet im Interview mit Finn Mayer-Kuckuk ein, was das Dokument bewirken kann. Huotari sagt: Auch wenn die China-Strategie nur wenig wirklich Überraschendes geboten hat – es ist nicht selbstverständlich, mit welcher Klarheit und Deutlichkeit die deutsche Regierung hier erstmals kommuniziert.
Peking nimmt das bisher gelassen: Unsere zweite Analyse sammelt die Reaktionen aus China und Deutschland – inklusive der eigenwilligen Interpretation des Autobauers Volkswagen.
Viele interessante Erkenntnisse bei der Lektüre wünscht


Die Strategie ist da. War das jetzt der Befreiungsschlag?
Nein, kein Befreiungsschlag und auch kein großer Wurf – aber ein wichtiger, der die deutlichen Veränderungen in der deutschen Chinapolitik markiert. In der Substanz ist wenig völlig überraschend. Vieles von dem, was da drinsteht, wurde seit Monaten diskutiert. Dass die Klarheit in der Beschreibung und deutlichen Ansprache von Risiken und Herausforderungen insgesamt bewahrt wurde, ist nicht selbstverständlich und zeigt, dass es im Kern eben doch relativ große Einigkeit in der Bundesregierung gibt.
Hat zumindest eine Neudefinition des deutschen Verhältnisses zu China stattgefunden oder liefert das Papier nur eine Bestandsaufnahme?
Die Neudefinition des Verhältnisses zu China hat nicht mit diesem Dokument stattgefunden, sondern sie begann spätestens mit dem Koalitionsvertrag und wurde über die vergangenen Monate austariert.
Es gab erste kritische Reaktionen von chinesischer Seite, beispielsweise von der Botschaft hier in Berlin. Wird die Strategie die Beziehungen nachhaltig belasten?
Ich erwarte jetzt keine große Konsequenz im Sinne von Stress in den Beziehungen, der hochgefahren wird, um zu zeigen, dass man sehr unzufrieden ist. China ist bereits darauf eingestellt gewesen, dass diese Strategie kommt. Chinas Premier Li Qiang hat bei seinem Besuch in Berlin im Juni schon versucht, den Gedanken des De-Riskings auszuhebeln, indem er es als reine Hausaufgabe für Unternehmen dargestellt hat.
Das Auswärtige Amt versichert, die Sprache des Dokuments sei so gewählt, dass Peking keine inakzeptablen Formulierungen findet.
Tatsächlich stört sich die chinesische Seite bereits am “De-Risking”. Außerdem wird sich Peking weiterhin gegen die Einordnung als systemischer Rivale oder sicherheitspolitische Herausforderung verwehren.
Was wird jetzt im Hinblick auf das De-Risking der Wirtschaft passieren?
Die Strategie sieht konkrete Schritte vor, beispielsweise eine verschärfte Prüfung chinesischer Investitionen hierzulande und eine Verschärfung der Exportkontrollen. Dazu kommt der Schutz der kritischen Infrastruktur und Maßnahmen zur Reduktion von Abhängigkeiten bei kritischen Rohstoffen. All das kann bereits weitreichende Auswirkungen auf Unternehmen haben. Die genaue Umsetzung von Risikoanalysen bleibt allerdings noch unklar.
Was ist die größte Änderung?
Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat von den Unternehmen ausdrücklich mehr Transparenz eingefordert, damit die Regierung den Risiken entgegenwirken kann. Da wird die Politik schon bei den Unternehmen nachfragen in den kommenden Monaten. Dieser Prozess hat allerdings noch kein institutionelles Gewand und wird sicher höchst umstritten bleiben.
Sollte beispielsweise das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle BAFA die Einhaltung von Transparenzregeln kontrollieren?
Die meisten würden so eine – sehr bürokratische – Lösung gerne vermeiden. Die Regierung will stattdessen im Dialog mit der Wirtschaft agieren. Nicht jede Abhängigkeit ist gleich problematisch. Die Strategie signalisiert den Firmen stattdessen, dass sie weiterhin grundsätzlich frei handeln können: It’s your business und eben auch euer Risiko. Nur dort wo kritische Technologierisiken mit Blick auf Dual-use und Menschenrechte bestehen ist mit echten Einschnitten zu rechnen.
Frei handeln konnten die Unternehmen vorher auch. Was bringt das Papier neu ein?
Es formuliert das Thema wirtschaftliche Sicherheit besonders klar und deutlich. Das ist eine Neuerung in der deutschen Chinapolitik.
Damit steht Deutschland nicht alleine da.
Ja, die Denkweise ist im G7-Kontext verankert und wird auch von der Europäischen Union vorangetrieben. Das ist ja genau das, was die Bundesregierung auch will: Nicht alleine handeln, sondern ihre China-Strategie mit den europäischen Prämissen abstimmen und dann im Gleichschritt mit G7-Partnern handeln.
Was ist gut gelungen an der Strategie?
Ich finde die grundsätzliche Analyse und die Präzision und Klarheit zur Frage gut: Warum ist China systemischer Rivale? Das ist wichtig und neu. Wichtig ist auch, dass Deutschland seine Chinapolitik am Verhalten Chinas kalibrieren wird, also insofern konditional und offen ist für Veränderung.
Was finden Sie enttäuschend?
Es ist nach traditioneller Anforderung an ein grundlegendes Strategiedokument zu lang, zu ausführlich. Es setzt zu wenig Prioritäten. Vor allem aber hapert es an der Handlungsfähigkeit zur Umsetzung. Es werden zu wenig Ressourcen dafür bereitgestellt. Wie bei der nationalen Sicherheitsstrategie war das Vorbedingung: Die Strategien dürfen keine neuen Anforderungen an den Haushalt stellen.
Einige sagen, der Ton sei zu harsch.
Tatsächlich behaupten manche, dass die Strategie die Tür zum Dialog zuschlägt. Die Regierung laufe nur noch mit dem moralischen Zeigefinger herum. Ich habe da aber relativ wenig drin gelesen, was manche als Wertegeklingel bezeichnen würden. Nichts weist auf einen Abbruch der Beziehungen hin, stattdessen ist das erklärte Ziel ihre Professionalisierung. Zugleich spricht ein klares Interesse daraus, weiterhin in Kontakt zu sein und auch den gesellschaftlichen Austausch aufrechtzuerhalten, wo immer das möglich ist.
Brüssel wartet auf eine chinapolitische Positionierung Deutschlands, des größten EU-Mitgliedslands. Wird dieses Papier Impulse auf EU-Ebene abgeben?
Wenn wir fair auf die Entwicklung der letzten Jahre schauen, stellen wir erst einmal fest, dass zentrale Impulse in der Chinapolitik umgekehrt aus Brüssel gekommen sind. Ich glaube aber, alle sind froh, wenn die Vielstimmigkeit der Bundesregierung zumindest etwas eingedämmt ist und man den Korridor erkennt, in dem die Bundesregierung künftig Chinapolitik gestalten will.
Eine ähnliche Frage noch einmal in Bezug auf die USA: Wird in Washington positiv aufgenommen werden, was Berlin da geliefert hat?
Grundsätzlich ja. Aber auch das ist ein Trend, der bereits lief. Der Begriff des De-Risking hatte sich bereits von einer Kanzlerrede ins Weiße Haus vorgearbeitet. Jetzt kommt noch die Strategie mit ihrer klaren Beschreibung der Herausforderungen hinzu, und mit der klaren Ansprache von Taiwan. Hier findet eine Angleichung der Positionen im G7-Kontext statt. Washington wird viele seiner Vorstellungen hier wiederfinden.
Noch eine persönliche Frage. Sie sind Direktor von Merics. Und Merics ist in dem Dokument ausdrücklich erwähnt als eine führende Forschungseinrichtung. Macht Sie das stolz?
Wir sind da eingebettet in eine Nennung von vielen Akteuren, Forschungseinrichtungen und Thinktanks. Wir stehen nicht alleine da. Aber wir haben uns darüber gefreut. Die Erwähnung steht exemplarisch dafür, dass nüchterne China-Analyse in der Zukunft noch mehr gebraucht wird.
Die Mitarbeiter von Merics sind seit 2021 von China sanktioniert. Erhält das Institut politische Rückendeckung, indem es in der Strategie genannt wird?
Das mag sein. Aber wichtiger ist: Wir machen unsere Hausaufgaben, betreiben China-Analyse so gut wir es können und freuen uns, wenn diese Arbeit nützlich ist und etwas zum Verständnis beiträgt.
Mikko Huotari ist seit 2020 Direktor des Mercator Institute for China Studies (Merics) in Berlin. Zuvor war er dort stellvertretender Direktor. Zu seinen Forschungsbereichen gehören die chinesische Außenpolitik, die Beziehungen zur EU und globaler Wettbewerb.

Die chinesische Nachrichten-App Zhi Xinwen betonte besonders die Symbolik des Titelbilds der neuen China-Strategie der Bundesrepublik, die am Freitag erschienen ist. Es zeige das Brettspiel Go, bei dem es “nicht darum gehe, den anderen Schachmatt zu setzen”, sondern eine besonders gute Position aufzubauen. Die Redakteure werten das als positives Zeichen für die Beziehungen beider Länder.
Chinas Führung und die gelenkten Medien nehmen die Veröffentlichung der China-Strategie insgesamt sportlich. Außenamtssprecher Wang Wenbin stellte am Freitag allerdings klar, dass China nicht das Objekt von De-Risking sein wolle. Es sei “kontraproduktiv”, alles unter dem Aspekt nationale Sicherheit zu sehen. Deutschland solle “normale Kooperation nicht politisieren”. Vor allem solle es im Namen des De-Risking keinen Protektionismus betreiben.
Der chinesische Regierungssprecher betonte zugleich, es gebe zwischen Deutschland und China viel mehr Verständigung als Differenzen. Er setze darauf, dass Deutschland Chinas Entwicklung auch weiter “objektiv sieht und eine rationale China-Politik betreibe“. Es gebe viele globale Herausforderungen, an denen man gemeinsam arbeiten wolle.
Die chinesische Botschaft in Berlin hatte sich zuvor noch deutlich kritischer geäußert als die Zentrale in Peking. Die Auffassung von China als Systemrivale widerspreche den Fakten und den gemeinsamen Interessen beider Länder. Die Botschaft warnte vor “Missverständnissen und falschen Einschätzungen”.
Der oberste Außenpolitiker des Landes, Wang Yi von der außenpolitischen Kommission der Partei, kommentierte am Wochenende zwar nicht direkt die deutsche China-Strategie. Bei einem Treffen mit dem EU-Außenbeauftragen Josep Borrell mahnte er aber eine berechenbare China-Politik der EU an. “Sie sollte nicht schwanken, geschweige denn zu Worten und Taten anspornen, die die Uhr zurückdrehen.” Es gebe keinen grundlegenden Interessenskonflikt zwischen China und der EU.
Wang meint damit: Die EU soll zu ihrem von der Regierung Merkel geprägten Kurs zurückkehren, den Handel mit China zu fördern. Dafür stand das fertig verhandelte Investitionsabkommen CAI, das im derzeitigen Umfeld keine Chance mehr hat, wirksam zu werden. Das CAI widerspricht völlig dem Geist der aktuell vorgestellten deutschen Strategie.
Die chinesische Seite Jiemian Xinwen legte in ihrem Artikel über die neue deutsche Strategie den Finger in die Wunde: Volkswagen habe weitere Investitionen angekündigt, während die deutsche Regierung das De-Risking ausrufe. Der Bericht fasst die Eckpunkte der Strategie für das chinesische Publikum zunächst klar und nüchtern zusammen.
Dann bezieht sich der Artikel auf einen langen LinkedIn-Post des China-Vorstands von VW, Ralf Brandstätter. In einer gedrechselten Argumentation lobt Brandstätter zunächst die “politischen Ziele” hinter der Strategie, legt sie dann aber in seinem Sinne aus. Das wichtigste Instrument geopolitischer Widerstandskraft sei der Handel.
Volkswagen blicke nicht naiv auf China, werde dort aber weiter investieren. Der Konzern betreibe längst Risikomanagement und schaffe starke Lieferketten. Eine starke wirtschaftliche Position Deutschlands in China sei mit einer Verringerung der Abhängigkeiten absolut vereinbar. VW werde die Innovationskraft des chinesischen Marktes nutzen, um selbst innovativer zu werden.
Die Wirtschaftsvereinigungen in Berlin blieben in ihrer Bewertung näher an der Intention der Bundesregierung als VW. “Es ist ein realistischer Blick auf China, der der neuen China-Strategie der Bundesregierung zugrunde liegt”, sagt Wolfgang Weber, Vorsitzender der Geschäftsführung des Verbands der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI). Besonders positiv bewertet der ZVEI, dass die Strategie europäisch eingebettet werden soll.
Für die weitere Entwicklung kommt es insbesondere auf die konkrete Umsetzung an, so der ZVEI: Die Ausgestaltung müsse nun im gesetzten Rahmen erfolgen, um die abgesteckten Ziele der Strategie nicht zu verwässern. Ähnlich äußerte sich der Industrieverband BDI: “De-Risking, aber kein Decoupling – diese Strategie ist richtig.” Jens Hildebrandt von der AHK in Peking begrüßte, dass die Strategie keine zusätzliche Bürokratie für die Unternehmen schaffe. Die Kammermitglieder betrieben längst von sich aus eine Minimierung der Risiken.
Bei seiner Sommerpressekonferenz in Berlin erläuterte auch Kanzler Olaf Scholz seine Interpretation des Dokuments – einen Tag nach der Außenministerin. Seine Sicht des De-Riskings ist näher an der von VW-China-Chef Brandstätter als die von Außenministerin Annalena Baerbock. Er erwarte, dass die Firmen “die Möglichkeiten nutzen, auch anderswo Direktinvestitionen zu tätigen, auch in anderen asiatischen Ländern, zum Beispiel anderswo Lieferketten aufbauen”, sagte Scholz. Er spricht sich also eher für eine stufenweise Diversifizierung aus als für einen zügigen Abbau der Abhängigkeiten.
Keine Spur vom chinesischen Außenminister Qin Gang: Nachdem er bereits am Freitag und Samstag an dem Außenministertreffen der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean in der indonesischen Hauptstadt Jakarta nicht dabei war, gibt die Führung in Peking auch weiter keine Informationen über den Verbleib ihres Außenministers bekannt.
Die japanische Nachrichtenagentur Kyodo berichtet von einer “außerehelichen Affäre” mit einer bekannten Fernsehjournalistin des Hongkonger Senders Phoenix und beruft sich auf Medien aus Taiwan. Auf Twitter kursieren seit Tagen Bilder des vermeintlichen Paares. Berichte, wonach die Zentralkommission für Disziplinarkontrolle gegen ihn ermittele und ihn bereits befragt habe, wollte in Peking niemand bestätigen.
Zuletzt war Qin am 25. Juni nach einem Treffen mit Staatsvertretern aus Russland, Sri Lanka und Vietnam in der Öffentlichkeit gesehen worden. Anfang Juli sollte er den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell in Peking treffen. Auch dieser Termin wurde kurzfristig verschoben. Spekulationen über gesundheitliche Probleme wurden von offizieller Seite nicht bestätigt. flee
John Kerry, der US-Sonderbeauftragte für den Klimawandel, ist am Sonntag in Peking eingetroffen, um von Montag bis Mittwoch Gespräche mit seinem chinesischen Amtskollegen Xie Zhenhua zu führen. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen Themen wie die Verringerung von Methanemissionen und Kohleverbrennung, die Eindämmung der Entwaldung und die Unterstützung armer Länder bei der Bekämpfung des Klimawandels.
Das Treffen der Vertreter der beiden größten Treibhausgasemittenten der Welt soll deren gemeinsame Bemühungen zur Bekämpfung der globalen Erwärmung wiederbeleben. Es ist der dritte hochrangige US-Besuch in China in diesem Jahr. Die beiden Staaten bemühen sich um eine Stabilisierung ihrer Beziehungen, die durch Handelsstreitigkeiten, militärische Spannungen und Spionagevorwürfe belastet sind. rtr
China hat sich bisher nicht mit dem G20-Block auf ein gemeinsames Verständnis einigen können, wie die Schulden armer Länder umzustrukturieren seien. Die Antwort des Landes sei bisher “nicht ermutigend”. Das sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle, die anonym bleiben wollte, am Sonntag gegenüber Reuters. Die G20-Staaten seien auch nicht an einer Einheitsregel für die Umstrukturierung der Schulden solcher Länder interessiert.
In den nächsten zwei Tagen treffen sich die Finanzchefs der 20 größten Volkswirtschaften der Welt im indischen Gandhinagar, um unter anderem über die Umschuldung dieser Länder im Rahmen des sogenannten “Common Framework” zu sprechen. Das ist der Name einer G20-Initiative, die armen Ländern helfen soll, ihre Schuldenrückzahlungen auf später zu verschieben.
US-Finanzministerin Janet Yellen sagte am Sonntag bei einer Pressekonferenz in Gandhinagar, sie sei “erpicht” (“eager”) darauf, mit China bei Themen von gemeinsamem Interesse zusammenzuarbeiten, unter anderem wenn es um die Umschuldungen für ärmere Länder gehe. Letzten Monat hat Sambia eine Vereinbarung zur Umstrukturierung von 6,3 Milliarden Dollar an Schulden bei ausländischen Regierungen, einschließlich China, erreicht: Das wurde als Durchbruch für ärmere Nationen in der Krise angesehen. rtr
Papst Franziskus hat einen im April von Peking ernannten Bischof nachträglich anerkannt. Gleichzeitig wirft der Vatikan China vor, Joseph Shen Bin ohne Konsultation auf den Posten des Bischofs von Shanghai versetzt zu haben, was gegen bilaterale Vereinbarungen verstößt.
In China gibt es sechs bis zwölf Millionen Katholiken. Ihre Mitglieder sind aufgespalten in eine von der Regierung gegründete Staatskirche, die der Partei untersteht und eine Untergrundkirche, die nach wie vor dem Papst und dem Vatikan die Treue schwört. Nach dem Verständnis der Kirche in Rom kann nur der Papst Bischöfe ernennen. Die Regierung in Peking will diese Autorität außerhalb ihres Machtspielraums jedoch nicht akzeptieren. Die Anerkennung des “geschätzten Pfarrers” Joseph Shen Bin zum Bischof sei nun zum “höheren Nutzen” der Gläubigen in Shanghai erfolgt, erklärt der Heilige Stuhl seinen Kompromiss.
2018 hatten Vertreter Pekings und des Vatikans eine Vereinbarung getroffen, die den Status mehrerer chinesischer Bischöfe regelte und den Weg für künftige Ernennungen ebnen sollte. Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin erklärte am Wochenende, Peking habe gegen den “Geist der Zusammenarbeit” verstoßen. Er hoffe nun, dass künftige Berufungen gemäß dem Geist des in Übereinkunft geforderten Konsenses erfolgen werden, so Parolin. fpe
China hat bekräftigt, dass generative KI-Dienste im Einklang mit den sozialistischen Grundwerten des Landes stehen müssen. Gleichzeitig will die Regierung die industrielle Nutzung der Technologie fördern. Vergangene Woche hat sie entsprechende Regelungen verkündet. Im Vergleich mit einem Entwurf aus dem April fällt der nun veröffentliche Maßnahmenkatalog Beobachtern zufolge gemäßigt aus.
Die Regeln, die am 15. August in Kraft treten, werden von Peking als “vorläufig” bezeichnet. Sie kommen, nachdem die Behörden das Ende ihres jahrelangen harten Vorgehens gegen die Tech-Industrie signalisiert hatten. In der Erklärung der chinesischen Cyberspace-Verwaltung (CAC) heißt es, dass nur Anbieter, die Dienste für die Öffentlichkeit anbieten wollen, Sicherheitsbewertungen vorlegen müssen.
Das deutet darauf hin, dass Firmen im Business-to-Business-Bereich ein gewisser Spielraum eingeräumt wird. China hat sich zum Ziel gesetzt, im Bereich der künstlichen Intelligenz bis 2030 weltweit führend zu werden, und gilt als Vorreiter in der Regulierung der Technologie. rtr
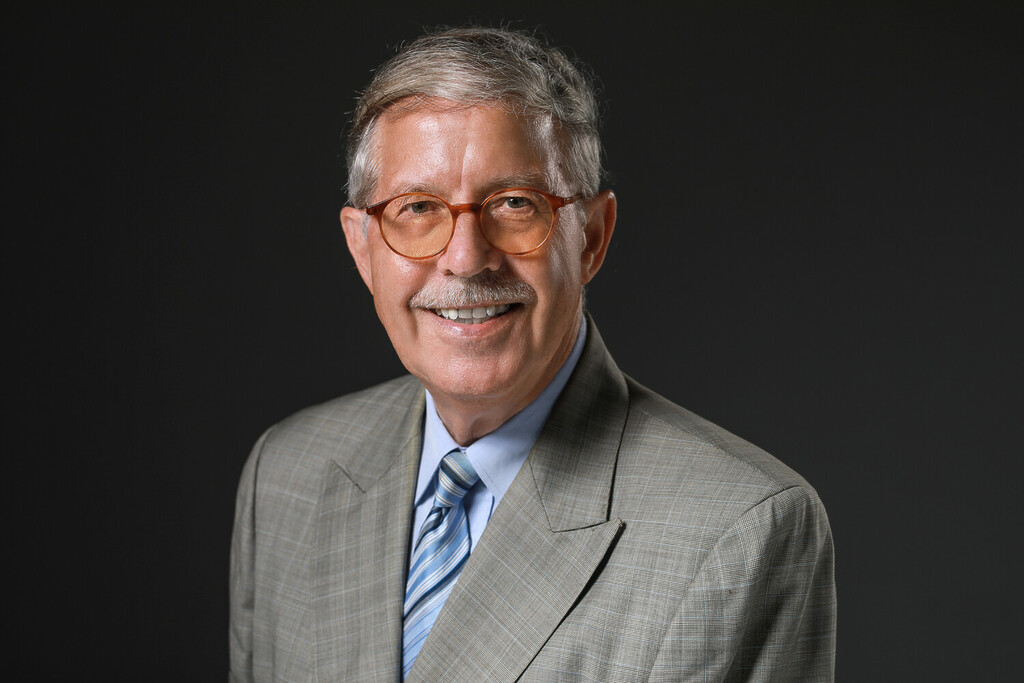
In den nächsten Wochen wird die erste China-Strategie, die die Bundesregierung jemals verabschiedet und die Außenministerin Baerbock am 13. Juli im Merics vorgestellt hat, umfassend erörtert werden. Da lohnt es, daran zu erinnern, dass diese Strategie nicht das erste Bemühen ist, die Beziehungen Deutschlands zu China auf eine konsolidierte Grundlage zu stellen. Im Mai 2002 war das Ostasien-Konzept des Auswärtigen Amts erschienen, überschrieben mit dem anspruchsvollen Titel “Aufgaben der deutschen Außenpolitik am Beginn des 21. Jahrhunderts”. Das von Staatsminister Volmer der Öffentlichkeit vorgestellte Konzept behandelte China, Japan, Korea und die Mongolei. Noch bis 2017 war es auf der Webseite des Auswärtigen Amts eingestellt.
Damals lagen die Asien-Krise der Jahre 1997/98 und die politischen Verwerfungen in der Folge des 11. September 2001 noch nicht lange zurück. China war im Vorjahr der Welthandelsorganisation beigetreten. Der erste demokratische Machtwechsel in Taiwan hatte 2000 stattgefunden.
Viel hat sich seither geändert, vieles ist aber auch gleichgeblieben. Der deutsch-chinesische Handel hat sich von 2001 bis 2022 verzehnfacht; der mit Taiwan ist immerhin auf das Dreifache gestiegen. Verdreifacht hat sich auch die Zahl der chinesischen Studierenden in Deutschland. 2001 war China größter Empfänger deutscher Entwicklungshilfe. Die ist heute Null; mit Recht, denn China ist mittlerweile zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Dass es “in wenigen Jahrzehnten” zur größten Volkswirtschaft werden könnte, vermutete bereits das Ostasien-Konzept. Ebenso, dass die asiatisch-pazifische Region auch “Ausgangspunkt krisenhafter Entwicklungen mit potenziell weltweiten Folgen” werden könne. Das Stichwort Geopolitik gab es schon damals; Naivität klingt anders.
Waren die Analyse der Situation in China und die Vorschläge für politisches Handeln vor gut 20 Jahren ganz andere als heute? Keineswegs. Gleich am Anfang der “zentralen Anliegen” deutscher Ostasienpolitik stehen “Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte”. Die Verbesserung der Menschenrechtslage in China sei zentrales Anliegen der deutschen Bemühungen um die weltweite Geltung der universellen Menschenrechte. Die drei Begriffe ziehen sich wie ein roter Faden durch das insgesamt 14 Seiten umfassende Dokument; der Schutz der Minderheiten unter anderem in Tibet und Xinjiang wird prominent erwähnt.
Damals brachte das Auswärtige Amt allerdings die Hoffnung zum Ausdruck, dass die deutsche Wirtschaft durch ihre Unternehmenskultur einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung leisten könne. Dieser Gedanke fehlt heute. Fehlen tut auch, überraschenderweise, ein Hinweis auf den deutschen Einsatz zur Abschaffung der Todesstrafe. Und noch etwas vermisst man: Einen Hinweis auf die Repression gegen Mitglieder christlicher Kirchen. Dafür würdigt die China-Strategie die Tätigkeit der deutschen Auslandsgemeinden der beiden großen Konfessionen und ihren Beitrag zum Dialog mit chinesischen Christen.
Nicht neu ist auch der Appell an die globale Verantwortung Chinas: schon damals mit Bezug auf die Verantwortung für den Klimawandel, heute auch bei der Haltung zum Ukraine-Krieg. Bereits 2002 wollte man Peking überzeugen, zunehmend Verantwortung für den Weltfrieden und globale Anliegen zu übernehmen.
Auch die Haltung zu Taiwan ist unverändert: Erforderlich, hieß es schon damals, sei eine friedliche Lösung aller sich zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße stellenden Fragen. Dass dies alles gemeinsam mit den EU-Partnern zu bewerkstelligen sei, ist ebenfalls damals wie heute grundlegende Politik.
Was hat sich also geändert? China hat in den letzten Jahrzehnten hunderte von Millionen Menschen aus absoluter Armut geführt, gewiss zu einem kleinen Teil auch als Folge deutscher Entwicklungshilfe. Trotz jüngst schwächelnder Wirtschaftszahlen ist damit zu rechnen, dass es nicht mehr Jahrzehnte dauern wird, bis es größte Volkswirtschaft der Welt wird. Die Zahl der deutschen Unternehmen ist auf 5.000 angewachsen; doch ihr zum Teil spektakulärer Erfolg wird heute zunehmend als Abhängigkeit wahrgenommen. Außenpolitisch ist China immer selbstbewusster geworden. Wohl auch deshalb wird unser Blick auf China kritischer. Würden wir heute mit dem China von 1972 – noch mitten in der Kulturrevolution – diplomatische Beziehungen aufnehmen?
Bei der Vorstellung der China-Strategie wurde erwähnt, es komme nun darauf an, sie auch umzusetzen. Es wird in der Tat spannend sein, das zu beobachten. Das Ostasien-Konzept von 2002 war über Monate verhandelt worden, wurde prominent der Öffentlichkeit vorgestellt, war für einige Wochen Gegenstand positiver ebenso wie kritischer Stellungnahmen – und verschwand dann irgendwo auf der Webseite des Auswärtigen Amts. Heute ist es selbst in dessen Archiv nicht mehr zu finden. Es gibt vermutlich keine außenpolitische Frage, bei deren Lösung irgendjemand vorher im Ostasien-Konzept nachgesehen hätte, was denn nun zu tun sei. Ob es der China-Strategie besser ergehen wird?
Wolfgang Röhr war dreieinhalb Jahrzehnte im deutschen Auswärtigen Dienst tätig, unter anderem in New York, Genf, Peking, Shanghai und als Botschafter im Arbeitsstab Deutschland-China in Berlin. Nach 2014 war der promovierte Jurist Senior Research Fellow am Deutschlandforschungszentrum der Tongji-Universität. Seit kurzem wohnen er und seine Frau, die Sinologin Silvia Kettelhut, wieder in Berlin.
Michael Locher-Tjoa ist seit Anfang Juli COO Region Greater China bei SAP. Locher-Tjoa ist seit mehr als zehn Jahren für den deutschen Softwarekonzern tätig. Für seinen neuen Posten wechselt er von Zürich nach Shanghai.
Thomas Fauth hat bei der Mercedes-Benz Group China den Posten des Senior Manager eDrive Integration & RTM development übernommen. Für seinen neuen Posten kehrt Fauth zurück nach Peking, wo er zuletzt 2020 als Senior Manager für Mercedes tätig war.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Wundern Sie sich bitte nicht, wenn auf WeChat Backsteine schleppende Frösche und Pandabären Ihr Chatfenster kreuzen. Machen Sie bitte Platz, wenn Cartoon-Schweinchen mit gelber Weste und Bauarbeiterhelm schwere Ziegelschubkarren vorbeischieben. Und zeigen Sie auch Verständnis, wenn Katzenpfötchen wild auf Laptops einhämmern mit dem Bitte-nicht-stören-Hinweis “搬砖ing” (bānzhuān-ing) – “gerade am Backsteintragen” (mit englischer ing-Verlaufsform). Vielleicht sendet Ihnen auch ein chinesischer Kollege folgende Message: 不说了,我要搬砖了 (bù shuō le, wǒ yào bānzhuān le) “Ich klinke mich dann mal aus, ich muss Backsteine schleppen.”
Nein, Chinas Angestellte sind nicht unter die Häuslebauer gegangen. Sie haben lediglich aus dem Sprachsteinbruch eine neue Alltagsmetapher rausgehauen, die sich prima als Internet-Meme eignet. 搬砖 bānzhuān (von 搬 bān “tragen, umstellen, umräumen” + 砖 zhuān “Backstein, Klinker, Ziegelstein”) ist im chinesischen Alltagssprachgebrauch neuerdings ein Synonym für schlecht bezahltes Rackern, Ackern und Schuften im Job. Die Ranklotz-Metaphorik trifft bei vielen jungen Menschen den Nerv der Zeit, angesichts platzender Traumjobseifenblasen und Überstundenernüchterung. Bester Gradmesser für die Beliebtheit des Trendbegriffs: eine nicht enden wollende Liste an Chat-Bildchen und digitalen Stickersets (表情包 biǎoqíngbāo), die sich aufklappt, wenn man 搬砖 bānzhuān in die WeChat-Suchmaske für Emojis eintippt.
Der Ziegelstein-Zynismus ist Teil eines Wortfeldes, das sich um die Unzufriedenheit im Job entsponnen hat. So verulken sich Chinas Büroangestellte gerne auch als 打工人 dǎgōngrén “Lohnarbeiter”. Dabei bezeichnete 打工 dǎgōng (“arbeiten, jobben”, ganz wörtlich eigentlich “Arbeit schlagen”) ursprünglich nur Gelegenheitsjobs oder einfache Lohnarbeiten, wie sie zum Beispiel Wanderarbeiter in den Städten verrichten. Eintönige und körperlich anstrengende Tätigkeiten also, die nur einen mageren Lohn abwerfen. Manche White-Collar-Worker in Chinas Bürotürmen motzen nun, dass sie trotz aller Karrierehoffnungen und guter Ausbildung letztlich auch nur bessere Tagelöhner sind.
Noch eine Frustrationsschublade tiefer ist der 工具人 gōngjùrén angesiedelt, der “Werkzeugmensch” (工具 gōngjù “Werkzeug, Instrument” + 人 rén “Mensch”). Als solche schimpften sich die Chinesen früher, wenn sie sich in zwischenmenschlichen Beziehungen nur als Mittel zum Zweck missbraucht sahen oder in Partnerschaften zum willenlosen “Schweizer Taschenmesser” avancierten, das dem oder der Liebsten als Laufbursche oder -mädchen jeden Wunsch von den Lippen ablas. Heute fühlt sich auch manch einer vom Chef zur Powerpoint-Zange oder zum Schreibtisch-Schraubenschlüssel instrumentalisiert. Gebührende Anerkennung und Vergütung der eigenen Leistungen? Fehlanzeige.
Besonders Chinas IT-Branche hechelt oft im Hamsterrad des 996-Überstunden-Übels. Angestellte der Tech-Branche haben sich daher scherzhaft den Namen 码农 mǎnóng “Code-Wanderarbeiter” gegeben (von 码 mǎ für 代码 dàimǎ “Code” wie in 写代码 xiě dàimǎ “einen Code schreiben” + 农 nóng wie in 农民 nóngmín “Wanderarbeiter vom Land”). Auch das also eine Anspielung auf das schuftende Heer der eher schlecht bezahlten Wanderarbeiter, die Chinas Aufschwung der vergangenen Jahrzehnte auf ihren Schultern mitgetragen haben.
Scheinbar geht eben die Motivation vor die Hunde, wenn sich nach Jahren des harten Büffelns und Studierens auch der vermeintlich attraktive Bürojob mehr als Ziegelsteinbruch und weniger als Zuckerschlecken erweist. Man sei eben doch nur ein “Arbeitsköter” (上班狗 shàngbāngǒu) respektive “Überstunden-Wauwau” (加班狗 jiābāngǒu) und entsprechend “hundemüde” (累成狗 lèi chéng gǒu) bellen Erschöpfte und Enttäuschte mit einer Prise Sarkasmus dann in Blogs und Posts. Auch das Gegenstück zum Backsteinschlepper-Modus (搬砖模式 bānzhuān móshì) hat im Mandarin natürlich längst eine bildhafte Bezeichnung gefunden. Wer keine Klinker klotzt, der “streichelt” in China “Fische”. Denn 摸鱼 mōyú (wörtlich “Fische tätscheln / streicheln / grapschen”) ist das trendige chinesische Sprachpendant für Faulenzen am Arbeitsplatz.
Überstunden, Überarbeitung und sprachliche Übersprungshandlungen sind natürlich längst kein genuin chinesisches Phänomen. Im Westen lodert der Burnout schließlich mancherorts längst als gesellschaftlicher Flächenbrand. Auch wir ringen auf der Werktätigenwippe um die richtige Work-Life-Balance. Vielleicht muss man manchmal nach fünf Uhr auch einfach fünfe gerade sein lassen und auf Digital-Detox-Modus (数字排毒 shùzì páidú “Digital Detox”) schalten. Und da bietet das Chinesische just noch eine andere Form des “Backsteinverschiebens” als Alternative an. Denn in einigen chinesischen Dialekten trägt 搬砖 bānzhuān auch die Bedeutung “Mahjong spielen” (eigentlich ja 打麻将 dǎ májiàng). Bei einem Gläschen Grüntee in einem chinesischen Garten speckige Spielsteine klackernd über den grünen Filz des Mahjongtisches schieben – das verspricht doch Heilung für gestresste Büroseelen, für chinesische genauso wie für deutsche.
Verena Menzel betreibt in Peking die Online-Sprachschule New Chinese.
lange wurde sie erwartet, vergangene Woche hat die Regierung sie endlich veröffentlicht: die nationale China-Strategie. Mindestens genauso spannend wie deren Inhalte ist die Frage, wie sie aufgenommen und interpretiert werden. Merics-Direktor Mikko Huotari ordnet im Interview mit Finn Mayer-Kuckuk ein, was das Dokument bewirken kann. Huotari sagt: Auch wenn die China-Strategie nur wenig wirklich Überraschendes geboten hat – es ist nicht selbstverständlich, mit welcher Klarheit und Deutlichkeit die deutsche Regierung hier erstmals kommuniziert.
Peking nimmt das bisher gelassen: Unsere zweite Analyse sammelt die Reaktionen aus China und Deutschland – inklusive der eigenwilligen Interpretation des Autobauers Volkswagen.
Viele interessante Erkenntnisse bei der Lektüre wünscht


Die Strategie ist da. War das jetzt der Befreiungsschlag?
Nein, kein Befreiungsschlag und auch kein großer Wurf – aber ein wichtiger, der die deutlichen Veränderungen in der deutschen Chinapolitik markiert. In der Substanz ist wenig völlig überraschend. Vieles von dem, was da drinsteht, wurde seit Monaten diskutiert. Dass die Klarheit in der Beschreibung und deutlichen Ansprache von Risiken und Herausforderungen insgesamt bewahrt wurde, ist nicht selbstverständlich und zeigt, dass es im Kern eben doch relativ große Einigkeit in der Bundesregierung gibt.
Hat zumindest eine Neudefinition des deutschen Verhältnisses zu China stattgefunden oder liefert das Papier nur eine Bestandsaufnahme?
Die Neudefinition des Verhältnisses zu China hat nicht mit diesem Dokument stattgefunden, sondern sie begann spätestens mit dem Koalitionsvertrag und wurde über die vergangenen Monate austariert.
Es gab erste kritische Reaktionen von chinesischer Seite, beispielsweise von der Botschaft hier in Berlin. Wird die Strategie die Beziehungen nachhaltig belasten?
Ich erwarte jetzt keine große Konsequenz im Sinne von Stress in den Beziehungen, der hochgefahren wird, um zu zeigen, dass man sehr unzufrieden ist. China ist bereits darauf eingestellt gewesen, dass diese Strategie kommt. Chinas Premier Li Qiang hat bei seinem Besuch in Berlin im Juni schon versucht, den Gedanken des De-Riskings auszuhebeln, indem er es als reine Hausaufgabe für Unternehmen dargestellt hat.
Das Auswärtige Amt versichert, die Sprache des Dokuments sei so gewählt, dass Peking keine inakzeptablen Formulierungen findet.
Tatsächlich stört sich die chinesische Seite bereits am “De-Risking”. Außerdem wird sich Peking weiterhin gegen die Einordnung als systemischer Rivale oder sicherheitspolitische Herausforderung verwehren.
Was wird jetzt im Hinblick auf das De-Risking der Wirtschaft passieren?
Die Strategie sieht konkrete Schritte vor, beispielsweise eine verschärfte Prüfung chinesischer Investitionen hierzulande und eine Verschärfung der Exportkontrollen. Dazu kommt der Schutz der kritischen Infrastruktur und Maßnahmen zur Reduktion von Abhängigkeiten bei kritischen Rohstoffen. All das kann bereits weitreichende Auswirkungen auf Unternehmen haben. Die genaue Umsetzung von Risikoanalysen bleibt allerdings noch unklar.
Was ist die größte Änderung?
Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat von den Unternehmen ausdrücklich mehr Transparenz eingefordert, damit die Regierung den Risiken entgegenwirken kann. Da wird die Politik schon bei den Unternehmen nachfragen in den kommenden Monaten. Dieser Prozess hat allerdings noch kein institutionelles Gewand und wird sicher höchst umstritten bleiben.
Sollte beispielsweise das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle BAFA die Einhaltung von Transparenzregeln kontrollieren?
Die meisten würden so eine – sehr bürokratische – Lösung gerne vermeiden. Die Regierung will stattdessen im Dialog mit der Wirtschaft agieren. Nicht jede Abhängigkeit ist gleich problematisch. Die Strategie signalisiert den Firmen stattdessen, dass sie weiterhin grundsätzlich frei handeln können: It’s your business und eben auch euer Risiko. Nur dort wo kritische Technologierisiken mit Blick auf Dual-use und Menschenrechte bestehen ist mit echten Einschnitten zu rechnen.
Frei handeln konnten die Unternehmen vorher auch. Was bringt das Papier neu ein?
Es formuliert das Thema wirtschaftliche Sicherheit besonders klar und deutlich. Das ist eine Neuerung in der deutschen Chinapolitik.
Damit steht Deutschland nicht alleine da.
Ja, die Denkweise ist im G7-Kontext verankert und wird auch von der Europäischen Union vorangetrieben. Das ist ja genau das, was die Bundesregierung auch will: Nicht alleine handeln, sondern ihre China-Strategie mit den europäischen Prämissen abstimmen und dann im Gleichschritt mit G7-Partnern handeln.
Was ist gut gelungen an der Strategie?
Ich finde die grundsätzliche Analyse und die Präzision und Klarheit zur Frage gut: Warum ist China systemischer Rivale? Das ist wichtig und neu. Wichtig ist auch, dass Deutschland seine Chinapolitik am Verhalten Chinas kalibrieren wird, also insofern konditional und offen ist für Veränderung.
Was finden Sie enttäuschend?
Es ist nach traditioneller Anforderung an ein grundlegendes Strategiedokument zu lang, zu ausführlich. Es setzt zu wenig Prioritäten. Vor allem aber hapert es an der Handlungsfähigkeit zur Umsetzung. Es werden zu wenig Ressourcen dafür bereitgestellt. Wie bei der nationalen Sicherheitsstrategie war das Vorbedingung: Die Strategien dürfen keine neuen Anforderungen an den Haushalt stellen.
Einige sagen, der Ton sei zu harsch.
Tatsächlich behaupten manche, dass die Strategie die Tür zum Dialog zuschlägt. Die Regierung laufe nur noch mit dem moralischen Zeigefinger herum. Ich habe da aber relativ wenig drin gelesen, was manche als Wertegeklingel bezeichnen würden. Nichts weist auf einen Abbruch der Beziehungen hin, stattdessen ist das erklärte Ziel ihre Professionalisierung. Zugleich spricht ein klares Interesse daraus, weiterhin in Kontakt zu sein und auch den gesellschaftlichen Austausch aufrechtzuerhalten, wo immer das möglich ist.
Brüssel wartet auf eine chinapolitische Positionierung Deutschlands, des größten EU-Mitgliedslands. Wird dieses Papier Impulse auf EU-Ebene abgeben?
Wenn wir fair auf die Entwicklung der letzten Jahre schauen, stellen wir erst einmal fest, dass zentrale Impulse in der Chinapolitik umgekehrt aus Brüssel gekommen sind. Ich glaube aber, alle sind froh, wenn die Vielstimmigkeit der Bundesregierung zumindest etwas eingedämmt ist und man den Korridor erkennt, in dem die Bundesregierung künftig Chinapolitik gestalten will.
Eine ähnliche Frage noch einmal in Bezug auf die USA: Wird in Washington positiv aufgenommen werden, was Berlin da geliefert hat?
Grundsätzlich ja. Aber auch das ist ein Trend, der bereits lief. Der Begriff des De-Risking hatte sich bereits von einer Kanzlerrede ins Weiße Haus vorgearbeitet. Jetzt kommt noch die Strategie mit ihrer klaren Beschreibung der Herausforderungen hinzu, und mit der klaren Ansprache von Taiwan. Hier findet eine Angleichung der Positionen im G7-Kontext statt. Washington wird viele seiner Vorstellungen hier wiederfinden.
Noch eine persönliche Frage. Sie sind Direktor von Merics. Und Merics ist in dem Dokument ausdrücklich erwähnt als eine führende Forschungseinrichtung. Macht Sie das stolz?
Wir sind da eingebettet in eine Nennung von vielen Akteuren, Forschungseinrichtungen und Thinktanks. Wir stehen nicht alleine da. Aber wir haben uns darüber gefreut. Die Erwähnung steht exemplarisch dafür, dass nüchterne China-Analyse in der Zukunft noch mehr gebraucht wird.
Die Mitarbeiter von Merics sind seit 2021 von China sanktioniert. Erhält das Institut politische Rückendeckung, indem es in der Strategie genannt wird?
Das mag sein. Aber wichtiger ist: Wir machen unsere Hausaufgaben, betreiben China-Analyse so gut wir es können und freuen uns, wenn diese Arbeit nützlich ist und etwas zum Verständnis beiträgt.
Mikko Huotari ist seit 2020 Direktor des Mercator Institute for China Studies (Merics) in Berlin. Zuvor war er dort stellvertretender Direktor. Zu seinen Forschungsbereichen gehören die chinesische Außenpolitik, die Beziehungen zur EU und globaler Wettbewerb.

Die chinesische Nachrichten-App Zhi Xinwen betonte besonders die Symbolik des Titelbilds der neuen China-Strategie der Bundesrepublik, die am Freitag erschienen ist. Es zeige das Brettspiel Go, bei dem es “nicht darum gehe, den anderen Schachmatt zu setzen”, sondern eine besonders gute Position aufzubauen. Die Redakteure werten das als positives Zeichen für die Beziehungen beider Länder.
Chinas Führung und die gelenkten Medien nehmen die Veröffentlichung der China-Strategie insgesamt sportlich. Außenamtssprecher Wang Wenbin stellte am Freitag allerdings klar, dass China nicht das Objekt von De-Risking sein wolle. Es sei “kontraproduktiv”, alles unter dem Aspekt nationale Sicherheit zu sehen. Deutschland solle “normale Kooperation nicht politisieren”. Vor allem solle es im Namen des De-Risking keinen Protektionismus betreiben.
Der chinesische Regierungssprecher betonte zugleich, es gebe zwischen Deutschland und China viel mehr Verständigung als Differenzen. Er setze darauf, dass Deutschland Chinas Entwicklung auch weiter “objektiv sieht und eine rationale China-Politik betreibe“. Es gebe viele globale Herausforderungen, an denen man gemeinsam arbeiten wolle.
Die chinesische Botschaft in Berlin hatte sich zuvor noch deutlich kritischer geäußert als die Zentrale in Peking. Die Auffassung von China als Systemrivale widerspreche den Fakten und den gemeinsamen Interessen beider Länder. Die Botschaft warnte vor “Missverständnissen und falschen Einschätzungen”.
Der oberste Außenpolitiker des Landes, Wang Yi von der außenpolitischen Kommission der Partei, kommentierte am Wochenende zwar nicht direkt die deutsche China-Strategie. Bei einem Treffen mit dem EU-Außenbeauftragen Josep Borrell mahnte er aber eine berechenbare China-Politik der EU an. “Sie sollte nicht schwanken, geschweige denn zu Worten und Taten anspornen, die die Uhr zurückdrehen.” Es gebe keinen grundlegenden Interessenskonflikt zwischen China und der EU.
Wang meint damit: Die EU soll zu ihrem von der Regierung Merkel geprägten Kurs zurückkehren, den Handel mit China zu fördern. Dafür stand das fertig verhandelte Investitionsabkommen CAI, das im derzeitigen Umfeld keine Chance mehr hat, wirksam zu werden. Das CAI widerspricht völlig dem Geist der aktuell vorgestellten deutschen Strategie.
Die chinesische Seite Jiemian Xinwen legte in ihrem Artikel über die neue deutsche Strategie den Finger in die Wunde: Volkswagen habe weitere Investitionen angekündigt, während die deutsche Regierung das De-Risking ausrufe. Der Bericht fasst die Eckpunkte der Strategie für das chinesische Publikum zunächst klar und nüchtern zusammen.
Dann bezieht sich der Artikel auf einen langen LinkedIn-Post des China-Vorstands von VW, Ralf Brandstätter. In einer gedrechselten Argumentation lobt Brandstätter zunächst die “politischen Ziele” hinter der Strategie, legt sie dann aber in seinem Sinne aus. Das wichtigste Instrument geopolitischer Widerstandskraft sei der Handel.
Volkswagen blicke nicht naiv auf China, werde dort aber weiter investieren. Der Konzern betreibe längst Risikomanagement und schaffe starke Lieferketten. Eine starke wirtschaftliche Position Deutschlands in China sei mit einer Verringerung der Abhängigkeiten absolut vereinbar. VW werde die Innovationskraft des chinesischen Marktes nutzen, um selbst innovativer zu werden.
Die Wirtschaftsvereinigungen in Berlin blieben in ihrer Bewertung näher an der Intention der Bundesregierung als VW. “Es ist ein realistischer Blick auf China, der der neuen China-Strategie der Bundesregierung zugrunde liegt”, sagt Wolfgang Weber, Vorsitzender der Geschäftsführung des Verbands der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI). Besonders positiv bewertet der ZVEI, dass die Strategie europäisch eingebettet werden soll.
Für die weitere Entwicklung kommt es insbesondere auf die konkrete Umsetzung an, so der ZVEI: Die Ausgestaltung müsse nun im gesetzten Rahmen erfolgen, um die abgesteckten Ziele der Strategie nicht zu verwässern. Ähnlich äußerte sich der Industrieverband BDI: “De-Risking, aber kein Decoupling – diese Strategie ist richtig.” Jens Hildebrandt von der AHK in Peking begrüßte, dass die Strategie keine zusätzliche Bürokratie für die Unternehmen schaffe. Die Kammermitglieder betrieben längst von sich aus eine Minimierung der Risiken.
Bei seiner Sommerpressekonferenz in Berlin erläuterte auch Kanzler Olaf Scholz seine Interpretation des Dokuments – einen Tag nach der Außenministerin. Seine Sicht des De-Riskings ist näher an der von VW-China-Chef Brandstätter als die von Außenministerin Annalena Baerbock. Er erwarte, dass die Firmen “die Möglichkeiten nutzen, auch anderswo Direktinvestitionen zu tätigen, auch in anderen asiatischen Ländern, zum Beispiel anderswo Lieferketten aufbauen”, sagte Scholz. Er spricht sich also eher für eine stufenweise Diversifizierung aus als für einen zügigen Abbau der Abhängigkeiten.
Keine Spur vom chinesischen Außenminister Qin Gang: Nachdem er bereits am Freitag und Samstag an dem Außenministertreffen der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean in der indonesischen Hauptstadt Jakarta nicht dabei war, gibt die Führung in Peking auch weiter keine Informationen über den Verbleib ihres Außenministers bekannt.
Die japanische Nachrichtenagentur Kyodo berichtet von einer “außerehelichen Affäre” mit einer bekannten Fernsehjournalistin des Hongkonger Senders Phoenix und beruft sich auf Medien aus Taiwan. Auf Twitter kursieren seit Tagen Bilder des vermeintlichen Paares. Berichte, wonach die Zentralkommission für Disziplinarkontrolle gegen ihn ermittele und ihn bereits befragt habe, wollte in Peking niemand bestätigen.
Zuletzt war Qin am 25. Juni nach einem Treffen mit Staatsvertretern aus Russland, Sri Lanka und Vietnam in der Öffentlichkeit gesehen worden. Anfang Juli sollte er den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell in Peking treffen. Auch dieser Termin wurde kurzfristig verschoben. Spekulationen über gesundheitliche Probleme wurden von offizieller Seite nicht bestätigt. flee
John Kerry, der US-Sonderbeauftragte für den Klimawandel, ist am Sonntag in Peking eingetroffen, um von Montag bis Mittwoch Gespräche mit seinem chinesischen Amtskollegen Xie Zhenhua zu führen. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen Themen wie die Verringerung von Methanemissionen und Kohleverbrennung, die Eindämmung der Entwaldung und die Unterstützung armer Länder bei der Bekämpfung des Klimawandels.
Das Treffen der Vertreter der beiden größten Treibhausgasemittenten der Welt soll deren gemeinsame Bemühungen zur Bekämpfung der globalen Erwärmung wiederbeleben. Es ist der dritte hochrangige US-Besuch in China in diesem Jahr. Die beiden Staaten bemühen sich um eine Stabilisierung ihrer Beziehungen, die durch Handelsstreitigkeiten, militärische Spannungen und Spionagevorwürfe belastet sind. rtr
China hat sich bisher nicht mit dem G20-Block auf ein gemeinsames Verständnis einigen können, wie die Schulden armer Länder umzustrukturieren seien. Die Antwort des Landes sei bisher “nicht ermutigend”. Das sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle, die anonym bleiben wollte, am Sonntag gegenüber Reuters. Die G20-Staaten seien auch nicht an einer Einheitsregel für die Umstrukturierung der Schulden solcher Länder interessiert.
In den nächsten zwei Tagen treffen sich die Finanzchefs der 20 größten Volkswirtschaften der Welt im indischen Gandhinagar, um unter anderem über die Umschuldung dieser Länder im Rahmen des sogenannten “Common Framework” zu sprechen. Das ist der Name einer G20-Initiative, die armen Ländern helfen soll, ihre Schuldenrückzahlungen auf später zu verschieben.
US-Finanzministerin Janet Yellen sagte am Sonntag bei einer Pressekonferenz in Gandhinagar, sie sei “erpicht” (“eager”) darauf, mit China bei Themen von gemeinsamem Interesse zusammenzuarbeiten, unter anderem wenn es um die Umschuldungen für ärmere Länder gehe. Letzten Monat hat Sambia eine Vereinbarung zur Umstrukturierung von 6,3 Milliarden Dollar an Schulden bei ausländischen Regierungen, einschließlich China, erreicht: Das wurde als Durchbruch für ärmere Nationen in der Krise angesehen. rtr
Papst Franziskus hat einen im April von Peking ernannten Bischof nachträglich anerkannt. Gleichzeitig wirft der Vatikan China vor, Joseph Shen Bin ohne Konsultation auf den Posten des Bischofs von Shanghai versetzt zu haben, was gegen bilaterale Vereinbarungen verstößt.
In China gibt es sechs bis zwölf Millionen Katholiken. Ihre Mitglieder sind aufgespalten in eine von der Regierung gegründete Staatskirche, die der Partei untersteht und eine Untergrundkirche, die nach wie vor dem Papst und dem Vatikan die Treue schwört. Nach dem Verständnis der Kirche in Rom kann nur der Papst Bischöfe ernennen. Die Regierung in Peking will diese Autorität außerhalb ihres Machtspielraums jedoch nicht akzeptieren. Die Anerkennung des “geschätzten Pfarrers” Joseph Shen Bin zum Bischof sei nun zum “höheren Nutzen” der Gläubigen in Shanghai erfolgt, erklärt der Heilige Stuhl seinen Kompromiss.
2018 hatten Vertreter Pekings und des Vatikans eine Vereinbarung getroffen, die den Status mehrerer chinesischer Bischöfe regelte und den Weg für künftige Ernennungen ebnen sollte. Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin erklärte am Wochenende, Peking habe gegen den “Geist der Zusammenarbeit” verstoßen. Er hoffe nun, dass künftige Berufungen gemäß dem Geist des in Übereinkunft geforderten Konsenses erfolgen werden, so Parolin. fpe
Die chinesischen Behörden haben 373 Konten auf Internetplattformen gesperrt und mit Strafen belegt. Als Grund nannten die Behörden, die betreffenden Accounts hätten “Informationen zur öffentlichen Ordnung fabriziert und verzerrt” und davon profitiert. Das berichtet Bloomberg.
Einige der Konten auf WeChat, Weibo und Xueqiu seien geschlossen worden, nachdem sie Gerüchte darüber verbreitet hätten, dass China bei einem Treffen eine Reihe von steuer- und wirtschaftspolitischen Maßnahmen diskutieren würde, hieß es in einer Erklärung der Regulierungsbehörde vom Samstag. Dies habe Auswirkungen auf den Aktienmarkt gehabt. Außerdem seien einige Konten auf Plattformen wie Kuaishou, Baidu und Zhihu aufgrund von Gerüchten über staatliche Subventionen, der Politik zu sozialen Sicherung und andere Themen geschlossen oder suspendiert worden. cyb
China hat bekräftigt, dass generative KI-Dienste im Einklang mit den sozialistischen Grundwerten des Landes stehen müssen. Gleichzeitig will die Regierung die industrielle Nutzung der Technologie fördern. Vergangene Woche hat sie entsprechende Regelungen verkündet. Im Vergleich mit einem Entwurf aus dem April fällt der nun veröffentliche Maßnahmenkatalog Beobachtern zufolge gemäßigt aus.
Die Regeln, die am 15. August in Kraft treten, werden von Peking als “vorläufig” bezeichnet. Sie kommen, nachdem die Behörden das Ende ihres jahrelangen harten Vorgehens gegen die Tech-Industrie signalisiert hatten. In der Erklärung der chinesischen Cyberspace-Verwaltung (CAC) heißt es, dass nur Anbieter, die Dienste für die Öffentlichkeit anbieten wollen, Sicherheitsbewertungen vorlegen müssen.
Das deutet darauf hin, dass Firmen im Business-to-Business-Bereich ein gewisser Spielraum eingeräumt wird. China hat sich zum Ziel gesetzt, im Bereich der künstlichen Intelligenz bis 2030 weltweit führend zu werden, und gilt als Vorreiter in der Regulierung der Technologie. rtr
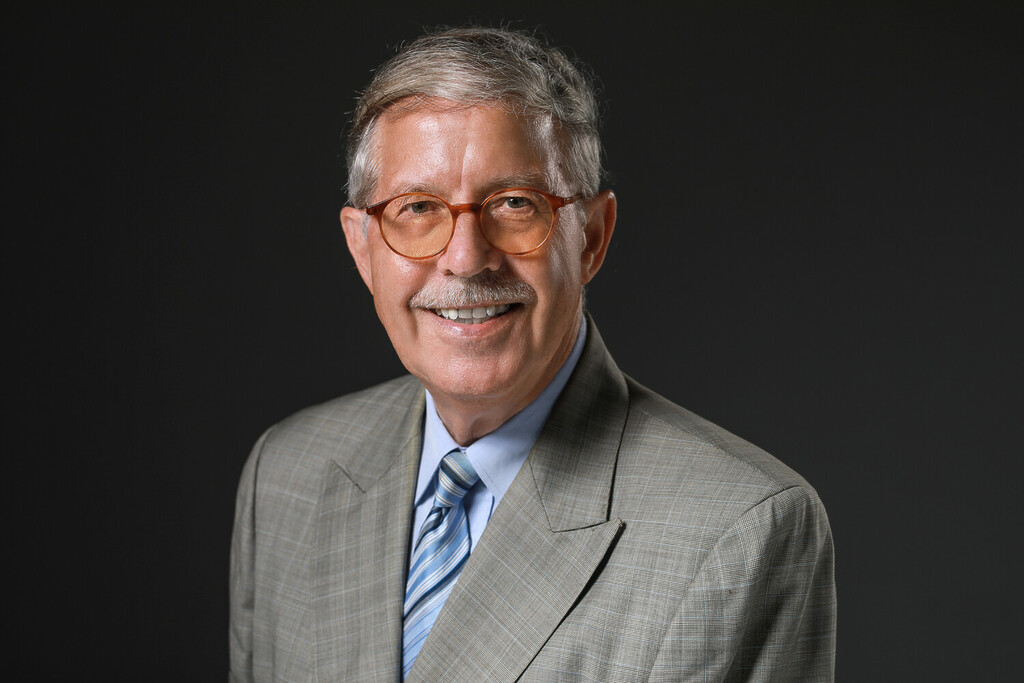
In den nächsten Wochen wird die erste China-Strategie, die die Bundesregierung jemals verabschiedet und die Außenministerin Baerbock am 13. Juli im Merics vorgestellt hat, umfassend erörtert werden. Da lohnt es, daran zu erinnern, dass diese Strategie nicht das erste Bemühen ist, die Beziehungen Deutschlands zu China auf eine konsolidierte Grundlage zu stellen. Im Mai 2002 war das Ostasien-Konzept des Auswärtigen Amts erschienen, überschrieben mit dem anspruchsvollen Titel “Aufgaben der deutschen Außenpolitik am Beginn des 21. Jahrhunderts”. Das von Staatsminister Volmer der Öffentlichkeit vorgestellte Konzept behandelte China, Japan, Korea und die Mongolei. Noch bis 2017 war es auf der Webseite des Auswärtigen Amts eingestellt.
Damals lagen die Asien-Krise der Jahre 1997/98 und die politischen Verwerfungen in der Folge des 11. September 2001 noch nicht lange zurück. China war im Vorjahr der Welthandelsorganisation beigetreten. Der erste demokratische Machtwechsel in Taiwan hatte 2000 stattgefunden.
Viel hat sich seither geändert, vieles ist aber auch gleichgeblieben. Der deutsch-chinesische Handel hat sich von 2001 bis 2022 verzehnfacht; der mit Taiwan ist immerhin auf das Dreifache gestiegen. Verdreifacht hat sich auch die Zahl der chinesischen Studierenden in Deutschland. 2001 war China größter Empfänger deutscher Entwicklungshilfe. Die ist heute Null; mit Recht, denn China ist mittlerweile zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Dass es “in wenigen Jahrzehnten” zur größten Volkswirtschaft werden könnte, vermutete bereits das Ostasien-Konzept. Ebenso, dass die asiatisch-pazifische Region auch “Ausgangspunkt krisenhafter Entwicklungen mit potenziell weltweiten Folgen” werden könne. Das Stichwort Geopolitik gab es schon damals; Naivität klingt anders.
Waren die Analyse der Situation in China und die Vorschläge für politisches Handeln vor gut 20 Jahren ganz andere als heute? Keineswegs. Gleich am Anfang der “zentralen Anliegen” deutscher Ostasienpolitik stehen “Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte”. Die Verbesserung der Menschenrechtslage in China sei zentrales Anliegen der deutschen Bemühungen um die weltweite Geltung der universellen Menschenrechte. Die drei Begriffe ziehen sich wie ein roter Faden durch das insgesamt 14 Seiten umfassende Dokument; der Schutz der Minderheiten unter anderem in Tibet und Xinjiang wird prominent erwähnt.
Damals brachte das Auswärtige Amt allerdings die Hoffnung zum Ausdruck, dass die deutsche Wirtschaft durch ihre Unternehmenskultur einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung leisten könne. Dieser Gedanke fehlt heute. Fehlen tut auch, überraschenderweise, ein Hinweis auf den deutschen Einsatz zur Abschaffung der Todesstrafe. Und noch etwas vermisst man: Einen Hinweis auf die Repression gegen Mitglieder christlicher Kirchen. Dafür würdigt die China-Strategie die Tätigkeit der deutschen Auslandsgemeinden der beiden großen Konfessionen und ihren Beitrag zum Dialog mit chinesischen Christen.
Nicht neu ist auch der Appell an die globale Verantwortung Chinas: schon damals mit Bezug auf die Verantwortung für den Klimawandel, heute auch bei der Haltung zum Ukraine-Krieg. Bereits 2002 wollte man Peking überzeugen, zunehmend Verantwortung für den Weltfrieden und globale Anliegen zu übernehmen.
Auch die Haltung zu Taiwan ist unverändert: Erforderlich, hieß es schon damals, sei eine friedliche Lösung aller sich zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße stellenden Fragen. Dass dies alles gemeinsam mit den EU-Partnern zu bewerkstelligen sei, ist ebenfalls damals wie heute grundlegende Politik.
Was hat sich also geändert? China hat in den letzten Jahrzehnten hunderte von Millionen Menschen aus absoluter Armut geführt, gewiss zu einem kleinen Teil auch als Folge deutscher Entwicklungshilfe. Trotz jüngst schwächelnder Wirtschaftszahlen ist damit zu rechnen, dass es nicht mehr Jahrzehnte dauern wird, bis es größte Volkswirtschaft der Welt wird. Die Zahl der deutschen Unternehmen ist auf 5.000 angewachsen; doch ihr zum Teil spektakulärer Erfolg wird heute zunehmend als Abhängigkeit wahrgenommen. Außenpolitisch ist China immer selbstbewusster geworden. Wohl auch deshalb wird unser Blick auf China kritischer. Würden wir heute mit dem China von 1972 – noch mitten in der Kulturrevolution – diplomatische Beziehungen aufnehmen?
Bei der Vorstellung der China-Strategie wurde erwähnt, es komme nun darauf an, sie auch umzusetzen. Es wird in der Tat spannend sein, das zu beobachten. Das Ostasien-Konzept von 2002 war über Monate verhandelt worden, wurde prominent der Öffentlichkeit vorgestellt, war für einige Wochen Gegenstand positiver ebenso wie kritischer Stellungnahmen – und verschwand dann irgendwo auf der Webseite des Auswärtigen Amts. Heute ist es selbst in dessen Archiv nicht mehr zu finden. Es gibt vermutlich keine außenpolitische Frage, bei deren Lösung irgendjemand vorher im Ostasien-Konzept nachgesehen hätte, was denn nun zu tun sei. Ob es der China-Strategie besser ergehen wird?
Wolfgang Röhr war dreieinhalb Jahrzehnte im deutschen Auswärtigen Dienst tätig, unter anderem in New York, Genf, Peking, Shanghai und als Botschafter im Arbeitsstab Deutschland-China in Berlin. Nach 2014 war der promovierte Jurist Senior Research Fellow am Deutschlandforschungszentrum der Tongji-Universität. Seit kurzem wohnen er und seine Frau, die Sinologin Silvia Kettelhut, wieder in Berlin.
Michael Locher-Tjoa ist seit Anfang Juli COO Region Greater China bei SAP. Locher-Tjoa ist seit mehr als zehn Jahren für den deutschen Softwarekonzern tätig. Für seinen neuen Posten wechselt er von Zürich nach Shanghai.
Thomas Fauth hat bei der Mercedes-Benz Group China den Posten des Senior Manager eDrive Integration & RTM development übernommen. Für seinen neuen Posten kehrt Fauth zurück nach Peking, wo er zuletzt 2020 als Senior Manager für Mercedes tätig war.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Wundern Sie sich bitte nicht, wenn auf WeChat Backsteine schleppende Frösche und Pandabären Ihr Chatfenster kreuzen. Machen Sie bitte Platz, wenn Cartoon-Schweinchen mit gelber Weste und Bauarbeiterhelm schwere Ziegelschubkarren vorbeischieben. Und zeigen Sie auch Verständnis, wenn Katzenpfötchen wild auf Laptops einhämmern mit dem Bitte-nicht-stören-Hinweis “搬砖ing” (bānzhuān-ing) – “gerade am Backsteintragen” (mit englischer ing-Verlaufsform). Vielleicht sendet Ihnen auch ein chinesischer Kollege folgende Message: 不说了,我要搬砖了 (bù shuō le, wǒ yào bānzhuān le) “Ich klinke mich dann mal aus, ich muss Backsteine schleppen.”
Nein, Chinas Angestellte sind nicht unter die Häuslebauer gegangen. Sie haben lediglich aus dem Sprachsteinbruch eine neue Alltagsmetapher rausgehauen, die sich prima als Internet-Meme eignet. 搬砖 bānzhuān (von 搬 bān “tragen, umstellen, umräumen” + 砖 zhuān “Backstein, Klinker, Ziegelstein”) ist im chinesischen Alltagssprachgebrauch neuerdings ein Synonym für schlecht bezahltes Rackern, Ackern und Schuften im Job. Die Ranklotz-Metaphorik trifft bei vielen jungen Menschen den Nerv der Zeit, angesichts platzender Traumjobseifenblasen und Überstundenernüchterung. Bester Gradmesser für die Beliebtheit des Trendbegriffs: eine nicht enden wollende Liste an Chat-Bildchen und digitalen Stickersets (表情包 biǎoqíngbāo), die sich aufklappt, wenn man 搬砖 bānzhuān in die WeChat-Suchmaske für Emojis eintippt.
Der Ziegelstein-Zynismus ist Teil eines Wortfeldes, das sich um die Unzufriedenheit im Job entsponnen hat. So verulken sich Chinas Büroangestellte gerne auch als 打工人 dǎgōngrén “Lohnarbeiter”. Dabei bezeichnete 打工 dǎgōng (“arbeiten, jobben”, ganz wörtlich eigentlich “Arbeit schlagen”) ursprünglich nur Gelegenheitsjobs oder einfache Lohnarbeiten, wie sie zum Beispiel Wanderarbeiter in den Städten verrichten. Eintönige und körperlich anstrengende Tätigkeiten also, die nur einen mageren Lohn abwerfen. Manche White-Collar-Worker in Chinas Bürotürmen motzen nun, dass sie trotz aller Karrierehoffnungen und guter Ausbildung letztlich auch nur bessere Tagelöhner sind.
Noch eine Frustrationsschublade tiefer ist der 工具人 gōngjùrén angesiedelt, der “Werkzeugmensch” (工具 gōngjù “Werkzeug, Instrument” + 人 rén “Mensch”). Als solche schimpften sich die Chinesen früher, wenn sie sich in zwischenmenschlichen Beziehungen nur als Mittel zum Zweck missbraucht sahen oder in Partnerschaften zum willenlosen “Schweizer Taschenmesser” avancierten, das dem oder der Liebsten als Laufbursche oder -mädchen jeden Wunsch von den Lippen ablas. Heute fühlt sich auch manch einer vom Chef zur Powerpoint-Zange oder zum Schreibtisch-Schraubenschlüssel instrumentalisiert. Gebührende Anerkennung und Vergütung der eigenen Leistungen? Fehlanzeige.
Besonders Chinas IT-Branche hechelt oft im Hamsterrad des 996-Überstunden-Übels. Angestellte der Tech-Branche haben sich daher scherzhaft den Namen 码农 mǎnóng “Code-Wanderarbeiter” gegeben (von 码 mǎ für 代码 dàimǎ “Code” wie in 写代码 xiě dàimǎ “einen Code schreiben” + 农 nóng wie in 农民 nóngmín “Wanderarbeiter vom Land”). Auch das also eine Anspielung auf das schuftende Heer der eher schlecht bezahlten Wanderarbeiter, die Chinas Aufschwung der vergangenen Jahrzehnte auf ihren Schultern mitgetragen haben.
Scheinbar geht eben die Motivation vor die Hunde, wenn sich nach Jahren des harten Büffelns und Studierens auch der vermeintlich attraktive Bürojob mehr als Ziegelsteinbruch und weniger als Zuckerschlecken erweist. Man sei eben doch nur ein “Arbeitsköter” (上班狗 shàngbāngǒu) respektive “Überstunden-Wauwau” (加班狗 jiābāngǒu) und entsprechend “hundemüde” (累成狗 lèi chéng gǒu) bellen Erschöpfte und Enttäuschte mit einer Prise Sarkasmus dann in Blogs und Posts. Auch das Gegenstück zum Backsteinschlepper-Modus (搬砖模式 bānzhuān móshì) hat im Mandarin natürlich längst eine bildhafte Bezeichnung gefunden. Wer keine Klinker klotzt, der “streichelt” in China “Fische”. Denn 摸鱼 mōyú (wörtlich “Fische tätscheln / streicheln / grapschen”) ist das trendige chinesische Sprachpendant für Faulenzen am Arbeitsplatz.
Überstunden, Überarbeitung und sprachliche Übersprungshandlungen sind natürlich längst kein genuin chinesisches Phänomen. Im Westen lodert der Burnout schließlich mancherorts längst als gesellschaftlicher Flächenbrand. Auch wir ringen auf der Werktätigenwippe um die richtige Work-Life-Balance. Vielleicht muss man manchmal nach fünf Uhr auch einfach fünfe gerade sein lassen und auf Digital-Detox-Modus (数字排毒 shùzì páidú “Digital Detox”) schalten. Und da bietet das Chinesische just noch eine andere Form des “Backsteinverschiebens” als Alternative an. Denn in einigen chinesischen Dialekten trägt 搬砖 bānzhuān auch die Bedeutung “Mahjong spielen” (eigentlich ja 打麻将 dǎ májiàng). Bei einem Gläschen Grüntee in einem chinesischen Garten speckige Spielsteine klackernd über den grünen Filz des Mahjongtisches schieben – das verspricht doch Heilung für gestresste Büroseelen, für chinesische genauso wie für deutsche.
Verena Menzel betreibt in Peking die Online-Sprachschule New Chinese.

Social-Media-Konten gesperrt
Die chinesischen Behörden haben 373 Konten auf Internetplattformen gesperrt und mit Strafen belegt. Als Grund nannten die Behörden, die betreffenden Accounts hätten “Informationen zur öffentlichen Ordnung fabriziert und verzerrt” und davon profitiert. Das berichtet Bloomberg.
Einige der Konten auf WeChat, Weibo und Xueqiu seien geschlossen worden, nachdem sie Gerüchte darüber verbreitet hätten, dass China bei einem Treffen eine Reihe von steuer- und wirtschaftspolitischen Maßnahmen diskutieren würde, hieß es in einer Erklärung der Regulierungsbehörde vom Samstag. Dies habe Auswirkungen auf den Aktienmarkt gehabt. Außerdem seien einige Konten auf Plattformen wie Kuaishou, Baidu und Zhihu aufgrund von Gerüchten über staatliche Subventionen, der Politik zu sozialen Sicherung und andere Themen geschlossen oder suspendiert worden. cyb