für US-Präsident Joe Biden war die Verabschiedung des Inflation Reduction Act im Sommer 2022 ein unerwarteter Erfolg. In Europa hingegen sieht man einige IRA-Regelungen mit Sorge. Bundeswirtschaftsminister Habeck und Frankreichs Wirtschaftsminister Le Maire sind nun mit ihren US-Kolleginnen und -Kollegen auf der Suche nach Auswegen aus dem Streit. Sie bieten engere Kooperation bei Green Tech und Lieferketten an. So solle eine “grüne Brücke über den Atlantik” gebaut werden. Bernhard Pötter berichtet aus Washington.
Peking reagiert auf ganz eigene Art auf das US-Subventionsprogramm – so zumindest lässt sich eine anstehende Entscheidung deuten, die weitreichende Folgen für die Solarbranche haben dürfte: China will ein Exportverbot für wichtige Technologien zur Produktion von Solaranlagen erlassen. Sollte das Verbot kommen, werde das für die westliche Industrie schmerzhaft sein, analysiert Nico Beckert. Die Volksrepublik ist weltweit führend sowohl bei der Herstellung von Solar-Vorprodukten als auch -Produktionsanlagen. Der Aufbau einer Solarindustrie in westlichen Staaten ohne chinesisches Equipment ist nach Einschätzung von Experten “fast unmöglich”.
Das Parlament macht Tempo: Morgen stimmen die Abgeordneten im federführenden Industrieausschuss über den Kompromiss zum Data Act ab. Beobachter rechnen mit einer klaren Mehrheit, da die großen Fraktionen den Vorschlag von Berichterstatterin Pilar del Castillo Vera (EVP) mittragen – wenn auch teilweise zähneknirschend, wie im Fall von Schattenberichterstatter Damian Boeselager (Grüne/EFA). Deutliche Kritik kommt hingegen aus der Industrie. Ein zentraler Konstruktionsfehler des Data Act sei, dass er nicht sachgerecht zwischen B2C- und B2B-Geschäftsbeziehungen unterscheide, heißt es etwa. Corinna Visser hat die Einzelheiten.

Die EU und die USA wollen beim Austausch von grünen Gütern enger zusammenarbeiten. “Wir sprechen darüber, ob über gemeinsame Standards und Normensetzung bei den grünen Industrien gemeinsame Märkte geschaffen werden können”, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck zum Abschluss seines Besuchs in Washington am Dienstag. Das soll über die bereits bestehende Expertengruppe zwischen den USA und der EU, den Trade Technology Council (TTC), geschehen.
Im Gespräch sei kein umfassendes Freihandelsabkommen, sondern praktische Einigungen: Zum Beispiel könnten Produkte, die auf dem US-Markt zugelassen sind, automatisch auch in Europa zugelassen werden – und umgekehrt, so Habeck. So solle eine “grüne Brücke über den Atlantik” gebaut werden.
Der Vorstoß zeigt, wie die USA und die EU sich im Streit um Subventionen für grüne US-Produkte vorsichtig aufeinander zubewegen wollen. Um die europäischen Interessen anzumelden und Spielräume bei der US-Regierung zu sondieren, war Habeck zusammen mit dem französischen Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire am Dienstag nach Washington gekommen. In “enger Absprache mit der EU-Kommission“, die die Verhandlungen führt, wie immer wieder betont wurde.
Beide Minister absolvierten einen Tag voller Gespräche in Washington: Auf Habecks Besuchsliste standen neben Energieministerin Jennifer Granholm auch Außenminister Antony Blinken, Finanzministerin Janet Yellen, Handelsministerin Gina Raimondo und die Handelsbeauftragte Katherine Tai.
Habeck lobte mehrfach den Inflation Reduction Act (IRA), mit dem der US-Kongress im vergangenen Sommer den Weg frei gemacht hat für massive Investitionen, unter anderem in grüne Technologien: Etwa 370 Milliarden Dollar sollen über zehn Jahre unter anderem in erneuerbare Energien, grünen Wasserstoff, saubere Mobilität, Batteriefertigung und Kohlenstoffspeicherung (CCS) fließen. Das Paket soll helfen, die CO₂-Emissionen der USA bis 2030 um jährlich eine Milliarde Tonnen zu senken. Es schafft damit bisher nach einer umfassenden Studie zwei Drittel der Reduktion, die nötig sind, um die USA wie beschlossen bis 2050 auf netto null Emissionen zu bringen.
Für US-Präsident Joe Biden war die Verabschiedung des IRA im Sommer 2022 ein großer und überraschender Erfolg. Es wurde erwartet, dass er es bei seiner Rede an die Nation am Dienstagabend (nach Redaktionsschluss) zu einem Hauptthema machen würde.
Habeck und Le Maire betonten, eine starke europäische Industrie kooperiere am besten mit einer starken amerikanischen Industrie. Vom IRA und der Nachfrage nach Produkten würden laut Habeck auch europäische Industrien wie der Anlagenbau stark profitieren.
Le Maire betonte aber auch, es brauche Fairness im Umgang miteinander. Diese Aussage bezieht sich auf Vorschriften im IRA, wonach etwa 60 Prozent aller Steuervergünstigungen eine “Local Content”-Klausel vorsehen. Damit müssen Produkte ganz oder teilweise in den USA gefertigt sein oder aus Kanada oder Mexiko stammen, mit denen die USA Freihandelsabkommen haben. Die EU hat bereits angekündigt, als Antwort auf den IRA auch ihre Beihilferegeln zu entschlacken.
Die Europäer drängen beim IRA besonders in folgenden Punkten auf Änderungen:
Habeck und Le Maire betonten, sie erwarteten nicht, dass der IRA als Gesetzespaket noch einmal verändert werde. Es gehe nun darum, in den Ausführungsbestimmungen noch Fortschritte zu erzielen.
Wie wichtig die Lieferketten für das grüne Wachstum in den USA sind, zeigt eine neue Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Demnach kommen bislang 76 Prozent der kritischen Rohstoffe aus Ländern, die kein Freihandelsabkommen mit den USA haben. Bei kritischer Green Tech wie Photovoltaik, Windturbinen oder Lithium-Batterien stammen die Rohstoffe zu mehr als der Hälfte aus Nicht-Freihandelsländern.
“Die USA wollen mit dem Inflation Reduction Act vor allem die heimische Wirtschaft stützen, sie resilienter gegen Lieferengpässe machen und sich als Technologieführer positionieren. Aber ihre starke Rohstoff- und Technologieabhängigkeit könnte dazu führen, dass sie weiterhin auch auf Länder ohne Freihandelsabkommen angewiesen sind”, erläutert Studienautorin Josefin Meyer.
Es ist eine kleine Meldung, die große Wirkung entfalten könnte: China will ein Exportverbot für wichtige Technologien zur Produktion von Solaranlagen erlassen. Eine endgültige Entscheidung darüber steht noch aus. Eine öffentliche Konsultation lief bis Ende Januar. Doch alle befragten China-Experten sind sich sicher, dass die Exporteinschränkungen kommen werden. Nach der Konsultationsphase mache China größere Änderungen an Regulierungen nur selten rückgängig, sagt Rebecca Arcesati, Analystin bei der deutschen China-Denkfabrik Merics.
Wird das Vorhaben durchgezogen, ist ein Export von Solar-Produktionstechnologien nur noch mit Genehmigung der Behörden möglich. “Es wird nicht einfach sein, solche Genehmigungen zu erhalten”, sagt die Handelsexpertin Wan-Hsin Liu vom Kiel Institut für Weltwirtschaft. Der Antragsprozess sei kompliziert.
Zunächst muss eine Anfrage gestellt werden, die unter anderem anhand von sicherheits- und industriepolitischen Gesichtspunkten geprüft wird. “Erst dann dürfen die Unternehmen mit möglichen Käufern über die Geschäfte verhandeln”, sagt Liu. Sind sich Käufer und Verkäufer über das Geschäft einig, muss eine zweite Export-Genehmigung “mit weiteren Dokumenten” beantragt werden.
Die Exportbeschränkungen werden den Aufbau eigener Produktionskapazitäten in westlichen Staaten “auf jeden Fall” verlangsamen, sagt Johannes Bernreuter, Experte für Solar-Lieferketten. Das Know-how bestehe zwar weiterhin, auch außerhalb Chinas. Aber “die Produktionskapazitäten sind winzig und preislich nicht wettbewerbsfähig”.
Chinesische Produktionsanlagen seien – auch durch jahrelange staatliche Subventionen für den Sektor – viel günstiger als westliche, sagt der Experte, der eine eigene Beratungsagentur führt. Aufgrund der fehlenden preislichen Wettbewerbsfähigkeit hätten sich westliche Hersteller von Produktionsanlagen aus dem Markt zurückgezogen. Das chinesische Ausfuhrverbot werde die westliche Industrie deshalb an einer zentralen Schwachstelle treffen.
Von den Exportbeschränkungen betroffen wären:
Die Volksrepublik ist weltweit führend bei der Herstellung dieser Solarvorprodukte. 97 Prozent der weltweit produzierten Solar-Wafer und -Ingots stammen aus China.
Auch bei Solar-Produktionsanlagen ist China Weltmarktführer. Der Aufbau einer Solarindustrie in westlichen Staaten ohne Rückgriff auf chinesisches Equipment sei “fast unmöglich”, schreiben die Analysten des Think-Tanks Bloomberg NEF. Die Eintrittsbarrieren zur Produktion von Wafern und Ingots sind demnach sehr hoch. “Das Spitzenwissen über die Fotovoltaik-Herstellung befindet sich in China“, so die BNEF-Analysten.
Die Exportbeschränkungen kommen nicht zu einem überraschenden Zeitpunkt. Die USA haben mit dem Inflation Reduction Act erst kürzlich Milliardensubventionen zum Aufbau grüner Industrien bereitgestellt. Auch die EU will bei grünen Technologien aufholen. Und Indien unternimmt viel zum Aufbau einer eigenen Solarindustrie.
China sieht also seine Vormachtstellung in dem Bereich bedroht. Der Solarsektor ist ein wichtiger Wirtschaftssektor:
Die Exportbeschränkungen für Solar-Produktionstechnologien dienen auch politischen Zwecken. “Peking will die westlichen Länder so weit wie möglich in Abhängigkeit von China halten und die Vorherrschaft über die von China kontrollierten Tech-Lieferketten ausbauen”, sagt Merics-Analystin Arcesati. Chinas Beschluss sei als Antwort auf den Inflation Reduction Act der USA und die Bemühungen der EU zum Aufbau eigener grüner Lieferketten zu verstehen.
Bei den Exporteinschränkungen für Solar-Produktionstechnologien “geht es um die nationale Sicherheit Chinas“, sagt Wan-Hsin Liu vom Kiel Institut für Weltwirtschaft. “Es ist für China wirtschaftlich sowie geopolitisch entscheidend, seine technologische Stärke und Wettbewerbsvorteile in der Solarproduktion zu beschützen.” Die Exportbeschränkungen könnten die Bemühungen anderer Staaten zum Aufbau eigener Solar-Lieferketten “verlangsamen oder gar behindern”, sagt Liu.
Die Brisanz der Entscheidung wird auch anhand der anderen Güter deutlich, die China schon in der Vergangenheit auf seine “Export-Beschränkungs-Liste” gesetzt hat. Die Liste wurde erstmals 2008 veröffentlicht. Schon früh wurden Technologien zur Förderung und Weiterverarbeitung von Seltenen Erden auf die Liste gesetzt, sodass Exporte dieser Technologien verboten sind. Auch bei der Förderung und dem Export Seltener Erden ist China weltweit führend und hatte zwischenzeitlich fast eine Monopolstellung aufgebaut.
Die Dominanz bei Seltenen Erden setzte Peking etwa 2010 in einem Territorialkonflikt gegen Japan ein. Es erließ einen Exportstopp und setzte Japan massiv unter Druck. China hat sein Exportkontrollsystem in den vergangenen Jahren “zur Verteidigung seiner sicherheitspolitischen, wirtschaftlichen, technologischen und industriellen Interessen” aufgebaut, sagt Arcesati von Merics.
Allerdings ist unklar, ob sich China mit diesen Exportbeschränkungen langfristig nicht sogar schadet. “Die Bedrohung durch die Kontrolle der Solartechnologie wird andere dazu veranlassen, ihre Bemühungen um Diversifizierung zu verstärken“, schreibt der Energieexperte Lauri Myllyvirta vom Centre for Research on Energy and Clean Air bei Twitter. Ähnliches war im Fall des chinesischen Seltene-Erden-Embargos gegen Japan zu beobachten. Der Nachbarstaat erhöhte daraufhin seine Bemühungen um Diversifizierung der Bezugsquellen.
Anders als beim AI Act ist es diesmal das Parlament, das Tempo macht. Der Rat ist beim Datengesetz (Data Act) noch weit entfernt von einer generellen Ausrichtung. Die Abgeordneten im federführenden Industrieausschuss (ITRE) an diesem Donnerstag stimmen jedoch bereits über einen Kompromiss ab. Das Papier liegt Table.Media vor.
Da die großen Fraktionen EVP, S&D, Renew, Grüne/EFA und EKR den Kompromiss von Berichterstatterin Pilar del Castillo Vera (EVP) mittragen, rechnen Beobachter damit, dass der Vorschlag eine klare Mehrheit findet. Widerspruch kommt aus der Industrie, sie warnt vor negativen Folgen für die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen. Die anderen beteiligten Ausschüsse haben ihre Stellungnahmen bereits abgegeben. Im Plenum ist die Abstimmung für den 13. März vorgesehen.
Das Parlament hat eine Reihe von Änderungen an dem von Binnenmarktkommissar Thierry Breton im Februar 2022 vorgeschlagenen Dossier vorgenommen. Darunter:
Schattenberichterstatter Damian Boeselager (Grüne/EFA) ist zwar nicht zufrieden, etwa wenn es um die Datendefinition geht. Denn den Herstellern würden unzählige Möglichkeiten geboten, um die Datenzugangsrechte von Nutzern, also den Eigentümern vernetzter Geräte, einzuschränken.
Dies sind unter anderem Geschäftsgeheimnisse, sicherheitsrelevante Daten sowie Daten, die auf Basis von komplexen proprietären Algorithmen erhoben werden und Anti-Wettbewerbsklauseln. All diese Einschränkungen machten das Teilen von Daten rechtsunsicherer. Und sie führten dazu, dass die Datenökonomie nicht ausreichend zur Ausfaltung komme, meint Boeselager. Insgesamt tragen er und seine Fraktion den Kompromiss jedoch mit.
Es sei “ein guter Start ist für eine Data Sharing Economy”, auch wenn er noch hinter den Möglichkeiten zurückbleibe, kommentiert die Vizepräsidentin des Europaparlaments, Nicola Beer (Renew), den Kompromiss. Ihr Fraktionskollege, Schattenberichterstatter Alin Mituța, sieht den Data Act gar als Schlüsselinstrument. Der Kompromiss schaffe “die Voraussetzungen dafür, dass europäische Unternehmen, einschließlich KMU, mehr Zugang zu Daten erhalten und innovativ sein können”.
Mituța findet, das Parlament habe Klarheit über viele Bestimmungen erreicht, einschließlich der Definitionen und des Anwendungsbereichs. “Er ist ein ausgewogener Ansatz, da er Garantien für den Schutz der Rechte am geistigen Eigentum unserer Unternehmen einführt und gleichzeitig sicherstellt, dass Unternehmen die Ausnahmeregelung für Geschäftsgeheimnisse nicht strategisch nutzen, um ihre Verpflichtungen zur Datenweitergabe zu umgehen.”
Angelika Niebler (CSU) sieht die Herausforderung beim Data Act vor allem darin, eine Balance zwischen den unterschiedlichen Interessen von Datennutzern sowie Dateninhabern zu finden. Wichtig sei zudem gewesen, besser abzugrenzen, welche Produktdaten geteilt werden müssen – und welche nicht, wie beispielsweise Daten von Prototypen. “Richtig ist auch, dass die Kommission in ihrer Review nun bewerten muss, ob es wirtschaftlich attraktiv ist, hochwertige und innovative Datensätze zu erheben”, sagt Niebler.
Beim Schutz der Geschäftsgeheimnisse hätte sich Niebler noch mehr Rechtssicherheit für Unternehmen gewünscht. Es sei zwar klargestellt, dass Inhaber von Geschäftsgeheimnissen die gemeinsame Nutzung dieser Daten bei einer Verletzung der Schutzmaßnahmen suspendieren können. “Besser wäre es aber, wenn der Inhaber der Geschäftsgeheimnisse die gemeinsame Nutzung von solchen Daten bei Nichteinhaltung dieser Maßnahmen auch im Vorfeld verweigern könnte”, meint Niebler. “Hier gilt es im weiteren Verlauf nachzubessern.”
Nachbesserungsbedarf sehen auch die europäische und die deutsche Wirtschaft. “Die konkreten Vorgaben des Data Acts stellen erhebliche Risiken für die Digitalisierung der Industrie und den Industriestandort Europa dar”, kritisiert der Verband der Maschinen- und Anlagenbauer VDMA. Er fordert das EU-Parlament auf, nicht unbegründet in Geschäftsbeziehungen einzugreifen und Freiräume im Data Act vorzusehen, die für den Datenaustausch zwischen Unternehmen unbedingt notwendig seien.
Ein zentraler Konstruktionsfehler des Data Act sei, dass er nicht sachgerecht zwischen B2C- und B2B-Geschäftsbeziehungen unterscheide. Diese grundsätzliche Trennung sei aber elementar, denn im B2B-Verhältnis müsse kein Verbraucher geschützt werden. “Es stehen sich Unternehmen gegenüber, die den Datenaustausch frei und für beide Seiten zufriedenstellend gestalten können”, befindet der VDMA.
Der Zentralverband des deutschen Handwerks wiederum fordert von den Abgeordneten, die Nutzer der Produkte in den Mittelpunkt zu rücken. “Handwerksbetriebe sind für ihre Arbeit auf einen fairen Zugang zu generierten Daten aus Heizungen, Smart Homes und Fahrzeugen angewiesen”, sagt ZDH-Generalsekretär Holger Schwannecke. Der Verband befürchtet einen Pflichtenkatalog, der für Handwerksbetriebe schwer überschaubar sei. Das führe dann dazu, dass für die Betriebe die Datennutzung und -verarbeitung zu riskant würde.
Nicola Beer geht davon aus, dass die Trilog-Verhandlungen schwierig werden. “Hier spielen auch viele nationale Interessen mit”, erläutert sie. “Wir müssen deshalb schauen, dass wir das Ziel nicht aus dem Blick verlieren: Es geht um eine Data Sharing Economy, die Innovation fördern soll durch einen verbesserten Zugang zu Rohdaten.” Dies helfe vor allem KMUs und Start-ups, sich zu entwickeln. “Im Trilog wird es darauf ankommen, die Mittelstandsperspektive durchzuziehen und nicht vor Interessen der National Champions einzuknicken.”
Die EU will Desinformationskampagnen aus China und Russland mit einer neuen Plattform effektiver entgegentreten. Ein neu geschaffenes Informationsaustausch- und Analysezentrum innerhalb des diplomatischen Dienstes der EU (EEAS) soll Desinformation aus Drittstaaten aufspüren und sich auch mit den 27 Mitgliedstaaten und zivilgesellschaftlichen Akteuren abstimmen, wie EU-Chefdiplomat Josep Borrell am Dienstag bei einer Veranstaltung zur Desinformationsbekämpfung in Brüssel sagte. “Autoritäre Regime versuchen, Fehlinformationen zu erzeugen und zu manipulieren”, warnte Borrell.
Die Idee ist es, eine dezentrale Plattform für den Austausch von Informationen in Echtzeit mit Ländern, Cybersicherheitsbehörden und NGOs zu schaffen. So sollen bereits bestehende Desinformationskampagnen besser untersucht und verstanden werden können. Außerdem soll auf neu aufkommende Narrative schneller reagiert werden können. Nähere Details zur Größe und Besetzung des Zentrums gab es zunächst nicht. Über die Plattform hinaus kündigte Borrell auch an, EU-Delegationen im Ausland mit Desinformationsexperten verstärken zu wollen.
Im vergangenen Jahr habe aus der Volksrepublik vor allem Informationsmanipulation im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Ukraine dominiert, sagte die auf Desinformation spezialisierte Einheit der EU, die Stratcom-Abteilung des EEAS, in einem ersten Bericht zu diesem Thema. Die verbreiteten Narrative hätten sich hauptsächlich darauf konzentriert, die russische Invasion zu unterstützen. “Ein Großteil der auf die Ukraine bezogenen Berichte in internationalen Kanälen staatlich kontrollierter chinesischer Medien basiert auf offiziellen russischen Quellen“, heißt es im Stratcom-Bericht.
Für den Bericht hat die Stratcom-Einheit rund 100 Fälle der Informationsmanipulation näher untersucht. Demnach ist die Desinformation überwiegend bild- und videobasiert, mehrsprachig und wird über ein dichtes Netzwerk von Akteuren verbreitet. Auf Twitter seien dazu auch die Kanäle von diplomatischen Vertretern aus China und Russland besonders involviert.
Deutlich werde auch, dass China sehr auf die eigene Wahrnehmung bedacht sei. So “verfolgt China gleichzeitig das Ziel, konkurrierende und potenziell kritische Geschichten über sich selbst zu unterdrücken, auch durch Einschüchterung und Belästigung”, heißt es in dem Bericht. So werde beispielsweise versucht, Berichte zu Menschenrechtsproblemen zu beeinflussen. Peking sei dabei auch besonders im Westbalkan aktiv. ari
Die Bundesregierung hat eine europäische Initiative zum Bürokratieabbau in bestimmten Technologiesektoren angestoßen. Es gebe “jede Menge” Vorschriften im europäischen Recht, die etwa den Ausbau der Photovoltaik unnötig aufhielten, sagte Wirtschaftsstaatssekretär Sven Giegold am Dienstag beim informellen Wettbewerbsfähigkeitsrat in Stockholm.
Als Beispiel nannte Giegold die Begrenzung der derzeit sehr gefragten Balkon-Solaranlagen auf 800 Watt Wechselrichterleistung, die in EU-Standards begründet sei. Fragwürdig sei auch die EU-Pflicht, bei zahlreichen Geräten in diversen Sprachen auf Papier gedruckte Gebrauchsanweisungen vorzulegen. Das Wirtschaftsministerium trägt derzeit weitere Beispiele zusammen.
Die Initiative zum Bürokratieabbau soll dazu beitragen, Europa als Produktionsstandort für Technologien wie Windkraft, Solar, Wärmepumpen oder Halbleiter zu stärken. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hatte im Herbst bereits die Plattform Clean Tech Europe angestoßen, die dem gleichen Ziel dient. Binnenmarktkommissar Thierry Breton kündigte in der Sitzung am Dienstag an, auch die neue Initiative aufzugreifen.
Die EU diskutiert derzeit, wie sie angesichts der massiven Förderung in den USA, China oder Indien in diesen Zukunftsmärkten wettbewerbsfähig bleiben kann. Die EU-Kommission hatte vergangene Woche ein Maßnahmenbündel vorgeschlagen, das den Mitgliedstaaten auch mehr Spielraum zur Subventionierung neuer Produktionsstätten einräumt.
Besonders Frankreich und Deutschland drängen auf Änderungen am Beihilferecht – die Verfahren seien zu bürokratisch und langsam. Etliche Mitgliedstaaten warnen angesichts ihrer geringen finanziellen Spielräume aber davor, zu stark auf Subventionen zu setzen.
Beim Sondergipfel am Donnerstag wollen die Staats- und Regierungschefs ebenfalls darüber diskutieren. Im aktuellen Entwurf der Schlussfolgerungen heißt es etwa, die “Verwaltungs- und Genehmigungsverfahren sollten vereinfacht und beschleunigt werden”. tho
Es gibt keine offizielle Bestätigung des Besuchs von Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag in Brüssel. Bestätigt ist nur, dass Ratspräsident Charles Michel den ukrainischen Präsidenten eingeladen hat, an einem Europäischen Rat teilzunehmen. Dass er schon am Donnerstag und Freitag zu dem Gipfeltreffen kommt, bei dem Russland, die Ukraine und Migration auf der Tagesordnung stehen, ist nicht verbürgt.
Im Gespräch war auch eine Rede von Selenskyj bei einer Sondersitzung um 10 Uhr im Europaparlament. Am Donnerstag war keine reguläre Sitzung geplant. Gestern Abend beschloss das Präsidium, die Abgeordneten für eine Sitzung am Donnerstag zwischen zehn und elf Uhr einzuladen.
Montagnachmittag hatte ein Tweet der EVP-Fraktion den Auftritt Selenskyjs im Parlament angekündigt. Der Tweet wurde schnell wieder zurückgezogen. Offenbar hatte das Social-Media-Team der Fraktion voreilig die Nachricht verbreitet und dabei die Risiken außer Acht gelassen.
Jede Reise ist ein hohes Risiko für den Politiker, dessen Land seit fast einem Jahr Ziel des russischen Angriffskrieges ist. Dem Vernehmen nach hatte Parlamentspräsidentin Roberta Metsola die Fraktionen am Montagnachmittag über den möglichen Besuch informiert. Seit Kriegsausbruch hat Selenskyj nur eine Auslandsreise in die USA unternommen. Auch dabei war versucht worden, seinen USA-Besuch so lange wie möglich geheim zu halten. mgr
Die Europäische Union hat am Dienstag Gespräche über ein mögliches Verbot der weit verbreiteten künstlich hergestellten Industriechemikaliengruppe PFAS begonnen. Deutschland, die Niederlande, Dänemark, Schweden und Norwegen hatten den Vorschlag zum Verbot von per- und polyfluorierten Alkylverbindungen (PFAS) gemacht, die im Verdacht stehen, krebserregend zu sein und Immunschwächen hervorzurufen.
Die Länder teilten in einer gemeinsamen Erklärung mit, es gehe um eines der größten Verbote für chemische Substanzen in Europa. “Ein Verbot von PFAS würde die PFAS-Mengen in der Umwelt langfristig reduzieren. Außerdem würden Produkte und Prozesse für den Menschen sicherer.”
Allerdings wird damit gerechnet, dass es Jahre dauern wird, bis ein solches Verbot in Kraft tritt. Innerhalb der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) werden zwei wissenschaftliche Ausschüsse für Risikobewertung (RAC) und für sozioökonomische Analyse (SEAC) prüfen, ob ein PFAS-Verbot mit der EU-Verordnung für Chemikalien (REACH) vereinbar ist. Dann wird es eine wissenschaftliche Bewertung und Beratung mit der Industrie geben. Die ECHA erklärte dazu, die beiden Ausschüsse könnten länger als die üblichen zwölf Monate brauchen, um ihre Bewertung abzuschließen. Anschließend entscheiden die Kommission und die EU-Mitgliedstaaten.
Unternehmen würden laut Vorschlagsentwurf zwischen 18 Monaten und zwölf Jahren Zeit bekommen, um je nach Verfügbarkeit alternative Stoffe einzuführen. “In vielen Fällen gibt es derzeit keine solchen Alternativen, und in einigen wird es sie möglicherweise auch nie geben”, teilten die Länder mit. Die Unternehmen müssten daher jetzt bereits damit beginnen, Ersatz zu finden.
PFAS stehen im Verdacht, gesundheitsschädigend zu sein. Demnach könnten sie unter anderem Leberschäden, Schilddrüsenerkrankungen, Fettleibigkeit, Fruchtbarkeitsstörungen und Krebs auslösen. Die Substanzen sind extrem langlebig und werden auch als “Ewigkeits-Chemikalien” bezeichnet. Sie widerstehen extremen Temperaturen und Korrosion und werden in Zehntausenden Produkten verwendet, darunter in Kühlmitteln, Flugzeugen, Autos, Textilien, medizinischen Ausrüstungen oder Windrädern. rtr
Erneut sind in zahlreichen französischen Städten Tausende aus Protest gegen die geplante Rentenreform auf die Straße gegangen. Kundgebungen gab es am Dienstag zum Beispiel in Bordeaux, Rennes, Montpellier und Toulouse. Zeitgleich kam es auch wieder zu Streiks – etwa bei der Bahn, in Schulen und im Energiesektor.
Frankreichs Mitte-Regierung unter Staatschef Emmanuel Macron will das Renteneintrittsalter schrittweise von 62 auf 64 Jahre anheben. Die Anhebung der nötigen Einzahldauer für eine volle Rente will sie beschleunigen. Außerdem sollen Einzelrentensysteme mit Privilegien für bestimmte Berufsgruppen abgeschafft werden.
Derzeit liegt das Renteneintrittsalter bei 62 Jahren. Tatsächlich beginnt der Ruhestand im Schnitt aber später: Wer nicht lang genug eingezahlt hat, um Anspruch auf volle Rente zu haben, arbeitet länger. Mit 67 Jahren gibt es dann unabhängig von der Einzahldauer Rente ohne Abschlag – dies will die Regierung so belassen. Die Mindestrente will sie auf etwa 1200 Euro anheben.
Der Regierung zufolge ist die Reform notwendig, weil das Rentensystem auf ein Defizit zuläuft. Die Gewerkschaften finden die Reformpläne ungerecht. Vergangene Woche brachten sie nach Angaben des Innenministeriums mehr als 1,27 Millionen Menschen auf die Straße. Die Gewerkschaft CGT sprach von etwa 2,8 Millionen, die sich an Streiks und Protest beteiligten.
Mittlerweile ist das Vorhaben im Plenum der Nationalversammlung zur Prüfung angekommen. Die Beratung soll noch bis Ende nächster Woche dauern. Die Regierung hat in der Parlamentskammer keine eigene Mehrheit und hofft auf Zustimmung der konservativen Républicains. Auch dort gibt es aber Vorbehalte. Noch steht keine Mehrheit. dpa
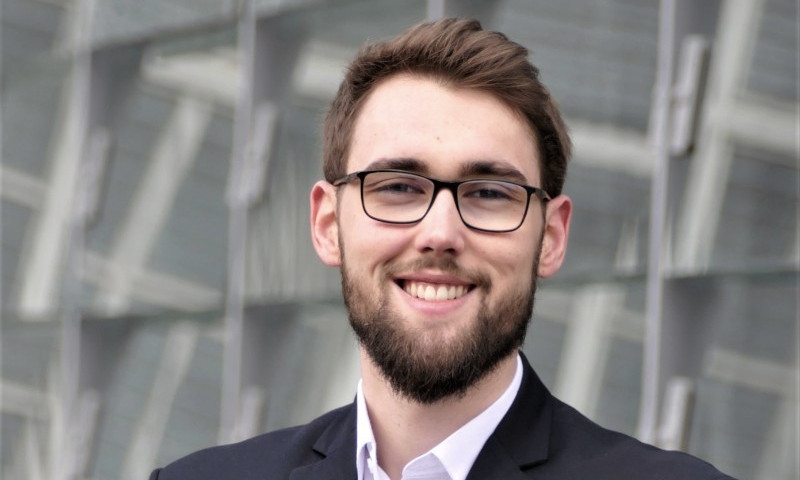
Während des Telefonats hat sich Florian Rothenberg eine Wolldecke umgehängt. Die Energiekrise beschäftigt ihn nicht nur beruflich – er ist Emissionshandel-Analyst beim Informationsdienst Independent Commodity Intelligence Services (ICIS) in Karlsruhe. Auch privat sind die hohen Energiepreise ein Thema für ihn: Weil er die Energiespar-Challenge der Stadtwerke Karlsruhe gewinnen und seinen Verbrauch um mindestens 20 Prozent senken will, heizt er kaum noch und duscht kalt. Und zieht sich bei der Arbeit im Homeoffice eben warm an.
Im Job beschäftigt sich Rothenberg aktuell vor allem mit der Frage, wie sich der Einmarsch Russlands in die Ukraine auf den europäischen Emissionshandel und die Energiemärkte auswirkt.
Viele Marktteilnehmer, auch Rothenbergs Kunden, hatten zu Beginn der Krise befürchtet, dass die Politik den Emissionshandel fallen lässt – die Preise für Energie und die Verschmutzungsrechte waren einfach zu stark gestiegen. “Vertrauen ist in dem Markt aber sehr wichtig”, sagt Rothenberg. Denn wenn ein Industriebetrieb jetzt Zertifikate für die kommenden zehn Jahre kaufe, müsse er sicher sein können, dass es das System des Emissionshandels dann auch noch gibt.
Am Ende gab es einen Kompromiss: Frontloading. Kurzfristig können Unternehmen mehr Zertifikate kaufen, zukünftig dafür weniger. Dadurch habe man erreicht, dass der Emissionshandel kein Kollateralschaden der Energiekrise geworden sei, sagt der Experte. “Im Vergleich zu anderen Märkten wie dem Strom- oder dem Gasmarkt ist er glimpflich davongekommen.”
Seit sechs Jahren arbeitet der 28-jährige Rothenberg bei ICIS, und “es wird nicht langweilig”. Er hat Wirtschaftsingenieurwesen in Karlsruhe studiert, und dort ist es normal, dass man irgendwann von ICIS hört. “Emissionshandel bleibt eine Nische, und daher ist ICIS nicht allen Studierenden bekannt”, sagt Rothenberg. “Aber wer sich mit Energiewirtschaft beschäftigt, stolpert über uns.”
Kernthemen des Analysten sind Energiemärkte und Dekarbonisierung, darüber hinaus informiert sich Rothenberg ständig über Trends, die die Märkte beeinflussen könnten. Das findet er spannend: “Das Thema CO₂ ist überall, ich muss sehr schnell verstehen, wo Energie gebraucht und verbraucht wird – und inwiefern das den Emissionshandel betrifft.”
Um diese Fragen zu beantworten, sammelt er unter anderem Daten zu Nachfrage und Angebot von Verschmutzungszertifikaten. Er untersucht, wie sich Preise bilden, warum sie sinken oder steigen. Seine Analysen hält er in mathematischen Modellen fest, diskutiert die Ergebnisse mit Kolleginnen und Kollegen und dann mit seinen Kunden.
Der Green Deal der EU ist zurzeit ein wichtiges Thema für ihn. “Die große Frage ist, zu welchem CO₂-Preis Europa Net-Zero erreichen kann“, sagt Florian Rothenberg. Dabei geht es nicht um einen konkreten Euro-Betrag, sondern um einen Preispfad. Denn der ist einer der wichtigsten Entscheidungsfaktoren für Industrieunternehmen, um in Klimaschutz zu investieren.
Klimaforscherinnen und Klimaforscher kritisieren, dass die Ziele der EU nicht weit genug gehen. “Das ist wahrscheinlich richtig, doch ambitioniertere Ziele hätten schon vor fünf bis zehn Jahren angestoßen werden müssen”, sagt Rothenberg. “Für die Wirtschaft ist es ein Riesenschritt, bis zum Jahr 2030 die EU-Emissionen um 55 Prozent zu senken, denn sie braucht unglaublich lange, um sich umzubauen.”
Sein eigener CO₂-Fußabdruck, gibt Rothenberg zu, ist “wahrscheinlich deutlich schlechter als der Weltdurchschnitt”. Denn er reist gerne und fliegt dafür auch mit dem Flugzeug. Immerhin nimmt er die Bahn, wenn er geschäftlich unterwegs ist, um Emissionen einzusparen. “Ich glaube, dass jeder einen kleinen Teil gegen den Klimawandel unternehmen kann und auch sollte.” Patricia Hoffhaus
für US-Präsident Joe Biden war die Verabschiedung des Inflation Reduction Act im Sommer 2022 ein unerwarteter Erfolg. In Europa hingegen sieht man einige IRA-Regelungen mit Sorge. Bundeswirtschaftsminister Habeck und Frankreichs Wirtschaftsminister Le Maire sind nun mit ihren US-Kolleginnen und -Kollegen auf der Suche nach Auswegen aus dem Streit. Sie bieten engere Kooperation bei Green Tech und Lieferketten an. So solle eine “grüne Brücke über den Atlantik” gebaut werden. Bernhard Pötter berichtet aus Washington.
Peking reagiert auf ganz eigene Art auf das US-Subventionsprogramm – so zumindest lässt sich eine anstehende Entscheidung deuten, die weitreichende Folgen für die Solarbranche haben dürfte: China will ein Exportverbot für wichtige Technologien zur Produktion von Solaranlagen erlassen. Sollte das Verbot kommen, werde das für die westliche Industrie schmerzhaft sein, analysiert Nico Beckert. Die Volksrepublik ist weltweit führend sowohl bei der Herstellung von Solar-Vorprodukten als auch -Produktionsanlagen. Der Aufbau einer Solarindustrie in westlichen Staaten ohne chinesisches Equipment ist nach Einschätzung von Experten “fast unmöglich”.
Das Parlament macht Tempo: Morgen stimmen die Abgeordneten im federführenden Industrieausschuss über den Kompromiss zum Data Act ab. Beobachter rechnen mit einer klaren Mehrheit, da die großen Fraktionen den Vorschlag von Berichterstatterin Pilar del Castillo Vera (EVP) mittragen – wenn auch teilweise zähneknirschend, wie im Fall von Schattenberichterstatter Damian Boeselager (Grüne/EFA). Deutliche Kritik kommt hingegen aus der Industrie. Ein zentraler Konstruktionsfehler des Data Act sei, dass er nicht sachgerecht zwischen B2C- und B2B-Geschäftsbeziehungen unterscheide, heißt es etwa. Corinna Visser hat die Einzelheiten.

Die EU und die USA wollen beim Austausch von grünen Gütern enger zusammenarbeiten. “Wir sprechen darüber, ob über gemeinsame Standards und Normensetzung bei den grünen Industrien gemeinsame Märkte geschaffen werden können”, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck zum Abschluss seines Besuchs in Washington am Dienstag. Das soll über die bereits bestehende Expertengruppe zwischen den USA und der EU, den Trade Technology Council (TTC), geschehen.
Im Gespräch sei kein umfassendes Freihandelsabkommen, sondern praktische Einigungen: Zum Beispiel könnten Produkte, die auf dem US-Markt zugelassen sind, automatisch auch in Europa zugelassen werden – und umgekehrt, so Habeck. So solle eine “grüne Brücke über den Atlantik” gebaut werden.
Der Vorstoß zeigt, wie die USA und die EU sich im Streit um Subventionen für grüne US-Produkte vorsichtig aufeinander zubewegen wollen. Um die europäischen Interessen anzumelden und Spielräume bei der US-Regierung zu sondieren, war Habeck zusammen mit dem französischen Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire am Dienstag nach Washington gekommen. In “enger Absprache mit der EU-Kommission“, die die Verhandlungen führt, wie immer wieder betont wurde.
Beide Minister absolvierten einen Tag voller Gespräche in Washington: Auf Habecks Besuchsliste standen neben Energieministerin Jennifer Granholm auch Außenminister Antony Blinken, Finanzministerin Janet Yellen, Handelsministerin Gina Raimondo und die Handelsbeauftragte Katherine Tai.
Habeck lobte mehrfach den Inflation Reduction Act (IRA), mit dem der US-Kongress im vergangenen Sommer den Weg frei gemacht hat für massive Investitionen, unter anderem in grüne Technologien: Etwa 370 Milliarden Dollar sollen über zehn Jahre unter anderem in erneuerbare Energien, grünen Wasserstoff, saubere Mobilität, Batteriefertigung und Kohlenstoffspeicherung (CCS) fließen. Das Paket soll helfen, die CO₂-Emissionen der USA bis 2030 um jährlich eine Milliarde Tonnen zu senken. Es schafft damit bisher nach einer umfassenden Studie zwei Drittel der Reduktion, die nötig sind, um die USA wie beschlossen bis 2050 auf netto null Emissionen zu bringen.
Für US-Präsident Joe Biden war die Verabschiedung des IRA im Sommer 2022 ein großer und überraschender Erfolg. Es wurde erwartet, dass er es bei seiner Rede an die Nation am Dienstagabend (nach Redaktionsschluss) zu einem Hauptthema machen würde.
Habeck und Le Maire betonten, eine starke europäische Industrie kooperiere am besten mit einer starken amerikanischen Industrie. Vom IRA und der Nachfrage nach Produkten würden laut Habeck auch europäische Industrien wie der Anlagenbau stark profitieren.
Le Maire betonte aber auch, es brauche Fairness im Umgang miteinander. Diese Aussage bezieht sich auf Vorschriften im IRA, wonach etwa 60 Prozent aller Steuervergünstigungen eine “Local Content”-Klausel vorsehen. Damit müssen Produkte ganz oder teilweise in den USA gefertigt sein oder aus Kanada oder Mexiko stammen, mit denen die USA Freihandelsabkommen haben. Die EU hat bereits angekündigt, als Antwort auf den IRA auch ihre Beihilferegeln zu entschlacken.
Die Europäer drängen beim IRA besonders in folgenden Punkten auf Änderungen:
Habeck und Le Maire betonten, sie erwarteten nicht, dass der IRA als Gesetzespaket noch einmal verändert werde. Es gehe nun darum, in den Ausführungsbestimmungen noch Fortschritte zu erzielen.
Wie wichtig die Lieferketten für das grüne Wachstum in den USA sind, zeigt eine neue Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Demnach kommen bislang 76 Prozent der kritischen Rohstoffe aus Ländern, die kein Freihandelsabkommen mit den USA haben. Bei kritischer Green Tech wie Photovoltaik, Windturbinen oder Lithium-Batterien stammen die Rohstoffe zu mehr als der Hälfte aus Nicht-Freihandelsländern.
“Die USA wollen mit dem Inflation Reduction Act vor allem die heimische Wirtschaft stützen, sie resilienter gegen Lieferengpässe machen und sich als Technologieführer positionieren. Aber ihre starke Rohstoff- und Technologieabhängigkeit könnte dazu führen, dass sie weiterhin auch auf Länder ohne Freihandelsabkommen angewiesen sind”, erläutert Studienautorin Josefin Meyer.
Es ist eine kleine Meldung, die große Wirkung entfalten könnte: China will ein Exportverbot für wichtige Technologien zur Produktion von Solaranlagen erlassen. Eine endgültige Entscheidung darüber steht noch aus. Eine öffentliche Konsultation lief bis Ende Januar. Doch alle befragten China-Experten sind sich sicher, dass die Exporteinschränkungen kommen werden. Nach der Konsultationsphase mache China größere Änderungen an Regulierungen nur selten rückgängig, sagt Rebecca Arcesati, Analystin bei der deutschen China-Denkfabrik Merics.
Wird das Vorhaben durchgezogen, ist ein Export von Solar-Produktionstechnologien nur noch mit Genehmigung der Behörden möglich. “Es wird nicht einfach sein, solche Genehmigungen zu erhalten”, sagt die Handelsexpertin Wan-Hsin Liu vom Kiel Institut für Weltwirtschaft. Der Antragsprozess sei kompliziert.
Zunächst muss eine Anfrage gestellt werden, die unter anderem anhand von sicherheits- und industriepolitischen Gesichtspunkten geprüft wird. “Erst dann dürfen die Unternehmen mit möglichen Käufern über die Geschäfte verhandeln”, sagt Liu. Sind sich Käufer und Verkäufer über das Geschäft einig, muss eine zweite Export-Genehmigung “mit weiteren Dokumenten” beantragt werden.
Die Exportbeschränkungen werden den Aufbau eigener Produktionskapazitäten in westlichen Staaten “auf jeden Fall” verlangsamen, sagt Johannes Bernreuter, Experte für Solar-Lieferketten. Das Know-how bestehe zwar weiterhin, auch außerhalb Chinas. Aber “die Produktionskapazitäten sind winzig und preislich nicht wettbewerbsfähig”.
Chinesische Produktionsanlagen seien – auch durch jahrelange staatliche Subventionen für den Sektor – viel günstiger als westliche, sagt der Experte, der eine eigene Beratungsagentur führt. Aufgrund der fehlenden preislichen Wettbewerbsfähigkeit hätten sich westliche Hersteller von Produktionsanlagen aus dem Markt zurückgezogen. Das chinesische Ausfuhrverbot werde die westliche Industrie deshalb an einer zentralen Schwachstelle treffen.
Von den Exportbeschränkungen betroffen wären:
Die Volksrepublik ist weltweit führend bei der Herstellung dieser Solarvorprodukte. 97 Prozent der weltweit produzierten Solar-Wafer und -Ingots stammen aus China.
Auch bei Solar-Produktionsanlagen ist China Weltmarktführer. Der Aufbau einer Solarindustrie in westlichen Staaten ohne Rückgriff auf chinesisches Equipment sei “fast unmöglich”, schreiben die Analysten des Think-Tanks Bloomberg NEF. Die Eintrittsbarrieren zur Produktion von Wafern und Ingots sind demnach sehr hoch. “Das Spitzenwissen über die Fotovoltaik-Herstellung befindet sich in China“, so die BNEF-Analysten.
Die Exportbeschränkungen kommen nicht zu einem überraschenden Zeitpunkt. Die USA haben mit dem Inflation Reduction Act erst kürzlich Milliardensubventionen zum Aufbau grüner Industrien bereitgestellt. Auch die EU will bei grünen Technologien aufholen. Und Indien unternimmt viel zum Aufbau einer eigenen Solarindustrie.
China sieht also seine Vormachtstellung in dem Bereich bedroht. Der Solarsektor ist ein wichtiger Wirtschaftssektor:
Die Exportbeschränkungen für Solar-Produktionstechnologien dienen auch politischen Zwecken. “Peking will die westlichen Länder so weit wie möglich in Abhängigkeit von China halten und die Vorherrschaft über die von China kontrollierten Tech-Lieferketten ausbauen”, sagt Merics-Analystin Arcesati. Chinas Beschluss sei als Antwort auf den Inflation Reduction Act der USA und die Bemühungen der EU zum Aufbau eigener grüner Lieferketten zu verstehen.
Bei den Exporteinschränkungen für Solar-Produktionstechnologien “geht es um die nationale Sicherheit Chinas“, sagt Wan-Hsin Liu vom Kiel Institut für Weltwirtschaft. “Es ist für China wirtschaftlich sowie geopolitisch entscheidend, seine technologische Stärke und Wettbewerbsvorteile in der Solarproduktion zu beschützen.” Die Exportbeschränkungen könnten die Bemühungen anderer Staaten zum Aufbau eigener Solar-Lieferketten “verlangsamen oder gar behindern”, sagt Liu.
Die Brisanz der Entscheidung wird auch anhand der anderen Güter deutlich, die China schon in der Vergangenheit auf seine “Export-Beschränkungs-Liste” gesetzt hat. Die Liste wurde erstmals 2008 veröffentlicht. Schon früh wurden Technologien zur Förderung und Weiterverarbeitung von Seltenen Erden auf die Liste gesetzt, sodass Exporte dieser Technologien verboten sind. Auch bei der Förderung und dem Export Seltener Erden ist China weltweit führend und hatte zwischenzeitlich fast eine Monopolstellung aufgebaut.
Die Dominanz bei Seltenen Erden setzte Peking etwa 2010 in einem Territorialkonflikt gegen Japan ein. Es erließ einen Exportstopp und setzte Japan massiv unter Druck. China hat sein Exportkontrollsystem in den vergangenen Jahren “zur Verteidigung seiner sicherheitspolitischen, wirtschaftlichen, technologischen und industriellen Interessen” aufgebaut, sagt Arcesati von Merics.
Allerdings ist unklar, ob sich China mit diesen Exportbeschränkungen langfristig nicht sogar schadet. “Die Bedrohung durch die Kontrolle der Solartechnologie wird andere dazu veranlassen, ihre Bemühungen um Diversifizierung zu verstärken“, schreibt der Energieexperte Lauri Myllyvirta vom Centre for Research on Energy and Clean Air bei Twitter. Ähnliches war im Fall des chinesischen Seltene-Erden-Embargos gegen Japan zu beobachten. Der Nachbarstaat erhöhte daraufhin seine Bemühungen um Diversifizierung der Bezugsquellen.
Anders als beim AI Act ist es diesmal das Parlament, das Tempo macht. Der Rat ist beim Datengesetz (Data Act) noch weit entfernt von einer generellen Ausrichtung. Die Abgeordneten im federführenden Industrieausschuss (ITRE) an diesem Donnerstag stimmen jedoch bereits über einen Kompromiss ab. Das Papier liegt Table.Media vor.
Da die großen Fraktionen EVP, S&D, Renew, Grüne/EFA und EKR den Kompromiss von Berichterstatterin Pilar del Castillo Vera (EVP) mittragen, rechnen Beobachter damit, dass der Vorschlag eine klare Mehrheit findet. Widerspruch kommt aus der Industrie, sie warnt vor negativen Folgen für die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen. Die anderen beteiligten Ausschüsse haben ihre Stellungnahmen bereits abgegeben. Im Plenum ist die Abstimmung für den 13. März vorgesehen.
Das Parlament hat eine Reihe von Änderungen an dem von Binnenmarktkommissar Thierry Breton im Februar 2022 vorgeschlagenen Dossier vorgenommen. Darunter:
Schattenberichterstatter Damian Boeselager (Grüne/EFA) ist zwar nicht zufrieden, etwa wenn es um die Datendefinition geht. Denn den Herstellern würden unzählige Möglichkeiten geboten, um die Datenzugangsrechte von Nutzern, also den Eigentümern vernetzter Geräte, einzuschränken.
Dies sind unter anderem Geschäftsgeheimnisse, sicherheitsrelevante Daten sowie Daten, die auf Basis von komplexen proprietären Algorithmen erhoben werden und Anti-Wettbewerbsklauseln. All diese Einschränkungen machten das Teilen von Daten rechtsunsicherer. Und sie führten dazu, dass die Datenökonomie nicht ausreichend zur Ausfaltung komme, meint Boeselager. Insgesamt tragen er und seine Fraktion den Kompromiss jedoch mit.
Es sei “ein guter Start ist für eine Data Sharing Economy”, auch wenn er noch hinter den Möglichkeiten zurückbleibe, kommentiert die Vizepräsidentin des Europaparlaments, Nicola Beer (Renew), den Kompromiss. Ihr Fraktionskollege, Schattenberichterstatter Alin Mituța, sieht den Data Act gar als Schlüsselinstrument. Der Kompromiss schaffe “die Voraussetzungen dafür, dass europäische Unternehmen, einschließlich KMU, mehr Zugang zu Daten erhalten und innovativ sein können”.
Mituța findet, das Parlament habe Klarheit über viele Bestimmungen erreicht, einschließlich der Definitionen und des Anwendungsbereichs. “Er ist ein ausgewogener Ansatz, da er Garantien für den Schutz der Rechte am geistigen Eigentum unserer Unternehmen einführt und gleichzeitig sicherstellt, dass Unternehmen die Ausnahmeregelung für Geschäftsgeheimnisse nicht strategisch nutzen, um ihre Verpflichtungen zur Datenweitergabe zu umgehen.”
Angelika Niebler (CSU) sieht die Herausforderung beim Data Act vor allem darin, eine Balance zwischen den unterschiedlichen Interessen von Datennutzern sowie Dateninhabern zu finden. Wichtig sei zudem gewesen, besser abzugrenzen, welche Produktdaten geteilt werden müssen – und welche nicht, wie beispielsweise Daten von Prototypen. “Richtig ist auch, dass die Kommission in ihrer Review nun bewerten muss, ob es wirtschaftlich attraktiv ist, hochwertige und innovative Datensätze zu erheben”, sagt Niebler.
Beim Schutz der Geschäftsgeheimnisse hätte sich Niebler noch mehr Rechtssicherheit für Unternehmen gewünscht. Es sei zwar klargestellt, dass Inhaber von Geschäftsgeheimnissen die gemeinsame Nutzung dieser Daten bei einer Verletzung der Schutzmaßnahmen suspendieren können. “Besser wäre es aber, wenn der Inhaber der Geschäftsgeheimnisse die gemeinsame Nutzung von solchen Daten bei Nichteinhaltung dieser Maßnahmen auch im Vorfeld verweigern könnte”, meint Niebler. “Hier gilt es im weiteren Verlauf nachzubessern.”
Nachbesserungsbedarf sehen auch die europäische und die deutsche Wirtschaft. “Die konkreten Vorgaben des Data Acts stellen erhebliche Risiken für die Digitalisierung der Industrie und den Industriestandort Europa dar”, kritisiert der Verband der Maschinen- und Anlagenbauer VDMA. Er fordert das EU-Parlament auf, nicht unbegründet in Geschäftsbeziehungen einzugreifen und Freiräume im Data Act vorzusehen, die für den Datenaustausch zwischen Unternehmen unbedingt notwendig seien.
Ein zentraler Konstruktionsfehler des Data Act sei, dass er nicht sachgerecht zwischen B2C- und B2B-Geschäftsbeziehungen unterscheide. Diese grundsätzliche Trennung sei aber elementar, denn im B2B-Verhältnis müsse kein Verbraucher geschützt werden. “Es stehen sich Unternehmen gegenüber, die den Datenaustausch frei und für beide Seiten zufriedenstellend gestalten können”, befindet der VDMA.
Der Zentralverband des deutschen Handwerks wiederum fordert von den Abgeordneten, die Nutzer der Produkte in den Mittelpunkt zu rücken. “Handwerksbetriebe sind für ihre Arbeit auf einen fairen Zugang zu generierten Daten aus Heizungen, Smart Homes und Fahrzeugen angewiesen”, sagt ZDH-Generalsekretär Holger Schwannecke. Der Verband befürchtet einen Pflichtenkatalog, der für Handwerksbetriebe schwer überschaubar sei. Das führe dann dazu, dass für die Betriebe die Datennutzung und -verarbeitung zu riskant würde.
Nicola Beer geht davon aus, dass die Trilog-Verhandlungen schwierig werden. “Hier spielen auch viele nationale Interessen mit”, erläutert sie. “Wir müssen deshalb schauen, dass wir das Ziel nicht aus dem Blick verlieren: Es geht um eine Data Sharing Economy, die Innovation fördern soll durch einen verbesserten Zugang zu Rohdaten.” Dies helfe vor allem KMUs und Start-ups, sich zu entwickeln. “Im Trilog wird es darauf ankommen, die Mittelstandsperspektive durchzuziehen und nicht vor Interessen der National Champions einzuknicken.”
Die EU will Desinformationskampagnen aus China und Russland mit einer neuen Plattform effektiver entgegentreten. Ein neu geschaffenes Informationsaustausch- und Analysezentrum innerhalb des diplomatischen Dienstes der EU (EEAS) soll Desinformation aus Drittstaaten aufspüren und sich auch mit den 27 Mitgliedstaaten und zivilgesellschaftlichen Akteuren abstimmen, wie EU-Chefdiplomat Josep Borrell am Dienstag bei einer Veranstaltung zur Desinformationsbekämpfung in Brüssel sagte. “Autoritäre Regime versuchen, Fehlinformationen zu erzeugen und zu manipulieren”, warnte Borrell.
Die Idee ist es, eine dezentrale Plattform für den Austausch von Informationen in Echtzeit mit Ländern, Cybersicherheitsbehörden und NGOs zu schaffen. So sollen bereits bestehende Desinformationskampagnen besser untersucht und verstanden werden können. Außerdem soll auf neu aufkommende Narrative schneller reagiert werden können. Nähere Details zur Größe und Besetzung des Zentrums gab es zunächst nicht. Über die Plattform hinaus kündigte Borrell auch an, EU-Delegationen im Ausland mit Desinformationsexperten verstärken zu wollen.
Im vergangenen Jahr habe aus der Volksrepublik vor allem Informationsmanipulation im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Ukraine dominiert, sagte die auf Desinformation spezialisierte Einheit der EU, die Stratcom-Abteilung des EEAS, in einem ersten Bericht zu diesem Thema. Die verbreiteten Narrative hätten sich hauptsächlich darauf konzentriert, die russische Invasion zu unterstützen. “Ein Großteil der auf die Ukraine bezogenen Berichte in internationalen Kanälen staatlich kontrollierter chinesischer Medien basiert auf offiziellen russischen Quellen“, heißt es im Stratcom-Bericht.
Für den Bericht hat die Stratcom-Einheit rund 100 Fälle der Informationsmanipulation näher untersucht. Demnach ist die Desinformation überwiegend bild- und videobasiert, mehrsprachig und wird über ein dichtes Netzwerk von Akteuren verbreitet. Auf Twitter seien dazu auch die Kanäle von diplomatischen Vertretern aus China und Russland besonders involviert.
Deutlich werde auch, dass China sehr auf die eigene Wahrnehmung bedacht sei. So “verfolgt China gleichzeitig das Ziel, konkurrierende und potenziell kritische Geschichten über sich selbst zu unterdrücken, auch durch Einschüchterung und Belästigung”, heißt es in dem Bericht. So werde beispielsweise versucht, Berichte zu Menschenrechtsproblemen zu beeinflussen. Peking sei dabei auch besonders im Westbalkan aktiv. ari
Die Bundesregierung hat eine europäische Initiative zum Bürokratieabbau in bestimmten Technologiesektoren angestoßen. Es gebe “jede Menge” Vorschriften im europäischen Recht, die etwa den Ausbau der Photovoltaik unnötig aufhielten, sagte Wirtschaftsstaatssekretär Sven Giegold am Dienstag beim informellen Wettbewerbsfähigkeitsrat in Stockholm.
Als Beispiel nannte Giegold die Begrenzung der derzeit sehr gefragten Balkon-Solaranlagen auf 800 Watt Wechselrichterleistung, die in EU-Standards begründet sei. Fragwürdig sei auch die EU-Pflicht, bei zahlreichen Geräten in diversen Sprachen auf Papier gedruckte Gebrauchsanweisungen vorzulegen. Das Wirtschaftsministerium trägt derzeit weitere Beispiele zusammen.
Die Initiative zum Bürokratieabbau soll dazu beitragen, Europa als Produktionsstandort für Technologien wie Windkraft, Solar, Wärmepumpen oder Halbleiter zu stärken. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hatte im Herbst bereits die Plattform Clean Tech Europe angestoßen, die dem gleichen Ziel dient. Binnenmarktkommissar Thierry Breton kündigte in der Sitzung am Dienstag an, auch die neue Initiative aufzugreifen.
Die EU diskutiert derzeit, wie sie angesichts der massiven Förderung in den USA, China oder Indien in diesen Zukunftsmärkten wettbewerbsfähig bleiben kann. Die EU-Kommission hatte vergangene Woche ein Maßnahmenbündel vorgeschlagen, das den Mitgliedstaaten auch mehr Spielraum zur Subventionierung neuer Produktionsstätten einräumt.
Besonders Frankreich und Deutschland drängen auf Änderungen am Beihilferecht – die Verfahren seien zu bürokratisch und langsam. Etliche Mitgliedstaaten warnen angesichts ihrer geringen finanziellen Spielräume aber davor, zu stark auf Subventionen zu setzen.
Beim Sondergipfel am Donnerstag wollen die Staats- und Regierungschefs ebenfalls darüber diskutieren. Im aktuellen Entwurf der Schlussfolgerungen heißt es etwa, die “Verwaltungs- und Genehmigungsverfahren sollten vereinfacht und beschleunigt werden”. tho
Es gibt keine offizielle Bestätigung des Besuchs von Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag in Brüssel. Bestätigt ist nur, dass Ratspräsident Charles Michel den ukrainischen Präsidenten eingeladen hat, an einem Europäischen Rat teilzunehmen. Dass er schon am Donnerstag und Freitag zu dem Gipfeltreffen kommt, bei dem Russland, die Ukraine und Migration auf der Tagesordnung stehen, ist nicht verbürgt.
Im Gespräch war auch eine Rede von Selenskyj bei einer Sondersitzung um 10 Uhr im Europaparlament. Am Donnerstag war keine reguläre Sitzung geplant. Gestern Abend beschloss das Präsidium, die Abgeordneten für eine Sitzung am Donnerstag zwischen zehn und elf Uhr einzuladen.
Montagnachmittag hatte ein Tweet der EVP-Fraktion den Auftritt Selenskyjs im Parlament angekündigt. Der Tweet wurde schnell wieder zurückgezogen. Offenbar hatte das Social-Media-Team der Fraktion voreilig die Nachricht verbreitet und dabei die Risiken außer Acht gelassen.
Jede Reise ist ein hohes Risiko für den Politiker, dessen Land seit fast einem Jahr Ziel des russischen Angriffskrieges ist. Dem Vernehmen nach hatte Parlamentspräsidentin Roberta Metsola die Fraktionen am Montagnachmittag über den möglichen Besuch informiert. Seit Kriegsausbruch hat Selenskyj nur eine Auslandsreise in die USA unternommen. Auch dabei war versucht worden, seinen USA-Besuch so lange wie möglich geheim zu halten. mgr
Die Europäische Union hat am Dienstag Gespräche über ein mögliches Verbot der weit verbreiteten künstlich hergestellten Industriechemikaliengruppe PFAS begonnen. Deutschland, die Niederlande, Dänemark, Schweden und Norwegen hatten den Vorschlag zum Verbot von per- und polyfluorierten Alkylverbindungen (PFAS) gemacht, die im Verdacht stehen, krebserregend zu sein und Immunschwächen hervorzurufen.
Die Länder teilten in einer gemeinsamen Erklärung mit, es gehe um eines der größten Verbote für chemische Substanzen in Europa. “Ein Verbot von PFAS würde die PFAS-Mengen in der Umwelt langfristig reduzieren. Außerdem würden Produkte und Prozesse für den Menschen sicherer.”
Allerdings wird damit gerechnet, dass es Jahre dauern wird, bis ein solches Verbot in Kraft tritt. Innerhalb der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) werden zwei wissenschaftliche Ausschüsse für Risikobewertung (RAC) und für sozioökonomische Analyse (SEAC) prüfen, ob ein PFAS-Verbot mit der EU-Verordnung für Chemikalien (REACH) vereinbar ist. Dann wird es eine wissenschaftliche Bewertung und Beratung mit der Industrie geben. Die ECHA erklärte dazu, die beiden Ausschüsse könnten länger als die üblichen zwölf Monate brauchen, um ihre Bewertung abzuschließen. Anschließend entscheiden die Kommission und die EU-Mitgliedstaaten.
Unternehmen würden laut Vorschlagsentwurf zwischen 18 Monaten und zwölf Jahren Zeit bekommen, um je nach Verfügbarkeit alternative Stoffe einzuführen. “In vielen Fällen gibt es derzeit keine solchen Alternativen, und in einigen wird es sie möglicherweise auch nie geben”, teilten die Länder mit. Die Unternehmen müssten daher jetzt bereits damit beginnen, Ersatz zu finden.
PFAS stehen im Verdacht, gesundheitsschädigend zu sein. Demnach könnten sie unter anderem Leberschäden, Schilddrüsenerkrankungen, Fettleibigkeit, Fruchtbarkeitsstörungen und Krebs auslösen. Die Substanzen sind extrem langlebig und werden auch als “Ewigkeits-Chemikalien” bezeichnet. Sie widerstehen extremen Temperaturen und Korrosion und werden in Zehntausenden Produkten verwendet, darunter in Kühlmitteln, Flugzeugen, Autos, Textilien, medizinischen Ausrüstungen oder Windrädern. rtr
Erneut sind in zahlreichen französischen Städten Tausende aus Protest gegen die geplante Rentenreform auf die Straße gegangen. Kundgebungen gab es am Dienstag zum Beispiel in Bordeaux, Rennes, Montpellier und Toulouse. Zeitgleich kam es auch wieder zu Streiks – etwa bei der Bahn, in Schulen und im Energiesektor.
Frankreichs Mitte-Regierung unter Staatschef Emmanuel Macron will das Renteneintrittsalter schrittweise von 62 auf 64 Jahre anheben. Die Anhebung der nötigen Einzahldauer für eine volle Rente will sie beschleunigen. Außerdem sollen Einzelrentensysteme mit Privilegien für bestimmte Berufsgruppen abgeschafft werden.
Derzeit liegt das Renteneintrittsalter bei 62 Jahren. Tatsächlich beginnt der Ruhestand im Schnitt aber später: Wer nicht lang genug eingezahlt hat, um Anspruch auf volle Rente zu haben, arbeitet länger. Mit 67 Jahren gibt es dann unabhängig von der Einzahldauer Rente ohne Abschlag – dies will die Regierung so belassen. Die Mindestrente will sie auf etwa 1200 Euro anheben.
Der Regierung zufolge ist die Reform notwendig, weil das Rentensystem auf ein Defizit zuläuft. Die Gewerkschaften finden die Reformpläne ungerecht. Vergangene Woche brachten sie nach Angaben des Innenministeriums mehr als 1,27 Millionen Menschen auf die Straße. Die Gewerkschaft CGT sprach von etwa 2,8 Millionen, die sich an Streiks und Protest beteiligten.
Mittlerweile ist das Vorhaben im Plenum der Nationalversammlung zur Prüfung angekommen. Die Beratung soll noch bis Ende nächster Woche dauern. Die Regierung hat in der Parlamentskammer keine eigene Mehrheit und hofft auf Zustimmung der konservativen Républicains. Auch dort gibt es aber Vorbehalte. Noch steht keine Mehrheit. dpa
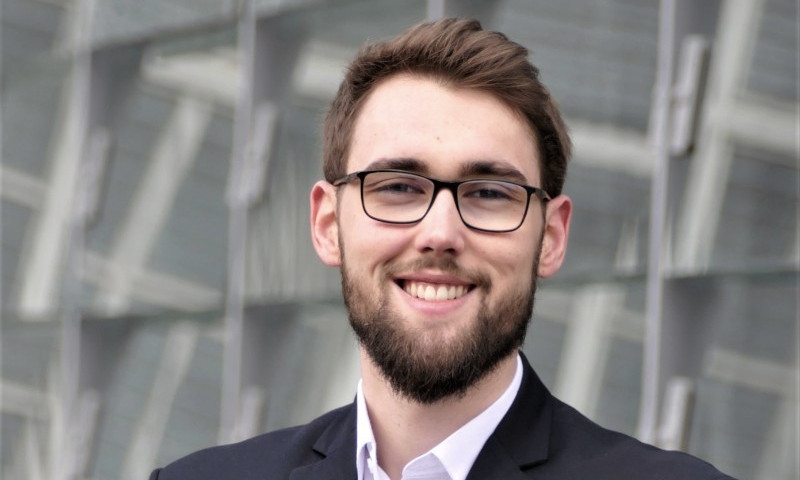
Während des Telefonats hat sich Florian Rothenberg eine Wolldecke umgehängt. Die Energiekrise beschäftigt ihn nicht nur beruflich – er ist Emissionshandel-Analyst beim Informationsdienst Independent Commodity Intelligence Services (ICIS) in Karlsruhe. Auch privat sind die hohen Energiepreise ein Thema für ihn: Weil er die Energiespar-Challenge der Stadtwerke Karlsruhe gewinnen und seinen Verbrauch um mindestens 20 Prozent senken will, heizt er kaum noch und duscht kalt. Und zieht sich bei der Arbeit im Homeoffice eben warm an.
Im Job beschäftigt sich Rothenberg aktuell vor allem mit der Frage, wie sich der Einmarsch Russlands in die Ukraine auf den europäischen Emissionshandel und die Energiemärkte auswirkt.
Viele Marktteilnehmer, auch Rothenbergs Kunden, hatten zu Beginn der Krise befürchtet, dass die Politik den Emissionshandel fallen lässt – die Preise für Energie und die Verschmutzungsrechte waren einfach zu stark gestiegen. “Vertrauen ist in dem Markt aber sehr wichtig”, sagt Rothenberg. Denn wenn ein Industriebetrieb jetzt Zertifikate für die kommenden zehn Jahre kaufe, müsse er sicher sein können, dass es das System des Emissionshandels dann auch noch gibt.
Am Ende gab es einen Kompromiss: Frontloading. Kurzfristig können Unternehmen mehr Zertifikate kaufen, zukünftig dafür weniger. Dadurch habe man erreicht, dass der Emissionshandel kein Kollateralschaden der Energiekrise geworden sei, sagt der Experte. “Im Vergleich zu anderen Märkten wie dem Strom- oder dem Gasmarkt ist er glimpflich davongekommen.”
Seit sechs Jahren arbeitet der 28-jährige Rothenberg bei ICIS, und “es wird nicht langweilig”. Er hat Wirtschaftsingenieurwesen in Karlsruhe studiert, und dort ist es normal, dass man irgendwann von ICIS hört. “Emissionshandel bleibt eine Nische, und daher ist ICIS nicht allen Studierenden bekannt”, sagt Rothenberg. “Aber wer sich mit Energiewirtschaft beschäftigt, stolpert über uns.”
Kernthemen des Analysten sind Energiemärkte und Dekarbonisierung, darüber hinaus informiert sich Rothenberg ständig über Trends, die die Märkte beeinflussen könnten. Das findet er spannend: “Das Thema CO₂ ist überall, ich muss sehr schnell verstehen, wo Energie gebraucht und verbraucht wird – und inwiefern das den Emissionshandel betrifft.”
Um diese Fragen zu beantworten, sammelt er unter anderem Daten zu Nachfrage und Angebot von Verschmutzungszertifikaten. Er untersucht, wie sich Preise bilden, warum sie sinken oder steigen. Seine Analysen hält er in mathematischen Modellen fest, diskutiert die Ergebnisse mit Kolleginnen und Kollegen und dann mit seinen Kunden.
Der Green Deal der EU ist zurzeit ein wichtiges Thema für ihn. “Die große Frage ist, zu welchem CO₂-Preis Europa Net-Zero erreichen kann“, sagt Florian Rothenberg. Dabei geht es nicht um einen konkreten Euro-Betrag, sondern um einen Preispfad. Denn der ist einer der wichtigsten Entscheidungsfaktoren für Industrieunternehmen, um in Klimaschutz zu investieren.
Klimaforscherinnen und Klimaforscher kritisieren, dass die Ziele der EU nicht weit genug gehen. “Das ist wahrscheinlich richtig, doch ambitioniertere Ziele hätten schon vor fünf bis zehn Jahren angestoßen werden müssen”, sagt Rothenberg. “Für die Wirtschaft ist es ein Riesenschritt, bis zum Jahr 2030 die EU-Emissionen um 55 Prozent zu senken, denn sie braucht unglaublich lange, um sich umzubauen.”
Sein eigener CO₂-Fußabdruck, gibt Rothenberg zu, ist “wahrscheinlich deutlich schlechter als der Weltdurchschnitt”. Denn er reist gerne und fliegt dafür auch mit dem Flugzeug. Immerhin nimmt er die Bahn, wenn er geschäftlich unterwegs ist, um Emissionen einzusparen. “Ich glaube, dass jeder einen kleinen Teil gegen den Klimawandel unternehmen kann und auch sollte.” Patricia Hoffhaus
