langsam bewegen sich die COP-Verhandler:innen in Richtung Abschlusserklärung, die britische COP26-Präsidentschaft hat einen ersten Entwurf vorgelegt. Es sei gut, “dass der Text durchweg den Geist von mehr Anstrengung im Klimaschutz atmet”, sagte der deutsche Chefverhandler Jochen Flasbarth. Doch Flasbarth übt auch Kritik, die allerdings milde ausfällt im Vergleich zu dem, was Umweltorganisationen zum Papier zu sagen haben. Es sei nicht mehr als eine Vereinbarung, “dass wir alle die Daumen drücken und das Beste hoffen”, heißt es von Greenpeace. Mehr zum Entwurf lesen Sie in der Analyse von Lukas Scheid.
Auch COP-Präsident Alok Sharma räumte ein, dass die bisherigen Klimazusagen der Länder nicht ausreichen, um die Pariser Klimaziele zu erreichen und forderte für die letzten beiden Verhandlungstage mehr Einsatz. Ebensolchen bewiesen am Mittwoch die beiden größten Treibhausgas-Emittenten. Die Vereinigten Staaten und China haben eine Vereinbarung über eine verstärkte Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des Klimawandels getroffen, die unter anderem die Verringerung der Methanemissionen, den Kohleausstieg und den Schutz der Wälder vorsieht.
Ein Erfolg für EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager, eine Niederlage für Google: Das EuG hat eine Klage des Konzerns gegen die Entscheidung im Fall Google Shopping abgewiesen. Wie Till Hoppe berichtet, könnte das den Anstoß geben für weitere Verfahren gegen den Konzern. Denn längst gibt es etliche Beschwerden, dass Google seine Dominanz bei der allgemeinen Suche für eigene Zwecke missbrauche.

In den Sphären von Weltklimakonferenzen werden wenige Stunden, die bis zu einer Entscheidung bleiben, meist als “noch viel Zeit” angesehen. Mehrere Tage sind dementsprechend eine halbe Ewigkeit. Dass die britische COP26-Präsidentschaft schon am Mittwoch einen ersten Entwurf für eine Abschlusserklärung des Glasgower Gipfels vorgelegt hat, wird daher als enorm früher Vorstoß wahrgenommen. BMU-Staatssekretär Jochen Flasbarth begrüßt diesen Schritt. Die Basis für die weiteren Verhandlungen der Minister sei dadurch konkreter.
In dem Entwurf wird ausdrücklich erwähnt, dass die Auswirkungen des Klimawandels bei einem Temperaturanstieg von 1,5 Grad im Vergleich zu 2 Grad deutlich niedriger wären und dass es noch in diesem Jahrzehnt “bedeutende und wirksame Maßnahmen aller Parteien” bedarf. In dem Papier wird anerkannt, dass zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziels eine Reduzierung der weltweiten Kohlendioxidemissionen um 45 Prozent bis 2030 gegenüber 2010 nötig ist.
Die Länder sollen ihre Klimaschutzziele (NDCs) bis 2030 schon Ende nächsten Jahres “überarbeiten und stärken”. Ursprünglich sollte dieses Update erst 2025 erfolgen. Zudem berücksichtigt der Text die Ergebnisse des sechsten Sachstandsberichtes des IPCC (Europe.Table berichtete). Eine solche Orientierung an wissenschaftlichen Daten ist laut Flasbarth eine Grundlage, die nicht immer unumstritten ist. Es sei gut, “dass der Text durchweg den Geist von mehr Anstrengung im Klimaschutz atmet.”
Der deutsche Chefverhandler auf der COP26 bemängelt jedoch, dass in dem Entwurf die Haupt-Emittenten – also die G20-Staaten, die die Emissionseinsparungen schlussendlich leisten müssen, nicht explizit in die Pflicht genommen werden. “Wir meinen, dass hier noch ein bisschen deutlicher werden muss, wer hier eigentlich handeln muss.” Gemeint sein dürfte damit vor allem China, ohne dass das Land namentlich genannt wird. China ist der weltweit größte Emittent, dessen bisheriges Klimaschutzziel auf der COP26 als deutlich zu wenig ambitioniert angesehen wird.
Was in dem Entwurf jedoch steht, ist die Aufforderung an die Länder, Subventionen für fossile Brennstoffe zu stoppen (Europe.Table berichtete). Ein festes Datum wird aber nicht genannt. Eine solche Formulierung stünde in direktem Widerspruch zu einer noch unveröffentlichten Liste der EU-Kommission, die am Mittwoch geleakt wurde. Auf der Liste der sogenannten “Projects of Common Interest” (PCI) stehen Projekte zur grenzüberschreitenden Infrastruktur, die in der Folge durch EU-Gelder gefördert werden können und schnellere Genehmigungsverfahren durchlaufen. Mit auf dieser noch unvollständigen Liste stehen auch mehrere Vorhaben zu fossilen Energieträgern wie Gas. Eine solche Formulierung in der Abschlusserklärung der COP26 hätte also auch Auswirkungen für die Förderpolitik der EU.
Aber zurück nach Glasgow: Neben dem Aus von Öl- und Gas-Subventionen steht in dem Entwurf auch die Aufforderung, den Ausstieg aus der Kohle zu beschleunigen – ebenfalls ohne Zieldatum. Für Umweltorganisationen geht der Entwurf deshalb nicht weit genug. Greenpeace äußerte Bedenken, dass Länder wie Saudi-Arabien, Russland und Brasilien darauf pochen könnten, die beiden Formulierungen zu fossilen Energieträgern aus der Abschlusserklärung der COP26 rauszunehmen. Die NGO bewertet das Papier bislang nicht als Plan zur Entschärfung der Klimakrise, sondern als eine Vereinbarung, “dass wir alle die Daumen drücken und das Beste hoffen.” Es sei eine “höfliche Bitte, dass die Staaten vielleicht, möglicherweise, im nächsten Jahr mehr tun”.
Umweltorganisationen und Aktivisten vermissen vor allem klarere Forderungen in dem Entwurf, die festhalten, dass Industriestaaten für Verluste und Schäden (“Loss and Damage”) von Entwicklungsländern infolge des Klimawandels aufkommen und mehr Geld für die Klimaschutzfinanzierung der am meisten vom Klimawandel betroffenen Länder bereitstellen.
Weiterhin völlig offen ist, ob das Regelwerk des Pariser Klimaabkommens in Glasgow finalisiert werden wird (Europe.Table berichtete). Dort gebe es noch viele “technische Schwierigkeiten”, die die britische Präsidentschaft aus dem Weg räumen müsse, sagt Flasbarth. Zwar halte er diese für lösbar, jedoch betonte er, dass es keinen “Trade-off” zwischen einer Einigung auf das Regelwerk und einer Einigung auf eine Abschlusserklärung geben dürfe. Beide müssten gleichermaßen ambitioniert sein.
Das Gericht der Europäischen Union (EuG) hat EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager einen großen Erfolg beschert und zugleich die Tür für weitere Missbrauchsverfahren gegen Google geöffnet. Die Luxemburger Richter wiesen eine Klage des US-Konzerns gegen die Entscheidung im Fall Google Shopping ab. Die Kommission hatte 2017 ein Bußgeld von 2,4 Milliarden Euro verhängt, weil das Unternehmen konkurrierende Preisvergleichsportale benachteiligt habe.
Die Richter folgten dabei in ihrem ersten Urteil zu den Wettbewerbsverfahren gegen das Unternehmen weitgehend der Argumentation der Kommission. Diese hatte die hervorgehobene Präsentation der Google-eigenen Produktsuche-Treffer als Missbrauch der Marktmacht gewertet. In seiner Reaktion verwies Google darauf, in Reaktion auf die Entscheidung habe man die Art der Darstellung bereits geändert.
Andere Preisvergleichsanbieter wie Foundem oder Kelkoo haben sich aber bei der Kommission beschwert, dass die Änderungen die Diskriminierung nicht beseitigten. Sie dürften durch das Urteil ermutigt werden. Das Urteil beseitige nicht den erheblichen Schaden, den Googles wettbewerbsschädliches Verhalten über mehr als ein Jahrzehnt verursacht habe, sagte Foundem-Mitgründer Shivaun Raff. Die Kommission hatte die Untersuchung bereits 2010 eingeleitet.
Google droht nach Einschätzung von Kartellrechtlern auch neues Ungemach. Etliche Konkurrenten haben sich bei der Kommission bereits beschwert, dass der Konzern seine Dominanz bei der allgemeinen Suche missbrauche, um in spezialisierte Märkte wie die Suche nach Reisen vorzudrängen. “Es ist gut möglich, dass die Kommission diese Beschwerden jetzt aufgreift und Google neue Bußgelder drohen“, sagt Silvio Cappellari, Partner bei der Kanzlei SZA Schilling, Zutt & Anschütz.
Die Generaldirektorin des Verbraucherverbandes BEUC, Monique Goyens, forderte die Kommission genau dazu auf: Die Behörde solle sicherstellen, dass Google “die Dominanz seiner Suchmaschine nicht ausnutzt, um sich Vorteile auf anderen Gebieten zu verschaffen”, sagte sie.
Cappellari rechnet daher damit, dass Google und der Mutterkonzern Alphabet in Berufung vor dem EuGH gehen werden. Zumal Google durch einen solchen Schritt auch mögliche Schadenersatzklagen der betroffenen Konkurrenten weiter hinausschieben könne. Das Unternehmen selbst will zunächst das Urteil prüfen.
Die Verteidigungsstrategie von Google vor dem Gericht der Europäischen Union beruhte insbesondere auf dem Argument, dass seine Suchmaschine als “wesentliche Einrichtung” (essential facility) hätte gewertet werden müssen, wie eine Schieneninfrastruktur etwa. “Dann hätte die Kommission nachweisen müssen, dass der Zugang zu dieser Infrastruktur unverzichtbar gewesen wäre – eine sehr hohe Hürde”, so Cappellari.
Das Gericht folgte dieser Argumentation aber nicht: Es sieht zwar deutliche Ähnlichkeit der Google-Suchplattform zu einer “wesentlichen Einrichtung”, wendet dann aber das allgemeine Diskriminierungsverbot an, gegen das Google verstoßen habe.
Das Urteil bestätigt indirekt auch die geplante Gesetzgebung zur Regulierung der großen Plattformen, insbesondere den Digital Marktes Act (DMA). Der Gesetzentwurf sieht ein Verbot des sogenannten Self-Preferencing für große Gatekeeper-Plattformen vor, wie es der EuG jetzt im Shopping-Fall für illegal gewertet hat.
Mit dem DMA werde die EU dafür sorgen, dass die Kommission in Zukunft früher eingreifen könne (Europe.Table berichtete), noch bevor solch enormer Schaden entstehe, sagte der zuständige Berichterstatter des Europaparlaments, Andreas Schwab (CDU/EVP). Die Prinzipien des fairen Wettbewerbs sollten für Unternehmen aus aller Welt gelten. Das heutige Urteil des Gerichts der EU beweise, dass die Europäische Union dazu in der Lage ist, diese Prinzipien durchzusetzen.
In Großbritannien konnte Google hingegen einen juristischen Erfolg erzielen: Dort stoppte das Oberste Gericht eine 3,75 Milliarden Euro schwere Sammelklage gegen den Konzern wegen Verstößen gegen den Datenschutz. Die Richter gaben Googles Beschwerde statt und dürften damit Verfahren gegen Unternehmen wie Facebook und Tiktok ebenfalls erschwert haben. Die Kläger werfen Google vor, sich zwischen 2011 und 2012 missbräuchlich Zugang zu den Daten von mehr als fünf Millionen iPhone-Besitzern verschafft zu haben, in dem Suchverläufe abgegriffen und für kommerzielle Zwecke genutzt wurden.
12.11.2021 – 09:00-16:00 Uhr, online
Konferenz Wasserstofftag 2021
Der Wasserstofftag 2021 unter dem Motto “Zero Emission” wird von der Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn, dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und dem Technologie-Transfer-Zentrum (TTZ) veranstaltet. Wissenschaftler:innen und Branchenvertreter:innen werden eingeladen, sich über aktuelle Entwicklungen und Trends zum Thema Wasserstoff auszutauschen. INFOS & ANMELDUNG
15.11.2021 – 09:00 Uhr, Brüssel/online
Conference Charting the European economy post Covid-19
Participants of the Annual Research Conference will get an update on the European economy after COVID-19. Speakers will discuss topics such as the unequal impact of the pandemic for citizens, firms and governments, the impact of the pandemic on value chains, and how the Recovery and Resilience Facility is helping the EU emerge stronger and more resilient from the COVID-19 pandemic. INFOS & REGISTRATION
15.11.2021 – 18:00-19:30 Uhr, online
Polis 180, Diskussion Gas conflicts in Europe’s neighborhood: Is Russia weaponizing its energy exports?
Bei dieser Polis-180-Veranstaltung können Teilnehmende mit Dionis Cenusa (Experte für Energiesicherheit in Osteuropa) die Dynamik der jüngsten Gaskonflikte mit Russland in europäischen Nachbarländern wie Moldawien und der Ukraine und ihre geopolitischen Auswirkungen diskutieren. INFOS & ANMELDUNG
15.11.2021 – 18:00-20:00 Uhr, online
HBS, Podiumsdiskussion Russland und der “Green Deal” der EU – Konfrontation oder Perspektive für Zusammenarbeit?
In der Reihe “Russische Alternativen” der Heinrich-Böll-Stiftung (HBS) werden Voraussetzungen und Zielstellungen für ein neues Kapitel der Energiebeziehungen zwischen der EU und Russland diskutiert. Bei dieser Veranstaltung steht die Frage im Mittelpunkt, ob Russland zum Produzenten und Exporteur sauberer Energie und klimaneutraler Produkte werden kann. INFOS & ANMELDUNG
15.11.2021 – 18:30-20:00 Uhr, online
DGAP, Podiumsdiskussion Fakten und Folgen der 26. UN-Klimakonferenz in Glasgow
Die Referent:innen der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) diskutieren, inwiefern die Maßnahmen zur Eindämmung der Klimakrise erfolgreich waren, in welchen Bereichen Fortschritte erzielt wurden und wie zukünftige Maßnahmen aussehen müssen. INFOS & ANMELDUNG
16.11.2021 – 09:00-11:35 Uhr, Athen/online
Eurogas, Conference Greece: The Energy Transition and the Role of Gas
Experts and speakers at the first Eurogas Regional Conference in Greece will address the key topics: The Regional Gas Market and A Clean Energy Transition. INFOS & REGISTRATION
16.11.2021 – 18:30-19:30 Uhr, online
Polis 180, Vortrag Digitale Souveränität
Bei dieser Veranstaltung von Polis 180, die begleitend zu einer Veröffentlichung stattfindet, diskutieren Autor:innen und Expert:innen unter der Frage “Digitale Souveränität – politisches Buzzword, akademische Mode oder die Zukunft der Digitalpolitik?”, wie Unabhängigkeit und Eigenständigkeit in der Digitalpolitik aussehen und gelingen kann. INFOS & ANMELDUNG
16.11.-18.11.2021, Barcelona/online
EIT, Conference Urban Mobility 2021 Summit & Tomorrow Mobility World Congress
The European Institute of Innovation & Technology (EIT) Urban Mobility Summit has been merged with the Tomorrow Mobility World Congress. Tomorrow Mobility is an event focusing on the development and deployment of new sustainable urban mobility models and aims to address mobility on a global scale. INFOS & REGISTRATION
Nach anfänglichem Zögern hat Deutschland am Mittwochabend doch noch eine gemeinsame Erklärung zu mehr Klimaschutz im Luftverkehr unterzeichnet. Das teilte das Bundesverkehrsministerium mit.
Zu den bislang 22 Unterstützern gehören auch die USA, Großbritannien, Frankreich, Kanada und die Türkei. Aufgrund des globalen Charakters des Sektors sei internationale Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der nach wie vor steigenden Emissionen von zentraler Bedeutung, heißt es in dem Dokument. Zumal über die kommenden 30 Jahre mit einer deutlichen Zunahme des Passagier- und Frachtaufkommens zu rechnen sei.
Die Allianz verpflichtet sich deshalb, spezifische Maßnahmen zur Verringerung der Luftverkehrsemissionen zu unterstützen, darunter nachhaltige Flugkraftstoffe, das globale CORSIA-Kompensationsprogramm und neue Flugzeugtechnologien.
Daneben gehört Deutschland zu den über 20 Unterzeichnern einer Vereinbarung zur Einrichtung sogenannter grüner Schiffskorridore. Bis zur Mitte des Jahrzehnts sollen zwischen zwei oder mehr Häfen mindestens sechs emissionsfreie Seeverkehrsrouten eingerichtet werden. Bis 2030 sollen “viele weitere grüne Korridore” hinzukommen, heißt es in der Erklärung.
Bei einem Abkommen zum globalen Aus für Verbrennungsmotoren ab dem Jahr 2040 gehört Deutschland hingegen nicht zu den Unterstützern (Europe.Table berichtete). Zwar bestehe innerhalb der Bundesregierung Konsens, dass bis 2035 nur noch klimaneutrale Fahrzeuge zugelassen werden sollen. “Allerdings besteht nach wie vor keine Einigkeit zu einem Randaspekt der Erklärung, nämlich der Frage, ob aus erneuerbaren Energien gewonnene E-Fuels Teil der Lösung sein können”, teilte ein BMU-Sprecher am Mittwoch mit.
Widerstand komme insbesondere aus dem CSU-geführten Verkehrsministerium. Das BMU jedenfalls halte E-Fuels mit Blick auf Verfügbarkeit und Effizienz genau wie die Unterzeichnerstaaten nicht für zielführend. til
Der geplante CO2-Grenzausgleich (CBAM) der Europäischen Union sorgt weltweit für Verunsicherung und beschäftigt die EU-Delegation auf der Klimakonferenz (COP26) in Glasgow. Es sei jedoch ein positives Signal, dass der Emissionshandel nebst CBAM überhaupt ein Thema sei, sagt Peter Liese, Co-Verhandlungsführer des EU-Parlaments, zu Europe.Table. Denn bereits die Diskussion um den geplanten Grenzausgleich habe erste Effekte gezeigt – darunter die Ratifizierung des Pariser Klimaabkommens durch die Türkei. Der CDU-Europaabgeordnete räumt aber ein: “Das Instrument ist noch nicht perfekt.”
Eine der zentralen Forderung auf der COP26: Die Einnahmen aus dem CBAM sollten nicht ausschließlich der EU zugutekommen, sondern auch in die Klimafinanzierung fließen, um insbesondere Entwicklungsländer bei der Dekarbonisierung zu unterstützen. Liese unterstützt den Vorstoß. Dass ein solcher Mechanismus im Vorschlag der Kommission nicht vorgesehen ist, sei ein Fehler, sagt er und kündigt an: Entsprechende Änderungsanträge durch das EU-Parlament seien wahrscheinlich.
Die französische Regierung hingegen hatte zuletzt angekündigt, die Einnahmen als Eigenmittel der EU behandeln zu wollen (Europe.Table berichtete). Das Land will den CBAM zur Priorität seiner Ratspräsidentschaft machen und in der ersten Jahreshälfte 2022 energisch vorantreiben.
Der Grenzausgleichsmechanismus soll schrittweise die Zuteilung kostenfreier CO2-Zertifikate an die Industrie ersetzen und für die ersten Sektoren ab 2026 vollständig in Kraft treten. Ziel ist der Schutz vor Carbon Leakage. til
Die Europäische Union sollte nach der COVID-19-Pandemie eine echte Reform ihrer Haushaltsregeln anstreben und nicht nur kleine Korrekturen am bestehenden Rahmen vornehmen, so der Europäische Fiskalausschuss (EFB) in seinem Jahresbericht vom Mittwoch.
Der EFB ist ein Beratungsgremium der Europäischen Kommission, die im nächsten Jahr ihre Vorschläge zur Reform der EU-Haushaltsregeln ausarbeiten wird. Die 1997 eingeführten Regeln wurden ausgesetzt, um die COVID-19-Pandemie zu bekämpfen. Sie müssen aus Sicht der Kommission jedoch geändert werden, weil durch die Pandemie die öffentliche Verschuldung in ganz Europa stark angestiegen ist und die meisten Länder nicht in der Lage sind, die Schulden in dem jetzt erforderlichen Tempo abzubauen.
Die Regeln sehen auch keine Sonderbehandlung für Investitionen vor, obwohl der Kampf der EU gegen den Klimawandel nach Angaben der Kommission in den nächsten zehn Jahren jährlich 650 Milliarden Euro an Investitionen erfordern wird. “Der EFB ist davon überzeugt, dass eine echte Reform des fiskalischen Rahmens besser ist als eine mögliche Alternative mit diskretionären und schwer vorhersehbaren Änderungen bei der Umsetzung des bestehenden Regelwerks”, heißt es in dem Bericht.
Das Regelwerk sieht derzeit eine Begrenzung des öffentlichen Defizits auf 3 Prozent des BIP und eine Begrenzung der öffentlichen Verschuldung auf 60 Prozent des BIP vor. Liegt die Verschuldung höher, wie es in den meisten EU-Ländern der Fall ist, muss sie jedes Jahr um ein Zwanzigstel des Überschusses über 60 Prozent gesenkt werden – ein zu ehrgeiziges Ziel für die meisten.
“Unser Vorschlag dreht sich um ein Hauptziel: eine nachhaltige Schuldendynamik; ein Hauptinstrument: eine Ausgaben-Benchmark; und eine Ausweichklausel, die auf der Grundlage einer unabhängigen Wirtschaftsanalyse geltend gemacht werden kann”, so der EFB.
Die Reform der Regeln sollte die Defizitgrenze von 3 Prozent beibehalten, aber die Rolle der Ausgaben-Benchmark betonen – eine Regel, die besagt, dass eine Regierung mehr ausgeben darf, wenn das Wirtschaftswachstum unter dem Potenzial liegt, und weniger, wenn es darüber liegt. Das Tempo des Schuldenabbaus sollte am besten auf die Gegebenheiten in den einzelnen Ländern abgestimmt werden, anstatt eine pauschale Regel für alle festzulegen, so der EFB.
Um dem Investitionsbedarf Rechnung zu tragen, schlug der EFB die Schaffung eines Budgets vor, das als zentrale Fiskalkapazität bezeichnet wird, um öffentliche Investitionen zu stabilisieren, zu schützen und zu fördern, anstatt sie, wie von einigen vorgeschlagen, von der Defizitberechnung auszunehmen.
Schließlich sollten die Regeln eine Ausweichklausel für außergewöhnliche Schocks enthalten, wenn die Regeln ausgesetzt werden müssen. rtr
Die EU-Regierungen haben am Mittwoch Einigkeit über “robuste” Maßnahmen gegenüber Großbritannien verabredet, wenn die Regierung in London den Streit über die Umsetzung der Brexit-Vereinbarungen eskalieren lassen sollte. Des bestätigten EU-Diplomaten am Mittwoch in Brüssel.
Großbritannien und die Europäische Kommission verhandeln seit einem Monat über Handelsvereinbarungen für Nordirland, die Kontrollen bei der Einfuhr von Waren aus Großbritannien vorsehen. Die Kontrollen sind notwendig, um die Einführung einer harten Grenze zwischen der britischen Provinz und dem EU-Mitglied Irland zu vermeiden. Die britische Regierung will von der eingegangenen Verpflichtung aber wieder abrücken.
Der Vizepräsident der Europäischen Kommission, Maroš Šefčovič, informierte am Mittwoch die EU-Botschafter in Brüssel und teilte ihnen nach Angaben von EU-Diplomaten mit, dass die Gespräche mit Großbritannien nicht gut liefen, aber fortgesetzt werden sollten. Der britische Brexit-Minister David Frost sagte daraufhin, Brüssel solle Ruhe bewahren und keine “massiven und unverhältnismäßigen Vergeltungsmaßnahmen” ergreifen, wenn London seine Drohung wahrmache, einen Handelsstreit nach dem Brexit zu eskalieren.
Premierminister Boris Johnson hatte im Rahmen des Brexit-Abkommens im Jahr 2020 das sogenannte Nordirland-Protokoll unterzeichnet. Seither argumentiert er jedoch, dass es in Eile vereinbart worden sei und Nachbesserungen notwendig seien. Die EU und auch die Bundesregierung lehnen eine Neuverhandlung ab. Die EU-Kommission hatte aber angeboten, dass die EU die Zollvorschriften und Kontrollen des Güterverkehrs zwischen dem britischen Kernland und Nordirland abspeckt.
Die britischen Clearinghäuser dürfen weiterhin Handelsgeschäfte für Kunden in der Europäischen Union abwickeln. Die EU werde die bis Juni 2022 geltende Ausnahmeerlaubnis verlängern, sagte EU-Kommissarin Mairead McGuinness am Mittwoch. Die Finanzinstitute in Kontinentaleuropa bräuchten mehr Zeit, um mehr Kapazitäten für Wertpapierabwicklung aufzubauen. Wie lange die Frist verlängert werden soll, sagte sie nicht. rtr
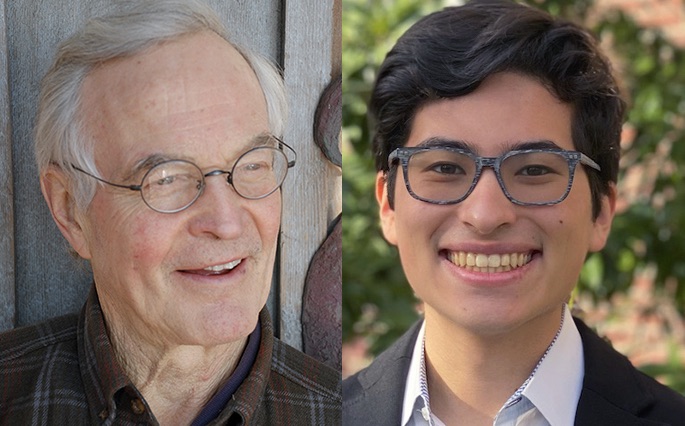
Diesen Sommer veröffentlichte der Weltklimarat (IPCC) seinen neuesten Bericht, und das Erschreckendste daran ist, wie wenig überraschend dessen Inhalt war. Das Schlimmste zu verhindern, so der Bericht, ist immer noch möglich, aber nur, wenn die Menschheit so schnell wie möglich zu einer kohlenstoffneutralen Wirtschaft übergeht. “Dieser Bericht”, so der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, “muss der Kohle und den fossilen Brennstoffen den Todesstoß versetzen, bevor sie unseren Planeten zerstören.”
Doch während der Planet in Flammen steht, schüren die Finanzinstitute das Feuer. Viele der mächtigsten Finanzakteure der Welt investieren weiterhin in die fossile Brennstoffindustrie, selbst wenn deren Handlungen vorhersehbar zu massiven wirtschaftlichen Störungen, ökologischen Katastrophen und sozialer Ungerechtigkeit führen. Bis jetzt sind sie damit davongekommen. Doch ein neuer Trend in der Gesetzgebung zwingt institutionelle Investoren dazu, ihre Portfolios zu dekarbonisieren – oder sie werden rechtlich zur Verantwortung gezogen.
Die Harvard-Universität ist ein typisches Beispiel dafür. Ein Jahrzehnt lang hat die Harvard-Leitung die Forderungen von Studenten, Dozenten und Ehemaligen ignoriert, das 53 Milliarden Dollar schwere Stiftungsvermögen der Universität aus der fossilen Brennstoffindustrie abzuziehen. In Anerkennung der wissenschaftlichen und finanziellen Realität verpflichtete sich die Universität im September schließlich dazu, sich von Unternehmen zu trennen, deren Geschäftsmodelle, die auf einer anhaltenden Kohlenstoffgewinnung beruhen, mit einer lebenswerten Zukunft unvereinbar sind.
“Angesichts der Notwendigkeit, die Wirtschaft zu dekarbonisieren, und unserer Verantwortung als Treuhänder, langfristige Investitionsentscheidungen zu treffen, die unseren Lehr- und Forschungsauftrag unterstützen”, schrieb Universitätspräsident Larry Bacow, “glauben wir nicht, dass solche Investitionen besonnen sind.”
Der Begriff “Prudence” (Vernunft, Besonnenheit) ist in der Satzung, die die Harvard-Stiftung und viele andere institutionelle Fonds regelt, ein grundlegendes Rechtskonzept, das die Sorgfalt, Geschicklichkeit und Vorsicht festlegt, mit der die Investitionen eines Fonds verwaltet werden müssen. Besonnenheit ist die Richtschnur dafür, wie ein Fonds verwaltet werden muss, um den Interessen der Begünstigten zu dienen, und es gibt erhebliche Strafen wenn dagegen verstoßen wird. Die Erklärung der Harvard-Universität räumt ein, dass es unmöglich ist, eine solche Pflicht einzuhalten und gleichzeitig in fossile Brennstoffe zu investieren.
Es gibt viele Gründe, warum dies der Fall sein könnte. Zunächst einmal sind die Unternehmen der fossilen Energiewirtschaft mit existenzieller Unsicherheit konfrontiert. Eine Flut von Marktverschiebungen, Regulierungen und Rechtsstreitigkeiten birgt grundlegende Risiken für die Interessen der Branche, während viele der CO2-Aktiva, aus denen sie ihren Wert ableitet, unverkäuflich gemacht und stranden werden, um die internationalen Klimaziele zu erreichen. Darüber hinaus widerspricht der Gedanke, von Unternehmen zu profitieren, deren Abhängigkeit von CO2-Emissionen den Klimawandel beschleunigt, den Vorstellungen vom öffentlichen Zweck und der sozialen Pflicht, die verantwortungsbewusste Investoren zu wahren vorgeben. Allein das wäre Grund genug, eine umfassende Dekarbonisierung anzustreben.
Mit anderen Worten: Das Geschäftsmodell der Industrie für fossile Brennstoffe ist inzwischen so sehr von der wissenschaftlichen und finanziellen Realität abgewichen, dass es nicht nur falsch ist, auf diese Unternehmen zu setzen (oder, allgemeiner gesagt, auf die Art von Unternehmen, die wesentlich von CO2-Emissionen abhängen). Von Rechts wegen ist es fahrlässig falsch. Darüber hinaus gilt das Konzept der Besonnenheit in ähnlicher Form für jeden Anleger, der dem Treuhandstandard unterliegt, und ist somit im Wesentlichen für jede akademische Stiftung, jeden Wohltätigkeitsfonds und jeden öffentlichen und privaten Pensionsfonds verbindlich. Das bedeutet, dass Billionen von Dollar von Harvards jüngstem Präzedenzfall betroffen sein könnten.
Tatsächlich gibt es bereits Auswirkungen der Harvard-Entscheidung. In den Wochen seit der Ankündigung haben eine Reihe anderer einflussreicher Investoren – von den Stiftungen der Boston University, der University of Minnesota und der MacArthur Foundation bis hin zum öffentlichen Pensionsfonds ABP in den Niederlanden (dem größten Europas) – ebenfalls gehandelt, um ihr Geld mit den Forderungen nach Besonnenheit und Klimaschutz in Einklang zu bringen. Damit schließen sie sich Anlegern mit einem Vermögen von über 39 Billionen Dollar an, von denen viele, wie die Märkte zeigen, bereits finanzielle Gewinne aus dem Ausstieg aus Aktien fossiler Brennstoffe erzielen.
Indem er die Entscheidung von Harvard auf Besonnenheit gründete, wollte Larry Bacow vielleicht die weitreichende Wirkung erzielen, die der Verzicht der Universität auf fossile Brennstoffe zweifelsohne haben wird. Vielleicht war es aber auch ein rechtzeitiger Verteidigungszug. Als Bacow die Entscheidung bekannt gab, wog der Generalstaatsanwalt von Massachusetts ab, ob er auf eine Klage reagieren sollte, die von Studenten und anderen Mitgliedern der Harvard-Gemeinschaft zusammen mit dem gemeinnützigen Climate Defense Project eingereicht worden war. Darin wurde behauptet, dass die Investitionen der Universität in fossile Brennstoffe einen Verstoß gegen ihre karitativen Verpflichtungen darstellten.
Was auch immer der Grund sein mag – Harvard hat einer Doktrin eine Stimme gegeben, die sich angesichts der Dringlichkeit der Klimakrise schnell in der ganzen Welt verbreiten und ähnliche Entscheidungen von Treuhändern überall beschleunigen sollte. Ein Jahrzehnt des Kampfes war nötig, um Harvard so weit zu bringen. Da die Universität nun endlich Schritte unternimmt, um ihren weltweiten Ruf als Vorreiterin gerecht zu werden, müssen andere institutionelle Anleger davon Notiz nehmen. Im Zeitalter der Klimakrise ist es die Aufgabe dieser Akteure, sich für die Zukunft einzusetzen. Sonst riskieren sie, nicht nur auf der falschen Seite der Geschichte, sondern auch auf der falschen Seite des Gesetzes zu landen.
In Zusammenarbeit mit Project Syndicate, Übersetzung: Andreas Hubig
Haben Sie es gemerkt? Wir befinden uns nun in der siebten Woche nach der Bundestagswahl. Seitdem haben SPD, Grüne und FDP erst vorsondiert. Dann sondiert. Und dann Koalitionsverhandlungen aufgenommen.
Allein: Man weiß fast nichts. Weil die drei Parteien ihre Unterhändler zu absolutem Stillschweigen verdonnert haben. Wenn überhaupt einmal jemand etwas öffentlich zu den Gesprächen sagt, dann die Chefetage.
Einerseits demokratisch bedenklich. Denn natürlich müssen die Vorhaben einer solchen Regierung auch gesamtgesellschaftlich, in den beteiligten Parteien und durch die künftige Opposition intensiv diskutiert werden. Das ist eine Grundregel des demokratischen Diskurses, und hierfür wird die Zeit nach ursprünglichem Plan langsam knapp.
Andererseits scheint niemand so richtig traurig darüber zu sein. Die derzeit desorientierten Unionsparteien. Die mit sich selbst beschäftigten Linken. Und die AfD, die sich eh stärker für die Geschehnisse an der russisch-polnischen Grenze als für nervigen Kleinkram wie Koalitionsverträge zu interessieren scheint.
Aber selbst viele Berichterstatter, eigentlich professionell neugierig, sind nicht unglücklich. Sie können sich das Herumlungern auf den Fluren im Paul-Löbe-Haus, bei den politischen Stiftungen und den Landesvertretungen sparen. Kürzlich traf ich gar welche, die sehr dankbar waren, dass ihre Redaktionen nicht dauernd aufgeregt wegen Twitter-Halbsätzen einschlägiger Liveberichterstatter anriefen und dazu “schnell eine ausgeruhte, tiefgründige Analyse in 1500 Zeichen” haben wollten.
Aber ein bisschen erschrocken waren auch sie. So viele Verhandlerinnen und Verhandler – und kaum einer traut sich, wirklich etwas zu den Inhalten zu sagen. Geschweige denn, irgendein Papier durchzustechen. Gilt hier etwa die alte Haushaltsausschussregel? Die besagt: Wenn einer vor Beschluss über sein Anliegen öffentliche Äußerungen tätigt, wird genau dieses Projekt einvernehmlich gestrichen. Oder müssen Übeltäter gar für den Unionsvorsitz kandidieren?
Oder spielen die Herrschaften in Wahrheit seit ein paar Tagen Gesellschaftsspiele und schauen belustigt auf das doch noch vorhandene Interesse vor den Türen? Oder wartet man mit öffentlichen Äußerungen, bis die sichtbaren Blessuren abgeklungen sind?
Man darf gespannt bleiben.
Die Grünen jedenfalls haben ihre Mitglieder nun aufgefordert, ihre Adressdaten zu prüfen. Damit ihnen die Abstimmungsunterlagen für den Koalitionsvertrag auch zugehen können. Man könnte das jetzt als Zeichen von Optimismus interpretieren. Aber nur in rot-grün-gelben Eckenklammern, Type Calibri, Schriftgröße 11. Also den Formatvorgaben, über die derzeit fast als einziges wirklich zu berichten ist. Falk Steiner
langsam bewegen sich die COP-Verhandler:innen in Richtung Abschlusserklärung, die britische COP26-Präsidentschaft hat einen ersten Entwurf vorgelegt. Es sei gut, “dass der Text durchweg den Geist von mehr Anstrengung im Klimaschutz atmet”, sagte der deutsche Chefverhandler Jochen Flasbarth. Doch Flasbarth übt auch Kritik, die allerdings milde ausfällt im Vergleich zu dem, was Umweltorganisationen zum Papier zu sagen haben. Es sei nicht mehr als eine Vereinbarung, “dass wir alle die Daumen drücken und das Beste hoffen”, heißt es von Greenpeace. Mehr zum Entwurf lesen Sie in der Analyse von Lukas Scheid.
Auch COP-Präsident Alok Sharma räumte ein, dass die bisherigen Klimazusagen der Länder nicht ausreichen, um die Pariser Klimaziele zu erreichen und forderte für die letzten beiden Verhandlungstage mehr Einsatz. Ebensolchen bewiesen am Mittwoch die beiden größten Treibhausgas-Emittenten. Die Vereinigten Staaten und China haben eine Vereinbarung über eine verstärkte Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des Klimawandels getroffen, die unter anderem die Verringerung der Methanemissionen, den Kohleausstieg und den Schutz der Wälder vorsieht.
Ein Erfolg für EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager, eine Niederlage für Google: Das EuG hat eine Klage des Konzerns gegen die Entscheidung im Fall Google Shopping abgewiesen. Wie Till Hoppe berichtet, könnte das den Anstoß geben für weitere Verfahren gegen den Konzern. Denn längst gibt es etliche Beschwerden, dass Google seine Dominanz bei der allgemeinen Suche für eigene Zwecke missbrauche.

In den Sphären von Weltklimakonferenzen werden wenige Stunden, die bis zu einer Entscheidung bleiben, meist als “noch viel Zeit” angesehen. Mehrere Tage sind dementsprechend eine halbe Ewigkeit. Dass die britische COP26-Präsidentschaft schon am Mittwoch einen ersten Entwurf für eine Abschlusserklärung des Glasgower Gipfels vorgelegt hat, wird daher als enorm früher Vorstoß wahrgenommen. BMU-Staatssekretär Jochen Flasbarth begrüßt diesen Schritt. Die Basis für die weiteren Verhandlungen der Minister sei dadurch konkreter.
In dem Entwurf wird ausdrücklich erwähnt, dass die Auswirkungen des Klimawandels bei einem Temperaturanstieg von 1,5 Grad im Vergleich zu 2 Grad deutlich niedriger wären und dass es noch in diesem Jahrzehnt “bedeutende und wirksame Maßnahmen aller Parteien” bedarf. In dem Papier wird anerkannt, dass zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziels eine Reduzierung der weltweiten Kohlendioxidemissionen um 45 Prozent bis 2030 gegenüber 2010 nötig ist.
Die Länder sollen ihre Klimaschutzziele (NDCs) bis 2030 schon Ende nächsten Jahres “überarbeiten und stärken”. Ursprünglich sollte dieses Update erst 2025 erfolgen. Zudem berücksichtigt der Text die Ergebnisse des sechsten Sachstandsberichtes des IPCC (Europe.Table berichtete). Eine solche Orientierung an wissenschaftlichen Daten ist laut Flasbarth eine Grundlage, die nicht immer unumstritten ist. Es sei gut, “dass der Text durchweg den Geist von mehr Anstrengung im Klimaschutz atmet.”
Der deutsche Chefverhandler auf der COP26 bemängelt jedoch, dass in dem Entwurf die Haupt-Emittenten – also die G20-Staaten, die die Emissionseinsparungen schlussendlich leisten müssen, nicht explizit in die Pflicht genommen werden. “Wir meinen, dass hier noch ein bisschen deutlicher werden muss, wer hier eigentlich handeln muss.” Gemeint sein dürfte damit vor allem China, ohne dass das Land namentlich genannt wird. China ist der weltweit größte Emittent, dessen bisheriges Klimaschutzziel auf der COP26 als deutlich zu wenig ambitioniert angesehen wird.
Was in dem Entwurf jedoch steht, ist die Aufforderung an die Länder, Subventionen für fossile Brennstoffe zu stoppen (Europe.Table berichtete). Ein festes Datum wird aber nicht genannt. Eine solche Formulierung stünde in direktem Widerspruch zu einer noch unveröffentlichten Liste der EU-Kommission, die am Mittwoch geleakt wurde. Auf der Liste der sogenannten “Projects of Common Interest” (PCI) stehen Projekte zur grenzüberschreitenden Infrastruktur, die in der Folge durch EU-Gelder gefördert werden können und schnellere Genehmigungsverfahren durchlaufen. Mit auf dieser noch unvollständigen Liste stehen auch mehrere Vorhaben zu fossilen Energieträgern wie Gas. Eine solche Formulierung in der Abschlusserklärung der COP26 hätte also auch Auswirkungen für die Förderpolitik der EU.
Aber zurück nach Glasgow: Neben dem Aus von Öl- und Gas-Subventionen steht in dem Entwurf auch die Aufforderung, den Ausstieg aus der Kohle zu beschleunigen – ebenfalls ohne Zieldatum. Für Umweltorganisationen geht der Entwurf deshalb nicht weit genug. Greenpeace äußerte Bedenken, dass Länder wie Saudi-Arabien, Russland und Brasilien darauf pochen könnten, die beiden Formulierungen zu fossilen Energieträgern aus der Abschlusserklärung der COP26 rauszunehmen. Die NGO bewertet das Papier bislang nicht als Plan zur Entschärfung der Klimakrise, sondern als eine Vereinbarung, “dass wir alle die Daumen drücken und das Beste hoffen.” Es sei eine “höfliche Bitte, dass die Staaten vielleicht, möglicherweise, im nächsten Jahr mehr tun”.
Umweltorganisationen und Aktivisten vermissen vor allem klarere Forderungen in dem Entwurf, die festhalten, dass Industriestaaten für Verluste und Schäden (“Loss and Damage”) von Entwicklungsländern infolge des Klimawandels aufkommen und mehr Geld für die Klimaschutzfinanzierung der am meisten vom Klimawandel betroffenen Länder bereitstellen.
Weiterhin völlig offen ist, ob das Regelwerk des Pariser Klimaabkommens in Glasgow finalisiert werden wird (Europe.Table berichtete). Dort gebe es noch viele “technische Schwierigkeiten”, die die britische Präsidentschaft aus dem Weg räumen müsse, sagt Flasbarth. Zwar halte er diese für lösbar, jedoch betonte er, dass es keinen “Trade-off” zwischen einer Einigung auf das Regelwerk und einer Einigung auf eine Abschlusserklärung geben dürfe. Beide müssten gleichermaßen ambitioniert sein.
Das Gericht der Europäischen Union (EuG) hat EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager einen großen Erfolg beschert und zugleich die Tür für weitere Missbrauchsverfahren gegen Google geöffnet. Die Luxemburger Richter wiesen eine Klage des US-Konzerns gegen die Entscheidung im Fall Google Shopping ab. Die Kommission hatte 2017 ein Bußgeld von 2,4 Milliarden Euro verhängt, weil das Unternehmen konkurrierende Preisvergleichsportale benachteiligt habe.
Die Richter folgten dabei in ihrem ersten Urteil zu den Wettbewerbsverfahren gegen das Unternehmen weitgehend der Argumentation der Kommission. Diese hatte die hervorgehobene Präsentation der Google-eigenen Produktsuche-Treffer als Missbrauch der Marktmacht gewertet. In seiner Reaktion verwies Google darauf, in Reaktion auf die Entscheidung habe man die Art der Darstellung bereits geändert.
Andere Preisvergleichsanbieter wie Foundem oder Kelkoo haben sich aber bei der Kommission beschwert, dass die Änderungen die Diskriminierung nicht beseitigten. Sie dürften durch das Urteil ermutigt werden. Das Urteil beseitige nicht den erheblichen Schaden, den Googles wettbewerbsschädliches Verhalten über mehr als ein Jahrzehnt verursacht habe, sagte Foundem-Mitgründer Shivaun Raff. Die Kommission hatte die Untersuchung bereits 2010 eingeleitet.
Google droht nach Einschätzung von Kartellrechtlern auch neues Ungemach. Etliche Konkurrenten haben sich bei der Kommission bereits beschwert, dass der Konzern seine Dominanz bei der allgemeinen Suche missbrauche, um in spezialisierte Märkte wie die Suche nach Reisen vorzudrängen. “Es ist gut möglich, dass die Kommission diese Beschwerden jetzt aufgreift und Google neue Bußgelder drohen“, sagt Silvio Cappellari, Partner bei der Kanzlei SZA Schilling, Zutt & Anschütz.
Die Generaldirektorin des Verbraucherverbandes BEUC, Monique Goyens, forderte die Kommission genau dazu auf: Die Behörde solle sicherstellen, dass Google “die Dominanz seiner Suchmaschine nicht ausnutzt, um sich Vorteile auf anderen Gebieten zu verschaffen”, sagte sie.
Cappellari rechnet daher damit, dass Google und der Mutterkonzern Alphabet in Berufung vor dem EuGH gehen werden. Zumal Google durch einen solchen Schritt auch mögliche Schadenersatzklagen der betroffenen Konkurrenten weiter hinausschieben könne. Das Unternehmen selbst will zunächst das Urteil prüfen.
Die Verteidigungsstrategie von Google vor dem Gericht der Europäischen Union beruhte insbesondere auf dem Argument, dass seine Suchmaschine als “wesentliche Einrichtung” (essential facility) hätte gewertet werden müssen, wie eine Schieneninfrastruktur etwa. “Dann hätte die Kommission nachweisen müssen, dass der Zugang zu dieser Infrastruktur unverzichtbar gewesen wäre – eine sehr hohe Hürde”, so Cappellari.
Das Gericht folgte dieser Argumentation aber nicht: Es sieht zwar deutliche Ähnlichkeit der Google-Suchplattform zu einer “wesentlichen Einrichtung”, wendet dann aber das allgemeine Diskriminierungsverbot an, gegen das Google verstoßen habe.
Das Urteil bestätigt indirekt auch die geplante Gesetzgebung zur Regulierung der großen Plattformen, insbesondere den Digital Marktes Act (DMA). Der Gesetzentwurf sieht ein Verbot des sogenannten Self-Preferencing für große Gatekeeper-Plattformen vor, wie es der EuG jetzt im Shopping-Fall für illegal gewertet hat.
Mit dem DMA werde die EU dafür sorgen, dass die Kommission in Zukunft früher eingreifen könne (Europe.Table berichtete), noch bevor solch enormer Schaden entstehe, sagte der zuständige Berichterstatter des Europaparlaments, Andreas Schwab (CDU/EVP). Die Prinzipien des fairen Wettbewerbs sollten für Unternehmen aus aller Welt gelten. Das heutige Urteil des Gerichts der EU beweise, dass die Europäische Union dazu in der Lage ist, diese Prinzipien durchzusetzen.
In Großbritannien konnte Google hingegen einen juristischen Erfolg erzielen: Dort stoppte das Oberste Gericht eine 3,75 Milliarden Euro schwere Sammelklage gegen den Konzern wegen Verstößen gegen den Datenschutz. Die Richter gaben Googles Beschwerde statt und dürften damit Verfahren gegen Unternehmen wie Facebook und Tiktok ebenfalls erschwert haben. Die Kläger werfen Google vor, sich zwischen 2011 und 2012 missbräuchlich Zugang zu den Daten von mehr als fünf Millionen iPhone-Besitzern verschafft zu haben, in dem Suchverläufe abgegriffen und für kommerzielle Zwecke genutzt wurden.
12.11.2021 – 09:00-16:00 Uhr, online
Konferenz Wasserstofftag 2021
Der Wasserstofftag 2021 unter dem Motto “Zero Emission” wird von der Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn, dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und dem Technologie-Transfer-Zentrum (TTZ) veranstaltet. Wissenschaftler:innen und Branchenvertreter:innen werden eingeladen, sich über aktuelle Entwicklungen und Trends zum Thema Wasserstoff auszutauschen. INFOS & ANMELDUNG
15.11.2021 – 09:00 Uhr, Brüssel/online
Conference Charting the European economy post Covid-19
Participants of the Annual Research Conference will get an update on the European economy after COVID-19. Speakers will discuss topics such as the unequal impact of the pandemic for citizens, firms and governments, the impact of the pandemic on value chains, and how the Recovery and Resilience Facility is helping the EU emerge stronger and more resilient from the COVID-19 pandemic. INFOS & REGISTRATION
15.11.2021 – 18:00-19:30 Uhr, online
Polis 180, Diskussion Gas conflicts in Europe’s neighborhood: Is Russia weaponizing its energy exports?
Bei dieser Polis-180-Veranstaltung können Teilnehmende mit Dionis Cenusa (Experte für Energiesicherheit in Osteuropa) die Dynamik der jüngsten Gaskonflikte mit Russland in europäischen Nachbarländern wie Moldawien und der Ukraine und ihre geopolitischen Auswirkungen diskutieren. INFOS & ANMELDUNG
15.11.2021 – 18:00-20:00 Uhr, online
HBS, Podiumsdiskussion Russland und der “Green Deal” der EU – Konfrontation oder Perspektive für Zusammenarbeit?
In der Reihe “Russische Alternativen” der Heinrich-Böll-Stiftung (HBS) werden Voraussetzungen und Zielstellungen für ein neues Kapitel der Energiebeziehungen zwischen der EU und Russland diskutiert. Bei dieser Veranstaltung steht die Frage im Mittelpunkt, ob Russland zum Produzenten und Exporteur sauberer Energie und klimaneutraler Produkte werden kann. INFOS & ANMELDUNG
15.11.2021 – 18:30-20:00 Uhr, online
DGAP, Podiumsdiskussion Fakten und Folgen der 26. UN-Klimakonferenz in Glasgow
Die Referent:innen der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) diskutieren, inwiefern die Maßnahmen zur Eindämmung der Klimakrise erfolgreich waren, in welchen Bereichen Fortschritte erzielt wurden und wie zukünftige Maßnahmen aussehen müssen. INFOS & ANMELDUNG
16.11.2021 – 09:00-11:35 Uhr, Athen/online
Eurogas, Conference Greece: The Energy Transition and the Role of Gas
Experts and speakers at the first Eurogas Regional Conference in Greece will address the key topics: The Regional Gas Market and A Clean Energy Transition. INFOS & REGISTRATION
16.11.2021 – 18:30-19:30 Uhr, online
Polis 180, Vortrag Digitale Souveränität
Bei dieser Veranstaltung von Polis 180, die begleitend zu einer Veröffentlichung stattfindet, diskutieren Autor:innen und Expert:innen unter der Frage “Digitale Souveränität – politisches Buzzword, akademische Mode oder die Zukunft der Digitalpolitik?”, wie Unabhängigkeit und Eigenständigkeit in der Digitalpolitik aussehen und gelingen kann. INFOS & ANMELDUNG
16.11.-18.11.2021, Barcelona/online
EIT, Conference Urban Mobility 2021 Summit & Tomorrow Mobility World Congress
The European Institute of Innovation & Technology (EIT) Urban Mobility Summit has been merged with the Tomorrow Mobility World Congress. Tomorrow Mobility is an event focusing on the development and deployment of new sustainable urban mobility models and aims to address mobility on a global scale. INFOS & REGISTRATION
Nach anfänglichem Zögern hat Deutschland am Mittwochabend doch noch eine gemeinsame Erklärung zu mehr Klimaschutz im Luftverkehr unterzeichnet. Das teilte das Bundesverkehrsministerium mit.
Zu den bislang 22 Unterstützern gehören auch die USA, Großbritannien, Frankreich, Kanada und die Türkei. Aufgrund des globalen Charakters des Sektors sei internationale Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der nach wie vor steigenden Emissionen von zentraler Bedeutung, heißt es in dem Dokument. Zumal über die kommenden 30 Jahre mit einer deutlichen Zunahme des Passagier- und Frachtaufkommens zu rechnen sei.
Die Allianz verpflichtet sich deshalb, spezifische Maßnahmen zur Verringerung der Luftverkehrsemissionen zu unterstützen, darunter nachhaltige Flugkraftstoffe, das globale CORSIA-Kompensationsprogramm und neue Flugzeugtechnologien.
Daneben gehört Deutschland zu den über 20 Unterzeichnern einer Vereinbarung zur Einrichtung sogenannter grüner Schiffskorridore. Bis zur Mitte des Jahrzehnts sollen zwischen zwei oder mehr Häfen mindestens sechs emissionsfreie Seeverkehrsrouten eingerichtet werden. Bis 2030 sollen “viele weitere grüne Korridore” hinzukommen, heißt es in der Erklärung.
Bei einem Abkommen zum globalen Aus für Verbrennungsmotoren ab dem Jahr 2040 gehört Deutschland hingegen nicht zu den Unterstützern (Europe.Table berichtete). Zwar bestehe innerhalb der Bundesregierung Konsens, dass bis 2035 nur noch klimaneutrale Fahrzeuge zugelassen werden sollen. “Allerdings besteht nach wie vor keine Einigkeit zu einem Randaspekt der Erklärung, nämlich der Frage, ob aus erneuerbaren Energien gewonnene E-Fuels Teil der Lösung sein können”, teilte ein BMU-Sprecher am Mittwoch mit.
Widerstand komme insbesondere aus dem CSU-geführten Verkehrsministerium. Das BMU jedenfalls halte E-Fuels mit Blick auf Verfügbarkeit und Effizienz genau wie die Unterzeichnerstaaten nicht für zielführend. til
Der geplante CO2-Grenzausgleich (CBAM) der Europäischen Union sorgt weltweit für Verunsicherung und beschäftigt die EU-Delegation auf der Klimakonferenz (COP26) in Glasgow. Es sei jedoch ein positives Signal, dass der Emissionshandel nebst CBAM überhaupt ein Thema sei, sagt Peter Liese, Co-Verhandlungsführer des EU-Parlaments, zu Europe.Table. Denn bereits die Diskussion um den geplanten Grenzausgleich habe erste Effekte gezeigt – darunter die Ratifizierung des Pariser Klimaabkommens durch die Türkei. Der CDU-Europaabgeordnete räumt aber ein: “Das Instrument ist noch nicht perfekt.”
Eine der zentralen Forderung auf der COP26: Die Einnahmen aus dem CBAM sollten nicht ausschließlich der EU zugutekommen, sondern auch in die Klimafinanzierung fließen, um insbesondere Entwicklungsländer bei der Dekarbonisierung zu unterstützen. Liese unterstützt den Vorstoß. Dass ein solcher Mechanismus im Vorschlag der Kommission nicht vorgesehen ist, sei ein Fehler, sagt er und kündigt an: Entsprechende Änderungsanträge durch das EU-Parlament seien wahrscheinlich.
Die französische Regierung hingegen hatte zuletzt angekündigt, die Einnahmen als Eigenmittel der EU behandeln zu wollen (Europe.Table berichtete). Das Land will den CBAM zur Priorität seiner Ratspräsidentschaft machen und in der ersten Jahreshälfte 2022 energisch vorantreiben.
Der Grenzausgleichsmechanismus soll schrittweise die Zuteilung kostenfreier CO2-Zertifikate an die Industrie ersetzen und für die ersten Sektoren ab 2026 vollständig in Kraft treten. Ziel ist der Schutz vor Carbon Leakage. til
Die Europäische Union sollte nach der COVID-19-Pandemie eine echte Reform ihrer Haushaltsregeln anstreben und nicht nur kleine Korrekturen am bestehenden Rahmen vornehmen, so der Europäische Fiskalausschuss (EFB) in seinem Jahresbericht vom Mittwoch.
Der EFB ist ein Beratungsgremium der Europäischen Kommission, die im nächsten Jahr ihre Vorschläge zur Reform der EU-Haushaltsregeln ausarbeiten wird. Die 1997 eingeführten Regeln wurden ausgesetzt, um die COVID-19-Pandemie zu bekämpfen. Sie müssen aus Sicht der Kommission jedoch geändert werden, weil durch die Pandemie die öffentliche Verschuldung in ganz Europa stark angestiegen ist und die meisten Länder nicht in der Lage sind, die Schulden in dem jetzt erforderlichen Tempo abzubauen.
Die Regeln sehen auch keine Sonderbehandlung für Investitionen vor, obwohl der Kampf der EU gegen den Klimawandel nach Angaben der Kommission in den nächsten zehn Jahren jährlich 650 Milliarden Euro an Investitionen erfordern wird. “Der EFB ist davon überzeugt, dass eine echte Reform des fiskalischen Rahmens besser ist als eine mögliche Alternative mit diskretionären und schwer vorhersehbaren Änderungen bei der Umsetzung des bestehenden Regelwerks”, heißt es in dem Bericht.
Das Regelwerk sieht derzeit eine Begrenzung des öffentlichen Defizits auf 3 Prozent des BIP und eine Begrenzung der öffentlichen Verschuldung auf 60 Prozent des BIP vor. Liegt die Verschuldung höher, wie es in den meisten EU-Ländern der Fall ist, muss sie jedes Jahr um ein Zwanzigstel des Überschusses über 60 Prozent gesenkt werden – ein zu ehrgeiziges Ziel für die meisten.
“Unser Vorschlag dreht sich um ein Hauptziel: eine nachhaltige Schuldendynamik; ein Hauptinstrument: eine Ausgaben-Benchmark; und eine Ausweichklausel, die auf der Grundlage einer unabhängigen Wirtschaftsanalyse geltend gemacht werden kann”, so der EFB.
Die Reform der Regeln sollte die Defizitgrenze von 3 Prozent beibehalten, aber die Rolle der Ausgaben-Benchmark betonen – eine Regel, die besagt, dass eine Regierung mehr ausgeben darf, wenn das Wirtschaftswachstum unter dem Potenzial liegt, und weniger, wenn es darüber liegt. Das Tempo des Schuldenabbaus sollte am besten auf die Gegebenheiten in den einzelnen Ländern abgestimmt werden, anstatt eine pauschale Regel für alle festzulegen, so der EFB.
Um dem Investitionsbedarf Rechnung zu tragen, schlug der EFB die Schaffung eines Budgets vor, das als zentrale Fiskalkapazität bezeichnet wird, um öffentliche Investitionen zu stabilisieren, zu schützen und zu fördern, anstatt sie, wie von einigen vorgeschlagen, von der Defizitberechnung auszunehmen.
Schließlich sollten die Regeln eine Ausweichklausel für außergewöhnliche Schocks enthalten, wenn die Regeln ausgesetzt werden müssen. rtr
Die EU-Regierungen haben am Mittwoch Einigkeit über “robuste” Maßnahmen gegenüber Großbritannien verabredet, wenn die Regierung in London den Streit über die Umsetzung der Brexit-Vereinbarungen eskalieren lassen sollte. Des bestätigten EU-Diplomaten am Mittwoch in Brüssel.
Großbritannien und die Europäische Kommission verhandeln seit einem Monat über Handelsvereinbarungen für Nordirland, die Kontrollen bei der Einfuhr von Waren aus Großbritannien vorsehen. Die Kontrollen sind notwendig, um die Einführung einer harten Grenze zwischen der britischen Provinz und dem EU-Mitglied Irland zu vermeiden. Die britische Regierung will von der eingegangenen Verpflichtung aber wieder abrücken.
Der Vizepräsident der Europäischen Kommission, Maroš Šefčovič, informierte am Mittwoch die EU-Botschafter in Brüssel und teilte ihnen nach Angaben von EU-Diplomaten mit, dass die Gespräche mit Großbritannien nicht gut liefen, aber fortgesetzt werden sollten. Der britische Brexit-Minister David Frost sagte daraufhin, Brüssel solle Ruhe bewahren und keine “massiven und unverhältnismäßigen Vergeltungsmaßnahmen” ergreifen, wenn London seine Drohung wahrmache, einen Handelsstreit nach dem Brexit zu eskalieren.
Premierminister Boris Johnson hatte im Rahmen des Brexit-Abkommens im Jahr 2020 das sogenannte Nordirland-Protokoll unterzeichnet. Seither argumentiert er jedoch, dass es in Eile vereinbart worden sei und Nachbesserungen notwendig seien. Die EU und auch die Bundesregierung lehnen eine Neuverhandlung ab. Die EU-Kommission hatte aber angeboten, dass die EU die Zollvorschriften und Kontrollen des Güterverkehrs zwischen dem britischen Kernland und Nordirland abspeckt.
Die britischen Clearinghäuser dürfen weiterhin Handelsgeschäfte für Kunden in der Europäischen Union abwickeln. Die EU werde die bis Juni 2022 geltende Ausnahmeerlaubnis verlängern, sagte EU-Kommissarin Mairead McGuinness am Mittwoch. Die Finanzinstitute in Kontinentaleuropa bräuchten mehr Zeit, um mehr Kapazitäten für Wertpapierabwicklung aufzubauen. Wie lange die Frist verlängert werden soll, sagte sie nicht. rtr
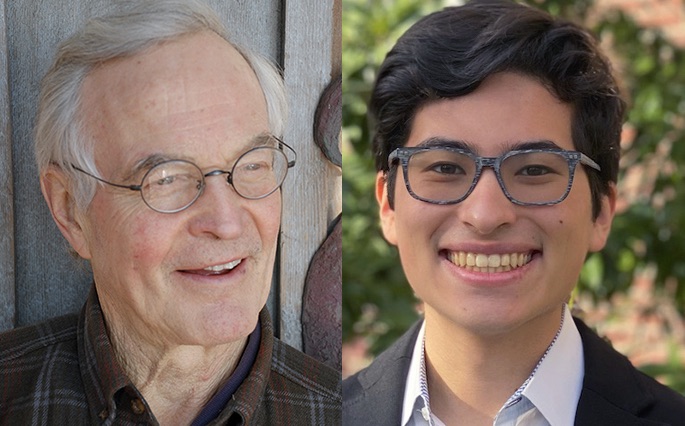
Diesen Sommer veröffentlichte der Weltklimarat (IPCC) seinen neuesten Bericht, und das Erschreckendste daran ist, wie wenig überraschend dessen Inhalt war. Das Schlimmste zu verhindern, so der Bericht, ist immer noch möglich, aber nur, wenn die Menschheit so schnell wie möglich zu einer kohlenstoffneutralen Wirtschaft übergeht. “Dieser Bericht”, so der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, “muss der Kohle und den fossilen Brennstoffen den Todesstoß versetzen, bevor sie unseren Planeten zerstören.”
Doch während der Planet in Flammen steht, schüren die Finanzinstitute das Feuer. Viele der mächtigsten Finanzakteure der Welt investieren weiterhin in die fossile Brennstoffindustrie, selbst wenn deren Handlungen vorhersehbar zu massiven wirtschaftlichen Störungen, ökologischen Katastrophen und sozialer Ungerechtigkeit führen. Bis jetzt sind sie damit davongekommen. Doch ein neuer Trend in der Gesetzgebung zwingt institutionelle Investoren dazu, ihre Portfolios zu dekarbonisieren – oder sie werden rechtlich zur Verantwortung gezogen.
Die Harvard-Universität ist ein typisches Beispiel dafür. Ein Jahrzehnt lang hat die Harvard-Leitung die Forderungen von Studenten, Dozenten und Ehemaligen ignoriert, das 53 Milliarden Dollar schwere Stiftungsvermögen der Universität aus der fossilen Brennstoffindustrie abzuziehen. In Anerkennung der wissenschaftlichen und finanziellen Realität verpflichtete sich die Universität im September schließlich dazu, sich von Unternehmen zu trennen, deren Geschäftsmodelle, die auf einer anhaltenden Kohlenstoffgewinnung beruhen, mit einer lebenswerten Zukunft unvereinbar sind.
“Angesichts der Notwendigkeit, die Wirtschaft zu dekarbonisieren, und unserer Verantwortung als Treuhänder, langfristige Investitionsentscheidungen zu treffen, die unseren Lehr- und Forschungsauftrag unterstützen”, schrieb Universitätspräsident Larry Bacow, “glauben wir nicht, dass solche Investitionen besonnen sind.”
Der Begriff “Prudence” (Vernunft, Besonnenheit) ist in der Satzung, die die Harvard-Stiftung und viele andere institutionelle Fonds regelt, ein grundlegendes Rechtskonzept, das die Sorgfalt, Geschicklichkeit und Vorsicht festlegt, mit der die Investitionen eines Fonds verwaltet werden müssen. Besonnenheit ist die Richtschnur dafür, wie ein Fonds verwaltet werden muss, um den Interessen der Begünstigten zu dienen, und es gibt erhebliche Strafen wenn dagegen verstoßen wird. Die Erklärung der Harvard-Universität räumt ein, dass es unmöglich ist, eine solche Pflicht einzuhalten und gleichzeitig in fossile Brennstoffe zu investieren.
Es gibt viele Gründe, warum dies der Fall sein könnte. Zunächst einmal sind die Unternehmen der fossilen Energiewirtschaft mit existenzieller Unsicherheit konfrontiert. Eine Flut von Marktverschiebungen, Regulierungen und Rechtsstreitigkeiten birgt grundlegende Risiken für die Interessen der Branche, während viele der CO2-Aktiva, aus denen sie ihren Wert ableitet, unverkäuflich gemacht und stranden werden, um die internationalen Klimaziele zu erreichen. Darüber hinaus widerspricht der Gedanke, von Unternehmen zu profitieren, deren Abhängigkeit von CO2-Emissionen den Klimawandel beschleunigt, den Vorstellungen vom öffentlichen Zweck und der sozialen Pflicht, die verantwortungsbewusste Investoren zu wahren vorgeben. Allein das wäre Grund genug, eine umfassende Dekarbonisierung anzustreben.
Mit anderen Worten: Das Geschäftsmodell der Industrie für fossile Brennstoffe ist inzwischen so sehr von der wissenschaftlichen und finanziellen Realität abgewichen, dass es nicht nur falsch ist, auf diese Unternehmen zu setzen (oder, allgemeiner gesagt, auf die Art von Unternehmen, die wesentlich von CO2-Emissionen abhängen). Von Rechts wegen ist es fahrlässig falsch. Darüber hinaus gilt das Konzept der Besonnenheit in ähnlicher Form für jeden Anleger, der dem Treuhandstandard unterliegt, und ist somit im Wesentlichen für jede akademische Stiftung, jeden Wohltätigkeitsfonds und jeden öffentlichen und privaten Pensionsfonds verbindlich. Das bedeutet, dass Billionen von Dollar von Harvards jüngstem Präzedenzfall betroffen sein könnten.
Tatsächlich gibt es bereits Auswirkungen der Harvard-Entscheidung. In den Wochen seit der Ankündigung haben eine Reihe anderer einflussreicher Investoren – von den Stiftungen der Boston University, der University of Minnesota und der MacArthur Foundation bis hin zum öffentlichen Pensionsfonds ABP in den Niederlanden (dem größten Europas) – ebenfalls gehandelt, um ihr Geld mit den Forderungen nach Besonnenheit und Klimaschutz in Einklang zu bringen. Damit schließen sie sich Anlegern mit einem Vermögen von über 39 Billionen Dollar an, von denen viele, wie die Märkte zeigen, bereits finanzielle Gewinne aus dem Ausstieg aus Aktien fossiler Brennstoffe erzielen.
Indem er die Entscheidung von Harvard auf Besonnenheit gründete, wollte Larry Bacow vielleicht die weitreichende Wirkung erzielen, die der Verzicht der Universität auf fossile Brennstoffe zweifelsohne haben wird. Vielleicht war es aber auch ein rechtzeitiger Verteidigungszug. Als Bacow die Entscheidung bekannt gab, wog der Generalstaatsanwalt von Massachusetts ab, ob er auf eine Klage reagieren sollte, die von Studenten und anderen Mitgliedern der Harvard-Gemeinschaft zusammen mit dem gemeinnützigen Climate Defense Project eingereicht worden war. Darin wurde behauptet, dass die Investitionen der Universität in fossile Brennstoffe einen Verstoß gegen ihre karitativen Verpflichtungen darstellten.
Was auch immer der Grund sein mag – Harvard hat einer Doktrin eine Stimme gegeben, die sich angesichts der Dringlichkeit der Klimakrise schnell in der ganzen Welt verbreiten und ähnliche Entscheidungen von Treuhändern überall beschleunigen sollte. Ein Jahrzehnt des Kampfes war nötig, um Harvard so weit zu bringen. Da die Universität nun endlich Schritte unternimmt, um ihren weltweiten Ruf als Vorreiterin gerecht zu werden, müssen andere institutionelle Anleger davon Notiz nehmen. Im Zeitalter der Klimakrise ist es die Aufgabe dieser Akteure, sich für die Zukunft einzusetzen. Sonst riskieren sie, nicht nur auf der falschen Seite der Geschichte, sondern auch auf der falschen Seite des Gesetzes zu landen.
In Zusammenarbeit mit Project Syndicate, Übersetzung: Andreas Hubig
Haben Sie es gemerkt? Wir befinden uns nun in der siebten Woche nach der Bundestagswahl. Seitdem haben SPD, Grüne und FDP erst vorsondiert. Dann sondiert. Und dann Koalitionsverhandlungen aufgenommen.
Allein: Man weiß fast nichts. Weil die drei Parteien ihre Unterhändler zu absolutem Stillschweigen verdonnert haben. Wenn überhaupt einmal jemand etwas öffentlich zu den Gesprächen sagt, dann die Chefetage.
Einerseits demokratisch bedenklich. Denn natürlich müssen die Vorhaben einer solchen Regierung auch gesamtgesellschaftlich, in den beteiligten Parteien und durch die künftige Opposition intensiv diskutiert werden. Das ist eine Grundregel des demokratischen Diskurses, und hierfür wird die Zeit nach ursprünglichem Plan langsam knapp.
Andererseits scheint niemand so richtig traurig darüber zu sein. Die derzeit desorientierten Unionsparteien. Die mit sich selbst beschäftigten Linken. Und die AfD, die sich eh stärker für die Geschehnisse an der russisch-polnischen Grenze als für nervigen Kleinkram wie Koalitionsverträge zu interessieren scheint.
Aber selbst viele Berichterstatter, eigentlich professionell neugierig, sind nicht unglücklich. Sie können sich das Herumlungern auf den Fluren im Paul-Löbe-Haus, bei den politischen Stiftungen und den Landesvertretungen sparen. Kürzlich traf ich gar welche, die sehr dankbar waren, dass ihre Redaktionen nicht dauernd aufgeregt wegen Twitter-Halbsätzen einschlägiger Liveberichterstatter anriefen und dazu “schnell eine ausgeruhte, tiefgründige Analyse in 1500 Zeichen” haben wollten.
Aber ein bisschen erschrocken waren auch sie. So viele Verhandlerinnen und Verhandler – und kaum einer traut sich, wirklich etwas zu den Inhalten zu sagen. Geschweige denn, irgendein Papier durchzustechen. Gilt hier etwa die alte Haushaltsausschussregel? Die besagt: Wenn einer vor Beschluss über sein Anliegen öffentliche Äußerungen tätigt, wird genau dieses Projekt einvernehmlich gestrichen. Oder müssen Übeltäter gar für den Unionsvorsitz kandidieren?
Oder spielen die Herrschaften in Wahrheit seit ein paar Tagen Gesellschaftsspiele und schauen belustigt auf das doch noch vorhandene Interesse vor den Türen? Oder wartet man mit öffentlichen Äußerungen, bis die sichtbaren Blessuren abgeklungen sind?
Man darf gespannt bleiben.
Die Grünen jedenfalls haben ihre Mitglieder nun aufgefordert, ihre Adressdaten zu prüfen. Damit ihnen die Abstimmungsunterlagen für den Koalitionsvertrag auch zugehen können. Man könnte das jetzt als Zeichen von Optimismus interpretieren. Aber nur in rot-grün-gelben Eckenklammern, Type Calibri, Schriftgröße 11. Also den Formatvorgaben, über die derzeit fast als einziges wirklich zu berichten ist. Falk Steiner
