die Automesse in Shanghai vor einem Jahr brachte einen Schock für die deutschen Autobauer. Denn sie alle hatten nicht mitbekommen, wie sehr die chinesische Konkurrenz sie in den drei Jahren der Pandemie in der Elektromobilität abgehängt hatte.
Jetzt, ein Jahr später, findet die Automesse turnusgemäß in Peking statt. Der Volkswagen-Konzern gibt sich kämpferisch. Er will sich noch lange nicht geschlagen geben. Doch es steht eine mindestens zwei Jahre andauernde Durststrecke bevor, schreibt Jörn Petring, der in den kommenden Tagen zusammen mit Table-Redakteurin Julia Fiedler von der Messe berichten wird.
Ein weiteres Thema auf der Messe sind intelligente Autos, die sich selbst steuern. Wir betrachten heute die Fragen der Datensicherheit. Digital-Expertin Rebecca Arcesati von Merics wundert sich im Gespräch mit Fabian Peltsch darüber, warum die Gefahren nicht mehr im Fokus stehen. Das Auto der Zukunft ist ein fahrender Datensammler. Und könnte die Umgebung, seine Insassen und seine Besitzer ausforschen. Spione mit vier Rädern, gewissermaßen.
Bisher läuft die Spionage allerdings noch auf ganz klassische Art durch menschliche Agenten. Die deutsche Politik hat gerade vier mutmaßliche Spione festgenommen. Markus Weißkopf hat für uns nachgeforscht, zu welchen Unis die verdächtigen Firmen Kontakt hatten.


Deutschland und China haben während des Scholz-Besuchs ein Abkommen zur Zusammenarbeit beim autonomen Fahren unterzeichnet. Hat Sie das überrascht angesichts der Tatsache, dass wir immer noch keine klare Haltung zu chinesischen Sicherheitsrisiken durch Unternehmen wie Tiktok und Huawei haben?
Das war in der Tat überraschend für mich, vor allem auch der Zeitpunkt. Auf der einen Seite gibt es mehrere Maßnahmen, die die USA ergriffen haben, darunter die Verfügung von Präsident Biden, die das Handelsministerium ermächtigt, Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit vernetzten Fahrzeugen aus China zu untersuchen. Andererseits hat die EU-Kommission eine Antisubventionsuntersuchung gegen chinesische EV-Importe eingeleitet. Vor diesem Hintergrund erweckt die Absichtserklärung den Eindruck, dass die deutsche Regierung nicht ganz auf einer Linie mit der De-Risking-Agenda der EU liegt.
Will Deutschland seinen Automarkt um jeden Preis fördern und ignoriert dabei Sicherheitsbedenken?
Deutsche Unternehmen arbeiten ja schon seit Jahren mit chinesischen Firmen in diesem Bereich zusammen, beispielsweise indem sie Software von Huawei oder Baidu für die Entwicklung deutscher Elektrofahrzeuge und intelligenter Fahrzeuge nutzen. Soweit ich weiß, baut die Absichtserklärung nun auf einer bereits bestehenden Vereinbarung auf, die im letzten Sommer ausgelaufen ist. Ein Schwerpunkt der Vereinbarung scheint darin zu liegen, dass die deutschen Autohersteller ihre Daten aus China herausholen können.
Tatsächlich ein langjähriges Problem aufgrund der strengen Lokalisierungsanforderungen Chinas.
Die chinesische Cyberspace-Verwaltung hatte bereits im März ihre Regeln gelockert, um den Unternehmen die Auslagerung von Daten aus dem Land zu erleichtern. Ich sehe also keine großen Zugeständnisse an Deutschland, abgesehen von der Zusage, die ungelösten Probleme im Zusammenhang mit Autodaten weiter zu diskutieren. Ich frage mich also, warum die deutsche Regierung zu diesem Zeitpunkt noch das Bedürfnis hatte, das Thema auf diese Weise hochzuhalten. Während die Europäische Kommission versucht, die Mitgliedstaaten zu ermutigen, Risikobewertungen für kritische Infrastrukturen vorzunehmen, einschließlich des Verkehrs, und die Risiken auf der Ebene der Zulieferer zu berücksichtigen, verpflichtet sich Deutschland, mit China über “gegenseitigen Datentransfer” zu diskutieren.
Glauben Sie, dass die chinesische Seite auf diese Erklärung gedrängt hat, um beispielsweise ein Signal an die Vereinigten Staaten zu senden?
Ich habe in den chinesischen Medien verfolgt, dass die Zusammenarbeit mit Deutschland als Antwort und Alternative zum US-Ansatz dargestellt wird. Deutschland wird als Akteur präsentiert, der für eine Zusammenarbeit zugunsten von Innovation und industrieller Entwicklung offen ist. Das ist durchaus ironisch, denn die chinesische Regierung verfolgt eine ganz ähnliche Politik wie die, die sie von den Vereinigten Staaten befürchtet. Aus Angst vor Spionage behandelt sie ausländische Technologieanbieter zunehmend als Bedrohung der nationalen Sicherheit und versucht gleichzeitig, die Weitergabe sensibler chinesischer Daten an das Ausland zu begrenzen.
Was sind die Worst-Case-Szenarien? Können Autos lahmgelegt oder als Waffen eingesetzt werden, oder ist das Science Fiction?
Ich denke, es ist absolut richtig, sich die schlimmsten Szenarien vorzustellen, wenn es um Cyber- und Datensicherheit geht. Es stimmt, dass ein vernetztes Fahrzeug gehackt werden kann. Es kann zum Spionieren verwendet werden. Diese Fahrzeuge sammeln eine riesige Menge an Daten, nicht nur in Bezug auf Personen, sondern auch auf Standorte. Sie können ihre Umgebung kartografieren. Dies wirft eine Reihe von Fragen auf. Was wäre zum Beispiel, wenn ein Fahrzeug chinesischer Herkunft in eine sensible Militäreinrichtung eindringen könnte, weil ein Regierungsmitarbeiter es fährt? Aber auch hier gilt, dass Fahrverbote für Unternehmen nur das letzte Mittel der Wahl sein sollten. Erforderlich ist eine Politik, die alle möglichen Risikoszenarien abwägt und eine optimale Lösung herbeiführt.
Können die jetzigen EU-Regularien die Risiken bereits eingrenzen?
Die Allgemeine Datenschutzverordnung der EU (GDPR) befasst sich mit dem Schutz der Privatsphäre, d. h. mit dem Schutz der Rechte des Einzelnen in Bezug auf personenbezogene Daten. Sie befasst sich nicht wirklich mit der Sicherheit und den strategischen Dimensionen der zunehmend miteinander verbundenen und vernetzten Gesellschaften. Das lässt Schlupflöcher offen. Es gibt Hard- und Software chinesischen Ursprungs nicht nur auf der Ebene der 5G-Netze, sondern auch in vernetzten Fahrzeugen, im öffentlichen Raum durch Sicherheitskameras, in der logistischen Infrastruktur wie Häfen, in Unterseekabeln und so weiter. Es gibt aber einige Vorschriften, die in gewissem Umfang bereits zum Tragen kommen könnten. Zum Beispiel die NIS-2-Richtlinie. Auch das Datengesetz enthält einige Bestimmungen in dieser Hinsicht, denn es regelt die gemeinsame Nutzung nicht personenbezogener Daten für öffentliche Zwecke und Innovationen. Letztlich wird es jedoch an den Mitgliedstaaten liegen, bei der Prüfung von Technologieanbietern eine Logik der Risikominderung anzuwenden.
US-Handelsministerin Gina Raimondo erklärte, vernetzte Autos seien “wie Smartphones auf Rädern”. Was ist potenziell gefährlicher: Tiktok, Huawei oder chinesische Autos?
Ich würde nicht sagen, dass es so etwas wie eine Hierarchie der Bedrohungen gibt. Gleichzeitig muss ich betonen, dass Schwachstellen in der zugrunde liegenden Telekommunikationsinfrastruktur besonders folgenreich sein können. Deutschland hat zum Beispiel seine Abhängigkeit von risikoreichen Anbietern, insbesondere Huawei, für 5G-Netzausrüstung im Vergleich zu 4G eher erhöht als verringert. Dies führt zu einem Problem, denn wenn das Netz nicht ausreichend sicher ist, können auch die angeschlossenen Geräte im “Internet der Dinge” leichter kompromittiert werden.
Kritiker sagen, dass ein umfassender Schutz in smarten Geräten und Autos unmöglich ist, weil nach jedem kleinen Update Millionen von Codes überprüft werden müssten.
Da die Autos der Zukunft ein immer höheres Maß an Autonomie aufweisen, werden unweigerlich viele Daten in Echtzeit an den Hersteller und an Drittanbieter von Software übertragen. Mit den in China hergestellten intelligenten Autos, die in Europa im Umlauf sind, wird es zu einem Datenfluss zurück zu Servern in China kommen, einem Land, in dem es keinen sinnvollen und durchsetzbaren Schutz persönlicher Informationen und anderer sensibler Daten vor staatlichem Zugriff und Missbrauch gibt. Wir müssen über praktikable Vereinbarungen zur gemeinsamen Nutzung von Daten nachdenken. Zum Beispiel wie die für Tiktok in der EU umgesetzte Vereinbarung, bei der Unternehmen mit Sitz in Ländern mit hohem Risiko höheren Anforderungen an die Datenlokalisierung unterliegen, um Daten von strategischer oder für die nationale Sicherheit relevanter Bedeutung zu schützen.
Wird die chinesische Seite dem nachkommen?
Wie alle multinationalen Unternehmen werden auch chinesische Unternehmen versuchen, in so vielen Ländern wie möglich tätig zu sein, ohne sich mit fragmentierten und manchmal inkompatiblen Regulierungssystemen herumschlagen zu müssen. Die Datenschutz-Grundverordnung (GDPR) hat bereits zu einem großen Widerstand in der Industrie geführt, weil die Unternehmen der Meinung waren, dass sie die Kosten für die Einhaltung der Vorschriften unverhältnismäßig in die Höhe trieb. Wenn chinesische Automobilhersteller mehr in die EU exportieren wollen, wozu sie von ihrer Regierung sehr ermutigt und unterstützt werden, sollten sie gleichzeitig Wege finden, hohe Standards in Sachen Cyber- und Datensicherheit zu erfüllen.
Wie nutzt China inzwischen seine und unsere Daten?
In China findet ein reger Datenaustausch zwischen Unternehmen und Behörden statt, von dem auch deutsche Autohersteller betroffen sind. Hersteller von Elektrofahrzeugen müssen beispielsweise Standortdaten und einige elektromechanische Daten mit staatlichen Plattformen austauschen. Man könnte sich vorstellen, dass diese Daten von den chinesischen Behörden für industriepolitische Ziele genutzt werden, um einheimische Hersteller zu begünstigen, die ihren deutschen Konkurrenten bereits überlegen sind. In China gibt es ein breiteres Denken über die Nutzung von Daten als Produktionsfaktor, um Innovation und Modernisierung in der heimischen Industrie zu fördern. Ausländische Unternehmen hingegen werden wahrscheinlich nicht den gleichen Zugang zu diesen Datenpools für F&E-Zwecke erhalten wie ihre lokalen Konkurrenten.
Heißt das, dass deutsche Unternehmen in China dazu beitragen, ihre Konkurrenten mit ihren eigenen Daten zu stärken?
Wir haben nicht genug Beweise, um diese Behauptung aufzustellen, aber es ist ein klares Risiko für die Wettbewerbsfähigkeit und Geschäftsgeheimnisse und etwas, worüber sich auch die Industrie Sorgen macht. Darüber hinaus könnten deutsche Unternehmen, ob sie wollen oder nicht, durch die Speicherung von Daten in China und die Einhaltung der dortigen Vorschriften über den Austausch von Daten zwischen Unternehmen und Behörden auch zu Chinas massivem Überwachungsstaat beitragen.
Was meinen Sie genau?
Stellen Sie sich ein Szenario vor, in dem ein deutscher Autohersteller aufgefordert wird, Standort- oder Gesprächsdaten mit den chinesischen Strafverfolgungsbehörden zu teilen. Das ist keine Science-Fiction, sondern etwas, das das dortige System verlangt. Die deutschen Autohersteller werden dem nachkommen müssen, wenn sie darum gebeten werden. Während die Datenschutz-Grundverordnung die Datenschutzrechte der europäischen Bürger schützt, gibt es viele ethische Fragen im Zusammenhang mit der Weitergabe von chinesischen Verbraucherdaten an die chinesische Regierung, einschließlich sensibler Daten. Das ist ein Aspekt, den wir hier gerne vergessen, weil wir uns so sehr auf die Datenschutzrechte europäischer Bürger konzentrieren.
Rebecca Arcesati ist Lead Analyst für Chinas Technologie- und Digitalpolitik beim Mercator Institute for China Studies (Merics). Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt auf der globalen Präsenz chinesischer Technologieunternehmen, der Verwaltung von Daten und künstlicher Intelligenz, Technologietransfers und Forschungszusammenarbeit. Sie hat in Peking, Shanghai und Dalian studiert und gearbeitet.

Volkswagen sieht trotz der Probleme beim Verkauf von Elektroautos auf dem chinesischen Markt Licht am Ende des Tunnels. “Wir laufen auf Hochgeschwindigkeit, um uns in diesem Segment zu verbessern”, sagte Konzernchef Oliver Blume am Vorabend der am Donnerstag beginnenden Pekinger Automesse.
Zugleich räumte VW aber ein, dass die Lage vorerst schwierig bleibe. Der Preiskampf mit Herstellern wie dem südchinesischen Platzhirsch BYD sei derzeit kaum zu gewinnen: “Im April haben wir eine weitere Runde von Preissenkungen gesehen, der heftige Preiswettbewerb wird also in den nächsten Jahren anhalten”, sagte VW-China-Chef Ralf Brandstätter.
Zumindest aber haben die Wolfsburger eine klare Vorstellung davon, wie sie sich zurückkämpfen wollen. Bis 2026, so der Plan, wollen sie bei E-Autos auf Augenhöhe mit der lokalen Konkurrenz sein. Das bedeute aber noch mindestens zwei harte Jahre. So müssen laut Brandstätter etwa die bisherigen Lücken im Fahrzeugportfolio geschlossen werden. Vor allem Einstiegsmodelle in der Kompaktklasse fehlten bisher. VW erwartet, dass in diesem Segment künftig die meisten Autos in China verkauft werden.
Erneut verwiesen Brandstätter und Blume am Mittwoch auf ihre “in China für China”-Strategie. Damit will VW dynamischer auf Veränderungen im schnelllebigen chinesischen Markt reagieren. Das Management vor Ort hat nun große Freiräume und kann viele Entscheidungen auch eigenständig treffen. Das soll die Effizienz steigern und die Kosten senken.
Wie ernst die Lage für VW in China ist, haben gerade erst die Zahlen für das erste Quartal gezeigt. Nach eigenen Angaben verkaufte der VW-Konzern mit seinen Marken wie Audi und Porsche 693.600 Fahrzeuge in China. Davon hatten lediglich 41.000 Fahrzeuge einen Elektroantrieb, also sechs Prozent. Auf dem Gesamtmarkt haben E-Autos dabei schon einen viel größeren Anteil.
Für das laufende Jahr wird erwartet, dass 40 Prozent aller verkauften Fahrzeuge in China E-Autos sein werden, berichtete kürzlich die staatliche Zeitung China Daily. Schon im nächsten Jahr soll jedes zweite in China verkaufte Neufahrzeug ein E-Auto sein. Von dieser Quote ist VW noch weit entfernt.
Dass VW – anders als mancher reine E-Auto-Hersteller – noch Verbrenner in China im Angebot hat, habe laut Blume aber auch etwas Gutes. Denn damit lasse sich schließlich Geld verdienen. Volkswagen sei in der starken Position, diese Gewinne in die Transformation investieren zu können, so Blume.
Ohnehin rechnet VW nicht mit einem kompletten Aus für den Verbrenner in China. Zwar sollen in den chinesischen Megacities und Großstädten bis 2030 überwiegend E-Autos fahren. Doch in kleineren Städten mit schlechter Ladeinfrastruktur oder etwa in besonders kalten Regionen im Norden des Landes hat der Verbrennungsmotor auch Ende des Jahrzehnts noch eine Zukunft, glaubt man bei Volkswagen.
Blume betonte am Mittwoch auch, dass ein Schlüssel zum Erfolg darin liege, stärker als bisher auf Kooperationen zu setzen. Hier habe bei Volkswagen ein Umdenken stattgefunden. “Wir können und wollen nicht alles selbst und alleine machen, gerade bei den sich so schnell entwickelnden Transformationstechnologien”, sagte Blume. Er verwies unter anderem auf die Zusammenarbeit mit Horizon Robotics bei der Entwicklung selbstfahrender Fahrzeuge oder die Beteiligung am chinesischen Elektroauto-Startup Xpeng.
Langfristig, konkret bis 2030, will die VW-Gruppe in China rund vier Millionen Fahrzeuge im Jahr verkaufen. Nach VW-Angaben entspräche das dann einem Marktanteil von 15 Prozent. Die Hälfte aller verkauften Autos soll dann elektrisch betrieben sein. Der Konzern hatte 2023 in China etwa 3,2 Millionen Pkw verkauft.
Zumindest der Blick an die Börse zeigt, dass die Anleger Volkswagen zuletzt mehr zugetraut haben als so manchem chinesischen Anbieter. Im Vergleich zum Vorjahr ist der VW-Kurs nahezu unverändert. BYD verlor dagegen rund zehn Prozent an Marktwert, die noch jungen chinesischen E-Auto-Start-ups Xpeng und Nio sogar 20 beziehungsweise 49 Prozent. Der intensive Wettbewerb auf dem chinesischen Markt macht eben nicht nur den deutschen Herstellern zu schaffen, sondern auch den einheimischen Anbietern.

Am Montag informierte die Bundesanwaltschaft über die Festnahme von drei Verdächtigen, gegen die der Vorwurf erhoben wird, für den chinesischen Geheimdienst tätig zu sein. Thomas R. soll mithilfe von Herwig F. und Ina F. über deren Firma unter anderem Informationen zu militärisch nutzbaren Technologien beschafft haben.
Es gibt mittlerweile Hinweise, dass es sich bei dem Unternehmen um die in Düsseldorf und London ansässige Innovative Dragon Ltd. handelt. Laut Bundesanwaltschaft wurden diese Firma Kontakte und Zusammenarbeit zu “Personen aus der deutschen Wissenschaft und Forschung” geknüpft. Und es soll ein Kooperationsabkommen mit einer deutschen Universität gegeben haben.
Gegenstand einer ersten Phase dieser Kooperation war wohl die Erstellung einer Studie für einen chinesischen Vertragspartner zum Stand der Technik von Maschinenteilen, die auch für den Betrieb leistungsstarker Schiffsmotoren, etwa in Kampfschiffen, von Bedeutung sind. Hinter dem chinesischen Vertragspartner habe ein Mitarbeiter des chinesischen Geheimdienstes MSS gestanden, von dem Thomas R. seine Aufträge erhielt. Die Finanzierung des Projekts sei durch staatliche chinesische Stellen erfolgt.
Die Homepage der Innovative Dragon Ltd. ist aktuell nicht mehr zu erreichen. Auf archivierten Internetseiten des Unternehmens findet sich jedoch unter anderem eine Referenzliste, auf der auch einige deutsche Hochschulen genannt werden. Table.Briefings hat die Hochschulen kontaktiert und zu ihren Beziehungen zu Innovative Dragons befragt.
Seitens der TU Chemnitz bestätigt man eine Zusammenarbeit mit Innovative Dragon Ltd. im Zeitraum von Juli 2022 bis März 2023. Ein Lehrstuhl habe für Innovative Dragon einen Auftrag zur Aufbereitung des vorhandenen und allgemein zugänglichen Stands der Technik von Gleitlagern durchgeführt.
Dieser sei “nach obligatorischer verwaltungsseitiger Prüfung als außenwirtschaftsrechtlich unbedenklich eingestuft” worden. Der Auftrag wurde durch einen Professor der TU Chemnitz durchgeführt und von Innovative Dragon mit 16.000 Euro honoriert. Den Namen des Professors nennt das Rektorat nicht.
Im Anschluss gab es laut TU Chemnitz Sondierungsgespräche direkt mit chinesischen Interessenten zu einer möglichen weiteren Zusammenarbeit. Auch diese wurde im Vorfeld auf außenwirtschaftsrechtliche Unbedenklichkeit geprüft. Zu dieser Zusammenarbeit sei es dann aber nicht gekommen, teilte das Rektorat mit. Gründe dafür wurden nicht genannt.
Keinen Auftrag, aber Kontakte zu Innovative Dragon gab es an der Universität Duisburg-Essen. Auf der Firmen-Homepage war der dortige Lehrstuhl für Mechatronik als Referenz genannt. Herwig F., Technischer Direktor bei Innovative Dragon, trat in der Vergangenheit unter anderem als Redner auf dem Wissenschaftsforum “Mobilität” der Universität Duisburg-Essen auf, wie die Universität auf Anfrage von Table.Briefings bestätigte. Darüber hinaus habe Innovative Dragon Limited das Mobilitätsforum mit 1.000 Euro unterstützt. Herwig F. stand mit der Uni “im wissenschaftlichen Austausch zu Fragen des Autonomen Fahrens“.
Zu einem vertraglich vereinbarten gemeinsamen Projekt sei es jedoch nicht gekommen. Beim Austausch ging es wohl vor allem um das autonome Testfahrzeug Flait der Innovative Dragon Ltd. Über dieses wurden auch einige Abschlussarbeiten an der Universität angefertigt. Die Universität betont, dass der Austausch ausschließlich zu zivilen Projekten im Bereich autonomes Fahren stattgefunden habe.
Es gibt jedoch noch eine Verbindung: Wie die Universität mitteilt, sei seit diesem Frühjahr einer der Lehrstuhlinhaber als stiller Teilhaber mit fünf Prozent an einer neu gegründeten Firma beteiligt. Das Unternehmen sei gemeinsam mit Personen aus dem Umfeld der Innovative Dragon Limited angemeldet worden. Unternehmensgegenstand seien ausschließlich zivile Anwendungen des Autonomen Fahrens.
Damit könnte nach Recherchen von Table.Briefings die Flait GmbH gemeint sein, die in diesem Jahr gegründet wurde und deren Geschäftsführer wohl ein ehemaliger Mitarbeiter der Innovative Dragon Ltd. ist.
An der RWTH Aachen, von der fünf Institute auf der Webseite von Innovative Dragon als Referenz angegeben waren, konnte man keine konkreten Verbindungen der Institute zu der Firma der Verdächtigen bestätigen. Lediglich bei einem Institut habe es 2009 eine Kooperationsanfrage gegeben, die jedoch nicht weiterverfolgt wurde.
Seitens der TU Dresden teilte man Table.Briefings mit, dass sowohl eine “zentrale Abfrage als auch die Abfrage in der Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik keinen Hinweis auf eine Forschungskooperation mit dem genannten Unternehmen ergeben” habe. Der Ruhr-Uni Bochum ist auf Anfrage ebenfalls kein “Vertrag mit der Firma bekannt”. Der auf der Homepage genannte Lehrstuhl sei bereits 2012 umbenannt worden, der damalige Inhaber verstorben.
Die weitere in der Referenzliste benannte Universität Stuttgart wollte sich aufgrund der noch andauernden Klärung des Sachverhalts bislang nicht äußern.
Was der aktuelle Fall zeigt: Die Klärung sicherheitsrelevanter Verbindungen kann unter Umständen für die Hochschulen schwierig werden. Firmen wie die Innovative Dragon Ltd. würden häufiger Vermittlungsdienste zwischen ihren chinesischen Kunden und deutschen Hochschulen übernehmen, berichten Insider. Auf der chinesischen Seite seien dann teilweise nochmals Mittlerfirmen dazwischengeschaltet, um den tatsächlichen Auftraggeber nicht preiszugeben.
Auf der deutschen Seite wiederum wickelten Professoren diese Kooperationen teilweise über eigene, ausgegliederte, kleinere GmbHs ab. Verträge mit den Hochschulen werden dann nur noch geschlossen, wenn Ressourcen der Einrichtung genutzt werden. Ob eine solche Kooperation über eine eigene GmbH als Nebentätigkeit angegeben werden muss, ist unklar. Gesetzlich geregelt ist das anscheinend nicht.
Offenbar fließen Meldungen über Nebentätigkeiten an vielen Hochschulen auch nicht mit anderen relevanten Informationen zusammen, zum Beispiel aus der Exportkontrolle. Daran wird deutlich, dass es hier eine weitere Professionalisierung der Prozesse an den Hochschulen, aber auch eine übergeordnete Unterstützung braucht.
Auf die Anfrage von Table.Briefings, ob nun konkreter Handlungsbedarf bestehe, antwortet man beim BMBF mit der Forderung nach mehr China-Kompetenz. Eine “fundierte und unabhängige China-Kompetenz ist essenziell, um deutsche Interessen wahrnehmen und durchsetzen zu können”, schreibt das Ministerium. Dazu werde man in Kürze eine weitere Förderrichtlinie veröffentlichen. Es gehe darum, “die Information und Sensibilisierung von Hochschulen und Forschungseinrichtungen gemeinsam mit den zuständigen Behörden weiter zu verstärken“.
Ob das reicht, bezweifelte die Wirtschaftsethikerin und China-Expertin Alicia Hennig schon im vergangenen Jahr. Sie forderte “verbindliche Regeln und zentrale Einrichtungen zur Unterstützung, sonst laufen wir Gefahr, dass der Wissens- und Technologietransfer einfach ungeregelt weitergeht”.
Der Verfassungsschutz warnt die deutsche Wirtschaft vor einer naiven Haltung gegenüber China, die für den Industriestandort existenzbedrohend sein könnte. “Wir haben eine Vielzahl von Fallbeispielen, in denen eine vielleicht höchst optimistische und zu positive Haltung hinsichtlich der Handelsbeziehungen zu China dazu geführt hat, dass sich diese Unternehmen praktisch aufgelöst haben”, sagte der Vizepräsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Sinan Selen, am Mittwoch auf einer Veranstaltung für Wirtschaftsunternehmen in Berlin. “Das droht auch Ihnen”, fügte er hinzu und forderte einen realistischeren Blick auf China.
Die Debatte über die Sicherheit der Wirtschaft war in den vergangenen Tagen durch Berichte über einen umfassenden Cyberangriff auf den VW-Konzern sowie vier Festnahmen wegen Spionageverdacht für China und die China-Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz wieder aufgebrandet. Einer der Verhafteten war ein Mitarbeiter des AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl, Maximilian Krah. Scholz nannte den Fall “sehr, sehr, sehr besorgniserregend”.
Der wegen einer Spionage-Affäre in Verbindung mit China unter Druck geratene AfD-Politiker Maximilian Krah will Spitzenkandidat seiner Partei für die Europawahl bleiben. Er habe persönlich kein Fehlverhalten an den Tag gelegt, sagte Krah am Mittwoch in Berlin nach einem Gespräch mit der AfD-Spitze. Daher sehe er keine Notwendigkeit, persönliche Konsequenzen zu ziehen. “Ich bin und bleibe Spitzenkandidat”, betonte Krah. Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden teilte am Abend auf Nachfrage mit, dass sie Vorermittlungen wegen der Berichte über Zahlungen aus Russland und China begonnen habe.
Der Verfassungschutz-Vize verwies darauf, dass die kommunistische Regierung “mit legitimen und illegitimen Mitteln (…) die wirtschaftliche, technologische und politische Weltführerschaft bis zum Jahr 2049″ verfolge. Besonderes Interesse gelte den Bereichen Luft- und Raumfahrttechnologie, Automatisierung, Robotik, Energieeinsparung und Elektromobilität, Informations- und Kommunikationstechnologie, Biomedizin und Medizin-Geräte. Firmen müssten immer mitdenken, dass hinter chinesischen Partnern auch der Staat und ein anderes Rechtssystem stehe.
Es sei kein Widerspruch, dass man versuche, Risiken zu minimieren und es dennoch eine bilaterale Handelsbilanz von 253 Milliarden Euro im Jahr 2023 gegeben habe und Kanzler Scholz nach China reise, betonte der Verfassungsschutz-Vizepräsident. Der Verfassungsschutz habe aber die Rolle, vor allem auf die Sicherheitsrisiken zu verweisen. Alexander Borgschulze, Vorsitzender der Allianz für Sicherheit in der Wirtschaft (ASW) mahnte an, dass sich die Firmen wappnen müssten. “Der Technologiestandort Deutschland ist (…) zunehmenden Risiken durch Wirtschafts- und Industrie-Spionage ausgesetzt”, warnte er und verwies auf eine zunehmende Cyberangriffe. rtr
Am Mittwoch veröffentlichte die EU-Kommission eine Bekanntmachung im Europäischen Amtsblatt, wonach sie ein Untersuchungsverfahren nach Maßgabe des Instruments für das Internationale Beschaffungswesen (International Procurement Instrument, IPI) gestartet hat. Ziel der Untersuchung ist der öffentliche Beschaffungsmarkt für Medizinprodukte in China, wo europäische Anbieter aktuell Marktanteile verlieren.
Das IPI erlaubt es der EU, gegen Drittländer vorzugehen, die EU-Anbieter in ihrer öffentlichen Beschaffung zugunsten heimischer Anbieter benachteiligen. In der Bekanntmachung erwähnt die Kommission eine Reihe von Benachteiligungen, denen europäische Anbieter ausgesetzt sind:
Mit dem Start der Untersuchung sendet die Kommission einen Fragebogen an die chinesische Regierung. Dieser soll die chinesische Regierung einladen, sich an der Klärung der von der Kommission aufgeworfenen Fragen zu beteiligen. Die Untersuchung endet nach neun Monaten, kann aber um fünf Monate verlängert werden.
Falls die Diskussion mit der chinesischen Regierung nicht zum gewünschten Resultat führt, stehen der EU-Kommission unter den Vorgaben des IPI zwei Möglichkeiten offen. Erstens kann sie chinesischen Anbietern bei öffentlichen Ausschreibungen in der EU ein sogenanntes “Score Adjustment” auferlegen. Das heißt, der Preis des chinesischen Angebots wird für den Vergleich der Angebote künstlich erhöht. Die Kommission kann ein maximales Score Adjustment um 50 Prozent und in Einzelfällen bis zu 100 Prozent vornehmen.
Der Kommission steht es auch offen, chinesische Anbieter ganz aus öffentlichen Beschaffungsmärkten auszuschließen. Das IPI besagt jedoch, dass die Gegenmaßnahme der EU verhältnismäßig sein muss. Die Gegenmaßnahmen sind nicht zwingend auf den betroffenen Sektor der Medizinprodukte beschränkt, doch aufgrund der Verhältnismäßigkeitsklausel dürften sich Gegenmaßnahmen primär auf diesen Sektor fokussieren.
Der Start der Untersuchung löste eine Reihe von Reaktionen aus. Die chinesische Handelskammer in der EU kommunizierte ihre “tiefe Enttäuschung” über das Vorgehen der Kommission und forderte mehr Dialog. Die Handelsbeauftragte der USA, Katherine Tai, sagte, sie verfolge die Entwicklung mit Interesse. “Das Instrument für das Internationale Beschaffungswesen ist ein Handelsinstrument, das potenziell helfen könnte, die unfairen Handelspolitiken und -praktiken der Volksrepublik Chinas anzugehen”, sagte sie in einem Statement. jaa
Das Europaparlament hat am Mittwoch das EU-Lieferkettengesetz endgültig verabschiedet. Mit 374 Stimmen bei 235 Gegenstimmen und 19 Enthaltungen nahmen die Abgeordneten das Ergebnis der Trilogverhandlungen an. Kommission, Rat und Parlament hatten sich zwar bereits Mitte Dezember auf einen Text geeinigt, die Mitgliedstaaten hatten im Ausschuss der stellvertretenden EU-Botschafter im März jedoch noch deutliche Änderungen bewirkt.
Der Rat muss die finale Fassung nun noch annehmen, bevor die Richtlinie in Kraft treten kann. Die Mitgliedstaaten haben dann zwei Jahre Zeit, sie in nationales Recht umzusetzen. In Deutschland soll hierfür das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) angepasst werden. Es ist zu erwarten, dass das EU-Lieferkettengesetz chinesischen Geschäftsinteressen in Europa und die Geschäftstätigkeit von EU-Firmen in China erschweren wird.
Auch der Trilogeinigung über die Verpackungsverordnung haben die EU-Abgeordneten zugestimmt und damit einem De-facto-Einfuhrverbot für recycelte Kunststoffe von außerhalb der EU. Die Vorgabe ist Teil der neuen EU-Verpackungsregeln. Die Vorgabe will Hersteller in China und anderswo auf der Welt dazu verpflichten, die in Europa für recycelte Kunststoffverpackungen geltenden Standards einzuhalten. Sollte der recycelte Kunststoff aus China nicht die gleichen Standards erfüllen, die von Herstellern in der EU gefordert werden, würde ihm der Zugang zum EU-Markt verwehrt. leo/ari
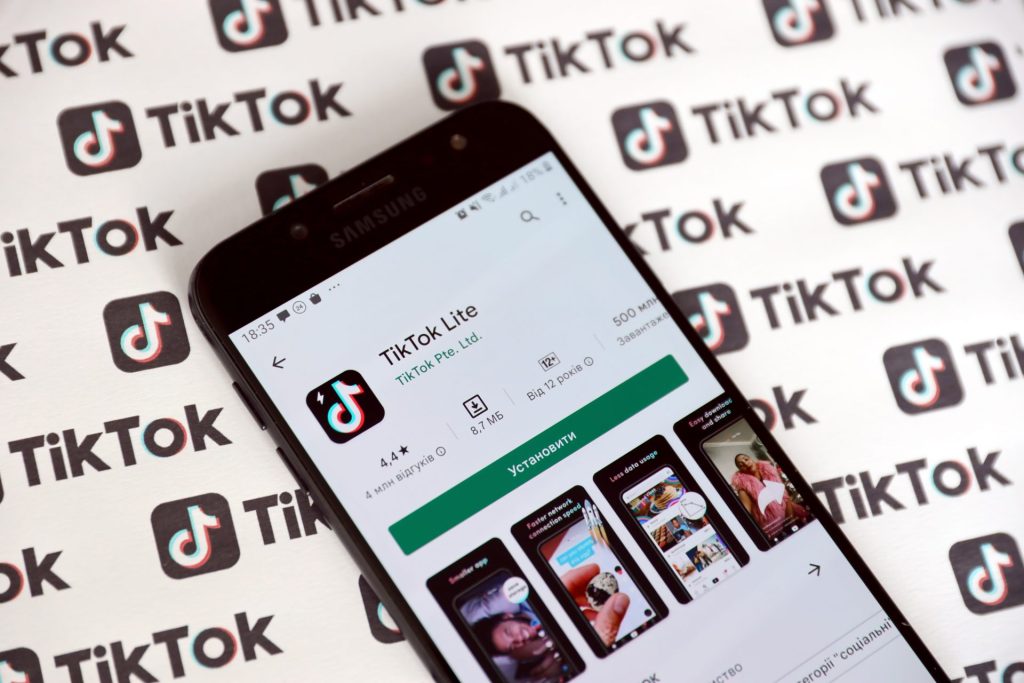
Der Tiktok-Betreiber Bytedance hat angekündigt, das von der EU-Kommission als potenziell rechtswidrig eingestufte Belohnungssystem bei der in Spanien und Frankreich eingeführten App Tiktok-Lite auszusetzen. “Tiktok versucht immer einen konstruktiven Umgang mit der EU-Kommission und anderen Regulierern zu finden. Deshalb setzen wir freiwillig die Belohnungsfunktionen in Tiktok-Lite aus, während wir die aufgeworfenen Bedenken adressieren”, ließ die Firma am Mittwochnachmittag wissen. Keine eineinhalb Stunden, bevor eine Frist zur Stellungnahme durch die EU-Kommission ausgelaufen wäre, lenkte die Firma also vorerst ein.
Doch die Kommission will den umstrittenen Social-Media-Anbieter im chinesischen Besitz nicht vom Haken lassen. “Unsere Kinder sind keine Versuchskaninchen für Social Media”, zürnt Thierry Breton auf X (ehemals Twitter). Er nehme zwar zur Kenntnis, dass Tiktok das Belohnungssystem abschalte. Aber: “Die Verfahren gegen Tiktok zum Suchtrisiko auf der Plattform werden weitergeführt.”
Bytedance hat somit in letzter Minute die angedrohte Anordnung nach dem Digital Services Act abgewehrt, die schon am Donnerstag hätte folgen können. Unter dem DSA können Aufsichtsbehörden beim Verdacht auf Verstöße Zwangsmaßnahmen bis hin zur Sperrung eines Angebots anordnen. fst
AHK-China-Chef Jens Hildebrandt wechselt zur BASF in China und wird der wichtige Kontakt des Unternehmens zur chinesischen Regierung. Das gab der Konzern am Mittwoch bekannt. Hildebrandt wird ab dem 1. Juli Vice President Government Relations Greater China mit Sitz in Peking und folgt damit Jörg Wuttke nach.
Hildebrandt ist seit August 2018 Delegierter der Deutschen Wirtschaft in Peking und dortiger Geschäftsführer der Deutschen Handelskammer. Er hat Politikwissenschaft und Sinologie in Leipzig, Peking und Hongkong studiert. Er arbeitete seit 2007 in verschiedenen Positionen für die deutschen Auslandshandelskammern. “Jörg Wuttke hinterlässt riesige Fußstapfen. Ich freue mich auf die neue Herausforderung in der Industrie”, sagte Hildebrandt anlässlich des Jobwechsels zu Table.Briefings.
Wuttke wird ab dem Sommer Partner bei der US-Beratung Albright Stonebridge Group, die zur US-Kanzlei Dentons Global Advisors gehört. Der 65-Jährige war seit 1997 für die BASF in China tätig. ari

Seit Anfang März ist Frank Han Chef von Volkswagens Softwaresparte Cariad. Es ist eine wichtige Position, die Durchhaltevermögen und Fingerspitzengefühl verlangt. Am Erfolg von Cariad hängt auch der Erfolg von Europas größtem Autohersteller. Denn die Autos der Zukunft sind smart, vernetzt, Infotainmentsysteme auf vier Rädern, wenn man so will. Die chinesischen Autobauer haben den Bedarf bekanntlich erkannt und sind dabei, die Deutschen auf dem größten Automarkt der Welt abzuhängen.
Cariad selbst wurde 2019 vom damaligen VW-Chef Herbert Diess ins Leben gerufen. Die VW-Tochter sollte nichts Geringeres als Europas zweitgrößtes Softwareunternehmen hinter SAP werden. Stattdessen wurde Cariad zum Sorgenkind. Bis heute verzögert die IT den Start und die Weiterentwicklung wichtiger Audi-, Porsche- und VW-Modelle, darunter das automatisierte Trinity-Projekt. Besonders in China stoße VW auf “gewaltige Probleme” bei der Integration neuer, speziell entwickelter Features in die Cariad-Softwarearchitektur, erklärte Thomas Ulbrich, Vorstandsmitglied für Elektromobilität im Februar.
Im Juni 2023 übernahm Peter Bosch die Leitung des Softwareunternehmens, um das Ruder herumzureißen. Noch bis 2025 befindet sich der Konzern in einem Restrukturierungs- und Gesundschrumpfungsprozess. Um effizienter zu werden, sollen 2.000 Stellen gestrichen werden. Cariad sei zu schnell zu teuer geworden, heißt es. Laut McKinsey wird die geplante Software-Architektur bis 2026 rund 3,5 Milliarden Euro mehr Kosten verschlingen, als ursprünglich veranschlagt war.
Als ein Hauptgrund, warum Cariad nicht die Erwartungen erfüllt, gilt der Mangel an branchengeschulten Fachkräften. In China verstünden die Manager und Entwickler zum Beispiel noch immer nicht, dass man das Auto der Software anpassen müsse und nicht die Software dem Auto, wie es chinesische Konzerne längst tun.
Und hier kommt Frank Han ins Spiel. Vor seinem Ruf zu Cariad arbeitete er für Huawei und den E-Autokonzern Changan, wo er sich als Chief Technical Officer ebenfalls um die Entwicklung von softwaredefinierten Fahrzeugplattformen kümmerte. Mit seiner Hilfe sollen die Entwicklungszeiten für China-spezifische Softwarelösungen um 30 Prozent verkürzt werden. Innovationen im Auto sollen schneller zum Kunden gelangen. Die Digitalausstattung samt Novelty-Gadgets ist für Konsumenten in China mitunter der wichtigste Kaufgrund. Han weiß das.
Er hat Maschinenbau und Informatik an der Southwest Jiaotong University und der University of Texas in Dallas studiert. Bei Changan leitete er ein Technologieteam von über 2.000 Ingenieuren und 1.500 Ingenieuren bei Partnerunternehmen. Er war für die umfassende Entwicklung einer SDV-Plattform verantwortlich. Bei VW soll Han aber nicht nur nachbessern. Er soll den Konzern wieder zu alten China-Erfolgen führen. Volkswagens China-Vorstand Ralf Brandstätter will bis 2023 hier 30 neue E-Modelle an den Start bringen. Die Weichen stellt Cariad.
Im vergangenen Jahr hat Cariad ein Joint Venture mit der chinesischen Technologiegruppe Thundersoft gegründet. Das Actionfilm-artig benannte “Carthunder” soll passgenaue Softwarelösungen für China anbieten. Außerdem hat sich Cariad mit der Smartphonefirma Vivo zusammengetan, einer großen Nummer auf Chinas Handy-Markt. Ihr gemeinsames “Mobile & Mobility Fusion Joint Innovative Lab” soll die nahtlose Verknüpfung von mobilen Endgeräten und E-Fahrzeugen gewährleisten.
Zu seiner Position als CEO ist der 53-jährige Han auch in den China-Vorstand von Volkswagen aufgerückt. Man setzt offenbar große Hoffnungen in ihn, das Werk seines Vorgängers Chang Qing erfolgreich zu vollenden. “Aufgrund der sehr spezifischen Anforderungen unserer chinesischen Kunden ist die Lokalisierung der Softwareentwicklung eine wichtige Säule unserer ‘in China, for China’-Strategie”, kommentierte Ralf Brandstätter den Neuzugang. “Mit seiner technischen Expertise und seinem Wissen über die regionalen Kundenbedürfnisse wird Frank Han die Integration innovativer digitaler Technologien in unsere Produkte umsetzen”. Fabian Peltsch
Jozef Kaban, bislang Chefdesigner von Volkswagen, wechselt zum chinesischen Autobauer SAIC und wird am SAIC-Hauptsitz Shanghai als Vice President des Global Design Centers die Designverantwortung für die Marke MG übernehmen.
Danni Wang hat im April das China Produktprojektmanagement Digitalisierung bei Audi China übernommen. Die in Tianjin, Berlin und Leipzig ausgebildete Wirtschaftswissenschaftlerin war bereits für Siemens und VW in China tätig. Für Audi China arbeitet sie seit Oktober 2022.
Nan Li ist im April zum R&D Development China bei Porsche ernannt worden. Li war zuvor Abteilungsleiter für Big Data, AI und Connectivity bei Mercedes. Sein neuer Einsatzort ist Weissach in Baden-Württemberg.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Schneelandschaft auch in Yushu, einer von Tibetern bewohnten Region in der Provinz Qinghai. Doch während Schnee in Deutschland im April eher selten geworden ist, gehört Schnee hier in dieser Jahreszeit zur Normalität. Noch.
die Automesse in Shanghai vor einem Jahr brachte einen Schock für die deutschen Autobauer. Denn sie alle hatten nicht mitbekommen, wie sehr die chinesische Konkurrenz sie in den drei Jahren der Pandemie in der Elektromobilität abgehängt hatte.
Jetzt, ein Jahr später, findet die Automesse turnusgemäß in Peking statt. Der Volkswagen-Konzern gibt sich kämpferisch. Er will sich noch lange nicht geschlagen geben. Doch es steht eine mindestens zwei Jahre andauernde Durststrecke bevor, schreibt Jörn Petring, der in den kommenden Tagen zusammen mit Table-Redakteurin Julia Fiedler von der Messe berichten wird.
Ein weiteres Thema auf der Messe sind intelligente Autos, die sich selbst steuern. Wir betrachten heute die Fragen der Datensicherheit. Digital-Expertin Rebecca Arcesati von Merics wundert sich im Gespräch mit Fabian Peltsch darüber, warum die Gefahren nicht mehr im Fokus stehen. Das Auto der Zukunft ist ein fahrender Datensammler. Und könnte die Umgebung, seine Insassen und seine Besitzer ausforschen. Spione mit vier Rädern, gewissermaßen.
Bisher läuft die Spionage allerdings noch auf ganz klassische Art durch menschliche Agenten. Die deutsche Politik hat gerade vier mutmaßliche Spione festgenommen. Markus Weißkopf hat für uns nachgeforscht, zu welchen Unis die verdächtigen Firmen Kontakt hatten.


Deutschland und China haben während des Scholz-Besuchs ein Abkommen zur Zusammenarbeit beim autonomen Fahren unterzeichnet. Hat Sie das überrascht angesichts der Tatsache, dass wir immer noch keine klare Haltung zu chinesischen Sicherheitsrisiken durch Unternehmen wie Tiktok und Huawei haben?
Das war in der Tat überraschend für mich, vor allem auch der Zeitpunkt. Auf der einen Seite gibt es mehrere Maßnahmen, die die USA ergriffen haben, darunter die Verfügung von Präsident Biden, die das Handelsministerium ermächtigt, Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit vernetzten Fahrzeugen aus China zu untersuchen. Andererseits hat die EU-Kommission eine Antisubventionsuntersuchung gegen chinesische EV-Importe eingeleitet. Vor diesem Hintergrund erweckt die Absichtserklärung den Eindruck, dass die deutsche Regierung nicht ganz auf einer Linie mit der De-Risking-Agenda der EU liegt.
Will Deutschland seinen Automarkt um jeden Preis fördern und ignoriert dabei Sicherheitsbedenken?
Deutsche Unternehmen arbeiten ja schon seit Jahren mit chinesischen Firmen in diesem Bereich zusammen, beispielsweise indem sie Software von Huawei oder Baidu für die Entwicklung deutscher Elektrofahrzeuge und intelligenter Fahrzeuge nutzen. Soweit ich weiß, baut die Absichtserklärung nun auf einer bereits bestehenden Vereinbarung auf, die im letzten Sommer ausgelaufen ist. Ein Schwerpunkt der Vereinbarung scheint darin zu liegen, dass die deutschen Autohersteller ihre Daten aus China herausholen können.
Tatsächlich ein langjähriges Problem aufgrund der strengen Lokalisierungsanforderungen Chinas.
Die chinesische Cyberspace-Verwaltung hatte bereits im März ihre Regeln gelockert, um den Unternehmen die Auslagerung von Daten aus dem Land zu erleichtern. Ich sehe also keine großen Zugeständnisse an Deutschland, abgesehen von der Zusage, die ungelösten Probleme im Zusammenhang mit Autodaten weiter zu diskutieren. Ich frage mich also, warum die deutsche Regierung zu diesem Zeitpunkt noch das Bedürfnis hatte, das Thema auf diese Weise hochzuhalten. Während die Europäische Kommission versucht, die Mitgliedstaaten zu ermutigen, Risikobewertungen für kritische Infrastrukturen vorzunehmen, einschließlich des Verkehrs, und die Risiken auf der Ebene der Zulieferer zu berücksichtigen, verpflichtet sich Deutschland, mit China über “gegenseitigen Datentransfer” zu diskutieren.
Glauben Sie, dass die chinesische Seite auf diese Erklärung gedrängt hat, um beispielsweise ein Signal an die Vereinigten Staaten zu senden?
Ich habe in den chinesischen Medien verfolgt, dass die Zusammenarbeit mit Deutschland als Antwort und Alternative zum US-Ansatz dargestellt wird. Deutschland wird als Akteur präsentiert, der für eine Zusammenarbeit zugunsten von Innovation und industrieller Entwicklung offen ist. Das ist durchaus ironisch, denn die chinesische Regierung verfolgt eine ganz ähnliche Politik wie die, die sie von den Vereinigten Staaten befürchtet. Aus Angst vor Spionage behandelt sie ausländische Technologieanbieter zunehmend als Bedrohung der nationalen Sicherheit und versucht gleichzeitig, die Weitergabe sensibler chinesischer Daten an das Ausland zu begrenzen.
Was sind die Worst-Case-Szenarien? Können Autos lahmgelegt oder als Waffen eingesetzt werden, oder ist das Science Fiction?
Ich denke, es ist absolut richtig, sich die schlimmsten Szenarien vorzustellen, wenn es um Cyber- und Datensicherheit geht. Es stimmt, dass ein vernetztes Fahrzeug gehackt werden kann. Es kann zum Spionieren verwendet werden. Diese Fahrzeuge sammeln eine riesige Menge an Daten, nicht nur in Bezug auf Personen, sondern auch auf Standorte. Sie können ihre Umgebung kartografieren. Dies wirft eine Reihe von Fragen auf. Was wäre zum Beispiel, wenn ein Fahrzeug chinesischer Herkunft in eine sensible Militäreinrichtung eindringen könnte, weil ein Regierungsmitarbeiter es fährt? Aber auch hier gilt, dass Fahrverbote für Unternehmen nur das letzte Mittel der Wahl sein sollten. Erforderlich ist eine Politik, die alle möglichen Risikoszenarien abwägt und eine optimale Lösung herbeiführt.
Können die jetzigen EU-Regularien die Risiken bereits eingrenzen?
Die Allgemeine Datenschutzverordnung der EU (GDPR) befasst sich mit dem Schutz der Privatsphäre, d. h. mit dem Schutz der Rechte des Einzelnen in Bezug auf personenbezogene Daten. Sie befasst sich nicht wirklich mit der Sicherheit und den strategischen Dimensionen der zunehmend miteinander verbundenen und vernetzten Gesellschaften. Das lässt Schlupflöcher offen. Es gibt Hard- und Software chinesischen Ursprungs nicht nur auf der Ebene der 5G-Netze, sondern auch in vernetzten Fahrzeugen, im öffentlichen Raum durch Sicherheitskameras, in der logistischen Infrastruktur wie Häfen, in Unterseekabeln und so weiter. Es gibt aber einige Vorschriften, die in gewissem Umfang bereits zum Tragen kommen könnten. Zum Beispiel die NIS-2-Richtlinie. Auch das Datengesetz enthält einige Bestimmungen in dieser Hinsicht, denn es regelt die gemeinsame Nutzung nicht personenbezogener Daten für öffentliche Zwecke und Innovationen. Letztlich wird es jedoch an den Mitgliedstaaten liegen, bei der Prüfung von Technologieanbietern eine Logik der Risikominderung anzuwenden.
US-Handelsministerin Gina Raimondo erklärte, vernetzte Autos seien “wie Smartphones auf Rädern”. Was ist potenziell gefährlicher: Tiktok, Huawei oder chinesische Autos?
Ich würde nicht sagen, dass es so etwas wie eine Hierarchie der Bedrohungen gibt. Gleichzeitig muss ich betonen, dass Schwachstellen in der zugrunde liegenden Telekommunikationsinfrastruktur besonders folgenreich sein können. Deutschland hat zum Beispiel seine Abhängigkeit von risikoreichen Anbietern, insbesondere Huawei, für 5G-Netzausrüstung im Vergleich zu 4G eher erhöht als verringert. Dies führt zu einem Problem, denn wenn das Netz nicht ausreichend sicher ist, können auch die angeschlossenen Geräte im “Internet der Dinge” leichter kompromittiert werden.
Kritiker sagen, dass ein umfassender Schutz in smarten Geräten und Autos unmöglich ist, weil nach jedem kleinen Update Millionen von Codes überprüft werden müssten.
Da die Autos der Zukunft ein immer höheres Maß an Autonomie aufweisen, werden unweigerlich viele Daten in Echtzeit an den Hersteller und an Drittanbieter von Software übertragen. Mit den in China hergestellten intelligenten Autos, die in Europa im Umlauf sind, wird es zu einem Datenfluss zurück zu Servern in China kommen, einem Land, in dem es keinen sinnvollen und durchsetzbaren Schutz persönlicher Informationen und anderer sensibler Daten vor staatlichem Zugriff und Missbrauch gibt. Wir müssen über praktikable Vereinbarungen zur gemeinsamen Nutzung von Daten nachdenken. Zum Beispiel wie die für Tiktok in der EU umgesetzte Vereinbarung, bei der Unternehmen mit Sitz in Ländern mit hohem Risiko höheren Anforderungen an die Datenlokalisierung unterliegen, um Daten von strategischer oder für die nationale Sicherheit relevanter Bedeutung zu schützen.
Wird die chinesische Seite dem nachkommen?
Wie alle multinationalen Unternehmen werden auch chinesische Unternehmen versuchen, in so vielen Ländern wie möglich tätig zu sein, ohne sich mit fragmentierten und manchmal inkompatiblen Regulierungssystemen herumschlagen zu müssen. Die Datenschutz-Grundverordnung (GDPR) hat bereits zu einem großen Widerstand in der Industrie geführt, weil die Unternehmen der Meinung waren, dass sie die Kosten für die Einhaltung der Vorschriften unverhältnismäßig in die Höhe trieb. Wenn chinesische Automobilhersteller mehr in die EU exportieren wollen, wozu sie von ihrer Regierung sehr ermutigt und unterstützt werden, sollten sie gleichzeitig Wege finden, hohe Standards in Sachen Cyber- und Datensicherheit zu erfüllen.
Wie nutzt China inzwischen seine und unsere Daten?
In China findet ein reger Datenaustausch zwischen Unternehmen und Behörden statt, von dem auch deutsche Autohersteller betroffen sind. Hersteller von Elektrofahrzeugen müssen beispielsweise Standortdaten und einige elektromechanische Daten mit staatlichen Plattformen austauschen. Man könnte sich vorstellen, dass diese Daten von den chinesischen Behörden für industriepolitische Ziele genutzt werden, um einheimische Hersteller zu begünstigen, die ihren deutschen Konkurrenten bereits überlegen sind. In China gibt es ein breiteres Denken über die Nutzung von Daten als Produktionsfaktor, um Innovation und Modernisierung in der heimischen Industrie zu fördern. Ausländische Unternehmen hingegen werden wahrscheinlich nicht den gleichen Zugang zu diesen Datenpools für F&E-Zwecke erhalten wie ihre lokalen Konkurrenten.
Heißt das, dass deutsche Unternehmen in China dazu beitragen, ihre Konkurrenten mit ihren eigenen Daten zu stärken?
Wir haben nicht genug Beweise, um diese Behauptung aufzustellen, aber es ist ein klares Risiko für die Wettbewerbsfähigkeit und Geschäftsgeheimnisse und etwas, worüber sich auch die Industrie Sorgen macht. Darüber hinaus könnten deutsche Unternehmen, ob sie wollen oder nicht, durch die Speicherung von Daten in China und die Einhaltung der dortigen Vorschriften über den Austausch von Daten zwischen Unternehmen und Behörden auch zu Chinas massivem Überwachungsstaat beitragen.
Was meinen Sie genau?
Stellen Sie sich ein Szenario vor, in dem ein deutscher Autohersteller aufgefordert wird, Standort- oder Gesprächsdaten mit den chinesischen Strafverfolgungsbehörden zu teilen. Das ist keine Science-Fiction, sondern etwas, das das dortige System verlangt. Die deutschen Autohersteller werden dem nachkommen müssen, wenn sie darum gebeten werden. Während die Datenschutz-Grundverordnung die Datenschutzrechte der europäischen Bürger schützt, gibt es viele ethische Fragen im Zusammenhang mit der Weitergabe von chinesischen Verbraucherdaten an die chinesische Regierung, einschließlich sensibler Daten. Das ist ein Aspekt, den wir hier gerne vergessen, weil wir uns so sehr auf die Datenschutzrechte europäischer Bürger konzentrieren.
Rebecca Arcesati ist Lead Analyst für Chinas Technologie- und Digitalpolitik beim Mercator Institute for China Studies (Merics). Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt auf der globalen Präsenz chinesischer Technologieunternehmen, der Verwaltung von Daten und künstlicher Intelligenz, Technologietransfers und Forschungszusammenarbeit. Sie hat in Peking, Shanghai und Dalian studiert und gearbeitet.

Volkswagen sieht trotz der Probleme beim Verkauf von Elektroautos auf dem chinesischen Markt Licht am Ende des Tunnels. “Wir laufen auf Hochgeschwindigkeit, um uns in diesem Segment zu verbessern”, sagte Konzernchef Oliver Blume am Vorabend der am Donnerstag beginnenden Pekinger Automesse.
Zugleich räumte VW aber ein, dass die Lage vorerst schwierig bleibe. Der Preiskampf mit Herstellern wie dem südchinesischen Platzhirsch BYD sei derzeit kaum zu gewinnen: “Im April haben wir eine weitere Runde von Preissenkungen gesehen, der heftige Preiswettbewerb wird also in den nächsten Jahren anhalten”, sagte VW-China-Chef Ralf Brandstätter.
Zumindest aber haben die Wolfsburger eine klare Vorstellung davon, wie sie sich zurückkämpfen wollen. Bis 2026, so der Plan, wollen sie bei E-Autos auf Augenhöhe mit der lokalen Konkurrenz sein. Das bedeute aber noch mindestens zwei harte Jahre. So müssen laut Brandstätter etwa die bisherigen Lücken im Fahrzeugportfolio geschlossen werden. Vor allem Einstiegsmodelle in der Kompaktklasse fehlten bisher. VW erwartet, dass in diesem Segment künftig die meisten Autos in China verkauft werden.
Erneut verwiesen Brandstätter und Blume am Mittwoch auf ihre “in China für China”-Strategie. Damit will VW dynamischer auf Veränderungen im schnelllebigen chinesischen Markt reagieren. Das Management vor Ort hat nun große Freiräume und kann viele Entscheidungen auch eigenständig treffen. Das soll die Effizienz steigern und die Kosten senken.
Wie ernst die Lage für VW in China ist, haben gerade erst die Zahlen für das erste Quartal gezeigt. Nach eigenen Angaben verkaufte der VW-Konzern mit seinen Marken wie Audi und Porsche 693.600 Fahrzeuge in China. Davon hatten lediglich 41.000 Fahrzeuge einen Elektroantrieb, also sechs Prozent. Auf dem Gesamtmarkt haben E-Autos dabei schon einen viel größeren Anteil.
Für das laufende Jahr wird erwartet, dass 40 Prozent aller verkauften Fahrzeuge in China E-Autos sein werden, berichtete kürzlich die staatliche Zeitung China Daily. Schon im nächsten Jahr soll jedes zweite in China verkaufte Neufahrzeug ein E-Auto sein. Von dieser Quote ist VW noch weit entfernt.
Dass VW – anders als mancher reine E-Auto-Hersteller – noch Verbrenner in China im Angebot hat, habe laut Blume aber auch etwas Gutes. Denn damit lasse sich schließlich Geld verdienen. Volkswagen sei in der starken Position, diese Gewinne in die Transformation investieren zu können, so Blume.
Ohnehin rechnet VW nicht mit einem kompletten Aus für den Verbrenner in China. Zwar sollen in den chinesischen Megacities und Großstädten bis 2030 überwiegend E-Autos fahren. Doch in kleineren Städten mit schlechter Ladeinfrastruktur oder etwa in besonders kalten Regionen im Norden des Landes hat der Verbrennungsmotor auch Ende des Jahrzehnts noch eine Zukunft, glaubt man bei Volkswagen.
Blume betonte am Mittwoch auch, dass ein Schlüssel zum Erfolg darin liege, stärker als bisher auf Kooperationen zu setzen. Hier habe bei Volkswagen ein Umdenken stattgefunden. “Wir können und wollen nicht alles selbst und alleine machen, gerade bei den sich so schnell entwickelnden Transformationstechnologien”, sagte Blume. Er verwies unter anderem auf die Zusammenarbeit mit Horizon Robotics bei der Entwicklung selbstfahrender Fahrzeuge oder die Beteiligung am chinesischen Elektroauto-Startup Xpeng.
Langfristig, konkret bis 2030, will die VW-Gruppe in China rund vier Millionen Fahrzeuge im Jahr verkaufen. Nach VW-Angaben entspräche das dann einem Marktanteil von 15 Prozent. Die Hälfte aller verkauften Autos soll dann elektrisch betrieben sein. Der Konzern hatte 2023 in China etwa 3,2 Millionen Pkw verkauft.
Zumindest der Blick an die Börse zeigt, dass die Anleger Volkswagen zuletzt mehr zugetraut haben als so manchem chinesischen Anbieter. Im Vergleich zum Vorjahr ist der VW-Kurs nahezu unverändert. BYD verlor dagegen rund zehn Prozent an Marktwert, die noch jungen chinesischen E-Auto-Start-ups Xpeng und Nio sogar 20 beziehungsweise 49 Prozent. Der intensive Wettbewerb auf dem chinesischen Markt macht eben nicht nur den deutschen Herstellern zu schaffen, sondern auch den einheimischen Anbietern.

Am Montag informierte die Bundesanwaltschaft über die Festnahme von drei Verdächtigen, gegen die der Vorwurf erhoben wird, für den chinesischen Geheimdienst tätig zu sein. Thomas R. soll mithilfe von Herwig F. und Ina F. über deren Firma unter anderem Informationen zu militärisch nutzbaren Technologien beschafft haben.
Es gibt mittlerweile Hinweise, dass es sich bei dem Unternehmen um die in Düsseldorf und London ansässige Innovative Dragon Ltd. handelt. Laut Bundesanwaltschaft wurden diese Firma Kontakte und Zusammenarbeit zu “Personen aus der deutschen Wissenschaft und Forschung” geknüpft. Und es soll ein Kooperationsabkommen mit einer deutschen Universität gegeben haben.
Gegenstand einer ersten Phase dieser Kooperation war wohl die Erstellung einer Studie für einen chinesischen Vertragspartner zum Stand der Technik von Maschinenteilen, die auch für den Betrieb leistungsstarker Schiffsmotoren, etwa in Kampfschiffen, von Bedeutung sind. Hinter dem chinesischen Vertragspartner habe ein Mitarbeiter des chinesischen Geheimdienstes MSS gestanden, von dem Thomas R. seine Aufträge erhielt. Die Finanzierung des Projekts sei durch staatliche chinesische Stellen erfolgt.
Die Homepage der Innovative Dragon Ltd. ist aktuell nicht mehr zu erreichen. Auf archivierten Internetseiten des Unternehmens findet sich jedoch unter anderem eine Referenzliste, auf der auch einige deutsche Hochschulen genannt werden. Table.Briefings hat die Hochschulen kontaktiert und zu ihren Beziehungen zu Innovative Dragons befragt.
Seitens der TU Chemnitz bestätigt man eine Zusammenarbeit mit Innovative Dragon Ltd. im Zeitraum von Juli 2022 bis März 2023. Ein Lehrstuhl habe für Innovative Dragon einen Auftrag zur Aufbereitung des vorhandenen und allgemein zugänglichen Stands der Technik von Gleitlagern durchgeführt.
Dieser sei “nach obligatorischer verwaltungsseitiger Prüfung als außenwirtschaftsrechtlich unbedenklich eingestuft” worden. Der Auftrag wurde durch einen Professor der TU Chemnitz durchgeführt und von Innovative Dragon mit 16.000 Euro honoriert. Den Namen des Professors nennt das Rektorat nicht.
Im Anschluss gab es laut TU Chemnitz Sondierungsgespräche direkt mit chinesischen Interessenten zu einer möglichen weiteren Zusammenarbeit. Auch diese wurde im Vorfeld auf außenwirtschaftsrechtliche Unbedenklichkeit geprüft. Zu dieser Zusammenarbeit sei es dann aber nicht gekommen, teilte das Rektorat mit. Gründe dafür wurden nicht genannt.
Keinen Auftrag, aber Kontakte zu Innovative Dragon gab es an der Universität Duisburg-Essen. Auf der Firmen-Homepage war der dortige Lehrstuhl für Mechatronik als Referenz genannt. Herwig F., Technischer Direktor bei Innovative Dragon, trat in der Vergangenheit unter anderem als Redner auf dem Wissenschaftsforum “Mobilität” der Universität Duisburg-Essen auf, wie die Universität auf Anfrage von Table.Briefings bestätigte. Darüber hinaus habe Innovative Dragon Limited das Mobilitätsforum mit 1.000 Euro unterstützt. Herwig F. stand mit der Uni “im wissenschaftlichen Austausch zu Fragen des Autonomen Fahrens“.
Zu einem vertraglich vereinbarten gemeinsamen Projekt sei es jedoch nicht gekommen. Beim Austausch ging es wohl vor allem um das autonome Testfahrzeug Flait der Innovative Dragon Ltd. Über dieses wurden auch einige Abschlussarbeiten an der Universität angefertigt. Die Universität betont, dass der Austausch ausschließlich zu zivilen Projekten im Bereich autonomes Fahren stattgefunden habe.
Es gibt jedoch noch eine Verbindung: Wie die Universität mitteilt, sei seit diesem Frühjahr einer der Lehrstuhlinhaber als stiller Teilhaber mit fünf Prozent an einer neu gegründeten Firma beteiligt. Das Unternehmen sei gemeinsam mit Personen aus dem Umfeld der Innovative Dragon Limited angemeldet worden. Unternehmensgegenstand seien ausschließlich zivile Anwendungen des Autonomen Fahrens.
Damit könnte nach Recherchen von Table.Briefings die Flait GmbH gemeint sein, die in diesem Jahr gegründet wurde und deren Geschäftsführer wohl ein ehemaliger Mitarbeiter der Innovative Dragon Ltd. ist.
An der RWTH Aachen, von der fünf Institute auf der Webseite von Innovative Dragon als Referenz angegeben waren, konnte man keine konkreten Verbindungen der Institute zu der Firma der Verdächtigen bestätigen. Lediglich bei einem Institut habe es 2009 eine Kooperationsanfrage gegeben, die jedoch nicht weiterverfolgt wurde.
Seitens der TU Dresden teilte man Table.Briefings mit, dass sowohl eine “zentrale Abfrage als auch die Abfrage in der Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik keinen Hinweis auf eine Forschungskooperation mit dem genannten Unternehmen ergeben” habe. Der Ruhr-Uni Bochum ist auf Anfrage ebenfalls kein “Vertrag mit der Firma bekannt”. Der auf der Homepage genannte Lehrstuhl sei bereits 2012 umbenannt worden, der damalige Inhaber verstorben.
Die weitere in der Referenzliste benannte Universität Stuttgart wollte sich aufgrund der noch andauernden Klärung des Sachverhalts bislang nicht äußern.
Was der aktuelle Fall zeigt: Die Klärung sicherheitsrelevanter Verbindungen kann unter Umständen für die Hochschulen schwierig werden. Firmen wie die Innovative Dragon Ltd. würden häufiger Vermittlungsdienste zwischen ihren chinesischen Kunden und deutschen Hochschulen übernehmen, berichten Insider. Auf der chinesischen Seite seien dann teilweise nochmals Mittlerfirmen dazwischengeschaltet, um den tatsächlichen Auftraggeber nicht preiszugeben.
Auf der deutschen Seite wiederum wickelten Professoren diese Kooperationen teilweise über eigene, ausgegliederte, kleinere GmbHs ab. Verträge mit den Hochschulen werden dann nur noch geschlossen, wenn Ressourcen der Einrichtung genutzt werden. Ob eine solche Kooperation über eine eigene GmbH als Nebentätigkeit angegeben werden muss, ist unklar. Gesetzlich geregelt ist das anscheinend nicht.
Offenbar fließen Meldungen über Nebentätigkeiten an vielen Hochschulen auch nicht mit anderen relevanten Informationen zusammen, zum Beispiel aus der Exportkontrolle. Daran wird deutlich, dass es hier eine weitere Professionalisierung der Prozesse an den Hochschulen, aber auch eine übergeordnete Unterstützung braucht.
Auf die Anfrage von Table.Briefings, ob nun konkreter Handlungsbedarf bestehe, antwortet man beim BMBF mit der Forderung nach mehr China-Kompetenz. Eine “fundierte und unabhängige China-Kompetenz ist essenziell, um deutsche Interessen wahrnehmen und durchsetzen zu können”, schreibt das Ministerium. Dazu werde man in Kürze eine weitere Förderrichtlinie veröffentlichen. Es gehe darum, “die Information und Sensibilisierung von Hochschulen und Forschungseinrichtungen gemeinsam mit den zuständigen Behörden weiter zu verstärken“.
Ob das reicht, bezweifelte die Wirtschaftsethikerin und China-Expertin Alicia Hennig schon im vergangenen Jahr. Sie forderte “verbindliche Regeln und zentrale Einrichtungen zur Unterstützung, sonst laufen wir Gefahr, dass der Wissens- und Technologietransfer einfach ungeregelt weitergeht”.
Der Verfassungsschutz warnt die deutsche Wirtschaft vor einer naiven Haltung gegenüber China, die für den Industriestandort existenzbedrohend sein könnte. “Wir haben eine Vielzahl von Fallbeispielen, in denen eine vielleicht höchst optimistische und zu positive Haltung hinsichtlich der Handelsbeziehungen zu China dazu geführt hat, dass sich diese Unternehmen praktisch aufgelöst haben”, sagte der Vizepräsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Sinan Selen, am Mittwoch auf einer Veranstaltung für Wirtschaftsunternehmen in Berlin. “Das droht auch Ihnen”, fügte er hinzu und forderte einen realistischeren Blick auf China.
Die Debatte über die Sicherheit der Wirtschaft war in den vergangenen Tagen durch Berichte über einen umfassenden Cyberangriff auf den VW-Konzern sowie vier Festnahmen wegen Spionageverdacht für China und die China-Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz wieder aufgebrandet. Einer der Verhafteten war ein Mitarbeiter des AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl, Maximilian Krah. Scholz nannte den Fall “sehr, sehr, sehr besorgniserregend”.
Der wegen einer Spionage-Affäre in Verbindung mit China unter Druck geratene AfD-Politiker Maximilian Krah will Spitzenkandidat seiner Partei für die Europawahl bleiben. Er habe persönlich kein Fehlverhalten an den Tag gelegt, sagte Krah am Mittwoch in Berlin nach einem Gespräch mit der AfD-Spitze. Daher sehe er keine Notwendigkeit, persönliche Konsequenzen zu ziehen. “Ich bin und bleibe Spitzenkandidat”, betonte Krah. Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden teilte am Abend auf Nachfrage mit, dass sie Vorermittlungen wegen der Berichte über Zahlungen aus Russland und China begonnen habe.
Der Verfassungschutz-Vize verwies darauf, dass die kommunistische Regierung “mit legitimen und illegitimen Mitteln (…) die wirtschaftliche, technologische und politische Weltführerschaft bis zum Jahr 2049″ verfolge. Besonderes Interesse gelte den Bereichen Luft- und Raumfahrttechnologie, Automatisierung, Robotik, Energieeinsparung und Elektromobilität, Informations- und Kommunikationstechnologie, Biomedizin und Medizin-Geräte. Firmen müssten immer mitdenken, dass hinter chinesischen Partnern auch der Staat und ein anderes Rechtssystem stehe.
Es sei kein Widerspruch, dass man versuche, Risiken zu minimieren und es dennoch eine bilaterale Handelsbilanz von 253 Milliarden Euro im Jahr 2023 gegeben habe und Kanzler Scholz nach China reise, betonte der Verfassungsschutz-Vizepräsident. Der Verfassungsschutz habe aber die Rolle, vor allem auf die Sicherheitsrisiken zu verweisen. Alexander Borgschulze, Vorsitzender der Allianz für Sicherheit in der Wirtschaft (ASW) mahnte an, dass sich die Firmen wappnen müssten. “Der Technologiestandort Deutschland ist (…) zunehmenden Risiken durch Wirtschafts- und Industrie-Spionage ausgesetzt”, warnte er und verwies auf eine zunehmende Cyberangriffe. rtr
Am Mittwoch veröffentlichte die EU-Kommission eine Bekanntmachung im Europäischen Amtsblatt, wonach sie ein Untersuchungsverfahren nach Maßgabe des Instruments für das Internationale Beschaffungswesen (International Procurement Instrument, IPI) gestartet hat. Ziel der Untersuchung ist der öffentliche Beschaffungsmarkt für Medizinprodukte in China, wo europäische Anbieter aktuell Marktanteile verlieren.
Das IPI erlaubt es der EU, gegen Drittländer vorzugehen, die EU-Anbieter in ihrer öffentlichen Beschaffung zugunsten heimischer Anbieter benachteiligen. In der Bekanntmachung erwähnt die Kommission eine Reihe von Benachteiligungen, denen europäische Anbieter ausgesetzt sind:
Mit dem Start der Untersuchung sendet die Kommission einen Fragebogen an die chinesische Regierung. Dieser soll die chinesische Regierung einladen, sich an der Klärung der von der Kommission aufgeworfenen Fragen zu beteiligen. Die Untersuchung endet nach neun Monaten, kann aber um fünf Monate verlängert werden.
Falls die Diskussion mit der chinesischen Regierung nicht zum gewünschten Resultat führt, stehen der EU-Kommission unter den Vorgaben des IPI zwei Möglichkeiten offen. Erstens kann sie chinesischen Anbietern bei öffentlichen Ausschreibungen in der EU ein sogenanntes “Score Adjustment” auferlegen. Das heißt, der Preis des chinesischen Angebots wird für den Vergleich der Angebote künstlich erhöht. Die Kommission kann ein maximales Score Adjustment um 50 Prozent und in Einzelfällen bis zu 100 Prozent vornehmen.
Der Kommission steht es auch offen, chinesische Anbieter ganz aus öffentlichen Beschaffungsmärkten auszuschließen. Das IPI besagt jedoch, dass die Gegenmaßnahme der EU verhältnismäßig sein muss. Die Gegenmaßnahmen sind nicht zwingend auf den betroffenen Sektor der Medizinprodukte beschränkt, doch aufgrund der Verhältnismäßigkeitsklausel dürften sich Gegenmaßnahmen primär auf diesen Sektor fokussieren.
Der Start der Untersuchung löste eine Reihe von Reaktionen aus. Die chinesische Handelskammer in der EU kommunizierte ihre “tiefe Enttäuschung” über das Vorgehen der Kommission und forderte mehr Dialog. Die Handelsbeauftragte der USA, Katherine Tai, sagte, sie verfolge die Entwicklung mit Interesse. “Das Instrument für das Internationale Beschaffungswesen ist ein Handelsinstrument, das potenziell helfen könnte, die unfairen Handelspolitiken und -praktiken der Volksrepublik Chinas anzugehen”, sagte sie in einem Statement. jaa
Das Europaparlament hat am Mittwoch das EU-Lieferkettengesetz endgültig verabschiedet. Mit 374 Stimmen bei 235 Gegenstimmen und 19 Enthaltungen nahmen die Abgeordneten das Ergebnis der Trilogverhandlungen an. Kommission, Rat und Parlament hatten sich zwar bereits Mitte Dezember auf einen Text geeinigt, die Mitgliedstaaten hatten im Ausschuss der stellvertretenden EU-Botschafter im März jedoch noch deutliche Änderungen bewirkt.
Der Rat muss die finale Fassung nun noch annehmen, bevor die Richtlinie in Kraft treten kann. Die Mitgliedstaaten haben dann zwei Jahre Zeit, sie in nationales Recht umzusetzen. In Deutschland soll hierfür das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) angepasst werden. Es ist zu erwarten, dass das EU-Lieferkettengesetz chinesischen Geschäftsinteressen in Europa und die Geschäftstätigkeit von EU-Firmen in China erschweren wird.
Auch der Trilogeinigung über die Verpackungsverordnung haben die EU-Abgeordneten zugestimmt und damit einem De-facto-Einfuhrverbot für recycelte Kunststoffe von außerhalb der EU. Die Vorgabe ist Teil der neuen EU-Verpackungsregeln. Die Vorgabe will Hersteller in China und anderswo auf der Welt dazu verpflichten, die in Europa für recycelte Kunststoffverpackungen geltenden Standards einzuhalten. Sollte der recycelte Kunststoff aus China nicht die gleichen Standards erfüllen, die von Herstellern in der EU gefordert werden, würde ihm der Zugang zum EU-Markt verwehrt. leo/ari
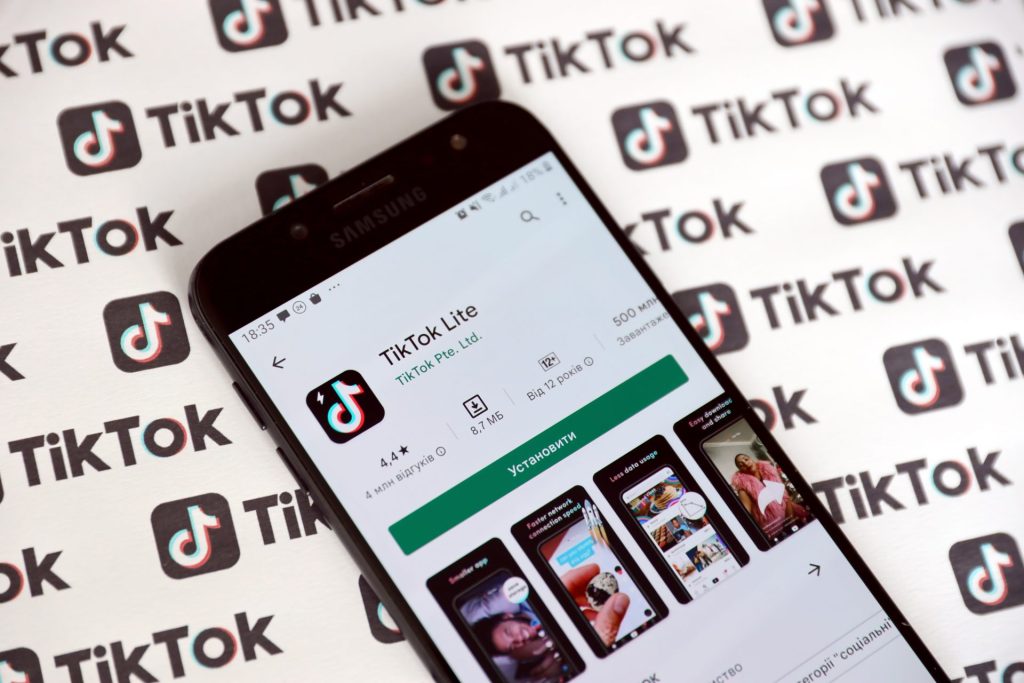
Der Tiktok-Betreiber Bytedance hat angekündigt, das von der EU-Kommission als potenziell rechtswidrig eingestufte Belohnungssystem bei der in Spanien und Frankreich eingeführten App Tiktok-Lite auszusetzen. “Tiktok versucht immer einen konstruktiven Umgang mit der EU-Kommission und anderen Regulierern zu finden. Deshalb setzen wir freiwillig die Belohnungsfunktionen in Tiktok-Lite aus, während wir die aufgeworfenen Bedenken adressieren”, ließ die Firma am Mittwochnachmittag wissen. Keine eineinhalb Stunden, bevor eine Frist zur Stellungnahme durch die EU-Kommission ausgelaufen wäre, lenkte die Firma also vorerst ein.
Doch die Kommission will den umstrittenen Social-Media-Anbieter im chinesischen Besitz nicht vom Haken lassen. “Unsere Kinder sind keine Versuchskaninchen für Social Media”, zürnt Thierry Breton auf X (ehemals Twitter). Er nehme zwar zur Kenntnis, dass Tiktok das Belohnungssystem abschalte. Aber: “Die Verfahren gegen Tiktok zum Suchtrisiko auf der Plattform werden weitergeführt.”
Bytedance hat somit in letzter Minute die angedrohte Anordnung nach dem Digital Services Act abgewehrt, die schon am Donnerstag hätte folgen können. Unter dem DSA können Aufsichtsbehörden beim Verdacht auf Verstöße Zwangsmaßnahmen bis hin zur Sperrung eines Angebots anordnen. fst
AHK-China-Chef Jens Hildebrandt wechselt zur BASF in China und wird der wichtige Kontakt des Unternehmens zur chinesischen Regierung. Das gab der Konzern am Mittwoch bekannt. Hildebrandt wird ab dem 1. Juli Vice President Government Relations Greater China mit Sitz in Peking und folgt damit Jörg Wuttke nach.
Hildebrandt ist seit August 2018 Delegierter der Deutschen Wirtschaft in Peking und dortiger Geschäftsführer der Deutschen Handelskammer. Er hat Politikwissenschaft und Sinologie in Leipzig, Peking und Hongkong studiert. Er arbeitete seit 2007 in verschiedenen Positionen für die deutschen Auslandshandelskammern. “Jörg Wuttke hinterlässt riesige Fußstapfen. Ich freue mich auf die neue Herausforderung in der Industrie”, sagte Hildebrandt anlässlich des Jobwechsels zu Table.Briefings.
Wuttke wird ab dem Sommer Partner bei der US-Beratung Albright Stonebridge Group, die zur US-Kanzlei Dentons Global Advisors gehört. Der 65-Jährige war seit 1997 für die BASF in China tätig. ari

Seit Anfang März ist Frank Han Chef von Volkswagens Softwaresparte Cariad. Es ist eine wichtige Position, die Durchhaltevermögen und Fingerspitzengefühl verlangt. Am Erfolg von Cariad hängt auch der Erfolg von Europas größtem Autohersteller. Denn die Autos der Zukunft sind smart, vernetzt, Infotainmentsysteme auf vier Rädern, wenn man so will. Die chinesischen Autobauer haben den Bedarf bekanntlich erkannt und sind dabei, die Deutschen auf dem größten Automarkt der Welt abzuhängen.
Cariad selbst wurde 2019 vom damaligen VW-Chef Herbert Diess ins Leben gerufen. Die VW-Tochter sollte nichts Geringeres als Europas zweitgrößtes Softwareunternehmen hinter SAP werden. Stattdessen wurde Cariad zum Sorgenkind. Bis heute verzögert die IT den Start und die Weiterentwicklung wichtiger Audi-, Porsche- und VW-Modelle, darunter das automatisierte Trinity-Projekt. Besonders in China stoße VW auf “gewaltige Probleme” bei der Integration neuer, speziell entwickelter Features in die Cariad-Softwarearchitektur, erklärte Thomas Ulbrich, Vorstandsmitglied für Elektromobilität im Februar.
Im Juni 2023 übernahm Peter Bosch die Leitung des Softwareunternehmens, um das Ruder herumzureißen. Noch bis 2025 befindet sich der Konzern in einem Restrukturierungs- und Gesundschrumpfungsprozess. Um effizienter zu werden, sollen 2.000 Stellen gestrichen werden. Cariad sei zu schnell zu teuer geworden, heißt es. Laut McKinsey wird die geplante Software-Architektur bis 2026 rund 3,5 Milliarden Euro mehr Kosten verschlingen, als ursprünglich veranschlagt war.
Als ein Hauptgrund, warum Cariad nicht die Erwartungen erfüllt, gilt der Mangel an branchengeschulten Fachkräften. In China verstünden die Manager und Entwickler zum Beispiel noch immer nicht, dass man das Auto der Software anpassen müsse und nicht die Software dem Auto, wie es chinesische Konzerne längst tun.
Und hier kommt Frank Han ins Spiel. Vor seinem Ruf zu Cariad arbeitete er für Huawei und den E-Autokonzern Changan, wo er sich als Chief Technical Officer ebenfalls um die Entwicklung von softwaredefinierten Fahrzeugplattformen kümmerte. Mit seiner Hilfe sollen die Entwicklungszeiten für China-spezifische Softwarelösungen um 30 Prozent verkürzt werden. Innovationen im Auto sollen schneller zum Kunden gelangen. Die Digitalausstattung samt Novelty-Gadgets ist für Konsumenten in China mitunter der wichtigste Kaufgrund. Han weiß das.
Er hat Maschinenbau und Informatik an der Southwest Jiaotong University und der University of Texas in Dallas studiert. Bei Changan leitete er ein Technologieteam von über 2.000 Ingenieuren und 1.500 Ingenieuren bei Partnerunternehmen. Er war für die umfassende Entwicklung einer SDV-Plattform verantwortlich. Bei VW soll Han aber nicht nur nachbessern. Er soll den Konzern wieder zu alten China-Erfolgen führen. Volkswagens China-Vorstand Ralf Brandstätter will bis 2023 hier 30 neue E-Modelle an den Start bringen. Die Weichen stellt Cariad.
Im vergangenen Jahr hat Cariad ein Joint Venture mit der chinesischen Technologiegruppe Thundersoft gegründet. Das Actionfilm-artig benannte “Carthunder” soll passgenaue Softwarelösungen für China anbieten. Außerdem hat sich Cariad mit der Smartphonefirma Vivo zusammengetan, einer großen Nummer auf Chinas Handy-Markt. Ihr gemeinsames “Mobile & Mobility Fusion Joint Innovative Lab” soll die nahtlose Verknüpfung von mobilen Endgeräten und E-Fahrzeugen gewährleisten.
Zu seiner Position als CEO ist der 53-jährige Han auch in den China-Vorstand von Volkswagen aufgerückt. Man setzt offenbar große Hoffnungen in ihn, das Werk seines Vorgängers Chang Qing erfolgreich zu vollenden. “Aufgrund der sehr spezifischen Anforderungen unserer chinesischen Kunden ist die Lokalisierung der Softwareentwicklung eine wichtige Säule unserer ‘in China, for China’-Strategie”, kommentierte Ralf Brandstätter den Neuzugang. “Mit seiner technischen Expertise und seinem Wissen über die regionalen Kundenbedürfnisse wird Frank Han die Integration innovativer digitaler Technologien in unsere Produkte umsetzen”. Fabian Peltsch
Jozef Kaban, bislang Chefdesigner von Volkswagen, wechselt zum chinesischen Autobauer SAIC und wird am SAIC-Hauptsitz Shanghai als Vice President des Global Design Centers die Designverantwortung für die Marke MG übernehmen.
Danni Wang hat im April das China Produktprojektmanagement Digitalisierung bei Audi China übernommen. Die in Tianjin, Berlin und Leipzig ausgebildete Wirtschaftswissenschaftlerin war bereits für Siemens und VW in China tätig. Für Audi China arbeitet sie seit Oktober 2022.
Nan Li ist im April zum R&D Development China bei Porsche ernannt worden. Li war zuvor Abteilungsleiter für Big Data, AI und Connectivity bei Mercedes. Sein neuer Einsatzort ist Weissach in Baden-Württemberg.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Schneelandschaft auch in Yushu, einer von Tibetern bewohnten Region in der Provinz Qinghai. Doch während Schnee in Deutschland im April eher selten geworden ist, gehört Schnee hier in dieser Jahreszeit zur Normalität. Noch.
