einmal mehr zeigt sich: Die Elektro-Revolution kommt aus China. Während bereits jetzt jeder vierte Neuwagen in der Volksrepublik elektrisch fährt, davon 80 Prozent aus chinesischer Fabrikation, hat der Batteriehersteller CATL aus Ningde auf der Automesse in Shanghai mit einer weiteren Sensation überrascht: CATL präsentierte einen Akku, in dem pro Kilogramm Batteriezelle 500 Wattstunden Strom gespeichert werden können. Bisherige Batterien kommen maximal auf die Hälfte.
Das schafft völlig neue Möglichkeiten der Elektrifizierung, etwa für Kleinwagen oder rein elektrisch betriebene LKW, sogar E-Flugzeuge. Bisher waren die Speicher dafür zu schwer. Noch in diesem Jahr will CATL mit der Produktion starten. Und, das ist die zweite positive Nachricht, analysiert Christian Domke-Seidel: Auch die europäischen Standorte von CATL sollen mit einbezogen werden.
Technisch immer innovativer, ansonsten aber immer repressiver – das zeigt sich mit der Änderung des Gesetzes zum Kampf gegen Spionage, das der Volkskongress verabschiedet hat. Mit der Änderung sollen nicht mehr nur Staatsgeheimnisse, sondern auch vage definierte “nationale Interessen” geschützt werden. Schon müssen auch ausländische Unternehmen in China Auswirkungen befürchten, schreibt unser Autor Fabian Kretschmer. Denn es sind vor allem diese vagen Formulierungen in Gesetzen, die China einmal mehr zu einem unberechenbaren Willkürstaat machen.
Bleiben Sie dennoch zuversichtlich!


Kein anderes Bauteil entscheidet so sehr über den Erfolg der E-Mobilität wie der Akku. Er ist es, der das Auto teuer macht. Außerdem reduzieren viele Kunden die Frage nach der Alltagstauglichkeit eines E-Autos auf Reichweite und Ladedauer. Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) ist dabei ein Durchbruch gelungen.
Das chinesische Unternehmen aus Ningde, Provinz Fujian, hat es geschafft, die Natrium-Ionen-Batterie zur Großserienreife zu bringen. Sie ist deutlich günstiger, robuster gegen Temperaturschwankungen und weniger rohstoffintensiv, wie ein CATL-Techniker gegenüber China.Table erläutert. Das kann auch Auswirkungen auf die europäischen Standorte des Konzerns haben.
Selbst viele Besucher der Automesse in Shanghai dürften die riesige Tragweite der Präsentation nicht ganz erfasst haben: Im Vorfeld der Messe zeigte der Hersteller Chery seine neue Marke iCar samt zweier neuer Fahrzeuge: den iCar GT (ein flacher Elektro-Sportwagen) und den iCar 03 (ein Kompakt-SUV mit 4,2 Metern Länge). Eine Natrium-Ionen-Batterie liefert den Fahrzeugen den benötigten Strom. Die Großserienproduktion dieser Technologie hatte CATL erst wenige Tage davor verkündet.
Die Entwicklung könnte dem globalen Elektroautomarkt einen enormen Schub verleihen. Denn Natrium-Ionen-Akkus lösen zentrale Probleme, die bei Lithium-Ionen-Akkus bestehen.
Der vergleichsweise geringe Preis macht Natrium-Ionen-Akkus vor allem für Klein- und Kompaktwagen interessant – also in Fahrzeugklassen mit hohen Absatzzahlen, in denen die Elektrifizierung noch nicht so weit vorangeschritten ist. Das dürfte innerhalb kürzester Zeit zu spürbaren Skaleneffekten führen. Nach CATL-Angaben sind nun aufgrund des geringen Gewichts bei sehr viel höherer Leistung selbst E-Flugzeuge möglich.
Auch BYD soll bereits kurz vor dem Großserieneinsatz eines Natrium-Ionen-Akku stehen. Angeblich will der Hersteller den Akku ab der zweiten Jahreshälfte 2023 in den Modellen Qin, Dolphin und Seagull verbauen. Offiziell bestätigt hat die Marke das allerdings noch nicht. Es handelt sich lediglich um Informationen von Insidern.
Allerdings schöpft die Natrium-Ionen-Batterie ihr Potenzial in der Praxis noch nicht aus. Die Energiedichte der Natrium-Ionen-Batteriezelle der ersten Generation von CATL liegt bei bis zu 160 Wattstunden pro Kilogramm. Doch herkömmliche Lithium-Ionen-Akkus erreichen bereits rund 200 Wattstunden pro Kilogramm. Ein Wert, den CATL in der nächsten Generation an Natrium-Ionen-Akkus einholen will.
Um diesen Schwachpunkt kurzfristig auszugleichen, liefert CATL zunächst eine Kombination aus Natrium- und Lithium-Ionen-Akkus aus. Während die Natrium-Technik jedoch erst ganz am Anfang steht und bis zu 500 Wattstunden pro Kilogramm erreichen kann, ist die Lithium-Technik bereits weitgehend ausgereizt.
Ein anderes, grundsätzliches Problem mit Natrium-Ionen-Akkus scheinen die CATL-Techniker gelöst zu haben. Es handelt sich um das Problem des amorphen Kohlenstoffs (auch “Hard Carbon” genannt) an der Anode. Bislang konnten große Hersteller wie BYD und eben CATL nicht verhindern, dass durch den Einsatz dieses Materials beim ersten Laden rund ein Fünftel der Batteriekapazität verloren ging.
Einen genauen Einblick, wie der chinesische Weltmarktführer das Problem lösen konnte, gibt der Techniker im Interview nicht. Er sagt nur: “CATL hat ein Hard Carbon entwickelt, das sich durch eine einzigartige poröse Struktur auszeichnet.” Das Problem des Leistungsverlustes ist damit offenbar beherrscht.
Die Investition von CATL in Europa hat bereits für einige Schlagzeilen gesorgt. An beiden europäischen Standorten können problemlos auch die neuen Technologien hergestellt werden. “Die Natrium-Ionen-Batterie hat einen ähnlichen Herstellungsprozess wie die Lithium-Ionen-Batterie, was bedeutet, dass wir mithilfe unserer flexiblen Produktionslinien schnell von der Lithium-Ionen-Batterie zur Natrium-Ionen-Batterie wechseln können”, so der Techniker im Interview mit China.Table. Bei den Produktionslinien gäbe es einen globalen Standard.
Auch einen weiteren Flaschenhals bei der Rohstofflieferung löst die Natrium-Ionen-Zelle auf. In der Produktion braucht es nicht nur kein Lithium, sondern auch kein Nickel oder Kobalt – alles knappe Waren. CATL selbst werde seine Produktion ausschließlich an der Nachfrage orientieren. Jetzt müssen also nur noch die Bestellungen hereinkommen.
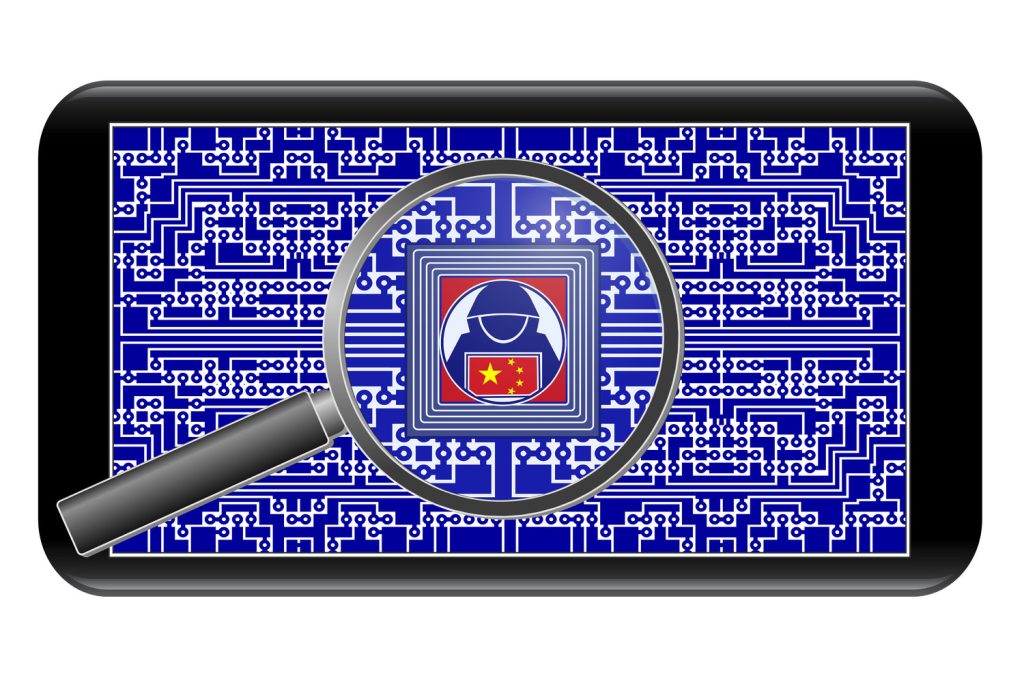
Am Donnerstag hat der Ständige Ausschuss des Volkskongresses eine Überarbeitung des sogenannten “Anti-Spionage-Gesetzes” verabschiedet. Das Dokument sieht eine massive Ausweitung der Befugnisse der Staatssicherheit vor, die künftig leichter Razzien und Festnahmen ohne Gerichtsbeschluss durchführen kann.
Damit erhält eine bereits verbreitete Praxis ihre gesetzliche Grundlage. Schon seit Tagen kursierten die Gerüchte, nun sind sie offiziell bestätigt: Die Sicherheitsbehörden in Shanghai haben eine Razzia in den Räumen der China-Tochter der US-Unternehmensberatung Bain durchgeführt und dabei Laptops und Smartphones konfisziert. Einige Mitarbeiter sprachen gar von mehreren unangekündigten Besuchen.
Worum es bei den Ermittlungen geht, ist bislang nicht bekannt. Der betroffene Konzern hat lediglich mitgeteilt, dass man “mit den chinesischen Behörden kooperieren” werde. Doch der Verdacht liegt nahe, dass die Gängelung von US-Unternehmen politisch motiviert ist.
Vor allem aber definiert das Gesetz den Strafbestand der Spionage neu: So sollen nicht mehr nur Staatsgeheimnisse geschützt werden, sondern sämtliche Dokumente oder Dateien, welche die “nationalen Interessen” berühren. Letztere sind jedoch derart vage formuliert, dass sie den Behörden Spielraum für eine willkürliche Anwendung geben. Jene Ambivalenz ist von der kommunistischen Partei gewollt: Sie erzeugt eine diffuse Angst, die schlussendlich zu vorauseilendem Gehorsam führt. Niemand weiß schließlich, wo genau die roten Linien verlaufen.
Das Gesetz verunsichert damit auch in China tätige ausländische Unternehmen. Gewöhnliche Marktanalysen können als Spionage ausgelegt, Interviews mit westlichen Journalisten als Bedrohung für die nationale Sicherheit gedeutet werden.
Europäische Unternehmen dürften zwar vorerst nicht primär ins Visier der Behörden geraten, da die chinesische Regierung seit einigen Monaten eine regelrechte Charme-Offensive gegenüber ihrem größten Handelspartner fährt. Doch sollten die politischen Beziehungen sich verschlechtern – etwa, wenn die deutsche Bundesregierung eine neue China-Strategie vorlegt -, dann könnte das Anti-Spionage-Gesetz eine willkommene Steilvorlage für ökonomische Vergeltungsschläge bilden.
Dass es sich dabei nicht um unbegründete Paranoia handelt, zeigt eine ganze Liste an Beispielen: Im März traf es einen Mitarbeiter des japanischen Pharmakonzerns Astella, der wegen Spionage verhaftet wurde. Im selben Monat schlossen die Behörden das Pekinger Büro der US-amerikanischen Mintz Group, die sogenannte Prüfungen der Einhaltung rechtlicher Vorschriften für Unternehmensverkäufe und Börsengänge durchführt. Sämtliche der fünf Angestellten in Festlandchina wurden wegen “rechtswidriger Geschäftstätigkeiten” verhaftet. Zum Zeitpunkt der Verhaftung hatte das Unternehmen keinerlei Informationen darüber, dass überhaupt ein Verfahren läuft.
Und da solche Prozesse – mit Hinweis auf die nationale Sicherheit – stets hinter verschlossenen Türen stattfinden und auch Diplomaten keinen Zugang erhalten, ist oftmals gar nicht ersichtlich, ob die Vorwürfe überhaupt begründet sind. Denn es ist mehr als auffällig, dass es nahezu immer Firmen aus denjenigen Ländern trifft, deren Beziehungen zu China kürzlich eskaliert sind.
“Sicherheit” ist seit einigen Jahren bereits das wohl am häufigsten verwendete Schlagwort von Staatschef Xi Jinping, der damit innerhalb der Bevölkerung ein Gefühl der latenten Bedrohung schafft. Sowohl im Außen als auch Inneren kann jederzeit ein potenzieller Staatsfeind lauern, lautet die Botschaft. In Staatsunternehmen ist es längst Usus, die Belegschaft diffus vor ausländischen Spionen zu warnen. Auch ausländische Journalisten werden nicht selten von den Staatsmedien als potenzielle Geheimdienstmitarbeiter porträtiert.
Es ist ein schmaler Grat zwischen Sicherheitswahn und wirtschaftlichen Ambitionen: Gleichzeitig nämlich versucht die Regierung auch, die Handelsbeziehungen zum Ausland nach der ökonomisch katastrophalen Null-Covid-Isolation aktiv zu fördern. Den wieder eintrudelnden Geschäftsdelegationen wird dieser Tage sprichwörtlich der rote Teppich ausgerollt, damit die großen Konzerne bloß nicht ihre Produktion von China nach Indien oder Südostasien abziehen. Fabian Kretschmer

Mehr als ein Jahr lang hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj um ein Gespräch mit Xi Jinping gebeten. Nun hat es endlich geklappt. Wie überraschend kam der Anruf von Xi bei Selenskyj?
Nicht sonderlich überraschend. Der Anruf war lange geplant, von chinesischer Seite hieß es zuletzt ja auch öffentlich, es würde zu gegebenem Zeitpunkt einen solchen Anruf geben. Zudem war es seit fast einem Jahr eine der zentralen Forderungen der Europäischen Union.
Aber warum ausgerechnet jetzt? Was hat sich verändert?
Zum einen verändert sich die Lage in der Ukraine. Zum anderen stehen wichtige Ereignisse an, wie der G7-Gipfel und europäische Debatten zur Zukunft Chinapolitik. Hier musste China etwas Druck wegnehmen und sich positionieren. Mit diesem Schritt versucht Peking natürlich auch wieder den Ball ins europäische Camp zu spielen: “Eure Forderung haben wir erfüllt, jetzt seid Ihr dran”. Peking versucht sich weiterhin als verantwortungsvoller Akteur zu präsentieren.
Oder hat es vielleicht auch etwas mit Emmanuel Macron zu tun? Frankreichs Präsident hat in Peking ja intensiv um Xi Jinping geworben – und wurde dafür in Europa heftig kritisiert. Muss man jetzt feststellen, dass Macron Xi tatsächlich dazu gebracht hat, bei der Lösung des Kriegs in der Ukraine aktiver zu werden?
Dafür gibt es schlicht bislang keine Belege. Es spricht viel dafür, dass es der gemeinsame europäische Druck war, und die Gespräche von Sanchez, Macron, Ursula von der Leyen und Annalena Baerbock in Peking dann lediglich der letzte Katalysator waren. Ob Macron und Xi bilateral weitere Schritte schon skizziert haben, und ob diese tragfähig sind, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.
Wie ernst meint es China mit seinen Bemühungen?
China ist ernst zu nehmen, wenn es beispielsweise um das Thema nukleare Sicherheit oder humanitärer Hilfe geht. Peking ist heute schon Teil der Konfliktkonstellation und wird es auch bleiben – deshalb ist es wichtig, dass beispielsweise diplomatische Kontakte wieder aufgenommen wurden.
Andererseits glauben viele Experten, dieser Krieg nutze China: billiges Öl und Gas aus Russland, ein schwacher Juniorpartner Moskau und die Ablenkung der USA.
Dass China von einem langen Krieg in der Ukraine profitieren würde, ist eine durchweg zynische Interpretation der Lage. Ich glaube, China ist klug genug, sich mit einer solchen Haltung nicht langfristig von Europa abzukehren. Gleichzeitig will China aber auch Russland und insbesondere Putin so weit wie möglich unterstützen. Bei aller Skepsis und Sorge, bleibt es sinnvoll und notwendig, mit Peking im engen Austausch zu bleiben.
Putin so weit wie möglich unterstützen? Dann hat sich an Chinas Haltung also gar nichts verändert?
Richtig. Grundsätzlich hat sich an Chinas Haltung nichts geändert.
Im Westen ist man denn auch skeptisch. Wie könnte Xi “beweisen”, dass er kein Verbündeter Putins ist, sondern ernsthaft an Frieden interessiert?
Es ist überhaupt nicht im Interesse Pekings zu beweisen, dass man kein Verbündeter Putins ist. Vielmehr hat man klar formuliert, dass China und Russland auf einer Seite stehen. Daran sollte niemand ernsthaft Zweifel haben. Aber Peking bleibt ein zentraler Akteur und kann Teil einer Vermittlungslösung sein. Wie sehr Chinas Verhalten dann aber im ukrainischen oder gar im europäischen Interesse ist, bleibt mehr als fraglich.
Was sind die größten Probleme für China als Friedensvermittler?
China muss klare Vorbedingungen benennen für einen Waffenstillstand oder für die Rückführung von Truppen. Hier müsste China auch klare Forderungen an Putin stellen – und das tut Xi im Moment nicht. Ein anderes Riesenproblem ist, dass China noch immer nicht von Krieg, sondern nur von einer Krise spricht. Auch dass Peking eine beidseitige Verantwortung für den Krieg sieht, bleibt zutiefst problematisch.
In anderen Regionen und Konflikten ist China derzeit sehr erfolgreich als Vermittler, zum Beispiel im Konflikt zwischen Iran und Saudi-Arabien.
Das stimmt. Aber der Ukrainekrieg ist von einem ganz anderen Kaliber, vor allem im Vergleich zu Gesprächen zwischen Iran und Saudi-Arabien, wo China wenig Substanzielles beigetragen hat über die Gastgeber-Rolle hinaus. Aber ja, wir werden wohl in der Zukunft an China nicht als Akteur bei der Bearbeitung von globalen Konfliktherden vorbeikommen. Aber nochmals: Der Ukrainekrieg ist von einem ganz anderen Kaliber.
Der erfahrene Außenpolitiker Norbert Röttgen hat im Interview mit Table.Media eindringlich davor gewarnt, China in die europäische Sicherheitsarchitektur einzubinden. Liegt er falsch?
Nein, er liegt vollkommen richtig. China stellt an vielen Stellen eine sicherheitspolitische Herausforderung für Europa dar.
Also China soll in der Ukraine vermitteln – und damit hat Peking seine Schuldigkeit getan?
Nein. Ich sehe ein anderes Problem: Es ist unwahrscheinlich, dass China im ukrainischen und europäischen Interesse auftreten würde. Chinas Sicht auf die europäische Sicherheitsordnung ist russischen Vorstellungen deutlich näher als unseren.
Wie sollte nun die deutsche Regierung reagieren?
Den Worten müssen Taten folgen – das müssen europäische Regierungen nun genau nachverfolgen, etwa bei humanitären Fragen. Auch Kontakt zum chinesischen Sondergesandten ist wichtig. Aber man muss weiterhin mit größter Vorsicht hinschauen, ob sich an der eigentlichen Position Chinas überhaupt etwas ändert. Denn die dem chinesischen Vorstoß zugrundeliegende strategische Position liegt bislang nicht in unserem europäischen Interesse.
Mikko Huotari ist der Direktor des Mercator Institute for China Studies (Merics) in Berlin.
02.05.2023, 09:00 Uhr (15:00 Uhr Beijing time)
German Chamber of Commerce, Hong Kong, Online-Seminar: Hongkong als Markt für bayerische Lebensmittel Mehr
02.05.2023, 17:00 Uhr (23:00 Uhr Beijing time)
Center for Strategic & International Studies, Webinar: Chinese Assessments of the Soviet Union’s Collapse Mehr
02.05.2023, 18:00 Uhr
Zentrum für Osteuropa- und Internationale Studien, Vortrag (vor Ort in Berlin): Silk Road Talk: China in Eastern Europe: Challenges and Opportunities Mehr
02.05.2023, 19:00 Uhr
Konfuzius-Institut Bonn, Vortrag (vor Ort): Künstliche Intelligenz: Verstehen natürlicher Sprache als Herausforderung internationaler Forschung Mehr
02.05.2023, 18:30 Uhr
Konfuzius-Institut Trier, Vortrag (vor Ort): Kosmopolitische Ethik – die konfuzianische Tradition Mehr
03.05.2023, 22:00 Uhr (04.05., 04:30 Uhr Beijing time)
Fairbank Center for Chinese Studies, Webinar: The Tormented Alliance: American Servicemen and the Occupation of China, 1941-1949 Mehr
04.05.2023, 18:00 Uhr (05.05., 00:00 Uhr Beijing time)
Konfuzius-Institut Nürnberg-Erlangen, Vortrag: Buddhismus in China zwischen Politik, Tourismus und Volksreligion Mehr
04.05.2023, 19:00 Uhr (05.05., 01:00 Uhr Beijing time)
Friedrich-Naumann-Stiftung und VHS Stuttgart, Diskussion: Gefährdete Demokratie Taiwan: Ein Land zwischen außenpolitischen Herausforderungen und demokratischen Innovationen Mehr
04.05.2023, 15:45 Uhr
Dezan Shira & Associates, Vortrag und Networking (vor Ort in München): Remote Workers: A legal and tax perspective within the current European and Asian framework Mehr
04.05.2023, 15:00 Uhr (21:00 Uhr Beijing time)
Center for Strategic & International Studies, Webcast: Allies and Geopolitical Competition in the Indo-Pacific Region Mehr
07.05.2023, 11:00-18:00 Uhr
Konfuzius-Institut Uni Heidelberg, Ausstellung: Comics aus China: Das literarische Erbe Mehr
BASF-Vorstandschef Martin Brudermüller hat bei der Aktionärsversammlung des DAX-Konzerns harte Kritik für seine China-Strategie einstecken müssen. Im Fokus steht eine Zehn-Milliarden-Investition in einen neuen Verbundstandort in China.
Arne Rautenberg, Fondsmanager bei Union Investment, die als Großaktionär die Interessen von 5,8 Millionen Anlegern vertritt, verwies auf den russischen Angriff auf die Ukraine. Dieser habe gezeigt, “wie schnell geopolitische Albträume” Realität werden könnten. An Brudermüller gerichtet sagte er: “Doch Sie halten unbeirrt an Ihrer China-Strategie fest, die am Kapitalmarkt als Hochrisikostrategie gesehen wird, da ein möglicher Angriff Chinas auf Taiwan zu einem Totalverlust des China-Geschäfts führen könnte.“
Haiyuer Kuerban vom Weltkongress der Uiguren (WUC) verwies auf die Menschenrechtslage in der autonomen Region Xinjiang und die Gefahr einer Verstrickung von BASF in dortige Zwangsarbeitsysteme. “Die BASF hat wiederholt versichert, dass es in ihren Joint Ventures zu keiner Zwangsarbeit käme und dass Überprüfungen durchgeführt worden seien. Allerdings schließt die Ethnical Trading Initiative eine unabhängige Überprüfung der Arbeitsbedingungen aufgrund der weitreichenden Repression aus”, sagte Kuerban. BASF verwies auf interne Prüfungen und auf “konkrete Gespräche” mit einem externen Prüfer über Audits in der Zukunft.
BASF betreibt in der Industriezone der Stadt Korla zwei Joint Ventures. Laut offiziellen chinesischen Dokumenten wurden tausende uigurische Arbeiter unfreiwillig dorthin transferiert, um dort unter Bedingungen arbeiten zu müssen, die im Verdacht der Zwangsarbeit stehen. “Nach unserem Kenntnisstand”, hieß es seitens des Vorstandes, seien in keinem der beiden Gemeinschaftsunternehmen Uiguren beschäftigt. Der für China zuständige Vorstand Markus Kamieth betonte, das Unternehmen vertrete “sehr hohe ethische Standards”. Das gelte für alle Niederlassungen, auch jene in Xinjiang.
Haiyuer Kuerban vom Weltkongress der Uiguren hingegen äußerte weitere Bedenken. “Zudem besorgt uns, dass der BASF Joint-Venture-Partner Xinjang Markor Chemikal indirekt im Besitz der Xinjiang Zhongtai Group ist. Diese ist aktiv an den uigurischen Arbeitstransfers der chinesischen Regierung beteiligt sowie an Indoktrinierung und Überwachung von uigurischen Arbeitern”.
Ungeachtet der Kritik sagte Brudermüller, dass BASF in China weiterhin wachsen wolle. In der Volksrepublik erwirtschafte die Chemieindustrie die Hälfte ihrer Umsätze. Bei BASF steht China jedoch für weniger als 15 Prozent des Gesamtumsatzes des Unternehmens. China ist so gesehen für das Unternehmen noch untergewichtet.
Tilman Massa vom Dachverband Kritische Aktionäre zeigte sich enttäuscht von Brudermüller. “Er hat zu den großen geopolitischen Risiken des China-Engagements keine Stellung bezogen. Eine mögliche militärische Eskalation wegen Taiwan hat er als rein hypothetisch abgetan“, sagte Massa.
Mögliche Konsequenzen drohen BASF an den Finanzmärkten. Beispielsweise, wenn Union Investment und andere Großinvestoren BASF-Titel aus ihren Nachhaltigkeitsfonds nehmen sollten. Sie könnten damit eine mögliche Lawine lostreten, wenn Aktionäre auf breiter Front über die Investierbarkeit von Wertpapieren des Unternehmens unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten nachdenken.
Mit einer solchen Entwicklung muss sich möglicherweise auch der Autobauer Volkswagen auseinandersetzen. Die Fondsgesellschaft Deka hat die Aktie von VW wegen seines Engagements in Xinjiang bereits aus dem Nachhaltigkeitssegment geworfen. grz
Die nächsten deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen werden im Juni stattfinden, wie aus Regierungskreisen zu hören ist. Dabei handelt es sich um ein Präsenztreffen eines Großteils der Kabinettsministerinnen und -minister beider Seiten. Der genaue Termin soll der 20. Juni sein, wird in Berlin gemunkelt.
Die Regierungskonsultationen finden seit 2011 regelmäßig statt. Während der Pandemie war das Treffen virtuell angelegt. Im vergangenen Jahr fanden keine Konsultationen statt. Ziel ist ein persönlicher Austausch der Minister und hohen Fachbeamten. Kritiker sehen in dem groß angelegten Treffen vor allem einen PR-Erfolg für Peking, das die besondere Partnerschaft mit Deutschland zelebriert. Deutschland pflegt solche Konsultationen vor allem mit europäischen Nachbarn wie Frankreich, Italien und Polen. International gibt es sie mit Japan, Israel, Indien und Brasilien.
Seit den sechsten Konsultationen haben sich das Klima und die Themen stark gewandelt. Im Jahr 2021 saßen als Regierungschefs noch Angela Merkel und Li Keqiang am Tisch, die sich noch einem partnerschaftlicheren Geist verpflichtet fühlten. Zwischen den Ministern der Ampelkoalition und Li Qiang dürfte ein deutlich robusteres Gesprächsklima herrschen. Neben Sachfragen wird es zudem auch um aufgeladene Konfliktpunkte wie den Krieg in der Ukraine gehen.
Im Vorfeld der Konsultationen sind vorbereitende Besuche von Ressortchefs und Fachbeamten in Peking und Berlin geplant. Die aktuelle Tour des Handelsministers Wang Wentao dürfte in diesen Zusammenhang fallen. fin
Die Bundesregierung denkt offenbar darüber nach, den Export von Chemikalien zur Halbleiter-Herstellung nach China zu begrenzen. Die Ampel-Regierung berate zudem über weitere Exportbeschränkungen mit Hinblick auf die Chipindustrie, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Das Vorgehen falle in den Kontext der geplanten China-Strategie der Bundesregierung. Als möglicherweise betroffene Hersteller werden Merck und BASF genannt.
Die USA wollen China global von Lieferungen von Hochtechnik für die Produktion modernster Mikrochips abschneiden. Die Niederlande und Japan machen bereits mit. Die deutsche Bundesregierung hat sich nicht pauschal angeschlossen, obwohl einige relevante Unternehmen in Deutschland sitzen. Sie setzt auf Einzelfallentscheidungen durch das Wirtschaftsministerium. fin
Die chinesische Staatsführung hat mehr als 1.300 Staatsbürger aus dem Sudan in Sicherheit gebracht, nachdem vor knapp zwei Wochen schwere Kämpfe zwischen Paramilitärs und Regierungstruppen ausgebrochen sind. Wie Außenamtssprecherin Mao Ning versicherte, habe ein Teil den Sudan bereits an Bord chinesischer Marineschiffe verlassen. Es befänden sich nur noch wenige Chinesen außerhalb von Khartum im Sudan. Nach Berichten in Staatsmedien gelangten 300 chinesische Staatsbürger über Land in Nachbarländer.
Chinas Marine hatte mehrere Schiffe entsandt, wie das Verteidigungsministerium in Peking berichtete. In sozialen Medien waren Videos zu sehen, in denen Chinesen im Hafen darauf warten, an Bord gehen zu können. Wie die Außenamtssprecherin sagte, sei bei der Evakuierung auch Staatsbürgern aus fünf anderen Ländern geholfen worden. Wie viele Marineschiffe an dem Einsatz beteiligt sind, sagte die Außenamtssprecherin nicht. flee

Michael Schumann findet es arrogant, wenn sich deutsche Politiker, Medienvertreter und Meinungsbildner auf Deutschlands gutem Image in der Welt ausruhen und Länder wie China verurteilen, ohne sich intensiver mit ihnen befasst zu haben. Die Kritik äußerte er in einem aktuellen TV-Berlin Gespräch mit Claudia Sünder und auch im Video-Call mit Table.Media.
Der Vorsitzende des Bundesverbands für Wirtschaftsförderung und Außenwirtschaft (BWA) schildert seine Beobachtungen und Bewertungen sachlich und begründet sie mit Erfahrungen, die er in seinem Berufsleben gemacht hat. Er habe tiefen Respekt für die Unterschiedlichkeit menschlicher Gesellschaften im Allgemeinen und der chinesischen Kultur im Speziellen. Eine Haltung, die sich durch sein vielfältiges Engagement zieht.
Schumann ist Mitgründer und Vorsitzender der China-Brücke, eines Public Diplomacy Forums für deutsch-chinesische Beziehungen. Dort beschäftigt er sich intensiv mit interkulturellen Barrieren und berät deutsche Unternehmen, die den chinesischen Markt erschließen wollen. Es gibt viele Herausforderungen – wie zum Beispiel die langen Antragszeiten bei der Visavergabe für chinesische Geschäftspartner, die Risikobewertung in der geopolitisch angespannten Situation, oder die Frage, wie man gutes Personal für eine Region gewinnen kann, über die Medien größtenteils sehr negativ berichten.
Als Beispiel nennt Schumann die Berichterstattung über die Pandemie: “Das gegenwärtige Narrativ zu den letzten drei Jahren Pandemie in China wird dominiert durch die Aussage, die chinesische Corona-Politik sei furchtbar gewesen und letztendlich gescheitert”, sagt Schumann. Aber man dürfe nicht verkennen, dass es in zwei von diesen drei Jahren in China Verhältnisse gegeben habe, in denen viele Chinesen ein relativ normales Leben führen konnten – und das, “während wir hier bei uns im Lockdown saßen”.
Stichwort Wettbewerb der Systeme: “Warum nimmt Deutschland sich China in bestimmten Bereichen nicht zum Vorbild, wenn es darum geht, voneinander zu lernen?”, fragt Schumann. In einem staatlich subventionierten Programm der State Administration of Foreign Experts Affairs habe China beispielsweise tausende Führungskräfte aus Unternehmen, Verwaltung und Politik viele Jahre lang für zweiwöchige Theorie- und Praxisprogramme ins Ausland geschickt. Das Ziel: anhand bestimmter Themen mögliche Impulse analysieren, was die eigene Gesellschaft besser macht. “Da haben die chinesischen Teilnehmer etwa am Beispiel des deutschen Steuerwesens begierig aufgenommen, was wir unter einem Weißbuch oder einem Schwarzbuch verstehen”, erinnert sich der 52-Jährige. “Und überlegt, wie so etwas in das chinesische System integriert werden könnte.”
Den ersten Kontakt zu China hatte Schumann 2010 bei der Vorbereitung der Weltausstellung Expo in Shanghai, für die er deutsche Innovationen auswählen sollte. Der Eindruck war so prägend, dass er kurz darauf in Shanghai das Büro des Bundesverbandes für Wirtschaftsförderung und Außenwirtschaft eröffnete. Diesen hatte er 2006 mit aufgebaut.
Wenn Schumann für deutsche Firmen Kontakte zu chinesischen Institutionen und Entscheidungsträgern herstellt, oder namhafte chinesische Konzerne nach Deutschland führt, dann tut er dies immer nach dem Prinzip: hingehen, zuhören und Vertrauen aufbauen. China hat er inzwischen mehr als hundertmal bereist. Schumann ist mit einer Chinesin verheiratet und hat insgesamt fünf Jahre in Shanghai gelebt. Janna Degener-Storr
Shao Ping Guan wird neuer Head of China Equity bei Allianz Global Investors. Ab dem 1. Juli wird er von Hongkong aus das Portfoliomanagement für chinesische Aktienstrategien verantworten. Er folgt auf Anthony Wong.
Michael Schalk ist seit Februar 2023 Pressesprecher Produktion, Logistik und Standorte China für die Audi AG.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Handarbeit ist nicht unbedingt ein Zeichen von technischer Unterentwicklung. Wie die meisten Reisbauern im Süden Chinas schwören auch diese Farmer im Kreis Yuping-Dong, Provinz Guizhou, auf die von Menschen angelegten Reisterrassen. Schweres Gerät lässt sich auf den kleinen Parzellen kaum einsetzen. Die Bauern bringen dennoch mehrere Ernten im Jahr ein – indem sie die Felder so sorgfältig pflegen wie hier.
einmal mehr zeigt sich: Die Elektro-Revolution kommt aus China. Während bereits jetzt jeder vierte Neuwagen in der Volksrepublik elektrisch fährt, davon 80 Prozent aus chinesischer Fabrikation, hat der Batteriehersteller CATL aus Ningde auf der Automesse in Shanghai mit einer weiteren Sensation überrascht: CATL präsentierte einen Akku, in dem pro Kilogramm Batteriezelle 500 Wattstunden Strom gespeichert werden können. Bisherige Batterien kommen maximal auf die Hälfte.
Das schafft völlig neue Möglichkeiten der Elektrifizierung, etwa für Kleinwagen oder rein elektrisch betriebene LKW, sogar E-Flugzeuge. Bisher waren die Speicher dafür zu schwer. Noch in diesem Jahr will CATL mit der Produktion starten. Und, das ist die zweite positive Nachricht, analysiert Christian Domke-Seidel: Auch die europäischen Standorte von CATL sollen mit einbezogen werden.
Technisch immer innovativer, ansonsten aber immer repressiver – das zeigt sich mit der Änderung des Gesetzes zum Kampf gegen Spionage, das der Volkskongress verabschiedet hat. Mit der Änderung sollen nicht mehr nur Staatsgeheimnisse, sondern auch vage definierte “nationale Interessen” geschützt werden. Schon müssen auch ausländische Unternehmen in China Auswirkungen befürchten, schreibt unser Autor Fabian Kretschmer. Denn es sind vor allem diese vagen Formulierungen in Gesetzen, die China einmal mehr zu einem unberechenbaren Willkürstaat machen.
Bleiben Sie dennoch zuversichtlich!


Kein anderes Bauteil entscheidet so sehr über den Erfolg der E-Mobilität wie der Akku. Er ist es, der das Auto teuer macht. Außerdem reduzieren viele Kunden die Frage nach der Alltagstauglichkeit eines E-Autos auf Reichweite und Ladedauer. Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) ist dabei ein Durchbruch gelungen.
Das chinesische Unternehmen aus Ningde, Provinz Fujian, hat es geschafft, die Natrium-Ionen-Batterie zur Großserienreife zu bringen. Sie ist deutlich günstiger, robuster gegen Temperaturschwankungen und weniger rohstoffintensiv, wie ein CATL-Techniker gegenüber China.Table erläutert. Das kann auch Auswirkungen auf die europäischen Standorte des Konzerns haben.
Selbst viele Besucher der Automesse in Shanghai dürften die riesige Tragweite der Präsentation nicht ganz erfasst haben: Im Vorfeld der Messe zeigte der Hersteller Chery seine neue Marke iCar samt zweier neuer Fahrzeuge: den iCar GT (ein flacher Elektro-Sportwagen) und den iCar 03 (ein Kompakt-SUV mit 4,2 Metern Länge). Eine Natrium-Ionen-Batterie liefert den Fahrzeugen den benötigten Strom. Die Großserienproduktion dieser Technologie hatte CATL erst wenige Tage davor verkündet.
Die Entwicklung könnte dem globalen Elektroautomarkt einen enormen Schub verleihen. Denn Natrium-Ionen-Akkus lösen zentrale Probleme, die bei Lithium-Ionen-Akkus bestehen.
Der vergleichsweise geringe Preis macht Natrium-Ionen-Akkus vor allem für Klein- und Kompaktwagen interessant – also in Fahrzeugklassen mit hohen Absatzzahlen, in denen die Elektrifizierung noch nicht so weit vorangeschritten ist. Das dürfte innerhalb kürzester Zeit zu spürbaren Skaleneffekten führen. Nach CATL-Angaben sind nun aufgrund des geringen Gewichts bei sehr viel höherer Leistung selbst E-Flugzeuge möglich.
Auch BYD soll bereits kurz vor dem Großserieneinsatz eines Natrium-Ionen-Akku stehen. Angeblich will der Hersteller den Akku ab der zweiten Jahreshälfte 2023 in den Modellen Qin, Dolphin und Seagull verbauen. Offiziell bestätigt hat die Marke das allerdings noch nicht. Es handelt sich lediglich um Informationen von Insidern.
Allerdings schöpft die Natrium-Ionen-Batterie ihr Potenzial in der Praxis noch nicht aus. Die Energiedichte der Natrium-Ionen-Batteriezelle der ersten Generation von CATL liegt bei bis zu 160 Wattstunden pro Kilogramm. Doch herkömmliche Lithium-Ionen-Akkus erreichen bereits rund 200 Wattstunden pro Kilogramm. Ein Wert, den CATL in der nächsten Generation an Natrium-Ionen-Akkus einholen will.
Um diesen Schwachpunkt kurzfristig auszugleichen, liefert CATL zunächst eine Kombination aus Natrium- und Lithium-Ionen-Akkus aus. Während die Natrium-Technik jedoch erst ganz am Anfang steht und bis zu 500 Wattstunden pro Kilogramm erreichen kann, ist die Lithium-Technik bereits weitgehend ausgereizt.
Ein anderes, grundsätzliches Problem mit Natrium-Ionen-Akkus scheinen die CATL-Techniker gelöst zu haben. Es handelt sich um das Problem des amorphen Kohlenstoffs (auch “Hard Carbon” genannt) an der Anode. Bislang konnten große Hersteller wie BYD und eben CATL nicht verhindern, dass durch den Einsatz dieses Materials beim ersten Laden rund ein Fünftel der Batteriekapazität verloren ging.
Einen genauen Einblick, wie der chinesische Weltmarktführer das Problem lösen konnte, gibt der Techniker im Interview nicht. Er sagt nur: “CATL hat ein Hard Carbon entwickelt, das sich durch eine einzigartige poröse Struktur auszeichnet.” Das Problem des Leistungsverlustes ist damit offenbar beherrscht.
Die Investition von CATL in Europa hat bereits für einige Schlagzeilen gesorgt. An beiden europäischen Standorten können problemlos auch die neuen Technologien hergestellt werden. “Die Natrium-Ionen-Batterie hat einen ähnlichen Herstellungsprozess wie die Lithium-Ionen-Batterie, was bedeutet, dass wir mithilfe unserer flexiblen Produktionslinien schnell von der Lithium-Ionen-Batterie zur Natrium-Ionen-Batterie wechseln können”, so der Techniker im Interview mit China.Table. Bei den Produktionslinien gäbe es einen globalen Standard.
Auch einen weiteren Flaschenhals bei der Rohstofflieferung löst die Natrium-Ionen-Zelle auf. In der Produktion braucht es nicht nur kein Lithium, sondern auch kein Nickel oder Kobalt – alles knappe Waren. CATL selbst werde seine Produktion ausschließlich an der Nachfrage orientieren. Jetzt müssen also nur noch die Bestellungen hereinkommen.
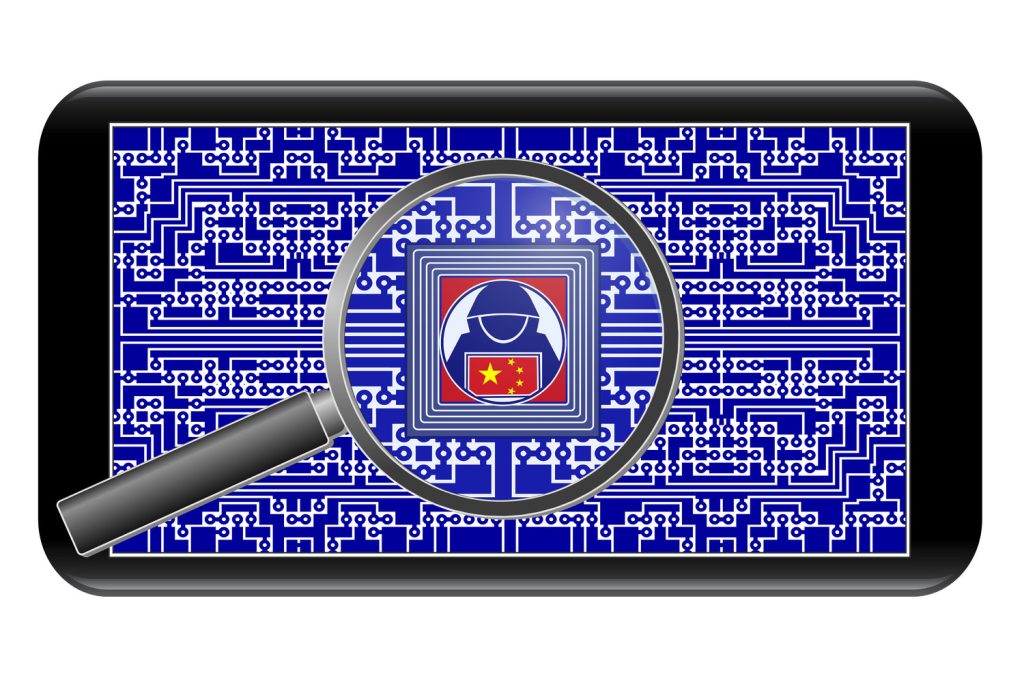
Am Donnerstag hat der Ständige Ausschuss des Volkskongresses eine Überarbeitung des sogenannten “Anti-Spionage-Gesetzes” verabschiedet. Das Dokument sieht eine massive Ausweitung der Befugnisse der Staatssicherheit vor, die künftig leichter Razzien und Festnahmen ohne Gerichtsbeschluss durchführen kann.
Damit erhält eine bereits verbreitete Praxis ihre gesetzliche Grundlage. Schon seit Tagen kursierten die Gerüchte, nun sind sie offiziell bestätigt: Die Sicherheitsbehörden in Shanghai haben eine Razzia in den Räumen der China-Tochter der US-Unternehmensberatung Bain durchgeführt und dabei Laptops und Smartphones konfisziert. Einige Mitarbeiter sprachen gar von mehreren unangekündigten Besuchen.
Worum es bei den Ermittlungen geht, ist bislang nicht bekannt. Der betroffene Konzern hat lediglich mitgeteilt, dass man “mit den chinesischen Behörden kooperieren” werde. Doch der Verdacht liegt nahe, dass die Gängelung von US-Unternehmen politisch motiviert ist.
Vor allem aber definiert das Gesetz den Strafbestand der Spionage neu: So sollen nicht mehr nur Staatsgeheimnisse geschützt werden, sondern sämtliche Dokumente oder Dateien, welche die “nationalen Interessen” berühren. Letztere sind jedoch derart vage formuliert, dass sie den Behörden Spielraum für eine willkürliche Anwendung geben. Jene Ambivalenz ist von der kommunistischen Partei gewollt: Sie erzeugt eine diffuse Angst, die schlussendlich zu vorauseilendem Gehorsam führt. Niemand weiß schließlich, wo genau die roten Linien verlaufen.
Das Gesetz verunsichert damit auch in China tätige ausländische Unternehmen. Gewöhnliche Marktanalysen können als Spionage ausgelegt, Interviews mit westlichen Journalisten als Bedrohung für die nationale Sicherheit gedeutet werden.
Europäische Unternehmen dürften zwar vorerst nicht primär ins Visier der Behörden geraten, da die chinesische Regierung seit einigen Monaten eine regelrechte Charme-Offensive gegenüber ihrem größten Handelspartner fährt. Doch sollten die politischen Beziehungen sich verschlechtern – etwa, wenn die deutsche Bundesregierung eine neue China-Strategie vorlegt -, dann könnte das Anti-Spionage-Gesetz eine willkommene Steilvorlage für ökonomische Vergeltungsschläge bilden.
Dass es sich dabei nicht um unbegründete Paranoia handelt, zeigt eine ganze Liste an Beispielen: Im März traf es einen Mitarbeiter des japanischen Pharmakonzerns Astella, der wegen Spionage verhaftet wurde. Im selben Monat schlossen die Behörden das Pekinger Büro der US-amerikanischen Mintz Group, die sogenannte Prüfungen der Einhaltung rechtlicher Vorschriften für Unternehmensverkäufe und Börsengänge durchführt. Sämtliche der fünf Angestellten in Festlandchina wurden wegen “rechtswidriger Geschäftstätigkeiten” verhaftet. Zum Zeitpunkt der Verhaftung hatte das Unternehmen keinerlei Informationen darüber, dass überhaupt ein Verfahren läuft.
Und da solche Prozesse – mit Hinweis auf die nationale Sicherheit – stets hinter verschlossenen Türen stattfinden und auch Diplomaten keinen Zugang erhalten, ist oftmals gar nicht ersichtlich, ob die Vorwürfe überhaupt begründet sind. Denn es ist mehr als auffällig, dass es nahezu immer Firmen aus denjenigen Ländern trifft, deren Beziehungen zu China kürzlich eskaliert sind.
“Sicherheit” ist seit einigen Jahren bereits das wohl am häufigsten verwendete Schlagwort von Staatschef Xi Jinping, der damit innerhalb der Bevölkerung ein Gefühl der latenten Bedrohung schafft. Sowohl im Außen als auch Inneren kann jederzeit ein potenzieller Staatsfeind lauern, lautet die Botschaft. In Staatsunternehmen ist es längst Usus, die Belegschaft diffus vor ausländischen Spionen zu warnen. Auch ausländische Journalisten werden nicht selten von den Staatsmedien als potenzielle Geheimdienstmitarbeiter porträtiert.
Es ist ein schmaler Grat zwischen Sicherheitswahn und wirtschaftlichen Ambitionen: Gleichzeitig nämlich versucht die Regierung auch, die Handelsbeziehungen zum Ausland nach der ökonomisch katastrophalen Null-Covid-Isolation aktiv zu fördern. Den wieder eintrudelnden Geschäftsdelegationen wird dieser Tage sprichwörtlich der rote Teppich ausgerollt, damit die großen Konzerne bloß nicht ihre Produktion von China nach Indien oder Südostasien abziehen. Fabian Kretschmer

Mehr als ein Jahr lang hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj um ein Gespräch mit Xi Jinping gebeten. Nun hat es endlich geklappt. Wie überraschend kam der Anruf von Xi bei Selenskyj?
Nicht sonderlich überraschend. Der Anruf war lange geplant, von chinesischer Seite hieß es zuletzt ja auch öffentlich, es würde zu gegebenem Zeitpunkt einen solchen Anruf geben. Zudem war es seit fast einem Jahr eine der zentralen Forderungen der Europäischen Union.
Aber warum ausgerechnet jetzt? Was hat sich verändert?
Zum einen verändert sich die Lage in der Ukraine. Zum anderen stehen wichtige Ereignisse an, wie der G7-Gipfel und europäische Debatten zur Zukunft Chinapolitik. Hier musste China etwas Druck wegnehmen und sich positionieren. Mit diesem Schritt versucht Peking natürlich auch wieder den Ball ins europäische Camp zu spielen: “Eure Forderung haben wir erfüllt, jetzt seid Ihr dran”. Peking versucht sich weiterhin als verantwortungsvoller Akteur zu präsentieren.
Oder hat es vielleicht auch etwas mit Emmanuel Macron zu tun? Frankreichs Präsident hat in Peking ja intensiv um Xi Jinping geworben – und wurde dafür in Europa heftig kritisiert. Muss man jetzt feststellen, dass Macron Xi tatsächlich dazu gebracht hat, bei der Lösung des Kriegs in der Ukraine aktiver zu werden?
Dafür gibt es schlicht bislang keine Belege. Es spricht viel dafür, dass es der gemeinsame europäische Druck war, und die Gespräche von Sanchez, Macron, Ursula von der Leyen und Annalena Baerbock in Peking dann lediglich der letzte Katalysator waren. Ob Macron und Xi bilateral weitere Schritte schon skizziert haben, und ob diese tragfähig sind, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.
Wie ernst meint es China mit seinen Bemühungen?
China ist ernst zu nehmen, wenn es beispielsweise um das Thema nukleare Sicherheit oder humanitärer Hilfe geht. Peking ist heute schon Teil der Konfliktkonstellation und wird es auch bleiben – deshalb ist es wichtig, dass beispielsweise diplomatische Kontakte wieder aufgenommen wurden.
Andererseits glauben viele Experten, dieser Krieg nutze China: billiges Öl und Gas aus Russland, ein schwacher Juniorpartner Moskau und die Ablenkung der USA.
Dass China von einem langen Krieg in der Ukraine profitieren würde, ist eine durchweg zynische Interpretation der Lage. Ich glaube, China ist klug genug, sich mit einer solchen Haltung nicht langfristig von Europa abzukehren. Gleichzeitig will China aber auch Russland und insbesondere Putin so weit wie möglich unterstützen. Bei aller Skepsis und Sorge, bleibt es sinnvoll und notwendig, mit Peking im engen Austausch zu bleiben.
Putin so weit wie möglich unterstützen? Dann hat sich an Chinas Haltung also gar nichts verändert?
Richtig. Grundsätzlich hat sich an Chinas Haltung nichts geändert.
Im Westen ist man denn auch skeptisch. Wie könnte Xi “beweisen”, dass er kein Verbündeter Putins ist, sondern ernsthaft an Frieden interessiert?
Es ist überhaupt nicht im Interesse Pekings zu beweisen, dass man kein Verbündeter Putins ist. Vielmehr hat man klar formuliert, dass China und Russland auf einer Seite stehen. Daran sollte niemand ernsthaft Zweifel haben. Aber Peking bleibt ein zentraler Akteur und kann Teil einer Vermittlungslösung sein. Wie sehr Chinas Verhalten dann aber im ukrainischen oder gar im europäischen Interesse ist, bleibt mehr als fraglich.
Was sind die größten Probleme für China als Friedensvermittler?
China muss klare Vorbedingungen benennen für einen Waffenstillstand oder für die Rückführung von Truppen. Hier müsste China auch klare Forderungen an Putin stellen – und das tut Xi im Moment nicht. Ein anderes Riesenproblem ist, dass China noch immer nicht von Krieg, sondern nur von einer Krise spricht. Auch dass Peking eine beidseitige Verantwortung für den Krieg sieht, bleibt zutiefst problematisch.
In anderen Regionen und Konflikten ist China derzeit sehr erfolgreich als Vermittler, zum Beispiel im Konflikt zwischen Iran und Saudi-Arabien.
Das stimmt. Aber der Ukrainekrieg ist von einem ganz anderen Kaliber, vor allem im Vergleich zu Gesprächen zwischen Iran und Saudi-Arabien, wo China wenig Substanzielles beigetragen hat über die Gastgeber-Rolle hinaus. Aber ja, wir werden wohl in der Zukunft an China nicht als Akteur bei der Bearbeitung von globalen Konfliktherden vorbeikommen. Aber nochmals: Der Ukrainekrieg ist von einem ganz anderen Kaliber.
Der erfahrene Außenpolitiker Norbert Röttgen hat im Interview mit Table.Media eindringlich davor gewarnt, China in die europäische Sicherheitsarchitektur einzubinden. Liegt er falsch?
Nein, er liegt vollkommen richtig. China stellt an vielen Stellen eine sicherheitspolitische Herausforderung für Europa dar.
Also China soll in der Ukraine vermitteln – und damit hat Peking seine Schuldigkeit getan?
Nein. Ich sehe ein anderes Problem: Es ist unwahrscheinlich, dass China im ukrainischen und europäischen Interesse auftreten würde. Chinas Sicht auf die europäische Sicherheitsordnung ist russischen Vorstellungen deutlich näher als unseren.
Wie sollte nun die deutsche Regierung reagieren?
Den Worten müssen Taten folgen – das müssen europäische Regierungen nun genau nachverfolgen, etwa bei humanitären Fragen. Auch Kontakt zum chinesischen Sondergesandten ist wichtig. Aber man muss weiterhin mit größter Vorsicht hinschauen, ob sich an der eigentlichen Position Chinas überhaupt etwas ändert. Denn die dem chinesischen Vorstoß zugrundeliegende strategische Position liegt bislang nicht in unserem europäischen Interesse.
Mikko Huotari ist der Direktor des Mercator Institute for China Studies (Merics) in Berlin.
02.05.2023, 09:00 Uhr (15:00 Uhr Beijing time)
German Chamber of Commerce, Hong Kong, Online-Seminar: Hongkong als Markt für bayerische Lebensmittel Mehr
02.05.2023, 17:00 Uhr (23:00 Uhr Beijing time)
Center for Strategic & International Studies, Webinar: Chinese Assessments of the Soviet Union’s Collapse Mehr
02.05.2023, 18:00 Uhr
Zentrum für Osteuropa- und Internationale Studien, Vortrag (vor Ort in Berlin): Silk Road Talk: China in Eastern Europe: Challenges and Opportunities Mehr
02.05.2023, 19:00 Uhr
Konfuzius-Institut Bonn, Vortrag (vor Ort): Künstliche Intelligenz: Verstehen natürlicher Sprache als Herausforderung internationaler Forschung Mehr
02.05.2023, 18:30 Uhr
Konfuzius-Institut Trier, Vortrag (vor Ort): Kosmopolitische Ethik – die konfuzianische Tradition Mehr
03.05.2023, 22:00 Uhr (04.05., 04:30 Uhr Beijing time)
Fairbank Center for Chinese Studies, Webinar: The Tormented Alliance: American Servicemen and the Occupation of China, 1941-1949 Mehr
04.05.2023, 18:00 Uhr (05.05., 00:00 Uhr Beijing time)
Konfuzius-Institut Nürnberg-Erlangen, Vortrag: Buddhismus in China zwischen Politik, Tourismus und Volksreligion Mehr
04.05.2023, 19:00 Uhr (05.05., 01:00 Uhr Beijing time)
Friedrich-Naumann-Stiftung und VHS Stuttgart, Diskussion: Gefährdete Demokratie Taiwan: Ein Land zwischen außenpolitischen Herausforderungen und demokratischen Innovationen Mehr
04.05.2023, 15:45 Uhr
Dezan Shira & Associates, Vortrag und Networking (vor Ort in München): Remote Workers: A legal and tax perspective within the current European and Asian framework Mehr
04.05.2023, 15:00 Uhr (21:00 Uhr Beijing time)
Center for Strategic & International Studies, Webcast: Allies and Geopolitical Competition in the Indo-Pacific Region Mehr
07.05.2023, 11:00-18:00 Uhr
Konfuzius-Institut Uni Heidelberg, Ausstellung: Comics aus China: Das literarische Erbe Mehr
BASF-Vorstandschef Martin Brudermüller hat bei der Aktionärsversammlung des DAX-Konzerns harte Kritik für seine China-Strategie einstecken müssen. Im Fokus steht eine Zehn-Milliarden-Investition in einen neuen Verbundstandort in China.
Arne Rautenberg, Fondsmanager bei Union Investment, die als Großaktionär die Interessen von 5,8 Millionen Anlegern vertritt, verwies auf den russischen Angriff auf die Ukraine. Dieser habe gezeigt, “wie schnell geopolitische Albträume” Realität werden könnten. An Brudermüller gerichtet sagte er: “Doch Sie halten unbeirrt an Ihrer China-Strategie fest, die am Kapitalmarkt als Hochrisikostrategie gesehen wird, da ein möglicher Angriff Chinas auf Taiwan zu einem Totalverlust des China-Geschäfts führen könnte.“
Haiyuer Kuerban vom Weltkongress der Uiguren (WUC) verwies auf die Menschenrechtslage in der autonomen Region Xinjiang und die Gefahr einer Verstrickung von BASF in dortige Zwangsarbeitsysteme. “Die BASF hat wiederholt versichert, dass es in ihren Joint Ventures zu keiner Zwangsarbeit käme und dass Überprüfungen durchgeführt worden seien. Allerdings schließt die Ethnical Trading Initiative eine unabhängige Überprüfung der Arbeitsbedingungen aufgrund der weitreichenden Repression aus”, sagte Kuerban. BASF verwies auf interne Prüfungen und auf “konkrete Gespräche” mit einem externen Prüfer über Audits in der Zukunft.
BASF betreibt in der Industriezone der Stadt Korla zwei Joint Ventures. Laut offiziellen chinesischen Dokumenten wurden tausende uigurische Arbeiter unfreiwillig dorthin transferiert, um dort unter Bedingungen arbeiten zu müssen, die im Verdacht der Zwangsarbeit stehen. “Nach unserem Kenntnisstand”, hieß es seitens des Vorstandes, seien in keinem der beiden Gemeinschaftsunternehmen Uiguren beschäftigt. Der für China zuständige Vorstand Markus Kamieth betonte, das Unternehmen vertrete “sehr hohe ethische Standards”. Das gelte für alle Niederlassungen, auch jene in Xinjiang.
Haiyuer Kuerban vom Weltkongress der Uiguren hingegen äußerte weitere Bedenken. “Zudem besorgt uns, dass der BASF Joint-Venture-Partner Xinjang Markor Chemikal indirekt im Besitz der Xinjiang Zhongtai Group ist. Diese ist aktiv an den uigurischen Arbeitstransfers der chinesischen Regierung beteiligt sowie an Indoktrinierung und Überwachung von uigurischen Arbeitern”.
Ungeachtet der Kritik sagte Brudermüller, dass BASF in China weiterhin wachsen wolle. In der Volksrepublik erwirtschafte die Chemieindustrie die Hälfte ihrer Umsätze. Bei BASF steht China jedoch für weniger als 15 Prozent des Gesamtumsatzes des Unternehmens. China ist so gesehen für das Unternehmen noch untergewichtet.
Tilman Massa vom Dachverband Kritische Aktionäre zeigte sich enttäuscht von Brudermüller. “Er hat zu den großen geopolitischen Risiken des China-Engagements keine Stellung bezogen. Eine mögliche militärische Eskalation wegen Taiwan hat er als rein hypothetisch abgetan“, sagte Massa.
Mögliche Konsequenzen drohen BASF an den Finanzmärkten. Beispielsweise, wenn Union Investment und andere Großinvestoren BASF-Titel aus ihren Nachhaltigkeitsfonds nehmen sollten. Sie könnten damit eine mögliche Lawine lostreten, wenn Aktionäre auf breiter Front über die Investierbarkeit von Wertpapieren des Unternehmens unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten nachdenken.
Mit einer solchen Entwicklung muss sich möglicherweise auch der Autobauer Volkswagen auseinandersetzen. Die Fondsgesellschaft Deka hat die Aktie von VW wegen seines Engagements in Xinjiang bereits aus dem Nachhaltigkeitssegment geworfen. grz
Die nächsten deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen werden im Juni stattfinden, wie aus Regierungskreisen zu hören ist. Dabei handelt es sich um ein Präsenztreffen eines Großteils der Kabinettsministerinnen und -minister beider Seiten. Der genaue Termin soll der 20. Juni sein, wird in Berlin gemunkelt.
Die Regierungskonsultationen finden seit 2011 regelmäßig statt. Während der Pandemie war das Treffen virtuell angelegt. Im vergangenen Jahr fanden keine Konsultationen statt. Ziel ist ein persönlicher Austausch der Minister und hohen Fachbeamten. Kritiker sehen in dem groß angelegten Treffen vor allem einen PR-Erfolg für Peking, das die besondere Partnerschaft mit Deutschland zelebriert. Deutschland pflegt solche Konsultationen vor allem mit europäischen Nachbarn wie Frankreich, Italien und Polen. International gibt es sie mit Japan, Israel, Indien und Brasilien.
Seit den sechsten Konsultationen haben sich das Klima und die Themen stark gewandelt. Im Jahr 2021 saßen als Regierungschefs noch Angela Merkel und Li Keqiang am Tisch, die sich noch einem partnerschaftlicheren Geist verpflichtet fühlten. Zwischen den Ministern der Ampelkoalition und Li Qiang dürfte ein deutlich robusteres Gesprächsklima herrschen. Neben Sachfragen wird es zudem auch um aufgeladene Konfliktpunkte wie den Krieg in der Ukraine gehen.
Im Vorfeld der Konsultationen sind vorbereitende Besuche von Ressortchefs und Fachbeamten in Peking und Berlin geplant. Die aktuelle Tour des Handelsministers Wang Wentao dürfte in diesen Zusammenhang fallen. fin
Die Bundesregierung denkt offenbar darüber nach, den Export von Chemikalien zur Halbleiter-Herstellung nach China zu begrenzen. Die Ampel-Regierung berate zudem über weitere Exportbeschränkungen mit Hinblick auf die Chipindustrie, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Das Vorgehen falle in den Kontext der geplanten China-Strategie der Bundesregierung. Als möglicherweise betroffene Hersteller werden Merck und BASF genannt.
Die USA wollen China global von Lieferungen von Hochtechnik für die Produktion modernster Mikrochips abschneiden. Die Niederlande und Japan machen bereits mit. Die deutsche Bundesregierung hat sich nicht pauschal angeschlossen, obwohl einige relevante Unternehmen in Deutschland sitzen. Sie setzt auf Einzelfallentscheidungen durch das Wirtschaftsministerium. fin
Die chinesische Staatsführung hat mehr als 1.300 Staatsbürger aus dem Sudan in Sicherheit gebracht, nachdem vor knapp zwei Wochen schwere Kämpfe zwischen Paramilitärs und Regierungstruppen ausgebrochen sind. Wie Außenamtssprecherin Mao Ning versicherte, habe ein Teil den Sudan bereits an Bord chinesischer Marineschiffe verlassen. Es befänden sich nur noch wenige Chinesen außerhalb von Khartum im Sudan. Nach Berichten in Staatsmedien gelangten 300 chinesische Staatsbürger über Land in Nachbarländer.
Chinas Marine hatte mehrere Schiffe entsandt, wie das Verteidigungsministerium in Peking berichtete. In sozialen Medien waren Videos zu sehen, in denen Chinesen im Hafen darauf warten, an Bord gehen zu können. Wie die Außenamtssprecherin sagte, sei bei der Evakuierung auch Staatsbürgern aus fünf anderen Ländern geholfen worden. Wie viele Marineschiffe an dem Einsatz beteiligt sind, sagte die Außenamtssprecherin nicht. flee

Michael Schumann findet es arrogant, wenn sich deutsche Politiker, Medienvertreter und Meinungsbildner auf Deutschlands gutem Image in der Welt ausruhen und Länder wie China verurteilen, ohne sich intensiver mit ihnen befasst zu haben. Die Kritik äußerte er in einem aktuellen TV-Berlin Gespräch mit Claudia Sünder und auch im Video-Call mit Table.Media.
Der Vorsitzende des Bundesverbands für Wirtschaftsförderung und Außenwirtschaft (BWA) schildert seine Beobachtungen und Bewertungen sachlich und begründet sie mit Erfahrungen, die er in seinem Berufsleben gemacht hat. Er habe tiefen Respekt für die Unterschiedlichkeit menschlicher Gesellschaften im Allgemeinen und der chinesischen Kultur im Speziellen. Eine Haltung, die sich durch sein vielfältiges Engagement zieht.
Schumann ist Mitgründer und Vorsitzender der China-Brücke, eines Public Diplomacy Forums für deutsch-chinesische Beziehungen. Dort beschäftigt er sich intensiv mit interkulturellen Barrieren und berät deutsche Unternehmen, die den chinesischen Markt erschließen wollen. Es gibt viele Herausforderungen – wie zum Beispiel die langen Antragszeiten bei der Visavergabe für chinesische Geschäftspartner, die Risikobewertung in der geopolitisch angespannten Situation, oder die Frage, wie man gutes Personal für eine Region gewinnen kann, über die Medien größtenteils sehr negativ berichten.
Als Beispiel nennt Schumann die Berichterstattung über die Pandemie: “Das gegenwärtige Narrativ zu den letzten drei Jahren Pandemie in China wird dominiert durch die Aussage, die chinesische Corona-Politik sei furchtbar gewesen und letztendlich gescheitert”, sagt Schumann. Aber man dürfe nicht verkennen, dass es in zwei von diesen drei Jahren in China Verhältnisse gegeben habe, in denen viele Chinesen ein relativ normales Leben führen konnten – und das, “während wir hier bei uns im Lockdown saßen”.
Stichwort Wettbewerb der Systeme: “Warum nimmt Deutschland sich China in bestimmten Bereichen nicht zum Vorbild, wenn es darum geht, voneinander zu lernen?”, fragt Schumann. In einem staatlich subventionierten Programm der State Administration of Foreign Experts Affairs habe China beispielsweise tausende Führungskräfte aus Unternehmen, Verwaltung und Politik viele Jahre lang für zweiwöchige Theorie- und Praxisprogramme ins Ausland geschickt. Das Ziel: anhand bestimmter Themen mögliche Impulse analysieren, was die eigene Gesellschaft besser macht. “Da haben die chinesischen Teilnehmer etwa am Beispiel des deutschen Steuerwesens begierig aufgenommen, was wir unter einem Weißbuch oder einem Schwarzbuch verstehen”, erinnert sich der 52-Jährige. “Und überlegt, wie so etwas in das chinesische System integriert werden könnte.”
Den ersten Kontakt zu China hatte Schumann 2010 bei der Vorbereitung der Weltausstellung Expo in Shanghai, für die er deutsche Innovationen auswählen sollte. Der Eindruck war so prägend, dass er kurz darauf in Shanghai das Büro des Bundesverbandes für Wirtschaftsförderung und Außenwirtschaft eröffnete. Diesen hatte er 2006 mit aufgebaut.
Wenn Schumann für deutsche Firmen Kontakte zu chinesischen Institutionen und Entscheidungsträgern herstellt, oder namhafte chinesische Konzerne nach Deutschland führt, dann tut er dies immer nach dem Prinzip: hingehen, zuhören und Vertrauen aufbauen. China hat er inzwischen mehr als hundertmal bereist. Schumann ist mit einer Chinesin verheiratet und hat insgesamt fünf Jahre in Shanghai gelebt. Janna Degener-Storr
Shao Ping Guan wird neuer Head of China Equity bei Allianz Global Investors. Ab dem 1. Juli wird er von Hongkong aus das Portfoliomanagement für chinesische Aktienstrategien verantworten. Er folgt auf Anthony Wong.
Michael Schalk ist seit Februar 2023 Pressesprecher Produktion, Logistik und Standorte China für die Audi AG.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Handarbeit ist nicht unbedingt ein Zeichen von technischer Unterentwicklung. Wie die meisten Reisbauern im Süden Chinas schwören auch diese Farmer im Kreis Yuping-Dong, Provinz Guizhou, auf die von Menschen angelegten Reisterrassen. Schweres Gerät lässt sich auf den kleinen Parzellen kaum einsetzen. Die Bauern bringen dennoch mehrere Ernten im Jahr ein – indem sie die Felder so sorgfältig pflegen wie hier.
