das waren noch Zeiten, als sämtliche Architektinnen und Architekten von Rang und Namen nach Shanghai, Peking und Shenzhen strömten und sich wahrlich austobten. Einige Bauwerke waren so avantgardistisch, dass sie zum Gespött der Bürger wurden, etwa das berühmte Gebäude des Staatssenders CCTV, das wegen seiner seltsamen Form rasch den Spitznamen “Unterhose” erhielt. Diesem Boom hat Staatschef Xi Jinping ein Ende gesetzt. Wie es dazu kam, beschreibt Johnny Erling in seiner Kolumne.
Bislang waren die chinesischen Schiffbauer vor allem auf dem Markt für Handels- und Frachtschiffe erfolgreich. Nun wollen sie auch Kreuzfahrtschiffe bauen, das Kronjuwel der Schifffahrt. Die europäische Konkurrenz zeigt sich unbeeindruckt. In der Vergangenheit haben die Chinesen das schon einmal versucht – und sind gescheitert. Doch China hat Geduld, analysiert Jörn Petring.
Vor etwas mehr als einem Monat verschwand der mittlerweile abgesetzte chinesische Außenminister Qin Gang. Die Gründe wurden der Öffentlichkeit bis heute nicht mitgeteilt. Was ebenfalls für Rätselraten sorgt: Wichtige Generäle der sogenannten Raketenarmee, denen die Atomraketen unterstanden, wurden abgesägt und sind seitdem von der Bildfläche verschwunden. Ob ihre Absetzung mit Qin Gang in Zusammenhang stehen – darüber lässt sich nur spekulieren. Denn auch bei den Generälen der Raketenarmee werden keine Gründe für ihre Absetzung geliefert. Was an Fakten bekannt ist und welche der Szenarien realistisch sind, hat Michael Radunski zusammengefasst.
Einen schönen letzten Arbeitstag vor dem Wochenende!


Es war eine kurze Meldung, die zu Wochenbeginn über den Ticker der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua lief: “Xi Jinping, Vorsitzender der Zentralen Militärkommission, überreichte am Montag Ordensurkunden zur Beförderung des Kommandeurs der Raketentruppe Wang Houbin und ihres politischen Kommissars Xu Xisheng in den Rang eines Generals.”
Was so manchem wie eine Nachricht ausschließlich für Militärexperten erscheinen mag, ist Analysten zufolge die größte Säuberung seit Jahrzehnten im chinesischen Militär. Die Raketenstreitkräfte der chinesischen Volksbefreiungsarmee (中国人民解放军火箭军) sind eine der wichtigsten Einheiten der PLA. Ihrem Kommando unterstehen unter anderem Chinas Atomwaffenarsenal sowie die strategisch-konventionellen Raketen des Landes. Das Beben in ihrer Führung hat deshalb weitreichende Folgen – für die Machtposition von Xi Jinping, für die Ausrichtung des chinesischen Militärs und schlussendlich auch für Taiwan und die USA.
Zunächst zu den Fakten: Neuer Befehlshaber der Raketenstreitkräfte wird Wang Houbin 王厚斌. Wang war seit 2020 der ehemalige stellvertretende Marinekommandant. Sein Vorgänger Li Yuchao war seit Wochen nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen worden. Die Nachrichtenagentur Xinhua gab keine Gründe für seine Abberufung an. Auch ist der aktuelle Status der Geschassten unklar.
Gleichzeitig wird Xu Xisheng 徐西盛 neuer politischer Kommissar der PLA Rocket Force (PLARF), er ist für Disziplin und Personalfragen zuständig und löst auf diesem Posten Xu Zhongbo ab. Xu Xisheng ist Luftwaffenoffizier und Mitglied des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei. Er war zuletzt stellvertretender politischer Kommissar des Southern Theater Command.
Einer der wichtigsten Posten von Xi Jinping ist der als Vorsitzender der Zentralen Militärkommission. In dieser Funktion ist Xi seit Jahren dabei, die angestaubte Volksbefreiungsarmee in eine moderne, schlagkräftige Truppe umzuwandeln. Einer der wichtigsten Bestandteile sind die Raketenstreitkräfte der chinesischen Volksbefreiungsarmee.
“Xi hat persönlich seinen Fokus auf die PLARF gelegt”, erklärt Brendan Mulvaney im Gespräch mit Table.Media. Seit seinem Amtsantritt habe Xi viel Zeit und Ressourcen sowie politische Unterstützung in dieser Truppe investiert. “Xi spricht davon, dass das PLARF von zentraler Bedeutung für künftige Konflikte sei”, sagt der Direktor des China Aerospace Studies Institute, einer renommierten Denkfabrik der US-Luftwaffe.
Im Jahr 2016 wertete Xi deshalb die Truppe in der PLA-Hierarchie auf. Ihre Entwicklung spiegelt Xis Ambitionen wider: China zu einer Großmacht zu machen, die bereit ist, der amerikanischen Vormachtstellung in der Region entgegenzutreten.
Allein in den vergangenen vier Jahren sind die Raketenstreitkräfte um 35 Prozent gewachsen – eine beeindruckende Rate angesichts der aktuellen Krisen und Wirtschaftsprobleme. Zudem verfügen sie über das größte und vielfältigste Raketenprogramm der Welt, einschließlich Russlands oder den USA. Ihnen obliegt die Verantwortung für sämtliche landgestützte nicht-taktische Raketen Chinas – für die konventionellen wie auch für die nuklearen Sprengköpfe.
“Im Gegensatz zu Russland und den Vereinigten Staaten ist China nicht durch internationale Verträge dazu verpflichtet, die Anzahl seiner ballistischen Raketensysteme mittlerer und mittel bis großer Reichweite zu begrenzen, was die PLARF zu einem strategisch-asymmetrischen Vorteil macht im Wettstreit mit den USA”, erklärt Daniel Rice im Gespräch mit Table.Media. Rice ist Militärexperte und Präsident von Dong Feng, einem Strategieberatungsunternehmen für China.
Erst vor wenigen Wochen hatte ein ranghoher Kommandeur der US-Marine die Gefahr hervorgehoben, die von der Raketentruppe ausgehe. Im Interview mit dem Fernsehsender CBS bezeichnete Admiral Samuel Paparo die PLARF als die größte Bedrohung, der die US-Marine in der indopazifischen Region ausgesetzt sei. In den Szenarien eines möglichen Kriegs um Taiwan spiele sie eine herausragende Rolle.
“Dass Xi Jinping nun den Kommandeur dieser wichtigen Kampftruppe und zur gleichen Zeit auch noch ihren politischen Chef fallen lässt, ist ein extrem ungewöhnlicher Vorgang“, urteilt Mulvaney. Doch die Gründe liegen noch völlig im Dunkeln.
Bislang gibt es keinerlei offizielle Erklärung darüber, warum die Führung der Raketenstreitkräfte abgesetzt wurde. Entsprechend kursieren allerlei Gerüchte, selbst eine Verbindung zum verschwundenen Ex-Außenminister Qin Gang wird konstruiert. Am plausibelsten erscheinen vor allem zwei Erklärungen: Korruption und Spionage.
Die South China Morning Post berichtet von Korruptionsvorwürfen und beruft sich dabei auf zwei anonyme Quellen. Korruption ist vor allem unter Xi Jinping ein häufig gewählter Vorwurf. Allerdings verbergen sich dahinter meist viele andere Aspekte wie Affären oder schlichte Illoyalität. Zudem ist nicht klar, gegen wen sonst in der PLA noch Ermittlungen im Zusammenhang mit diesen Beamten laufen.
Beobachter berichten, dass im Zusammenhang mit einer möglichen Korruptionsaffäre etliche weitere Personen in Schwierigkeiten stecken sollen wie:
Die zweite These wird vor allem von der britischen Zeitung “Financial Times” vertreten: Geheimnisverrat. In der FT heißt es: “Ausländische Offizielle, die über entsprechende Geheimdienstinformationen unterrichtet sind, glauben, dass gegen die beiden Generäle wegen angeblicher Weitergabe von Militärgeheimnissen ermittelt wird.”
Diese These muss in Peking für Aufregung sorgen. Erst vor wenigen Wochen hatte CIA-Direktor William Burns verkündet, seine Behörde erziele Fortschritte in dem Bemühen, ein Informanten-Netz im chinesischen Apparat wiederaufzubauen.
Ohnehin sind die Gründe für die Entlassungen weniger wichtig als ihre Auswirkungen. Vor allem zwei Dinge sind wichtig. Erstens: Die Ernennung von Wang Houbin, der seine Karriere in der Ost- und Südflotte machte, und von Xu Xisheng, der vom Southern Theater Command kommt, zeigt, dass Taiwan und das Südchinesische Meer weiterhin im Fokus der Volksbefreiungsarmee stehen.
Und zweitens: Dass Xi mit Wang von der Marine und Xu von der Luftwaffe zwei außenstehende Militärs an die Spitze der Raketenstreitkräfte beordert, zeigt, wie beunruhigt der Oberbefehlshaber sein muss. Mit diesem radikalen Schnitt festigt Xi weiter seinen Zugriff auf eine zentrale Einheit der Volksbefreiungsarmee. Manch einer mag sich an Xis Worte vom 20. Parteitag erinnern: Die Zeit der unterschiedlichen Fraktionen ist vorbei. Die Führung der chinesischen Raketenstreitkräfte hat Xi diese Woche jedenfalls auf Linie gebracht.

Das erste in China gebaute große Kreuzfahrtschiff hat seine Jungfernfahrt abgeschlossen. Das auf den Namen “Adora Magic City” getaufte Schiff lief vor zwei Wochen nach acht Tagen Probefahrt wieder in den Hafen von Shanghai ein. Die “Adora Magic City” mit einer Verdrängung von 135.500 Tonnen und 324 Metern Länge verfügt über 2.125 Zimmer und kann nach einem Bericht des Staatssenders CGTN mehr als 6.500 Passagiere befördern.
Das Schiff wurde auf der Werft Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding gebaut, einer Tochterfirma des staatlichen Schiffbauriesen CSSC. Die Werft will das Schiff bis Ende des Jahres ausliefern. Es soll voraussichtlich im Jahr 2024 seinen kommerziellen Betrieb aufnehmen.
Während der Jungfernfahrt prüften Ingenieure unter anderem die Leistung der Schiffssysteme wie etwa Energieversorgung, Antrieb oder Steuerung. Nun werde man die Feinabstimmung der “Adora Magic City” vornehmen und die Inneneinrichtung fertigstellen. Im Oktober ist demnach eine zweite Probefahrt geplant.
China hat seit langem eine starke Position im globalen Schiffbau. Allerdings waren die chinesischen Hersteller bisher vor allem auf dem Markt für Handels- und Frachtschiffe aktiv. Die europäische Konkurrenz klagt seit Jahren über ungleiche Wettbewerbsbedingungen und chinesische Dumpingpreise.
Dass die Chinesen nun auch den Bau von Kreuzfahrtschiffen, das “Kronjuwel” der Schifffahrt, ins Visier nehmen, löst im Westen jedoch noch keine Alarmstimmung aus. Die Branche gibt sich selbstbewusst. Das Risiko des chinesischen Vorstoßes sei “nicht gleich null”, sagt Reinhard Lüken, Hauptgeschäftsführer des Verbands für Schiffbau und Meerestechnik (VSM), im Gespräch mit Table.Media: “Aber wir haben die Gefahren vor zehn Jahren höher eingeschätzt.” Schon damals, so Lüken, habe es einen großen Hype um den chinesischen Kreuzfahrtmarkt gegeben.
Doch die Erwartungen der europäischen Hersteller auf einen China-Boom wurden enttäuscht. Die Menschen in der Volksrepublik konnten sich mit Kreuzfahrten nicht anfreunden. “Eine ganze Reihe von Schiffen, die für den chinesischen Markt vorgesehen waren, wurden wieder abgezogen, weil die Tickets nicht verkauft werden konnten”, berichtet Lüken. Einige für den chinesischen Markt konzipierte Schiffe wurden sogar nach kurzer Zeit wieder in die Werft zurückgeschickt. Sie wurden dann mit großem Aufwand und hohen Investitionen für den westlichen Markt umgebaut.
Nun macht China sich also daran, selbst die Schiffe für den eigenen Markt zu bauen. Dass die Chinesen einen langen Atem haben, sei zwar bekannt, sagt Lüken. Aber die Einstiegshürden seien sehr hoch. “Wir haben Erfahrungen mit anderen asiatischen Akteuren, die versucht haben, in diesen Markt einzusteigen”, sagt er. “Die Koreaner haben es zehn Jahre lang versucht und dann aufgegeben. Die Japaner haben es dreimal versucht – auch ohne Erfolg.”

Die Europäer beherrschen mit der italienischen Werft Fincantieri, der Chantiers de l’Atlantique in Frankreich und der Meyer Werft in Deutschland die Branche. “Ich gehe davon aus, dass die drei großen europäischen Werften auch weiterhin den Markt dominieren werden”, sagt Lüken. Und dass in China nach dem schleppenden Start vor zehn Jahren und der Covid-Krise jetzt ein Kreuzfahrtboom ausbricht, glaubt in der Branche kaum jemand.
Kreuzfahrten funktionieren auf dem asiatischen Markt ganz anders als etwa in der Karibik. “Hier spielt Glücksspiel eine große Rolle”, sagt Lüken. Doch das Beispiel der chinesischen Glücksspielhochburg Macau zeigt, dass sich die Zeiten ändern. Dort forciert die Regierung Pläne, die Stadt unabhängiger von ihren berühmten Casinos zu machen. Ähnlich könnte es dem Glücksspiel auf hoher See ergehen.
Auch in China sind Experten vorsichtig. “China ist zwar führend bei konventionellen Schiffen, hinkt aber bei Schiffen mit hoher Wertschöpfung noch hinterher”, sagte der Shanghaier Ökonom Xu Mingqi kürzlich in einem Interview zu Chinas Kreuzfahrtambitionen: “Aber uns gelingen immer mehr technische Durchbrüche, und wir fördern Investitionen in Forschung und Entwicklung.”
Vielleicht wird es also für Chinas Kreuzfahrtschiffe ähnlich laufen wie für das erste in China gebaute große Passagierflugzeug. Die Comac C919 wird seit diesem Jahr an chinesische Fluggesellschaften ausgeliefert. Die Maschine ist der Konkurrenz von Boeing und Airbus zwar noch deutlich unterlegen, doch China reicht es, die Lücke langsam zu schließen.
03.08.2023 bis 27.08.2023
Galerie JF+, Ausstellung (in Berlin): Chen Nier: Aphoric Conversation – Stille Gespräche Mehr
08.08.2023, 09:00 Uhr (15:00 Uhr Beijing time)
German Chamber of Commerce in China, GCC Knowledge Hub (auf Chinesisch): Way to Resolve Tax Disputes Mehr
10.08.2023, 11:30 Uhr (17:30 Uhr Beijing time)
Institut der deutschen Wirtschaft, Webinar: Die Zukunft des Westens in der Deglobalisierung – Gestaltungspotenziale trotz Abhängigkeit? Mehr
Die Beschäftigung von ausländischen Doktoranden mit Beteiligung an einem konkreten Forschungsvorhaben kann der Exportkontrolle unterfallen und gegenüber dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) genehmigungspflichtig sein. Das stellte das BAFA auf Anfrage von Table.Media klar. Die Aussage ist für Hochschulen und Universitäten im Zuge der Debatte über einen möglichen Ausschluss von chinesischen Stipendiaten relevant, die vom staatlichen Chinese Scholarship Counsil (CSC) vermittelt werden. Institutionen, die Doktoranden beschäftigen, könnten sich mit Blick auf das Außenwirtschaftsrecht strafbar machen, heißt es vom BAFA. Dies gilt allerdings nur für spezielle Konstellationen.
“Für die Frage, ob ein Vorhaben nicht nur genehmigungspflichtig, sondern auch genehmigungsfähig ist, spielen sowohl der Inhalt des konkreten Forschungsvorhabens als auch das Bestimmungsland sowie die Person des Empfängers eine Rolle”, teilte das BAFA mit. Im Falle von Forschungsvorhaben zu genehmigungspflichtigen Gütern oder mit möglichen Verwendungen im Zusammenhang mit Massenvernichtungswaffen oder konventioneller Rüstung sollten Bewerbungen einer genauen Prüfung unterzogen werden, stellte das BAFA klar.
Diese genaue Prüfung sah die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) offensichtlich nicht gegeben bei Promotionsstipendiaten, die vom CSC zur Anstellung an der FAU vermittelt und allein finanziert wurden. Seit 1. Juni gilt an der FAU deshalb der Beschluss, solche Stipendiaten künftig auszuschließen. Das Stipendienprogramm CSC vergibt Stipendien an den wissenschaftlichen Nachwuchs und untersteht dem Pekinger Bildungsministerium. Die Hochschule hatte den Schritt mit einer Prüfung des BAFA begründet.
Grundsätzlich sei das Amt nicht selbst für die Kontrolle von Ausführern und die Sanktionierung von Verstößen gegen das Außenwirtschaftsrecht zuständig, teilte ein BAFA-Sprecher mit. Dies obliege den Zoll- und Strafverfolgungsbehörden. “Sollten Anhaltspunkte für etwaige Verstöße beim BAFA oder BMWK vorliegen, werden diese allerdings unmittelbar an die zuständigen Strafverfolgungs- und Ermittlungsbehörden weitergegeben“, teilte das BAFA mit.
Universitäten und Hochschulen könnten sich also gegebenenfalls strafbar machen, wenn sie nicht gewährleisten können, dass Promotionsstipendiaten, die etwa an sensiblen Technologieprojekten arbeiten, ausreichend überprüft werden.
Das CSC-Stipendium sei ein strategisches Instrument Chinas, mit dessen Hilfe technologische Lücken geschlossen werden sollen, indem Wissen aus dem Ausland gewonnen werde, warnte Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Zudem könnten die Stipendiaten die im deutschen Grundgesetz verankerte Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit nicht vollumfänglich ausüben. Sie forderte auch andere Hochschulen auf, dem Beispiel aus Erlangen zu folgen.
Der deutsche Hochschulverband plädierte gegenüber der Mediengruppe Bayern für eine differenzierte Betrachtung. “Es ist Sache der Universität, dies zu entscheiden. Wenn konkreter Spionageverdacht in Rede steht, wird ein solcher Ausschluss wohl geboten sein. Mit der Absolutheit des Verbots habe ich allerdings Probleme”, sagte Hubert Detmer, zweiter Geschäftsführer des Hochschulverbands. Zumindest müsse in die Bewertung mit einbezogen werden, ob es sich bei dem Forschungsgegenstand um einen sensiblen oder neuralgischen Bereich handele. tg
Ein schneller Verzicht auf Mobilfunktechnik von chinesischen Anbietern wird die Stabilität und Übertragungsqualität in den deutschen Handynetzen spürbar beeinträchtigen. Das befürchtet zumindest die Firma Vodafone. Eine interne Studie habe gezeigt, dass es in den Ländern, wo es zu einem ungeplanten, sehr schnellen Ausschluss von einzelnen Technologieanbietern gekommen sei, zum Teil deutliche Qualitätsverluste in den Mobilfunknetzen gegeben habe, erklärte das Unternehmen am Donnerstag in Düsseldorf.
Die Europäische Kommission drängt Netzbetreiber und Mitgliedstaaten seit Jahren dazu, auf Mobilfunktechnik aus der Volksrepublik zu verzichten. Es sei der EU gelungen, die Abhängigkeiten in anderen Sektoren wie dem Energiesektor in Rekordzeit zu verringern, sagte EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton. “Bei 5G sollte es nicht anders sein: Wir können es uns nicht leisten, kritische Abhängigkeiten aufrechtzuerhalten, die zu einer ‘Waffe’ gegen unsere Interessen werden könnten.” Breton forderte alle EU-Staaten und Telekommunikationsbetreiber auf, “unverzüglich” die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen.
Vodafone verwies dpa zufolge darauf, dass die Folgen eines zu schnellen Verzichts nicht nur kurzfristig zu spüren seien, sondern auch nach längerer Zeit. “Noch bis zu einem Jahr nach Austausch der Antennen kann die Netzqualität negativ beeinflusst werden”, erklärte der Mobilfunkanbieter. So habe man in den Ländern, die schnell und ungeplant gewechselt haben, deutlich mehr Gesprächsabbrüche verzeichnet. Weiterhin habe sich gezeigt, dass der Ausbau der Mobilfunknetze der 5. Generation (5G) in den meisten dieser Länder erheblich verlangsamt worden sei.
Einem Handelsblatt-Bericht zufolge wurden Störungen in anderen Ländern bislang jedoch nicht beobachtet. Dänemark hat demnach bereits vor drei Jahren den Ausbau von chinesischen Bestandskomponenten angeordnet, Netzwerkprobleme habe es daraufhin nicht gegeben.
Mobilfunkanbieter befürchten dennoch hohe Kosten durch ein Verbot der chinesischen Mobilfunktechnik. Die Telekom, die besonders betroffen wäre, hat laut Handelsblatt schon vor einigen Jahren entsprechende Szenarien für den Fall durchgespielt, dass der Konzern chinesische Ausrüster nicht länger in seinen Netzen verwenden darf. Demnach könnte das Entfernen der Komponenten bei der Telekom bis zu fünf Jahre dauern und drei Milliarden Euro kosten.
Die Kostenbelastung könnte jedoch durch einen schrittweisen Ausbau reduziert werden, wie er laut Handelsblatt in anderen europäischen Ländern gehandhabt wird. Großbritannien etwa hat seinen Netzbetreibern eine Frist von sieben Jahren eingeräumt, die einzelnen Komponenten müssen ohnehin regelmäßig ausgetauscht werden. Frankreich geht ähnlich vor. Die Diskussion über die Sicherheitsrisiken und ein mögliches Verbot wird bereits seit mehreren Jahren geführt, die Netzbetreiber haben dennoch weiter Huawei- und ZTE-Teile verbaut.
Mehrere westliche Länder werfen Huawei und ZTE enge Verbindungen zur chinesischen Regierung vor und haben die Unternehmen mit Sanktionen belegt. Huawei und ZTE weisen die Vorwürfe zurück. flee/jul
Fast 60 Prozent von Chinas 100 größten Immobilienunternehmen haben in den ersten sieben Monaten dieses Jahres keine Grundstücke erworben, berichtet Yicai Global und bezieht sich auf eine Studie des Marktforschungsinstituts Kerry Research Center.
Demnach wurden von Januar bis Juli Grundstücke im Wert von 11,6 Billionen Yuan (rund 1,46 Billionen Euro) von Bauträgern gekauft, die in den Top 100 gelistet sind, was einem Rückgang von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Am meisten gaben China Resources Land, Binjiang Group und Poly Development für Land aus.
Die Zahlen deuten darauf hin, dass die Bauträger des Landes in dem schleppenden Markt vorsichtig mit Investitionen sind. Sollte sich der Immobilienmarkt nicht erholen, könnten die Bauträger der Studie zufolge zurückhaltend bleiben. jul

Nach Taifun “Doksuri” kämpft die Provinz Hebei weiter mit den Folgen der Regenmassen. Einsatzkräfte versuchten am Donnerstag mit Hochdruck, weitere Zehntausende eingeschlossene Menschen aus ihren Häusern zu retten und Wasser sicher aus den vollgelaufenen Stauseen abzulassen.
In dem Gebiet des Hai-He-Stroms, in dem fünf Flüsse zusammenfließen und das Hebei und die Hauptstadt Peking umfasst, würden die technischen Systeme zur Hochwasserbekämpfung auf die “schwerste Probe” seit den Überschwemmungen im Sommer 1996 gestellt, berichteten staatliche Medien. Bei der Hochwasser-Katastrophe im Einzugsgebiet des Jangtse-Flusses kamen damals etwa 2.800 Menschen ums Leben.
In den vergangenen Tagen wurden bereits mehr als 1,2 Millionen Menschen in Hebei evakuiert. Am schwersten betroffen ist die Stadt Zhuozhou südwestlich von Peking. Hier könnte es bis zu einem Monat dauern, bis die Fluten zurückweichen, sagte ein Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamtes zu staatlichen Medien.
Im Norden Chinas ist indes eine Brücke einer Fernstraße von Sturzfluten zum Einsturz gebracht worden. Zwei Autos fielen in den Fluss unter der Brücke, wie staatliche Medienberichteten. Eine Rettungsaktion dauere an, ein Abschnitt der Fernstraße sei geschlossen worden, hieß es. Das Unglück ereignete sich auf der Straße, die von Harbin nach Mudanjiang in der Provinz Heilongjiang führt, wie die Zeitung Xin Jing Bao berichtete.
Meteorologe befürchten, dass die Regenfälle noch einige Wochen anhalten könnten. rtr/jul

Architekten aller Couleur, von Büros aus den USA (I.M.Pei) bis zur Creme de la Creme europäischer Designer und Stadtplaner, pilgerten nach Peking und Shanghai und drückten der Volksrepublik ihren baumeisterlichen Stempel auf. Ganz gemäß Maos Motto: China ist ein weißes Blatt, auf das sich die schönsten Schriftzeichen pinseln lassen (一张 白纸 ….好画最新最美的画图).

Auf der illustren Liste standen etwa Meinhard von Gerkan (gmp), Albert Speer und Partner (asp) Ole Scheren, der Holländer Rem Kohlhaas, die Schweizer Herzog & de Meuron, der Franzose Paul Andreu, die irakisch-britische Zaha Hadid und Norman Foster. Ihre Wolkenkratzer prägen heute die Skyline von Shanghai; Superprojekte wie der CCTV-Tower, das Nationaltheater oder die Olympiastadien sind moderne Wahrzeichen der Pekinger City. Chinas Baugewerbe boomte.

Es war der 28. November 2008 und Shanghai noch mitten im Höhenrausch. Akio Yoshimura, Chefrepräsentant des japanischen Immobilienkonzerns Mori, lud Pekinger Korrespondenten zur Besichtigung seines 492 Meter hohen SWFC-Weltfinanzzentrums in Shanghais Sonderzone Pudong ein. Er brüstete sich, den “zweithöchsten Büroturm der Welt” nach dem Design von New Yorks Architekten Kohn Pedersen Fox (KPF) erbaut zu haben. Nur Taiwans Taipei-Tower 101 sei noch höher.

Besonders stolz war er auf die Aussichtsplattform in 474 Meter Höhe, “die höchste der Welt.” Alle Konkurrenten wirkten dagegen wie “Winzlinge.” Er meinte den wenige hundert Meter entfernten 420,5 Meter hohen Jinmao-Tower, entworfen von der US-Firma Skidmore, Owings & Merrill (SOM). Die 750 Millionen US-Dollar Kosten für seinen Wolkenkratzer hätten sich gelohnt.
Der japanische Manager wusste noch nicht, dass an diesem Tag Shanghais Stadtregierung in einer Sondersitzung den Baubeginn für ein noch höheres Haus vorfristig beschloss. Peking wollte, dass Shanghai Flagge gegen die Weltwirtschaftskrise zeigte. Tags darauf tönten Shanghais Medien: “Gegen Krise und Abwärtstrend. Shanghai baut noch höher.”
Am 29. November fiel der erste Spatenstich für das “Shanghai Zentrum” (上海中心大厦), das mit 632 Meter und einer 562 Meter hohen Aussichts-Plattform den danebenstehenden Mori-Turm haushoch überragen würde. Der US-Architekt Arthur Gensler hatte erst im Juni die Ausschreibung dafür gewonnen. Richtfest konnte er im August 2013 feiern.
Erneut lobte alle Welt das “Shanghai-Tempo”, mit dem Superprojekte hochgezogen wurden. Auch die Deutschen trugen mit vielfachen Superprojekten bei, darunter mit dem spektakulären Transrapidbau in Pudong (Thyssen), der in nur 18 Monaten gebauten Formel 1-Rennstrecke (Architekt Hermann Tilke), oder der nach deutschem Vorbild erschaffenen ökologischen Kleinstadt “Anting New Town” von Stadtplaner Abert Speer&Partner (AS&P).
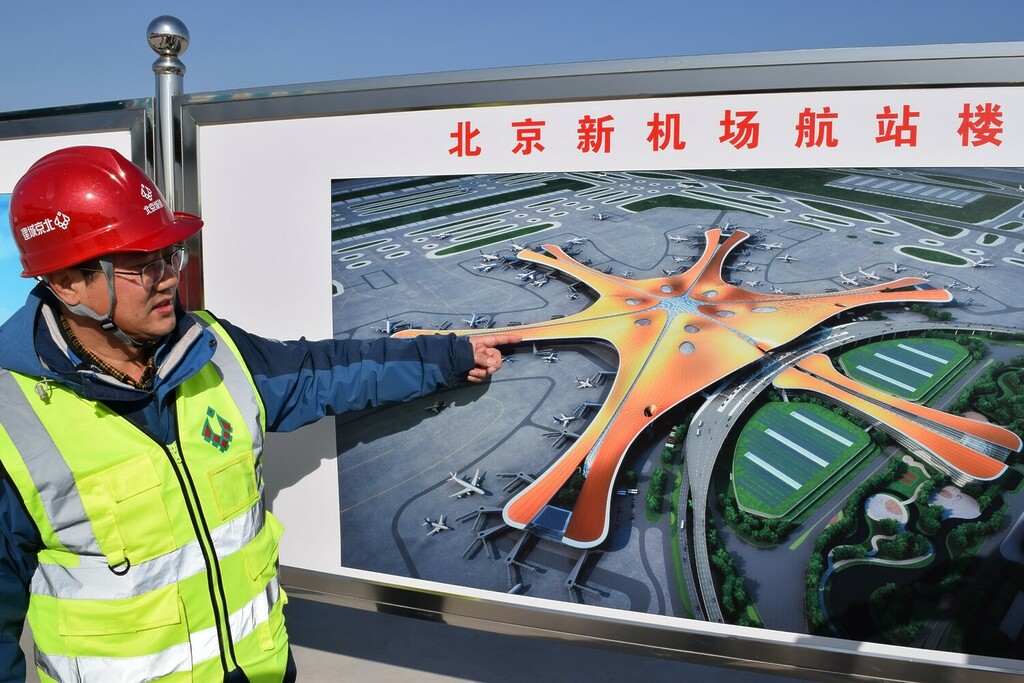
Die drei Wolkenkratzer in Pudong wurden zu neuen Wahrzeichen Shanghais. Vor 100 Jahren hatte die Hafenstadt mit ihrer Uferpromenade (Bund) und den dort nach europäischem Stil gebauten kolonialen Bank-, Zoll- und Handelshäusern Aufsehen als Gegenstück zu News Yorks Silhouette erregt. Das galt erst recht im 21. Jahrhundert, als auf Shanghais anderer Flussseite Dutzende Avantgarde-Bauten seine moderne Skyline begründeten.
Städte im ganzen Land verfielen nun dem Hochhaus-Bauwahn und machten ein seit den 1990er Jahren geflügeltes Wort vom “Wolkenkratzer-Index” populär. Er stellt einen Zusammenhang zwischen neuen Rekorden beim Bau von Wolkenkratzern und dem Niedergang von Institutionen her, die in ihnen residieren und ihren Höhepunkt überschreiten – als Warnsignal einer Krise.
Doch ein anderer Index passt besser zu China. Die jährliche MyCOS-Liste (麦可思研究院调查编著的) zeigt die Favoriten der Studienwahl und die Chancen, sechs Monate nach Uni-Abschluss einen hoch bezahlten Job zu finden. Architektur und Design standen bis 2013 auf Platz 1 unter den zehn begehrtesten Studienplätzen. Ihre Wahl garantierte zu 98,3 Prozent auch einen Arbeitsplatz mit höchstem Anfangsmonatslohn.
Doch die Architektur fiel seither aus der Topliste, kam nicht mal mehr unter die ersten zehn Fächer, meldete 2023 Chinas investigative Wochenzeitung “Nanfang Zhoumo” (南方周末). Die Webseite “Sixth Tone” schrieb: “Vor einem Jahrzehnt war sie ein Symbol für das chinesische Wirtschaftswunder.” Diese Zeiten sind vorbei. Frustriert klagte ein Absolvent, der 2018 sein Studium beendete, heute keine Arbeit mehr zu finden: “Viele von uns sind gezwungen, als Boten Lebensmittel auszufahren.”
Mehr als zwei Jahrzehnte hatte China wie am Fließband ausländische Bauwerke, sogar ganze Kleinstädte kopiert, bevor Pekings Bauministerium “allen zu großen, zu ausländischen und zu seltsamen Gebäuden” einen Riegel vorschob und verbat, Wolkenkratzer über 500 Meter Höhe zu bauen.
China hatte einst Dutzende “Weiße Häuser” nachgebaut, Triumphbögen oder Eiffelturm errichtet, sogar 2011 in Guangdong das pittoreske österreichische Alpenstädtchen Hallstadt zur Gänze nachgebaut. Meist dienten sie als Werbeobjekte für Immobiliendeals oder als Tourismusmagneten.

Es gab Ausnahmen. Sinn machte etwa ein 1999 von Shanghais Oberbürgermeister ausgeschriebenes Musterprojekt, die drohende Unbewohnbarkeit der durch Bevölkerungswachstum und Urbanisierung zersiedelten Shanghaier Metropole über einen Ring von neun attraktiven Satellitenstädten nach europäischem Vorbild zu konterkarieren. Die Frankfurter Stadtplaner Albert Speer und sein für China zuständiger Partner Johannes Dell erhielten den Auftrag, eines der Kleinstädtchen “New Town Anting” nach deutschem Vorbild zu bauen. Deutsch daran, so sagt Dell heute, waren vor allem Merkmale des Bauhaus-Stil, Raumplanung und energiesparende Versorgungstechnologie.” Aber es dauerte nach dem Fertigbau viele Jahre, bis die Shanghaier Bürger Anting zu schätzen begannen. Nur zwei der neun “europäischen” Satellitenstädte wurden tatsächlich gebaut. Das deutsche Anting und die britische “Thames Town.”
Hinter Chinas groteskem Flirt mit westlicher Architektur stecke mehr, behauptet die Journalistin Bianca Bosker, die 2013 eine umfassende Fotodokumentation verfasste. “Original Copies: Architectural mimicry in Contemporary China”. Peking hätte die massenhafte Kopiererei toleriert, um auch “sehr symbolisch” nach außen “Muskeln” vorzuzeigen, “dass es die Welt neu arrangieren kann”, indem es erst einmal die “größten Hits” des Westens nachbaut. Es sei kein Zufall, dass Modelle des ‘Weißen Hauses’, ultimatives Symbol des US-Macht, zu den meist kopierten Gebäuden in der Volksrepublik wurden.

Chinas traditionelle Architekten und Bauplaner sahen das anders. Ihr Unmut entlud sich in einer zornigen Attacke am 11. November 2013 gegen die westliche Dominanz in der zeitgenössischen Architektur. Die Akademie für Ingenieurwissenschaften war Gastgeber für die Großkonferenz in Nanjing. Frühere Minister des Bauministeriums kamen ebenso wie hohe Planungsfunktionäre, 15 Akademieräte und Vertreter aller Designinstitute. Sie erregten sich über den angeblichen Ausverkauf der Baukultur. In den Kerngebieten von Peking, Shanghai und Guangzhou seien fast alle Neubauten von Ausländern entworfen. In Bausch und Bogen verdammten sie die “vier Pekinger Prestigebauten” ausländischer Designer als “extravagant, verschwenderisch, instabil und erdbebengefährdet”, Sie nannten das Nationaltheater (国家大剧院), CCTV-Hochhaus (央视新大楼) und die Olympiastadien Vogelnest (鸟巢) und Wasserkubus (水立方). Chinas Zeitschrift “Southern Weekly” (南方周末) überschrieb ihren Report: “Kanonendonner an der Architekturfront” (中国当代建筑论坛上的”炮声”).

Ein Jahr nach der Konferenz fanden sie Gehör bei Parteichef Xi Jinping. In einer Grundsatzrede im Dezember 2014 verlangte er von Chinas Literatur und Kunst, sich dem Primat der Politik zu unterwerfen. Dabei äußerte er sich auch zum Streit über avantgardistische Architektur. Künftig sollten in Peking “keine seltsamen Gebäude” mehr auftauchen, wie etwa das CCTV-Fernsehhaus, das vom Volksmund als ‘große Unterhose’ verspottet würde. (北京市今后不太可能再出现如同”大裤衩”一样奇形怪状的建筑了)
Das war das Ende für den Höhenrausch der experimentellen Architektur. Der große Treck aus dem Ausland führt nicht mehr nach China. Für die chinesischen Baumeister sieht es aus vielerlei Gründen derzeit düster aus. Im Juli titelte die Webseite Sixth Tone: “China war ein Traum für Architekten. Nun ist es zum Alptraum geworden.”
Hugo Zhu wird neuer CEO des Elektro-Autohersteller Aiways. Er soll die Expansion ins Ausland beschleunigen.
Alan Beebe wird neuer CEO der gemeinnützigen Organisation Urban Land Institute (ULI) für die Asien-Pazifik-Region. Er war vorher Präsident der US-Handelskammer in China.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Gegendert wird auf Chinesisch zwar noch nicht, aber mit Bosie gibt es nun zumindest ein Mode-Unternehmen, das nicht zwischen Mann und Frau unterscheidet. Bosie bietet ausschließlich geschlechterneutrale Kleidung an und setzt bei seinen Geschäften auf ein silbergraues, futuristisches Raumschiff-Ambiente, wie hier beim Flagship-Store in Shanghai. In der Zukunft wird es laut Bosie also offenbar keine Geschlechtertrennung mehr geben – das zumindest könnte die Message sein.
das waren noch Zeiten, als sämtliche Architektinnen und Architekten von Rang und Namen nach Shanghai, Peking und Shenzhen strömten und sich wahrlich austobten. Einige Bauwerke waren so avantgardistisch, dass sie zum Gespött der Bürger wurden, etwa das berühmte Gebäude des Staatssenders CCTV, das wegen seiner seltsamen Form rasch den Spitznamen “Unterhose” erhielt. Diesem Boom hat Staatschef Xi Jinping ein Ende gesetzt. Wie es dazu kam, beschreibt Johnny Erling in seiner Kolumne.
Bislang waren die chinesischen Schiffbauer vor allem auf dem Markt für Handels- und Frachtschiffe erfolgreich. Nun wollen sie auch Kreuzfahrtschiffe bauen, das Kronjuwel der Schifffahrt. Die europäische Konkurrenz zeigt sich unbeeindruckt. In der Vergangenheit haben die Chinesen das schon einmal versucht – und sind gescheitert. Doch China hat Geduld, analysiert Jörn Petring.
Vor etwas mehr als einem Monat verschwand der mittlerweile abgesetzte chinesische Außenminister Qin Gang. Die Gründe wurden der Öffentlichkeit bis heute nicht mitgeteilt. Was ebenfalls für Rätselraten sorgt: Wichtige Generäle der sogenannten Raketenarmee, denen die Atomraketen unterstanden, wurden abgesägt und sind seitdem von der Bildfläche verschwunden. Ob ihre Absetzung mit Qin Gang in Zusammenhang stehen – darüber lässt sich nur spekulieren. Denn auch bei den Generälen der Raketenarmee werden keine Gründe für ihre Absetzung geliefert. Was an Fakten bekannt ist und welche der Szenarien realistisch sind, hat Michael Radunski zusammengefasst.
Einen schönen letzten Arbeitstag vor dem Wochenende!


Es war eine kurze Meldung, die zu Wochenbeginn über den Ticker der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua lief: “Xi Jinping, Vorsitzender der Zentralen Militärkommission, überreichte am Montag Ordensurkunden zur Beförderung des Kommandeurs der Raketentruppe Wang Houbin und ihres politischen Kommissars Xu Xisheng in den Rang eines Generals.”
Was so manchem wie eine Nachricht ausschließlich für Militärexperten erscheinen mag, ist Analysten zufolge die größte Säuberung seit Jahrzehnten im chinesischen Militär. Die Raketenstreitkräfte der chinesischen Volksbefreiungsarmee (中国人民解放军火箭军) sind eine der wichtigsten Einheiten der PLA. Ihrem Kommando unterstehen unter anderem Chinas Atomwaffenarsenal sowie die strategisch-konventionellen Raketen des Landes. Das Beben in ihrer Führung hat deshalb weitreichende Folgen – für die Machtposition von Xi Jinping, für die Ausrichtung des chinesischen Militärs und schlussendlich auch für Taiwan und die USA.
Zunächst zu den Fakten: Neuer Befehlshaber der Raketenstreitkräfte wird Wang Houbin 王厚斌. Wang war seit 2020 der ehemalige stellvertretende Marinekommandant. Sein Vorgänger Li Yuchao war seit Wochen nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen worden. Die Nachrichtenagentur Xinhua gab keine Gründe für seine Abberufung an. Auch ist der aktuelle Status der Geschassten unklar.
Gleichzeitig wird Xu Xisheng 徐西盛 neuer politischer Kommissar der PLA Rocket Force (PLARF), er ist für Disziplin und Personalfragen zuständig und löst auf diesem Posten Xu Zhongbo ab. Xu Xisheng ist Luftwaffenoffizier und Mitglied des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei. Er war zuletzt stellvertretender politischer Kommissar des Southern Theater Command.
Einer der wichtigsten Posten von Xi Jinping ist der als Vorsitzender der Zentralen Militärkommission. In dieser Funktion ist Xi seit Jahren dabei, die angestaubte Volksbefreiungsarmee in eine moderne, schlagkräftige Truppe umzuwandeln. Einer der wichtigsten Bestandteile sind die Raketenstreitkräfte der chinesischen Volksbefreiungsarmee.
“Xi hat persönlich seinen Fokus auf die PLARF gelegt”, erklärt Brendan Mulvaney im Gespräch mit Table.Media. Seit seinem Amtsantritt habe Xi viel Zeit und Ressourcen sowie politische Unterstützung in dieser Truppe investiert. “Xi spricht davon, dass das PLARF von zentraler Bedeutung für künftige Konflikte sei”, sagt der Direktor des China Aerospace Studies Institute, einer renommierten Denkfabrik der US-Luftwaffe.
Im Jahr 2016 wertete Xi deshalb die Truppe in der PLA-Hierarchie auf. Ihre Entwicklung spiegelt Xis Ambitionen wider: China zu einer Großmacht zu machen, die bereit ist, der amerikanischen Vormachtstellung in der Region entgegenzutreten.
Allein in den vergangenen vier Jahren sind die Raketenstreitkräfte um 35 Prozent gewachsen – eine beeindruckende Rate angesichts der aktuellen Krisen und Wirtschaftsprobleme. Zudem verfügen sie über das größte und vielfältigste Raketenprogramm der Welt, einschließlich Russlands oder den USA. Ihnen obliegt die Verantwortung für sämtliche landgestützte nicht-taktische Raketen Chinas – für die konventionellen wie auch für die nuklearen Sprengköpfe.
“Im Gegensatz zu Russland und den Vereinigten Staaten ist China nicht durch internationale Verträge dazu verpflichtet, die Anzahl seiner ballistischen Raketensysteme mittlerer und mittel bis großer Reichweite zu begrenzen, was die PLARF zu einem strategisch-asymmetrischen Vorteil macht im Wettstreit mit den USA”, erklärt Daniel Rice im Gespräch mit Table.Media. Rice ist Militärexperte und Präsident von Dong Feng, einem Strategieberatungsunternehmen für China.
Erst vor wenigen Wochen hatte ein ranghoher Kommandeur der US-Marine die Gefahr hervorgehoben, die von der Raketentruppe ausgehe. Im Interview mit dem Fernsehsender CBS bezeichnete Admiral Samuel Paparo die PLARF als die größte Bedrohung, der die US-Marine in der indopazifischen Region ausgesetzt sei. In den Szenarien eines möglichen Kriegs um Taiwan spiele sie eine herausragende Rolle.
“Dass Xi Jinping nun den Kommandeur dieser wichtigen Kampftruppe und zur gleichen Zeit auch noch ihren politischen Chef fallen lässt, ist ein extrem ungewöhnlicher Vorgang“, urteilt Mulvaney. Doch die Gründe liegen noch völlig im Dunkeln.
Bislang gibt es keinerlei offizielle Erklärung darüber, warum die Führung der Raketenstreitkräfte abgesetzt wurde. Entsprechend kursieren allerlei Gerüchte, selbst eine Verbindung zum verschwundenen Ex-Außenminister Qin Gang wird konstruiert. Am plausibelsten erscheinen vor allem zwei Erklärungen: Korruption und Spionage.
Die South China Morning Post berichtet von Korruptionsvorwürfen und beruft sich dabei auf zwei anonyme Quellen. Korruption ist vor allem unter Xi Jinping ein häufig gewählter Vorwurf. Allerdings verbergen sich dahinter meist viele andere Aspekte wie Affären oder schlichte Illoyalität. Zudem ist nicht klar, gegen wen sonst in der PLA noch Ermittlungen im Zusammenhang mit diesen Beamten laufen.
Beobachter berichten, dass im Zusammenhang mit einer möglichen Korruptionsaffäre etliche weitere Personen in Schwierigkeiten stecken sollen wie:
Die zweite These wird vor allem von der britischen Zeitung “Financial Times” vertreten: Geheimnisverrat. In der FT heißt es: “Ausländische Offizielle, die über entsprechende Geheimdienstinformationen unterrichtet sind, glauben, dass gegen die beiden Generäle wegen angeblicher Weitergabe von Militärgeheimnissen ermittelt wird.”
Diese These muss in Peking für Aufregung sorgen. Erst vor wenigen Wochen hatte CIA-Direktor William Burns verkündet, seine Behörde erziele Fortschritte in dem Bemühen, ein Informanten-Netz im chinesischen Apparat wiederaufzubauen.
Ohnehin sind die Gründe für die Entlassungen weniger wichtig als ihre Auswirkungen. Vor allem zwei Dinge sind wichtig. Erstens: Die Ernennung von Wang Houbin, der seine Karriere in der Ost- und Südflotte machte, und von Xu Xisheng, der vom Southern Theater Command kommt, zeigt, dass Taiwan und das Südchinesische Meer weiterhin im Fokus der Volksbefreiungsarmee stehen.
Und zweitens: Dass Xi mit Wang von der Marine und Xu von der Luftwaffe zwei außenstehende Militärs an die Spitze der Raketenstreitkräfte beordert, zeigt, wie beunruhigt der Oberbefehlshaber sein muss. Mit diesem radikalen Schnitt festigt Xi weiter seinen Zugriff auf eine zentrale Einheit der Volksbefreiungsarmee. Manch einer mag sich an Xis Worte vom 20. Parteitag erinnern: Die Zeit der unterschiedlichen Fraktionen ist vorbei. Die Führung der chinesischen Raketenstreitkräfte hat Xi diese Woche jedenfalls auf Linie gebracht.

Das erste in China gebaute große Kreuzfahrtschiff hat seine Jungfernfahrt abgeschlossen. Das auf den Namen “Adora Magic City” getaufte Schiff lief vor zwei Wochen nach acht Tagen Probefahrt wieder in den Hafen von Shanghai ein. Die “Adora Magic City” mit einer Verdrängung von 135.500 Tonnen und 324 Metern Länge verfügt über 2.125 Zimmer und kann nach einem Bericht des Staatssenders CGTN mehr als 6.500 Passagiere befördern.
Das Schiff wurde auf der Werft Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding gebaut, einer Tochterfirma des staatlichen Schiffbauriesen CSSC. Die Werft will das Schiff bis Ende des Jahres ausliefern. Es soll voraussichtlich im Jahr 2024 seinen kommerziellen Betrieb aufnehmen.
Während der Jungfernfahrt prüften Ingenieure unter anderem die Leistung der Schiffssysteme wie etwa Energieversorgung, Antrieb oder Steuerung. Nun werde man die Feinabstimmung der “Adora Magic City” vornehmen und die Inneneinrichtung fertigstellen. Im Oktober ist demnach eine zweite Probefahrt geplant.
China hat seit langem eine starke Position im globalen Schiffbau. Allerdings waren die chinesischen Hersteller bisher vor allem auf dem Markt für Handels- und Frachtschiffe aktiv. Die europäische Konkurrenz klagt seit Jahren über ungleiche Wettbewerbsbedingungen und chinesische Dumpingpreise.
Dass die Chinesen nun auch den Bau von Kreuzfahrtschiffen, das “Kronjuwel” der Schifffahrt, ins Visier nehmen, löst im Westen jedoch noch keine Alarmstimmung aus. Die Branche gibt sich selbstbewusst. Das Risiko des chinesischen Vorstoßes sei “nicht gleich null”, sagt Reinhard Lüken, Hauptgeschäftsführer des Verbands für Schiffbau und Meerestechnik (VSM), im Gespräch mit Table.Media: “Aber wir haben die Gefahren vor zehn Jahren höher eingeschätzt.” Schon damals, so Lüken, habe es einen großen Hype um den chinesischen Kreuzfahrtmarkt gegeben.
Doch die Erwartungen der europäischen Hersteller auf einen China-Boom wurden enttäuscht. Die Menschen in der Volksrepublik konnten sich mit Kreuzfahrten nicht anfreunden. “Eine ganze Reihe von Schiffen, die für den chinesischen Markt vorgesehen waren, wurden wieder abgezogen, weil die Tickets nicht verkauft werden konnten”, berichtet Lüken. Einige für den chinesischen Markt konzipierte Schiffe wurden sogar nach kurzer Zeit wieder in die Werft zurückgeschickt. Sie wurden dann mit großem Aufwand und hohen Investitionen für den westlichen Markt umgebaut.
Nun macht China sich also daran, selbst die Schiffe für den eigenen Markt zu bauen. Dass die Chinesen einen langen Atem haben, sei zwar bekannt, sagt Lüken. Aber die Einstiegshürden seien sehr hoch. “Wir haben Erfahrungen mit anderen asiatischen Akteuren, die versucht haben, in diesen Markt einzusteigen”, sagt er. “Die Koreaner haben es zehn Jahre lang versucht und dann aufgegeben. Die Japaner haben es dreimal versucht – auch ohne Erfolg.”

Die Europäer beherrschen mit der italienischen Werft Fincantieri, der Chantiers de l’Atlantique in Frankreich und der Meyer Werft in Deutschland die Branche. “Ich gehe davon aus, dass die drei großen europäischen Werften auch weiterhin den Markt dominieren werden”, sagt Lüken. Und dass in China nach dem schleppenden Start vor zehn Jahren und der Covid-Krise jetzt ein Kreuzfahrtboom ausbricht, glaubt in der Branche kaum jemand.
Kreuzfahrten funktionieren auf dem asiatischen Markt ganz anders als etwa in der Karibik. “Hier spielt Glücksspiel eine große Rolle”, sagt Lüken. Doch das Beispiel der chinesischen Glücksspielhochburg Macau zeigt, dass sich die Zeiten ändern. Dort forciert die Regierung Pläne, die Stadt unabhängiger von ihren berühmten Casinos zu machen. Ähnlich könnte es dem Glücksspiel auf hoher See ergehen.
Auch in China sind Experten vorsichtig. “China ist zwar führend bei konventionellen Schiffen, hinkt aber bei Schiffen mit hoher Wertschöpfung noch hinterher”, sagte der Shanghaier Ökonom Xu Mingqi kürzlich in einem Interview zu Chinas Kreuzfahrtambitionen: “Aber uns gelingen immer mehr technische Durchbrüche, und wir fördern Investitionen in Forschung und Entwicklung.”
Vielleicht wird es also für Chinas Kreuzfahrtschiffe ähnlich laufen wie für das erste in China gebaute große Passagierflugzeug. Die Comac C919 wird seit diesem Jahr an chinesische Fluggesellschaften ausgeliefert. Die Maschine ist der Konkurrenz von Boeing und Airbus zwar noch deutlich unterlegen, doch China reicht es, die Lücke langsam zu schließen.
03.08.2023 bis 27.08.2023
Galerie JF+, Ausstellung (in Berlin): Chen Nier: Aphoric Conversation – Stille Gespräche Mehr
08.08.2023, 09:00 Uhr (15:00 Uhr Beijing time)
German Chamber of Commerce in China, GCC Knowledge Hub (auf Chinesisch): Way to Resolve Tax Disputes Mehr
10.08.2023, 11:30 Uhr (17:30 Uhr Beijing time)
Institut der deutschen Wirtschaft, Webinar: Die Zukunft des Westens in der Deglobalisierung – Gestaltungspotenziale trotz Abhängigkeit? Mehr
Die Beschäftigung von ausländischen Doktoranden mit Beteiligung an einem konkreten Forschungsvorhaben kann der Exportkontrolle unterfallen und gegenüber dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) genehmigungspflichtig sein. Das stellte das BAFA auf Anfrage von Table.Media klar. Die Aussage ist für Hochschulen und Universitäten im Zuge der Debatte über einen möglichen Ausschluss von chinesischen Stipendiaten relevant, die vom staatlichen Chinese Scholarship Counsil (CSC) vermittelt werden. Institutionen, die Doktoranden beschäftigen, könnten sich mit Blick auf das Außenwirtschaftsrecht strafbar machen, heißt es vom BAFA. Dies gilt allerdings nur für spezielle Konstellationen.
“Für die Frage, ob ein Vorhaben nicht nur genehmigungspflichtig, sondern auch genehmigungsfähig ist, spielen sowohl der Inhalt des konkreten Forschungsvorhabens als auch das Bestimmungsland sowie die Person des Empfängers eine Rolle”, teilte das BAFA mit. Im Falle von Forschungsvorhaben zu genehmigungspflichtigen Gütern oder mit möglichen Verwendungen im Zusammenhang mit Massenvernichtungswaffen oder konventioneller Rüstung sollten Bewerbungen einer genauen Prüfung unterzogen werden, stellte das BAFA klar.
Diese genaue Prüfung sah die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) offensichtlich nicht gegeben bei Promotionsstipendiaten, die vom CSC zur Anstellung an der FAU vermittelt und allein finanziert wurden. Seit 1. Juni gilt an der FAU deshalb der Beschluss, solche Stipendiaten künftig auszuschließen. Das Stipendienprogramm CSC vergibt Stipendien an den wissenschaftlichen Nachwuchs und untersteht dem Pekinger Bildungsministerium. Die Hochschule hatte den Schritt mit einer Prüfung des BAFA begründet.
Grundsätzlich sei das Amt nicht selbst für die Kontrolle von Ausführern und die Sanktionierung von Verstößen gegen das Außenwirtschaftsrecht zuständig, teilte ein BAFA-Sprecher mit. Dies obliege den Zoll- und Strafverfolgungsbehörden. “Sollten Anhaltspunkte für etwaige Verstöße beim BAFA oder BMWK vorliegen, werden diese allerdings unmittelbar an die zuständigen Strafverfolgungs- und Ermittlungsbehörden weitergegeben“, teilte das BAFA mit.
Universitäten und Hochschulen könnten sich also gegebenenfalls strafbar machen, wenn sie nicht gewährleisten können, dass Promotionsstipendiaten, die etwa an sensiblen Technologieprojekten arbeiten, ausreichend überprüft werden.
Das CSC-Stipendium sei ein strategisches Instrument Chinas, mit dessen Hilfe technologische Lücken geschlossen werden sollen, indem Wissen aus dem Ausland gewonnen werde, warnte Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Zudem könnten die Stipendiaten die im deutschen Grundgesetz verankerte Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit nicht vollumfänglich ausüben. Sie forderte auch andere Hochschulen auf, dem Beispiel aus Erlangen zu folgen.
Der deutsche Hochschulverband plädierte gegenüber der Mediengruppe Bayern für eine differenzierte Betrachtung. “Es ist Sache der Universität, dies zu entscheiden. Wenn konkreter Spionageverdacht in Rede steht, wird ein solcher Ausschluss wohl geboten sein. Mit der Absolutheit des Verbots habe ich allerdings Probleme”, sagte Hubert Detmer, zweiter Geschäftsführer des Hochschulverbands. Zumindest müsse in die Bewertung mit einbezogen werden, ob es sich bei dem Forschungsgegenstand um einen sensiblen oder neuralgischen Bereich handele. tg
Ein schneller Verzicht auf Mobilfunktechnik von chinesischen Anbietern wird die Stabilität und Übertragungsqualität in den deutschen Handynetzen spürbar beeinträchtigen. Das befürchtet zumindest die Firma Vodafone. Eine interne Studie habe gezeigt, dass es in den Ländern, wo es zu einem ungeplanten, sehr schnellen Ausschluss von einzelnen Technologieanbietern gekommen sei, zum Teil deutliche Qualitätsverluste in den Mobilfunknetzen gegeben habe, erklärte das Unternehmen am Donnerstag in Düsseldorf.
Die Europäische Kommission drängt Netzbetreiber und Mitgliedstaaten seit Jahren dazu, auf Mobilfunktechnik aus der Volksrepublik zu verzichten. Es sei der EU gelungen, die Abhängigkeiten in anderen Sektoren wie dem Energiesektor in Rekordzeit zu verringern, sagte EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton. “Bei 5G sollte es nicht anders sein: Wir können es uns nicht leisten, kritische Abhängigkeiten aufrechtzuerhalten, die zu einer ‘Waffe’ gegen unsere Interessen werden könnten.” Breton forderte alle EU-Staaten und Telekommunikationsbetreiber auf, “unverzüglich” die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen.
Vodafone verwies dpa zufolge darauf, dass die Folgen eines zu schnellen Verzichts nicht nur kurzfristig zu spüren seien, sondern auch nach längerer Zeit. “Noch bis zu einem Jahr nach Austausch der Antennen kann die Netzqualität negativ beeinflusst werden”, erklärte der Mobilfunkanbieter. So habe man in den Ländern, die schnell und ungeplant gewechselt haben, deutlich mehr Gesprächsabbrüche verzeichnet. Weiterhin habe sich gezeigt, dass der Ausbau der Mobilfunknetze der 5. Generation (5G) in den meisten dieser Länder erheblich verlangsamt worden sei.
Einem Handelsblatt-Bericht zufolge wurden Störungen in anderen Ländern bislang jedoch nicht beobachtet. Dänemark hat demnach bereits vor drei Jahren den Ausbau von chinesischen Bestandskomponenten angeordnet, Netzwerkprobleme habe es daraufhin nicht gegeben.
Mobilfunkanbieter befürchten dennoch hohe Kosten durch ein Verbot der chinesischen Mobilfunktechnik. Die Telekom, die besonders betroffen wäre, hat laut Handelsblatt schon vor einigen Jahren entsprechende Szenarien für den Fall durchgespielt, dass der Konzern chinesische Ausrüster nicht länger in seinen Netzen verwenden darf. Demnach könnte das Entfernen der Komponenten bei der Telekom bis zu fünf Jahre dauern und drei Milliarden Euro kosten.
Die Kostenbelastung könnte jedoch durch einen schrittweisen Ausbau reduziert werden, wie er laut Handelsblatt in anderen europäischen Ländern gehandhabt wird. Großbritannien etwa hat seinen Netzbetreibern eine Frist von sieben Jahren eingeräumt, die einzelnen Komponenten müssen ohnehin regelmäßig ausgetauscht werden. Frankreich geht ähnlich vor. Die Diskussion über die Sicherheitsrisiken und ein mögliches Verbot wird bereits seit mehreren Jahren geführt, die Netzbetreiber haben dennoch weiter Huawei- und ZTE-Teile verbaut.
Mehrere westliche Länder werfen Huawei und ZTE enge Verbindungen zur chinesischen Regierung vor und haben die Unternehmen mit Sanktionen belegt. Huawei und ZTE weisen die Vorwürfe zurück. flee/jul
Fast 60 Prozent von Chinas 100 größten Immobilienunternehmen haben in den ersten sieben Monaten dieses Jahres keine Grundstücke erworben, berichtet Yicai Global und bezieht sich auf eine Studie des Marktforschungsinstituts Kerry Research Center.
Demnach wurden von Januar bis Juli Grundstücke im Wert von 11,6 Billionen Yuan (rund 1,46 Billionen Euro) von Bauträgern gekauft, die in den Top 100 gelistet sind, was einem Rückgang von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Am meisten gaben China Resources Land, Binjiang Group und Poly Development für Land aus.
Die Zahlen deuten darauf hin, dass die Bauträger des Landes in dem schleppenden Markt vorsichtig mit Investitionen sind. Sollte sich der Immobilienmarkt nicht erholen, könnten die Bauträger der Studie zufolge zurückhaltend bleiben. jul

Nach Taifun “Doksuri” kämpft die Provinz Hebei weiter mit den Folgen der Regenmassen. Einsatzkräfte versuchten am Donnerstag mit Hochdruck, weitere Zehntausende eingeschlossene Menschen aus ihren Häusern zu retten und Wasser sicher aus den vollgelaufenen Stauseen abzulassen.
In dem Gebiet des Hai-He-Stroms, in dem fünf Flüsse zusammenfließen und das Hebei und die Hauptstadt Peking umfasst, würden die technischen Systeme zur Hochwasserbekämpfung auf die “schwerste Probe” seit den Überschwemmungen im Sommer 1996 gestellt, berichteten staatliche Medien. Bei der Hochwasser-Katastrophe im Einzugsgebiet des Jangtse-Flusses kamen damals etwa 2.800 Menschen ums Leben.
In den vergangenen Tagen wurden bereits mehr als 1,2 Millionen Menschen in Hebei evakuiert. Am schwersten betroffen ist die Stadt Zhuozhou südwestlich von Peking. Hier könnte es bis zu einem Monat dauern, bis die Fluten zurückweichen, sagte ein Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamtes zu staatlichen Medien.
Im Norden Chinas ist indes eine Brücke einer Fernstraße von Sturzfluten zum Einsturz gebracht worden. Zwei Autos fielen in den Fluss unter der Brücke, wie staatliche Medienberichteten. Eine Rettungsaktion dauere an, ein Abschnitt der Fernstraße sei geschlossen worden, hieß es. Das Unglück ereignete sich auf der Straße, die von Harbin nach Mudanjiang in der Provinz Heilongjiang führt, wie die Zeitung Xin Jing Bao berichtete.
Meteorologe befürchten, dass die Regenfälle noch einige Wochen anhalten könnten. rtr/jul

Architekten aller Couleur, von Büros aus den USA (I.M.Pei) bis zur Creme de la Creme europäischer Designer und Stadtplaner, pilgerten nach Peking und Shanghai und drückten der Volksrepublik ihren baumeisterlichen Stempel auf. Ganz gemäß Maos Motto: China ist ein weißes Blatt, auf das sich die schönsten Schriftzeichen pinseln lassen (一张 白纸 ….好画最新最美的画图).

Auf der illustren Liste standen etwa Meinhard von Gerkan (gmp), Albert Speer und Partner (asp) Ole Scheren, der Holländer Rem Kohlhaas, die Schweizer Herzog & de Meuron, der Franzose Paul Andreu, die irakisch-britische Zaha Hadid und Norman Foster. Ihre Wolkenkratzer prägen heute die Skyline von Shanghai; Superprojekte wie der CCTV-Tower, das Nationaltheater oder die Olympiastadien sind moderne Wahrzeichen der Pekinger City. Chinas Baugewerbe boomte.

Es war der 28. November 2008 und Shanghai noch mitten im Höhenrausch. Akio Yoshimura, Chefrepräsentant des japanischen Immobilienkonzerns Mori, lud Pekinger Korrespondenten zur Besichtigung seines 492 Meter hohen SWFC-Weltfinanzzentrums in Shanghais Sonderzone Pudong ein. Er brüstete sich, den “zweithöchsten Büroturm der Welt” nach dem Design von New Yorks Architekten Kohn Pedersen Fox (KPF) erbaut zu haben. Nur Taiwans Taipei-Tower 101 sei noch höher.

Besonders stolz war er auf die Aussichtsplattform in 474 Meter Höhe, “die höchste der Welt.” Alle Konkurrenten wirkten dagegen wie “Winzlinge.” Er meinte den wenige hundert Meter entfernten 420,5 Meter hohen Jinmao-Tower, entworfen von der US-Firma Skidmore, Owings & Merrill (SOM). Die 750 Millionen US-Dollar Kosten für seinen Wolkenkratzer hätten sich gelohnt.
Der japanische Manager wusste noch nicht, dass an diesem Tag Shanghais Stadtregierung in einer Sondersitzung den Baubeginn für ein noch höheres Haus vorfristig beschloss. Peking wollte, dass Shanghai Flagge gegen die Weltwirtschaftskrise zeigte. Tags darauf tönten Shanghais Medien: “Gegen Krise und Abwärtstrend. Shanghai baut noch höher.”
Am 29. November fiel der erste Spatenstich für das “Shanghai Zentrum” (上海中心大厦), das mit 632 Meter und einer 562 Meter hohen Aussichts-Plattform den danebenstehenden Mori-Turm haushoch überragen würde. Der US-Architekt Arthur Gensler hatte erst im Juni die Ausschreibung dafür gewonnen. Richtfest konnte er im August 2013 feiern.
Erneut lobte alle Welt das “Shanghai-Tempo”, mit dem Superprojekte hochgezogen wurden. Auch die Deutschen trugen mit vielfachen Superprojekten bei, darunter mit dem spektakulären Transrapidbau in Pudong (Thyssen), der in nur 18 Monaten gebauten Formel 1-Rennstrecke (Architekt Hermann Tilke), oder der nach deutschem Vorbild erschaffenen ökologischen Kleinstadt “Anting New Town” von Stadtplaner Abert Speer&Partner (AS&P).
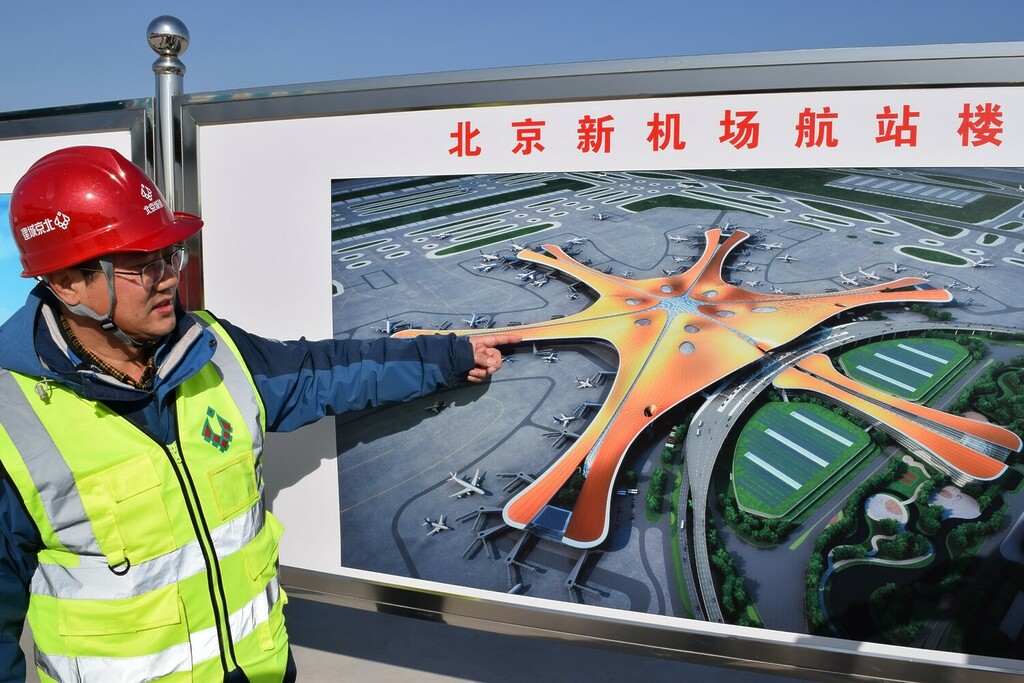
Die drei Wolkenkratzer in Pudong wurden zu neuen Wahrzeichen Shanghais. Vor 100 Jahren hatte die Hafenstadt mit ihrer Uferpromenade (Bund) und den dort nach europäischem Stil gebauten kolonialen Bank-, Zoll- und Handelshäusern Aufsehen als Gegenstück zu News Yorks Silhouette erregt. Das galt erst recht im 21. Jahrhundert, als auf Shanghais anderer Flussseite Dutzende Avantgarde-Bauten seine moderne Skyline begründeten.
Städte im ganzen Land verfielen nun dem Hochhaus-Bauwahn und machten ein seit den 1990er Jahren geflügeltes Wort vom “Wolkenkratzer-Index” populär. Er stellt einen Zusammenhang zwischen neuen Rekorden beim Bau von Wolkenkratzern und dem Niedergang von Institutionen her, die in ihnen residieren und ihren Höhepunkt überschreiten – als Warnsignal einer Krise.
Doch ein anderer Index passt besser zu China. Die jährliche MyCOS-Liste (麦可思研究院调查编著的) zeigt die Favoriten der Studienwahl und die Chancen, sechs Monate nach Uni-Abschluss einen hoch bezahlten Job zu finden. Architektur und Design standen bis 2013 auf Platz 1 unter den zehn begehrtesten Studienplätzen. Ihre Wahl garantierte zu 98,3 Prozent auch einen Arbeitsplatz mit höchstem Anfangsmonatslohn.
Doch die Architektur fiel seither aus der Topliste, kam nicht mal mehr unter die ersten zehn Fächer, meldete 2023 Chinas investigative Wochenzeitung “Nanfang Zhoumo” (南方周末). Die Webseite “Sixth Tone” schrieb: “Vor einem Jahrzehnt war sie ein Symbol für das chinesische Wirtschaftswunder.” Diese Zeiten sind vorbei. Frustriert klagte ein Absolvent, der 2018 sein Studium beendete, heute keine Arbeit mehr zu finden: “Viele von uns sind gezwungen, als Boten Lebensmittel auszufahren.”
Mehr als zwei Jahrzehnte hatte China wie am Fließband ausländische Bauwerke, sogar ganze Kleinstädte kopiert, bevor Pekings Bauministerium “allen zu großen, zu ausländischen und zu seltsamen Gebäuden” einen Riegel vorschob und verbat, Wolkenkratzer über 500 Meter Höhe zu bauen.
China hatte einst Dutzende “Weiße Häuser” nachgebaut, Triumphbögen oder Eiffelturm errichtet, sogar 2011 in Guangdong das pittoreske österreichische Alpenstädtchen Hallstadt zur Gänze nachgebaut. Meist dienten sie als Werbeobjekte für Immobiliendeals oder als Tourismusmagneten.

Es gab Ausnahmen. Sinn machte etwa ein 1999 von Shanghais Oberbürgermeister ausgeschriebenes Musterprojekt, die drohende Unbewohnbarkeit der durch Bevölkerungswachstum und Urbanisierung zersiedelten Shanghaier Metropole über einen Ring von neun attraktiven Satellitenstädten nach europäischem Vorbild zu konterkarieren. Die Frankfurter Stadtplaner Albert Speer und sein für China zuständiger Partner Johannes Dell erhielten den Auftrag, eines der Kleinstädtchen “New Town Anting” nach deutschem Vorbild zu bauen. Deutsch daran, so sagt Dell heute, waren vor allem Merkmale des Bauhaus-Stil, Raumplanung und energiesparende Versorgungstechnologie.” Aber es dauerte nach dem Fertigbau viele Jahre, bis die Shanghaier Bürger Anting zu schätzen begannen. Nur zwei der neun “europäischen” Satellitenstädte wurden tatsächlich gebaut. Das deutsche Anting und die britische “Thames Town.”
Hinter Chinas groteskem Flirt mit westlicher Architektur stecke mehr, behauptet die Journalistin Bianca Bosker, die 2013 eine umfassende Fotodokumentation verfasste. “Original Copies: Architectural mimicry in Contemporary China”. Peking hätte die massenhafte Kopiererei toleriert, um auch “sehr symbolisch” nach außen “Muskeln” vorzuzeigen, “dass es die Welt neu arrangieren kann”, indem es erst einmal die “größten Hits” des Westens nachbaut. Es sei kein Zufall, dass Modelle des ‘Weißen Hauses’, ultimatives Symbol des US-Macht, zu den meist kopierten Gebäuden in der Volksrepublik wurden.

Chinas traditionelle Architekten und Bauplaner sahen das anders. Ihr Unmut entlud sich in einer zornigen Attacke am 11. November 2013 gegen die westliche Dominanz in der zeitgenössischen Architektur. Die Akademie für Ingenieurwissenschaften war Gastgeber für die Großkonferenz in Nanjing. Frühere Minister des Bauministeriums kamen ebenso wie hohe Planungsfunktionäre, 15 Akademieräte und Vertreter aller Designinstitute. Sie erregten sich über den angeblichen Ausverkauf der Baukultur. In den Kerngebieten von Peking, Shanghai und Guangzhou seien fast alle Neubauten von Ausländern entworfen. In Bausch und Bogen verdammten sie die “vier Pekinger Prestigebauten” ausländischer Designer als “extravagant, verschwenderisch, instabil und erdbebengefährdet”, Sie nannten das Nationaltheater (国家大剧院), CCTV-Hochhaus (央视新大楼) und die Olympiastadien Vogelnest (鸟巢) und Wasserkubus (水立方). Chinas Zeitschrift “Southern Weekly” (南方周末) überschrieb ihren Report: “Kanonendonner an der Architekturfront” (中国当代建筑论坛上的”炮声”).

Ein Jahr nach der Konferenz fanden sie Gehör bei Parteichef Xi Jinping. In einer Grundsatzrede im Dezember 2014 verlangte er von Chinas Literatur und Kunst, sich dem Primat der Politik zu unterwerfen. Dabei äußerte er sich auch zum Streit über avantgardistische Architektur. Künftig sollten in Peking “keine seltsamen Gebäude” mehr auftauchen, wie etwa das CCTV-Fernsehhaus, das vom Volksmund als ‘große Unterhose’ verspottet würde. (北京市今后不太可能再出现如同”大裤衩”一样奇形怪状的建筑了)
Das war das Ende für den Höhenrausch der experimentellen Architektur. Der große Treck aus dem Ausland führt nicht mehr nach China. Für die chinesischen Baumeister sieht es aus vielerlei Gründen derzeit düster aus. Im Juli titelte die Webseite Sixth Tone: “China war ein Traum für Architekten. Nun ist es zum Alptraum geworden.”
Hugo Zhu wird neuer CEO des Elektro-Autohersteller Aiways. Er soll die Expansion ins Ausland beschleunigen.
Alan Beebe wird neuer CEO der gemeinnützigen Organisation Urban Land Institute (ULI) für die Asien-Pazifik-Region. Er war vorher Präsident der US-Handelskammer in China.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Gegendert wird auf Chinesisch zwar noch nicht, aber mit Bosie gibt es nun zumindest ein Mode-Unternehmen, das nicht zwischen Mann und Frau unterscheidet. Bosie bietet ausschließlich geschlechterneutrale Kleidung an und setzt bei seinen Geschäften auf ein silbergraues, futuristisches Raumschiff-Ambiente, wie hier beim Flagship-Store in Shanghai. In der Zukunft wird es laut Bosie also offenbar keine Geschlechtertrennung mehr geben – das zumindest könnte die Message sein.
