Ministerpräsident Li Qiang hat mit seinem Arbeitsbericht den Nationalen Volkskongress eröffnet, wie immer mit vielen Details. Dabei fällt vor allem auf, wie sehr Li auf Kontinuität setzt. Die Zielgrößen für Defizit, Inflationsziel, Arbeitslosenquote und – am wichtigsten – das Wirtschaftswachstum sind praktisch identisch mit denen von vor einem Jahr, schreibt Jörn Petring. Ein großes Konjunkturpaket legt der NVK wie erwartet nicht auf.
Das Wachstumsziel von “rund fünf Prozent” schickte die Aktienkurse am Dienstag auf Talfahrt. Dieser Wert ist allerdings durchaus nicht ohne Ehrgeiz, erklärt Finn Mayer-Kuckuk. Da Chinas Volkswirtschaft bereits etwas größer als die der EU ist, kommen bei einem Wachstum von fünf Prozent enorm viele Waren und Dienstleistungen hinzu. Dabei dient der Konsum als Schlüssel, einen kreditfinanzierten Bau- oder Investitionsboom kann die Regierung nicht noch einmal riskieren. Das wiederum ist eine gute Nachricht für deutsche Firmen, die für Chinas Konsumgütermarkt produzieren.
Stärker als die Wirtschaft soll erneut das Militärbudget wachsen. 7,2 Prozent mehr soll die Volksbefreiungsarmee in diesem Jahr bekommen. Das weckt Sorgen in der Region, die schon jetzt unter dem Druck ihres großen und immer stärker werdenden Nachbarn steht, wie Michael Radunski analysiert. Und: Gegenüber Taiwan habe der Ministerpräsident die Rhetorik auf dem Volkskongress noch einmal verschärft.
Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre,


Trotz eines ehrgeizigen Wachstumsziels von “rund fünf Prozent” und Hilfszusagen für den kriselnden Immobiliensektor hat der jährliche Regierungsbericht zum Auftakt des Volkskongresses in Peking die Stimmung in Chinas Wirtschaft nicht beflügelt. Die erste Reaktion der Märkte auf die am Dienstag von Ministerpräsident Li Qiang vorgestellten Regierungspläne für das laufende Jahr fiel ernüchternd aus. Zwar konnte sich der Shanghai Composite Index bis zum Handelsschluss noch leicht ins Plus retten. Zu einem regelrechten Ausverkauf kam es jedoch in Hongkong, wo der Hang Seng Index mit einem Minus von 2,6 Prozent schloss.
Die Anleger senkten demnach eindeutig die Daumen. Wie bereits im Vorfeld erwartet, hatte der Premier kein umfangreiches Konjunkturpaket in der Tasche. Vielmehr machte Li deutlich, dass Peking weitgehend am bisherigen Kurs festhalten wird: Geld soll nicht mehr mit der Gießkanne verteilt werden, sondern in Zukunftsbranchen und neue Technologien fließen.
“Es gab keine Überraschungen in der heutigen Rede, aber es wurden auch keine sinnvollen Lösungen präsentiert”, fasste der bekannte Pekinger Ökonom Michael Pettis seine Eindrücke vom Auftakt zusammen. Die Marschroute “Weiter so” wird auch an den besonders wichtigen Kennzahlen deutlich, die Li am Dienstag präsentierte. Viele sind gegenüber dem Vorjahr fast gleich geblieben.
Das sieht offenbar auch Regierungschef Li so: “Es wird nicht einfach sein, die diesjährigen Ziele zu erreichen”, räumte er vor den 2.872 Delegierten in der Großen Halle des Volkes ein. Man müsse “hart arbeiten” und gemeinsame Anstrengungen aller Seiten mobilisieren. Li machte deutlich, dass der Umbau der Wirtschaft weitergehen müsse. “Wir sollten an den Prinzipien des Fortschritts und der Stabilität festhalten”, sagte der Regierungschef. Erst müsse Neues geschaffen werden, bevor Altes abgeschafft werde.
Li legte Pläne vor, wonach das staatliche Budget für die Wissenschafts- und Technologieforschung gegenüber dem Vorjahr um satte zehn Prozent steigt. Auch der ebenfalls am Dienstag vorgestellte Plan der Entwicklungs- und Reformkommission machte deutlich, dass Peking bei der Förderung neuer Wirtschaftszweige unverändert aufs Tempo drücken will. Die “Nutzung wissenschaftlicher und technologischer Innovationen, um die Modernisierung des Industriesystems anzuführen”, wird hier als übergeordnetes Ziel für 2024 genannt.
“Wir werden umfassend daran arbeiten, die Autonomie und Stärke von Wissenschaft und Technologie zu erhöhen und das Grundsystem für umfassende Innovationen zu verbessern”, heißt es weiter. Man werde die “neue Industrialisierung” energisch vorantreiben. Zudem will Peking demnach “schnellere Durchbrüche bei Schlüsseltechnologien” erzielen und “neue Wachstumsmotoren” erschließen.
Erst an zweiter Stelle wird die Belebung des Konsums genannt. Zumindest für die geplagten Immobilienbesitzer gab es ein eher positives Signal. Erstmals seit Jahren tauchte die von Staats- und Parteichef Xi Jinping geprägte Formel “Wohnungen sind zum Wohnen und nicht zum Spekulieren da” nicht mehr auf.
Von einer Abkehr der strikten Politik gegen hoch verschuldete Immobilienentwickler kann zwar keine Rede sein. Aber die Führung betont in ihren Plänen, dass sie das Problem im Blick hat. So sollen die Lokalregierungen ihre “regulatorische Verantwortung wahrnehmen, um sicherzustellen, dass bereits verkaufte Häuser rechtzeitig übergeben werden”. Außerdem sollen Anstrengungen unternommen werden, um den “angemessenen Finanzierungsbedarf” von Immobilienunternehmen zu decken.

Ökonomen halten Chinas Ziel von rund fünf Prozent Wachstum für 2024 für ehrgeizig, aber machbar. “Es ist ja auch nicht als Prognose zu sehen, sondern als Signalgröße”, sagt Doris Fischer, Professorin für China Business and Economics an der Universität Würzburg zu Table.Briefings. Premier Li Qiang wolle der Öffentlichkeit sagen: Die Regierung ist bemüht, die Probleme in den Griff zu bekommen. Sein Ziel sei es, das Vertrauen in die Wirtschaft und die Konjunkturpolitik wiederherzustellen.
Fischer glaubt allerdings, dass die Wirtschaft sich weiter auseinanderentwickeln wird. Während es in einigen Branchen gut läuft, bereitet vor allem die hohe Arbeitslosigkeit Sorge. “Was ich aus China höre, ist, dass die Stimmung schlecht ist – und das gerade unter jungen Akademikern.” Für sie wird die Rede von Premier Li “kein Startschuss für neue positive Stimmung sein”.
Umso dringender erscheint eine aktive Arbeitsmarktpolitik. Doch die Regierung scheint ihren eigenen Mitteln nicht so ganz zu trauen. Sie hat als Ziel für die Arbeitslosenquote 5,5 Prozent angegeben, während der Wert laut Statistikamt im vergangenen Jahr bei 5,1 Prozent lag. Fischer erkennt hier ein Eingeständnis, dass die Arbeitslosigkeit trotz der Schaffung neuer Jobs steigen könnte.

Ökonomen zufolge müssten deutlich mehr positive Signale zusammenkommen, damit unter Verbrauchern und Firmen wieder Optimismus ausbricht. “Sie blicken verunsichert in die Zukunft“, sagt Horst Löchel, Volkswirt sowie Ko-Vorsitzender des Sino-German Centers an der Frankfurt School of Finance & Management. “Und das nicht nur, weil das Wachstum so niedrig war, sondern beispielsweise auch wegen der Regulierung der Internetfirmen in den vergangenen Jahren.”
Doch im Gesamtbild bleibt Premier Li nichts anderes übrig, als den Verbrauch zu stimulieren. Denn der private Konsum dient als Schlüssel dazu, das Wachstum den Planzielen entsprechend hoch zu halten: Einen kreditfinanzierten Bau- oder Investitionsboom kann die Regierung nicht noch einmal riskieren. “Das schuldengetriebene Wachstumsmodell ist tot”, sagt Löchel.
Die Aussicht auf eine Erholung der Ausgabenfreude gilt wiederum als gute Nachricht für die deutsche Industrie. “Wenn der Verbrauch wieder angetrieben wird, bleibt China durch seine Größe ein interessanter Markt”, sagt Fischer.
Die deutsche Wirtschaft wolle daher möglichst ihre Anteile an dem weiterhin wichtigen Markt halten, so Fischer. Das gelte für die Autoindustrie und ihre Zulieferer, aber auch für alle anderen Branchen, die direkt und indirekt von Konsumausgaben profitieren.
Li gab sich am Dienstag große Mühe, positive Signale an die Privatwirtschaft zu senden und die Befürchtungen internationaler Konzerne zu zerstreuen. Er gestand ihnen eine “große Rolle für Chinas Modernisierungsanstrengungen” zu. “So etwas kommt in der Industrie gut an”, beobachtet Löchel. China bleibe ein entscheidender Markt für internationale Strategien. Trotz Immobilien- und Schuldenkrise werde er vorerst immer wichtiger werden.
Ökonomin Fischer sieht die wichtigste Stellschraube für eine Stimulierung des Konsums darin, das Vertrauen in die Zukunft wiederherzustellen und die Sparquote zu senken. Während der Corona-Pandemie haben die chinesischen Bürgerinnen und Bürger nochmals mehr auf die hohe Kante gelegt.
Erst wenn sie sich wieder sicherer fühlen, könne auch wieder mehr Dynamik entstehen. Ein Mittel dazu wäre mehr Sozialpolitik, die den Menschen die Ängste vor Altersarmut, Krankenhauskosten und dergleichen nimmt.
Fischers Beobachtungen zufolge ist Staatschef Xi Jinping jedoch hin- und hergerissen zwischen der Erkenntnis, dass die Ungleichheit dem Zusammenhalt schadet, und einer Abneigung gegen den Sozialstaat europäischen Stils, der seiner Ansicht nach zu Trägheit verleitet. Fischers Eindruck: Im Ergebnis trage das Sozial- und Steuersystem dazu bei, die Ungleichheit zu erhalten.
Auch hier ließe sich ansetzen. Denn ein anderer Weg, den Konsum anzukurbeln, wäre, höhere Einkommen der Durchschnittsbevölkerung zuzulassen – auf Kosten der Wettbewerbsfähigkeit. Xi und seine Regierung versuchten hier seit Jahren die “Quadratur des Kreises”, Fortschritt zu schaffen, sagt Fischer, ohne dass dabei Veränderungen entstehen, die seiner Macht gefährlich werden könnten.
Aus dem NVK-Bericht gehen einige Sektoren hervor, die in den kommenden Jahren deutlich von der Förderpolitik profitieren dürften:
In einigen dieser Branchen können deutsche Unternehmen durchaus auf zusätzliche Aufträge hoffen oder von günstiger Beschaffung in China profitieren. Bei den Halbleitern könnte das durch Sanktionen erschwert sein, aber gerade im Bereich der Energieversorgung seien noch gute Kooperationen möglich, sagt Löchel.

Chinas Verteidigungsausgaben sollen in diesem Jahr um 7,2 Prozent steigen. Das geht aus dem Haushaltsplan des chinesischen Finanzministeriums hervor, der am Dienstag dem Nationalen Volkskongress vorgelegt wurde. Damit steigen die Militärausgaben voraussichtlich auf 1,67 Billionen Yuan (rund 231 Mrd. US-Dollar/214 Mrd. Euro). Wichtig ist zudem der interne Vergleich: Mit 7,2 Prozent liegt der Wert deutlich über dem angepeilten Wirtschaftswachstum von “rund fünf Prozent”.
Es ist eine besorgniserregende Entwicklung. Der Druck auf Taiwan nimmt zu, die Streitigkeiten im Ost- und Südchinesischen Meer verschärfen sich, und die Beziehungen zwischen China und den USA sind ebenfalls angespannt. “Chinas Militär ist ganz klar auf seine unmittelbaren territorialen Ziele ausgerichtet. Das sind Gebiete im Ost- und Südchinesischen Meer, aber vor allem Taiwan”, sagt Dan Smith vom renommierten Stockholm International Peace Research Institute (Sipri) zu Table.Briefings.
Vor allem Taiwan gerät zunehmend unter Druck. Auch am Dienstag verschärfte Ministerpräsident Li vor dem Volkskongress die offizielle Wortwahl in Bezug auf die demokratisch regierte Insel. So verzichtete er auf die bisher gängige Formulierung einer “friedlichen Wiedervereinigung”. Stattdessen sagte Li, man sei “entschlossen, die Sache der Wiedervereinigung Chinas voranzutreiben und die grundlegenden Interessen der chinesischen Nation zu wahren”.
Es ist zwar auch früher ab und zu vorgekommen, dass Offizielle in diesem Zusammenhang das Adjektiv “friedvoll” weggelassen haben. Aber angesichts der aktuellen Spannungen und bei einer derart wichtigen Veranstaltung wie dem Nationalen Volkskongress ist davon auszugehen, dass die Führung in Peking an diesem Dienstag auch verbal das Drohpotential gegenüber Taiwan erhöhen wollte.
Zugleich schickte Li eine indirekte Warnung an die USA: Er rief die Delegierten dazu auf, “sich entschieden gegen Taiwans Unabhängigkeits-Separatismus und gegen jede Einmischung von außen stellen”.
Vor allem der stete Anstieg des Wehretats bereitet vielen Beobachtern Sorgen. “China ist das einzige Land, das seine Militärausgaben in den vergangenen 28 Jahren jedes Jahr erhöht hat”, sagt Sipri-Chef Smith. In den vergangenen drei Jahrzehnten sind Chinas Militärausgaben jedes Jahr um mindestens 6,6 Prozent gestiegen – zuletzt sogar um mehr als 7 Prozent, obwohl das Wirtschaftswachstum stetig nachlässt.
Zudem merken Analysten an, dass die tatsächliche Zahl wohl weit über der offiziellen Summe liegen dürfte, da unter anderem die Ausgaben für Forschung und Entwicklung nicht berücksichtigt werden.

Chinas Verteidigungsausgaben sind jedenfalls längst ein zentraler Bestandteil des Staatshaushalts. Sie machen rund 40 Prozent der erwarteten Gesamtausgaben der Zentralregierung aus. Peking gibt für das Militär zehnmal so viel aus wie für Bildung. Entsprechend erklärte das Finanzministerium: Verteidigungsausgaben würden Priorität genießen, während andere Ausgaben der strikten Einhaltung von Sparauflagen unterliegen. Ministerpräsident Li betonte: “Wir in der Regierung werden auf allen Ebenen die Entwicklung der Landesverteidigung nachdrücklich unterstützen.”
Setzt man Chinas Militärausgaben ins Verhältnis zum Ausland, ergibt sich allerdings ein deutlich ausgewogeneres Bild. Der am Dienstag verkündete Anstieg des Verteidigungsbudgets bedeutet, dass Chinas Militäretat weiterhin nur etwa 1,2 bis 1,6 Prozent des BIP ausmacht. Damit bleibt die Volksrepublik deutlich unter dem Ziel der Nato-Mitglieder von jährlich 2 Prozent.

Sipri-Chef Smith verweist auf einen globalen Trend. “Insgesamt sprechen wir von einer Welt, in der mehr Geld für Militär ausgegeben wird als je zuvor. Der weltweite Aufbau der Militärs belief sich allein im vergangenen Jahr auf mehr als 2200 Billionen US-Dollar.” Hier stehen an der Spitze nach wie vor unangefochten die USA mit 877 Billionen US-Dollar im Jahr 2022, gefolgt von China mit 292 Billionen US-Dollar.
Doch in Taiwan wie auch bei Chinas Nachbarn Japan, Südkorea, Australien oder den Philippinen wird man sich kaum von internationalen Vergleichen beruhigen lassen. Sie kennen die Pläne von Xi Jinping für Chinas Militär nur allzu gut.
Chinas Staatschef hat das Ziel ausgegeben, das chinesische Militär bis 2027 zu einer “Weltklasse-Streitmacht” zu machen. Die Aufstockung des Militärbudgets stehe im Einklang mit der “vollständigen Umsetzung von Xi Jinpings Überlegungen zur Stärkung des Militärs”, heißt es im Haushaltsentwurf.
Zudem erleben Chinas Nachbarn schon jetzt in unterschiedlichsten Formen das enorme Druckpotential der chinesischen Streitkräfte. China verfügt bereits über die größte Marine der Welt – gemessen an der Zahl der Schiffe. Zusammen mit den USA und Russland ist die Volksrepublik das einzige Land, das Kampfflugzeuge der fünften Generation produziert. Und vergangene Woche warnten die USA, China steigere auch im Weltraum seine militärischen Fähigkeiten in “atemberaubendem Tempo”.
Auch Chinas Ministerpräsident Li ließ am Dienstag keinen Zweifel aufkommen. Die Führung in Peking sei fest entschlossen, Chinas Militär kampfbereit zu machen. “Die Streitkräfte werden die umfassende militärische Ausbildung und Kampfbereitschaft stärken und die nationale Souveränität, Sicherheit und Entwicklungsinteressen entschlossen wahren.”
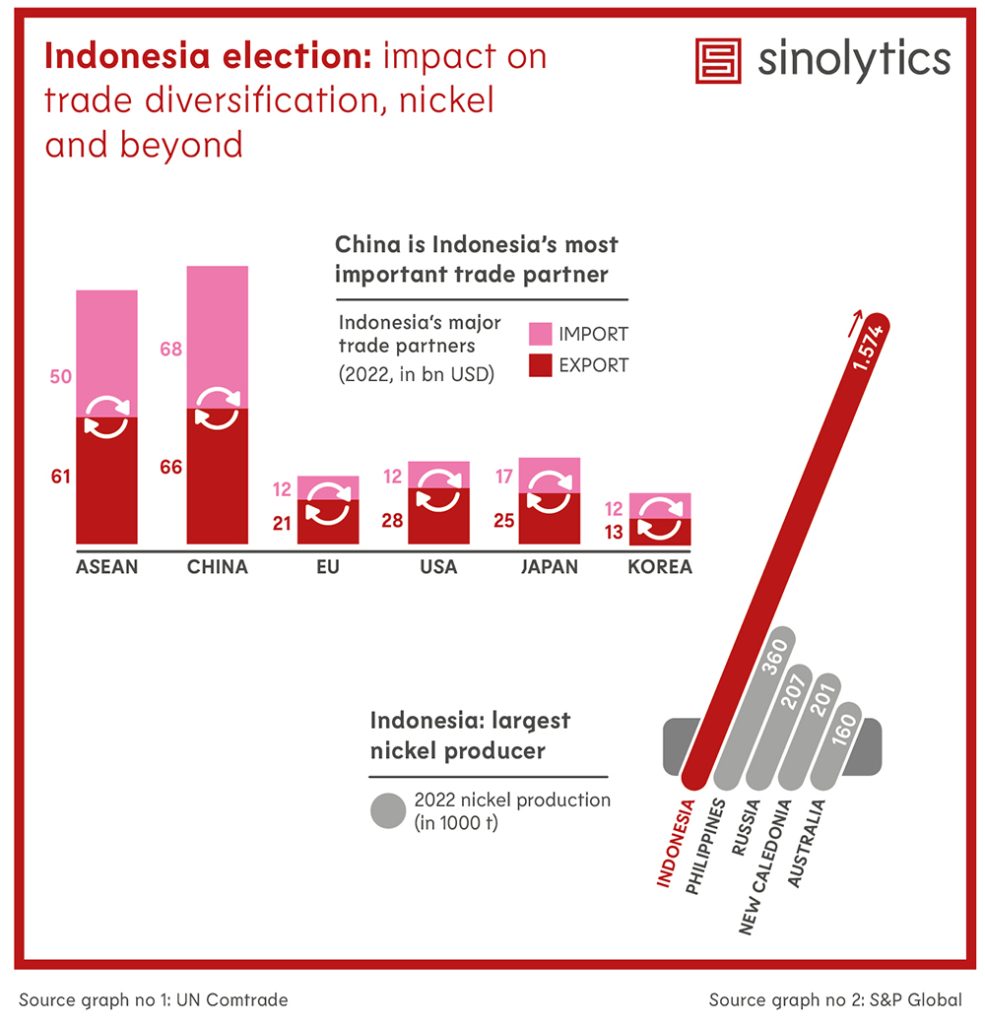
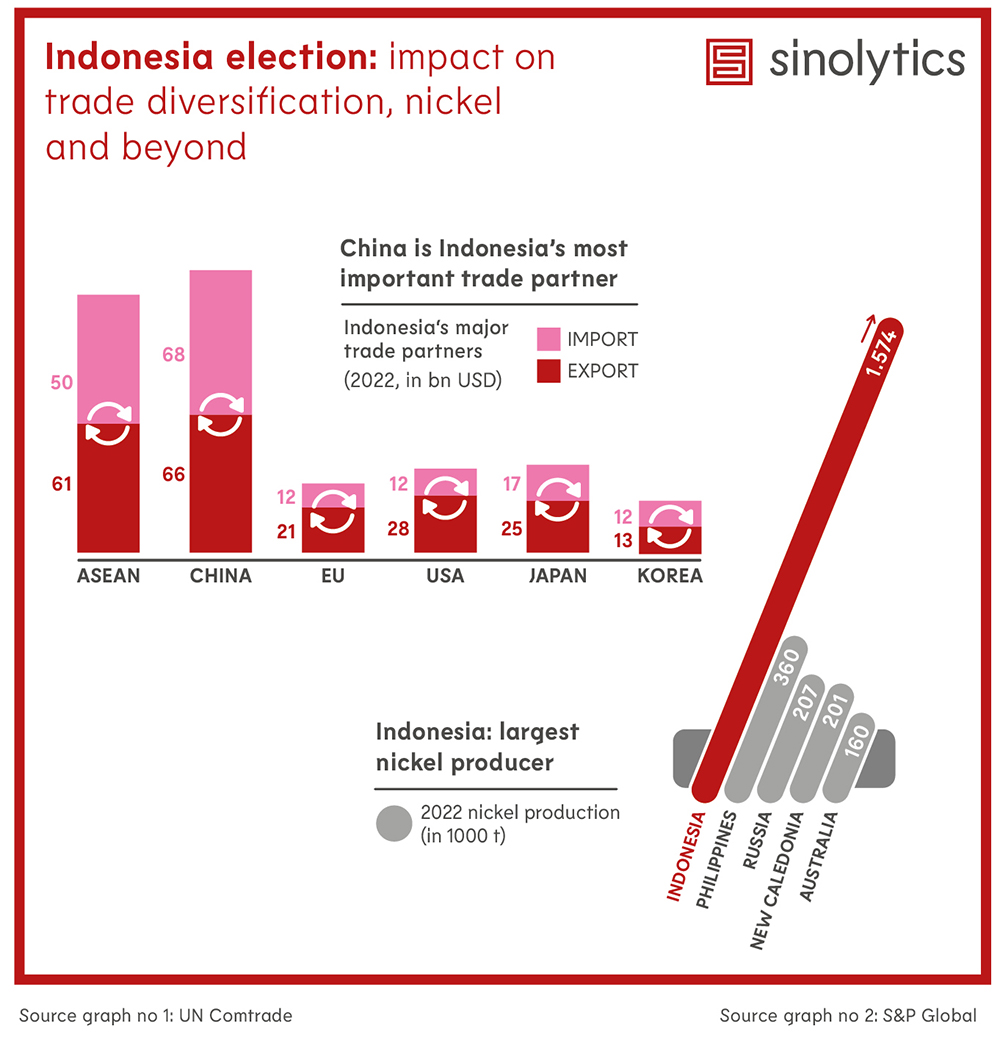
Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.
Produkte aus Zwangsarbeit sollen zukünftig nicht mehr auf dem EU-Binnenmarkt bereitgestellt, verkauft und von dort exportiert werden. EU-Parlament und Rat haben sich in der Nacht auf Dienstag über die neue Verordnung geeinigt. Anders als von Parlament und Zivilgesellschaft gefordert enthält diese zunächst keine materielle Wiedergutmachung für die Opfer von Zwangsarbeit.
Die EU-Kommission und zuständige Behörden in den Mitgliedstaaten sollen laut der Verordnung künftig Produkte ermitteln, in deren Lieferkette Menschen in Zwangsarbeit involviert sind. Zu den Kriterien gehören dabei unter anderem Ausmaß und Schwere der Zwangsarbeit und die Frage, ob diese staatlich angeordnet wurde. Der Gesetzestext geht insbesondere auf staatlich initiierte Zwangsarbeit ein.
Sektoren in Regionen mit staatlich initiierter Zwangsarbeit werden demnach in einer Datenbank identifiziert, in der die EU-Kommission Informationen über Zwangsarbeitsrisiken sammeln soll. Die Entscheidung über ein Produktverbot wird für diese Regionen auf weniger detaillierter Datengrundlage getroffen werden können. Das Parlament hatte ursprünglich gefordert, Hochrisikosektoren in Regionen mit überwiegend staatlich initiierter Zwangsarbeit zu bestimmen. Denn etwa in Xinjiang sei ein Sammeln der notwendigen Beweise in der Regel nicht möglich. Die jetzt gefundene Formulierung kommt dem Parlament ein Stück weit entgegen.
Ob das Gesetz im Rat die nötige Mehrheit erhält, ist allerdings unklar. Deutschland hatte sich bei der Abstimmung über das Verhandlungsmandat des Rates auf Druck der FDP bereits enthalten.
Nach Angaben der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) wurden im Jahr 2021 rund 27,6 Millionen Menschen zur Arbeit gezwungen – darunter etwa zwölf Prozent Kinder. 3,9 Millionen waren Opfer staatlich verordneter Zwangsarbeit, wie mutmaßlich in der chinesischen Region Xinjiang. Laut einem 2021 von der Grünen-Europapolitikerin Anna Cavazzini beauftragten Bericht profitieren mehr als 80 internationale Markenkonzerne direkt oder indirekt von Arbeit, zu der Uiguren in China gezwungen werden. leo
Der chinesische Solargigant Longi Green Energy Technology hat Peking aufgefordert, gegen niedrige Preise vorzugehen und die Qualität von Solarmodulen sicherzustellen. Überkapazitäten und der harte Wettbewerb trieben Firmen in die Pleite, sagte Longi-Chairman Zhong Baoshen am Rande des Nationalen Volkskongresses in einem Interview mit der Wirtschaftszeitung Shanghai Securities News. Einige Hersteller böten bei Ausschreibungen etwa für Solarparks Preise unter den Produktionskosten. Peking solle neue Ausschreibungsregeln einführen, die Dumping verhindern, forderte Zhong.
Die Regierung solle Unternehmen belohnen, die langlebige und zuverlässige Produkte liefern können, zitierte Bloomberg Zhong aus dem Gespräch. Longi ist in China derzeit die Nummer Zwei hinter Marktführer Jinko Solar. Zhongs Aussagen zeigen, dass die Krise in der Solarindustrie auch China selbst trifft, das die Branche global dominiert. Trotz eines Rekord-Zubaus von Solaranlagen im Land in 2023 (216,9 Gigawatt) und einer guten Prognose für 2024 müssen die Hersteller Produktionen weit unter Kapazitätsniveau drosseln und Personal entlassen.
Experten erwarten daher seit einiger Zeit eine Konsolidierung der Branche in China. Schon Ende 2023 hatte Trina-Solar-Chairman Gao Jifan gewarnt, dass kleinere Unternehmen aufgrund der extrem niedrigen Preise aus dem Markt gedrängt würden. “Im Moment bluten alle”, sagte Longis Vize-Präsident Dennis She im Februar der britischen Zeitung Financial Times. Das könnten nur die Großen überleben. Seine eigene Produktion hat Longi laut dem FT-Bericht derzeit auf 70 bis 80 Prozent der Kapazität reduziert.
Die vielen überschüssigen Solarmodule hat China seit 2023 exportiert, vor allem nach Europa. Dort sorgte das Überangebot aus der Volksrepublik für einen beispiellosen Preissturz. ck
Russland und China ziehen in Betracht, in den Jahren 2033 bis 2035 ein Kernkraftwerk auf dem Mond zu errichten. “Heute denken wir ernsthaft über ein Projekt zwischen den Jahren 2033-2035 nach, um gemeinsam mit unseren chinesischen Kollegen ein Kraftwerk auf die Mondoberfläche zu bringen und zu installieren”, sagte Juri Borissow, Leiter der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, am Dienstag. Russland und China arbeiteten gemeinsam an einem Mondprogramm, so Borissow.
China hatte Ende Februar angekündigt, der erste chinesische Astronaut solle noch vor 2030 auf dem Mond landen. Ein Kernkraftwerk könne eines Tages dann sogar den Bau von Mondsiedlungen ermöglichen, sagte Borissow. Solarzellen könnten nicht genug Strom für künftige Mondsiedlungen liefern, während die Atomkraft dazu in der Lage sei.
Russland steht mit diesen futuristisch klingenden Ideen nicht alleine da: Auch die US-Raumfahrtbehörde Nasa denkt über Atomkraftwerke auf dem Mond nach und hat bereits vor zwei Jahren Aufträge an Unternehmen vergeben, Entwürfe für die Kernenergie-Versorgung auf dem Mond zu erstellen. Der Flugzeugmotor-Hersteller Rolls-Royce stellte im vergangenen Jahr das Modell eines kleinen Kernkraftwerks vor, das auf dem Mond oder gar auf dem Mars Wärme und elektrische Energie für Menschen liefern können soll. cyb/rtr
Die Meldungen über die wachsenden Ambitionen des chinesischen E-Auto-Marktführers BYD im Ausland reißen nicht ab. BYD plane, seine Flotte von Autotransportern innerhalb von zwei Jahren auf acht zu erweitern, berichtete die japanische Zeitung Nikkei Asia am Dienstag. Damit wolle der Konzern seine Exportkapazitäten steigern. Bislang waren sieben Frachter geplant.
Fehlende Schiffsplätze sind seit einiger Zeit ein Flaschenhals für Autoexporte aus China. Am vergangenen Montag war erstmals einer der riesigen BYD-Autofrachter mit 7.000 Stellplätzen für Pkw in Bremerhaven eingelaufen und hatte dort 3.000 Fahrzeuge abgeladen.
Auch seine Produktionskapazitäten will BYD weltweit rasch ausbauen. Der Autobauer sei von der italienischen Regierung kontaktiert worden, berichtete Bloomberg vergangene Woche. Rom wolle einen zweiten Autohersteller ansiedeln, zusätzlich zum Fiat-Hersteller Stellantis. “Wir hatten einige Kontakte, um das zu besprechen”, zitierte Bloomberg den Geschäftsführer von BYD Europe, Michael Shu. Seit 2023 verkauft das Unternehmen zwei Elektromodelle in Italien. BYD konzentriere sich derzeit aber auf Ungarn, betonte Shu. Es sei daher zu früh zu sagen, ob und wann eine Entscheidung über einen zweiten Standort in Europa getroffen werde. Der Konzern hatte im Dezember den Bau einer Fabrik in Ungarn angekündigt.
Auch mit den Behörden in Mexiko verhandelt BYD über den Bau eines Werks. Die Produktion in Mexiko könnte einen zollfreien Weg auf den US-Automarkt ermöglichen. Außerdem will BYD Milliarden in intelligente Fahrzeuge stecken und ins Premium- und Luxussegment einsteigen. ck
Immer mehr chinesische Smartphone-Nutzer greifen statt zu Apple-Produkten lieber zur lokalen Konkurrenz. In den ersten sechs Wochen dieses Jahres sei der iPhone-Absatz in der Volksrepublik im Jahresvergleich um 24 Prozent eingebrochen, teilte das Research-Haus Counterpoint am Dienstag mit. Gleichzeitig habe Apples chinesischer Hauptrivale Huawei seine Verkäufe um 64 Prozent gesteigert. Insgesamt lag in dieser Zeit der Absatz im chinesischen Mobilfunkmarkt um sieben Prozent unter dem Vorjahr.
“Im oberen Preissegment sieht sich Apple einer starken Konkurrenz durch ein wiedererstarktes Huawei gegenüber, während es im mittleren Segment durch die aggressive Preispolitik von Oppo, Vivo und Xiaomi unter Druck gesetzt wird”, sagte Counterpoint-Analyst Zhang Mengmeng.
Den größten Marktanteil im untersuchten Zeitraum hatte laut Counterpoint das in Dongguan ansässige Unternehmen Vivo, das sich auf das Billigsegment konzentriert. Der Apple-Marktanteil schrumpfte derweil von 19 Prozent auf 15,7 Prozent, was nur noch Rang vier unter den größten Smartphone-Anbietern in China bedeutet. Huawei habe seinen Anteil dagegen auf 16,5 Prozent nahezu verdoppelt und rangiere auf Platz zwei. Alle Hersteller hatten unter 20 Prozent Marktanteil.
Huawei hatte im vergangenen Herbst, kurz vor der Präsentation der aktuellen iPhone-Generation, sein neues Top-Modell “Mate 60 Pro+” vorgestellt. Apple reagierte bereits im Januar mit einer seiner seltenen Rabatt-Aktionen auf die geringere Nachfrage. Chinesische Online-Händler bieten das iPhone 15 derzeit mit Nachlässen von umgerechnet 170 Euro an. rtr
Die US-Regierung erlaubt dem US-Halbleiterkonzern Advanced Micro Devices (AMD) nicht, einen eigens auf den chinesischen Markt zugeschnittenen KI-Chip auch dort zu verkaufen. Das berichtet der Nachrichtendienst Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.
AMD hatte demnach gehofft, eine Zusage aus dem Handelsministerium für den Verkauf des KI-Prozessors an chinesische Kunden zu erhalten. Der Chip hat eine geringere Leistung als die Produkte, die AMD außerhalb Chinas verkauft. Der Konzern hatte ihn eigens so entwickelt, um die US-Exportbeschränkungen zu erfüllen. US-Beamte haben AMD jedoch mitgeteilt, dass der Chip immer noch zu leistungsfähig sei.
Der Konzern müsse für den Verkauf eine Lizenz des Amts für Industrie und Sicherheit (Bureau of Industry and Security) des Handelsministeriums einholen, hieß es in dem Bericht. AMD gab keine unmittelbare Stellungnahme ab; auch das Bureau of Industry and Security wollte sich nicht äußern. Noch ist nicht bekannt, ob AMD eine entsprechende Lizenz beantragen wird. cyb
Liang Zhang hat im Januar den Posten des Head of Procurement China JV BFDA bei Daimler China übernommen. Zhang ist seit mehr als fünf Jahren in der chinesischen Autobranche tätig, zuletzt war er General Manager bei Lotus in Shanghai. Für seine neue Rolle ist er nach Peking gewechselt.
Axel Christian ist seit Januar CFO Greater China bei Carl Zeiss in Shanghai. Christian war zuvor bereits zwei Jahre lang als Head of Corporate Finance and Controlling für das global operierende Tech-Unternehmen mit Hauptsitz im baden-württembergischen Oberkochen tätig.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Taylor Swift ist die wohl beliebteste Pop-Sängerin der Gegenwart – auch in China. Bei den dortigen “Swifties” – so nennen sich die Fans der Sängerin – sorgt die Tatsache, dass ihr Idol im relativ nahegelegenen Singapur bis zum 9. März sechs exklusive Südostasien-Konzerte gibt, für Begeisterung. Erst kürzlich hatte der Stadtstaat die Visa-Bestimmungen für chinesische Touristen aufgehoben. Die Chinesen, die vom Festland anreisen, müssen für Flüge, Hotels und die rund 300 Euro teuren Konzerttickets aber tief in die Tasche greifen. Ein abgesagter Flug von Singapore Airlines (SIA) sorgte unterdessen für Panik. Die angebotenen Ersatzflüge würden sie nicht mehr rechtzeitig zum geplanten Konzert bringen, erklärten Fans.
Ministerpräsident Li Qiang hat mit seinem Arbeitsbericht den Nationalen Volkskongress eröffnet, wie immer mit vielen Details. Dabei fällt vor allem auf, wie sehr Li auf Kontinuität setzt. Die Zielgrößen für Defizit, Inflationsziel, Arbeitslosenquote und – am wichtigsten – das Wirtschaftswachstum sind praktisch identisch mit denen von vor einem Jahr, schreibt Jörn Petring. Ein großes Konjunkturpaket legt der NVK wie erwartet nicht auf.
Das Wachstumsziel von “rund fünf Prozent” schickte die Aktienkurse am Dienstag auf Talfahrt. Dieser Wert ist allerdings durchaus nicht ohne Ehrgeiz, erklärt Finn Mayer-Kuckuk. Da Chinas Volkswirtschaft bereits etwas größer als die der EU ist, kommen bei einem Wachstum von fünf Prozent enorm viele Waren und Dienstleistungen hinzu. Dabei dient der Konsum als Schlüssel, einen kreditfinanzierten Bau- oder Investitionsboom kann die Regierung nicht noch einmal riskieren. Das wiederum ist eine gute Nachricht für deutsche Firmen, die für Chinas Konsumgütermarkt produzieren.
Stärker als die Wirtschaft soll erneut das Militärbudget wachsen. 7,2 Prozent mehr soll die Volksbefreiungsarmee in diesem Jahr bekommen. Das weckt Sorgen in der Region, die schon jetzt unter dem Druck ihres großen und immer stärker werdenden Nachbarn steht, wie Michael Radunski analysiert. Und: Gegenüber Taiwan habe der Ministerpräsident die Rhetorik auf dem Volkskongress noch einmal verschärft.
Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre,


Trotz eines ehrgeizigen Wachstumsziels von “rund fünf Prozent” und Hilfszusagen für den kriselnden Immobiliensektor hat der jährliche Regierungsbericht zum Auftakt des Volkskongresses in Peking die Stimmung in Chinas Wirtschaft nicht beflügelt. Die erste Reaktion der Märkte auf die am Dienstag von Ministerpräsident Li Qiang vorgestellten Regierungspläne für das laufende Jahr fiel ernüchternd aus. Zwar konnte sich der Shanghai Composite Index bis zum Handelsschluss noch leicht ins Plus retten. Zu einem regelrechten Ausverkauf kam es jedoch in Hongkong, wo der Hang Seng Index mit einem Minus von 2,6 Prozent schloss.
Die Anleger senkten demnach eindeutig die Daumen. Wie bereits im Vorfeld erwartet, hatte der Premier kein umfangreiches Konjunkturpaket in der Tasche. Vielmehr machte Li deutlich, dass Peking weitgehend am bisherigen Kurs festhalten wird: Geld soll nicht mehr mit der Gießkanne verteilt werden, sondern in Zukunftsbranchen und neue Technologien fließen.
“Es gab keine Überraschungen in der heutigen Rede, aber es wurden auch keine sinnvollen Lösungen präsentiert”, fasste der bekannte Pekinger Ökonom Michael Pettis seine Eindrücke vom Auftakt zusammen. Die Marschroute “Weiter so” wird auch an den besonders wichtigen Kennzahlen deutlich, die Li am Dienstag präsentierte. Viele sind gegenüber dem Vorjahr fast gleich geblieben.
Das sieht offenbar auch Regierungschef Li so: “Es wird nicht einfach sein, die diesjährigen Ziele zu erreichen”, räumte er vor den 2.872 Delegierten in der Großen Halle des Volkes ein. Man müsse “hart arbeiten” und gemeinsame Anstrengungen aller Seiten mobilisieren. Li machte deutlich, dass der Umbau der Wirtschaft weitergehen müsse. “Wir sollten an den Prinzipien des Fortschritts und der Stabilität festhalten”, sagte der Regierungschef. Erst müsse Neues geschaffen werden, bevor Altes abgeschafft werde.
Li legte Pläne vor, wonach das staatliche Budget für die Wissenschafts- und Technologieforschung gegenüber dem Vorjahr um satte zehn Prozent steigt. Auch der ebenfalls am Dienstag vorgestellte Plan der Entwicklungs- und Reformkommission machte deutlich, dass Peking bei der Förderung neuer Wirtschaftszweige unverändert aufs Tempo drücken will. Die “Nutzung wissenschaftlicher und technologischer Innovationen, um die Modernisierung des Industriesystems anzuführen”, wird hier als übergeordnetes Ziel für 2024 genannt.
“Wir werden umfassend daran arbeiten, die Autonomie und Stärke von Wissenschaft und Technologie zu erhöhen und das Grundsystem für umfassende Innovationen zu verbessern”, heißt es weiter. Man werde die “neue Industrialisierung” energisch vorantreiben. Zudem will Peking demnach “schnellere Durchbrüche bei Schlüsseltechnologien” erzielen und “neue Wachstumsmotoren” erschließen.
Erst an zweiter Stelle wird die Belebung des Konsums genannt. Zumindest für die geplagten Immobilienbesitzer gab es ein eher positives Signal. Erstmals seit Jahren tauchte die von Staats- und Parteichef Xi Jinping geprägte Formel “Wohnungen sind zum Wohnen und nicht zum Spekulieren da” nicht mehr auf.
Von einer Abkehr der strikten Politik gegen hoch verschuldete Immobilienentwickler kann zwar keine Rede sein. Aber die Führung betont in ihren Plänen, dass sie das Problem im Blick hat. So sollen die Lokalregierungen ihre “regulatorische Verantwortung wahrnehmen, um sicherzustellen, dass bereits verkaufte Häuser rechtzeitig übergeben werden”. Außerdem sollen Anstrengungen unternommen werden, um den “angemessenen Finanzierungsbedarf” von Immobilienunternehmen zu decken.

Ökonomen halten Chinas Ziel von rund fünf Prozent Wachstum für 2024 für ehrgeizig, aber machbar. “Es ist ja auch nicht als Prognose zu sehen, sondern als Signalgröße”, sagt Doris Fischer, Professorin für China Business and Economics an der Universität Würzburg zu Table.Briefings. Premier Li Qiang wolle der Öffentlichkeit sagen: Die Regierung ist bemüht, die Probleme in den Griff zu bekommen. Sein Ziel sei es, das Vertrauen in die Wirtschaft und die Konjunkturpolitik wiederherzustellen.
Fischer glaubt allerdings, dass die Wirtschaft sich weiter auseinanderentwickeln wird. Während es in einigen Branchen gut läuft, bereitet vor allem die hohe Arbeitslosigkeit Sorge. “Was ich aus China höre, ist, dass die Stimmung schlecht ist – und das gerade unter jungen Akademikern.” Für sie wird die Rede von Premier Li “kein Startschuss für neue positive Stimmung sein”.
Umso dringender erscheint eine aktive Arbeitsmarktpolitik. Doch die Regierung scheint ihren eigenen Mitteln nicht so ganz zu trauen. Sie hat als Ziel für die Arbeitslosenquote 5,5 Prozent angegeben, während der Wert laut Statistikamt im vergangenen Jahr bei 5,1 Prozent lag. Fischer erkennt hier ein Eingeständnis, dass die Arbeitslosigkeit trotz der Schaffung neuer Jobs steigen könnte.

Ökonomen zufolge müssten deutlich mehr positive Signale zusammenkommen, damit unter Verbrauchern und Firmen wieder Optimismus ausbricht. “Sie blicken verunsichert in die Zukunft“, sagt Horst Löchel, Volkswirt sowie Ko-Vorsitzender des Sino-German Centers an der Frankfurt School of Finance & Management. “Und das nicht nur, weil das Wachstum so niedrig war, sondern beispielsweise auch wegen der Regulierung der Internetfirmen in den vergangenen Jahren.”
Doch im Gesamtbild bleibt Premier Li nichts anderes übrig, als den Verbrauch zu stimulieren. Denn der private Konsum dient als Schlüssel dazu, das Wachstum den Planzielen entsprechend hoch zu halten: Einen kreditfinanzierten Bau- oder Investitionsboom kann die Regierung nicht noch einmal riskieren. “Das schuldengetriebene Wachstumsmodell ist tot”, sagt Löchel.
Die Aussicht auf eine Erholung der Ausgabenfreude gilt wiederum als gute Nachricht für die deutsche Industrie. “Wenn der Verbrauch wieder angetrieben wird, bleibt China durch seine Größe ein interessanter Markt”, sagt Fischer.
Die deutsche Wirtschaft wolle daher möglichst ihre Anteile an dem weiterhin wichtigen Markt halten, so Fischer. Das gelte für die Autoindustrie und ihre Zulieferer, aber auch für alle anderen Branchen, die direkt und indirekt von Konsumausgaben profitieren.
Li gab sich am Dienstag große Mühe, positive Signale an die Privatwirtschaft zu senden und die Befürchtungen internationaler Konzerne zu zerstreuen. Er gestand ihnen eine “große Rolle für Chinas Modernisierungsanstrengungen” zu. “So etwas kommt in der Industrie gut an”, beobachtet Löchel. China bleibe ein entscheidender Markt für internationale Strategien. Trotz Immobilien- und Schuldenkrise werde er vorerst immer wichtiger werden.
Ökonomin Fischer sieht die wichtigste Stellschraube für eine Stimulierung des Konsums darin, das Vertrauen in die Zukunft wiederherzustellen und die Sparquote zu senken. Während der Corona-Pandemie haben die chinesischen Bürgerinnen und Bürger nochmals mehr auf die hohe Kante gelegt.
Erst wenn sie sich wieder sicherer fühlen, könne auch wieder mehr Dynamik entstehen. Ein Mittel dazu wäre mehr Sozialpolitik, die den Menschen die Ängste vor Altersarmut, Krankenhauskosten und dergleichen nimmt.
Fischers Beobachtungen zufolge ist Staatschef Xi Jinping jedoch hin- und hergerissen zwischen der Erkenntnis, dass die Ungleichheit dem Zusammenhalt schadet, und einer Abneigung gegen den Sozialstaat europäischen Stils, der seiner Ansicht nach zu Trägheit verleitet. Fischers Eindruck: Im Ergebnis trage das Sozial- und Steuersystem dazu bei, die Ungleichheit zu erhalten.
Auch hier ließe sich ansetzen. Denn ein anderer Weg, den Konsum anzukurbeln, wäre, höhere Einkommen der Durchschnittsbevölkerung zuzulassen – auf Kosten der Wettbewerbsfähigkeit. Xi und seine Regierung versuchten hier seit Jahren die “Quadratur des Kreises”, Fortschritt zu schaffen, sagt Fischer, ohne dass dabei Veränderungen entstehen, die seiner Macht gefährlich werden könnten.
Aus dem NVK-Bericht gehen einige Sektoren hervor, die in den kommenden Jahren deutlich von der Förderpolitik profitieren dürften:
In einigen dieser Branchen können deutsche Unternehmen durchaus auf zusätzliche Aufträge hoffen oder von günstiger Beschaffung in China profitieren. Bei den Halbleitern könnte das durch Sanktionen erschwert sein, aber gerade im Bereich der Energieversorgung seien noch gute Kooperationen möglich, sagt Löchel.

Chinas Verteidigungsausgaben sollen in diesem Jahr um 7,2 Prozent steigen. Das geht aus dem Haushaltsplan des chinesischen Finanzministeriums hervor, der am Dienstag dem Nationalen Volkskongress vorgelegt wurde. Damit steigen die Militärausgaben voraussichtlich auf 1,67 Billionen Yuan (rund 231 Mrd. US-Dollar/214 Mrd. Euro). Wichtig ist zudem der interne Vergleich: Mit 7,2 Prozent liegt der Wert deutlich über dem angepeilten Wirtschaftswachstum von “rund fünf Prozent”.
Es ist eine besorgniserregende Entwicklung. Der Druck auf Taiwan nimmt zu, die Streitigkeiten im Ost- und Südchinesischen Meer verschärfen sich, und die Beziehungen zwischen China und den USA sind ebenfalls angespannt. “Chinas Militär ist ganz klar auf seine unmittelbaren territorialen Ziele ausgerichtet. Das sind Gebiete im Ost- und Südchinesischen Meer, aber vor allem Taiwan”, sagt Dan Smith vom renommierten Stockholm International Peace Research Institute (Sipri) zu Table.Briefings.
Vor allem Taiwan gerät zunehmend unter Druck. Auch am Dienstag verschärfte Ministerpräsident Li vor dem Volkskongress die offizielle Wortwahl in Bezug auf die demokratisch regierte Insel. So verzichtete er auf die bisher gängige Formulierung einer “friedlichen Wiedervereinigung”. Stattdessen sagte Li, man sei “entschlossen, die Sache der Wiedervereinigung Chinas voranzutreiben und die grundlegenden Interessen der chinesischen Nation zu wahren”.
Es ist zwar auch früher ab und zu vorgekommen, dass Offizielle in diesem Zusammenhang das Adjektiv “friedvoll” weggelassen haben. Aber angesichts der aktuellen Spannungen und bei einer derart wichtigen Veranstaltung wie dem Nationalen Volkskongress ist davon auszugehen, dass die Führung in Peking an diesem Dienstag auch verbal das Drohpotential gegenüber Taiwan erhöhen wollte.
Zugleich schickte Li eine indirekte Warnung an die USA: Er rief die Delegierten dazu auf, “sich entschieden gegen Taiwans Unabhängigkeits-Separatismus und gegen jede Einmischung von außen stellen”.
Vor allem der stete Anstieg des Wehretats bereitet vielen Beobachtern Sorgen. “China ist das einzige Land, das seine Militärausgaben in den vergangenen 28 Jahren jedes Jahr erhöht hat”, sagt Sipri-Chef Smith. In den vergangenen drei Jahrzehnten sind Chinas Militärausgaben jedes Jahr um mindestens 6,6 Prozent gestiegen – zuletzt sogar um mehr als 7 Prozent, obwohl das Wirtschaftswachstum stetig nachlässt.
Zudem merken Analysten an, dass die tatsächliche Zahl wohl weit über der offiziellen Summe liegen dürfte, da unter anderem die Ausgaben für Forschung und Entwicklung nicht berücksichtigt werden.

Chinas Verteidigungsausgaben sind jedenfalls längst ein zentraler Bestandteil des Staatshaushalts. Sie machen rund 40 Prozent der erwarteten Gesamtausgaben der Zentralregierung aus. Peking gibt für das Militär zehnmal so viel aus wie für Bildung. Entsprechend erklärte das Finanzministerium: Verteidigungsausgaben würden Priorität genießen, während andere Ausgaben der strikten Einhaltung von Sparauflagen unterliegen. Ministerpräsident Li betonte: “Wir in der Regierung werden auf allen Ebenen die Entwicklung der Landesverteidigung nachdrücklich unterstützen.”
Setzt man Chinas Militärausgaben ins Verhältnis zum Ausland, ergibt sich allerdings ein deutlich ausgewogeneres Bild. Der am Dienstag verkündete Anstieg des Verteidigungsbudgets bedeutet, dass Chinas Militäretat weiterhin nur etwa 1,2 bis 1,6 Prozent des BIP ausmacht. Damit bleibt die Volksrepublik deutlich unter dem Ziel der Nato-Mitglieder von jährlich 2 Prozent.

Sipri-Chef Smith verweist auf einen globalen Trend. “Insgesamt sprechen wir von einer Welt, in der mehr Geld für Militär ausgegeben wird als je zuvor. Der weltweite Aufbau der Militärs belief sich allein im vergangenen Jahr auf mehr als 2200 Billionen US-Dollar.” Hier stehen an der Spitze nach wie vor unangefochten die USA mit 877 Billionen US-Dollar im Jahr 2022, gefolgt von China mit 292 Billionen US-Dollar.
Doch in Taiwan wie auch bei Chinas Nachbarn Japan, Südkorea, Australien oder den Philippinen wird man sich kaum von internationalen Vergleichen beruhigen lassen. Sie kennen die Pläne von Xi Jinping für Chinas Militär nur allzu gut.
Chinas Staatschef hat das Ziel ausgegeben, das chinesische Militär bis 2027 zu einer “Weltklasse-Streitmacht” zu machen. Die Aufstockung des Militärbudgets stehe im Einklang mit der “vollständigen Umsetzung von Xi Jinpings Überlegungen zur Stärkung des Militärs”, heißt es im Haushaltsentwurf.
Zudem erleben Chinas Nachbarn schon jetzt in unterschiedlichsten Formen das enorme Druckpotential der chinesischen Streitkräfte. China verfügt bereits über die größte Marine der Welt – gemessen an der Zahl der Schiffe. Zusammen mit den USA und Russland ist die Volksrepublik das einzige Land, das Kampfflugzeuge der fünften Generation produziert. Und vergangene Woche warnten die USA, China steigere auch im Weltraum seine militärischen Fähigkeiten in “atemberaubendem Tempo”.
Auch Chinas Ministerpräsident Li ließ am Dienstag keinen Zweifel aufkommen. Die Führung in Peking sei fest entschlossen, Chinas Militär kampfbereit zu machen. “Die Streitkräfte werden die umfassende militärische Ausbildung und Kampfbereitschaft stärken und die nationale Souveränität, Sicherheit und Entwicklungsinteressen entschlossen wahren.”
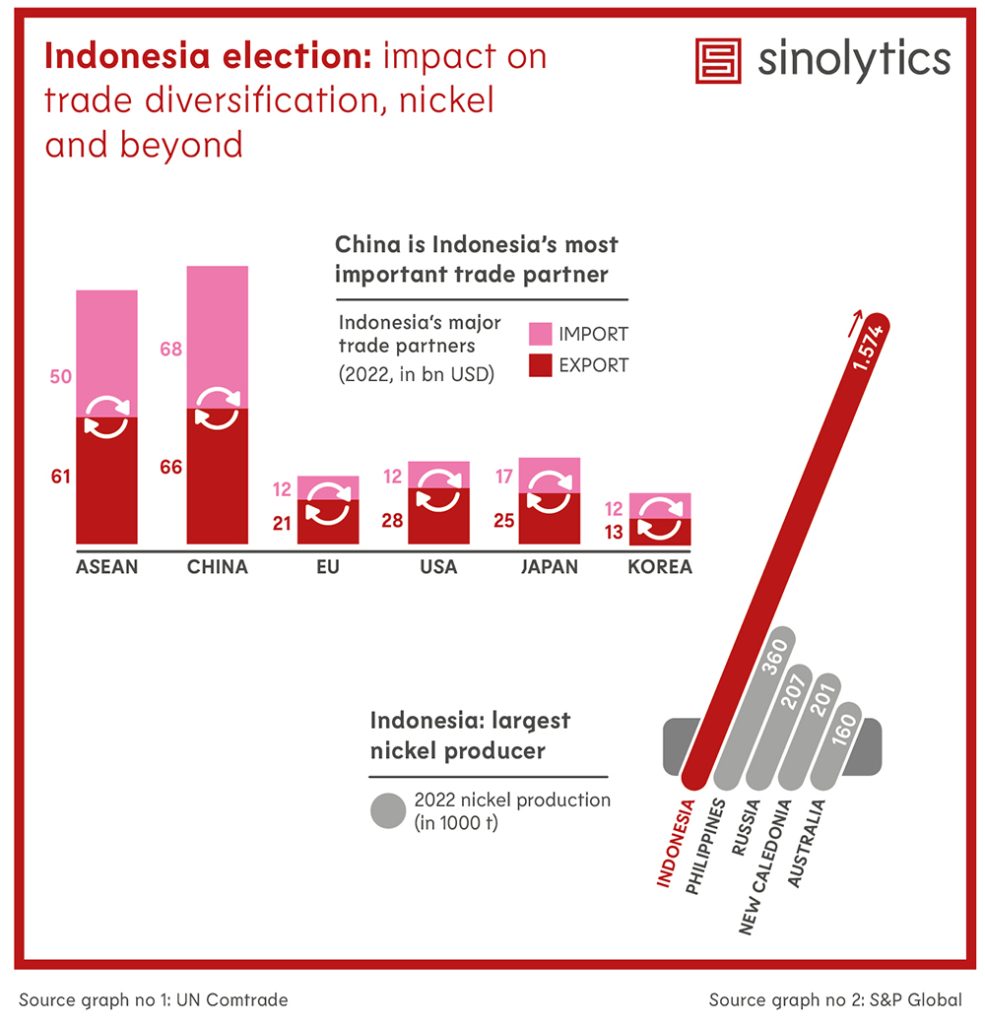
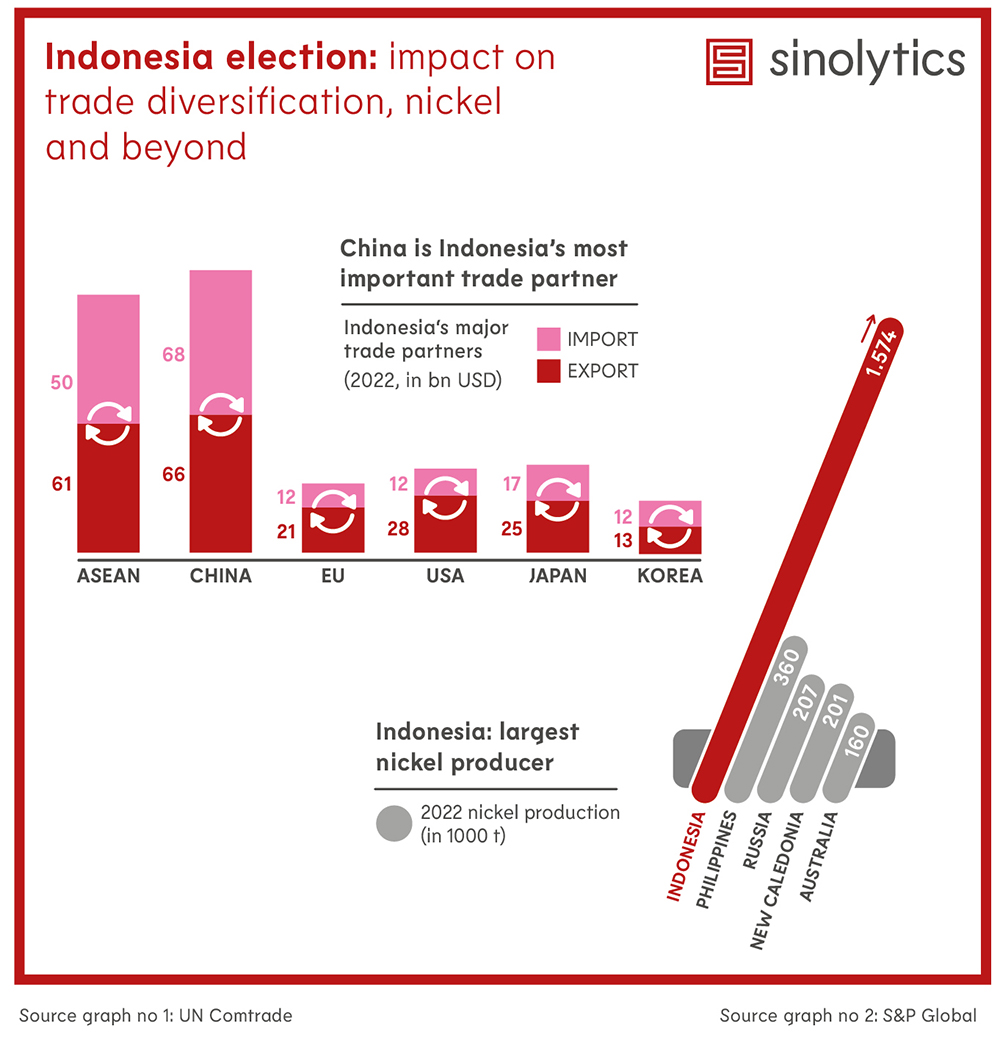
Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.
Produkte aus Zwangsarbeit sollen zukünftig nicht mehr auf dem EU-Binnenmarkt bereitgestellt, verkauft und von dort exportiert werden. EU-Parlament und Rat haben sich in der Nacht auf Dienstag über die neue Verordnung geeinigt. Anders als von Parlament und Zivilgesellschaft gefordert enthält diese zunächst keine materielle Wiedergutmachung für die Opfer von Zwangsarbeit.
Die EU-Kommission und zuständige Behörden in den Mitgliedstaaten sollen laut der Verordnung künftig Produkte ermitteln, in deren Lieferkette Menschen in Zwangsarbeit involviert sind. Zu den Kriterien gehören dabei unter anderem Ausmaß und Schwere der Zwangsarbeit und die Frage, ob diese staatlich angeordnet wurde. Der Gesetzestext geht insbesondere auf staatlich initiierte Zwangsarbeit ein.
Sektoren in Regionen mit staatlich initiierter Zwangsarbeit werden demnach in einer Datenbank identifiziert, in der die EU-Kommission Informationen über Zwangsarbeitsrisiken sammeln soll. Die Entscheidung über ein Produktverbot wird für diese Regionen auf weniger detaillierter Datengrundlage getroffen werden können. Das Parlament hatte ursprünglich gefordert, Hochrisikosektoren in Regionen mit überwiegend staatlich initiierter Zwangsarbeit zu bestimmen. Denn etwa in Xinjiang sei ein Sammeln der notwendigen Beweise in der Regel nicht möglich. Die jetzt gefundene Formulierung kommt dem Parlament ein Stück weit entgegen.
Ob das Gesetz im Rat die nötige Mehrheit erhält, ist allerdings unklar. Deutschland hatte sich bei der Abstimmung über das Verhandlungsmandat des Rates auf Druck der FDP bereits enthalten.
Nach Angaben der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) wurden im Jahr 2021 rund 27,6 Millionen Menschen zur Arbeit gezwungen – darunter etwa zwölf Prozent Kinder. 3,9 Millionen waren Opfer staatlich verordneter Zwangsarbeit, wie mutmaßlich in der chinesischen Region Xinjiang. Laut einem 2021 von der Grünen-Europapolitikerin Anna Cavazzini beauftragten Bericht profitieren mehr als 80 internationale Markenkonzerne direkt oder indirekt von Arbeit, zu der Uiguren in China gezwungen werden. leo
Der chinesische Solargigant Longi Green Energy Technology hat Peking aufgefordert, gegen niedrige Preise vorzugehen und die Qualität von Solarmodulen sicherzustellen. Überkapazitäten und der harte Wettbewerb trieben Firmen in die Pleite, sagte Longi-Chairman Zhong Baoshen am Rande des Nationalen Volkskongresses in einem Interview mit der Wirtschaftszeitung Shanghai Securities News. Einige Hersteller böten bei Ausschreibungen etwa für Solarparks Preise unter den Produktionskosten. Peking solle neue Ausschreibungsregeln einführen, die Dumping verhindern, forderte Zhong.
Die Regierung solle Unternehmen belohnen, die langlebige und zuverlässige Produkte liefern können, zitierte Bloomberg Zhong aus dem Gespräch. Longi ist in China derzeit die Nummer Zwei hinter Marktführer Jinko Solar. Zhongs Aussagen zeigen, dass die Krise in der Solarindustrie auch China selbst trifft, das die Branche global dominiert. Trotz eines Rekord-Zubaus von Solaranlagen im Land in 2023 (216,9 Gigawatt) und einer guten Prognose für 2024 müssen die Hersteller Produktionen weit unter Kapazitätsniveau drosseln und Personal entlassen.
Experten erwarten daher seit einiger Zeit eine Konsolidierung der Branche in China. Schon Ende 2023 hatte Trina-Solar-Chairman Gao Jifan gewarnt, dass kleinere Unternehmen aufgrund der extrem niedrigen Preise aus dem Markt gedrängt würden. “Im Moment bluten alle”, sagte Longis Vize-Präsident Dennis She im Februar der britischen Zeitung Financial Times. Das könnten nur die Großen überleben. Seine eigene Produktion hat Longi laut dem FT-Bericht derzeit auf 70 bis 80 Prozent der Kapazität reduziert.
Die vielen überschüssigen Solarmodule hat China seit 2023 exportiert, vor allem nach Europa. Dort sorgte das Überangebot aus der Volksrepublik für einen beispiellosen Preissturz. ck
Russland und China ziehen in Betracht, in den Jahren 2033 bis 2035 ein Kernkraftwerk auf dem Mond zu errichten. “Heute denken wir ernsthaft über ein Projekt zwischen den Jahren 2033-2035 nach, um gemeinsam mit unseren chinesischen Kollegen ein Kraftwerk auf die Mondoberfläche zu bringen und zu installieren”, sagte Juri Borissow, Leiter der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, am Dienstag. Russland und China arbeiteten gemeinsam an einem Mondprogramm, so Borissow.
China hatte Ende Februar angekündigt, der erste chinesische Astronaut solle noch vor 2030 auf dem Mond landen. Ein Kernkraftwerk könne eines Tages dann sogar den Bau von Mondsiedlungen ermöglichen, sagte Borissow. Solarzellen könnten nicht genug Strom für künftige Mondsiedlungen liefern, während die Atomkraft dazu in der Lage sei.
Russland steht mit diesen futuristisch klingenden Ideen nicht alleine da: Auch die US-Raumfahrtbehörde Nasa denkt über Atomkraftwerke auf dem Mond nach und hat bereits vor zwei Jahren Aufträge an Unternehmen vergeben, Entwürfe für die Kernenergie-Versorgung auf dem Mond zu erstellen. Der Flugzeugmotor-Hersteller Rolls-Royce stellte im vergangenen Jahr das Modell eines kleinen Kernkraftwerks vor, das auf dem Mond oder gar auf dem Mars Wärme und elektrische Energie für Menschen liefern können soll. cyb/rtr
Die Meldungen über die wachsenden Ambitionen des chinesischen E-Auto-Marktführers BYD im Ausland reißen nicht ab. BYD plane, seine Flotte von Autotransportern innerhalb von zwei Jahren auf acht zu erweitern, berichtete die japanische Zeitung Nikkei Asia am Dienstag. Damit wolle der Konzern seine Exportkapazitäten steigern. Bislang waren sieben Frachter geplant.
Fehlende Schiffsplätze sind seit einiger Zeit ein Flaschenhals für Autoexporte aus China. Am vergangenen Montag war erstmals einer der riesigen BYD-Autofrachter mit 7.000 Stellplätzen für Pkw in Bremerhaven eingelaufen und hatte dort 3.000 Fahrzeuge abgeladen.
Auch seine Produktionskapazitäten will BYD weltweit rasch ausbauen. Der Autobauer sei von der italienischen Regierung kontaktiert worden, berichtete Bloomberg vergangene Woche. Rom wolle einen zweiten Autohersteller ansiedeln, zusätzlich zum Fiat-Hersteller Stellantis. “Wir hatten einige Kontakte, um das zu besprechen”, zitierte Bloomberg den Geschäftsführer von BYD Europe, Michael Shu. Seit 2023 verkauft das Unternehmen zwei Elektromodelle in Italien. BYD konzentriere sich derzeit aber auf Ungarn, betonte Shu. Es sei daher zu früh zu sagen, ob und wann eine Entscheidung über einen zweiten Standort in Europa getroffen werde. Der Konzern hatte im Dezember den Bau einer Fabrik in Ungarn angekündigt.
Auch mit den Behörden in Mexiko verhandelt BYD über den Bau eines Werks. Die Produktion in Mexiko könnte einen zollfreien Weg auf den US-Automarkt ermöglichen. Außerdem will BYD Milliarden in intelligente Fahrzeuge stecken und ins Premium- und Luxussegment einsteigen. ck
Immer mehr chinesische Smartphone-Nutzer greifen statt zu Apple-Produkten lieber zur lokalen Konkurrenz. In den ersten sechs Wochen dieses Jahres sei der iPhone-Absatz in der Volksrepublik im Jahresvergleich um 24 Prozent eingebrochen, teilte das Research-Haus Counterpoint am Dienstag mit. Gleichzeitig habe Apples chinesischer Hauptrivale Huawei seine Verkäufe um 64 Prozent gesteigert. Insgesamt lag in dieser Zeit der Absatz im chinesischen Mobilfunkmarkt um sieben Prozent unter dem Vorjahr.
“Im oberen Preissegment sieht sich Apple einer starken Konkurrenz durch ein wiedererstarktes Huawei gegenüber, während es im mittleren Segment durch die aggressive Preispolitik von Oppo, Vivo und Xiaomi unter Druck gesetzt wird”, sagte Counterpoint-Analyst Zhang Mengmeng.
Den größten Marktanteil im untersuchten Zeitraum hatte laut Counterpoint das in Dongguan ansässige Unternehmen Vivo, das sich auf das Billigsegment konzentriert. Der Apple-Marktanteil schrumpfte derweil von 19 Prozent auf 15,7 Prozent, was nur noch Rang vier unter den größten Smartphone-Anbietern in China bedeutet. Huawei habe seinen Anteil dagegen auf 16,5 Prozent nahezu verdoppelt und rangiere auf Platz zwei. Alle Hersteller hatten unter 20 Prozent Marktanteil.
Huawei hatte im vergangenen Herbst, kurz vor der Präsentation der aktuellen iPhone-Generation, sein neues Top-Modell “Mate 60 Pro+” vorgestellt. Apple reagierte bereits im Januar mit einer seiner seltenen Rabatt-Aktionen auf die geringere Nachfrage. Chinesische Online-Händler bieten das iPhone 15 derzeit mit Nachlässen von umgerechnet 170 Euro an. rtr
Die US-Regierung erlaubt dem US-Halbleiterkonzern Advanced Micro Devices (AMD) nicht, einen eigens auf den chinesischen Markt zugeschnittenen KI-Chip auch dort zu verkaufen. Das berichtet der Nachrichtendienst Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.
AMD hatte demnach gehofft, eine Zusage aus dem Handelsministerium für den Verkauf des KI-Prozessors an chinesische Kunden zu erhalten. Der Chip hat eine geringere Leistung als die Produkte, die AMD außerhalb Chinas verkauft. Der Konzern hatte ihn eigens so entwickelt, um die US-Exportbeschränkungen zu erfüllen. US-Beamte haben AMD jedoch mitgeteilt, dass der Chip immer noch zu leistungsfähig sei.
Der Konzern müsse für den Verkauf eine Lizenz des Amts für Industrie und Sicherheit (Bureau of Industry and Security) des Handelsministeriums einholen, hieß es in dem Bericht. AMD gab keine unmittelbare Stellungnahme ab; auch das Bureau of Industry and Security wollte sich nicht äußern. Noch ist nicht bekannt, ob AMD eine entsprechende Lizenz beantragen wird. cyb
Liang Zhang hat im Januar den Posten des Head of Procurement China JV BFDA bei Daimler China übernommen. Zhang ist seit mehr als fünf Jahren in der chinesischen Autobranche tätig, zuletzt war er General Manager bei Lotus in Shanghai. Für seine neue Rolle ist er nach Peking gewechselt.
Axel Christian ist seit Januar CFO Greater China bei Carl Zeiss in Shanghai. Christian war zuvor bereits zwei Jahre lang als Head of Corporate Finance and Controlling für das global operierende Tech-Unternehmen mit Hauptsitz im baden-württembergischen Oberkochen tätig.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Taylor Swift ist die wohl beliebteste Pop-Sängerin der Gegenwart – auch in China. Bei den dortigen “Swifties” – so nennen sich die Fans der Sängerin – sorgt die Tatsache, dass ihr Idol im relativ nahegelegenen Singapur bis zum 9. März sechs exklusive Südostasien-Konzerte gibt, für Begeisterung. Erst kürzlich hatte der Stadtstaat die Visa-Bestimmungen für chinesische Touristen aufgehoben. Die Chinesen, die vom Festland anreisen, müssen für Flüge, Hotels und die rund 300 Euro teuren Konzerttickets aber tief in die Tasche greifen. Ein abgesagter Flug von Singapore Airlines (SIA) sorgte unterdessen für Panik. Die angebotenen Ersatzflüge würden sie nicht mehr rechtzeitig zum geplanten Konzert bringen, erklärten Fans.
