als Chef des Asien-Pazifik-Ausschusses gehört es zu den Aufgaben von Joe Kaeser, die Stimmung und die Interessen der Wirtschaft aufzufangen und in konkrete Positionen umzusetzen. Zugleich nimmt er zunehmend eine Rolle als Vordenker in Fragen der Handelspolitik ein: In seiner Zeit als aktiver Siemens-Manager hat er reichlich Erfahrung in der Geschäftspraxis gesammelt, als Konzernchef bewegte er sich in den vergangenen Jahren in den Korridoren der Macht. Im Interview mit China.Table gibt er der Regierung und den Unternehmen den Rat: Wir sollten es uns nicht mit China verscherzen, aber zugleich intensiv nach Alternativen suchen. Eine Exportnation kann sich Handelsstreit nicht leisten, darf aber auch nicht von einem unberechenbaren Auslandsmarkt abhängig sein.
Hat die Produktion von Billig-Pelzen uns die Pandemie gebracht? Marderhunde haben ein wunderschönes, weiches Fell. Deshalb züchten Pelztierhöfe in China sie in Massen. Der Virologe Christian Drosten vermutet hier den Ursprung der weltweit grassierenden Seuche. Durch Fahrlässigkeit bei der Haltung und barbarische Methoden bei der Schlachtung könnte das Virus auf den Menschen übergesprungen sein. Vielleicht kommt der chinesischen Führung die große Diskussion um den Laborursprung in Anbetracht dessen gerade gar nicht so unrecht. Denn eine falsche Fährte könnte vom wahren Ursprung der Pandemie ablenken.
Uran war in den Fünfziger- und Sechzigerjahre der Energierohstoff der Zukunft, die Vorräte galten seinerzeit noch als praktisch unerschöpflich. Für China ist die Kernkraft heute immer noch ein wichtiger Baustein für eine klimaneutrale Stromversorgung. Die eigenen Uranvorkommen reichen jedoch nur noch wenige Jahre, schreibt Frank Sieren. Die Techniker des Landes wollen das radioaktive Metall daher nun aus dem Meer gewinnen. Immerhin ist das eine Kraftanstrengung, die sich Deutschland wegen seiner Atom-freien Strategie sparen kann.
Einen produktive Start in die Woche wünscht


Herr Kaeser, ist die Konzentration der deutschen Wirtschaft auf China aktuell zu groß?
China ist in den letzten 40 Jahren durch Öffnungspolitik zu einem der Hauptmärkte Deutschlands geworden, noch vor den USA. Austausch und Handel haben allen Beteiligten sehr geholfen. China konnte viele Millionen Menschen aus der Armut befreien und in einigen Bereichen die technologische Führungsrolle übernehmen. Deutschen Unternehmen jeder Größenordnung hat es geholfen, neue Wachstumschancen zu erschließen. Einzelne Branchen haben inzwischen deutliche Schwerpunkte in China gesetzt, darunter die Autohersteller und die Maschinenbauer. Insofern handelt es sich um eine Partnerschaft, aus der beide Seiten Vorteile gezogen haben.
Aber?
Kein wirkliches “aber”. Nur ist mittlerweile die Lage komplexer geworden. Die Verhältnisse haben sich vor allem dadurch gewandelt, dass China mit großer Entschlossenheit eine Führungsrolle in der Weltwirtschaft anmeldet und teilweise auch bereits einnimmt. Die technischen Fähigkeiten sind zudem bereits sehr hoch entwickelt. Durch all das ist das Thema des Systemwettbewerbs aufgekommen. Die Vereinigten Staaten sind dabei, ihre Nummer-eins-Position als Wirtschaftsmacht mittelfristig zu verlieren. Sie wollen aber nicht Nummer zwei in der Weltordnung sein. Welche Nummer eins will das schon.
Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie daraus?
Die deutsche Wirtschaft wäre gut beraten, ihre Möglichkeiten zu nutzen, noch stärker auf die EU einzuwirken: Sie soll mit am Tisch sitzen und international gehört werden. Die EU muss den Welthandel von morgen im zwischenstaatlichen Raum mitgestalten. Außerdem wäre die deutsche Wirtschaft gut beraten zu schauen, welche Märkte und Partnerländer es außer China in der Region noch gibt. Asien bleibt ganz eindeutig Wachstumsmotor.
Gilt Ihre Botschaft den Verbandsmitgliedern des APA oder eher der Politik? Es steht den Firmen ja frei, zu investieren, wo sie die größten Chancen sehen.
Unser aktuelles Positionspapier ist aus den Verbänden heraus entstanden. Es ist zwar ein gewaltiger Kompromiss zwischen den Interessen verschiedener Branchen und Unternehmen. Dennoch haben wir eine gute Synthese dafür entwickelt, was das Beste für unser Land ist. Es ist eine Botschaft in mehrere Richtungen. Es ist aber auch eine Warnung: Was wir heute an chinesischem Führungsanspruch sehen, ist erst der Anfang! Der politischen Ebene wollen wir mitgeben: Deutschland allein wird zu klein sein, um beim Setzen der globalen Standards mitzureden. Wenn wir uns nicht gebündelt einbringen, wird das im Wesentlichen zwischen den USA und China stattfinden. Ob dieser Ruf von Brüssel gehört wird und etwas bringt, muss man abwarten. Wir können uns aber nicht vorwerfen lassen, nicht rechtzeitig darauf hingewiesen zu haben. Es steht viel auf dem Spiel. Denn diese Entwicklungen beeinflussen unseren Wohlstand in der Zukunft.
Ihre besondere Sorge gilt dem Setzen von Standards ohne deutsche Beteiligung?
Ja, denn das könnte besonders unseren Mittelstand treffen, der das breite Rückgrat unserer heimischen Wirtschaft ist. Die global agierenden Großunternehmen werden nicht warten, bis sich das Umfeld formiert, sie werden ihren eigenen Weg in die Lokalisierung gehen. Sie haben die Ressourcen, um das Decoupling mitzumachen. Konkret bedeutet das: Sie können für jeden Markt eigene Produkte nach den dortigen Standards entwickeln und vor Ort produzieren. Der Mittelstand hat diese Möglichkeiten nicht so einfach. Er profitiert am meisten von offenen Märkten mit gemeinsamen Standards. Kleine und mittlere Unternehmen sind jedoch das wirtschaftliche und gesellschaftliche Stabilitätselement. Alles, was zu ihrem Nachteil ist, hat Konsequenzen für den Wohlstand im Lande.
Das Investitionsabkommen CAI war ein Versuch, Unternehmen aller Größe einen verlässlicheren Zugang zum chinesischen Markt zu sichern. Jetzt kommt es auf absehbare Zeit nicht voran. Was denken Sie darüber?
Es schien, als sei es ein guter Anfang, ein solches Rahmenwerk zu bauen. Mehr war das CAI von Ausprägung und Timing her allerdings auch nicht. Jetzt sehen wir, dass es ohnehin auf Eis liegt. All das zeigt auch die Problematik, wie gespalten man eigentlich gegenüber der Wirtschaftsmacht China inzwischen ist. Dort wird man zwar auf uns schauen, aber nicht auf uns warten.
Wie könnte es jetzt weitergehen?
Im Gesamtbild liegt unsere größte Hoffnung in größerer europäischer Integration. Nur sie kann auf Dauer den Wohlstand sichern. Es wird höchste Zeit, dass hier Veränderungen geschehen. Die neue Bundesregierung muss das Thema ab Herbst mit Hochdruck angehen. Das Timing unseres Positionspapiers war der Versuch, hierzu Ermunterung und Hilfestellung bei der Priorisierung der Wirtschaftspolitik zu bieten. Deutschland als größte Volkswirtschaft in Europa, und als Technologie- und Marktführer in vielen Branchen, hat am meisten zu verlieren, wenn dieser Prozess schiefgeht.
Das neue Positionspapier regt zur Diversifizierung weg von China an, nachdem der BDI bereits im vorvergangenen Jahr kritische Töne gegen China angeschlagen hat. Setzt auf Verbandsebene eine gewisse Skepsis gegen China ein?
Wie gesagt, wir wollen wirksame Hilfestellung für die politischen Entscheidungsprozesse liefern. Dazu gehört es, Alternativen aufzuzeigen. Am Ende müssen die Unternehmen selbst entscheiden, wie sie mit Markt und Wettbewerb umgehen. Sie haben mehr zu verlieren als eine Wahl.
Sie plädieren auch für eine Rückbesinnung auf die alten Partnerländer Japan, Australien, Südkorea und Indien?
Diese sind in der Tat nicht abgemeldet. Und sie haben mit ähnlichen Verhältnissen zu kämpfen wie wir. Die meisten davon sind ebenfalls Exportländer. Teilweise weisen sie alternde Bevölkerungen auf, beispielsweise Japan, und haben damit viele Gemeinsamkeiten mit Deutschland. Wir tun gut daran, diese Wirtschaftsnationen nicht den Amerikanern zu überlassen. Präsident Joe Biden hat sich sehr, sehr schnell mit seinem Wirtschaftsteam verständigt, mit diesen Ländern enge Bande zu knüpfen. Vermutlich will er damit ein lokales Gegengewicht zur expansiven Politik Chinas aufbauen.
Haben wir Chinas Aktivitäten wie die Belt and Road Initiative nicht ernst genug genommen?
Wir haben lange unterschätzt, wie viel wirtschaftlichen aber auch geostrategischen Einfluss China mit der Belt and Road Initiative aufbaut. Jetzt müssen wir darauf achten, was die Amerikaner in dieser Situation vorhaben. Diese werden handeln und sich strategisch neu ausrichten. Mutmaßlich werden sie Taiwan, Korea, Japan und weitere Länder mit gemeinsamen strategischen Interessen an den Tisch holen. Diese werden eher mit den USA zusammenarbeiten als mit einem Europa, das geopolitisch schwer einzuordnen ist und im Zweifel als Schutzmacht ausfällt. Wir müssen in Europa darauf achten, hier nicht abgehängt zu werden.
Die Frage ist, ob die EU das hinbekommt, sich hier eindeutig zu positionieren.
Es ist tatsächlich Fakt, dass sie keine gemeinsame Außenwirtschaftsposition hat. Die Interessen gehen innerhalb der EU weit auseinander. Die einen haben Weinbauern, die anderen Fischer, wir haben zum Beispiel Auto- und Maschinenbauer. Wenn es die Einstimmigkeit von 27 Ländern braucht, dann wird es schwierig. Das sehen wir jetzt daran, wie schwer sich die EU mit Positionen zu aktuellen wirtschaftlichen und politischen Fragen tut. Kein Wunder, dass Desillusionierung unter den Bürgern einsetzt. Wenn Europa aber eine gemeinsame Außenwirtschaftsposition vertritt, können weder China noch die USA das so einfach ignorieren. Die EU ist hinter den USA immer noch der zweitgrößte Binnenmarkt der Welt.
Wenn der EU die Abstimmung ihrer China-Politik doch noch gelingen sollte – was wäre der richtige Umgang mit einer Großmacht, die sich mit ihren Gegensanktionen zunehmend unfreundlich zeigt?
Es war ja nicht nur China, das zu der Kette der Ereignisse beigetragen hat. Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es zurück. Und mit welchem Recht verweigern reiche Industrienationen den Entwicklungsländern ihren Anspruch auf Wohlstand? Hier ist viel Fingerspitzengefühl gefragt. Die Menschen müssen weiter miteinander reden und dabei auch Rücksicht auf die Gegebenheiten in dem anderen Land nehmen. Es gibt kulturelle Dinge, die man sich verdeutlichen sollte, bevor man agiert. Klar ist aber eben auch, dass China jetzt seinen Führungsanspruch mit zunehmender Deutlichkeit und Effizienz umsetzt. Keine Frage. Deshalb kommen wir an der Auseinandersetzung mit China und seinem System nicht vorbei. Der Staatskapitalismus als Regierungsform ermöglicht ein hohes Maß an Effizienz. Das System ist nicht mit unseren demokratischen Standards vereinbar. Aber es existiert nun einmal. Deshalb muss sich die demokratische Welt damit auseinandersetzen.
Technologisch ist China in einigen Bereichen bereits voraus. Wie geht es weiter?
Die Entwicklung im Bereich Consumer Internet ist an Deutschland vorbeigegangen. Wir haben gar nicht teilgenommen. Dagegen ist die Automatisierung und Digitalisierung der Industrie gut unterwegs. Zusammen mit der Entwicklung Künstlicher Intelligenz entstehen Applikationen und neue Geschäftsmodelle, bei denen wir auch in Zukunft führend sein können.
Sie meinen Industrie 4.0?
Es gibt viele Bezeichnungen dafür. Der Kern lautet: Das Internet erreicht die industrielle Welt. Entweder man ist dabei oder man ist draußen. Wer Innovationen schafft, wird leichter und schneller. Das wird ein Riesenvorteil sein. Die Innovationsgeschwindigkeit steigt rasant, die Zeit für die Markteinführung neuer Produkte sinkt. Die Produktivität in der Herstellung und Logistik steigt. Maschinen sind verbunden und lernen selbst. Hier sind wir wieder bei dem Thema der gemeinsamen Standards.
Einen großen internationalen Markt für genormte Produkte gibt es aber nur in Partnerschaft mit China. Die Integration unserer Wirtschaftsräume würde sich dabei vertiefen, statt sich zu verringern.
Deshalb spielt Datensicherheit eine immer größere Rolle. Das Internet der Dinge braucht jederzeit freien Fluss der Daten überallhin. Grenzenlose Mobilität und Konnektivität mit sicherem Schutz der Daten. Das ist eine extraterritoriale Ordnung, die wir organisieren müssen. Das ist eine große Herausforderung für die Staatengemeinschaft, die in territorialer Ordnung organisiert ist.
Die politischen Trends von Decoupling, Handelskrieg und Sanktionsspiralen laufen also direkt dem entgegen, was die Entfaltung der technischen Trends erfordert?
Genau! Die Ära Trump hat nicht gerade geholfen, die Weltpolitik mit den globalen wirtschaftlichen Erfordernissen zusammenzubringen. Wir sollten uns aber nichts vormachen. Auch die Biden-Administration wird sich nicht davon abbringen lassen, die Position der USA als Systemmacht der Welt zu verteidigen. Dazu gehört es, die US-Interessen als Wirtschaftsmacht durchzusetzen. Das Thema wird deshalb nicht weggehen. Die Rhetorik wird sich unter Biden im Vergleich zu Trump sicher wieder ändern, aber das zugrundeliegende Thema wird bleiben: der Wettbewerb um die globale wirtschaftliche und geostrategische Vormachtstellung, der auch uns als Deutschland und EU unmittelbar betrifft.
Joe Kaeser, 63, ist Vorsitzender des Asien-Pazifik-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft (APA). Von 2013 bis Februar 2021 war er Vorstandsvorsitzender von Siemens, heute ist er Aufsichtsratsvorsitzender von Siemens Energy. Kaeser hat erste Asienerfahrung bereits 1987 gesammelt, als er das Halbleitergeschäft des Konzerns in Malaysia geleitet hat. Die Fernost-Märkte blieben bei ihm seitdem immer im Fokus.
Mit dem “Hualong One” hat China im Januar dieses Jahres seinen ersten selbst entwickelten Kernreaktor in Betrieb genommen (China.Table berichtete). Es ist ein Meilenstein für die chinesische Nukleartechnologie. Doch während beim Reaktorbau die Eigenständigkeit eine neue Stufe erreicht hat, droht anderswo neue Abhängigkeit. Denn das Land hat zwar Uranreserven – angesichts der hohen Zahl laufender Reaktoren aber bei weitem keine ausreichenden.
Das verwegenste Projekt Pekings, um bei der Atomkraft voranzukommen, ist daher in der Uranförderung zu finden. Um bis 2030 zum weltweit größten Atomstromproduzenten zu werden, plant China nun Uran aus Meerwasser zu gewinnen. Die Technologie ist jedoch sehr anspruchsvoll und noch nicht ausgereift. Chinas Nuklearbehörden haben jetzt angekündigt, in etwa einem Jahrzehnt über eine voll funktionsfähige Anlage zur Gewinnung von Uran aus dem Ozean zu verfügen. Die Bauarbeiten könnten 2026 beginnen, erklärte jüngst die China Academy of Engineering Physics, die auch die Entwicklung von Atomwaffen beaufsichtigt.
Schon seit Jahrzehnten forschen Wissenschaftler:innen in den USA, China und Japan an der Urangewinnung aus Meerwasser. 2013 zum Beispiel gelang es Forschern um Lin Wenbin an der Universität von North Carolina, Substanzen zu finden, sogenannte metallorganische Gerüstverbindungen (MOFs), die in der Lage sind, das Uran wie ein Schwamm aufzusaugen. Der Vorgang ist nicht ganz einfach: In einer Milliarde Moleküle Seewasser, Salz und toten Fischresten, finden sich nur drei Atome Uran.
Dennoch halten auch westliche Wissenschaftler:innen die Forschung in diesem Bereich für sinnvoll: “In den Ozeanen der Welt findet sich fast 1.000 Mal soviel Uran wie in der Erde”, schreibt zum Beispiel das Fachportal Chemical und Engineering News. “Insgesamt rund vier Milliarden metrische Tonnen. Die reichen aus, um die Industrie für Jahrhunderte zu versorgen, wenn die Industrie stark wächst”. Zudem sei die Gewinnung von Uran aus Meerwasser sehr viel umweltfreundlicher als der Bergbau.
Vor allem in den USA gibt es prominente Unterstützer wie den Physik-Nobelpreisträger Steven Chu, dem ehemaligen Energieminister Barack Obamas. Er sagt: “Die Seewasser-Gewinnung gibt Ländern, die über kein Uran in der Erde verfügen, die Sicherheit zu wissen, dass sie genug Rohmaterial haben, um ihre Energieversorgung zu sichern.” Während die Amerikaner mit der Amtsübernahme von US-Präsident Donald Trump die entsprechenden Forschungen vernachlässigten, ist Peking drangeblieben. Doch die Kosten sind enorm: Wenn die weltweit erste Demonstrationsanlage spätestens 2035 mit der Produktion beginnt, sei es sehr wahrscheinlich, so vermuten die Wissenschaftler der China Academy of Engineering Physics, dass das so gewonnene Uran viel teurer als jenes aus der Landgewinnung wird. Die Kosten für die Gewinnung von einem Kilo Uran aus dem Meer lägen nach derzeitigen Schätzungen bei über 1.000 US-Dollar – mehr als das Zehnfache des Preises für die Gewinnung von Uran an Land.
Ob Chinas Kraftwerke sich das leisten wollen, können und dürfen ist offen. Für Peking ist es allerdings politisch wichtig, so schnell wie möglich von internationalen Zulieferern unabhängig zu werden. China verfügt nur über gut zehn Prozent der Weltreserven an Uran und ist auf Lieferungen aus Kasachstan, Kanada und Australien angewiesen. Doch die Uran-Förderung aus Meerwasser läuft dem Ziel Pekings zuwider, die Kosten der Atomenergie so weit zu senken, dass sie wettbewerbsfähig ist mit Wind- und Solarenergie.
Der Erfolgsdruck, unter dem Peking steht, ist groß: Der Energiebedarf der 1,4 Milliarden Chines:innen ist nach wie vor hoch. Die Wirtschaft wächst und neue Städte und Industrien müssen mit immer mehr Strom versorgt werden. Gleichzeitig will China bei weiter wachsendem Energieverbrauch bis 2060 klimaneutral sein.
Der Anteil der Kernenergie, der im vergangenen Jahr fast fünf Prozent der Stromproduktion ausmachte, wächst dabei langsamer als die Wind- und Solarenergie. Dank sinkender Ausrüstungskosten und Subventionen wurden in den vergangenen Jahren unzählige Wind- und Solarprojekte gebaut. Mittlerweile machen sie zusammen fast zehn Prozent der Stromproduktion Chinas aus. Laut Branchen-Analysten könnte diese Zahl bis 2030 auf 26 Prozent und bis 2060 auf 63 Prozent steigen, was dann weit über den zu erwartenden zwölf Prozent der Kernenergie liegen würde. Insgesamt würde die Kohle-Abhängigkeit verringert.
Bei der derzeitigen Baurate von sechs bis acht Atomreaktoren pro Jahr würde China nach einer offiziellen Schätzung bis 2035 jährlich etwa 35.000 metrische Tonnen Uran benötigen. Heute sind es bereits rund 11.000. Nimmt man einen Durchschnittswert von 23.000 Tonnen an, wären Chinas Reserven von 170.000 Tonnen in gut sieben Jahren aufgebraucht. Dass die Volksrepublik gleichzeitig mit zwei der drei großen Lieferanten, namentlich Australien und Kanada, politisch im Clinch liegt, macht Peking nervös.
Mit den eigenen Meilern will sich China daher unabhängiger vom Ausland machen – und kann obendrein die Kosten senken. “Wenn innerhalb des 62-monatigen Fertigstellungsplans weitere Anlagen geliefert werden können, werden die Kosten akzeptabel und wettbewerbsfähig sein”, erklärt Lin Boqiang, Dekan des China Institute for Studies in Energy Policy der Xiamen University. Das Ziel ist, dass die Anlagen im Vergleich zur Wind- und Solarenergie wettbewerbsfähig werden. Das könne vor allem mit niedrigeren Baukosten und längeren Laufzeiten gelingen. Derzeit hat China, so die World Nuclear Association (WNA), sechs 1100 MW Hualong One Anlagen im Bau.
Christian Drosten, Virologe an der Berliner Charité, hat in der Diskussion über den Ursprung des Coronavirus Stellung bezogen. Einen Laborunfall halte er für unwahrscheinlich, sagte er dem Magazin “Republik” aus der Schweiz in einem Interview. Er sei stattdessen ein Anhänger der Theorie, die den Ursprung in der chinesischen Pelztierproduktion sieht. Drosten hält demnach die massenhafte Zucht von Tieren wie Marderhunden und Schleichkatzen virologisch für hochgefährlich. Es gelangten immer wieder gefährliche Erreger in die Pelztierhöfe. Bei der Schlachtung – einem grausamen Vorgang mit enger Beteiligung des Personals – können die Viren Dorsten zufolge auf Menschen überspringen.
Auch Drosten hält damit einen Ursprung mit menschlicher Mitwirkung in China für plausibel – nur eben nicht im Labor, sondern auf Zuchthöfen für Marderhunde. Möglicherweise lassen sich die Vorgänge jedoch rückblickend nicht aufklären: “Wenn man jetzt solche Bestände untersuchen würde, würde man vielleicht nicht mehr das Virus finden, das da – möglicherweise – vor anderthalb oder zwei Jahren gewesen ist”, so Drosten in dem Interview. Zugleich bedauert er es, dass in China keine transparente, konsequente Überprüfung dieser These läuft. Drosten ist jedenfalls keine laufende Untersuchung zu Virus-Varianten in chinesischen Pelztierbeständen bekannt.
Die Fortsetzung der Pelztierproduktion in China und anderswo hält Drosten unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten generell für fahrlässig. Er hatte nach dem Ausbruch des ersten Sars-Coronavirus im Jahr 2003 gehofft, dass die Praxis abgeschafft wird. Damals war das Virus von Marderhunden auf Menschen übergersprungen, wie Drosten und andere Wissenschaftler nachgewiesen haben. Durch die immer intensivere Nutzung von Tieren bei Zerstörung ihres natürlichen Lebensraumes steige insgesamt die Gefahr neuer Pandemien. fin
Die Zulassung des chinesischen Sinovac-Impfstoffes in der EU wird nach Ansicht des gesundheitspolitischen Sprechers der EVP-Fraktion im Europaparlament, Peter Liese (CDU), noch einige Zeit dauern. Er gehe eher von Monaten als Wochen aus, sagte Liese China.Table. Ein Grund dafür sei, dass die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) auch Inspektionen vor Ort durchführen müsse, was sich in China “nicht ganz so einfach” gestalte. Bei der EMA läuft das Überprüfungsverfahren für Sinovac seit Anfang Mai. Für die Impfkampagne in der EU und Deutschland ist Sinovac nicht dringend benötigt, weil die Liefermengen von Biontech Ende Juli stark zunehmen werden, wie Liese betont. Zudem werde für Juni mit einer Zulassung für den CureVac-Impfstoff gerechnet. Der chinesische Sinovac-Impfstoff käme aber beispielsweise künftig für Kinder infrage, so Liese, da es sich um einen inaktivierten Ganzvirus-Impfstoff und nicht mRNA-Impfstoff handelt.
Die Abgeordneten des EU-Parlaments stimmen in dieser Woche über die finale Zustimmung zum digitalen EU-Covid-Zertifikat für Bürger:innen der EU und auch Drittstaaten ab. Es soll Reisen während der Pandemie erleichtern. In dem Entwurf der Verordnung überlässt Brüssel es den Mitgliedsstaaten, auch Impfzertifikate über Vakzine, die bisher keine EU-Zulassung haben, anzuerkennen. Darunter auch Impfstoffe, “für die eine Notfallzulassung der WHO vorliegt”, wie es in der Verordnung heißt. Sinovac hat eine Notzulassung der Weltgesundheitsorganisation erhalten. Wer in China mit diesem Präparat geimpft ist, hätte damit eine höhere Wahrscheinlichkeit der Anerkennung des Impfschutzes als mit Sinopharm geimpfte Menschen.
Der EU-Abgeordnete Bernd Lange (SPD), Mitglied der Kontaktgruppe Impfstoffe des Parlaments, rechnet aber letztendlich auch mit einer EMA-Zulassung für Sinovac: “Ich gehe davon aus, dass es kommen wird”, sagte Lange China.Table. Die Sicherheit gehe jedoch vor, weshalb die Zulassung genau geprüft werden müsse. Er sieht die Beteiligung Chinas am weltweiten Impfprogramm als unerlässlich. Derzeit würden lediglich zwei große Regionen Vakzine an Länder mit schlechterem Zugang exportieren, so Lange, und das seien die EU und China. ari
Ein deutliches Bekenntnis der deutschen Wirtschaft zu Menschenrechten in China: Der Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie (BDI), Siegfried Russwurm, hat an die deutschen Unternehmen appelliert, bei Geschäften in der Volksrepublik auf ihre Einhaltung zu bestehen. “China ist ein wachsender Wettbewerber, der immer wieder gegen die globalen Regeln verstößt. Als Exportland müssen wir eine Grenze ziehen, an der die Kompromissfähigkeit aufhört: Menschenrechte sind keine innere Angelegenheit“, sagte der Chef des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) der Bild am Sonntag.
Russwurm sprach explizit auch die Situation in der Provinz Xinjiang im Nordwesten der Volksrepublik an. Dort gibt es seit Jahren Spannungen zwischen der muslimischen Minderheit der Uiguren auf der einen Seite und den zugezogenen Han-Chinesen aus dem Osten und Süden des Landes. Die chinesische Führung geht seit einigen Jahren rabiat gegen die Uiguren vor, sperrt sie in Lager und schränkt die Ausübung ihres muslimischen Glaubens ein. Was China mit der muslimischen Minderheit der Uiguren mache, sei “völlig inakzeptabel”, sagt nun der BDI-Präsident. Jedes Unternehmen mit Werken in Xinjiang müsse sich fragen, ob es ausschließen könne, dass es in seiner Wertschöpfungskette zu Zwangsarbeit komme. flee
Die staatliche chinesische Reederei COSCO will sich offenbar am Hamburger Hafen beteiligen. Das Unternehmen verhandele bereits mit dem Hafenbetreiber, berichtet der NDR. Konkret will die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) dem chinesischen Investor einen Anteil von 30 bis 40 Prozent an dem Containerterminal Tollerort abtreten. Tollerort ist eines der vier großen Containerterminals im Hamburger Hafen. Wenn das Geschäft zustande komme, könnten Schiffe von COSCO dort eine Vorzugsbehandlung erwarten, so der Fernsehsender. Die Bundesregierung habe keine Bedenken gegen die Übernahme, hieß es in dem Bericht. fin
In Budapest haben tausende Menschen gegen den geplanten Bau des umstrittenen Ablegers der chinesischen Fudan-Universität demonstriert. Sie marschierten am Samstag in der ungarischen Hauptstadt in Richtung des Parlaments, wie mehrere Medien berichteten. Die Demonstranten kritisierten, dass eine von der KP Chinas kontrollierte Einrichtung aus ungarischen Steuergeldern finanziert werden soll.
Die Kosten für den Bau des Campus werden auf etwa 1,5 Milliarden Euro geschätzt. Der größte Teil davon, rund 1,3 Milliarden Euro, sollen durch ein Darlehen einer chinesischen Bank gedeckt werden, wie aus Dokumenten hervorging, die das ungarische Investigativ-Portal Direkt36 offenlegte. Unmut gibt es in Budapest zudem darüber, dass der Uni-Ableger auf einem Gelände errichtet werden soll, das eigentlich für den Bau günstiger Studentenwohnungen vorgesehen war.
Budapests Oberbürgermeister Gergely Karácsony ist gegen das Projekt. Karácsony stellte den Berichten zufolge in einer Rede bei der Protest-Veranstaltung klar, dass sich die Demonstration weder gegen China noch gegen die Chines:innen richte, sondern gegen die von Premier Viktor Orbán betriebene Beschneidung der Freiheit der Wissenschaft. Die Stadt hatte vergangene Woche aus Protest gegen das Bauprojekt umliegende Straßen des künftigen Campus umbenannt und ihnen unter anderem die Namen “Dalai-Lama-Straße” oder “Freies-Hongkong-Straße” gegeben. ari
US-Präsident Joe Biden setzt die Sanktionen seines Vorgängers gegen chinesische Unternehmen fort – und verschärft sie noch. Per Verwaltungsdirektive ordnete er Beschränkungen für Kapitalbeteiligungen an Firmen an, denen er Verbindungen zum chinesischen Sicherheitsapparat unterstellt. Die Schwarze Liste (Entity List) umfasst nun 59 Unternehmen. Darunter befinden sich der Telekommunikationsausrüster Huawei und Hikvision, ein Anbieter von Überwachungskameras. Die neue Anweisung wird am 2. August wirksam. Trumps ursprüngliches Dekret betraf nur 31 Unternehmen.
Bidens Verfügung verbietet es US-Amerikanern, in die genannten Unternehmen zu investieren – beispielsweise durch den Kauf von Aktien. Die Praxis chinesischer Unternehmen, sich am Börsenstandort New York mit Kapital zu versorgen, findet damit derzeit ein Ende. Wichtige Unternehmen wie China Mobile wenden sich wieder einheimischen Aktienmärkten zu. Biden begründet das Dekret mit den “ungewöhnlichen Bedrohungen”, die er von seinem Land abwenden müsse. China protestierte gegen die Erweiterung der Liste: Biden verletze “nicht nur die legitimen Rechte chinesischer Unternehmen, sondern auch die von globalen Investoren”. Trotz der weiterhin harten Linie gegen China habe die Regierung Biden allerdings einen sachlicheren Dialog mit Peking in Handelsfragen aufgenommen, berichtet CNN. fin

Seit Herbst 2019 ist Moritz Körner Abgeordneter im Europäischen Parlament und dort Mitglied der Delegation für die Beziehungen zur Volksrepublik China. An Delegationsreisen nach Peking ist in Pandemie-Zeiten nicht zu denken. Stattdessen hatte Körner bislang lediglich einige Gespräche mit der chinesischen Vertretung zur EU in Brüssel. “Das ist schade”, sagt er im Videogespräch. “Als neues, junges Mitglied des Parlaments hätte mich sehr interessiert, gerade mit jungen Menschen aus China ins Gespräch zu kommen.”
Moritz Körner, im rheinländischen Langenfeld aufgewachsen, ist mit 30 Jahren weit unter dem Altersdurchschnitt der Europaabgeordneten, der in dieser Legislaturperiode fast 50 Jahre beträgt. Auch vorher, in der FDP-Landespolitik, gehörte er stets zu den Jüngeren: Mit 16 Jahren trat er den Jungen Liberalen in Nordrhein-Westfalen bei und war von 2013 bis 2018 deren Vorsitzender. Mit 26 Jahren ließ er sich zum damals jüngsten Landtagsabgeordneten in Düsseldorf wählen.
Für die China-Delegation hat sich Moritz Körner nicht bloß wegen seiner Reisepräferenzen entschieden. “Wir müssen China ernster nehmen, daran führt kein Weg mehr vorbei”, sagt er. “Gerade als junger Abgeordneter habe ich das Gefühl, dass China uns noch sehr lange beschäftigen wird.” Die Volksrepublik sei auf dem Weg, Weltmacht oder mindestens ebenbürtig mit den USA zu sein. Dies verändere die Weltordnung erheblich. Wenn nun China seine eigenen Vorstellungen von Menschenrechten immer stärker in den Rest der Welt exportiert – was bedeutet das für eine freie Gesellschaft, wie Körner sie sich vorstellt? Solche Fragen beschäftigen den 30-Jährigen.
Die EU müsse allerdings nicht nur in Bezug auf Menschenrechte konsequenter ihre Werte vertreten. Politik und Wirtschaft dürften nicht isoliert voneinander betrachtet werden, findet Moritz Körner – zum Beispiel mit Blick auf die Seidenstraßen-Initiative: “Wir sehen, dass viele Länder in eine Abhängigkeit von China geraten”, erklärt er. “Die Frage ist: Wird die EU das einfach zulassen? Oder müssen wir uns stärker in Rivalität positionieren?“
Im Europäischen Parlament sitzt Moritz Körner auch im Haushaltsausschuss und im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Inneres und Justiz. Viele Themen überschneiden sich mit China-Fragen – zum Beispiel die Kritik an Tiktok, die derzeit vor allem unter Jüngeren beliebte chinesische Video-App (China.Table berichtete über den Gründer Zhang Yiming). Die Plattform soll laut der US-amerikanischen Kartellbehörde illegal persönliche Daten von Kindern gesammelt haben. Dazu stellte Körner im Herbst 2019 eine Anfrage an die Europäische Kommission. Er wollte herausfinden, was an den Vorwürfen dran ist und ob es bereits eine Untersuchung gibt. Die Antwort der Kommission: Die nationalen Datenschutzbehörden seien zuständig. Der Datenschutzausschuss des Europäischen Parlaments leitete zwar eine Untersuchung ein – “mehr ist bislang leider noch nicht passiert”, sagt Körner.
Er selbst hat deshalb keinen Tiktok-Account. “Ich habe nichts gegen die App, aber ich möchte, dass sie sich an europäische Regeln hält. Ich sehe es skeptisch, wenn da möglicherweise der chinesische Staat Einfluss hat“, so Körner. Dafür nutzt er fast alle anderen Social Media Plattformen – und hat einen eigenen Podcast: In “Europa, wir müssen reden” spricht er in jeder Folge eine halbe Stunde lang mit Kolleg:innen aus anderen Parteien und Mitgliedstaaten. “Politik wirkt furchtbar weit weg”, sagt er. “Wir müssen viel mehr kommunizieren, was wir machen – gerade als Europaabgeordnete.” Leonie Düngefeld
Laura Matz will become Chief Science and Technology Officer at chemicals and pharmaceuticals group Merck on July 1. Matz’s responsibilities will then include Digital, Enterprise Data, Future Insight, and the company’s Innovation Hubs in China, Israel, the United States, and at Group headquarters in Darmstadt. Matz had been Head of Planarization in Merck’s semiconductor materials business since 2019.
Fiona Ip will become Regional Treasurer Asia Pacific at Deutsche Bank, effective July 1. Ip was previously APAC Head of Capital Management and Debt Issuance and Treasurer for Singapore at the German bank.
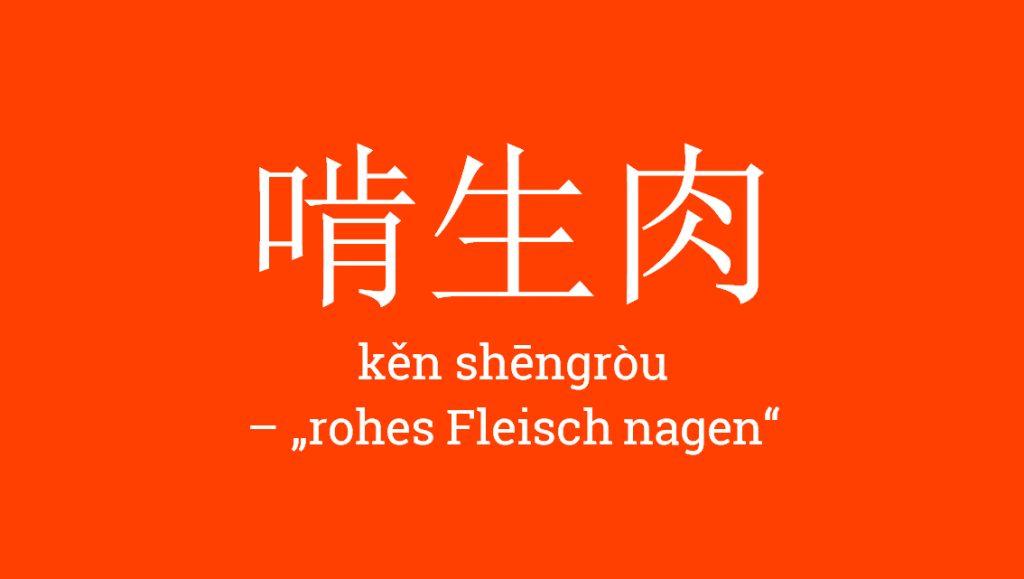
Müssen Vegetarier jetzt ganz stark sein? Gleich die Entwarnung: nein. Denn in diesem Beitrag geht es nicht wirklich um den beherzten Biss in ein rohes, blutiges Steak, sondern vielmehr um das “Nagen” an schwer verdaulicher geistiger Kost. Denn als 生肉 shēngròu – wörtlich “rohes Fleisch” – werden in Chinas Netzgemeinde ausländische Filme, Serien, Cartoons und Co. bezeichnet, die bisher nur in der Fremdsprache vorliegen, also noch nicht durch entsprechende Übersetzung für das chinesische Publikum “vorverdaut” wurden. Wer es nicht abwarten kann und sich solche Clips vorab zu Gemüte führt, nur gewappnet mit ein paar wackeligen Fremdsprachkenntnissen oder – noch schlimmer – unter Zuhilfenahme mehr oder weniger verlässlicher Übersetzungssoftware, hat eben schwer daran zu beißen. Oder, wie der Chinese sagen würde, er “nagt an rohem Fleisch” (啃生肉 kěn shēngròu). Sprachlich mundgerecht vorübersetzte Produktionen nennt man entsprechend 熟肉 shóuròu – “gares Fleisch”.
Im Fernsehen und auf den offiziellen Videoportalen in China sind Schriftzeichenuntertitel selbst bei heimischen Formaten Standard. Einige Hollywood-Produktion werden gar synchronisiert wie in Deutschland üblich. Doch vieles, was über YouTube, Netflix und TikTok an ausländischen Videoschnipseln inoffiziell nach China schwappt, muss erst einmal übersetzt werden. Dem hat sich eine ganze Armada von Freiwilligen, bestehend aus jungen Fremdsprachenlernern, verschrieben. Sie übertragen neue Videoclips oft in Windeseile ins Chinesische. Und dies öffnet auch das eine oder andere Nischenfenster jenseits des chinesischen Videomainstreams. So schaffte es etwa im Jahr 2011/2012 die deutsche Schauspielerin Martina Hill mit ihrer Comedy-Reihe “Knallerfrauen” in China kurzzeitig zu unverhoffter Berühmtheit, als chinesische Austauschstudenten begannen, Auszüge der SAT1-Serie in Eigenregie unter dem chinesischen Titel 屌丝女士 (Diǎosī Nǚshì) ins Chinesische zu übersetzen und online zu stellen. Auf diese Weise wurde deutsche Comedy-Lustigkeit erstmals einem größeren chinesischen Internetpublikum vertraut.
Copyright-mäßig bewegen sich die Hobbyübersetzer natürlich auf äußerst dünnem Eis. Andererseits eröffnen sie als Graswurzel-Initiative sonst kaum zugängliche Nischenkanäle für den Kulturaustausch. Jüngstes Beispiel hierfür ist das deutsche Flirtformat “Princess Charming” des Streamingdienstes TVNOW – die erste lesbische Datingshow im deutschen Mainstream-Fernsehen. Schon nach Ausstrahlung der ersten Folge brodelte Chinas “Untertitelküche” gehörig und “garte” Auszüge der Realityshow sprachlich für die eigene LGBTQ*-Community auf. Und die jubelte und gab ihre Freude sogar über Instagram und andere Social-Media-Kanäle direkt an die überraschten deutschen Protagonistinnen weiter. Kulturaustausch einmal ganz anders eben, die sprachliche “Garküche” macht’s möglich.
Verena Menzel betreibt in Peking die Online-Sprachschule www.new-chinese.org.
als Chef des Asien-Pazifik-Ausschusses gehört es zu den Aufgaben von Joe Kaeser, die Stimmung und die Interessen der Wirtschaft aufzufangen und in konkrete Positionen umzusetzen. Zugleich nimmt er zunehmend eine Rolle als Vordenker in Fragen der Handelspolitik ein: In seiner Zeit als aktiver Siemens-Manager hat er reichlich Erfahrung in der Geschäftspraxis gesammelt, als Konzernchef bewegte er sich in den vergangenen Jahren in den Korridoren der Macht. Im Interview mit China.Table gibt er der Regierung und den Unternehmen den Rat: Wir sollten es uns nicht mit China verscherzen, aber zugleich intensiv nach Alternativen suchen. Eine Exportnation kann sich Handelsstreit nicht leisten, darf aber auch nicht von einem unberechenbaren Auslandsmarkt abhängig sein.
Hat die Produktion von Billig-Pelzen uns die Pandemie gebracht? Marderhunde haben ein wunderschönes, weiches Fell. Deshalb züchten Pelztierhöfe in China sie in Massen. Der Virologe Christian Drosten vermutet hier den Ursprung der weltweit grassierenden Seuche. Durch Fahrlässigkeit bei der Haltung und barbarische Methoden bei der Schlachtung könnte das Virus auf den Menschen übergesprungen sein. Vielleicht kommt der chinesischen Führung die große Diskussion um den Laborursprung in Anbetracht dessen gerade gar nicht so unrecht. Denn eine falsche Fährte könnte vom wahren Ursprung der Pandemie ablenken.
Uran war in den Fünfziger- und Sechzigerjahre der Energierohstoff der Zukunft, die Vorräte galten seinerzeit noch als praktisch unerschöpflich. Für China ist die Kernkraft heute immer noch ein wichtiger Baustein für eine klimaneutrale Stromversorgung. Die eigenen Uranvorkommen reichen jedoch nur noch wenige Jahre, schreibt Frank Sieren. Die Techniker des Landes wollen das radioaktive Metall daher nun aus dem Meer gewinnen. Immerhin ist das eine Kraftanstrengung, die sich Deutschland wegen seiner Atom-freien Strategie sparen kann.
Einen produktive Start in die Woche wünscht


Herr Kaeser, ist die Konzentration der deutschen Wirtschaft auf China aktuell zu groß?
China ist in den letzten 40 Jahren durch Öffnungspolitik zu einem der Hauptmärkte Deutschlands geworden, noch vor den USA. Austausch und Handel haben allen Beteiligten sehr geholfen. China konnte viele Millionen Menschen aus der Armut befreien und in einigen Bereichen die technologische Führungsrolle übernehmen. Deutschen Unternehmen jeder Größenordnung hat es geholfen, neue Wachstumschancen zu erschließen. Einzelne Branchen haben inzwischen deutliche Schwerpunkte in China gesetzt, darunter die Autohersteller und die Maschinenbauer. Insofern handelt es sich um eine Partnerschaft, aus der beide Seiten Vorteile gezogen haben.
Aber?
Kein wirkliches “aber”. Nur ist mittlerweile die Lage komplexer geworden. Die Verhältnisse haben sich vor allem dadurch gewandelt, dass China mit großer Entschlossenheit eine Führungsrolle in der Weltwirtschaft anmeldet und teilweise auch bereits einnimmt. Die technischen Fähigkeiten sind zudem bereits sehr hoch entwickelt. Durch all das ist das Thema des Systemwettbewerbs aufgekommen. Die Vereinigten Staaten sind dabei, ihre Nummer-eins-Position als Wirtschaftsmacht mittelfristig zu verlieren. Sie wollen aber nicht Nummer zwei in der Weltordnung sein. Welche Nummer eins will das schon.
Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie daraus?
Die deutsche Wirtschaft wäre gut beraten, ihre Möglichkeiten zu nutzen, noch stärker auf die EU einzuwirken: Sie soll mit am Tisch sitzen und international gehört werden. Die EU muss den Welthandel von morgen im zwischenstaatlichen Raum mitgestalten. Außerdem wäre die deutsche Wirtschaft gut beraten zu schauen, welche Märkte und Partnerländer es außer China in der Region noch gibt. Asien bleibt ganz eindeutig Wachstumsmotor.
Gilt Ihre Botschaft den Verbandsmitgliedern des APA oder eher der Politik? Es steht den Firmen ja frei, zu investieren, wo sie die größten Chancen sehen.
Unser aktuelles Positionspapier ist aus den Verbänden heraus entstanden. Es ist zwar ein gewaltiger Kompromiss zwischen den Interessen verschiedener Branchen und Unternehmen. Dennoch haben wir eine gute Synthese dafür entwickelt, was das Beste für unser Land ist. Es ist eine Botschaft in mehrere Richtungen. Es ist aber auch eine Warnung: Was wir heute an chinesischem Führungsanspruch sehen, ist erst der Anfang! Der politischen Ebene wollen wir mitgeben: Deutschland allein wird zu klein sein, um beim Setzen der globalen Standards mitzureden. Wenn wir uns nicht gebündelt einbringen, wird das im Wesentlichen zwischen den USA und China stattfinden. Ob dieser Ruf von Brüssel gehört wird und etwas bringt, muss man abwarten. Wir können uns aber nicht vorwerfen lassen, nicht rechtzeitig darauf hingewiesen zu haben. Es steht viel auf dem Spiel. Denn diese Entwicklungen beeinflussen unseren Wohlstand in der Zukunft.
Ihre besondere Sorge gilt dem Setzen von Standards ohne deutsche Beteiligung?
Ja, denn das könnte besonders unseren Mittelstand treffen, der das breite Rückgrat unserer heimischen Wirtschaft ist. Die global agierenden Großunternehmen werden nicht warten, bis sich das Umfeld formiert, sie werden ihren eigenen Weg in die Lokalisierung gehen. Sie haben die Ressourcen, um das Decoupling mitzumachen. Konkret bedeutet das: Sie können für jeden Markt eigene Produkte nach den dortigen Standards entwickeln und vor Ort produzieren. Der Mittelstand hat diese Möglichkeiten nicht so einfach. Er profitiert am meisten von offenen Märkten mit gemeinsamen Standards. Kleine und mittlere Unternehmen sind jedoch das wirtschaftliche und gesellschaftliche Stabilitätselement. Alles, was zu ihrem Nachteil ist, hat Konsequenzen für den Wohlstand im Lande.
Das Investitionsabkommen CAI war ein Versuch, Unternehmen aller Größe einen verlässlicheren Zugang zum chinesischen Markt zu sichern. Jetzt kommt es auf absehbare Zeit nicht voran. Was denken Sie darüber?
Es schien, als sei es ein guter Anfang, ein solches Rahmenwerk zu bauen. Mehr war das CAI von Ausprägung und Timing her allerdings auch nicht. Jetzt sehen wir, dass es ohnehin auf Eis liegt. All das zeigt auch die Problematik, wie gespalten man eigentlich gegenüber der Wirtschaftsmacht China inzwischen ist. Dort wird man zwar auf uns schauen, aber nicht auf uns warten.
Wie könnte es jetzt weitergehen?
Im Gesamtbild liegt unsere größte Hoffnung in größerer europäischer Integration. Nur sie kann auf Dauer den Wohlstand sichern. Es wird höchste Zeit, dass hier Veränderungen geschehen. Die neue Bundesregierung muss das Thema ab Herbst mit Hochdruck angehen. Das Timing unseres Positionspapiers war der Versuch, hierzu Ermunterung und Hilfestellung bei der Priorisierung der Wirtschaftspolitik zu bieten. Deutschland als größte Volkswirtschaft in Europa, und als Technologie- und Marktführer in vielen Branchen, hat am meisten zu verlieren, wenn dieser Prozess schiefgeht.
Das neue Positionspapier regt zur Diversifizierung weg von China an, nachdem der BDI bereits im vorvergangenen Jahr kritische Töne gegen China angeschlagen hat. Setzt auf Verbandsebene eine gewisse Skepsis gegen China ein?
Wie gesagt, wir wollen wirksame Hilfestellung für die politischen Entscheidungsprozesse liefern. Dazu gehört es, Alternativen aufzuzeigen. Am Ende müssen die Unternehmen selbst entscheiden, wie sie mit Markt und Wettbewerb umgehen. Sie haben mehr zu verlieren als eine Wahl.
Sie plädieren auch für eine Rückbesinnung auf die alten Partnerländer Japan, Australien, Südkorea und Indien?
Diese sind in der Tat nicht abgemeldet. Und sie haben mit ähnlichen Verhältnissen zu kämpfen wie wir. Die meisten davon sind ebenfalls Exportländer. Teilweise weisen sie alternde Bevölkerungen auf, beispielsweise Japan, und haben damit viele Gemeinsamkeiten mit Deutschland. Wir tun gut daran, diese Wirtschaftsnationen nicht den Amerikanern zu überlassen. Präsident Joe Biden hat sich sehr, sehr schnell mit seinem Wirtschaftsteam verständigt, mit diesen Ländern enge Bande zu knüpfen. Vermutlich will er damit ein lokales Gegengewicht zur expansiven Politik Chinas aufbauen.
Haben wir Chinas Aktivitäten wie die Belt and Road Initiative nicht ernst genug genommen?
Wir haben lange unterschätzt, wie viel wirtschaftlichen aber auch geostrategischen Einfluss China mit der Belt and Road Initiative aufbaut. Jetzt müssen wir darauf achten, was die Amerikaner in dieser Situation vorhaben. Diese werden handeln und sich strategisch neu ausrichten. Mutmaßlich werden sie Taiwan, Korea, Japan und weitere Länder mit gemeinsamen strategischen Interessen an den Tisch holen. Diese werden eher mit den USA zusammenarbeiten als mit einem Europa, das geopolitisch schwer einzuordnen ist und im Zweifel als Schutzmacht ausfällt. Wir müssen in Europa darauf achten, hier nicht abgehängt zu werden.
Die Frage ist, ob die EU das hinbekommt, sich hier eindeutig zu positionieren.
Es ist tatsächlich Fakt, dass sie keine gemeinsame Außenwirtschaftsposition hat. Die Interessen gehen innerhalb der EU weit auseinander. Die einen haben Weinbauern, die anderen Fischer, wir haben zum Beispiel Auto- und Maschinenbauer. Wenn es die Einstimmigkeit von 27 Ländern braucht, dann wird es schwierig. Das sehen wir jetzt daran, wie schwer sich die EU mit Positionen zu aktuellen wirtschaftlichen und politischen Fragen tut. Kein Wunder, dass Desillusionierung unter den Bürgern einsetzt. Wenn Europa aber eine gemeinsame Außenwirtschaftsposition vertritt, können weder China noch die USA das so einfach ignorieren. Die EU ist hinter den USA immer noch der zweitgrößte Binnenmarkt der Welt.
Wenn der EU die Abstimmung ihrer China-Politik doch noch gelingen sollte – was wäre der richtige Umgang mit einer Großmacht, die sich mit ihren Gegensanktionen zunehmend unfreundlich zeigt?
Es war ja nicht nur China, das zu der Kette der Ereignisse beigetragen hat. Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es zurück. Und mit welchem Recht verweigern reiche Industrienationen den Entwicklungsländern ihren Anspruch auf Wohlstand? Hier ist viel Fingerspitzengefühl gefragt. Die Menschen müssen weiter miteinander reden und dabei auch Rücksicht auf die Gegebenheiten in dem anderen Land nehmen. Es gibt kulturelle Dinge, die man sich verdeutlichen sollte, bevor man agiert. Klar ist aber eben auch, dass China jetzt seinen Führungsanspruch mit zunehmender Deutlichkeit und Effizienz umsetzt. Keine Frage. Deshalb kommen wir an der Auseinandersetzung mit China und seinem System nicht vorbei. Der Staatskapitalismus als Regierungsform ermöglicht ein hohes Maß an Effizienz. Das System ist nicht mit unseren demokratischen Standards vereinbar. Aber es existiert nun einmal. Deshalb muss sich die demokratische Welt damit auseinandersetzen.
Technologisch ist China in einigen Bereichen bereits voraus. Wie geht es weiter?
Die Entwicklung im Bereich Consumer Internet ist an Deutschland vorbeigegangen. Wir haben gar nicht teilgenommen. Dagegen ist die Automatisierung und Digitalisierung der Industrie gut unterwegs. Zusammen mit der Entwicklung Künstlicher Intelligenz entstehen Applikationen und neue Geschäftsmodelle, bei denen wir auch in Zukunft führend sein können.
Sie meinen Industrie 4.0?
Es gibt viele Bezeichnungen dafür. Der Kern lautet: Das Internet erreicht die industrielle Welt. Entweder man ist dabei oder man ist draußen. Wer Innovationen schafft, wird leichter und schneller. Das wird ein Riesenvorteil sein. Die Innovationsgeschwindigkeit steigt rasant, die Zeit für die Markteinführung neuer Produkte sinkt. Die Produktivität in der Herstellung und Logistik steigt. Maschinen sind verbunden und lernen selbst. Hier sind wir wieder bei dem Thema der gemeinsamen Standards.
Einen großen internationalen Markt für genormte Produkte gibt es aber nur in Partnerschaft mit China. Die Integration unserer Wirtschaftsräume würde sich dabei vertiefen, statt sich zu verringern.
Deshalb spielt Datensicherheit eine immer größere Rolle. Das Internet der Dinge braucht jederzeit freien Fluss der Daten überallhin. Grenzenlose Mobilität und Konnektivität mit sicherem Schutz der Daten. Das ist eine extraterritoriale Ordnung, die wir organisieren müssen. Das ist eine große Herausforderung für die Staatengemeinschaft, die in territorialer Ordnung organisiert ist.
Die politischen Trends von Decoupling, Handelskrieg und Sanktionsspiralen laufen also direkt dem entgegen, was die Entfaltung der technischen Trends erfordert?
Genau! Die Ära Trump hat nicht gerade geholfen, die Weltpolitik mit den globalen wirtschaftlichen Erfordernissen zusammenzubringen. Wir sollten uns aber nichts vormachen. Auch die Biden-Administration wird sich nicht davon abbringen lassen, die Position der USA als Systemmacht der Welt zu verteidigen. Dazu gehört es, die US-Interessen als Wirtschaftsmacht durchzusetzen. Das Thema wird deshalb nicht weggehen. Die Rhetorik wird sich unter Biden im Vergleich zu Trump sicher wieder ändern, aber das zugrundeliegende Thema wird bleiben: der Wettbewerb um die globale wirtschaftliche und geostrategische Vormachtstellung, der auch uns als Deutschland und EU unmittelbar betrifft.
Joe Kaeser, 63, ist Vorsitzender des Asien-Pazifik-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft (APA). Von 2013 bis Februar 2021 war er Vorstandsvorsitzender von Siemens, heute ist er Aufsichtsratsvorsitzender von Siemens Energy. Kaeser hat erste Asienerfahrung bereits 1987 gesammelt, als er das Halbleitergeschäft des Konzerns in Malaysia geleitet hat. Die Fernost-Märkte blieben bei ihm seitdem immer im Fokus.
Mit dem “Hualong One” hat China im Januar dieses Jahres seinen ersten selbst entwickelten Kernreaktor in Betrieb genommen (China.Table berichtete). Es ist ein Meilenstein für die chinesische Nukleartechnologie. Doch während beim Reaktorbau die Eigenständigkeit eine neue Stufe erreicht hat, droht anderswo neue Abhängigkeit. Denn das Land hat zwar Uranreserven – angesichts der hohen Zahl laufender Reaktoren aber bei weitem keine ausreichenden.
Das verwegenste Projekt Pekings, um bei der Atomkraft voranzukommen, ist daher in der Uranförderung zu finden. Um bis 2030 zum weltweit größten Atomstromproduzenten zu werden, plant China nun Uran aus Meerwasser zu gewinnen. Die Technologie ist jedoch sehr anspruchsvoll und noch nicht ausgereift. Chinas Nuklearbehörden haben jetzt angekündigt, in etwa einem Jahrzehnt über eine voll funktionsfähige Anlage zur Gewinnung von Uran aus dem Ozean zu verfügen. Die Bauarbeiten könnten 2026 beginnen, erklärte jüngst die China Academy of Engineering Physics, die auch die Entwicklung von Atomwaffen beaufsichtigt.
Schon seit Jahrzehnten forschen Wissenschaftler:innen in den USA, China und Japan an der Urangewinnung aus Meerwasser. 2013 zum Beispiel gelang es Forschern um Lin Wenbin an der Universität von North Carolina, Substanzen zu finden, sogenannte metallorganische Gerüstverbindungen (MOFs), die in der Lage sind, das Uran wie ein Schwamm aufzusaugen. Der Vorgang ist nicht ganz einfach: In einer Milliarde Moleküle Seewasser, Salz und toten Fischresten, finden sich nur drei Atome Uran.
Dennoch halten auch westliche Wissenschaftler:innen die Forschung in diesem Bereich für sinnvoll: “In den Ozeanen der Welt findet sich fast 1.000 Mal soviel Uran wie in der Erde”, schreibt zum Beispiel das Fachportal Chemical und Engineering News. “Insgesamt rund vier Milliarden metrische Tonnen. Die reichen aus, um die Industrie für Jahrhunderte zu versorgen, wenn die Industrie stark wächst”. Zudem sei die Gewinnung von Uran aus Meerwasser sehr viel umweltfreundlicher als der Bergbau.
Vor allem in den USA gibt es prominente Unterstützer wie den Physik-Nobelpreisträger Steven Chu, dem ehemaligen Energieminister Barack Obamas. Er sagt: “Die Seewasser-Gewinnung gibt Ländern, die über kein Uran in der Erde verfügen, die Sicherheit zu wissen, dass sie genug Rohmaterial haben, um ihre Energieversorgung zu sichern.” Während die Amerikaner mit der Amtsübernahme von US-Präsident Donald Trump die entsprechenden Forschungen vernachlässigten, ist Peking drangeblieben. Doch die Kosten sind enorm: Wenn die weltweit erste Demonstrationsanlage spätestens 2035 mit der Produktion beginnt, sei es sehr wahrscheinlich, so vermuten die Wissenschaftler der China Academy of Engineering Physics, dass das so gewonnene Uran viel teurer als jenes aus der Landgewinnung wird. Die Kosten für die Gewinnung von einem Kilo Uran aus dem Meer lägen nach derzeitigen Schätzungen bei über 1.000 US-Dollar – mehr als das Zehnfache des Preises für die Gewinnung von Uran an Land.
Ob Chinas Kraftwerke sich das leisten wollen, können und dürfen ist offen. Für Peking ist es allerdings politisch wichtig, so schnell wie möglich von internationalen Zulieferern unabhängig zu werden. China verfügt nur über gut zehn Prozent der Weltreserven an Uran und ist auf Lieferungen aus Kasachstan, Kanada und Australien angewiesen. Doch die Uran-Förderung aus Meerwasser läuft dem Ziel Pekings zuwider, die Kosten der Atomenergie so weit zu senken, dass sie wettbewerbsfähig ist mit Wind- und Solarenergie.
Der Erfolgsdruck, unter dem Peking steht, ist groß: Der Energiebedarf der 1,4 Milliarden Chines:innen ist nach wie vor hoch. Die Wirtschaft wächst und neue Städte und Industrien müssen mit immer mehr Strom versorgt werden. Gleichzeitig will China bei weiter wachsendem Energieverbrauch bis 2060 klimaneutral sein.
Der Anteil der Kernenergie, der im vergangenen Jahr fast fünf Prozent der Stromproduktion ausmachte, wächst dabei langsamer als die Wind- und Solarenergie. Dank sinkender Ausrüstungskosten und Subventionen wurden in den vergangenen Jahren unzählige Wind- und Solarprojekte gebaut. Mittlerweile machen sie zusammen fast zehn Prozent der Stromproduktion Chinas aus. Laut Branchen-Analysten könnte diese Zahl bis 2030 auf 26 Prozent und bis 2060 auf 63 Prozent steigen, was dann weit über den zu erwartenden zwölf Prozent der Kernenergie liegen würde. Insgesamt würde die Kohle-Abhängigkeit verringert.
Bei der derzeitigen Baurate von sechs bis acht Atomreaktoren pro Jahr würde China nach einer offiziellen Schätzung bis 2035 jährlich etwa 35.000 metrische Tonnen Uran benötigen. Heute sind es bereits rund 11.000. Nimmt man einen Durchschnittswert von 23.000 Tonnen an, wären Chinas Reserven von 170.000 Tonnen in gut sieben Jahren aufgebraucht. Dass die Volksrepublik gleichzeitig mit zwei der drei großen Lieferanten, namentlich Australien und Kanada, politisch im Clinch liegt, macht Peking nervös.
Mit den eigenen Meilern will sich China daher unabhängiger vom Ausland machen – und kann obendrein die Kosten senken. “Wenn innerhalb des 62-monatigen Fertigstellungsplans weitere Anlagen geliefert werden können, werden die Kosten akzeptabel und wettbewerbsfähig sein”, erklärt Lin Boqiang, Dekan des China Institute for Studies in Energy Policy der Xiamen University. Das Ziel ist, dass die Anlagen im Vergleich zur Wind- und Solarenergie wettbewerbsfähig werden. Das könne vor allem mit niedrigeren Baukosten und längeren Laufzeiten gelingen. Derzeit hat China, so die World Nuclear Association (WNA), sechs 1100 MW Hualong One Anlagen im Bau.
Christian Drosten, Virologe an der Berliner Charité, hat in der Diskussion über den Ursprung des Coronavirus Stellung bezogen. Einen Laborunfall halte er für unwahrscheinlich, sagte er dem Magazin “Republik” aus der Schweiz in einem Interview. Er sei stattdessen ein Anhänger der Theorie, die den Ursprung in der chinesischen Pelztierproduktion sieht. Drosten hält demnach die massenhafte Zucht von Tieren wie Marderhunden und Schleichkatzen virologisch für hochgefährlich. Es gelangten immer wieder gefährliche Erreger in die Pelztierhöfe. Bei der Schlachtung – einem grausamen Vorgang mit enger Beteiligung des Personals – können die Viren Dorsten zufolge auf Menschen überspringen.
Auch Drosten hält damit einen Ursprung mit menschlicher Mitwirkung in China für plausibel – nur eben nicht im Labor, sondern auf Zuchthöfen für Marderhunde. Möglicherweise lassen sich die Vorgänge jedoch rückblickend nicht aufklären: “Wenn man jetzt solche Bestände untersuchen würde, würde man vielleicht nicht mehr das Virus finden, das da – möglicherweise – vor anderthalb oder zwei Jahren gewesen ist”, so Drosten in dem Interview. Zugleich bedauert er es, dass in China keine transparente, konsequente Überprüfung dieser These läuft. Drosten ist jedenfalls keine laufende Untersuchung zu Virus-Varianten in chinesischen Pelztierbeständen bekannt.
Die Fortsetzung der Pelztierproduktion in China und anderswo hält Drosten unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten generell für fahrlässig. Er hatte nach dem Ausbruch des ersten Sars-Coronavirus im Jahr 2003 gehofft, dass die Praxis abgeschafft wird. Damals war das Virus von Marderhunden auf Menschen übergersprungen, wie Drosten und andere Wissenschaftler nachgewiesen haben. Durch die immer intensivere Nutzung von Tieren bei Zerstörung ihres natürlichen Lebensraumes steige insgesamt die Gefahr neuer Pandemien. fin
Die Zulassung des chinesischen Sinovac-Impfstoffes in der EU wird nach Ansicht des gesundheitspolitischen Sprechers der EVP-Fraktion im Europaparlament, Peter Liese (CDU), noch einige Zeit dauern. Er gehe eher von Monaten als Wochen aus, sagte Liese China.Table. Ein Grund dafür sei, dass die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) auch Inspektionen vor Ort durchführen müsse, was sich in China “nicht ganz so einfach” gestalte. Bei der EMA läuft das Überprüfungsverfahren für Sinovac seit Anfang Mai. Für die Impfkampagne in der EU und Deutschland ist Sinovac nicht dringend benötigt, weil die Liefermengen von Biontech Ende Juli stark zunehmen werden, wie Liese betont. Zudem werde für Juni mit einer Zulassung für den CureVac-Impfstoff gerechnet. Der chinesische Sinovac-Impfstoff käme aber beispielsweise künftig für Kinder infrage, so Liese, da es sich um einen inaktivierten Ganzvirus-Impfstoff und nicht mRNA-Impfstoff handelt.
Die Abgeordneten des EU-Parlaments stimmen in dieser Woche über die finale Zustimmung zum digitalen EU-Covid-Zertifikat für Bürger:innen der EU und auch Drittstaaten ab. Es soll Reisen während der Pandemie erleichtern. In dem Entwurf der Verordnung überlässt Brüssel es den Mitgliedsstaaten, auch Impfzertifikate über Vakzine, die bisher keine EU-Zulassung haben, anzuerkennen. Darunter auch Impfstoffe, “für die eine Notfallzulassung der WHO vorliegt”, wie es in der Verordnung heißt. Sinovac hat eine Notzulassung der Weltgesundheitsorganisation erhalten. Wer in China mit diesem Präparat geimpft ist, hätte damit eine höhere Wahrscheinlichkeit der Anerkennung des Impfschutzes als mit Sinopharm geimpfte Menschen.
Der EU-Abgeordnete Bernd Lange (SPD), Mitglied der Kontaktgruppe Impfstoffe des Parlaments, rechnet aber letztendlich auch mit einer EMA-Zulassung für Sinovac: “Ich gehe davon aus, dass es kommen wird”, sagte Lange China.Table. Die Sicherheit gehe jedoch vor, weshalb die Zulassung genau geprüft werden müsse. Er sieht die Beteiligung Chinas am weltweiten Impfprogramm als unerlässlich. Derzeit würden lediglich zwei große Regionen Vakzine an Länder mit schlechterem Zugang exportieren, so Lange, und das seien die EU und China. ari
Ein deutliches Bekenntnis der deutschen Wirtschaft zu Menschenrechten in China: Der Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie (BDI), Siegfried Russwurm, hat an die deutschen Unternehmen appelliert, bei Geschäften in der Volksrepublik auf ihre Einhaltung zu bestehen. “China ist ein wachsender Wettbewerber, der immer wieder gegen die globalen Regeln verstößt. Als Exportland müssen wir eine Grenze ziehen, an der die Kompromissfähigkeit aufhört: Menschenrechte sind keine innere Angelegenheit“, sagte der Chef des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) der Bild am Sonntag.
Russwurm sprach explizit auch die Situation in der Provinz Xinjiang im Nordwesten der Volksrepublik an. Dort gibt es seit Jahren Spannungen zwischen der muslimischen Minderheit der Uiguren auf der einen Seite und den zugezogenen Han-Chinesen aus dem Osten und Süden des Landes. Die chinesische Führung geht seit einigen Jahren rabiat gegen die Uiguren vor, sperrt sie in Lager und schränkt die Ausübung ihres muslimischen Glaubens ein. Was China mit der muslimischen Minderheit der Uiguren mache, sei “völlig inakzeptabel”, sagt nun der BDI-Präsident. Jedes Unternehmen mit Werken in Xinjiang müsse sich fragen, ob es ausschließen könne, dass es in seiner Wertschöpfungskette zu Zwangsarbeit komme. flee
Die staatliche chinesische Reederei COSCO will sich offenbar am Hamburger Hafen beteiligen. Das Unternehmen verhandele bereits mit dem Hafenbetreiber, berichtet der NDR. Konkret will die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) dem chinesischen Investor einen Anteil von 30 bis 40 Prozent an dem Containerterminal Tollerort abtreten. Tollerort ist eines der vier großen Containerterminals im Hamburger Hafen. Wenn das Geschäft zustande komme, könnten Schiffe von COSCO dort eine Vorzugsbehandlung erwarten, so der Fernsehsender. Die Bundesregierung habe keine Bedenken gegen die Übernahme, hieß es in dem Bericht. fin
In Budapest haben tausende Menschen gegen den geplanten Bau des umstrittenen Ablegers der chinesischen Fudan-Universität demonstriert. Sie marschierten am Samstag in der ungarischen Hauptstadt in Richtung des Parlaments, wie mehrere Medien berichteten. Die Demonstranten kritisierten, dass eine von der KP Chinas kontrollierte Einrichtung aus ungarischen Steuergeldern finanziert werden soll.
Die Kosten für den Bau des Campus werden auf etwa 1,5 Milliarden Euro geschätzt. Der größte Teil davon, rund 1,3 Milliarden Euro, sollen durch ein Darlehen einer chinesischen Bank gedeckt werden, wie aus Dokumenten hervorging, die das ungarische Investigativ-Portal Direkt36 offenlegte. Unmut gibt es in Budapest zudem darüber, dass der Uni-Ableger auf einem Gelände errichtet werden soll, das eigentlich für den Bau günstiger Studentenwohnungen vorgesehen war.
Budapests Oberbürgermeister Gergely Karácsony ist gegen das Projekt. Karácsony stellte den Berichten zufolge in einer Rede bei der Protest-Veranstaltung klar, dass sich die Demonstration weder gegen China noch gegen die Chines:innen richte, sondern gegen die von Premier Viktor Orbán betriebene Beschneidung der Freiheit der Wissenschaft. Die Stadt hatte vergangene Woche aus Protest gegen das Bauprojekt umliegende Straßen des künftigen Campus umbenannt und ihnen unter anderem die Namen “Dalai-Lama-Straße” oder “Freies-Hongkong-Straße” gegeben. ari
US-Präsident Joe Biden setzt die Sanktionen seines Vorgängers gegen chinesische Unternehmen fort – und verschärft sie noch. Per Verwaltungsdirektive ordnete er Beschränkungen für Kapitalbeteiligungen an Firmen an, denen er Verbindungen zum chinesischen Sicherheitsapparat unterstellt. Die Schwarze Liste (Entity List) umfasst nun 59 Unternehmen. Darunter befinden sich der Telekommunikationsausrüster Huawei und Hikvision, ein Anbieter von Überwachungskameras. Die neue Anweisung wird am 2. August wirksam. Trumps ursprüngliches Dekret betraf nur 31 Unternehmen.
Bidens Verfügung verbietet es US-Amerikanern, in die genannten Unternehmen zu investieren – beispielsweise durch den Kauf von Aktien. Die Praxis chinesischer Unternehmen, sich am Börsenstandort New York mit Kapital zu versorgen, findet damit derzeit ein Ende. Wichtige Unternehmen wie China Mobile wenden sich wieder einheimischen Aktienmärkten zu. Biden begründet das Dekret mit den “ungewöhnlichen Bedrohungen”, die er von seinem Land abwenden müsse. China protestierte gegen die Erweiterung der Liste: Biden verletze “nicht nur die legitimen Rechte chinesischer Unternehmen, sondern auch die von globalen Investoren”. Trotz der weiterhin harten Linie gegen China habe die Regierung Biden allerdings einen sachlicheren Dialog mit Peking in Handelsfragen aufgenommen, berichtet CNN. fin

Seit Herbst 2019 ist Moritz Körner Abgeordneter im Europäischen Parlament und dort Mitglied der Delegation für die Beziehungen zur Volksrepublik China. An Delegationsreisen nach Peking ist in Pandemie-Zeiten nicht zu denken. Stattdessen hatte Körner bislang lediglich einige Gespräche mit der chinesischen Vertretung zur EU in Brüssel. “Das ist schade”, sagt er im Videogespräch. “Als neues, junges Mitglied des Parlaments hätte mich sehr interessiert, gerade mit jungen Menschen aus China ins Gespräch zu kommen.”
Moritz Körner, im rheinländischen Langenfeld aufgewachsen, ist mit 30 Jahren weit unter dem Altersdurchschnitt der Europaabgeordneten, der in dieser Legislaturperiode fast 50 Jahre beträgt. Auch vorher, in der FDP-Landespolitik, gehörte er stets zu den Jüngeren: Mit 16 Jahren trat er den Jungen Liberalen in Nordrhein-Westfalen bei und war von 2013 bis 2018 deren Vorsitzender. Mit 26 Jahren ließ er sich zum damals jüngsten Landtagsabgeordneten in Düsseldorf wählen.
Für die China-Delegation hat sich Moritz Körner nicht bloß wegen seiner Reisepräferenzen entschieden. “Wir müssen China ernster nehmen, daran führt kein Weg mehr vorbei”, sagt er. “Gerade als junger Abgeordneter habe ich das Gefühl, dass China uns noch sehr lange beschäftigen wird.” Die Volksrepublik sei auf dem Weg, Weltmacht oder mindestens ebenbürtig mit den USA zu sein. Dies verändere die Weltordnung erheblich. Wenn nun China seine eigenen Vorstellungen von Menschenrechten immer stärker in den Rest der Welt exportiert – was bedeutet das für eine freie Gesellschaft, wie Körner sie sich vorstellt? Solche Fragen beschäftigen den 30-Jährigen.
Die EU müsse allerdings nicht nur in Bezug auf Menschenrechte konsequenter ihre Werte vertreten. Politik und Wirtschaft dürften nicht isoliert voneinander betrachtet werden, findet Moritz Körner – zum Beispiel mit Blick auf die Seidenstraßen-Initiative: “Wir sehen, dass viele Länder in eine Abhängigkeit von China geraten”, erklärt er. “Die Frage ist: Wird die EU das einfach zulassen? Oder müssen wir uns stärker in Rivalität positionieren?“
Im Europäischen Parlament sitzt Moritz Körner auch im Haushaltsausschuss und im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Inneres und Justiz. Viele Themen überschneiden sich mit China-Fragen – zum Beispiel die Kritik an Tiktok, die derzeit vor allem unter Jüngeren beliebte chinesische Video-App (China.Table berichtete über den Gründer Zhang Yiming). Die Plattform soll laut der US-amerikanischen Kartellbehörde illegal persönliche Daten von Kindern gesammelt haben. Dazu stellte Körner im Herbst 2019 eine Anfrage an die Europäische Kommission. Er wollte herausfinden, was an den Vorwürfen dran ist und ob es bereits eine Untersuchung gibt. Die Antwort der Kommission: Die nationalen Datenschutzbehörden seien zuständig. Der Datenschutzausschuss des Europäischen Parlaments leitete zwar eine Untersuchung ein – “mehr ist bislang leider noch nicht passiert”, sagt Körner.
Er selbst hat deshalb keinen Tiktok-Account. “Ich habe nichts gegen die App, aber ich möchte, dass sie sich an europäische Regeln hält. Ich sehe es skeptisch, wenn da möglicherweise der chinesische Staat Einfluss hat“, so Körner. Dafür nutzt er fast alle anderen Social Media Plattformen – und hat einen eigenen Podcast: In “Europa, wir müssen reden” spricht er in jeder Folge eine halbe Stunde lang mit Kolleg:innen aus anderen Parteien und Mitgliedstaaten. “Politik wirkt furchtbar weit weg”, sagt er. “Wir müssen viel mehr kommunizieren, was wir machen – gerade als Europaabgeordnete.” Leonie Düngefeld
Laura Matz will become Chief Science and Technology Officer at chemicals and pharmaceuticals group Merck on July 1. Matz’s responsibilities will then include Digital, Enterprise Data, Future Insight, and the company’s Innovation Hubs in China, Israel, the United States, and at Group headquarters in Darmstadt. Matz had been Head of Planarization in Merck’s semiconductor materials business since 2019.
Fiona Ip will become Regional Treasurer Asia Pacific at Deutsche Bank, effective July 1. Ip was previously APAC Head of Capital Management and Debt Issuance and Treasurer for Singapore at the German bank.
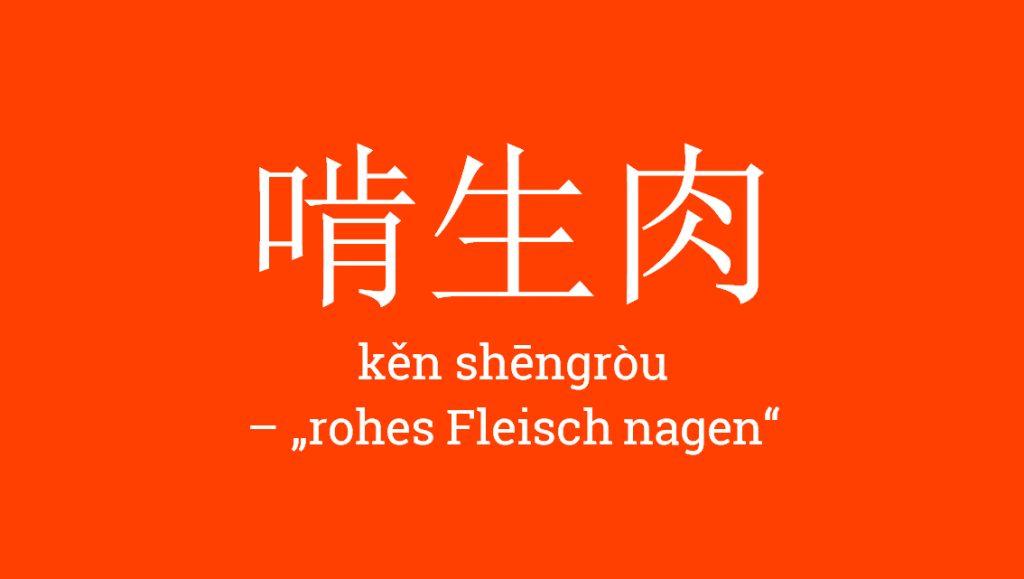
Müssen Vegetarier jetzt ganz stark sein? Gleich die Entwarnung: nein. Denn in diesem Beitrag geht es nicht wirklich um den beherzten Biss in ein rohes, blutiges Steak, sondern vielmehr um das “Nagen” an schwer verdaulicher geistiger Kost. Denn als 生肉 shēngròu – wörtlich “rohes Fleisch” – werden in Chinas Netzgemeinde ausländische Filme, Serien, Cartoons und Co. bezeichnet, die bisher nur in der Fremdsprache vorliegen, also noch nicht durch entsprechende Übersetzung für das chinesische Publikum “vorverdaut” wurden. Wer es nicht abwarten kann und sich solche Clips vorab zu Gemüte führt, nur gewappnet mit ein paar wackeligen Fremdsprachkenntnissen oder – noch schlimmer – unter Zuhilfenahme mehr oder weniger verlässlicher Übersetzungssoftware, hat eben schwer daran zu beißen. Oder, wie der Chinese sagen würde, er “nagt an rohem Fleisch” (啃生肉 kěn shēngròu). Sprachlich mundgerecht vorübersetzte Produktionen nennt man entsprechend 熟肉 shóuròu – “gares Fleisch”.
Im Fernsehen und auf den offiziellen Videoportalen in China sind Schriftzeichenuntertitel selbst bei heimischen Formaten Standard. Einige Hollywood-Produktion werden gar synchronisiert wie in Deutschland üblich. Doch vieles, was über YouTube, Netflix und TikTok an ausländischen Videoschnipseln inoffiziell nach China schwappt, muss erst einmal übersetzt werden. Dem hat sich eine ganze Armada von Freiwilligen, bestehend aus jungen Fremdsprachenlernern, verschrieben. Sie übertragen neue Videoclips oft in Windeseile ins Chinesische. Und dies öffnet auch das eine oder andere Nischenfenster jenseits des chinesischen Videomainstreams. So schaffte es etwa im Jahr 2011/2012 die deutsche Schauspielerin Martina Hill mit ihrer Comedy-Reihe “Knallerfrauen” in China kurzzeitig zu unverhoffter Berühmtheit, als chinesische Austauschstudenten begannen, Auszüge der SAT1-Serie in Eigenregie unter dem chinesischen Titel 屌丝女士 (Diǎosī Nǚshì) ins Chinesische zu übersetzen und online zu stellen. Auf diese Weise wurde deutsche Comedy-Lustigkeit erstmals einem größeren chinesischen Internetpublikum vertraut.
Copyright-mäßig bewegen sich die Hobbyübersetzer natürlich auf äußerst dünnem Eis. Andererseits eröffnen sie als Graswurzel-Initiative sonst kaum zugängliche Nischenkanäle für den Kulturaustausch. Jüngstes Beispiel hierfür ist das deutsche Flirtformat “Princess Charming” des Streamingdienstes TVNOW – die erste lesbische Datingshow im deutschen Mainstream-Fernsehen. Schon nach Ausstrahlung der ersten Folge brodelte Chinas “Untertitelküche” gehörig und “garte” Auszüge der Realityshow sprachlich für die eigene LGBTQ*-Community auf. Und die jubelte und gab ihre Freude sogar über Instagram und andere Social-Media-Kanäle direkt an die überraschten deutschen Protagonistinnen weiter. Kulturaustausch einmal ganz anders eben, die sprachliche “Garküche” macht’s möglich.
Verena Menzel betreibt in Peking die Online-Sprachschule www.new-chinese.org.

