Europa diskutiert derzeit über chinesische Elektroautos. Haben wir einen Import-Tsunami zu erwarten? Müssen wir uns wehren – und wenn ja, womit? Die EU hat eine Anti-Subventions-Untersuchung gestartet, die am Ende in Strafzölle münden könnte. Chinesische Hersteller erfreut das nicht. Aber sie wollen den europäischen Markt trotzdem erschließen.
Eine Marke, die 2024 den EU-Marktstart anpeilt, ist Chery. Beginnen will der Konzern in Spanien, Deutschland folge im dritten Quartal, erklärt Vize-Präsident von Chery International Charlie Zhang im Gespräch mit Julia Fiedler. Hierzulande will Chery demnach nicht nur Elektroautos anbieten, sondern auch Verbrenner und Plug-in-Hybride. Zhang zeigt sich zudem erstaunt, wie wenig die elektrische Ladeinfrastruktur in Deutschland bisher ausgebaut ist.
In China steigt die Zahl der Krebs-Erkrankungen im Vergleich zum Westen überproportional. Vor allem die Todeszahlen sind überdurchschnittlich hoch. Dass diese negative Entwicklung Kräfte freigesetzt hat, erklärt Jörn Petring. Denn China stieß eine schnellere Entwicklung neuer Medikamente und Diagnoseverfahren an, von denen auch der Westen profitieren könnte. Eines der neuen Medikamente aus der Volksrepublik ist bereits in den USA zugelassen. Weitere Regionen und weitere Medikamente dürften folgen.
Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die Woche!


Die Exporte von Chery lagen 2023 nach eigenen Angaben bei etwa 700.000 Fahrzeugen. In wie vielen Ländern verkaufen Sie aktuell Fahrzeuge?
Zurzeit sind wir in über 80 Ländern und Regionen tätig. 2024 werden wir allerdings noch größer, weil wir uns in Europa und insbesondere in Deutschland etablieren wollen. Wir gehen dabei Schritt für Schritt vor. Zunächst führen wir unsere Marke in Spanien ein, gefolgt von Italien und dem Vereinigten Königreich. In Deutschland werden wir wahrscheinlich erst im dritten Quartal 2024 auf den Markt kommen.
Warum so spät? Chery betreibt in Raunheim schon seit 2018 ein Entwicklungszentrum, Ihre Fahrzeuge sind in Deutschland aber noch nicht auf dem Markt. Eigentlich sollte der Verkauf bereits im Frühjahr losgehen…
Wir wollen sichergehen, dass wir gut vorbereitet sind. Entscheidend sind vier Schlüsselfaktoren: unsere Produkte, das Händlernetz, Marketing und Branding, sowie Service und die Verfügbarkeit von Ersatzteilen. All das muss stehen, bevor wir unsere Marken einführen.
Gibt es schon Verträge mit Händlern in Deutschland?
Wir befinden uns in sehr intensiven Gesprächen mit einer Reihe von potenziellen oder zukünftigen großen Händlergruppen.
Verträge haben Sie aber noch keine unterzeichnet?
Noch nicht. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass das bald geschieht.
Was für Fahrzeuge werden Sie auf den deutschen Markt bringen?
Wir wollen eine Reihe von Elektroautos anbieten. Gleichzeitig wissen wir, dass Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor in Deutschland immer noch einen großen Teil des Gesamtabsatzes ausmachen. Daher wollen wir eine Gesamtlösung anbieten: Verbrenner, batterieelektrische Fahrzeuge und Plug-in-Hybride.
Elektroautos aus China haben in letzter Zeit für viel Aufmerksamkeit gesorgt, das Interesse ist groß. Glauben Sie nicht, dass Sie Ihr Angebot verwässern, wenn Sie auch Verbrenner anbieten?
Über diese Frage haben wir lange nachgedacht. Es gibt einige andere chinesische Marken, zum Beispiel BYD und Nio, die nur batterieelektrische Fahrzeuge anbieten. Wir wollen allerdings groß sein. In China haben chinesische OEMs (Autohersteller) mittlerweile einen Gesamtmarktanteil von mehr als 50 Prozent. Bei den Elektroautos liegt der Anteil der chinesischen Marken sogar bei mehr als 80 Prozent. Die Wettbewerbsfähigkeit der chinesischen Hersteller wird immer größer und besser. Sie bringen viele Elektroautos auf den Markt – aber eben nicht nur, sondern auch Verbrenner. Wir können diesen großen Teil des Marktes nicht vernachlässigen.
Müssen sich die deutschen Hersteller Sorgen machen, dass E-Autos aus China den Markt mit der Wucht eines Tsunamis überschwemmen?
Ich glaube nicht, dass das eine passende Beschreibung für die Art des Wettbewerbs ist. Viele Jahrzehnte lang wurde der Sektor der Premiummarken von deutschen Marken wie BMW, Mercedes, Audi und Porsche dominiert. Die deutschen Marken, einschließlich Volkswagen China, haben jedes Jahr Millionen von Autos verkauft. Aber jetzt gerade werden die chinesischen Autobauer größer und stärker. Wir brauchen gleiche Wettbewerbsbedingungen. Deutschland ist eine Industrienation, die in China viele Geschäfte macht. Jetzt bieten die chinesischen Hersteller ihren deutschen Kunden gute Autos an. Ich glaube nicht, dass es sich um einen Tsunami handelt, die deutschen Autobauer sind in vielen Aspekten immer noch führend.
Die Qualitäten, für die deutsche Autohersteller immer bekannt waren, gelten in Zukunft aber vielleicht nicht mehr so sehr, wenn Autos zu Smartphones auf Rädern werden. Wie blicken Sie auf die deutsche Autoindustrie?
Lassen Sie es mich so formulieren: Es gibt einen konventionellen “alten Strang”, er steht für die Verbrenner, das letzte Jahrhundert. Darin sind die deutschen Autobauer ziemlich gut. Was Motoren und Getriebe angeht, war es schwierig, aufzuholen. Und dann gibt es den neuen Strang, für den die batterieelektrischen Fahrzeuge stehen. Batterien, Elektromotoren, elektrische Steuerungen, intelligente Cockpits, autonomes Fahren, all diese Technologien. Die chinesischen Hersteller haben hier eine Chance gesehen und versucht, in dieser Hinsicht stark zu sein.

Welche Folgen hat Chinas Einsatz für die neuen Technologien?
Wenn man die Lücke zwischen den chinesischen Herstellern und den deutschen Herstellern betrachtet, so hat sich diese definitiv verringert. Aber wenn es um die Grundlagen des Autobaus geht, um Haltbarkeit, Zuverlässigkeit und Qualität der Autos, dann sind die deutschen Hersteller immer noch mit Abstand führend.
Was bedeutet das?
Es gibt noch immer eine Menge Dinge, die wir lernen müssen. Volkswagen ist seit vielen, vielen Jahrzehnten unser Lehrer. Unser Vorstandsvorsitzender hat früher für Volkswagen gearbeitet. Er sagt uns immer, dass wir von der deutschen Qualität und der Art und Weise, wie Autos produziert werden, lernen müssen.
Trotzdem zittern die Vorstandsetagen in Wolfsburg und Stuttgart.
Für die deutschen Autobauer ist das jetzt gerade ein herausfordernder Moment. Schwer vorstellbar, wenn man viele Jahre lang führend war, doch jetzt bricht eine neue Ära an. Eben die der Smartphones auf Rädern. Sie ist anders. Die Art und Weise, wie wir konkurrieren, die Art und Weise, wie Sie Ihre Produkte bauen und entwickeln, ändert sich – und das bedeutet natürlich eine gewisse Herausforderung. Aber ich glaube immer noch, dass sich die beiden Seiten hervorragend ergänzen können. Warum sollten wir nicht hochgradig komplementäre Partnerschaften aufbauen?
Denken Sie nicht, dass eine gewisse Unabhängigkeit der Industrie für unsere beiden Länder wichtig ist?
Wenn Sie sich unsere Fabrik ansehen, werden Sie viele Geräte und Maschinen entdecken, die in Deutschland, Italien und Japan hergestellt werden. Wir kaufen und verwenden viele deutsche Maschinen und Anlagen. Klar erfordert die Entwicklung ein Umdenken. Früher exportierte China Spielzeug, Kleidung, vor allem Billigprodukte. Und auf einmal bietet China nicht nur Spielzeug, sondern auch Autos an. Ich denke, wir müssen uns an diese neue Realität, diese neue Normalität anpassen.
Sie sind aber nicht nur für Europa zuständig, sondern auch für andere Teile der Welt. Ich habe gehört, dass Sie besonders in Mexiko erfolgreich sind.
Wir haben Tochtergesellschaften in verschiedenen Ländern aufgebaut. 2022 haben wir unsere Marken in Mexiko eingeführt. Aktuell verkaufen wir dort monatlich etwa 4.000 bis 5.000 Fahrzeuge.
Die amerikanische Regierung ist nicht begeistert von Ihren Aktivitäten in Mexiko. In den USA gelten hohe Zölle für in China hergestellte Elektroautos. Die Regierung befürchtet, dass Sie Ihre Fahrzeuge durch die Produktion in Mexiko nun durch Hintertür in die USA importieren könnten. Wie stehen Sie dazu?
In Nordamerika gilt seit 2020 das United States-Mexico-Canada-Agreement (USMCA), das Nachfolgeabkommen zum NAFTA. Die Regelungen, was die Lokalisierung angeht, sind härter. Die Vereinigten Staaten wollten höhere Anforderungen an die lokale Herstellung in Mexiko stellen. Für uns ist der mexikanische Markt aktuell groß genug – es ist ein großer Markt von mehr als 1,2 Millionen Fahrzeugen. Andererseits hat Mexiko aber auch eine Reihe von Freihandelsabkommen mit anderen Ländern in Südamerika und sogar Europa. Mittelfristig können wir in Mexiko produzieren und in andere Länder exportieren.
Also auch in die USA?
Wir hoffen, dass wir die Freihandelsabkommen nutzen können, um in Mexiko zu produzieren und in die Vereinigten Staaten zu exportieren, insbesondere Elektroautos. Aber das ist nicht unser unmittelbares Ziel.

Auch die EU prüft nun Anti-Dumping-Zölle für chinesische Elektroautos. Es geht um angeblich irreguläre Subventionen der chinesischen Führung. Was heißt das für Sie?
Ich halte es für eine bedauerliche Entscheidung, dass die EU eine Anti-Subventionsuntersuchung eingeleitet hat, um chinesische Autos zu regulieren. Das wird sich definitiv negativ auf den Verkauf von chinesischen Elektroautos auswirken. Das können wir nicht ändern, wir müssen uns daran anpassen.
Die deutsche Regierung wiederum hat Ende letzten Jahres spontan die Subventionen für Käufer von Elektroautos eingestellt. Welche Folgen hat das für Ihr Unternehmen?
Deshalb werden wir auch Verbrenner anbieten. Wir können uns nicht nur auf den Markt für Elektroautos konzentrieren. Der ist mit knapp 20 Prozent an den Neuzulassungen 2023 noch relativ klein. Wir wollen ein robustes Produktportfolio einführen, das Verbrenner, Plug-in-Hybride und Elektrofahrzeuge umfasst, weil wir den Massenmarkt ansprechen wollen. Wenn man sich Europa als Ganzes ansieht, sind die einzelnen Märkte zudem sehr unterschiedlich.
Hatten Sie erwartet, dass sich Deutschland bei der Elektromobilität schneller entwickeln würde?
Jeder dachte, dass Deutschland, die größte Volkswirtschaft mit dem größten Markt in Europa, die Elektrifizierung fördern und versuchen will, Emissionsfreiheit zu erreichen. Doch jetzt hat die Bundesregierung sogar die Subventionen für Elektroautos gestrichen. Bei der Elektromobilität gibt es in meinen Augen drei Schlüsselfaktoren: Erschwinglichkeit, Batteriereichweite und Infrastruktur. Wenn diese drei Schlüsselfaktoren nicht gegeben sind, wird es sehr schwierig, eine 100-prozentige Elektrifizierung zu erreichen. Ich war in Frankfurt, München und Köln unterwegs und habe auf den Straßen nach Ladestationen Ausschau gehalten. Um ehrlich zu sein, war es sehr schwierig, besonders viele zu finden. Ich weiß nicht, wie die Regierung plant, die Infrastruktur landesweit oder in Europa zu fördern. Aber wenn die Infrastruktur fehlt – wie kann man dann davon sprechen, dass man bis 2035 nur noch emissionsfreie Pkw zulassen will?
Charlie Zhang (张升山) ist Executive Vice President von Chery International und Assistant President des Gesamtkonzerns Chery Automobile. Zuvor hatte er die Position als General Manager der Region Mittel- und Südamerika inne. Zhang arbeitet seit mehr als 15 Jahren für den chinesischen Autohersteller.

China hat ein Krebsproblem. Die Zahl der Krebstoten in China ist zwischen 2005 und 2020 um 21,6 Prozent auf jährlich fast 2,4 Millionen angestiegen, wie aus einer neuen Studie des staatlichen Chinesischen Zentrums für Krankheitskontrolle und Prävention (CDC) hervorgeht. Seit 2010 ist Krebs demnach die häufigste Todesursache in der Volksrepublik.
Neben den steigenden Todeszahlen sind dies die wichtigsten Erkenntnisse der im Dezember 2023 veröffentlichten Untersuchung:
China hat seit langem die höchste Zahl an Krebstoten weltweit. Die CDC-Forschenden warnen indes davor, dass die Mortalitätsraten des Landes aufgrund der begrenzten Datenlage möglicherweise sogar noch unterschätzt wurden. Sie fordern die chinesische Regierung auf, alle Anstrengungen zu unternehmen, um die Krebslast zu verringern. Dazu gehören die Förderung von kostengünstigen Krebsfrüherkennungs- und Impfprogrammen sowie die Umsetzung einer strikten Tabakkontrollpolitik.
Untätig ist Peking nicht. Gesundheitspolitiker haben es sich zum Ziel gesetzt, die Gesamtüberlebensrate von Krebspatienten bis 2025 um zehn Prozent zu erhöhen. Die vorzeitige Sterblichkeit durch nichtübertragbare Krankheiten einschließlich Krebs will man dagegen bis 2030 um 30 Prozent senken.
Vor allem aber geben wissenschaftliche Durchbrüche Anlass zur Hoffnung, dass China nicht nur mittelfristig seine eigenen Probleme in den Griff bekommt, sondern auch einen Beitrag zur Lösung des globalen Krebsnotstands leisten kann.
Chinesische Unternehmen haben Fortschritte bei der Entwicklung neuer Medikamente erzielt. Manche von diesen werden nun auch im Westen eingesetzt; so hat die Zulassung des Medikaments Toripalimab in den USA kürzlich für Aufsehen gesorgt. Das von Shanghai Junshi Biosciences entwickelte Medikament wurde im Oktober von der US Food and Drug Administration (FDA) zur Behandlung des Nasopharynxkarzinoms (NPC) zugelassen. Das ist eine aggressive Krebsart, die hinter der Nase im oberen Teil des Rachens beginnt. Toripalimab ist das erste und derzeit einzige von der FDA zugelassene Medikament zur Behandlung dieser Krebsart.
Ebenfalls erst vor wenigen Wochen stellte Dizal, ein biopharmazeutisches Unternehmen aus der Provinz Jiangsu, ein neues, vielversprechendes Medikament vor. Sunvozertinib zeigt gute Ergebnisse bei der Behandlung einer bestimmten Art von Lungenkrebs. In einer Phase-2-Studie mit 104 Patienten im fortgeschrittenen Krankheitsstadium zeigte Sunvozertinib eine deutlich höhere Wirksamkeit als alle bisherigen Kandidaten.
Es gibt eine Vielzahl ähnlicher Meldungen zu erfolgversprechenden Medikamenten aus China. So machten Forschende dort auch Fortschritte bei der Entwicklung und Anwendung von KI-basierten Bilderkennungssystemen, die in der Onkologie eingesetzt werden. Auch diese werden ihren Weg in den Westen finden. Gerade erst hat die DAMO Academy, ein Forschungsinstitut der Alibaba Group, ein neues KI-gestütztes Tool vorgestellt, das frühe Anzeichen von Bauchspeicheldrüsenkrebs erkennen kann. Das Tool mit dem Namen PANDA kann auf CT-Scans noch genauer als Radiologen erkennen, ob ein Patient erkrankt ist.
Der Staatsrat hat hoch verschuldete Lokalregierungen und Staatsbanken in zwölf Regionen des Landes angewiesen, einige staatlich finanzierte Infrastrukturprojekte zu verschieben oder zu stoppen. Das berichtete Reuters unter Berufung auf Insider. Die Direktive betrifft demnach Projekte, bei denen zum derzeitigen Stand weniger als die Hälfte der geplanten Investitionen abgeschlossen sind – darunter Schnellstraßen, Bau und Erweiterung von Flughäfen sowie Nahverkehrsprojekte.
Manche Projekte seien ausgenommen, beispielsweise solche, die von der Zentralregierung in Peking genehmigt worden waren, oder der Bau erschwinglichen Wohnraums. Der Staatsrat hat die Direktive bislang nicht öffentlich bekannt gegeben.
China bemüht sich seit Monaten, die kommunalen Schulden in den Griff zu bekommen, die inzwischen umgerechnet rund 11,94 Billionen Euro erreicht haben. Nach den aktuellsten verfügbaren Daten entsprachen sie 2022 76 Prozent des damaligen Bruttoinlandsprodukts. 2019 waren es noch 62 Prozent gewesen.
Bereits im Herbst 2023 hatte Peking laut Reuters die zwölf Regionen ins Visier genommen. Damals wies der Staatsrat dortige Lokalregierungen bereits an, “problematische” Public-Private-Partnership-Projekte zu stoppen und verfügte Investitionsbeschränkungen. Zu den zwölf betroffenen Regionen gehören die Provinzen Liaoning und Jilin im Nordosten, Guizhou und Yunnan im Südwesten, sowie die Städte Tianjin und Chongqing. Diese Regionen sollten alle Anstrengungen unternehmen, um ihr “Schuldenrisiko auf ein niedriges und mittleres Niveau” zu reduzieren, so die Quellen zu Reuters. Die Direktive habe aber nicht festgelegt, wie der Schuldenabbau gemessen werden solle.
Chinas Wirtschaft schaffte laut offiziellen Angaben 2023 ein BIP-Wachstum von 5,2 Prozent und lag damit leicht über dem offiziellen Ziel von rund fünf Prozent. Die Aussichten für 2024 bleiben aber mäßig. rtr/ck
Russland hat 2023 Saudi-Arabien als Chinas wichtigsten Rohöllieferanten überholt. Chinesischen Zolldaten zufolge lieferte Moskau im vergangenen Jahr die Rekordmenge von 107,02 Millionen Tonnen Rohöl nach China, was 2,14 Millionen Barrel pro Tag (bpd) entspricht. Das war weit mehr die Menge anderer großer Ölexporteure wie Saudi-Arabien und Irak. Chinas Einfuhren des bisherigen Top-Lieferanten Saudi-Arabien gingen dagegen um 1,8 Prozent auf 85,96 Millionen Tonnen zurück.
Die Volksrepublik nutzt dabei die Niedrigpreise russischen Erdöls, die Moskau aufgrund der Sanktionen und der Importstopps früherer Kunden akzeptieren muss. Um nicht gegen die westlichen Sanktionen zu verstoßen, setzen chinesische Raffinerien Zwischenhändler ein, die Transport und Versicherung des russischen Rohöls übernehmen. Russland betreibt nach Recheren von Ölhändlern seit 2022 eine ganze Flotte sogenannter Schattentanker, die unter dem Rader meist ohne Versicherungsschutz Öl transportieren. Oft wird dieses auf See dann von Schiff zu Schiff umgeladen, um die Herkunft zu verschleiern.
Chinesische Ölkonzerne äußern sich seit Kriegsbeginn eher zugeknöpft über die Quellen ihrer Importe. Russlands Vize-Ministerpräsident Alexander Nowak aber hatte bereits Ende Dezember betont, dass 2023 praktisch der gesamte russische Rohölexport nach China und Indien gegangen sei. Der Westen findet dagegen bislang kein Mittel. Seit kurzem gibt es laut Bloomberg allerdings erste Anzeichen, dass die russische Schattenflotte durch Verschärfungen der US-Sanktionen Probleme bekommt. So haben 14 Tanker, die russisches Erdöl nach Indien transportieren, entweder auf der Stelle gezögert, beigedreht oder die Geräte für digitale Ortungssysteme ausgestellt. Das könnte ebenso den China-Transport betreffen, ist bislang aber nur eine Beobachtung.
Transfers von Schiff zu Schiff finden gibt es derweil für Rohöl aus anderen sanktionierten Ländern. So nutzen Käufer laut Reuters die Gewässer vor Malaysia als Umschlagplatz für Ladungen aus Iran und Venezuela. Chinas als aus Malaysia stammend gekennzeichnete Einfuhren stiegen 2023 um 53,7 Prozent.
Insgesamt stiegen Chinas Rohölimporte 2023 stiegen auf einen Rekordwert von 563,99 Millionen Tonnen, was 11,28 Millionen bpd entspricht. Auch die Lieferungen aus den USA nach China stiegen trotz geopolitischer Spannungen zwischen Peking und Washington um 81,1 Prozent, da die Rohölproduktion in den USA zunahm. rtr/ck
Der für vergangenen Samstag geplante erste EU-Trilog für die Verordnung zum Importverbot für Produkte aus Zwangsarbeit ist geplatzt. Ursache ist Uneinigkeit im EU-Rat. Der Ausschuss der Ständigen Vertreter (AStV) hat in seiner Sitzung am Freitag bei Gesprächen über die Position des Rats zwar Fortschritte erzielt, konnte sich aber noch nicht auf einen finalen Text einigen, wie ein Sprecher zu Table.Media sagte. Im Trilog verhandeln Vertreter aus Kommission, Rat und Parlament miteinander über wichtige EU-Regeln.
In der kommenden Woche soll nun auf technischer Ebene weitergearbeitet werden; der AStV wird am Mittwoch oder Freitag noch einmal zusammenkommen. Damit wird die Zeit für die Verhandlungen mit dem Parlament knapp. Spätestens am 6. Februar müssten Rat und Parlament sich notfalls bei einem einzigen Treffen einigen. Das EU-Verbot für Produkte aus Zwangsarbeit zielt vor allem auf Produkte aus China, wo in Xinjiang Uiguren zur Zwangsarbeit verpflichtet sein sollen. leo
Die USA und China haben nach acht Jahren Pause den bilateralen Landwirtschafts-Dialog im China-U.S. Joint Committee on Cooperation in Agriculture (JCCA) wieder aufgenommen. Die beiden Landwirtschaftsminister Tang Renjian und Tom Vilsack seien in Washington zusammengetroffen, berichtete das Wirtschaftsmagazin Caixin. Das chinesische Agrarministerium teilte demnach mit, den Dialog zu pflegen und sein “stabiles Funktionieren zu gewährleisten”. Man habe “eingehende und offene” Gespräche über klimagerechte Landwirtschaft, Ernährungssicherheit und Handelserleichterungen geführt.
Vilsack nannte China in einem Statement seines Ministeriums laut Caixin einen “wichtigen landwirtschaftlichen Exportmarkt” und betonte den Willen zu mehr Zusammenarbeit. Die Wiederbelebung dieses Kommunikationskanals, der seit November 2015 auf Eis lag, ist ein weiteres Zeichen, dass die beiden Supermächte trotz ihrer geopolitischen Spannungen wieder mehr miteinander statt nur übereinander sprechen wollen. ck
China hat eine erste Serie von Lizenzen für Produktion und den Verkauf von gentechnisch veränderte Mais- und Sojabohnensorten erteilt. Damit habe das Landwirtschaftsministerium den Weg für die Kommerzialisierung dieser Kulturen geebnet, berichtete das Wirtschaftsmagazin Caixin am Freitag. Ingesamt gibt es demnach nun Lizenzen zur Herrstellung von Saatgut für 36 Genmais- und 10 Gensoja-Varianten. Sie gingen laut Caixin vor allem an drei Firmen: Die staatliche China National Seed Group sowie Agrar-Tochterfirmen von Beijing Dabeinong Technology und Yuan Longping High-Tech Agriculture.
Die Anpflanzung werde unter staatlicher Aufsicht erfolgen und sich auf bestimmte Gebiete beschränken, so der Bericht. Die Lizenzen werden demnach zunächst bis zum 24. Dezember 2028 in 13 Regionen auf Provinzebene gültig sein – darunter Peking und wichtige Getreide produzierende Provinzen wie Hebei, Liaoning, Jilin und die Innere Mongolei.
In China gibt es seit 2021 Pilotprojekte zum Anbau gentechnisch veränderter Mais- und Sojabohnensorten. Peking will mithilfe der Gentechnik die Erträge steigern, mit einem Fokus auf heimische Produktion und Ernährungssicherheit. Das Land hat bisher aber noch keine gentechnisch veränderten Pflanzen zum Markt zugelassen. Auch der Bayer-Konzern in Leverkusen hofft auf eine Zulassung. Mit der Übernahme des US- Agrarriesen Monsanto ist Bayer zu einem der größten Anbieter von grüner Gentechnik aufgestiegen. ck
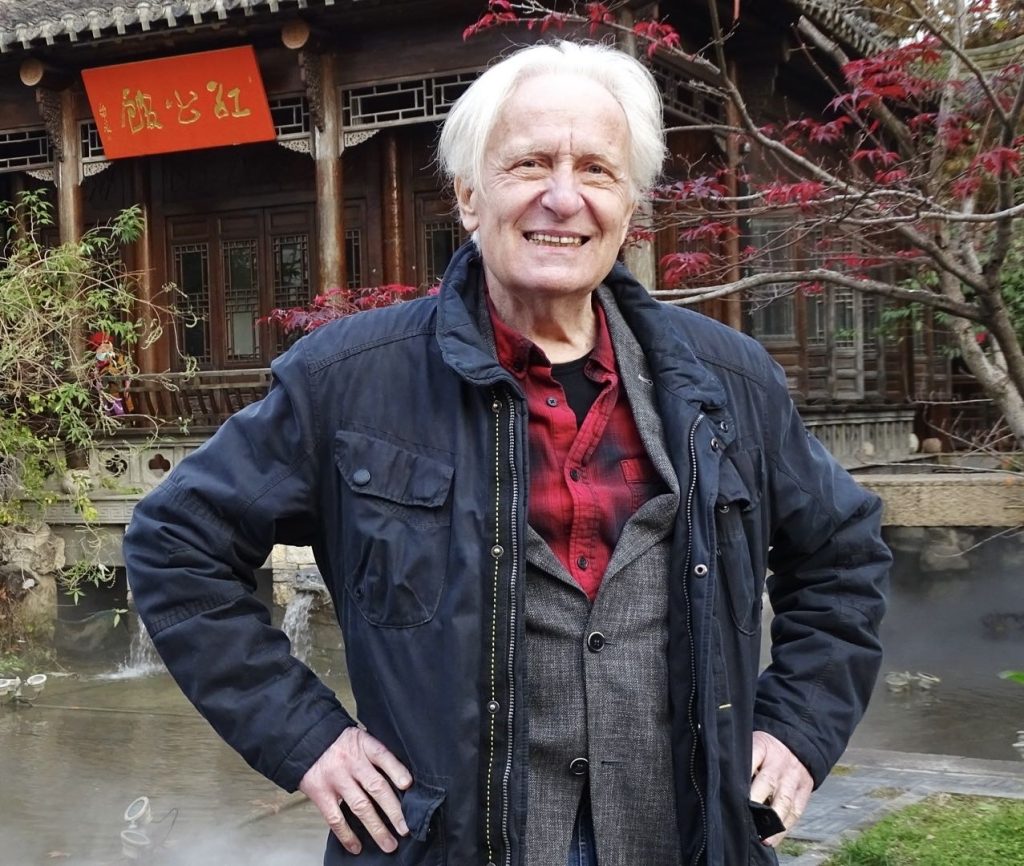
Uwe Kräuter sei der “Marco Polo unserer Zeit”, sagte ein Freund über ihn. Fast 50 Jahre lebt er nun in China, seit 1974. Damals, gegen Ende der berüchtigten Kulturrevolution und zwei Jahre vor dem Tode Mao Zedongs, bekam er den Titel “Ausländischer Experte”. Er ist auch bekannt als der am längsten in China lebende Deutsche.
Der Grund, warum Kräuter nach China kam, ist durchaus ungewöhnlich. Er hatte 1970 in Heidelberg an einer gewalttätigen Demonstration gegen den Vietnamkrieg teilgenommen und wurde wegen angeblicher Rädelsführerschaft zu acht Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt. Die Haft trat er aber nicht an – sondern nahm ein Jobangebot als Übersetzer beim Verlag für fremdsprachige Literatur der kommunistischen Führung in China an und ging nach Peking. Damit war er für die deutsche Justiz nicht mehr greifbar.
“Ich bin dankbar, dass ich damals diesen Mut und diese Energie gehabt habe, einfach zu sagen, wenn China mich einlädt, die Tore aufmacht, gehe ich da selbstverständlich hin. Überdies reizte mich die Exotik”, erzählt Kräuter heute. Seinen Entdeckergeist hat er zum Teil wohl von seinem Großvater, der als Seemann in China gewesen war: “Als ich Kind war, hat er mir viel von seinen Eindrücken dort erzählt, und das waren alles schöne Geschichten.”
Sein Interesse an Kunst und Film in China entdeckte Kräuter nach dem Ende der Kulturrevolution 1976. “Da kamen all diese chinesischen Künstler zurück aus Gefängnissen oder vom Land, von weit her in die großen Städte, aus denen sie ursprünglich stammten.” Kräuter hatte die Gelegenheit, viele dieser Menschen, die Unglaubliches erlebt hatten, persönlich kennenzulernen.
1985 drehte er in Kooperation mit dem Jugendfilmstudio der Pekinger Filmakademie die Dokumentation “Meine Pekinger Künstlerfreunde“. Unter den Porträtierten war auch der kürzlich verstorbene Maler Huang Yongyu, der zu Anfang der Kulturrevolution wegen seines Bildes einer Eule, die ein Auge geschlossen hat, bekannt wurde. “Die Viererbande behauptete, ein Auge sei geschlossen für die Revolution und das Denken von Mao Zedong – was für ein Unsinn!”
In seinen Tätigkeiten – nicht nur als Autor, sondern auch als Filmproduzent und Unternehmer – gelang es Uwe Kräuter, sich über die Jahre als Kulturmittler zwischen China und Deutschland zu etablieren. 1980 organisierte er mit dem Mannheimer Nationaltheater die Aufführung des chinesischen Dramas “Das Teehaus” von Lao She. “Alle Medien Deutschlands waren fasziniert von den Aufführungen”, erinnert er sich. Es habe keinen einzigen negativen Artikel gegeben.
Vor und nach Gründung einer eigenen Firma namens “Asia World Network Ltd” produzierte Kräuter Filme in und über China für das ZDF. Gleichzeitig fädelte er den Import deutscher Filme und Serien ein, zum Beispiel “Derrick”. Die Krimiserie wurde 1988 erstmals in China ausgestrahlt.
Wegen der scharfen US-Kritik an der brutalen Niederschlagung der Demokratiebewegung auf dem Tiananmenplatz am 4. Juni 1989 veranlasste der damalige Spitzenpolitiker Jiang Zemin, dass die US-Serie Hunter, die bis dahin im Schanghaier Fernsehen lief, abgesetzt wurde. Stattdessen nahm der Sender Derrick ins Programm, der seine Fälle mit Köpfchen statt mit Waffen löst. Man erhoffte sich, dass die friedvolle Art des Kommissars, auf Konfliktsituationen zu reagieren, Auswirkungen auf die Gemüter der Bürger haben würde.
Durch seine Filmarbeit reiste Kräuter in für damalige Verhältnisse entlegen geltende Städte und Regionen: 1991 besuchte er den Tempel Ai Dao Tang in Chengdu für die Produktion von “Prinzessin einer anderen Welt” über das Leben buddhistischer Nonnen in China. Nachhaltig beeindruckend war für ihn auch der Aufenthalt in der Taklamakan-Wüste in Xinjiang, wo uigurische Kinder ihm ihre Geschichten erzählten. So entstand die Serie “Wüstenkinder”.
Wie sieht ein Leben aus, das sich so viele Jahre in China abspielt? Es ist eine Biografie, die geprägt ist, sich auf neue Verhältnisse einzulassen. 2012 wurde sein Buch “So ist die Revolution, mein Freund” publiziert, in dem Kräuter seine Erlebnisse in China beschreibt. Er knüpfte Freundschaften in allen Schichten und Berufsgruppen.
Neben Freundschaften wie jenen zu den Künstlern war es aber auch die Liebe, die Kräuters Verhältnis zu dem Land geprägt hat. 1984 heiratete er Shen Danping, die in China als Schauspielerin viele Jahre lang berühmt war und bei vielen nach wie vor ist. Die offizielle chinesische Seite missbilligte diese Beziehung zunächst. “Die Skepsis gegenüber ausländisch-chinesischer Heirat ist heute Vergangenheit”, sagt Kräuter. Sie treten immer wieder gemeinsam in Talks Shows auf und wurden 2005 von Shanghai Television sogar zum humorvollsten Paar gekürt.
Vom Westen wünscht sich Kräuter eine unvoreingenommene Haltung und mehr Höflichkeit in der Annäherung. “Es sollte ein Bedürfnis sein, uns der Unterschiede in den Köpfen unserer Welt und der dortigen Welt, also unserer historischen Unterschiede bewusst zu sein”, sagt er. Wenn das nicht geschieht, werde es keine wahre Kommunikation geben können. Statt den Zeigefinger zu erheben, sollten lieber mehr Fragen gestellt werden – so lautet seine Devise.
Kräuter ist inzwischen 78 Jahre alt. Vor Kurzem ist sein neues Buch erschienen. “Reisen ins Unbekannte” heißt es. Darin schreibt er über seine Begegnungen in Nordkorea. Juliane Scholübbers
Karolin Kollmorgen ist seit Dezember als Referentin zuständig für das Projekt “China Hub” am Bayerischen Hochschulzentrum für China (BayCHINA). “China Hub” ist ein vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördertes Projekt zur Förderung von China-Kompetenz in der bayerischen Hochschul- und Wissenschaftslandschaft. Kollmorgen war zuvor Kulturmanagerin am Konfuzius-Institut Hamburg.
Ali Wyne ist seit diesem Monat Senior Research and Advocacy Advisor U.S.-China bei der International Crisis Group. Die Nichtregierungsorganisation mit Sitz in Brüssel liefert Analysen und Lösungsvorschläge zu internationalen Konflikten.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Tesla-Chef Elon Musk will seinen Cybertruck demnächst auf Promotion-Tour nach China schicken. Auch in der Volksrepublik, dem zweitgrößten Markt für Tesla, stößt das kantige Fahrzeug auf Hass und Liebe und kaum etwas dazwischen. Im Netz bringen viele das Auto mit Chinas “nutzlosem Edison” Geng Shuai 耿帥 in Verbindung, einem Schweißer aus dem Hinterland, der immer wieder mit Videos seltsamer Erfindungen viral geht.
Eine Marktzulassung für Teslas Cybertruck ist in China aber ohnehin unwahrscheinlich. Anders als in den USA sind Pickups hier ein Nischenprodukt, da viele Stadtverwaltungen, darunter auch die von Peking, sie nicht in Innenstädten erlauben.
Europa diskutiert derzeit über chinesische Elektroautos. Haben wir einen Import-Tsunami zu erwarten? Müssen wir uns wehren – und wenn ja, womit? Die EU hat eine Anti-Subventions-Untersuchung gestartet, die am Ende in Strafzölle münden könnte. Chinesische Hersteller erfreut das nicht. Aber sie wollen den europäischen Markt trotzdem erschließen.
Eine Marke, die 2024 den EU-Marktstart anpeilt, ist Chery. Beginnen will der Konzern in Spanien, Deutschland folge im dritten Quartal, erklärt Vize-Präsident von Chery International Charlie Zhang im Gespräch mit Julia Fiedler. Hierzulande will Chery demnach nicht nur Elektroautos anbieten, sondern auch Verbrenner und Plug-in-Hybride. Zhang zeigt sich zudem erstaunt, wie wenig die elektrische Ladeinfrastruktur in Deutschland bisher ausgebaut ist.
In China steigt die Zahl der Krebs-Erkrankungen im Vergleich zum Westen überproportional. Vor allem die Todeszahlen sind überdurchschnittlich hoch. Dass diese negative Entwicklung Kräfte freigesetzt hat, erklärt Jörn Petring. Denn China stieß eine schnellere Entwicklung neuer Medikamente und Diagnoseverfahren an, von denen auch der Westen profitieren könnte. Eines der neuen Medikamente aus der Volksrepublik ist bereits in den USA zugelassen. Weitere Regionen und weitere Medikamente dürften folgen.
Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die Woche!


Die Exporte von Chery lagen 2023 nach eigenen Angaben bei etwa 700.000 Fahrzeugen. In wie vielen Ländern verkaufen Sie aktuell Fahrzeuge?
Zurzeit sind wir in über 80 Ländern und Regionen tätig. 2024 werden wir allerdings noch größer, weil wir uns in Europa und insbesondere in Deutschland etablieren wollen. Wir gehen dabei Schritt für Schritt vor. Zunächst führen wir unsere Marke in Spanien ein, gefolgt von Italien und dem Vereinigten Königreich. In Deutschland werden wir wahrscheinlich erst im dritten Quartal 2024 auf den Markt kommen.
Warum so spät? Chery betreibt in Raunheim schon seit 2018 ein Entwicklungszentrum, Ihre Fahrzeuge sind in Deutschland aber noch nicht auf dem Markt. Eigentlich sollte der Verkauf bereits im Frühjahr losgehen…
Wir wollen sichergehen, dass wir gut vorbereitet sind. Entscheidend sind vier Schlüsselfaktoren: unsere Produkte, das Händlernetz, Marketing und Branding, sowie Service und die Verfügbarkeit von Ersatzteilen. All das muss stehen, bevor wir unsere Marken einführen.
Gibt es schon Verträge mit Händlern in Deutschland?
Wir befinden uns in sehr intensiven Gesprächen mit einer Reihe von potenziellen oder zukünftigen großen Händlergruppen.
Verträge haben Sie aber noch keine unterzeichnet?
Noch nicht. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass das bald geschieht.
Was für Fahrzeuge werden Sie auf den deutschen Markt bringen?
Wir wollen eine Reihe von Elektroautos anbieten. Gleichzeitig wissen wir, dass Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor in Deutschland immer noch einen großen Teil des Gesamtabsatzes ausmachen. Daher wollen wir eine Gesamtlösung anbieten: Verbrenner, batterieelektrische Fahrzeuge und Plug-in-Hybride.
Elektroautos aus China haben in letzter Zeit für viel Aufmerksamkeit gesorgt, das Interesse ist groß. Glauben Sie nicht, dass Sie Ihr Angebot verwässern, wenn Sie auch Verbrenner anbieten?
Über diese Frage haben wir lange nachgedacht. Es gibt einige andere chinesische Marken, zum Beispiel BYD und Nio, die nur batterieelektrische Fahrzeuge anbieten. Wir wollen allerdings groß sein. In China haben chinesische OEMs (Autohersteller) mittlerweile einen Gesamtmarktanteil von mehr als 50 Prozent. Bei den Elektroautos liegt der Anteil der chinesischen Marken sogar bei mehr als 80 Prozent. Die Wettbewerbsfähigkeit der chinesischen Hersteller wird immer größer und besser. Sie bringen viele Elektroautos auf den Markt – aber eben nicht nur, sondern auch Verbrenner. Wir können diesen großen Teil des Marktes nicht vernachlässigen.
Müssen sich die deutschen Hersteller Sorgen machen, dass E-Autos aus China den Markt mit der Wucht eines Tsunamis überschwemmen?
Ich glaube nicht, dass das eine passende Beschreibung für die Art des Wettbewerbs ist. Viele Jahrzehnte lang wurde der Sektor der Premiummarken von deutschen Marken wie BMW, Mercedes, Audi und Porsche dominiert. Die deutschen Marken, einschließlich Volkswagen China, haben jedes Jahr Millionen von Autos verkauft. Aber jetzt gerade werden die chinesischen Autobauer größer und stärker. Wir brauchen gleiche Wettbewerbsbedingungen. Deutschland ist eine Industrienation, die in China viele Geschäfte macht. Jetzt bieten die chinesischen Hersteller ihren deutschen Kunden gute Autos an. Ich glaube nicht, dass es sich um einen Tsunami handelt, die deutschen Autobauer sind in vielen Aspekten immer noch führend.
Die Qualitäten, für die deutsche Autohersteller immer bekannt waren, gelten in Zukunft aber vielleicht nicht mehr so sehr, wenn Autos zu Smartphones auf Rädern werden. Wie blicken Sie auf die deutsche Autoindustrie?
Lassen Sie es mich so formulieren: Es gibt einen konventionellen “alten Strang”, er steht für die Verbrenner, das letzte Jahrhundert. Darin sind die deutschen Autobauer ziemlich gut. Was Motoren und Getriebe angeht, war es schwierig, aufzuholen. Und dann gibt es den neuen Strang, für den die batterieelektrischen Fahrzeuge stehen. Batterien, Elektromotoren, elektrische Steuerungen, intelligente Cockpits, autonomes Fahren, all diese Technologien. Die chinesischen Hersteller haben hier eine Chance gesehen und versucht, in dieser Hinsicht stark zu sein.

Welche Folgen hat Chinas Einsatz für die neuen Technologien?
Wenn man die Lücke zwischen den chinesischen Herstellern und den deutschen Herstellern betrachtet, so hat sich diese definitiv verringert. Aber wenn es um die Grundlagen des Autobaus geht, um Haltbarkeit, Zuverlässigkeit und Qualität der Autos, dann sind die deutschen Hersteller immer noch mit Abstand führend.
Was bedeutet das?
Es gibt noch immer eine Menge Dinge, die wir lernen müssen. Volkswagen ist seit vielen, vielen Jahrzehnten unser Lehrer. Unser Vorstandsvorsitzender hat früher für Volkswagen gearbeitet. Er sagt uns immer, dass wir von der deutschen Qualität und der Art und Weise, wie Autos produziert werden, lernen müssen.
Trotzdem zittern die Vorstandsetagen in Wolfsburg und Stuttgart.
Für die deutschen Autobauer ist das jetzt gerade ein herausfordernder Moment. Schwer vorstellbar, wenn man viele Jahre lang führend war, doch jetzt bricht eine neue Ära an. Eben die der Smartphones auf Rädern. Sie ist anders. Die Art und Weise, wie wir konkurrieren, die Art und Weise, wie Sie Ihre Produkte bauen und entwickeln, ändert sich – und das bedeutet natürlich eine gewisse Herausforderung. Aber ich glaube immer noch, dass sich die beiden Seiten hervorragend ergänzen können. Warum sollten wir nicht hochgradig komplementäre Partnerschaften aufbauen?
Denken Sie nicht, dass eine gewisse Unabhängigkeit der Industrie für unsere beiden Länder wichtig ist?
Wenn Sie sich unsere Fabrik ansehen, werden Sie viele Geräte und Maschinen entdecken, die in Deutschland, Italien und Japan hergestellt werden. Wir kaufen und verwenden viele deutsche Maschinen und Anlagen. Klar erfordert die Entwicklung ein Umdenken. Früher exportierte China Spielzeug, Kleidung, vor allem Billigprodukte. Und auf einmal bietet China nicht nur Spielzeug, sondern auch Autos an. Ich denke, wir müssen uns an diese neue Realität, diese neue Normalität anpassen.
Sie sind aber nicht nur für Europa zuständig, sondern auch für andere Teile der Welt. Ich habe gehört, dass Sie besonders in Mexiko erfolgreich sind.
Wir haben Tochtergesellschaften in verschiedenen Ländern aufgebaut. 2022 haben wir unsere Marken in Mexiko eingeführt. Aktuell verkaufen wir dort monatlich etwa 4.000 bis 5.000 Fahrzeuge.
Die amerikanische Regierung ist nicht begeistert von Ihren Aktivitäten in Mexiko. In den USA gelten hohe Zölle für in China hergestellte Elektroautos. Die Regierung befürchtet, dass Sie Ihre Fahrzeuge durch die Produktion in Mexiko nun durch Hintertür in die USA importieren könnten. Wie stehen Sie dazu?
In Nordamerika gilt seit 2020 das United States-Mexico-Canada-Agreement (USMCA), das Nachfolgeabkommen zum NAFTA. Die Regelungen, was die Lokalisierung angeht, sind härter. Die Vereinigten Staaten wollten höhere Anforderungen an die lokale Herstellung in Mexiko stellen. Für uns ist der mexikanische Markt aktuell groß genug – es ist ein großer Markt von mehr als 1,2 Millionen Fahrzeugen. Andererseits hat Mexiko aber auch eine Reihe von Freihandelsabkommen mit anderen Ländern in Südamerika und sogar Europa. Mittelfristig können wir in Mexiko produzieren und in andere Länder exportieren.
Also auch in die USA?
Wir hoffen, dass wir die Freihandelsabkommen nutzen können, um in Mexiko zu produzieren und in die Vereinigten Staaten zu exportieren, insbesondere Elektroautos. Aber das ist nicht unser unmittelbares Ziel.

Auch die EU prüft nun Anti-Dumping-Zölle für chinesische Elektroautos. Es geht um angeblich irreguläre Subventionen der chinesischen Führung. Was heißt das für Sie?
Ich halte es für eine bedauerliche Entscheidung, dass die EU eine Anti-Subventionsuntersuchung eingeleitet hat, um chinesische Autos zu regulieren. Das wird sich definitiv negativ auf den Verkauf von chinesischen Elektroautos auswirken. Das können wir nicht ändern, wir müssen uns daran anpassen.
Die deutsche Regierung wiederum hat Ende letzten Jahres spontan die Subventionen für Käufer von Elektroautos eingestellt. Welche Folgen hat das für Ihr Unternehmen?
Deshalb werden wir auch Verbrenner anbieten. Wir können uns nicht nur auf den Markt für Elektroautos konzentrieren. Der ist mit knapp 20 Prozent an den Neuzulassungen 2023 noch relativ klein. Wir wollen ein robustes Produktportfolio einführen, das Verbrenner, Plug-in-Hybride und Elektrofahrzeuge umfasst, weil wir den Massenmarkt ansprechen wollen. Wenn man sich Europa als Ganzes ansieht, sind die einzelnen Märkte zudem sehr unterschiedlich.
Hatten Sie erwartet, dass sich Deutschland bei der Elektromobilität schneller entwickeln würde?
Jeder dachte, dass Deutschland, die größte Volkswirtschaft mit dem größten Markt in Europa, die Elektrifizierung fördern und versuchen will, Emissionsfreiheit zu erreichen. Doch jetzt hat die Bundesregierung sogar die Subventionen für Elektroautos gestrichen. Bei der Elektromobilität gibt es in meinen Augen drei Schlüsselfaktoren: Erschwinglichkeit, Batteriereichweite und Infrastruktur. Wenn diese drei Schlüsselfaktoren nicht gegeben sind, wird es sehr schwierig, eine 100-prozentige Elektrifizierung zu erreichen. Ich war in Frankfurt, München und Köln unterwegs und habe auf den Straßen nach Ladestationen Ausschau gehalten. Um ehrlich zu sein, war es sehr schwierig, besonders viele zu finden. Ich weiß nicht, wie die Regierung plant, die Infrastruktur landesweit oder in Europa zu fördern. Aber wenn die Infrastruktur fehlt – wie kann man dann davon sprechen, dass man bis 2035 nur noch emissionsfreie Pkw zulassen will?
Charlie Zhang (张升山) ist Executive Vice President von Chery International und Assistant President des Gesamtkonzerns Chery Automobile. Zuvor hatte er die Position als General Manager der Region Mittel- und Südamerika inne. Zhang arbeitet seit mehr als 15 Jahren für den chinesischen Autohersteller.

China hat ein Krebsproblem. Die Zahl der Krebstoten in China ist zwischen 2005 und 2020 um 21,6 Prozent auf jährlich fast 2,4 Millionen angestiegen, wie aus einer neuen Studie des staatlichen Chinesischen Zentrums für Krankheitskontrolle und Prävention (CDC) hervorgeht. Seit 2010 ist Krebs demnach die häufigste Todesursache in der Volksrepublik.
Neben den steigenden Todeszahlen sind dies die wichtigsten Erkenntnisse der im Dezember 2023 veröffentlichten Untersuchung:
China hat seit langem die höchste Zahl an Krebstoten weltweit. Die CDC-Forschenden warnen indes davor, dass die Mortalitätsraten des Landes aufgrund der begrenzten Datenlage möglicherweise sogar noch unterschätzt wurden. Sie fordern die chinesische Regierung auf, alle Anstrengungen zu unternehmen, um die Krebslast zu verringern. Dazu gehören die Förderung von kostengünstigen Krebsfrüherkennungs- und Impfprogrammen sowie die Umsetzung einer strikten Tabakkontrollpolitik.
Untätig ist Peking nicht. Gesundheitspolitiker haben es sich zum Ziel gesetzt, die Gesamtüberlebensrate von Krebspatienten bis 2025 um zehn Prozent zu erhöhen. Die vorzeitige Sterblichkeit durch nichtübertragbare Krankheiten einschließlich Krebs will man dagegen bis 2030 um 30 Prozent senken.
Vor allem aber geben wissenschaftliche Durchbrüche Anlass zur Hoffnung, dass China nicht nur mittelfristig seine eigenen Probleme in den Griff bekommt, sondern auch einen Beitrag zur Lösung des globalen Krebsnotstands leisten kann.
Chinesische Unternehmen haben Fortschritte bei der Entwicklung neuer Medikamente erzielt. Manche von diesen werden nun auch im Westen eingesetzt; so hat die Zulassung des Medikaments Toripalimab in den USA kürzlich für Aufsehen gesorgt. Das von Shanghai Junshi Biosciences entwickelte Medikament wurde im Oktober von der US Food and Drug Administration (FDA) zur Behandlung des Nasopharynxkarzinoms (NPC) zugelassen. Das ist eine aggressive Krebsart, die hinter der Nase im oberen Teil des Rachens beginnt. Toripalimab ist das erste und derzeit einzige von der FDA zugelassene Medikament zur Behandlung dieser Krebsart.
Ebenfalls erst vor wenigen Wochen stellte Dizal, ein biopharmazeutisches Unternehmen aus der Provinz Jiangsu, ein neues, vielversprechendes Medikament vor. Sunvozertinib zeigt gute Ergebnisse bei der Behandlung einer bestimmten Art von Lungenkrebs. In einer Phase-2-Studie mit 104 Patienten im fortgeschrittenen Krankheitsstadium zeigte Sunvozertinib eine deutlich höhere Wirksamkeit als alle bisherigen Kandidaten.
Es gibt eine Vielzahl ähnlicher Meldungen zu erfolgversprechenden Medikamenten aus China. So machten Forschende dort auch Fortschritte bei der Entwicklung und Anwendung von KI-basierten Bilderkennungssystemen, die in der Onkologie eingesetzt werden. Auch diese werden ihren Weg in den Westen finden. Gerade erst hat die DAMO Academy, ein Forschungsinstitut der Alibaba Group, ein neues KI-gestütztes Tool vorgestellt, das frühe Anzeichen von Bauchspeicheldrüsenkrebs erkennen kann. Das Tool mit dem Namen PANDA kann auf CT-Scans noch genauer als Radiologen erkennen, ob ein Patient erkrankt ist.
Der Staatsrat hat hoch verschuldete Lokalregierungen und Staatsbanken in zwölf Regionen des Landes angewiesen, einige staatlich finanzierte Infrastrukturprojekte zu verschieben oder zu stoppen. Das berichtete Reuters unter Berufung auf Insider. Die Direktive betrifft demnach Projekte, bei denen zum derzeitigen Stand weniger als die Hälfte der geplanten Investitionen abgeschlossen sind – darunter Schnellstraßen, Bau und Erweiterung von Flughäfen sowie Nahverkehrsprojekte.
Manche Projekte seien ausgenommen, beispielsweise solche, die von der Zentralregierung in Peking genehmigt worden waren, oder der Bau erschwinglichen Wohnraums. Der Staatsrat hat die Direktive bislang nicht öffentlich bekannt gegeben.
China bemüht sich seit Monaten, die kommunalen Schulden in den Griff zu bekommen, die inzwischen umgerechnet rund 11,94 Billionen Euro erreicht haben. Nach den aktuellsten verfügbaren Daten entsprachen sie 2022 76 Prozent des damaligen Bruttoinlandsprodukts. 2019 waren es noch 62 Prozent gewesen.
Bereits im Herbst 2023 hatte Peking laut Reuters die zwölf Regionen ins Visier genommen. Damals wies der Staatsrat dortige Lokalregierungen bereits an, “problematische” Public-Private-Partnership-Projekte zu stoppen und verfügte Investitionsbeschränkungen. Zu den zwölf betroffenen Regionen gehören die Provinzen Liaoning und Jilin im Nordosten, Guizhou und Yunnan im Südwesten, sowie die Städte Tianjin und Chongqing. Diese Regionen sollten alle Anstrengungen unternehmen, um ihr “Schuldenrisiko auf ein niedriges und mittleres Niveau” zu reduzieren, so die Quellen zu Reuters. Die Direktive habe aber nicht festgelegt, wie der Schuldenabbau gemessen werden solle.
Chinas Wirtschaft schaffte laut offiziellen Angaben 2023 ein BIP-Wachstum von 5,2 Prozent und lag damit leicht über dem offiziellen Ziel von rund fünf Prozent. Die Aussichten für 2024 bleiben aber mäßig. rtr/ck
Russland hat 2023 Saudi-Arabien als Chinas wichtigsten Rohöllieferanten überholt. Chinesischen Zolldaten zufolge lieferte Moskau im vergangenen Jahr die Rekordmenge von 107,02 Millionen Tonnen Rohöl nach China, was 2,14 Millionen Barrel pro Tag (bpd) entspricht. Das war weit mehr die Menge anderer großer Ölexporteure wie Saudi-Arabien und Irak. Chinas Einfuhren des bisherigen Top-Lieferanten Saudi-Arabien gingen dagegen um 1,8 Prozent auf 85,96 Millionen Tonnen zurück.
Die Volksrepublik nutzt dabei die Niedrigpreise russischen Erdöls, die Moskau aufgrund der Sanktionen und der Importstopps früherer Kunden akzeptieren muss. Um nicht gegen die westlichen Sanktionen zu verstoßen, setzen chinesische Raffinerien Zwischenhändler ein, die Transport und Versicherung des russischen Rohöls übernehmen. Russland betreibt nach Recheren von Ölhändlern seit 2022 eine ganze Flotte sogenannter Schattentanker, die unter dem Rader meist ohne Versicherungsschutz Öl transportieren. Oft wird dieses auf See dann von Schiff zu Schiff umgeladen, um die Herkunft zu verschleiern.
Chinesische Ölkonzerne äußern sich seit Kriegsbeginn eher zugeknöpft über die Quellen ihrer Importe. Russlands Vize-Ministerpräsident Alexander Nowak aber hatte bereits Ende Dezember betont, dass 2023 praktisch der gesamte russische Rohölexport nach China und Indien gegangen sei. Der Westen findet dagegen bislang kein Mittel. Seit kurzem gibt es laut Bloomberg allerdings erste Anzeichen, dass die russische Schattenflotte durch Verschärfungen der US-Sanktionen Probleme bekommt. So haben 14 Tanker, die russisches Erdöl nach Indien transportieren, entweder auf der Stelle gezögert, beigedreht oder die Geräte für digitale Ortungssysteme ausgestellt. Das könnte ebenso den China-Transport betreffen, ist bislang aber nur eine Beobachtung.
Transfers von Schiff zu Schiff finden gibt es derweil für Rohöl aus anderen sanktionierten Ländern. So nutzen Käufer laut Reuters die Gewässer vor Malaysia als Umschlagplatz für Ladungen aus Iran und Venezuela. Chinas als aus Malaysia stammend gekennzeichnete Einfuhren stiegen 2023 um 53,7 Prozent.
Insgesamt stiegen Chinas Rohölimporte 2023 stiegen auf einen Rekordwert von 563,99 Millionen Tonnen, was 11,28 Millionen bpd entspricht. Auch die Lieferungen aus den USA nach China stiegen trotz geopolitischer Spannungen zwischen Peking und Washington um 81,1 Prozent, da die Rohölproduktion in den USA zunahm. rtr/ck
Der für vergangenen Samstag geplante erste EU-Trilog für die Verordnung zum Importverbot für Produkte aus Zwangsarbeit ist geplatzt. Ursache ist Uneinigkeit im EU-Rat. Der Ausschuss der Ständigen Vertreter (AStV) hat in seiner Sitzung am Freitag bei Gesprächen über die Position des Rats zwar Fortschritte erzielt, konnte sich aber noch nicht auf einen finalen Text einigen, wie ein Sprecher zu Table.Media sagte. Im Trilog verhandeln Vertreter aus Kommission, Rat und Parlament miteinander über wichtige EU-Regeln.
In der kommenden Woche soll nun auf technischer Ebene weitergearbeitet werden; der AStV wird am Mittwoch oder Freitag noch einmal zusammenkommen. Damit wird die Zeit für die Verhandlungen mit dem Parlament knapp. Spätestens am 6. Februar müssten Rat und Parlament sich notfalls bei einem einzigen Treffen einigen. Das EU-Verbot für Produkte aus Zwangsarbeit zielt vor allem auf Produkte aus China, wo in Xinjiang Uiguren zur Zwangsarbeit verpflichtet sein sollen. leo
Die USA und China haben nach acht Jahren Pause den bilateralen Landwirtschafts-Dialog im China-U.S. Joint Committee on Cooperation in Agriculture (JCCA) wieder aufgenommen. Die beiden Landwirtschaftsminister Tang Renjian und Tom Vilsack seien in Washington zusammengetroffen, berichtete das Wirtschaftsmagazin Caixin. Das chinesische Agrarministerium teilte demnach mit, den Dialog zu pflegen und sein “stabiles Funktionieren zu gewährleisten”. Man habe “eingehende und offene” Gespräche über klimagerechte Landwirtschaft, Ernährungssicherheit und Handelserleichterungen geführt.
Vilsack nannte China in einem Statement seines Ministeriums laut Caixin einen “wichtigen landwirtschaftlichen Exportmarkt” und betonte den Willen zu mehr Zusammenarbeit. Die Wiederbelebung dieses Kommunikationskanals, der seit November 2015 auf Eis lag, ist ein weiteres Zeichen, dass die beiden Supermächte trotz ihrer geopolitischen Spannungen wieder mehr miteinander statt nur übereinander sprechen wollen. ck
China hat eine erste Serie von Lizenzen für Produktion und den Verkauf von gentechnisch veränderte Mais- und Sojabohnensorten erteilt. Damit habe das Landwirtschaftsministerium den Weg für die Kommerzialisierung dieser Kulturen geebnet, berichtete das Wirtschaftsmagazin Caixin am Freitag. Ingesamt gibt es demnach nun Lizenzen zur Herrstellung von Saatgut für 36 Genmais- und 10 Gensoja-Varianten. Sie gingen laut Caixin vor allem an drei Firmen: Die staatliche China National Seed Group sowie Agrar-Tochterfirmen von Beijing Dabeinong Technology und Yuan Longping High-Tech Agriculture.
Die Anpflanzung werde unter staatlicher Aufsicht erfolgen und sich auf bestimmte Gebiete beschränken, so der Bericht. Die Lizenzen werden demnach zunächst bis zum 24. Dezember 2028 in 13 Regionen auf Provinzebene gültig sein – darunter Peking und wichtige Getreide produzierende Provinzen wie Hebei, Liaoning, Jilin und die Innere Mongolei.
In China gibt es seit 2021 Pilotprojekte zum Anbau gentechnisch veränderter Mais- und Sojabohnensorten. Peking will mithilfe der Gentechnik die Erträge steigern, mit einem Fokus auf heimische Produktion und Ernährungssicherheit. Das Land hat bisher aber noch keine gentechnisch veränderten Pflanzen zum Markt zugelassen. Auch der Bayer-Konzern in Leverkusen hofft auf eine Zulassung. Mit der Übernahme des US- Agrarriesen Monsanto ist Bayer zu einem der größten Anbieter von grüner Gentechnik aufgestiegen. ck
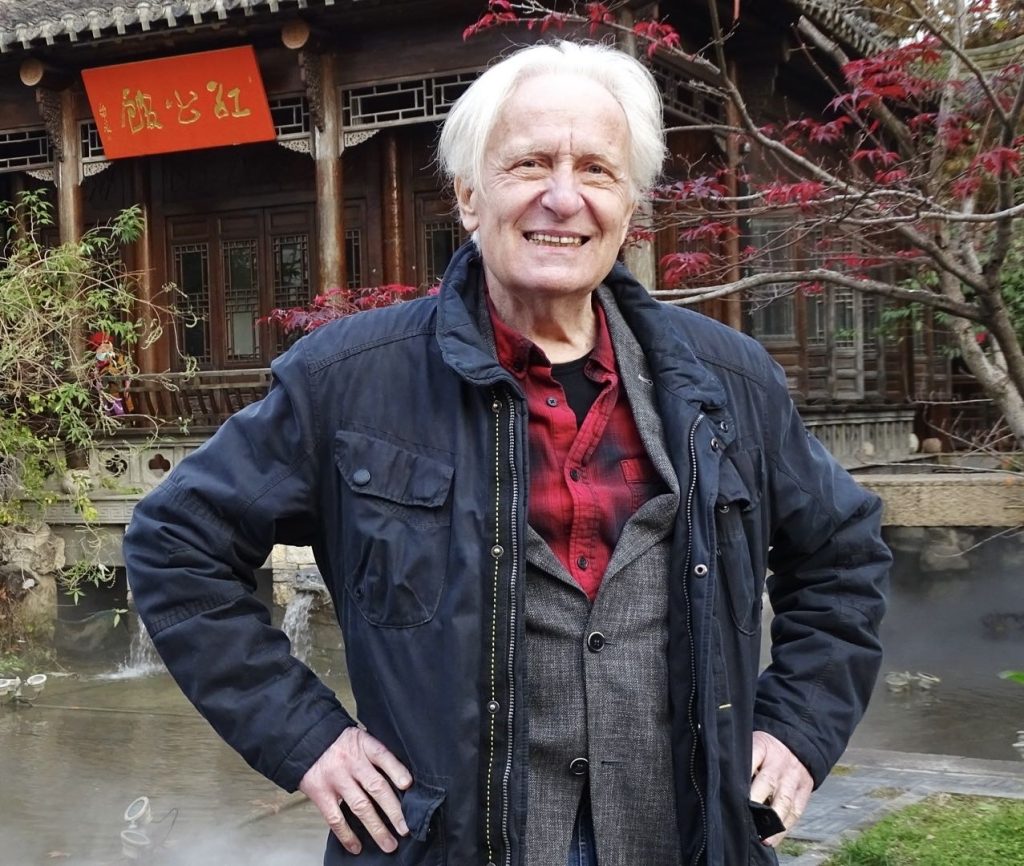
Uwe Kräuter sei der “Marco Polo unserer Zeit”, sagte ein Freund über ihn. Fast 50 Jahre lebt er nun in China, seit 1974. Damals, gegen Ende der berüchtigten Kulturrevolution und zwei Jahre vor dem Tode Mao Zedongs, bekam er den Titel “Ausländischer Experte”. Er ist auch bekannt als der am längsten in China lebende Deutsche.
Der Grund, warum Kräuter nach China kam, ist durchaus ungewöhnlich. Er hatte 1970 in Heidelberg an einer gewalttätigen Demonstration gegen den Vietnamkrieg teilgenommen und wurde wegen angeblicher Rädelsführerschaft zu acht Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt. Die Haft trat er aber nicht an – sondern nahm ein Jobangebot als Übersetzer beim Verlag für fremdsprachige Literatur der kommunistischen Führung in China an und ging nach Peking. Damit war er für die deutsche Justiz nicht mehr greifbar.
“Ich bin dankbar, dass ich damals diesen Mut und diese Energie gehabt habe, einfach zu sagen, wenn China mich einlädt, die Tore aufmacht, gehe ich da selbstverständlich hin. Überdies reizte mich die Exotik”, erzählt Kräuter heute. Seinen Entdeckergeist hat er zum Teil wohl von seinem Großvater, der als Seemann in China gewesen war: “Als ich Kind war, hat er mir viel von seinen Eindrücken dort erzählt, und das waren alles schöne Geschichten.”
Sein Interesse an Kunst und Film in China entdeckte Kräuter nach dem Ende der Kulturrevolution 1976. “Da kamen all diese chinesischen Künstler zurück aus Gefängnissen oder vom Land, von weit her in die großen Städte, aus denen sie ursprünglich stammten.” Kräuter hatte die Gelegenheit, viele dieser Menschen, die Unglaubliches erlebt hatten, persönlich kennenzulernen.
1985 drehte er in Kooperation mit dem Jugendfilmstudio der Pekinger Filmakademie die Dokumentation “Meine Pekinger Künstlerfreunde“. Unter den Porträtierten war auch der kürzlich verstorbene Maler Huang Yongyu, der zu Anfang der Kulturrevolution wegen seines Bildes einer Eule, die ein Auge geschlossen hat, bekannt wurde. “Die Viererbande behauptete, ein Auge sei geschlossen für die Revolution und das Denken von Mao Zedong – was für ein Unsinn!”
In seinen Tätigkeiten – nicht nur als Autor, sondern auch als Filmproduzent und Unternehmer – gelang es Uwe Kräuter, sich über die Jahre als Kulturmittler zwischen China und Deutschland zu etablieren. 1980 organisierte er mit dem Mannheimer Nationaltheater die Aufführung des chinesischen Dramas “Das Teehaus” von Lao She. “Alle Medien Deutschlands waren fasziniert von den Aufführungen”, erinnert er sich. Es habe keinen einzigen negativen Artikel gegeben.
Vor und nach Gründung einer eigenen Firma namens “Asia World Network Ltd” produzierte Kräuter Filme in und über China für das ZDF. Gleichzeitig fädelte er den Import deutscher Filme und Serien ein, zum Beispiel “Derrick”. Die Krimiserie wurde 1988 erstmals in China ausgestrahlt.
Wegen der scharfen US-Kritik an der brutalen Niederschlagung der Demokratiebewegung auf dem Tiananmenplatz am 4. Juni 1989 veranlasste der damalige Spitzenpolitiker Jiang Zemin, dass die US-Serie Hunter, die bis dahin im Schanghaier Fernsehen lief, abgesetzt wurde. Stattdessen nahm der Sender Derrick ins Programm, der seine Fälle mit Köpfchen statt mit Waffen löst. Man erhoffte sich, dass die friedvolle Art des Kommissars, auf Konfliktsituationen zu reagieren, Auswirkungen auf die Gemüter der Bürger haben würde.
Durch seine Filmarbeit reiste Kräuter in für damalige Verhältnisse entlegen geltende Städte und Regionen: 1991 besuchte er den Tempel Ai Dao Tang in Chengdu für die Produktion von “Prinzessin einer anderen Welt” über das Leben buddhistischer Nonnen in China. Nachhaltig beeindruckend war für ihn auch der Aufenthalt in der Taklamakan-Wüste in Xinjiang, wo uigurische Kinder ihm ihre Geschichten erzählten. So entstand die Serie “Wüstenkinder”.
Wie sieht ein Leben aus, das sich so viele Jahre in China abspielt? Es ist eine Biografie, die geprägt ist, sich auf neue Verhältnisse einzulassen. 2012 wurde sein Buch “So ist die Revolution, mein Freund” publiziert, in dem Kräuter seine Erlebnisse in China beschreibt. Er knüpfte Freundschaften in allen Schichten und Berufsgruppen.
Neben Freundschaften wie jenen zu den Künstlern war es aber auch die Liebe, die Kräuters Verhältnis zu dem Land geprägt hat. 1984 heiratete er Shen Danping, die in China als Schauspielerin viele Jahre lang berühmt war und bei vielen nach wie vor ist. Die offizielle chinesische Seite missbilligte diese Beziehung zunächst. “Die Skepsis gegenüber ausländisch-chinesischer Heirat ist heute Vergangenheit”, sagt Kräuter. Sie treten immer wieder gemeinsam in Talks Shows auf und wurden 2005 von Shanghai Television sogar zum humorvollsten Paar gekürt.
Vom Westen wünscht sich Kräuter eine unvoreingenommene Haltung und mehr Höflichkeit in der Annäherung. “Es sollte ein Bedürfnis sein, uns der Unterschiede in den Köpfen unserer Welt und der dortigen Welt, also unserer historischen Unterschiede bewusst zu sein”, sagt er. Wenn das nicht geschieht, werde es keine wahre Kommunikation geben können. Statt den Zeigefinger zu erheben, sollten lieber mehr Fragen gestellt werden – so lautet seine Devise.
Kräuter ist inzwischen 78 Jahre alt. Vor Kurzem ist sein neues Buch erschienen. “Reisen ins Unbekannte” heißt es. Darin schreibt er über seine Begegnungen in Nordkorea. Juliane Scholübbers
Karolin Kollmorgen ist seit Dezember als Referentin zuständig für das Projekt “China Hub” am Bayerischen Hochschulzentrum für China (BayCHINA). “China Hub” ist ein vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördertes Projekt zur Förderung von China-Kompetenz in der bayerischen Hochschul- und Wissenschaftslandschaft. Kollmorgen war zuvor Kulturmanagerin am Konfuzius-Institut Hamburg.
Ali Wyne ist seit diesem Monat Senior Research and Advocacy Advisor U.S.-China bei der International Crisis Group. Die Nichtregierungsorganisation mit Sitz in Brüssel liefert Analysen und Lösungsvorschläge zu internationalen Konflikten.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Tesla-Chef Elon Musk will seinen Cybertruck demnächst auf Promotion-Tour nach China schicken. Auch in der Volksrepublik, dem zweitgrößten Markt für Tesla, stößt das kantige Fahrzeug auf Hass und Liebe und kaum etwas dazwischen. Im Netz bringen viele das Auto mit Chinas “nutzlosem Edison” Geng Shuai 耿帥 in Verbindung, einem Schweißer aus dem Hinterland, der immer wieder mit Videos seltsamer Erfindungen viral geht.
Eine Marktzulassung für Teslas Cybertruck ist in China aber ohnehin unwahrscheinlich. Anders als in den USA sind Pickups hier ein Nischenprodukt, da viele Stadtverwaltungen, darunter auch die von Peking, sie nicht in Innenstädten erlauben.
