das Investitionsabkommen zwischen der EU und China (CAI) sollte den chinesischen Markt öffnen und lästige Praktiken wie den Technologietransfer einschränken. Jetzt liegt das Abkommen vorerst auf Eis. Und das könnte schon in naher Zukunft weitreichende Folgen für europäische Unternehmen haben. Felix Lee sprach darüber mit Liu Wan-Hsin. Die Ökonomin am Institut für Weltwirtschaft in Kiel warnt: Peking strebt Unabhängigkeit vom Ausland an. Unternehmen werden bald Fabriken nach China verlagern müssen. Das CAI hätte dagegen für faireren Wettbewerb gesorgt. Der Stopp der Ratifizierung sei verständlich und zugleich bedauerlich, so Liu.
Chinas Strommix beruht noch immer zu gut zwei Dritteln auf klimaschädlichem Kohlestrom. Unternehmen, die zu 100 Prozent auf erneuerbare Energien umsteigen wollen, haben es daher nicht leicht, analysiert Christiane Kühl. Selbermachen!, dachte sich BASF. Der Chemie-Riese hat einen Mechanismus zum Direktankauf von Ökostrom mit der Provinzregierung in Guangdong eingerichtet. Ein Vorbild also für andere deutsche Unternehmen vor Ort.
Wie wichtig eine sichere Stromversorgung ist, merken derzeit Firmen in Südchina. Dort kommt es seit einigen Tagen zu Elektrizitätsengpässen. In einigen Gegenden müssen Fabriken an drei Tagen der Woche schließen. Der Klimawandel schadet eben auch dem Ökostrom aus Wasserkraft.
Ich wünsche eine spannende Lektüre und einen guten Wochenstart!

Ein Großunternehmen kann den nötigen Ökostrom für ein großes Werk in der Regel nicht einfach so am Markt kaufen. Um Strom ausschließlich aus erneuerbaren Quellen zu beziehen, braucht es die nötige Infrastruktur, sowie die Kooperation der Stromnetze und des Strommarkt-Betreibers. Nur so lassen sich Klimaziele praktisch umsetzbar machen. Eine solche Kooperation hat der Chemiekonzern BASF jetzt in der Südprovinz Guangdong angestoßen. Die Ludwigshafener wollen in der Stadt Zhanjiang einen Verbundstandort errichten, der in seiner ersten Phase zu 100 Prozent mit Ökostrom versorgt wird – und initiierten dafür bei der Provinzregierung ab 2019 einen Mechanismus zum Direktankauf von Ökostrom.
Damals schlug das Unternehmen nach eigenen Angaben den lokalen Behörden das “Renewable Direct Power Purchase” (R-DPP)-Konzept vor, das es gemeinsam mit dem Konzern China Resources Power entwickelt hatte. “Dabei beziehen wir emissionsfreien Strom über den Netzbetreiber direkt von der entsprechenden erneuerbaren Energiequelle”, sagt Haryono Lim von BASF dem China.Table. “Im traditionellen System konnten wir nur Strom aus dem öffentlichen Stromnetz beziehen”, so der BASF-Verantwortliche für das “Project New Verbund Site China”. Das deutsche Wort “Verbund” hat hier Eingang in den internationalen Jargon der Branche gefunden.
Ins normale Stromnetz wird ein Mix aus verschiedenen Energieträgern mit einem hohen Anteil Kohlestrom eingespeist. Erneuerbare Energien tragen in China derzeit nur rund ein Viertel zum Strommix bei. Den Stromnetzen kommt daher bei Chinas Übergang zur Klimaneutralität eine entscheidende Rolle zu. Sie müssen das Kohle-Primat brechen und anteilig mehr Öko-Strom durchleiten. Sie brauchen dazu deutlich mehr Stromspeicher-Kapazitäten, da Strom aus Wind und Sonne aufgrund wechselnder Wetterbedingungen starken Schwankungen unterliegt. Und zuletzt müssen die Netzbetreiber Firmenkunden technisch und regulativ ermöglichen, Ökostrom direkt einzukaufen – wie es jetzt in Guangdong geschieht.
Das von BASF initiierte R-DPP-Konzept stieß laut Lim in Guangdong 2019 den Entwurf eines umfassenden neuen Pilot-Regelwerks für den Handel mit erneuerbaren Energien an, das diesen Mechanismus mit aufnimmt. Die zuständige Behörde für diese Geschäfte ist das 2016 für den Handel mit Strom gegründete Guangdong Power Exchange Center. “Wie wir vom Guangdong Power Exchange Center erfahren haben, gibt es keine Beschränkung für die Sektoren, in denen ein Handel nach dem R-DPP-Prinzip stattfinden kann”, sagt Lim. Auch andere Firmen in Guangdong werden also direkt Ökostrom beziehen können.
Die Chemieindustrie gehört zu den energieintensivsten Industriebranchen. Eine Transformation des Chemie- oder auch des Stahlsektors gilt daher als unverzichtbar für erfolgreichen Klimaschutz. BASF hat angekündigt, ab 2050 kohlenstoffneutral wirtschaften zu wollen. Bis 2030 will der Konzern den Ausstoß von Treibhausgasen um 25 Prozent gegenüber 2018 senken. Damals lagen die weltweiten Emissionen der BASF-Gruppe bei 21,9 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente. Nach Firmenangaben sind das nur noch die Hälfte der Emissionen von 1990.
Bis 2025 plant BASF dafür Investitionen von bis zu einer Milliarde Euro, sowie bis 2030 von weiteren zwei bis drei Milliarden Euro, wie das Unternehmen kürzlich mitteilte. Denn neuartige Produktionsprozesse – die es bisher teils noch gar nicht gibt – werden laut BASF den Strombedarf ansteigen lassen, da sie auf andere Energiequellen wie fossile Brennstoffe verzichten können. Das wiederum erfordert, den Strom aus erneuerbaren Quellen zu beziehen oder selbst zu erzeugen. Gemeinsam mit dem Energieerzeuger RWE will BASF daher zum Beispiel einen Offshore-Windpark in der Nordsee mit einer Kapazität von zwei Gigawatt bauen, wie beide Unternehmen kürzlich mitteilten. Bisher beziehen bereits 19 BASF-Standorte in Europa und Nordamerika ganz oder teilweise Strom aus erneuerbaren Energien.
Zhanjiang soll laut BASF ein Modell-Standort für nachhaltige Produktion werden. Ab 2022 sollen dort zunächst technische Kunststoffe und thermoplastische Polyurethane (TPU) hergestellt werden. “Die ersten Anlagen des Verbundstandorts Zhanjiang werden zu 100 Prozent mit Strom aus erneuerbaren Quellen wie Windenergie und Photovoltaik betrieben”, sagt Haryono Lim. Auch für zukünftige Phasen strebe BASF einen hohen Anteil an Ökostrom an. Eine genaue Zielmarke könne das Unternehmen aufgrund der langen Planungsvorläufe noch nicht nennen, so Lim. Erst für 2030 ist die komplette Fertigstellung des Standorts anvisiert.
Produktionsstandorte jeder Branche benötigen neben Strom immer auch andere Energieformen. Den Strom klimaneutral zu erzeugen oder einzukaufen, ist in der Regel der erste Schritt der klimafreundlichen Transformation. In China betreibt etwa Volvo nach eigenen Angaben ein Werk in Daqing mit 100 Prozent Ökostrom. Und VW kündigte an, dass es seine neue Elektroauto-Fabrik in Anhui – deren Bau gerade startete – ebenfalls mit Ökostrom betreiben werde. BASF hat in China an Standorten im Shanghaier Chemiepark Caojing sowie der großen Firmenzentrale in Pudong Photovoltaikanlagen installiert, die das Unternehmen selbst betreibt.
Wenn es um den gesamten Energiebedarf geht, setzen die Firmen dagegen zunächst auf Energieeinsparungen. “Wir konnten zum Beispiel unseren Dampfbedarf durch die Optimierung von Kondensat-Ableitern am BASF-Standort in Caojing und durch die Installation eines Dampfkühlers am Standort Nanjing reduzieren”, sagt Lim.
BASF berichtet Treibhausgasemissionen nach dem weltweit anerkannten Greenhouse-Gas-Protocol-Standard sowie dem sektorspezifischen Standard für die Chemieindustrie. Dieser unterscheidet zwischen direkten Emissionen der eigenen Produktion und der eigenen Erzeugung von Strom und Dampf eines Standorts (Scope 1), Emissionen durch den Zukauf von Strom (Scope 2) sowie Emissionen in der Wertschöpfungskette (Scope 3). Nach diesem Bewertungsverfahren wird der Industriebetrieb also auch für die Verbrennung von Kohle durch das Elektrizitätswerk zur Rechenschaft gezogen.
Würde BASF Strom für den neuen Verbundstandort aus dem Südlichen Stromnetz (South Grid) beziehen, zu dem Guangdong gehört, würden der neuen Anlage in Zhanjiang demnach die bei der Erzeugung dieses Stroms entstandenen Kohlendioxid-Emissionen zugeschlagen. Im Südlichen Stromnetz, zu dem Guangdong gehört, liegt der durchschnittliche Kohlendioxid-Ausstoß bei etwa 0,5 bis 0,6 Kilogramm pro Kilowattstunde, wie Lim erläutert. Da BASF mithilfe von R-DPP den Strom aus erneuerbaren Energien direkt von den Erzeugern beziehen kann, würde es diese Anrechnung von Emissionen des öffentlichen Netzes vermeiden. Das wiederum senkt die zu berichtenden Gesamt-Emissionen des Standorts.
Auch die Provinz Sichuan öffnete 2020 nach einem Bericht der South China Morning Post den Stromeinzelhandel und ermöglichte es damit privaten Unternehmen, 100 Prozent ihres Strombedarfs aus erneuerbaren Energien zu beziehen. Zuvor waren es maximal 70 Prozent. Es ist zu hoffen, dass andere Provinzen möglichst bald nachziehen.
Die jüngste Volkszählung Chinas hat einen Trend bestätigt, der sich seit längerem abzeichnet: Die Bevölkerung des Landes wird früher oder später schrumpfen (China.Table berichtete). In den vergangenen zehn Jahren ist sie nur noch um jährlich 0,53 Prozent gewachsen – so langsam wie seit den 1950er-Jahren nicht mehr. In Peking geht man nun davon aus, dass China noch in dieser Dekade den Höchststand bei der Bevölkerungszahl erreichen wird.
Gleichzeitig ist die Zahl der Chinesen über 60 Jahre seit 2010 um 5,4 Prozent auf 264 Millionen gestiegen, erklärt Pekings Statistikamt. Das klingt erst einmal dramatisch. Zumal China ohne Zweifel eines der Länder ist, die am schnellsten altern. Die Geburten sind allein im vergangenen Jahr um mehr als 18 Prozent zurückgegangen.
Das Problem dabei: Weniger junge Menschen produzieren und konsumieren weniger. Das bedeutet weniger Steuereinnahmen. Gleichzeitig steigen die Renten und Krankenversicherungsbelastungen für die Älteren. Aus der Sicht des Staates bedeutet das: Weniger Einnahmen, mehr Ausgaben.
Im internationalen Vergleich jedoch sieht die Lage noch entspannt aus. In China sind nur 12 Prozent der Bevölkerung über 65 Jahre. In Japan sind es 28 Prozent, in Italien 22 Prozent, in Deutschland 21 Prozent, in den USA 16 Prozent. Alle diese Länder mit einem hohen Anteil an Alten haben keine großen sozialen Unruhen und stehen auch nicht am Rand des wirtschaftlichen Kollapses.
Allerdings haben diese Länder im Unterschied zu China auch einen großen Vorteil: Sie haben ein viel höheres Pro-Kopf-Einkommen. An der Kaufkraftparität gemessen sind es in China knapp 17.000 US-Dollar. In den USA hingegen 65.000, in Deutschland 57.000 US-Dollar. Italien kommt auf 45.000 US-Dollar, Japan liegt bei 43.000.
Die Frage ist nun: Schafft es China, sein Pro-Kopf-Einkommen auf das Niveau der genannten Länder zu erhöhen, bevor die Alterung Wachstumspotenziale aufzehrt? Oder kürzer: Wird China reich, bevor es alt wird? Das ist aus vier Gründen gut möglich.
Grund 1 – Aufwärtspotenzial bei der Produktivität – durch Automatisierung, Prozessverbesserungen, Technologie: Sie ist bisher im Vergleich sehr niedrig und liegt bei 40 Prozent der japanischen, gut 30 Prozent der deutschen und rund 25 Prozent der US-amerikanischen Produktivität. Nichts spricht dagegen, dass die Chinesen einmal so produktiv werden, wie es die Japaner heute schon sind. Dabei hilft es auch, das Rentenalter anzuheben. Auch in diesem Bereich ist in China noch Luft nach oben: Es liegt für Männer bei 60 Jahren und für Frauen bei 55 Jahren.
Grund 2 – Eine hohe Sparrate – die Konsumausgaben könnten in Zukunft also erhöht werden: Zweitens liegt die Sparrate pro Haushalt in China bei über 35 Prozent, während sie in Japan nur über 4 Prozent liegt (USA 8 Prozent, Deutschland 10 Prozent). Die Sparrate ist deshalb wichtig, weil die finanzielle Hauptlast der sozialen Fürsorge in China, ähnlich wie in den USA, bei den Familien liegt. Das unterscheidet es von Japan, Deutschland und vor allem Italien. Dort liegt die Hauptlast beim Renten- und Krankenkassensystem und damit beim Staat, dem dies die Luft abschnürt. In China wächst das Haushaltseinkommen derweil mit gut zwei Prozent. Das müsste für stabile Verhältnisse reichen.
Grund 3 – Niedrige Staatsverschuldung: Japan ist mit seinen 120 Millionen Einwohnern als Vergleichsland dabei besonders interessant. Denn im Unterschied zu den USA oder Italien gelingt es Tokio die Stabilität in der alten Gesellschaft zu halten, ohne sich im Ausland zu verschulden. Keine Auslandsschulden zu haben, ist auch eine wichtige politische Maxime Pekings. Man möchte unter keinen Umständen vom Ausland finanziell abhängig sein. Das markiert einen großen Unterschied zu den USA, deren größte Gläubiger China und Japan sind.
Grund 4 – Chinas Bevölkerung schrumpft langsamer: Nach Hochrechnungen liegt der Rückgang mit minus 3 Prozent bis 2050 merklich unter dem in Japan (minus 16 Prozent), Italien (minus 10 Prozent) oder Deutschland (minus 4 Prozent).
Doch selbst, wenn die Rechnung nicht aufgehen sollte, weil etwas Unvorhersehbares passiert, gibt es einen ganz einfachen und international lang erprobten Weg, die Alterung der Gesellschaft schnell zu bremsen und das Verhältnis der arbeitenden Bevölkerung zu den Rentnern zügig zu verbessern. China kann ein Einwanderungsland werden. In Asien gibt es genügend junge Arbeitskräfte, die gerne für bessere Löhne in China arbeiten würden. Das ist ja der Jungbrunnen der USA. Die amerikanische Gesellschaft altert viel langsamer als die japanische, obwohl sie auf einem ähnlichen Entwicklungsstand ist, weil sie Einwanderung zulässt.
Das ist der Hauptgrund, warum die Voraussagen davon ausgehen, dass die amerikanische Bevölkerung bis 2050 um 15 Prozent steigt, während Chinas um 3 Prozent schrumpfen wird. Ob das ein Vorteil im Wettkampf der beiden Weltmächte für die USA sein wird, muss sich erst noch zeigen. Klar ist jedoch: Washington hat die Einwanderungskarte längst ausgespielt, Peking noch nicht. Als Ausländer, egal ob für Vietnamesen, Bulgaren oder Deutsche, ist es praktisch unmöglich chinesischer Staatsbürger zu werden. Die “Neue Seidenstraße” könnte dabei einen positiven Einfluss haben. Schon heute leben und arbeiten mehr Ausländer in China als je zuvor, immer mehr auch aus Afrika.
Sehr interessant ist, dass in der von der Regierung gelenkten öffentlichen Diskussion zur Alterung der Gesellschaft das Thema Einwanderung nicht auftaucht. Peking ist offensichtlich besorgt wegen der sozialen und politischen Nachteile von Einwanderungsgesellschaften, mit denen westliche Länder wie die USA, Großbritannien oder Frankreich zu kämpfen haben. Dazu zählen erbitterte Machtkämpfe zwischen den Einwanderern und den Etablierten, Ghettobildung, religiöse Differenzen oder generelle Unterschiede in den Wertsystemen.
Deshalb schwört Peking seine Bevölkerung – erst einmal jedenfalls – darauf ein, nicht den bequemen Weg zu gehen und Gastarbeiter einzuladen, sondern es so wie Japan erst einmal auf eigene Faust zu versuchen. Ein Luxus, den sich China offensichtlich noch leisten kann.
Insgesamt kann man also feststellen: Chinas Alterung ist ein Problem, aber kein Problem das Chinas soziale Stabilität aus den Angeln heben kann. Soziale Zeitbomben sehen anders aus.
Bereits im Jahr 2025 wird es in der Volksrepublik rund 300 Millionen Rentenempfänger geben. Das heißt immer weniger jüngere Menschen müssen für immer mehr Ältere aufkommen. Schon jetzt legt die Regierung strategische Rücklagen an und investiert mit dem Regierungsprogramm “Gesundes China 2030” in ein verbessertes Gesundheitssystem. Dass der Sozialstaat in China noch nicht ausgeprägt ist, kann sich zwischenzeitlich aber auch als Vorteil erweisen. Eine alternde Gesellschaft wird wirtschaftlich ja vor allem dann zum Problem, wenn der Staat die Transferleistungen nicht mehr zahlen kann.
Die Geburtenrate liegt in China heute bei einem Durchschnitt von 1,3 Kindern pro Frau. Und das, obwohl die Regierung bereits 2016 die jahrzehntelange Ein-Kind-Politik abgeschafft hat. Warum wollen die Chinesen nicht mehr Kinder? Wohnraum, Gesundheitsversorgung und die Ausbildung kosten immer mehr Geld. Deshalb konzentrieren viele Familien ihre Aufmerksamkeit lieber auf ein Kind. Hinzu kommt, dass für viele junge Chinesen heute die berufliche Karriere eine wichtigere Rolle spielt als für ihre Elterngeneration.
Doch das alles ist kein spezifisch chinesisches Problem. Es ist vielmehr eine Entwicklung, die fast alle Industriestaaten durchlaufen haben, allen voran Chinas Nachbarländer Südkorea und Japan. Dennoch geht es diesen Ländern wirtschaftlich sehr gut. Das liegt auch daran, dass die Alten heute mehr konsumieren als früher. Der oben angeführte geringere Konsum der Jungen wird also teilweise wieder aufgefangen. Auch Peking setzt auf das Motto “China muss reich werden, bevor es alt wird”. Die Verantwortlichen schwören die heimischen Unternehmen bereits darauf ein, ältere Menschen als Zielgruppe stärker ins Visier zu nehmen, Stichwort: “Silberhaar-Economy”. Die E-Commerce-Giganten JD.com und Taobao haben Senioren bereits als wichtige Zielgruppe erkannt, was sich zum Beispiel in Rabatten und verstärkter Werbung für bestimmte Haushaltswaren und Gesundheitsprodukte widerspiegelt. Ein Alibaba-Bericht aus dem Jahr 2020 zeigt, dass Kunden über 60 auf der hauseigenen E-Commerce-Plattform Taobao aktiver waren als andere Altersgruppen, und dass ihre Ausgaben in den letzten drei Jahren um fast 21 Prozent gestiegen sind.
Sogar die bislang vor allem bei jungen Nutzern beliebten Kurzvideoplattformen Kuaishou und Douyin, die chinesische Version von TikTok, haben eine größere Anzahl älterer Influencer rekrutiert und damit laut eigenen Angaben auch eine beträchtliche Anzahl älterer Nutzer gewinnen können.

Frau Liu, die EU-Kommission hat das mit Peking bereits weitgehend ausgehandelte Investitionsabkommen (CAI) auf Eis gelegt. War das eine richtige Entscheidung?
Liu Wan-Hsin: Ich kann natürlich verstehen, dass es angesichts der politischen Spannungen zwischen der EU und China insbesondere aufgrund der Menschenrechtssituation in Xinjiang momentan schwierig ist, diesen Ratifizierungsprozess voranzutreiben. Die Sanktionsspirale und die eskalierenden diplomatischen Spannungen zwischen den beiden Seiten führen zu einem großen Vertrauensverlust. Gegenseitiges Vertrauen ist aber unabdingbar für den Abschluss des Abkommens und vor allem auch für die Implementierung der im Abkommen vereinbarten Verpflichtungen. Trotzdem halte ich es für bedauerlich, dass die EU-Kommission so entschieden hat.
Warum?
Das Abkommen hätte deutschen und europäischen Unternehmen den Marktzugang in China erleichtert. Der wichtigste Effekt wäre vermutlich folgender: Durch das Investitionsabkommen wird es eine vertraglich festgeschriebene Bindung der bisher von China unilateral getätigten Marktliberalisierungen geben. Die chinesische Regierung könnte diese bereits getätigten Liberalisierungen nicht mehr nach eigenem Ermessen zurücknehmen. Das verringert Unsicherheiten.
Wie könnte das konkret aussehen?
Die EU könnte im Falle eines Verstoßes auf den im Abkommen vereinbarten zwischenstaatlichen Streitbeilegungsmechanimus zurückgreifen. Darüber hinaus hätte das Abkommen auch für fairere Wettbewerbsbedingungen in China gesorgt. Es enthält Verpflichtungen, die europäische Unternehmen schon lange gefordert haben: das Verbot erzwungener Technologietransfers, transparente und faire Verwaltungsverfahren und Regulierungen, Transparenz bei Subventionen sowie klare Regelungen für staatseigene Unternehmen.
Sie sagen selbst: Diese unfairen Wettbewerbsbedingungen gibt es seit langem. Trotzdem geht es vielen deutsche Unternehmen in China blendend. Warum diese Dringlichkeit?
China hat beim letzten Nationalen Volkskongress den neuen Fünfjahresplan verabschiedet. Und der hat es in sich. Er sieht nichts geringeres vor, als die Abhängigkeit vom Ausland zu reduzieren. Die Förderung heimischer Innovation, heimischer Produktion und heimischer Nachfrage hat absolute Priorität. Zulieferfirmen aus dem Ausland werden mittelfristig mehr Druck spüren, ihre Fabriken nach China verlagern und vor Ort zu produzieren, wenn sie weiterhin den chinesischen Markt mit ihren Produkten bedienen möchten. Die Investitionsunsicherheiten und unfairen Wettbewerbsbedingungen, mit denen viele ausländischen Unternehmen in China seit langer Zeit konfrontiert sind, können durch das Investitionsabkommen reduziert beziehungsweise verbessert werden.
Doch warum die Ratifizierung nicht erst einmal auf Eis legen? Wenn sich die politischen Spannungen gelegt haben, ließe sich dann ein neuer Anlauf starten.
Es hängt davon ab, wie lange der Ratifizierungsprozess auf Eis gelegt wird. Zeitlich könnte es knapp werden. Und es ist auch fraglich, ob es der beste Weg wäre, um die politischen Spannungen zu reduzieren. Mit ihrem neuen Fünfjahresplan hat sich die chinesische Führung zum Ziel gesetzt, nicht mehr länger nur die Werkbank für billige Produkte zu sein, sondern auch Waren von hoher Qualität herstellen zu können. Technologisch will China in mehreren Schlüsselbranchen zum Weltmarktführer aufsteigen. Dass China sich dieses Ziel setzt, ist völlig legitim. Trotzdem bedarf es fairer Wettbewerbsbedingungen. Durch das Abkommen könnte die chinesische Regierung zum Beispiel Technologietransfer von ausländischen Investoren an einen Joint-Venture Partner in China nicht einfach erzwingen.
Die Verhandlungen zu diesem Investitionsabkommen hatte die Bundesregierung kurz vor Jahresende unter ihrer EU-Ratspräsidentschaft noch eilig durchgepeitscht. Kritiker des Abkommens meinen, die EU hätte nur wenige Wochen warten müssen bis Joe Biden im Amt gewesen wäre. Ein Versäumnis?
Das sehe ich nicht so. Denn es war ja keineswegs so, dass die Europäer erst vor Kurzem mit den Verhandlungen begonnen haben, sondern schon vor sieben Jahren. Damals war Trumps Handelskrieg gegen China noch nicht abzusehen. Die EU und die Bundesregierung wollten das Abkommen endlich zu einem Abschluss bringen. Die Verhandlungsführerin der EU hat darauf hingewiesen, dass die EU kein besseres Ergebnis erzielen wird, wenn sie weiter wartet. Im Übrigen haben die USA unter Trump selbst Anfang 2020 mit China ein Abkommen mit vergleichbaren Elementen etwa im Bereich der Finanzdienstleistungen geschlossen.
Wie sollte es Ihrer Meinung jetzt weitergehen?
Das EU-Parlament hat entschieden, die Beratung für das Investitionsabkommen auf Eis zu legen, solange die chinesischen Sanktionen nicht aufgehoben seien. Ich halte es allerdings für sehr unwahrscheinlich, dass China – die mittlerweile zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und eines der wenigen Länder, deren Wirtschaft trotz Coronakrise weiterwächst – auf Grund von Sanktionen sein Verhalten ändert. Die Sanktionsspirale und der Vertrauensverlust machen einen konstruktiven Dialog zwischen der EU und China nicht einfacher, aber umso dringender.
Liu Wan-Hsin ist Ökonomin am Institut für Weltwirtschaft (IfW) Kiel. Ihre Forschungsschwerpunkte sind internationaler Handel, globale Lieferketten, sowie die Determinanten der Innovationstätigkeiten mit Fokus auf China. Die gebürtige Taiwanerin ist seit 2016 zudem Koordinatorin für das Kieler Zentrum für Globalisierung (KCG).
Stromversorger in der Industriehochburg Guangdong haben Fabriken aufgefordert, ihren Stromverbrauch zu reduzieren, da der immense Verbrauch und die hohen Temperaturen das Stromsystem der Region zu stark belastet. 17 Städte in der Provinz haben Beschränkungen für den Stromverbrauch verhängt, so das Wirtschaftsportal Caixin. In einigen Regionen werden die Fabriken für drei Tage die Woche geschlossen. Auch die Nachbarregionen Guangxi und Yunnan haben mit Stromengpässen zu kämpfen.
Der Stromverbrauch ist wegen des Wirtschaftsaufschwungs nach dem Coronaeinbruch und durch hohe Temperaturen stark angestiegen. Gleichzeitig schränken die Trockensaison und der starke Wassermangel die Produktion von Wasserkraftwerken ein. Die in letzter Zeit stark gestiegenen Kohlepreise haben auch die Kosten für die Stromerzeugung in Kohlekraftwerken in die Höhe getrieben und deren Produktion eingeschränkt, so Caixin. nib
Peking hat nach dem Arbeitsstopp des Europaparlaments am Investitionsabkommen CAI bei mehreren EU-Staaten für den Deal geworben – erstmals wieder bei persönlichen Treffen mit Diplomaten. China und die Europäische Union seien Partner, keine Konkurrenten, und die Zusammenarbeit werde beiden Seiten helfen, sagte der chinesische Außenminister Wang Yi einer Mitteilung zufolge anlässlich von Treffen mit seinen Amtskollegen aus Polen, Ungarn, Serbien und Irland am Wochenende.
Der polnische Außenminister Zbigniew Rau betonte demnach, sein Land sei der Ansicht, dass ein Investitionsabkommen zwischen China und der EU für beide Seiten von Vorteil sei. Die beiden Blöcke sollten laut Rau “angemessen mit Meinungsverschiedenheiten umgehen”, zeigt die Mitteilung der chinesischen Regierung. Das Format 17+1 zwischen mehreren ost- und mitteleuropäischen Staaten und Peking werde “eine wichtige Säule der Zusammenarbeit zwischen Europa und China bleiben”, hieß es in einem Tweet des polnischen Außenministeriums. Zudem sei darüber gesprochen worden, polnische Agrarexporte nach China auszuweiten.
Rau und Serbiens Außenminister Nikola Selaković trafen Wang Yi am Samstag getrennt voneinander in der südwestchinesischen Stadt Guiyang. Bei dem Treffen mit Selaković sagte Wang Staatsmedien zufolge, China unterstütze die Pläne der chinesischen Covid-19-Impfstoffhersteller, mit Serbien über eine gemeinsame Produktion in Serbien zu sprechen. Demnach sollen auch die Bauarbeiten an der Bahnstrecke Budapest-Belgrad beschleunigt werden.
Die Einladung der vier europäischen Diplomaten erfolgte nach dem offiziellen Austritt Litauens aus dem 17+1-Format und dem diplomatischen Streit um Sanktionen. Der Besuch, in dessen Rahmen auch Ungarns Péter Szijjártó und Irlands Simon Coveney in China sind, soll noch am Montag fortgesetzt werden. Die Diplomaten treffen sich alle getrennt voneinander mit chinesischen Vertretern, es handelt sich also nicht um einen Gruppenbesuch. ari
Staatsanwälte in Hongkong haben den Kontakt mit internationalen Journalisten als Grund angeführt, einen Kautionsantrag der Politikerin Claudia Mo abzulehnen. Sie muss nun vorerst im Gefängnis bleiben. Mo hatte sich in privaten Whatsapp-Chats gegenüber Journalisten kritisch über das neue Nationale Sicherheitsgesetz und restriktive Maßnahmen der Sicherheitsbehörden geäußert. Mo selbst wird wegen des Vorwurfs der Gefährdung der nationalen Sicherheit angeklagt, so Bloomberg.
Die Chatverläufe von Claudia Mo mit Mitarbeitern der BBC, der New York Times und des Wall Street Journals wurden ihr nun zum Verhängnis. Sie gehörten zu den Beweisen, die von der Staatsanwaltschaft letzten Monat während ihrer Kautionsanhörung vorgelegt wurden. Das zeige eine am Freitag veröffentlichte Akte, berichtet Bloomberg. “Das Urteil schafft einen abschreckenden Effekt, weil die Kommunikation mit ausländischen Korrespondenten als potenzielles Verbrechen angesehen werden kann”, zitiert die Agentur den Politiker Fernando Cheung.
Mo war eine der kritischsten Stimmen im Hongkonger Legislativrat, bevor sie sich anderen Oppositionsmitgliedern anschloss und im vergangenen Jahr zurücktrat, um gegen die Absetzung von pro-demokratischen Gesetzgebern zu protestieren. Sie gehörte zu den 47 prominenten Oppositionsmitgliedern, die im März wegen einer Wahlkampagne wegen Subversion angeklagt wurden. nib
Forscher aus China und den USA haben mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) antike chinesische Bücher in ausländischen Bibliotheken katalogisiert. Im Rahmen des Projekts der Universität von Sichuan, der US-Universität Berkeley sowie der DAMO Academy von Alibaba hat der Computer bereits rund 200.000 Seiten antiker Bücher mit insgesamt 30.000 Zeichen erfasst und mit Schlagworten verknüpft, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Die Arbeit dauerte demnach mehr als zwei Jahre.
Die Genauigkeit der KI erreichte laut dem Bericht eine Rate von 97,5 Prozent. “Die Genauigkeitsrate lag zu Beginn bei etwa 40 Prozent. Wir haben mehr als 30 Studenten, die die nicht von der KI erkannten oder falsch identifizierten Zeichen manuell identifizieren, um zur Verbesserung der Genauigkeit beizutragen”, erklärt Wang Guo, stellvertretender Dekan der Fakultät für Geschichte und Kultur der Universität Sichuan.
Die digitalen Versionen der antiken Bücher sollen online für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Die Bilder werden durch den Prozess der optischen Zeichenerkennung (OCR) in Text umgewandelt, wie die Universität Berkeley erklärt. Demnach habe die Universität von Sichuan gemeinsam mit DAMO ein System entwickelt, das KI nutzt, um alte chinesische Schriftzeichen in maschinenlesbaren Text umzuwandeln. Das System erkennt demnach chinesische Zeichen 30-Mal schneller als ein Mensch. ari
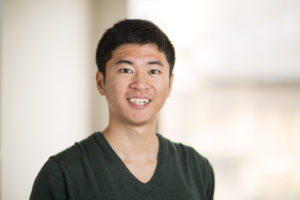
Jeffrey Ding gehört zu den führenden Kennern der chinesischen KI-Forschung. Wenn es darum geht, zu ergründen, wie China in diesem globalen Wettlauf um eine der wichtigen Zukunftstechnologien vorankommt, ist Ding ein gefragter Gesprächspartner. Der Wissenschaftler vom “Future of Humanity Institute” in Oxford kommt in seiner aktuellen Bewertung zu einem ambivalenten Urteil. “Im KI-Bereich ist China aktuell Zweiter hinter den USA, wenn wir alle wichtigen Parameter einbeziehen”, sagt Ding.
Er beobachtet, dass China und mit ihm seine führenden Technologieunternehmen große Fortschritte machen, aber gerade was die Innovationsfähigkeit betrifft immer noch hinter den Vereinigten Staaten hinterherhinken. “China mangelt es weiterhin an eigenen bahnbrechenden Durchbrüchen – etwa beim Deep Learning“, meint Ding, der selbst fließend Chinesisch spricht und vor seiner Zeit in Oxford unter anderem im US-Außenministerium tätig war.
Die Volksrepublik sei gut darin, bestehende Entwicklungen mit großer Finanzkraft und Personalstärke voranzutreiben, aber eigene Innovationen seien bis jetzt die Ausnahme. Als Beispiel führt Ding unter anderem die Entwicklung von Hochleistungs-Grafikchips an. Die Verarbeitung von Bildern ist eines der wichtigsten Elemente im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Die besten Chips stellt die US-Firma Nvidia her. Peking muss derzeit noch auf die Technik des US-Anbieters setzen. “China macht jedoch erhebliche Fortschritte bei der Chipentwicklung und hat sich vorgenommen, viel in diesen Bereich zu investieren”, sagt Ding.
Die Volksrepublik entwickelt allerdings nur selten eigene KI-Innovationen. Das hat laut Ding strukturelle Gründe. Im Silicon Valley hat sich ein Cluster gebildet, in dem immer neue Firmen gegründet und von dem immer mehr kluge Köpfe angezogen würden. China fehlt solch ein Cluster, auch wenn es Bemühungen gibt, kleinere Silicon Valleys an der eigenen Ostküste aufzubauen, sagt Ding.
Bedenken im globalen Westen hinsichtlich der KI-Fortschritte Chinas betreffen den womöglich menschenrechtswidrigen Einsatz der Technologie. “Die Gesichtserkennung ist ein Bereich, in dem China führend ist”, sagt Ding. “Die chinesischen Unternehmen werden vom Ministerium für Öffentliche Sicherheit unterstützt, das ihnen Gesichtsdaten bereitstellt.” Die Regierung in Peking ist an raschen Fortschritten interessiert, denn sie sieht sich selbst als erster und größter Abnehmer der Technologie.
Trotzdem will Peking keine komplett zentral geleitete Entwicklung. “Die Regierung möchte die KI-Forschung nicht zu sehr steuern, denn das würde den Wettbewerb um Ideen eliminieren.” Mit Blick auf die nächsten Jahre erwartet Ding indes nicht, dass China zur weltweiten Nummer eins im KI-Bereich wird. Andere Länder, insbesondere die USA, werden sich in diesem Feld nicht so einfach überholen lassen.
Ding wurde in Shanghai geboren, wanderte aber mit seinen Eltern bereits im Alter von drei Jahren in den US-Bundesstaat Iowa aus. Er kehrte später nach China zurück und verbrachte unter anderem ein Studienjahr in Peking. Ding kam zunächst als Rhodes Scholar nach Oxford und wurde im Anschluss Doktorand am “Future of Humanity Institute”. Constantin Eckner
This year’s Annual General Meeting (AGM) of the EU Chamber of Commerce in China decided on a number of personnel decisions.
Jörg Wuttke (BASF) was confirmed as President of the EU Chamber of Commerce in China. His term of office was thus extended for another two years.
Bruno Weill (BNP Paribas), Carlo D’Andrea (D’Andrea and Partners) and Guido Giacconi (In3act) are new Vice Presidents of the EU Chamber.
Bettina Schoen-Behanzin (Freudenberg) as Chair of the EU Chamber in Shanghai, Klaus Zenkel (Imedco Technology) as Chair of the South China Chamber and Massimo Bagnasco (Progetto CMR) as Chair of the Southwest China Chamber also became Vice Presidents at the national level.
Marko Tulus (Sandvik) continues as treasurer.

Das Leben in der gerade erworbenen Vorstadt-Villa im Grünen ist wirklich überbewertet, so ruhig und einsam. Hätte man doch lieber die Penthouse-Wohnung in der Innenstadt gekauft! Für unterschwellige Angebereien wie diese hat Chinas Netzgemeinde einen neuen Sammelbegriff ersonnen. “Versaillen” oder “einen auf Versailles machen” – chinesisch 凡尔赛 fán’ěrsài – nennt man solche versteckten Prahlereien im Seufz-Kostümchen, mit denen der Sprecher nur vermeintlich nach Mitgefühl heischt, eigentlich aber die eigene privilegierte Stellung herausposaunt.
Angelehnt ist der Begriff tatsächlich an das berühmte Schloss Versailles (凡尔赛宫 fáněrsàigōng) im gleichnamigen Pariser Nachbarort, das man gemeinhin mit pompösen Barockbauten, weitläufigen Gartenanlagen und luxuriösen Lustschlössern verbindet. Die Prachtanlage war in ihrer Zeit Treffpunkt der feinen Gesellschaft Europas. Und die hatte nicht nur ihre eigenen Etikette, sondern eben auch eine eigene, gehobene Sprache und natürlich standesgemäße Gesprächsthemen, bei denen das niedere Volk nicht mitreden konnte. Genau auf diesen Umstand spielen Chinesen heute an, wenn sie Zeitgenossen vorwerfen, sie betrieben 凡尔赛 fán’ěrsài – “unterschwellige Angeberei”.
Generell gilt, dass man mit Bescheidenheit (谦虚 qiānxū) im Reich der Mitte gut beraten ist, besonders als Reaktion auf ungerechtfertigte Komplimente wie Lobgesänge auf rudimentäre Chinesischkenntnisse. Werden diese unverdient in den Himmel gehoben, sollte man mit einer Bescheidenheitsphrase kontern. Nicht unbedingt zu empfehlen ist dabei das in vielen Lehrbüchern angeführte und bei Chinesischlernern weltweit beliebte 哪里哪里 nǎlǐ nǎlǐ “Ach, woher denn!” (wörtlich “wo – wo”). Damit wird man zwar Sympathiepunkte und den einen oder anderen Lacher ernten, sich gleichzeitig jedoch als Chinesisch-Einsteiger entlarven. Denn diese Floskel wird im Alltag unter Muttersprachlern in Wirklichkeit eher selten verwendet. Authentischer kann man dagegen mit zwei anderen einfachen Ausdrücken auftrumpfen, nämlich 过奖了guòjiǎng le (“Zu viel des Lobes!”) oder 不敢当 bù gǎndāng (“Das verdiene ich nicht!”). In diesem Sinne – immer schön auf dem Teppich bleiben!
Verena Menzel 孟维娜 betreibt in Peking die Online-Sprachschule New Chinese.
das Investitionsabkommen zwischen der EU und China (CAI) sollte den chinesischen Markt öffnen und lästige Praktiken wie den Technologietransfer einschränken. Jetzt liegt das Abkommen vorerst auf Eis. Und das könnte schon in naher Zukunft weitreichende Folgen für europäische Unternehmen haben. Felix Lee sprach darüber mit Liu Wan-Hsin. Die Ökonomin am Institut für Weltwirtschaft in Kiel warnt: Peking strebt Unabhängigkeit vom Ausland an. Unternehmen werden bald Fabriken nach China verlagern müssen. Das CAI hätte dagegen für faireren Wettbewerb gesorgt. Der Stopp der Ratifizierung sei verständlich und zugleich bedauerlich, so Liu.
Chinas Strommix beruht noch immer zu gut zwei Dritteln auf klimaschädlichem Kohlestrom. Unternehmen, die zu 100 Prozent auf erneuerbare Energien umsteigen wollen, haben es daher nicht leicht, analysiert Christiane Kühl. Selbermachen!, dachte sich BASF. Der Chemie-Riese hat einen Mechanismus zum Direktankauf von Ökostrom mit der Provinzregierung in Guangdong eingerichtet. Ein Vorbild also für andere deutsche Unternehmen vor Ort.
Wie wichtig eine sichere Stromversorgung ist, merken derzeit Firmen in Südchina. Dort kommt es seit einigen Tagen zu Elektrizitätsengpässen. In einigen Gegenden müssen Fabriken an drei Tagen der Woche schließen. Der Klimawandel schadet eben auch dem Ökostrom aus Wasserkraft.
Ich wünsche eine spannende Lektüre und einen guten Wochenstart!

Ein Großunternehmen kann den nötigen Ökostrom für ein großes Werk in der Regel nicht einfach so am Markt kaufen. Um Strom ausschließlich aus erneuerbaren Quellen zu beziehen, braucht es die nötige Infrastruktur, sowie die Kooperation der Stromnetze und des Strommarkt-Betreibers. Nur so lassen sich Klimaziele praktisch umsetzbar machen. Eine solche Kooperation hat der Chemiekonzern BASF jetzt in der Südprovinz Guangdong angestoßen. Die Ludwigshafener wollen in der Stadt Zhanjiang einen Verbundstandort errichten, der in seiner ersten Phase zu 100 Prozent mit Ökostrom versorgt wird – und initiierten dafür bei der Provinzregierung ab 2019 einen Mechanismus zum Direktankauf von Ökostrom.
Damals schlug das Unternehmen nach eigenen Angaben den lokalen Behörden das “Renewable Direct Power Purchase” (R-DPP)-Konzept vor, das es gemeinsam mit dem Konzern China Resources Power entwickelt hatte. “Dabei beziehen wir emissionsfreien Strom über den Netzbetreiber direkt von der entsprechenden erneuerbaren Energiequelle”, sagt Haryono Lim von BASF dem China.Table. “Im traditionellen System konnten wir nur Strom aus dem öffentlichen Stromnetz beziehen”, so der BASF-Verantwortliche für das “Project New Verbund Site China”. Das deutsche Wort “Verbund” hat hier Eingang in den internationalen Jargon der Branche gefunden.
Ins normale Stromnetz wird ein Mix aus verschiedenen Energieträgern mit einem hohen Anteil Kohlestrom eingespeist. Erneuerbare Energien tragen in China derzeit nur rund ein Viertel zum Strommix bei. Den Stromnetzen kommt daher bei Chinas Übergang zur Klimaneutralität eine entscheidende Rolle zu. Sie müssen das Kohle-Primat brechen und anteilig mehr Öko-Strom durchleiten. Sie brauchen dazu deutlich mehr Stromspeicher-Kapazitäten, da Strom aus Wind und Sonne aufgrund wechselnder Wetterbedingungen starken Schwankungen unterliegt. Und zuletzt müssen die Netzbetreiber Firmenkunden technisch und regulativ ermöglichen, Ökostrom direkt einzukaufen – wie es jetzt in Guangdong geschieht.
Das von BASF initiierte R-DPP-Konzept stieß laut Lim in Guangdong 2019 den Entwurf eines umfassenden neuen Pilot-Regelwerks für den Handel mit erneuerbaren Energien an, das diesen Mechanismus mit aufnimmt. Die zuständige Behörde für diese Geschäfte ist das 2016 für den Handel mit Strom gegründete Guangdong Power Exchange Center. “Wie wir vom Guangdong Power Exchange Center erfahren haben, gibt es keine Beschränkung für die Sektoren, in denen ein Handel nach dem R-DPP-Prinzip stattfinden kann”, sagt Lim. Auch andere Firmen in Guangdong werden also direkt Ökostrom beziehen können.
Die Chemieindustrie gehört zu den energieintensivsten Industriebranchen. Eine Transformation des Chemie- oder auch des Stahlsektors gilt daher als unverzichtbar für erfolgreichen Klimaschutz. BASF hat angekündigt, ab 2050 kohlenstoffneutral wirtschaften zu wollen. Bis 2030 will der Konzern den Ausstoß von Treibhausgasen um 25 Prozent gegenüber 2018 senken. Damals lagen die weltweiten Emissionen der BASF-Gruppe bei 21,9 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente. Nach Firmenangaben sind das nur noch die Hälfte der Emissionen von 1990.
Bis 2025 plant BASF dafür Investitionen von bis zu einer Milliarde Euro, sowie bis 2030 von weiteren zwei bis drei Milliarden Euro, wie das Unternehmen kürzlich mitteilte. Denn neuartige Produktionsprozesse – die es bisher teils noch gar nicht gibt – werden laut BASF den Strombedarf ansteigen lassen, da sie auf andere Energiequellen wie fossile Brennstoffe verzichten können. Das wiederum erfordert, den Strom aus erneuerbaren Quellen zu beziehen oder selbst zu erzeugen. Gemeinsam mit dem Energieerzeuger RWE will BASF daher zum Beispiel einen Offshore-Windpark in der Nordsee mit einer Kapazität von zwei Gigawatt bauen, wie beide Unternehmen kürzlich mitteilten. Bisher beziehen bereits 19 BASF-Standorte in Europa und Nordamerika ganz oder teilweise Strom aus erneuerbaren Energien.
Zhanjiang soll laut BASF ein Modell-Standort für nachhaltige Produktion werden. Ab 2022 sollen dort zunächst technische Kunststoffe und thermoplastische Polyurethane (TPU) hergestellt werden. “Die ersten Anlagen des Verbundstandorts Zhanjiang werden zu 100 Prozent mit Strom aus erneuerbaren Quellen wie Windenergie und Photovoltaik betrieben”, sagt Haryono Lim. Auch für zukünftige Phasen strebe BASF einen hohen Anteil an Ökostrom an. Eine genaue Zielmarke könne das Unternehmen aufgrund der langen Planungsvorläufe noch nicht nennen, so Lim. Erst für 2030 ist die komplette Fertigstellung des Standorts anvisiert.
Produktionsstandorte jeder Branche benötigen neben Strom immer auch andere Energieformen. Den Strom klimaneutral zu erzeugen oder einzukaufen, ist in der Regel der erste Schritt der klimafreundlichen Transformation. In China betreibt etwa Volvo nach eigenen Angaben ein Werk in Daqing mit 100 Prozent Ökostrom. Und VW kündigte an, dass es seine neue Elektroauto-Fabrik in Anhui – deren Bau gerade startete – ebenfalls mit Ökostrom betreiben werde. BASF hat in China an Standorten im Shanghaier Chemiepark Caojing sowie der großen Firmenzentrale in Pudong Photovoltaikanlagen installiert, die das Unternehmen selbst betreibt.
Wenn es um den gesamten Energiebedarf geht, setzen die Firmen dagegen zunächst auf Energieeinsparungen. “Wir konnten zum Beispiel unseren Dampfbedarf durch die Optimierung von Kondensat-Ableitern am BASF-Standort in Caojing und durch die Installation eines Dampfkühlers am Standort Nanjing reduzieren”, sagt Lim.
BASF berichtet Treibhausgasemissionen nach dem weltweit anerkannten Greenhouse-Gas-Protocol-Standard sowie dem sektorspezifischen Standard für die Chemieindustrie. Dieser unterscheidet zwischen direkten Emissionen der eigenen Produktion und der eigenen Erzeugung von Strom und Dampf eines Standorts (Scope 1), Emissionen durch den Zukauf von Strom (Scope 2) sowie Emissionen in der Wertschöpfungskette (Scope 3). Nach diesem Bewertungsverfahren wird der Industriebetrieb also auch für die Verbrennung von Kohle durch das Elektrizitätswerk zur Rechenschaft gezogen.
Würde BASF Strom für den neuen Verbundstandort aus dem Südlichen Stromnetz (South Grid) beziehen, zu dem Guangdong gehört, würden der neuen Anlage in Zhanjiang demnach die bei der Erzeugung dieses Stroms entstandenen Kohlendioxid-Emissionen zugeschlagen. Im Südlichen Stromnetz, zu dem Guangdong gehört, liegt der durchschnittliche Kohlendioxid-Ausstoß bei etwa 0,5 bis 0,6 Kilogramm pro Kilowattstunde, wie Lim erläutert. Da BASF mithilfe von R-DPP den Strom aus erneuerbaren Energien direkt von den Erzeugern beziehen kann, würde es diese Anrechnung von Emissionen des öffentlichen Netzes vermeiden. Das wiederum senkt die zu berichtenden Gesamt-Emissionen des Standorts.
Auch die Provinz Sichuan öffnete 2020 nach einem Bericht der South China Morning Post den Stromeinzelhandel und ermöglichte es damit privaten Unternehmen, 100 Prozent ihres Strombedarfs aus erneuerbaren Energien zu beziehen. Zuvor waren es maximal 70 Prozent. Es ist zu hoffen, dass andere Provinzen möglichst bald nachziehen.
Die jüngste Volkszählung Chinas hat einen Trend bestätigt, der sich seit längerem abzeichnet: Die Bevölkerung des Landes wird früher oder später schrumpfen (China.Table berichtete). In den vergangenen zehn Jahren ist sie nur noch um jährlich 0,53 Prozent gewachsen – so langsam wie seit den 1950er-Jahren nicht mehr. In Peking geht man nun davon aus, dass China noch in dieser Dekade den Höchststand bei der Bevölkerungszahl erreichen wird.
Gleichzeitig ist die Zahl der Chinesen über 60 Jahre seit 2010 um 5,4 Prozent auf 264 Millionen gestiegen, erklärt Pekings Statistikamt. Das klingt erst einmal dramatisch. Zumal China ohne Zweifel eines der Länder ist, die am schnellsten altern. Die Geburten sind allein im vergangenen Jahr um mehr als 18 Prozent zurückgegangen.
Das Problem dabei: Weniger junge Menschen produzieren und konsumieren weniger. Das bedeutet weniger Steuereinnahmen. Gleichzeitig steigen die Renten und Krankenversicherungsbelastungen für die Älteren. Aus der Sicht des Staates bedeutet das: Weniger Einnahmen, mehr Ausgaben.
Im internationalen Vergleich jedoch sieht die Lage noch entspannt aus. In China sind nur 12 Prozent der Bevölkerung über 65 Jahre. In Japan sind es 28 Prozent, in Italien 22 Prozent, in Deutschland 21 Prozent, in den USA 16 Prozent. Alle diese Länder mit einem hohen Anteil an Alten haben keine großen sozialen Unruhen und stehen auch nicht am Rand des wirtschaftlichen Kollapses.
Allerdings haben diese Länder im Unterschied zu China auch einen großen Vorteil: Sie haben ein viel höheres Pro-Kopf-Einkommen. An der Kaufkraftparität gemessen sind es in China knapp 17.000 US-Dollar. In den USA hingegen 65.000, in Deutschland 57.000 US-Dollar. Italien kommt auf 45.000 US-Dollar, Japan liegt bei 43.000.
Die Frage ist nun: Schafft es China, sein Pro-Kopf-Einkommen auf das Niveau der genannten Länder zu erhöhen, bevor die Alterung Wachstumspotenziale aufzehrt? Oder kürzer: Wird China reich, bevor es alt wird? Das ist aus vier Gründen gut möglich.
Grund 1 – Aufwärtspotenzial bei der Produktivität – durch Automatisierung, Prozessverbesserungen, Technologie: Sie ist bisher im Vergleich sehr niedrig und liegt bei 40 Prozent der japanischen, gut 30 Prozent der deutschen und rund 25 Prozent der US-amerikanischen Produktivität. Nichts spricht dagegen, dass die Chinesen einmal so produktiv werden, wie es die Japaner heute schon sind. Dabei hilft es auch, das Rentenalter anzuheben. Auch in diesem Bereich ist in China noch Luft nach oben: Es liegt für Männer bei 60 Jahren und für Frauen bei 55 Jahren.
Grund 2 – Eine hohe Sparrate – die Konsumausgaben könnten in Zukunft also erhöht werden: Zweitens liegt die Sparrate pro Haushalt in China bei über 35 Prozent, während sie in Japan nur über 4 Prozent liegt (USA 8 Prozent, Deutschland 10 Prozent). Die Sparrate ist deshalb wichtig, weil die finanzielle Hauptlast der sozialen Fürsorge in China, ähnlich wie in den USA, bei den Familien liegt. Das unterscheidet es von Japan, Deutschland und vor allem Italien. Dort liegt die Hauptlast beim Renten- und Krankenkassensystem und damit beim Staat, dem dies die Luft abschnürt. In China wächst das Haushaltseinkommen derweil mit gut zwei Prozent. Das müsste für stabile Verhältnisse reichen.
Grund 3 – Niedrige Staatsverschuldung: Japan ist mit seinen 120 Millionen Einwohnern als Vergleichsland dabei besonders interessant. Denn im Unterschied zu den USA oder Italien gelingt es Tokio die Stabilität in der alten Gesellschaft zu halten, ohne sich im Ausland zu verschulden. Keine Auslandsschulden zu haben, ist auch eine wichtige politische Maxime Pekings. Man möchte unter keinen Umständen vom Ausland finanziell abhängig sein. Das markiert einen großen Unterschied zu den USA, deren größte Gläubiger China und Japan sind.
Grund 4 – Chinas Bevölkerung schrumpft langsamer: Nach Hochrechnungen liegt der Rückgang mit minus 3 Prozent bis 2050 merklich unter dem in Japan (minus 16 Prozent), Italien (minus 10 Prozent) oder Deutschland (minus 4 Prozent).
Doch selbst, wenn die Rechnung nicht aufgehen sollte, weil etwas Unvorhersehbares passiert, gibt es einen ganz einfachen und international lang erprobten Weg, die Alterung der Gesellschaft schnell zu bremsen und das Verhältnis der arbeitenden Bevölkerung zu den Rentnern zügig zu verbessern. China kann ein Einwanderungsland werden. In Asien gibt es genügend junge Arbeitskräfte, die gerne für bessere Löhne in China arbeiten würden. Das ist ja der Jungbrunnen der USA. Die amerikanische Gesellschaft altert viel langsamer als die japanische, obwohl sie auf einem ähnlichen Entwicklungsstand ist, weil sie Einwanderung zulässt.
Das ist der Hauptgrund, warum die Voraussagen davon ausgehen, dass die amerikanische Bevölkerung bis 2050 um 15 Prozent steigt, während Chinas um 3 Prozent schrumpfen wird. Ob das ein Vorteil im Wettkampf der beiden Weltmächte für die USA sein wird, muss sich erst noch zeigen. Klar ist jedoch: Washington hat die Einwanderungskarte längst ausgespielt, Peking noch nicht. Als Ausländer, egal ob für Vietnamesen, Bulgaren oder Deutsche, ist es praktisch unmöglich chinesischer Staatsbürger zu werden. Die “Neue Seidenstraße” könnte dabei einen positiven Einfluss haben. Schon heute leben und arbeiten mehr Ausländer in China als je zuvor, immer mehr auch aus Afrika.
Sehr interessant ist, dass in der von der Regierung gelenkten öffentlichen Diskussion zur Alterung der Gesellschaft das Thema Einwanderung nicht auftaucht. Peking ist offensichtlich besorgt wegen der sozialen und politischen Nachteile von Einwanderungsgesellschaften, mit denen westliche Länder wie die USA, Großbritannien oder Frankreich zu kämpfen haben. Dazu zählen erbitterte Machtkämpfe zwischen den Einwanderern und den Etablierten, Ghettobildung, religiöse Differenzen oder generelle Unterschiede in den Wertsystemen.
Deshalb schwört Peking seine Bevölkerung – erst einmal jedenfalls – darauf ein, nicht den bequemen Weg zu gehen und Gastarbeiter einzuladen, sondern es so wie Japan erst einmal auf eigene Faust zu versuchen. Ein Luxus, den sich China offensichtlich noch leisten kann.
Insgesamt kann man also feststellen: Chinas Alterung ist ein Problem, aber kein Problem das Chinas soziale Stabilität aus den Angeln heben kann. Soziale Zeitbomben sehen anders aus.
Bereits im Jahr 2025 wird es in der Volksrepublik rund 300 Millionen Rentenempfänger geben. Das heißt immer weniger jüngere Menschen müssen für immer mehr Ältere aufkommen. Schon jetzt legt die Regierung strategische Rücklagen an und investiert mit dem Regierungsprogramm “Gesundes China 2030” in ein verbessertes Gesundheitssystem. Dass der Sozialstaat in China noch nicht ausgeprägt ist, kann sich zwischenzeitlich aber auch als Vorteil erweisen. Eine alternde Gesellschaft wird wirtschaftlich ja vor allem dann zum Problem, wenn der Staat die Transferleistungen nicht mehr zahlen kann.
Die Geburtenrate liegt in China heute bei einem Durchschnitt von 1,3 Kindern pro Frau. Und das, obwohl die Regierung bereits 2016 die jahrzehntelange Ein-Kind-Politik abgeschafft hat. Warum wollen die Chinesen nicht mehr Kinder? Wohnraum, Gesundheitsversorgung und die Ausbildung kosten immer mehr Geld. Deshalb konzentrieren viele Familien ihre Aufmerksamkeit lieber auf ein Kind. Hinzu kommt, dass für viele junge Chinesen heute die berufliche Karriere eine wichtigere Rolle spielt als für ihre Elterngeneration.
Doch das alles ist kein spezifisch chinesisches Problem. Es ist vielmehr eine Entwicklung, die fast alle Industriestaaten durchlaufen haben, allen voran Chinas Nachbarländer Südkorea und Japan. Dennoch geht es diesen Ländern wirtschaftlich sehr gut. Das liegt auch daran, dass die Alten heute mehr konsumieren als früher. Der oben angeführte geringere Konsum der Jungen wird also teilweise wieder aufgefangen. Auch Peking setzt auf das Motto “China muss reich werden, bevor es alt wird”. Die Verantwortlichen schwören die heimischen Unternehmen bereits darauf ein, ältere Menschen als Zielgruppe stärker ins Visier zu nehmen, Stichwort: “Silberhaar-Economy”. Die E-Commerce-Giganten JD.com und Taobao haben Senioren bereits als wichtige Zielgruppe erkannt, was sich zum Beispiel in Rabatten und verstärkter Werbung für bestimmte Haushaltswaren und Gesundheitsprodukte widerspiegelt. Ein Alibaba-Bericht aus dem Jahr 2020 zeigt, dass Kunden über 60 auf der hauseigenen E-Commerce-Plattform Taobao aktiver waren als andere Altersgruppen, und dass ihre Ausgaben in den letzten drei Jahren um fast 21 Prozent gestiegen sind.
Sogar die bislang vor allem bei jungen Nutzern beliebten Kurzvideoplattformen Kuaishou und Douyin, die chinesische Version von TikTok, haben eine größere Anzahl älterer Influencer rekrutiert und damit laut eigenen Angaben auch eine beträchtliche Anzahl älterer Nutzer gewinnen können.

Frau Liu, die EU-Kommission hat das mit Peking bereits weitgehend ausgehandelte Investitionsabkommen (CAI) auf Eis gelegt. War das eine richtige Entscheidung?
Liu Wan-Hsin: Ich kann natürlich verstehen, dass es angesichts der politischen Spannungen zwischen der EU und China insbesondere aufgrund der Menschenrechtssituation in Xinjiang momentan schwierig ist, diesen Ratifizierungsprozess voranzutreiben. Die Sanktionsspirale und die eskalierenden diplomatischen Spannungen zwischen den beiden Seiten führen zu einem großen Vertrauensverlust. Gegenseitiges Vertrauen ist aber unabdingbar für den Abschluss des Abkommens und vor allem auch für die Implementierung der im Abkommen vereinbarten Verpflichtungen. Trotzdem halte ich es für bedauerlich, dass die EU-Kommission so entschieden hat.
Warum?
Das Abkommen hätte deutschen und europäischen Unternehmen den Marktzugang in China erleichtert. Der wichtigste Effekt wäre vermutlich folgender: Durch das Investitionsabkommen wird es eine vertraglich festgeschriebene Bindung der bisher von China unilateral getätigten Marktliberalisierungen geben. Die chinesische Regierung könnte diese bereits getätigten Liberalisierungen nicht mehr nach eigenem Ermessen zurücknehmen. Das verringert Unsicherheiten.
Wie könnte das konkret aussehen?
Die EU könnte im Falle eines Verstoßes auf den im Abkommen vereinbarten zwischenstaatlichen Streitbeilegungsmechanimus zurückgreifen. Darüber hinaus hätte das Abkommen auch für fairere Wettbewerbsbedingungen in China gesorgt. Es enthält Verpflichtungen, die europäische Unternehmen schon lange gefordert haben: das Verbot erzwungener Technologietransfers, transparente und faire Verwaltungsverfahren und Regulierungen, Transparenz bei Subventionen sowie klare Regelungen für staatseigene Unternehmen.
Sie sagen selbst: Diese unfairen Wettbewerbsbedingungen gibt es seit langem. Trotzdem geht es vielen deutsche Unternehmen in China blendend. Warum diese Dringlichkeit?
China hat beim letzten Nationalen Volkskongress den neuen Fünfjahresplan verabschiedet. Und der hat es in sich. Er sieht nichts geringeres vor, als die Abhängigkeit vom Ausland zu reduzieren. Die Förderung heimischer Innovation, heimischer Produktion und heimischer Nachfrage hat absolute Priorität. Zulieferfirmen aus dem Ausland werden mittelfristig mehr Druck spüren, ihre Fabriken nach China verlagern und vor Ort zu produzieren, wenn sie weiterhin den chinesischen Markt mit ihren Produkten bedienen möchten. Die Investitionsunsicherheiten und unfairen Wettbewerbsbedingungen, mit denen viele ausländischen Unternehmen in China seit langer Zeit konfrontiert sind, können durch das Investitionsabkommen reduziert beziehungsweise verbessert werden.
Doch warum die Ratifizierung nicht erst einmal auf Eis legen? Wenn sich die politischen Spannungen gelegt haben, ließe sich dann ein neuer Anlauf starten.
Es hängt davon ab, wie lange der Ratifizierungsprozess auf Eis gelegt wird. Zeitlich könnte es knapp werden. Und es ist auch fraglich, ob es der beste Weg wäre, um die politischen Spannungen zu reduzieren. Mit ihrem neuen Fünfjahresplan hat sich die chinesische Führung zum Ziel gesetzt, nicht mehr länger nur die Werkbank für billige Produkte zu sein, sondern auch Waren von hoher Qualität herstellen zu können. Technologisch will China in mehreren Schlüsselbranchen zum Weltmarktführer aufsteigen. Dass China sich dieses Ziel setzt, ist völlig legitim. Trotzdem bedarf es fairer Wettbewerbsbedingungen. Durch das Abkommen könnte die chinesische Regierung zum Beispiel Technologietransfer von ausländischen Investoren an einen Joint-Venture Partner in China nicht einfach erzwingen.
Die Verhandlungen zu diesem Investitionsabkommen hatte die Bundesregierung kurz vor Jahresende unter ihrer EU-Ratspräsidentschaft noch eilig durchgepeitscht. Kritiker des Abkommens meinen, die EU hätte nur wenige Wochen warten müssen bis Joe Biden im Amt gewesen wäre. Ein Versäumnis?
Das sehe ich nicht so. Denn es war ja keineswegs so, dass die Europäer erst vor Kurzem mit den Verhandlungen begonnen haben, sondern schon vor sieben Jahren. Damals war Trumps Handelskrieg gegen China noch nicht abzusehen. Die EU und die Bundesregierung wollten das Abkommen endlich zu einem Abschluss bringen. Die Verhandlungsführerin der EU hat darauf hingewiesen, dass die EU kein besseres Ergebnis erzielen wird, wenn sie weiter wartet. Im Übrigen haben die USA unter Trump selbst Anfang 2020 mit China ein Abkommen mit vergleichbaren Elementen etwa im Bereich der Finanzdienstleistungen geschlossen.
Wie sollte es Ihrer Meinung jetzt weitergehen?
Das EU-Parlament hat entschieden, die Beratung für das Investitionsabkommen auf Eis zu legen, solange die chinesischen Sanktionen nicht aufgehoben seien. Ich halte es allerdings für sehr unwahrscheinlich, dass China – die mittlerweile zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und eines der wenigen Länder, deren Wirtschaft trotz Coronakrise weiterwächst – auf Grund von Sanktionen sein Verhalten ändert. Die Sanktionsspirale und der Vertrauensverlust machen einen konstruktiven Dialog zwischen der EU und China nicht einfacher, aber umso dringender.
Liu Wan-Hsin ist Ökonomin am Institut für Weltwirtschaft (IfW) Kiel. Ihre Forschungsschwerpunkte sind internationaler Handel, globale Lieferketten, sowie die Determinanten der Innovationstätigkeiten mit Fokus auf China. Die gebürtige Taiwanerin ist seit 2016 zudem Koordinatorin für das Kieler Zentrum für Globalisierung (KCG).
Stromversorger in der Industriehochburg Guangdong haben Fabriken aufgefordert, ihren Stromverbrauch zu reduzieren, da der immense Verbrauch und die hohen Temperaturen das Stromsystem der Region zu stark belastet. 17 Städte in der Provinz haben Beschränkungen für den Stromverbrauch verhängt, so das Wirtschaftsportal Caixin. In einigen Regionen werden die Fabriken für drei Tage die Woche geschlossen. Auch die Nachbarregionen Guangxi und Yunnan haben mit Stromengpässen zu kämpfen.
Der Stromverbrauch ist wegen des Wirtschaftsaufschwungs nach dem Coronaeinbruch und durch hohe Temperaturen stark angestiegen. Gleichzeitig schränken die Trockensaison und der starke Wassermangel die Produktion von Wasserkraftwerken ein. Die in letzter Zeit stark gestiegenen Kohlepreise haben auch die Kosten für die Stromerzeugung in Kohlekraftwerken in die Höhe getrieben und deren Produktion eingeschränkt, so Caixin. nib
Peking hat nach dem Arbeitsstopp des Europaparlaments am Investitionsabkommen CAI bei mehreren EU-Staaten für den Deal geworben – erstmals wieder bei persönlichen Treffen mit Diplomaten. China und die Europäische Union seien Partner, keine Konkurrenten, und die Zusammenarbeit werde beiden Seiten helfen, sagte der chinesische Außenminister Wang Yi einer Mitteilung zufolge anlässlich von Treffen mit seinen Amtskollegen aus Polen, Ungarn, Serbien und Irland am Wochenende.
Der polnische Außenminister Zbigniew Rau betonte demnach, sein Land sei der Ansicht, dass ein Investitionsabkommen zwischen China und der EU für beide Seiten von Vorteil sei. Die beiden Blöcke sollten laut Rau “angemessen mit Meinungsverschiedenheiten umgehen”, zeigt die Mitteilung der chinesischen Regierung. Das Format 17+1 zwischen mehreren ost- und mitteleuropäischen Staaten und Peking werde “eine wichtige Säule der Zusammenarbeit zwischen Europa und China bleiben”, hieß es in einem Tweet des polnischen Außenministeriums. Zudem sei darüber gesprochen worden, polnische Agrarexporte nach China auszuweiten.
Rau und Serbiens Außenminister Nikola Selaković trafen Wang Yi am Samstag getrennt voneinander in der südwestchinesischen Stadt Guiyang. Bei dem Treffen mit Selaković sagte Wang Staatsmedien zufolge, China unterstütze die Pläne der chinesischen Covid-19-Impfstoffhersteller, mit Serbien über eine gemeinsame Produktion in Serbien zu sprechen. Demnach sollen auch die Bauarbeiten an der Bahnstrecke Budapest-Belgrad beschleunigt werden.
Die Einladung der vier europäischen Diplomaten erfolgte nach dem offiziellen Austritt Litauens aus dem 17+1-Format und dem diplomatischen Streit um Sanktionen. Der Besuch, in dessen Rahmen auch Ungarns Péter Szijjártó und Irlands Simon Coveney in China sind, soll noch am Montag fortgesetzt werden. Die Diplomaten treffen sich alle getrennt voneinander mit chinesischen Vertretern, es handelt sich also nicht um einen Gruppenbesuch. ari
Staatsanwälte in Hongkong haben den Kontakt mit internationalen Journalisten als Grund angeführt, einen Kautionsantrag der Politikerin Claudia Mo abzulehnen. Sie muss nun vorerst im Gefängnis bleiben. Mo hatte sich in privaten Whatsapp-Chats gegenüber Journalisten kritisch über das neue Nationale Sicherheitsgesetz und restriktive Maßnahmen der Sicherheitsbehörden geäußert. Mo selbst wird wegen des Vorwurfs der Gefährdung der nationalen Sicherheit angeklagt, so Bloomberg.
Die Chatverläufe von Claudia Mo mit Mitarbeitern der BBC, der New York Times und des Wall Street Journals wurden ihr nun zum Verhängnis. Sie gehörten zu den Beweisen, die von der Staatsanwaltschaft letzten Monat während ihrer Kautionsanhörung vorgelegt wurden. Das zeige eine am Freitag veröffentlichte Akte, berichtet Bloomberg. “Das Urteil schafft einen abschreckenden Effekt, weil die Kommunikation mit ausländischen Korrespondenten als potenzielles Verbrechen angesehen werden kann”, zitiert die Agentur den Politiker Fernando Cheung.
Mo war eine der kritischsten Stimmen im Hongkonger Legislativrat, bevor sie sich anderen Oppositionsmitgliedern anschloss und im vergangenen Jahr zurücktrat, um gegen die Absetzung von pro-demokratischen Gesetzgebern zu protestieren. Sie gehörte zu den 47 prominenten Oppositionsmitgliedern, die im März wegen einer Wahlkampagne wegen Subversion angeklagt wurden. nib
Forscher aus China und den USA haben mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) antike chinesische Bücher in ausländischen Bibliotheken katalogisiert. Im Rahmen des Projekts der Universität von Sichuan, der US-Universität Berkeley sowie der DAMO Academy von Alibaba hat der Computer bereits rund 200.000 Seiten antiker Bücher mit insgesamt 30.000 Zeichen erfasst und mit Schlagworten verknüpft, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Die Arbeit dauerte demnach mehr als zwei Jahre.
Die Genauigkeit der KI erreichte laut dem Bericht eine Rate von 97,5 Prozent. “Die Genauigkeitsrate lag zu Beginn bei etwa 40 Prozent. Wir haben mehr als 30 Studenten, die die nicht von der KI erkannten oder falsch identifizierten Zeichen manuell identifizieren, um zur Verbesserung der Genauigkeit beizutragen”, erklärt Wang Guo, stellvertretender Dekan der Fakultät für Geschichte und Kultur der Universität Sichuan.
Die digitalen Versionen der antiken Bücher sollen online für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Die Bilder werden durch den Prozess der optischen Zeichenerkennung (OCR) in Text umgewandelt, wie die Universität Berkeley erklärt. Demnach habe die Universität von Sichuan gemeinsam mit DAMO ein System entwickelt, das KI nutzt, um alte chinesische Schriftzeichen in maschinenlesbaren Text umzuwandeln. Das System erkennt demnach chinesische Zeichen 30-Mal schneller als ein Mensch. ari
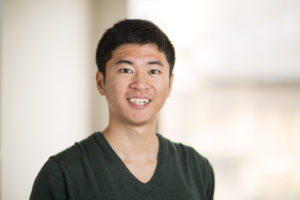
Jeffrey Ding gehört zu den führenden Kennern der chinesischen KI-Forschung. Wenn es darum geht, zu ergründen, wie China in diesem globalen Wettlauf um eine der wichtigen Zukunftstechnologien vorankommt, ist Ding ein gefragter Gesprächspartner. Der Wissenschaftler vom “Future of Humanity Institute” in Oxford kommt in seiner aktuellen Bewertung zu einem ambivalenten Urteil. “Im KI-Bereich ist China aktuell Zweiter hinter den USA, wenn wir alle wichtigen Parameter einbeziehen”, sagt Ding.
Er beobachtet, dass China und mit ihm seine führenden Technologieunternehmen große Fortschritte machen, aber gerade was die Innovationsfähigkeit betrifft immer noch hinter den Vereinigten Staaten hinterherhinken. “China mangelt es weiterhin an eigenen bahnbrechenden Durchbrüchen – etwa beim Deep Learning“, meint Ding, der selbst fließend Chinesisch spricht und vor seiner Zeit in Oxford unter anderem im US-Außenministerium tätig war.
Die Volksrepublik sei gut darin, bestehende Entwicklungen mit großer Finanzkraft und Personalstärke voranzutreiben, aber eigene Innovationen seien bis jetzt die Ausnahme. Als Beispiel führt Ding unter anderem die Entwicklung von Hochleistungs-Grafikchips an. Die Verarbeitung von Bildern ist eines der wichtigsten Elemente im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Die besten Chips stellt die US-Firma Nvidia her. Peking muss derzeit noch auf die Technik des US-Anbieters setzen. “China macht jedoch erhebliche Fortschritte bei der Chipentwicklung und hat sich vorgenommen, viel in diesen Bereich zu investieren”, sagt Ding.
Die Volksrepublik entwickelt allerdings nur selten eigene KI-Innovationen. Das hat laut Ding strukturelle Gründe. Im Silicon Valley hat sich ein Cluster gebildet, in dem immer neue Firmen gegründet und von dem immer mehr kluge Köpfe angezogen würden. China fehlt solch ein Cluster, auch wenn es Bemühungen gibt, kleinere Silicon Valleys an der eigenen Ostküste aufzubauen, sagt Ding.
Bedenken im globalen Westen hinsichtlich der KI-Fortschritte Chinas betreffen den womöglich menschenrechtswidrigen Einsatz der Technologie. “Die Gesichtserkennung ist ein Bereich, in dem China führend ist”, sagt Ding. “Die chinesischen Unternehmen werden vom Ministerium für Öffentliche Sicherheit unterstützt, das ihnen Gesichtsdaten bereitstellt.” Die Regierung in Peking ist an raschen Fortschritten interessiert, denn sie sieht sich selbst als erster und größter Abnehmer der Technologie.
Trotzdem will Peking keine komplett zentral geleitete Entwicklung. “Die Regierung möchte die KI-Forschung nicht zu sehr steuern, denn das würde den Wettbewerb um Ideen eliminieren.” Mit Blick auf die nächsten Jahre erwartet Ding indes nicht, dass China zur weltweiten Nummer eins im KI-Bereich wird. Andere Länder, insbesondere die USA, werden sich in diesem Feld nicht so einfach überholen lassen.
Ding wurde in Shanghai geboren, wanderte aber mit seinen Eltern bereits im Alter von drei Jahren in den US-Bundesstaat Iowa aus. Er kehrte später nach China zurück und verbrachte unter anderem ein Studienjahr in Peking. Ding kam zunächst als Rhodes Scholar nach Oxford und wurde im Anschluss Doktorand am “Future of Humanity Institute”. Constantin Eckner
This year’s Annual General Meeting (AGM) of the EU Chamber of Commerce in China decided on a number of personnel decisions.
Jörg Wuttke (BASF) was confirmed as President of the EU Chamber of Commerce in China. His term of office was thus extended for another two years.
Bruno Weill (BNP Paribas), Carlo D’Andrea (D’Andrea and Partners) and Guido Giacconi (In3act) are new Vice Presidents of the EU Chamber.
Bettina Schoen-Behanzin (Freudenberg) as Chair of the EU Chamber in Shanghai, Klaus Zenkel (Imedco Technology) as Chair of the South China Chamber and Massimo Bagnasco (Progetto CMR) as Chair of the Southwest China Chamber also became Vice Presidents at the national level.
Marko Tulus (Sandvik) continues as treasurer.

Das Leben in der gerade erworbenen Vorstadt-Villa im Grünen ist wirklich überbewertet, so ruhig und einsam. Hätte man doch lieber die Penthouse-Wohnung in der Innenstadt gekauft! Für unterschwellige Angebereien wie diese hat Chinas Netzgemeinde einen neuen Sammelbegriff ersonnen. “Versaillen” oder “einen auf Versailles machen” – chinesisch 凡尔赛 fán’ěrsài – nennt man solche versteckten Prahlereien im Seufz-Kostümchen, mit denen der Sprecher nur vermeintlich nach Mitgefühl heischt, eigentlich aber die eigene privilegierte Stellung herausposaunt.
Angelehnt ist der Begriff tatsächlich an das berühmte Schloss Versailles (凡尔赛宫 fáněrsàigōng) im gleichnamigen Pariser Nachbarort, das man gemeinhin mit pompösen Barockbauten, weitläufigen Gartenanlagen und luxuriösen Lustschlössern verbindet. Die Prachtanlage war in ihrer Zeit Treffpunkt der feinen Gesellschaft Europas. Und die hatte nicht nur ihre eigenen Etikette, sondern eben auch eine eigene, gehobene Sprache und natürlich standesgemäße Gesprächsthemen, bei denen das niedere Volk nicht mitreden konnte. Genau auf diesen Umstand spielen Chinesen heute an, wenn sie Zeitgenossen vorwerfen, sie betrieben 凡尔赛 fán’ěrsài – “unterschwellige Angeberei”.
Generell gilt, dass man mit Bescheidenheit (谦虚 qiānxū) im Reich der Mitte gut beraten ist, besonders als Reaktion auf ungerechtfertigte Komplimente wie Lobgesänge auf rudimentäre Chinesischkenntnisse. Werden diese unverdient in den Himmel gehoben, sollte man mit einer Bescheidenheitsphrase kontern. Nicht unbedingt zu empfehlen ist dabei das in vielen Lehrbüchern angeführte und bei Chinesischlernern weltweit beliebte 哪里哪里 nǎlǐ nǎlǐ “Ach, woher denn!” (wörtlich “wo – wo”). Damit wird man zwar Sympathiepunkte und den einen oder anderen Lacher ernten, sich gleichzeitig jedoch als Chinesisch-Einsteiger entlarven. Denn diese Floskel wird im Alltag unter Muttersprachlern in Wirklichkeit eher selten verwendet. Authentischer kann man dagegen mit zwei anderen einfachen Ausdrücken auftrumpfen, nämlich 过奖了guòjiǎng le (“Zu viel des Lobes!”) oder 不敢当 bù gǎndāng (“Das verdiene ich nicht!”). In diesem Sinne – immer schön auf dem Teppich bleiben!
Verena Menzel 孟维娜 betreibt in Peking die Online-Sprachschule New Chinese.
