die Datenschützer dieses Landes können Sie sich bei der Gruppe “Zerforschung” und Lilith Wittmann bedanken. Die Sicherheitsexpertin und Journalistin ist nicht gerade zimperlich, wenn sie sich eine App oder ein Startup vorknöpft. Aber: Sie prüft wenigstens, wie mit den Daten von Schülerinnen und Schülern umgegangen wird, welche dritten Parteien diese Daten nutzen – und ob damit möglicherweise Geld verdient wird. Sollte es sich am Ende als richtig erweisen, was Wittmann und die Zerforscher über die Schüler-App Scoolio aus Sachsen herausgefunden haben, dann ist das gerade für den innovationsfreundlichen Freistaat ein Problem. Und eine schwere Niederlage für die informationelle Selbstbestimmung von Kindern.
Peinlich ist es vor allem aber für den Datenschutz. Man wird das Gefühl nicht los, dass die Hüter der DSGVO in Deutschland nach dem Motto verfahren: Die Kleinen hängen wir, den Großen gucken wir gar nicht erst auf die Finger. Jedenfalls hat es der Datenschützer in Sachsen nicht für nötig befunden, ein prominentes, staatsgefördertes Startup mit inzwischen 1,8 Millionen Nutzern einmal auf seine Datenschutzkonzepte hin zu befragen. Aber Lehreri:nnen und Schulleiter:innen werden bei jeder Gelegenheit im digitalen Unterricht Knüppel zwischen die Beine geworfen. Den Entwicklern von Scoolio hätte es übrigens geholfen, wenn man rechtzeitig einen Blick in die App geworfen hätte.
Man kann nur hoffen, dass die Berliner Ampelverhandler den Digitalpakt nicht nur als einen Haufen Geld verstehen – sondern sich auch Gedanken darüber machen, wie man den Föderalismus und den Datenschutz neu organisiert. Sodass diese beiden wichtigen Institutionen Schülern und Lehrern künftig helfen.

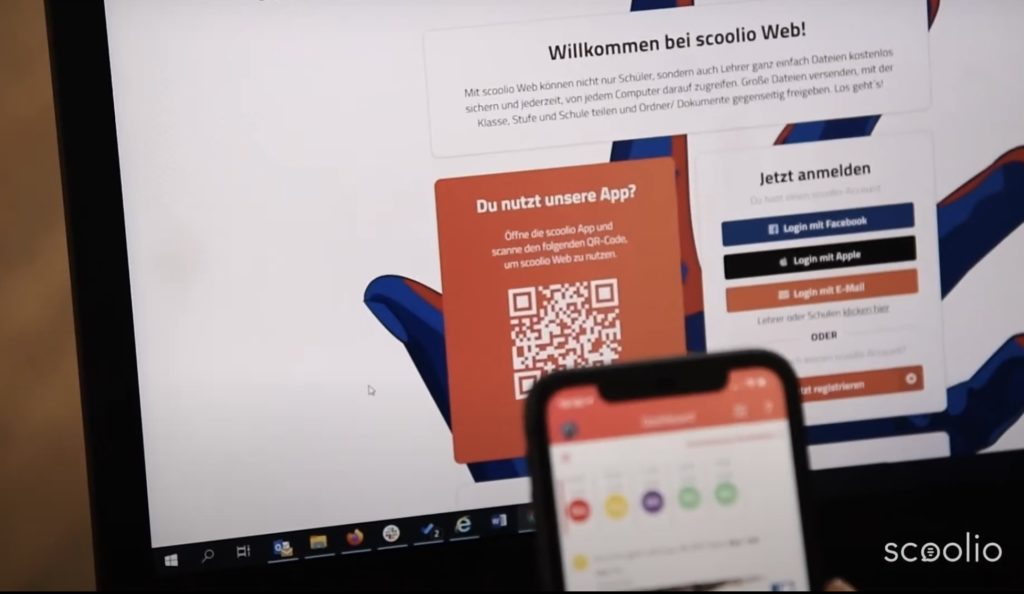
In der PR ist Scoolio spitze. “Ich habe eine mega-mega coole App entdeckt,” schwärmt eine Schülerin im Werbe-Video. “Ich wäre echt glücklich gewesen, hätte ich so eine App gehabt, die mich an meine Hausaufgaben erinnert,” strahlt eine junge Frau. Scoolio ist ein Dresdner Unternehmen, das – so der Gründer – “Schülern das Leben leichter machen will.” Zu der App gehören Hausaufgabenplaner, Notenübersicht, Klassenchat und Nachhilfevermittlung. Nun holt die Realität das Vorzeige-Startup aus Sachsen allerdings ein: Datenjournalisten zeigen, dass Scoolio weder sicher mit den Daten der Schüler umging noch deren Integrität im Chat wahrte.
Das Sicherheits-Kollektiv “Zerforschung” hat zahlreiche Sicherheitsschwachstellen der App aufgedeckt. Die Daten der Schülerinnen und Schüler ließen sich über eine ungeschützte Schnittstelle aufrufen. Einsehbar waren unter anderem Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Schule und Klasse, Interessen und in vielen Fällen auch der letzte Standort, an dem die App geöffnet wurde. Da die Gruppe Zerforschung vor der Veröffentlichung der Schwachstellen eine Frist einräumte, konnten die Sicherheitslücken nach Angabe des Unternehmens noch geschlossen werden, bevor der Bericht der Datenforscherin Lilith Wittmann und ihren Kolleg:innen erschien.
“Sie hat uns Mängel aufgezeigt, diese haben wir in den letzten vier Wochen mit Herzblut und Leidenschaft beseitigt,” bedankte sich Gründer Danny Roller. “Es ist nicht alles perfekt. Wir sind ein junges Unternehmen und haben eine Chance verdient, Dinge zu verbessern.” Roller, der Scoolio mit Kommilitonen der TU Dresden und der Berufsakademie Glauchau gegründet hatte, bekam für das Unternehmen auch staatliches Geld. Das erfuhr Bildung.Table auf Anfrage beim Sächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr. Scoolios Geldgeber “Technologiegründerfonds Sachsen” sei unter anderem mit Mitteln des Freistaats Sachsen und von Sparkassen bestückt worden. Es lasse sich aber nicht ermitteln, wie hoch der Anteil an staatlicher Förderung sei. Auch Danny Roller sagte Bildung.Table, “ich weiß nicht, wie die Struktur des Technologiegründerfonds zusammengesetzt ist.”
Der Datenschutzbeauftragte Sachsens befasst sich nicht bereits seit der Gründung mit Scoolio, sondern griff erst ein, als die Zerforscher kürzlich ihre Sicherheitswarnung herausgaben. Der Sprecher des Datenschutzbeauftragten, Andreas Schneider, sagte Bildung.Table, die Sicherheitslücke sei inzwischen geschlossen. Man habe Kontakt zu Scoolio, das Unternehmen sei kooperativ, daher habe man keine Verwaltungsakte vorgenommen. Dass staatlich geförderte Entwickler von vornherein vom Datenschutz geprüft würden, verneinte der Sprecher. Es sei aber sinnvoll, “dass man sich Projekte anschaut, die größere staatliche Zuschüsse erhalten.” Zu den Problemen des Werbetrackings von Schülern wollte sich der Sprecher nicht äußern. “Wir nehmen alle Aspekte auf – auch mögliche Hinweise, die Sie haben.” Offenbar baut der Datenschutz auf Privatermittler wie Zerforschung.
In der Tat wirft die Datenanalyse von Wittmann und ihren Mitstreiter:innen Fragen auf, die das Konzept werbefinanzierter Schulsoftware insgesamt betreffen. In einem detaillierten Blogbeitrag erklärt das Kollektiv, wie sie vorgegangen sind: Mit einem fiktiven Profil habe man sich bei der App angemeldet und dann den Datenverkehr durch einen Computer durchgeleitet, um ihn dort zu analysieren. Dabei erkannte man die Schnittstelle (API), bei der die App standardmäßig die Daten der nutzenden Person vom Scoolio-Server abruft. Diese Server-Schnittstelle ließ sich aber ohne Probleme mit anderen, fremden Profil-IDs ansprechen und gab dann ohne Einschränkung auch fremde Profildaten zurück. Die einzige Hürde, die verhinderte, dass man gleich die gesamte Datenbank ausliest: Die Profil-IDs waren nicht aus einer Zahlenreihe, sodass man sie hätte hochzählen können. Es waren vielmehr lange, zufällig generierte Zeichenketten, die man nicht erraten kann, z.B. 154bf0cd-2c53-4a6e-8590-c5879086373c. Allerdings lieferte die App im Rahmen einer Kennenlernfunktion bis zu 500 solcher IDs pro Region oder Schule. Das Team musste sich nur immer wieder an einer anderen Schule anmelden, um neue Daten abzurufen. Gegenüber dem IT-Nachrichtenprotal heise.de gab die Sicherheitsforscherin Lilith Wittmann an, dass sie die Menge der in dieser Weise bis vor kurzem abrufbaren Profile auf 400.000 schätzt.
Zusätzlich zu den Profildaten gelangte das Team auch an Persönlichkeitsmerkmale, die die App im Rahmen von Quizzes oder spielerischen Berufseignungstests erhoben hatte. Diese werden offenbar im Rahmen von Jobanfragen auch an werbende Unternehmen übermittelt. Spätestens an dieser Stelle stellt sich die grundlegende Frage nach dem Datenschutz und dem Geschäftsmodell. In dem Blogbeitrag wird kurz angerissen, dass die werbefinanzierte App auch gezielt Clouddienste für Schulen und Lehrkräfte anbietet, die damit Dateien für den Unterricht bereitstellen oder Hausaufgaben einsammeln können. Die Autoren von Zerforschung kommentieren: “Dadurch, dass die App dann im Unterricht zum Standard wird, haben Schüler:innen de facto keine Wahl mehr: Sie müssen die Scoolio-App verwenden. Und Scoolio kann die wehrlosen Schüler:innen als wertvolle, häufig wiederkehrende User an ihre Werbekunden vermarkten.”
Das scheint kein Unfall zu sein. Gründer Danny Roller begründete von Anfang an, dass er den Unternehmen die Scoolio-App “für zielgerichtetes Mikrotargeting zur Verfügung stellt, um sich den zukünftigen Nachwuchskräften zu präsentieren.” Roller erzählte dies schon 2018 im Gespräch mit dem heutigen Betreiber von “Schultransform” Thomas Schmidt – ohne eine Nachfrage zu bekommen. “Das verstehe ich,” sagte Schmidt damals lediglich. Dazu muss man wissen: Schultransform soll, gefördert vom Bundesbildungsministerium, die zentrale Institution werden, um Schulen und Schulträger in Deutschland beim Umbau zum digitalen Lernen zu helfen. Schaut also etwa auch der Bund nicht genau hin? Denn Werbung mit Schülern – das verbietet sich. Roller verwahrte sich dagegen, dass Scoolio Schüler bewusst tracken würde: “Wir verkaufen keine Drittanbieter-Werbung.” Gleichzeitig sagte er Bildung.Table: “Ich bin mir deutlich meiner Verantwortung bewusst. Es wird ein Security-Audit geben. Wir lassen uns gründlich prüfen.”
Was bei Scoolio mit der Werbung alles schiefläuft, hat sich indes beispielhaft das Infoportal Mobilsicher genauer angesehen. Man entdeckte in der App Module (sogenannte SDKs), die Verhaltensdaten an Drittanbieter wie Facebook oder Appsflyer senden. Bei diesen Anfragen wird auch die eindeutige Werbe-ID des Smartphones mitgesendet, die unter Werbetreibenden das wichtigste Erkennungsmerkmal für personalisierte Werbung bildet. Damit werden weltweit außerordentlich umfangreiche Verhaltensprofile von Personen gesammelt, die praktisch keiner Kontrolle mehr unterliegen. Auch wenn diese Praxis weit verbreitet ist: Ohne Einwilligung ist das nicht zulässig und die App verstößt daher auch gegen Datenschutzgesetze. Das sieht auch Miriam Ruhenstroth von dem Portal Mobilsicher in ihrem Kommentar zu dem Skandal so.
An dieser Stelle enden die Probleme von Scoolio allerdings nicht. Zerforschung weist auch auf die Gefahr hin, dass sich jede Person ohne Kontrolle in Chatgruppen, wie beispielsweise “nur Mädchen ab 10”, einschalten könne. Die Gefahr liegt hier sicher nicht darin, dass dort dann jüngere Mädchen mitchatten.
Scoolio, so resümiert Zerforschung, sei “ein von vornherein und offensichtlich völlig kaputtes Geschäftsmodell.” Der Staat habe es mit Millionen unterstützt, aber niemand habe sich genauer angeschaut, wie es mit der Sicherheit bestellt ist. Es ist nicht der erste Fall dieser Art: Anfang des Jahres war bekannt geworden, dass der Vokabeltrainer Phase 6 Verhaltensdaten und Werbe-IDs auch von Minderjährigen ohne gesetzliche Grundlage in die Werbenetzwerke versendet hat. Und es wird auch nicht der letzte Fall sein: Zerforschung hat angekündigt, in Kürze weitere Sicherheitslücken bei Lernsoftware in der Serie Back-To-School zu veröffentlichen. Die Frage, die am Schluss leider offen bleibt: Wann bekommen Schul- und Datenschutzbehörden die personelle und fachliche Ausstattung, um auf diese massiven Probleme im Bereich kommerzieller Angebote im Schulbereich systematisch zu reagieren? Matthias Eberl

Gastbeitrag von Jan-Martin Klinge
Gestern hatte ich die erste Stunde mit meinem 9er-NW-Projektkurs in unserem neuen Schulsystem. Dabei liegt der Schwerpunkt des thematischen Lernens in den Lernbüros – die Projektstunde wird wöchentlich zur Vertiefung genutzt und um eigene Interessen zu verfolgen.
Am Anfang jedes naturwissenschaftlichen Unterrichts stehen organisatorische Dinge wie die Sicherheitsbelehrung und eine transparente Leistungserwartung. Aber ich frage auch gerne, welche Erwartungen die Schüler:innen an den Kurs und an mich haben. “Wie muss der Unterricht hier aussehen, damit es ein richtig guter Kurs wird?”
Nur zögerlich kommen Antworten. “Dass Sie auch mal verständnisvoll sind, wenn man einen schlechten Tag hat.” “Dass man immer fragen kann.” Aber den meisten Zuspruch erfährt die Erwartung “Seien Sie bitte nicht langweilig!” “Ja, genau! Langweilen Sie uns bloß nicht!” “Ja, seien Sie cool!”
Ich erinnere mich an die zwei Schwestern in meinem Unterricht. Für die eine war ich ein pädagogisches Gottesgeschenk, für die andere eine Vollkatastrophe: Dr. Jekyll und Mr. Hide.
Es folgt eine lockere Einführung in das Thema Bewegungen. Wir sammeln, welche Bewegungen es gibt und wie die sich vielleicht gruppieren ließen (beschleunigte Bewegung, gleichförmige Bewegung, Rotation, …). In den letzten fünfzehn Minuten schiebe ich die Stunde in Richtung “Projekt”.
Für die nächsten sechs bis acht Wochen sollen die Schüler:innen sich ein für sie interessantes Subthema aus “Bewegung” heraussuchen und es berechnen, erforschen, erklären, präsentieren. Dabei liegt mein Fokus nicht nur auf dem Ergebnis, sondern auf dem Weg, dem Prozess dahin. (Mehr dazu in meinem Buch Projektunterricht? Geht doch!).
Ich erzähle von der Facharbeit über die Spritzmuster unterschiedlicher Toiletten oder die Untersuchung der Schaumhöhe von Pferdeurin. “Das Wichtigste aber ist”, erkläre ich mit erhobenem Zeigefinger und mache eine dramaturgische Pause, “wenn ihr euch ein Thema aussucht…” (noch eine Pause):
“Langweilt mich nicht!”
Touché!
***
So langsam kommt unser neues Schulsystem ins Rollen und ich finde mich (endlich) häufiger mit Unterricht und weniger mit Organisatorischem beschäftigt und lege meinen Fokus gerade auf den naturwissenschaftlichen Projektunterricht.
Spannend ist dabei zunächst folgende Grundfrage:
Sollten die Kinder sich zuerst ein gewisses Grundverständnis aneignen, auf dessen Basis sie dann ein Projektthema wählen können?
Oder sollten sie – umgekehrt – sich in völliger Unkenntnis über den Sachverhalt zuerst eine Forschungsfrage, ein Projekt wählen und sich von dieser Richtung motiviert erst anschließend die nötigen Grundlagen erarbeiten?
Ich habe mich für den zweiten Weg entschieden: “Schaut erstmal, was ihr spannend findet, was euch interessiert – und dann werdet ihr im Verlauf feststellen, was ihr dafür alles lernen müsst!”
So hat mein neuer 9er-Kurs (“Langweilen Sie uns bloß nicht!”) die vergangene Woche damit verbracht, sich Projektthemen zum Leitbegriff “Bewegung” herauszusuchen.
Um zu vermeiden, dass wir im Unterricht sitzen und niemand sich Gedanken gemacht hat, habe ich eingefordert, mir Vorschläge und Ideen im Verlaufe der Woche zuzuschicken, um direkt Rückmeldung zu bekommen. Wichtigste Maxime: “Es muss mit dem Oberbegriff physikalischer Bewegung zu tun haben und… langweilt mich nicht!”
Was ich nicht möchte, ist das x-te, müde vorgetragene Referat über Isaac Newton – stattdessen Neugierde und Forscherdrang. Und viele der Projektthemen machen mich tatsächlich neugierig.
Eine Auswahl:
Für die Projekte werden Vorträge verfasst, Facharbeiten geschrieben, Filme gedreht oder Experimente entwickelt. Ich bin wahnsinnig neugierig auf die Ergebnisse und folge ein wenig Nöltes “Master or Die“-Ansatz: Die Gruppen dürfen mir ihr Ergebnis so oft schicken, wie sie mögen, um Feedback einzuholen. Hauptsache, es wird am Ende eine sehr gute Arbeit.
Jan-Martin Klinge ist Autor, Blogger und Lehrer. Er unterrichtet an einer Gesamtschule im Raum Siegen und betreibt den Halbtagsblog, wo dieser Text zuerst erschien.
Die erste Aufregung war übertrieben, denn die von Lehrern gern genutzte Notiz- und Feedback-App Notability ändert ihr Geschäftsmodell nicht über Nacht. Erst am 1. November 2022 tritt das neue Bezahlmodell final für alle Nutzer in Kraft. “Aktuelle Kunden können Notability weiterhin nutzen,” versprechen die Entwickler der App. Sie macht es unkompliziert möglich, Notizen in einem Text auch mit dem digitalen Stift anzubringen oder Kommentare aufzusprechen.
Die Nutzung des Tablets wird durch Notability gerade auch für Lehrer praktisch. “Ich nutze sie überwiegend, um Arbeitsblätter, Arbeitsaufträge und auch Ergebnisse mit der Klasse zu besprechen,” sagte ein Lehrer zu Bildung.Table. Der niedersächsische Oberschullehrer Jan Vedder berichtete, dass seine ganze Schule die App nutze. “Die App ist bei uns die digitale Mappe,” so Vedder. “Für mich ist sie absoluter Allrounder: Ablage, Tafelbilder, Erklärvideos.” In Vedders Online-Bank für Fortbildung Studypoint gibt es eine eigene Reihe zu Notability. Darin heißt es: “Notability ist als klassische Notiz-App mit Whiteboardfunktion prädestiniert für den Einsatz im Unterricht.”
Die ersten Reaktionen aus der Lehrerschaft auf die Preisänderung klangen überrascht bis verärgert. “Ich z.B. hab schon 12 Euro für Notability ausgegeben, aber bekomme ein kostenloses Jahr – was halt so viel kostet, wie ich schon bezahlt habe,” schrieb ein Nutzer auf Twitter. “Klar, Notability hat einige Vorteile (wir haben lange überlegt, was wir nehmen), aber auch mit GoodNotes lässt sich in Schule und Unterricht sehr gut arbeiten,” hielt ein anderer fest. Lehrer müssen die App in der Regel selbst bezahlen. Sie kostete bisher einmalig 12 Dollar. Ab sofort kann die App umsonst heruntergeladen werden – die wichtigsten Premium-Funktionen kosten zunächst zwölf Dollar pro Jahr, später 15 Dollar. Allerdings nur für neue Nutzer.
Notability selbst versuchte den Ärger gerade der Lehrer einzudämmen. “K-12-Schulen erhalten die Vollversion kostenlos“, teilte das Unternehmen mit, musste später aber einräumen, dass dies in manchen Fällen noch nicht gelungen sei. “Die über den School Manager installierte Version 11.0 von Notability sollte alle Funktionen des kostenpflichtigen Abonnements enthalten,” schrieb das Unternehmen. “Wir entschuldigen uns dafür, dass sie Ihnen noch nicht zur Verfügung stehen. Wir werden in Kürze eine Version veröffentlichen, die dieses Problem behebt.” Der Entwickler von Notability sagte, das neue Preismodell sei nicht dazu da, um Einnahmen oder Gewinne zu erzielen. Es gehe “vielmehr darum, wie wir unsere Reichweite vergrößern und ein breiteres Ökosystem aufbauen können.” Die Idee besteht darin, dass wildfremde Nutzer ihre Notizen zu identischen Texten miteinander teilen. cif
Das Leibniz-Forschungsnetzwerk “Bildungspotenziale” will die naturwissenschaftlichen Fächer mit digitalen Mitteln stärken. Der Unterricht in den sogenannten MINT-Fächern müsse mit der digitalen Transformation verbunden werden, fordert das Netzwerk von Forschern aus 25 Einrichtungen. In einem Positionspapier anlässlich des Bildungspolitischen Forums 2021 verlangen die Erziehungswissenschaftler, Soziologen, Psychologen eine Reform der Stundentafeln zugunsten digitaler Inhalte. An allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen sei eine “flächendeckende und systematische Verankerung des Themas Digitalisierung in allen drei Phasen der Lehrkräfte-Aus- und Fortbildung” vonnöten.
Das Netzwerk will drei große Schwerpunkte des zukünftigen Lehrens und Lernens in allen Bildungsetappen verankert sehen: Erstens sollen fachspezifische digitale Kompetenzen vermittelt werden, um Simulationen im naturwissenschaftlichen Unterricht nutzbar zu machen. Zweitens sollen digitale Kompetenzen Bestandteil aller Fächer sein. Drittens hält das Forschungsnetzwerk informatische Kompetenzen für unverzichtbar, die bestenfalls in einem Fach Informatik vermittelt wären.
Grundsätzlich sprechen sich die Forscher dafür aus, den Zugang zu digitalen Bildungsressourcen zu vereinfachen. Dazu gehört neben einer stabilen IT-Infrastruktur für alle Schulen auch der Zugang zu Lernplattformen mitsamt der nötigen Endgeräte. Kinder aus bildungsbenachteiligten Haushalten seien bei der Geräteversorgung “im Sinne der Reduktion von Ungleichheiten im Bildungssystem zu priorisieren.” Auch um die Datensicherheit sind die Forscher besorgt. Hier bedürfe es “großer Anstrengungen” von Wissenschaft, Datenschutz, Praxis und Wirtschaft.
Handlungsbedarf sehen die Wissenschaftler auch im Lehramtsstudium, wo mehr Studierende für das Fach Informatik gewonnen werden müssen. Dafür brauche es eine Qualifizierungsoffensive des Ausbildungspersonals. Fortbildungsangebote auf allen Ebenen müssten zudem “soziale, ethische und ökonomische Fragen der Digitalisierung” enthalten. Diese Bemühungen zielen darauf ab, den Nachwuchs für technische Berufe zu fördern, der für die Digitalisierung aller Lebensbereiche gebraucht wird. Schon jetzt fehlen Ingenieure, Naturwissenschaftler und IT-Fachleute. Christine Keilholz
Überall in Deutschland gehen Schülerinnen und Schüler wieder zur Schule, doch manchen von ihnen bereitet das Angst. Sie fürchten sich vor Corona, Überfüllung und sozialer Interaktion, manche haben auch Sorge, ihre Eltern allein zu lassen. Die Zahlen schnellten nach oben, sagt Guilio Calia, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Chefarzt an der Tagesklinik Waltstedden in Nordrhein-Westfalen.
Die Umstellung von pandemiebedingten Formen des Unterrichts, also Hybrid- und Fernunterricht, zurück zum regulären Schulbetrieb verängstigt manche Schülerinnen und Schüler. Es ist zu laut, es ist zu voll, ständig wird Schüler:innen etwas abgefordert. In einem Bericht des WDR erzählt der Schulleiter der Maria-Kunigunda-Grundschule, Udo Moter, vom Verhalten einiger Schülerinnen und Schüler. Wenn diese überhaupt in die Schule kämen, dann verweigerten sie bisweilen den Unterricht – weil sie ihn nicht aushalten. Sie beginnen zu weinen, zucken stark oder geben seltsame Geräusche von sich. Ein Junge müsse konsequent einzeln beschult werden, “weil er im Klassenverband sofort dieses Zucken hat, wenn er mit der Gruppe zusammensitzt.”
Diese Schulangst hat mitunter ernste Auswirkungen bei betroffenen Kindern. Uwe Sonneborn vom Landesverband Schulpsychologie NRW sagt, dass die Mitarbeit oft zurückgehe und auch die Leistung abfalle. Das Verhalten der Schulkinder werde teils aggressiv, sie provozierten und begännen Streit. Doch das ist noch nicht alles: “Manchmal werden Schülerinnen und Schüler auch suizidal, das ist leider auch passiert”, sagt Sonneborn. Es scheint, als hätte die Corona-Zeit einen strukturellen Mangel von Schule aufgedeckt. Das Phänomen einer Post-Corona-Schulangst tritt nicht allein in NRW auf.
Die Gründe für die Schulangst sind verschieden. Kinder registrieren, wenn es familiäre Probleme gibt. Oft hat die Angst daher etwas mit der Situation zu Hause zu tun, wie der Arzt Guilio Calia berichtet: “Das Kind realisiert, dass es den Eltern nicht gut geht.” Dann hätten Kinder oft Sorge, den Eltern fehle zu Hause der Ansprechpartner oder ihnen könnte etwas passieren, während sie in der Schule sind. Die große Problematik: es ist “eine unbewusste Dynamik,” welche die Angst bei den Kindern verursacht. Deshalb kommunizieren sie die Ängste nicht. Schule aber ist nicht der Ort, der ihnen die Angst nimmt, sondern sie womöglich steigert. Robert Saar

Bestünde Twitter aus mehr Menschen wie Daniel Landau, dann wäre die Kurznachrichtenplattform ein besserer Ort. Dann hätte die Gründerin Verena Pausder Twitter wohl nicht verlassen. Der österreichische Bildungsreformer und Freidenker Daniel Landau findet sogar in seinen Twitter-Rezensionen “#LandausSchnellkritik” von Opern und Konzerten, die er zu einer eigenen Kunstform von einer Minute und 30 Sekunden Länge entwickelt hat, nur freundliche Worte. Er hat Twitter, wo so viel gemotzt und geätzt wird, zu einem Ort des Wohlfühlens und der freundlichen Aufmunterung gemacht.
Das bedeutet aber nicht, dass Landau zu allem lächelt. Kaum hat er sich gesetzt, holt er tief Luft und beginnt laut über die Machtergreifung der Taliban in Afghanistan nachzudenken. Die Situation der afghanischen Geflüchteten in Wien setzt ihm zu. Der ehemalige Pflichtschullehrer gehört zu den einflussreichen österreichischen Experten, wenn es um Bildung, Gerechtigkeit und digitales Lernen geht. Schlagworte, die der rote Faden seines Schaffens sind. Er sei aufgewachsen in einem Biotop, wo Bildung als Wert schlechthin gesehen wurde. Und für seinen Kampf für Bildungsgerechtigkeit probierte er sich schon in verschiedenen Bereichen aus. Sei es parteipolitisch bei den Grünen, für die er 2017 bei der Nationalratswahl kandidierte. Oder auf gesellschaftlicher Ebene, als Blogger, Autor und Gründer mehrerer Bildungsinitiativen, wie “zukunft.bildung” und “jedesK!ND“. Hauptsache “tachles reden”, wie es auf seinem Blog heißt: “tachles reden, und dabei keine Ruhe geben, bis jedes Kind Zugang zu besserer Bildung hat.”
Aufgewachsen in einer zwar nicht wohlhabenden, dafür aber bildungsaffinen Familie, wurde bereits im Elternhaus sein Bewusstsein für diese Themen geweckt. Die Erfahrungen seines Vaters Erwin und dessen Flucht vor den Nationalsozialisten nach Shanghai prägten das Gerechtigkeitsverständnis des Bildungsaktivisten stark. Seinen Eltern war der ersehnte Zugang zu höherer Bildung aus finanziellen Gründen verwehrt geblieben. Umso mehr sei es ihnen ein Anliegen gewesen, ihren Kindern das Studium zu ermöglichen, erzählt der 57-jährige.
Als Treffpunkt schlägt Landau das Alser Café im 8. Bezirk von Wien vor. Unter seiner Lederjacke trägt er ein rosafarbenes Hemd, oben locker geknöpft. Er kommt kaum dazu, einen Schluck seiner Apfelsaftschorle zu trinken, so sehr gerät er bei seinem wichtigsten Thema in Fahrt. “Gerechtigkeit bedeutet, dass die Menschen, die weniger haben, mehr bekommen.” Kein linker Mensch wolle alle Menschen gleich machen. Daher gehe es ihm auch um Chancengerechtigkeit und nicht um Chancengleichheit. In der Schule bedeute das, zu hinterfragen, wie sinnvoll das Notensystem sei. “Ein Schüler kommt von hier und hat so einen riesigen Schritt zurückgelegt,” sagt der Diplompädagoge für Musik und Mathematik. “Eine andere Person war hier und ist nur ein bisschen gehoppelt. Ist es gerecht, beiden die gleiche Note zu geben? Wäre es nicht gerechter, den Fortschritt mitzubeurteilen?”
Noten geben, das muss der Bildungsombudsmann, wie er sich gerne nennt, schon länger nicht mehr. Im Lehrerberuf hat er für eine Zeit pausiert. Für wie lange und ob er zurückkehren wird, das weiß er noch nicht. Momentan fühlt es sich für ihn richtiger an, das System auf andere Weise zu beeinflussen. Mit mehr als 16.000 Followern auf Twitter und seinen vielen Auftritten hat er Einfluss.
Das Bildungssystem zu kritisieren, ist seine Passion. Auf seinem Twitter-Profil posierte er im März anlässlich des zehnten Geburtstages des Bildungsvolksbegehrens neben einem goldenen Gartenzwerg, der frech den Mittelfinger entgegenstreckt. Mehr als 300.000 Personen hatten damals unterschrieben, 100.000 Stimmen braucht es, damit das Volksbegehren im Nationalrat besprochen wird. Passiert ist trotzdem nichts. Frustration löst das bei Mister Positiv aber nicht aus. “Aufgegeben wird nur ein Brief,” sagt er.
Daniel Landau ist ein Kritiker, vor allem aber ein Helfender. Während der ersten Corona-Monate bot er in einem Videoblog überforderten Eltern Unterstützung. In Corona sieht er auch einen positiven Effekt für die Digitalisierung: “Es wurden zwar viele Schulen ins kalte Wasser geworfen, doch erstaunlich viele haben zu schwimmen gelernt.” Die Digitalisierung des Lernens habe derzeit das größte Potenzial, Bildungsgerechtigkeit zu schaffen. Eine zunehmende Spaltung befürchtet er nicht. Schüler:innen könnten Inhalte freier und selbstständiger erarbeiten.
“Die Digitalisierung bringt großartige Möglichkeiten, die Menschen in ihrer Verschiedenartigkeit zu erreichen“, sagt Landau – und entwirft mit wenigen Strichen eine neue Welt des Lernens. Individualisierung, sagt er, “das geht oft einfacher über die vielfältigsten Sendekanäle der digitalen Medien, als dass das der Lehrer alleine im Klassenzimmer ohne Unterstützung schaffen könnte.” Er nennt Plattformen zur Gamifizierung und Lehr- und Lernvideos. “Was einem sofort durch den Kopf geht, sind Unterrichtsformen wie flipped classroom, die Schülern die Möglichkeit geben, zu Hause Inhalte in eigener Geschwindigkeit aufzunehmen.”
Gleichwohl weiß Landau, dass Digitalisierung Risiken und Nebenwirkungen mit sich bringt. “Schüler müssen in der Schule eben auch die Gefahren erkennen können, die darin stecken. Also wie kann ich als Schüler die Echtheit von Inhalten kontrollieren, in Bezug auf Bilder und auch auf Texte. Das bedeutet, die Quellen zu überprüfen, das Nachfragen zu lernen und die Inhalte einordnen zu können.”
Eine besondere Aufgabe verortet er bei den Lehrpersonen. “Die Schule hat durch die Überflutung der Kinder und Jugendlichen mit Inhalten aus dem Netz eine Verantwortung aufgetragen bekommen.” Was passiert, wenn man als Lehrer mit den digitalen Möglichkeiten gewissermaßen in die Kinderzimmer der Schüler hineinschauen kann? Daniel Landau hat hier keine perfekte Antwort, aber einen wichtigen Vergleich: Freundschaftsanfragen von Schülern auf Facebook. Sie anzunehmen, solange die Anfrager in der Schule sind, war für ihn als Lehrer stets inakzeptabel gewesen. Deswegen gelte für einen klugen Umgang mit Nähe und Distanz im Digitalen ein hoher Anspruch für die Kolleginnen und Kollegen. Sie sind “diejenigen, die in der Hauptverantwortung sind, ihren Schutzbefohlenen gegenüber – und als solche betrachte ich Schüler:innen – entsprechend professionell zu agieren. Das heißt, dem Abgleiten vom Unterrichtsthema, von welcher Seite auch immer, klar entgegenzutreten.”
Ohne Schulung und Geräte gebe es das alles aber nicht. Für Bildungs- und Chancengerechtigkeit sei es wichtig, dass alle mit Tablets und Laptops ausgestattet würden. Da habe die Regierung während Corona ziemlich versagt. Große Zusagen seien nicht eingehalten worden. Abhilfe hätten private Initiativen geschaffen, wie beispielsweise “PCs für alle,” die unter anderem gebrauchte Computer an Schulen verteilen. “Klar ist das eigentlich verdammt nochmal eine staatliche Aufgabe,” schimpft Landau. Er haut mit der Faust auf den Tisch. Lisa Winter
Die App Flipaclip ist super geeignet, um komplexe Vorgänge in Animationen zu visualisieren. So können die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen anwendungsorientiert aufdröseln und dabei selbstwirksam entdecken, wie diese komplexen Vorgänge wirklich funktionieren. Sie erstellen so beispielsweise Lernvideos für das eigene Lernen – können diese aber auch der ganzen Lerngruppe zur Verfügung stellen.
Für Flipaclip brauchen Schülerinnen und Schüler oder Lehrkräfte – je nachdem, wer das nutzen möchte – ein Tablet, mit dem man zeichnen kann. Dazu braucht man nicht unbedingt einen Tablet-Stift, empfehlen kann ich es aber. Die Schülerinnen und Schüler können die App einfach für sich nutzen, aber auch die Lehrkraft kann selbst Animationen erstellen und den Schülern zur Verfügung stellen. Ansonsten braucht man keine großen technischen Fähigkeiten – einfach ausprobieren! Meine Schülerinnen und Schüler haben das innerhalb von fünf Minuten schon direkt verstanden und erste Animation erstellt ohne, dass ich sie irgendwie angeleitet habe.
Flipaclip kann man auch im Präsenzunterricht einsetzen. Allerdings benötigt das natürlich einiges an Zeit, weshalb ich empfehlen würde, dass die App vielleicht nicht jede Stunde oder in jeder alltäglichen Stunde eingesetzt wird. Aber im Rahmen der Projektarbeit könnte das Endergebnis einer Projektarbeitsphase sein. Da kann ich mir das sehr gut vorstellen. Oder die Lehrkraft bereitet einfach eine Animation vor – es macht auch Spaß, das auszuprobieren – und kann sie den Schülerinnen und Schülern so zur Verfügung stellen. Aber auch in Präsenz können die Schülerinnen Schüler mit Flipaclip anwendungsorientiert arbeiten.
Mein Pro-Tipp für Flipaclip ist, Hintergründe einzufügen. So kann man zum Beispiel ein Bild von einem Vulkan einfügen und dann Lava beziehungsweise Magma einzeichnen – das spart nämlich Zeit. Wenn man dann die “frames per second” einstellt, muss man vielleicht nicht zwölf Bilder pro Sekunde zeichnen, sondern vielleicht reichen dann auch nur zehn. Es ist auch gut, die Animation zu beschriften oder eine Audio zu verwenden und das ganze so zu vertonen.
An Flipaclip finde ich ein bisschen kritisch, dass die kostenlose Version Werbung enthält. Das ist meistens so, aber es ist nervig und manchmal taucht die Werbung zu ungünstigen Zeitpunkt auf – wenn man gerade mittendrin ist, muss man erstmal warten. Wenn man das Video dann exportiert, ist unten so ein kleines Wasserzeichen, wo Flipaclip steht. Das ist es jetzt nicht weiter störend, aber könnte schon ein bisschen irritieren. Natürlich ist die App ein bisschen zeitaufwendig, aber durch das Kopieren von einzelnen Bildern bekommt man es gut in den Griff.
Sarah Busse ist Lehrerin an der KGS Leeste in Weyhe. Sie unterrichtet Französisch sowie Werte und Normen.
Flipaclip gibt es für Android und iOS. Die App benötigt keine Anmeldung. Für 5 Euro lassen sich die Premiumfunktionen (auf Android) freischalten.
3. November 2021, 13:30 bis 16:30 Uhr
Dialogforum: Bildungsübergänge und -zugänge in der Digitalität
Das Netzwerk Bildung Digital möchte über Bildungsübergänge und Bildungszugänge sprechen und fragt: “Wie kann die Digitalisierung den Zugang zu Bildung verbessern und Aufstiegschancen ermöglichen?” Das Dialogforum startet mit einem Panel und kann dann in Form einer Ideenwerkstatt als Ort für Austausch genutzt werden. Die dort entwickelten Fragestellungen werden in weiteren Workshops im November bearbeitet. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, die Anmeldung kostenlos. Infos & Anmeldung
10. bis 12. November 2021
Konferenz: Bildung Digitalisierung
Über 100 Speaker füllen das Programm der sechsten Leitkonferenz vom Forum Bildung Digitalisierung. Der Blick auf das Programm lohnt sich. Vorträge, Projektvorstellungen, Sessions und Panels – es ist alles dabei. Das Forum findet komplett digital statt. Anmeldung und Teilnahme sind kostenlos. Programm & Anmeldung
1. und 2. Dezember 2021
Kongress: TECHTIDE
Das niedersächsische Wirtschaftsministerium lädt zur Digitalisierungskonferenz Techtide. Anfang Dezember diskutieren Digitalisierungs-Professionals, aus Wirtschaft, Bildungswesen, Forschung, Zivilgesellschaft, Politik und Medien über die digitale Transformation in Wirtschaft und Gesellschaft. Den Anstoß gibt eine Thesensammlung, die ein Expertenkreis vor Beginn des Kongresses formuliert. Anmeldung in kürze möglich. Infos & Anmeldung (in Kürze)
die Datenschützer dieses Landes können Sie sich bei der Gruppe “Zerforschung” und Lilith Wittmann bedanken. Die Sicherheitsexpertin und Journalistin ist nicht gerade zimperlich, wenn sie sich eine App oder ein Startup vorknöpft. Aber: Sie prüft wenigstens, wie mit den Daten von Schülerinnen und Schülern umgegangen wird, welche dritten Parteien diese Daten nutzen – und ob damit möglicherweise Geld verdient wird. Sollte es sich am Ende als richtig erweisen, was Wittmann und die Zerforscher über die Schüler-App Scoolio aus Sachsen herausgefunden haben, dann ist das gerade für den innovationsfreundlichen Freistaat ein Problem. Und eine schwere Niederlage für die informationelle Selbstbestimmung von Kindern.
Peinlich ist es vor allem aber für den Datenschutz. Man wird das Gefühl nicht los, dass die Hüter der DSGVO in Deutschland nach dem Motto verfahren: Die Kleinen hängen wir, den Großen gucken wir gar nicht erst auf die Finger. Jedenfalls hat es der Datenschützer in Sachsen nicht für nötig befunden, ein prominentes, staatsgefördertes Startup mit inzwischen 1,8 Millionen Nutzern einmal auf seine Datenschutzkonzepte hin zu befragen. Aber Lehreri:nnen und Schulleiter:innen werden bei jeder Gelegenheit im digitalen Unterricht Knüppel zwischen die Beine geworfen. Den Entwicklern von Scoolio hätte es übrigens geholfen, wenn man rechtzeitig einen Blick in die App geworfen hätte.
Man kann nur hoffen, dass die Berliner Ampelverhandler den Digitalpakt nicht nur als einen Haufen Geld verstehen – sondern sich auch Gedanken darüber machen, wie man den Föderalismus und den Datenschutz neu organisiert. Sodass diese beiden wichtigen Institutionen Schülern und Lehrern künftig helfen.

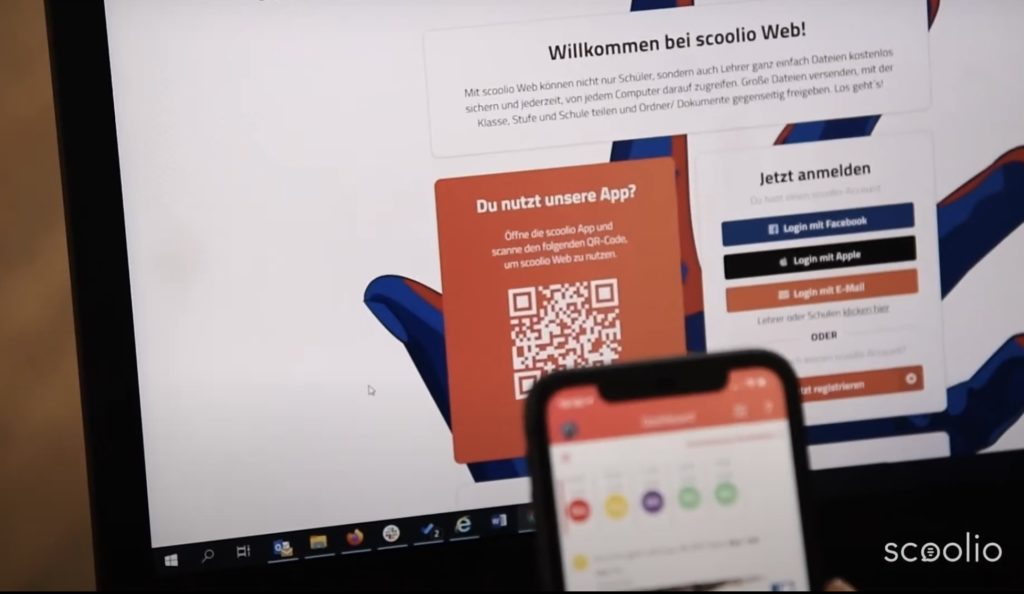
In der PR ist Scoolio spitze. “Ich habe eine mega-mega coole App entdeckt,” schwärmt eine Schülerin im Werbe-Video. “Ich wäre echt glücklich gewesen, hätte ich so eine App gehabt, die mich an meine Hausaufgaben erinnert,” strahlt eine junge Frau. Scoolio ist ein Dresdner Unternehmen, das – so der Gründer – “Schülern das Leben leichter machen will.” Zu der App gehören Hausaufgabenplaner, Notenübersicht, Klassenchat und Nachhilfevermittlung. Nun holt die Realität das Vorzeige-Startup aus Sachsen allerdings ein: Datenjournalisten zeigen, dass Scoolio weder sicher mit den Daten der Schüler umging noch deren Integrität im Chat wahrte.
Das Sicherheits-Kollektiv “Zerforschung” hat zahlreiche Sicherheitsschwachstellen der App aufgedeckt. Die Daten der Schülerinnen und Schüler ließen sich über eine ungeschützte Schnittstelle aufrufen. Einsehbar waren unter anderem Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Schule und Klasse, Interessen und in vielen Fällen auch der letzte Standort, an dem die App geöffnet wurde. Da die Gruppe Zerforschung vor der Veröffentlichung der Schwachstellen eine Frist einräumte, konnten die Sicherheitslücken nach Angabe des Unternehmens noch geschlossen werden, bevor der Bericht der Datenforscherin Lilith Wittmann und ihren Kolleg:innen erschien.
“Sie hat uns Mängel aufgezeigt, diese haben wir in den letzten vier Wochen mit Herzblut und Leidenschaft beseitigt,” bedankte sich Gründer Danny Roller. “Es ist nicht alles perfekt. Wir sind ein junges Unternehmen und haben eine Chance verdient, Dinge zu verbessern.” Roller, der Scoolio mit Kommilitonen der TU Dresden und der Berufsakademie Glauchau gegründet hatte, bekam für das Unternehmen auch staatliches Geld. Das erfuhr Bildung.Table auf Anfrage beim Sächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr. Scoolios Geldgeber “Technologiegründerfonds Sachsen” sei unter anderem mit Mitteln des Freistaats Sachsen und von Sparkassen bestückt worden. Es lasse sich aber nicht ermitteln, wie hoch der Anteil an staatlicher Förderung sei. Auch Danny Roller sagte Bildung.Table, “ich weiß nicht, wie die Struktur des Technologiegründerfonds zusammengesetzt ist.”
Der Datenschutzbeauftragte Sachsens befasst sich nicht bereits seit der Gründung mit Scoolio, sondern griff erst ein, als die Zerforscher kürzlich ihre Sicherheitswarnung herausgaben. Der Sprecher des Datenschutzbeauftragten, Andreas Schneider, sagte Bildung.Table, die Sicherheitslücke sei inzwischen geschlossen. Man habe Kontakt zu Scoolio, das Unternehmen sei kooperativ, daher habe man keine Verwaltungsakte vorgenommen. Dass staatlich geförderte Entwickler von vornherein vom Datenschutz geprüft würden, verneinte der Sprecher. Es sei aber sinnvoll, “dass man sich Projekte anschaut, die größere staatliche Zuschüsse erhalten.” Zu den Problemen des Werbetrackings von Schülern wollte sich der Sprecher nicht äußern. “Wir nehmen alle Aspekte auf – auch mögliche Hinweise, die Sie haben.” Offenbar baut der Datenschutz auf Privatermittler wie Zerforschung.
In der Tat wirft die Datenanalyse von Wittmann und ihren Mitstreiter:innen Fragen auf, die das Konzept werbefinanzierter Schulsoftware insgesamt betreffen. In einem detaillierten Blogbeitrag erklärt das Kollektiv, wie sie vorgegangen sind: Mit einem fiktiven Profil habe man sich bei der App angemeldet und dann den Datenverkehr durch einen Computer durchgeleitet, um ihn dort zu analysieren. Dabei erkannte man die Schnittstelle (API), bei der die App standardmäßig die Daten der nutzenden Person vom Scoolio-Server abruft. Diese Server-Schnittstelle ließ sich aber ohne Probleme mit anderen, fremden Profil-IDs ansprechen und gab dann ohne Einschränkung auch fremde Profildaten zurück. Die einzige Hürde, die verhinderte, dass man gleich die gesamte Datenbank ausliest: Die Profil-IDs waren nicht aus einer Zahlenreihe, sodass man sie hätte hochzählen können. Es waren vielmehr lange, zufällig generierte Zeichenketten, die man nicht erraten kann, z.B. 154bf0cd-2c53-4a6e-8590-c5879086373c. Allerdings lieferte die App im Rahmen einer Kennenlernfunktion bis zu 500 solcher IDs pro Region oder Schule. Das Team musste sich nur immer wieder an einer anderen Schule anmelden, um neue Daten abzurufen. Gegenüber dem IT-Nachrichtenprotal heise.de gab die Sicherheitsforscherin Lilith Wittmann an, dass sie die Menge der in dieser Weise bis vor kurzem abrufbaren Profile auf 400.000 schätzt.
Zusätzlich zu den Profildaten gelangte das Team auch an Persönlichkeitsmerkmale, die die App im Rahmen von Quizzes oder spielerischen Berufseignungstests erhoben hatte. Diese werden offenbar im Rahmen von Jobanfragen auch an werbende Unternehmen übermittelt. Spätestens an dieser Stelle stellt sich die grundlegende Frage nach dem Datenschutz und dem Geschäftsmodell. In dem Blogbeitrag wird kurz angerissen, dass die werbefinanzierte App auch gezielt Clouddienste für Schulen und Lehrkräfte anbietet, die damit Dateien für den Unterricht bereitstellen oder Hausaufgaben einsammeln können. Die Autoren von Zerforschung kommentieren: “Dadurch, dass die App dann im Unterricht zum Standard wird, haben Schüler:innen de facto keine Wahl mehr: Sie müssen die Scoolio-App verwenden. Und Scoolio kann die wehrlosen Schüler:innen als wertvolle, häufig wiederkehrende User an ihre Werbekunden vermarkten.”
Das scheint kein Unfall zu sein. Gründer Danny Roller begründete von Anfang an, dass er den Unternehmen die Scoolio-App “für zielgerichtetes Mikrotargeting zur Verfügung stellt, um sich den zukünftigen Nachwuchskräften zu präsentieren.” Roller erzählte dies schon 2018 im Gespräch mit dem heutigen Betreiber von “Schultransform” Thomas Schmidt – ohne eine Nachfrage zu bekommen. “Das verstehe ich,” sagte Schmidt damals lediglich. Dazu muss man wissen: Schultransform soll, gefördert vom Bundesbildungsministerium, die zentrale Institution werden, um Schulen und Schulträger in Deutschland beim Umbau zum digitalen Lernen zu helfen. Schaut also etwa auch der Bund nicht genau hin? Denn Werbung mit Schülern – das verbietet sich. Roller verwahrte sich dagegen, dass Scoolio Schüler bewusst tracken würde: “Wir verkaufen keine Drittanbieter-Werbung.” Gleichzeitig sagte er Bildung.Table: “Ich bin mir deutlich meiner Verantwortung bewusst. Es wird ein Security-Audit geben. Wir lassen uns gründlich prüfen.”
Was bei Scoolio mit der Werbung alles schiefläuft, hat sich indes beispielhaft das Infoportal Mobilsicher genauer angesehen. Man entdeckte in der App Module (sogenannte SDKs), die Verhaltensdaten an Drittanbieter wie Facebook oder Appsflyer senden. Bei diesen Anfragen wird auch die eindeutige Werbe-ID des Smartphones mitgesendet, die unter Werbetreibenden das wichtigste Erkennungsmerkmal für personalisierte Werbung bildet. Damit werden weltweit außerordentlich umfangreiche Verhaltensprofile von Personen gesammelt, die praktisch keiner Kontrolle mehr unterliegen. Auch wenn diese Praxis weit verbreitet ist: Ohne Einwilligung ist das nicht zulässig und die App verstößt daher auch gegen Datenschutzgesetze. Das sieht auch Miriam Ruhenstroth von dem Portal Mobilsicher in ihrem Kommentar zu dem Skandal so.
An dieser Stelle enden die Probleme von Scoolio allerdings nicht. Zerforschung weist auch auf die Gefahr hin, dass sich jede Person ohne Kontrolle in Chatgruppen, wie beispielsweise “nur Mädchen ab 10”, einschalten könne. Die Gefahr liegt hier sicher nicht darin, dass dort dann jüngere Mädchen mitchatten.
Scoolio, so resümiert Zerforschung, sei “ein von vornherein und offensichtlich völlig kaputtes Geschäftsmodell.” Der Staat habe es mit Millionen unterstützt, aber niemand habe sich genauer angeschaut, wie es mit der Sicherheit bestellt ist. Es ist nicht der erste Fall dieser Art: Anfang des Jahres war bekannt geworden, dass der Vokabeltrainer Phase 6 Verhaltensdaten und Werbe-IDs auch von Minderjährigen ohne gesetzliche Grundlage in die Werbenetzwerke versendet hat. Und es wird auch nicht der letzte Fall sein: Zerforschung hat angekündigt, in Kürze weitere Sicherheitslücken bei Lernsoftware in der Serie Back-To-School zu veröffentlichen. Die Frage, die am Schluss leider offen bleibt: Wann bekommen Schul- und Datenschutzbehörden die personelle und fachliche Ausstattung, um auf diese massiven Probleme im Bereich kommerzieller Angebote im Schulbereich systematisch zu reagieren? Matthias Eberl

Gastbeitrag von Jan-Martin Klinge
Gestern hatte ich die erste Stunde mit meinem 9er-NW-Projektkurs in unserem neuen Schulsystem. Dabei liegt der Schwerpunkt des thematischen Lernens in den Lernbüros – die Projektstunde wird wöchentlich zur Vertiefung genutzt und um eigene Interessen zu verfolgen.
Am Anfang jedes naturwissenschaftlichen Unterrichts stehen organisatorische Dinge wie die Sicherheitsbelehrung und eine transparente Leistungserwartung. Aber ich frage auch gerne, welche Erwartungen die Schüler:innen an den Kurs und an mich haben. “Wie muss der Unterricht hier aussehen, damit es ein richtig guter Kurs wird?”
Nur zögerlich kommen Antworten. “Dass Sie auch mal verständnisvoll sind, wenn man einen schlechten Tag hat.” “Dass man immer fragen kann.” Aber den meisten Zuspruch erfährt die Erwartung “Seien Sie bitte nicht langweilig!” “Ja, genau! Langweilen Sie uns bloß nicht!” “Ja, seien Sie cool!”
Ich erinnere mich an die zwei Schwestern in meinem Unterricht. Für die eine war ich ein pädagogisches Gottesgeschenk, für die andere eine Vollkatastrophe: Dr. Jekyll und Mr. Hide.
Es folgt eine lockere Einführung in das Thema Bewegungen. Wir sammeln, welche Bewegungen es gibt und wie die sich vielleicht gruppieren ließen (beschleunigte Bewegung, gleichförmige Bewegung, Rotation, …). In den letzten fünfzehn Minuten schiebe ich die Stunde in Richtung “Projekt”.
Für die nächsten sechs bis acht Wochen sollen die Schüler:innen sich ein für sie interessantes Subthema aus “Bewegung” heraussuchen und es berechnen, erforschen, erklären, präsentieren. Dabei liegt mein Fokus nicht nur auf dem Ergebnis, sondern auf dem Weg, dem Prozess dahin. (Mehr dazu in meinem Buch Projektunterricht? Geht doch!).
Ich erzähle von der Facharbeit über die Spritzmuster unterschiedlicher Toiletten oder die Untersuchung der Schaumhöhe von Pferdeurin. “Das Wichtigste aber ist”, erkläre ich mit erhobenem Zeigefinger und mache eine dramaturgische Pause, “wenn ihr euch ein Thema aussucht…” (noch eine Pause):
“Langweilt mich nicht!”
Touché!
***
So langsam kommt unser neues Schulsystem ins Rollen und ich finde mich (endlich) häufiger mit Unterricht und weniger mit Organisatorischem beschäftigt und lege meinen Fokus gerade auf den naturwissenschaftlichen Projektunterricht.
Spannend ist dabei zunächst folgende Grundfrage:
Sollten die Kinder sich zuerst ein gewisses Grundverständnis aneignen, auf dessen Basis sie dann ein Projektthema wählen können?
Oder sollten sie – umgekehrt – sich in völliger Unkenntnis über den Sachverhalt zuerst eine Forschungsfrage, ein Projekt wählen und sich von dieser Richtung motiviert erst anschließend die nötigen Grundlagen erarbeiten?
Ich habe mich für den zweiten Weg entschieden: “Schaut erstmal, was ihr spannend findet, was euch interessiert – und dann werdet ihr im Verlauf feststellen, was ihr dafür alles lernen müsst!”
So hat mein neuer 9er-Kurs (“Langweilen Sie uns bloß nicht!”) die vergangene Woche damit verbracht, sich Projektthemen zum Leitbegriff “Bewegung” herauszusuchen.
Um zu vermeiden, dass wir im Unterricht sitzen und niemand sich Gedanken gemacht hat, habe ich eingefordert, mir Vorschläge und Ideen im Verlaufe der Woche zuzuschicken, um direkt Rückmeldung zu bekommen. Wichtigste Maxime: “Es muss mit dem Oberbegriff physikalischer Bewegung zu tun haben und… langweilt mich nicht!”
Was ich nicht möchte, ist das x-te, müde vorgetragene Referat über Isaac Newton – stattdessen Neugierde und Forscherdrang. Und viele der Projektthemen machen mich tatsächlich neugierig.
Eine Auswahl:
Für die Projekte werden Vorträge verfasst, Facharbeiten geschrieben, Filme gedreht oder Experimente entwickelt. Ich bin wahnsinnig neugierig auf die Ergebnisse und folge ein wenig Nöltes “Master or Die“-Ansatz: Die Gruppen dürfen mir ihr Ergebnis so oft schicken, wie sie mögen, um Feedback einzuholen. Hauptsache, es wird am Ende eine sehr gute Arbeit.
Jan-Martin Klinge ist Autor, Blogger und Lehrer. Er unterrichtet an einer Gesamtschule im Raum Siegen und betreibt den Halbtagsblog, wo dieser Text zuerst erschien.
Die erste Aufregung war übertrieben, denn die von Lehrern gern genutzte Notiz- und Feedback-App Notability ändert ihr Geschäftsmodell nicht über Nacht. Erst am 1. November 2022 tritt das neue Bezahlmodell final für alle Nutzer in Kraft. “Aktuelle Kunden können Notability weiterhin nutzen,” versprechen die Entwickler der App. Sie macht es unkompliziert möglich, Notizen in einem Text auch mit dem digitalen Stift anzubringen oder Kommentare aufzusprechen.
Die Nutzung des Tablets wird durch Notability gerade auch für Lehrer praktisch. “Ich nutze sie überwiegend, um Arbeitsblätter, Arbeitsaufträge und auch Ergebnisse mit der Klasse zu besprechen,” sagte ein Lehrer zu Bildung.Table. Der niedersächsische Oberschullehrer Jan Vedder berichtete, dass seine ganze Schule die App nutze. “Die App ist bei uns die digitale Mappe,” so Vedder. “Für mich ist sie absoluter Allrounder: Ablage, Tafelbilder, Erklärvideos.” In Vedders Online-Bank für Fortbildung Studypoint gibt es eine eigene Reihe zu Notability. Darin heißt es: “Notability ist als klassische Notiz-App mit Whiteboardfunktion prädestiniert für den Einsatz im Unterricht.”
Die ersten Reaktionen aus der Lehrerschaft auf die Preisänderung klangen überrascht bis verärgert. “Ich z.B. hab schon 12 Euro für Notability ausgegeben, aber bekomme ein kostenloses Jahr – was halt so viel kostet, wie ich schon bezahlt habe,” schrieb ein Nutzer auf Twitter. “Klar, Notability hat einige Vorteile (wir haben lange überlegt, was wir nehmen), aber auch mit GoodNotes lässt sich in Schule und Unterricht sehr gut arbeiten,” hielt ein anderer fest. Lehrer müssen die App in der Regel selbst bezahlen. Sie kostete bisher einmalig 12 Dollar. Ab sofort kann die App umsonst heruntergeladen werden – die wichtigsten Premium-Funktionen kosten zunächst zwölf Dollar pro Jahr, später 15 Dollar. Allerdings nur für neue Nutzer.
Notability selbst versuchte den Ärger gerade der Lehrer einzudämmen. “K-12-Schulen erhalten die Vollversion kostenlos“, teilte das Unternehmen mit, musste später aber einräumen, dass dies in manchen Fällen noch nicht gelungen sei. “Die über den School Manager installierte Version 11.0 von Notability sollte alle Funktionen des kostenpflichtigen Abonnements enthalten,” schrieb das Unternehmen. “Wir entschuldigen uns dafür, dass sie Ihnen noch nicht zur Verfügung stehen. Wir werden in Kürze eine Version veröffentlichen, die dieses Problem behebt.” Der Entwickler von Notability sagte, das neue Preismodell sei nicht dazu da, um Einnahmen oder Gewinne zu erzielen. Es gehe “vielmehr darum, wie wir unsere Reichweite vergrößern und ein breiteres Ökosystem aufbauen können.” Die Idee besteht darin, dass wildfremde Nutzer ihre Notizen zu identischen Texten miteinander teilen. cif
Das Leibniz-Forschungsnetzwerk “Bildungspotenziale” will die naturwissenschaftlichen Fächer mit digitalen Mitteln stärken. Der Unterricht in den sogenannten MINT-Fächern müsse mit der digitalen Transformation verbunden werden, fordert das Netzwerk von Forschern aus 25 Einrichtungen. In einem Positionspapier anlässlich des Bildungspolitischen Forums 2021 verlangen die Erziehungswissenschaftler, Soziologen, Psychologen eine Reform der Stundentafeln zugunsten digitaler Inhalte. An allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen sei eine “flächendeckende und systematische Verankerung des Themas Digitalisierung in allen drei Phasen der Lehrkräfte-Aus- und Fortbildung” vonnöten.
Das Netzwerk will drei große Schwerpunkte des zukünftigen Lehrens und Lernens in allen Bildungsetappen verankert sehen: Erstens sollen fachspezifische digitale Kompetenzen vermittelt werden, um Simulationen im naturwissenschaftlichen Unterricht nutzbar zu machen. Zweitens sollen digitale Kompetenzen Bestandteil aller Fächer sein. Drittens hält das Forschungsnetzwerk informatische Kompetenzen für unverzichtbar, die bestenfalls in einem Fach Informatik vermittelt wären.
Grundsätzlich sprechen sich die Forscher dafür aus, den Zugang zu digitalen Bildungsressourcen zu vereinfachen. Dazu gehört neben einer stabilen IT-Infrastruktur für alle Schulen auch der Zugang zu Lernplattformen mitsamt der nötigen Endgeräte. Kinder aus bildungsbenachteiligten Haushalten seien bei der Geräteversorgung “im Sinne der Reduktion von Ungleichheiten im Bildungssystem zu priorisieren.” Auch um die Datensicherheit sind die Forscher besorgt. Hier bedürfe es “großer Anstrengungen” von Wissenschaft, Datenschutz, Praxis und Wirtschaft.
Handlungsbedarf sehen die Wissenschaftler auch im Lehramtsstudium, wo mehr Studierende für das Fach Informatik gewonnen werden müssen. Dafür brauche es eine Qualifizierungsoffensive des Ausbildungspersonals. Fortbildungsangebote auf allen Ebenen müssten zudem “soziale, ethische und ökonomische Fragen der Digitalisierung” enthalten. Diese Bemühungen zielen darauf ab, den Nachwuchs für technische Berufe zu fördern, der für die Digitalisierung aller Lebensbereiche gebraucht wird. Schon jetzt fehlen Ingenieure, Naturwissenschaftler und IT-Fachleute. Christine Keilholz
Überall in Deutschland gehen Schülerinnen und Schüler wieder zur Schule, doch manchen von ihnen bereitet das Angst. Sie fürchten sich vor Corona, Überfüllung und sozialer Interaktion, manche haben auch Sorge, ihre Eltern allein zu lassen. Die Zahlen schnellten nach oben, sagt Guilio Calia, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Chefarzt an der Tagesklinik Waltstedden in Nordrhein-Westfalen.
Die Umstellung von pandemiebedingten Formen des Unterrichts, also Hybrid- und Fernunterricht, zurück zum regulären Schulbetrieb verängstigt manche Schülerinnen und Schüler. Es ist zu laut, es ist zu voll, ständig wird Schüler:innen etwas abgefordert. In einem Bericht des WDR erzählt der Schulleiter der Maria-Kunigunda-Grundschule, Udo Moter, vom Verhalten einiger Schülerinnen und Schüler. Wenn diese überhaupt in die Schule kämen, dann verweigerten sie bisweilen den Unterricht – weil sie ihn nicht aushalten. Sie beginnen zu weinen, zucken stark oder geben seltsame Geräusche von sich. Ein Junge müsse konsequent einzeln beschult werden, “weil er im Klassenverband sofort dieses Zucken hat, wenn er mit der Gruppe zusammensitzt.”
Diese Schulangst hat mitunter ernste Auswirkungen bei betroffenen Kindern. Uwe Sonneborn vom Landesverband Schulpsychologie NRW sagt, dass die Mitarbeit oft zurückgehe und auch die Leistung abfalle. Das Verhalten der Schulkinder werde teils aggressiv, sie provozierten und begännen Streit. Doch das ist noch nicht alles: “Manchmal werden Schülerinnen und Schüler auch suizidal, das ist leider auch passiert”, sagt Sonneborn. Es scheint, als hätte die Corona-Zeit einen strukturellen Mangel von Schule aufgedeckt. Das Phänomen einer Post-Corona-Schulangst tritt nicht allein in NRW auf.
Die Gründe für die Schulangst sind verschieden. Kinder registrieren, wenn es familiäre Probleme gibt. Oft hat die Angst daher etwas mit der Situation zu Hause zu tun, wie der Arzt Guilio Calia berichtet: “Das Kind realisiert, dass es den Eltern nicht gut geht.” Dann hätten Kinder oft Sorge, den Eltern fehle zu Hause der Ansprechpartner oder ihnen könnte etwas passieren, während sie in der Schule sind. Die große Problematik: es ist “eine unbewusste Dynamik,” welche die Angst bei den Kindern verursacht. Deshalb kommunizieren sie die Ängste nicht. Schule aber ist nicht der Ort, der ihnen die Angst nimmt, sondern sie womöglich steigert. Robert Saar

Bestünde Twitter aus mehr Menschen wie Daniel Landau, dann wäre die Kurznachrichtenplattform ein besserer Ort. Dann hätte die Gründerin Verena Pausder Twitter wohl nicht verlassen. Der österreichische Bildungsreformer und Freidenker Daniel Landau findet sogar in seinen Twitter-Rezensionen “#LandausSchnellkritik” von Opern und Konzerten, die er zu einer eigenen Kunstform von einer Minute und 30 Sekunden Länge entwickelt hat, nur freundliche Worte. Er hat Twitter, wo so viel gemotzt und geätzt wird, zu einem Ort des Wohlfühlens und der freundlichen Aufmunterung gemacht.
Das bedeutet aber nicht, dass Landau zu allem lächelt. Kaum hat er sich gesetzt, holt er tief Luft und beginnt laut über die Machtergreifung der Taliban in Afghanistan nachzudenken. Die Situation der afghanischen Geflüchteten in Wien setzt ihm zu. Der ehemalige Pflichtschullehrer gehört zu den einflussreichen österreichischen Experten, wenn es um Bildung, Gerechtigkeit und digitales Lernen geht. Schlagworte, die der rote Faden seines Schaffens sind. Er sei aufgewachsen in einem Biotop, wo Bildung als Wert schlechthin gesehen wurde. Und für seinen Kampf für Bildungsgerechtigkeit probierte er sich schon in verschiedenen Bereichen aus. Sei es parteipolitisch bei den Grünen, für die er 2017 bei der Nationalratswahl kandidierte. Oder auf gesellschaftlicher Ebene, als Blogger, Autor und Gründer mehrerer Bildungsinitiativen, wie “zukunft.bildung” und “jedesK!ND“. Hauptsache “tachles reden”, wie es auf seinem Blog heißt: “tachles reden, und dabei keine Ruhe geben, bis jedes Kind Zugang zu besserer Bildung hat.”
Aufgewachsen in einer zwar nicht wohlhabenden, dafür aber bildungsaffinen Familie, wurde bereits im Elternhaus sein Bewusstsein für diese Themen geweckt. Die Erfahrungen seines Vaters Erwin und dessen Flucht vor den Nationalsozialisten nach Shanghai prägten das Gerechtigkeitsverständnis des Bildungsaktivisten stark. Seinen Eltern war der ersehnte Zugang zu höherer Bildung aus finanziellen Gründen verwehrt geblieben. Umso mehr sei es ihnen ein Anliegen gewesen, ihren Kindern das Studium zu ermöglichen, erzählt der 57-jährige.
Als Treffpunkt schlägt Landau das Alser Café im 8. Bezirk von Wien vor. Unter seiner Lederjacke trägt er ein rosafarbenes Hemd, oben locker geknöpft. Er kommt kaum dazu, einen Schluck seiner Apfelsaftschorle zu trinken, so sehr gerät er bei seinem wichtigsten Thema in Fahrt. “Gerechtigkeit bedeutet, dass die Menschen, die weniger haben, mehr bekommen.” Kein linker Mensch wolle alle Menschen gleich machen. Daher gehe es ihm auch um Chancengerechtigkeit und nicht um Chancengleichheit. In der Schule bedeute das, zu hinterfragen, wie sinnvoll das Notensystem sei. “Ein Schüler kommt von hier und hat so einen riesigen Schritt zurückgelegt,” sagt der Diplompädagoge für Musik und Mathematik. “Eine andere Person war hier und ist nur ein bisschen gehoppelt. Ist es gerecht, beiden die gleiche Note zu geben? Wäre es nicht gerechter, den Fortschritt mitzubeurteilen?”
Noten geben, das muss der Bildungsombudsmann, wie er sich gerne nennt, schon länger nicht mehr. Im Lehrerberuf hat er für eine Zeit pausiert. Für wie lange und ob er zurückkehren wird, das weiß er noch nicht. Momentan fühlt es sich für ihn richtiger an, das System auf andere Weise zu beeinflussen. Mit mehr als 16.000 Followern auf Twitter und seinen vielen Auftritten hat er Einfluss.
Das Bildungssystem zu kritisieren, ist seine Passion. Auf seinem Twitter-Profil posierte er im März anlässlich des zehnten Geburtstages des Bildungsvolksbegehrens neben einem goldenen Gartenzwerg, der frech den Mittelfinger entgegenstreckt. Mehr als 300.000 Personen hatten damals unterschrieben, 100.000 Stimmen braucht es, damit das Volksbegehren im Nationalrat besprochen wird. Passiert ist trotzdem nichts. Frustration löst das bei Mister Positiv aber nicht aus. “Aufgegeben wird nur ein Brief,” sagt er.
Daniel Landau ist ein Kritiker, vor allem aber ein Helfender. Während der ersten Corona-Monate bot er in einem Videoblog überforderten Eltern Unterstützung. In Corona sieht er auch einen positiven Effekt für die Digitalisierung: “Es wurden zwar viele Schulen ins kalte Wasser geworfen, doch erstaunlich viele haben zu schwimmen gelernt.” Die Digitalisierung des Lernens habe derzeit das größte Potenzial, Bildungsgerechtigkeit zu schaffen. Eine zunehmende Spaltung befürchtet er nicht. Schüler:innen könnten Inhalte freier und selbstständiger erarbeiten.
“Die Digitalisierung bringt großartige Möglichkeiten, die Menschen in ihrer Verschiedenartigkeit zu erreichen“, sagt Landau – und entwirft mit wenigen Strichen eine neue Welt des Lernens. Individualisierung, sagt er, “das geht oft einfacher über die vielfältigsten Sendekanäle der digitalen Medien, als dass das der Lehrer alleine im Klassenzimmer ohne Unterstützung schaffen könnte.” Er nennt Plattformen zur Gamifizierung und Lehr- und Lernvideos. “Was einem sofort durch den Kopf geht, sind Unterrichtsformen wie flipped classroom, die Schülern die Möglichkeit geben, zu Hause Inhalte in eigener Geschwindigkeit aufzunehmen.”
Gleichwohl weiß Landau, dass Digitalisierung Risiken und Nebenwirkungen mit sich bringt. “Schüler müssen in der Schule eben auch die Gefahren erkennen können, die darin stecken. Also wie kann ich als Schüler die Echtheit von Inhalten kontrollieren, in Bezug auf Bilder und auch auf Texte. Das bedeutet, die Quellen zu überprüfen, das Nachfragen zu lernen und die Inhalte einordnen zu können.”
Eine besondere Aufgabe verortet er bei den Lehrpersonen. “Die Schule hat durch die Überflutung der Kinder und Jugendlichen mit Inhalten aus dem Netz eine Verantwortung aufgetragen bekommen.” Was passiert, wenn man als Lehrer mit den digitalen Möglichkeiten gewissermaßen in die Kinderzimmer der Schüler hineinschauen kann? Daniel Landau hat hier keine perfekte Antwort, aber einen wichtigen Vergleich: Freundschaftsanfragen von Schülern auf Facebook. Sie anzunehmen, solange die Anfrager in der Schule sind, war für ihn als Lehrer stets inakzeptabel gewesen. Deswegen gelte für einen klugen Umgang mit Nähe und Distanz im Digitalen ein hoher Anspruch für die Kolleginnen und Kollegen. Sie sind “diejenigen, die in der Hauptverantwortung sind, ihren Schutzbefohlenen gegenüber – und als solche betrachte ich Schüler:innen – entsprechend professionell zu agieren. Das heißt, dem Abgleiten vom Unterrichtsthema, von welcher Seite auch immer, klar entgegenzutreten.”
Ohne Schulung und Geräte gebe es das alles aber nicht. Für Bildungs- und Chancengerechtigkeit sei es wichtig, dass alle mit Tablets und Laptops ausgestattet würden. Da habe die Regierung während Corona ziemlich versagt. Große Zusagen seien nicht eingehalten worden. Abhilfe hätten private Initiativen geschaffen, wie beispielsweise “PCs für alle,” die unter anderem gebrauchte Computer an Schulen verteilen. “Klar ist das eigentlich verdammt nochmal eine staatliche Aufgabe,” schimpft Landau. Er haut mit der Faust auf den Tisch. Lisa Winter
Die App Flipaclip ist super geeignet, um komplexe Vorgänge in Animationen zu visualisieren. So können die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen anwendungsorientiert aufdröseln und dabei selbstwirksam entdecken, wie diese komplexen Vorgänge wirklich funktionieren. Sie erstellen so beispielsweise Lernvideos für das eigene Lernen – können diese aber auch der ganzen Lerngruppe zur Verfügung stellen.
Für Flipaclip brauchen Schülerinnen und Schüler oder Lehrkräfte – je nachdem, wer das nutzen möchte – ein Tablet, mit dem man zeichnen kann. Dazu braucht man nicht unbedingt einen Tablet-Stift, empfehlen kann ich es aber. Die Schülerinnen und Schüler können die App einfach für sich nutzen, aber auch die Lehrkraft kann selbst Animationen erstellen und den Schülern zur Verfügung stellen. Ansonsten braucht man keine großen technischen Fähigkeiten – einfach ausprobieren! Meine Schülerinnen und Schüler haben das innerhalb von fünf Minuten schon direkt verstanden und erste Animation erstellt ohne, dass ich sie irgendwie angeleitet habe.
Flipaclip kann man auch im Präsenzunterricht einsetzen. Allerdings benötigt das natürlich einiges an Zeit, weshalb ich empfehlen würde, dass die App vielleicht nicht jede Stunde oder in jeder alltäglichen Stunde eingesetzt wird. Aber im Rahmen der Projektarbeit könnte das Endergebnis einer Projektarbeitsphase sein. Da kann ich mir das sehr gut vorstellen. Oder die Lehrkraft bereitet einfach eine Animation vor – es macht auch Spaß, das auszuprobieren – und kann sie den Schülerinnen und Schülern so zur Verfügung stellen. Aber auch in Präsenz können die Schülerinnen Schüler mit Flipaclip anwendungsorientiert arbeiten.
Mein Pro-Tipp für Flipaclip ist, Hintergründe einzufügen. So kann man zum Beispiel ein Bild von einem Vulkan einfügen und dann Lava beziehungsweise Magma einzeichnen – das spart nämlich Zeit. Wenn man dann die “frames per second” einstellt, muss man vielleicht nicht zwölf Bilder pro Sekunde zeichnen, sondern vielleicht reichen dann auch nur zehn. Es ist auch gut, die Animation zu beschriften oder eine Audio zu verwenden und das ganze so zu vertonen.
An Flipaclip finde ich ein bisschen kritisch, dass die kostenlose Version Werbung enthält. Das ist meistens so, aber es ist nervig und manchmal taucht die Werbung zu ungünstigen Zeitpunkt auf – wenn man gerade mittendrin ist, muss man erstmal warten. Wenn man das Video dann exportiert, ist unten so ein kleines Wasserzeichen, wo Flipaclip steht. Das ist es jetzt nicht weiter störend, aber könnte schon ein bisschen irritieren. Natürlich ist die App ein bisschen zeitaufwendig, aber durch das Kopieren von einzelnen Bildern bekommt man es gut in den Griff.
Sarah Busse ist Lehrerin an der KGS Leeste in Weyhe. Sie unterrichtet Französisch sowie Werte und Normen.
Flipaclip gibt es für Android und iOS. Die App benötigt keine Anmeldung. Für 5 Euro lassen sich die Premiumfunktionen (auf Android) freischalten.
3. November 2021, 13:30 bis 16:30 Uhr
Dialogforum: Bildungsübergänge und -zugänge in der Digitalität
Das Netzwerk Bildung Digital möchte über Bildungsübergänge und Bildungszugänge sprechen und fragt: “Wie kann die Digitalisierung den Zugang zu Bildung verbessern und Aufstiegschancen ermöglichen?” Das Dialogforum startet mit einem Panel und kann dann in Form einer Ideenwerkstatt als Ort für Austausch genutzt werden. Die dort entwickelten Fragestellungen werden in weiteren Workshops im November bearbeitet. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, die Anmeldung kostenlos. Infos & Anmeldung
10. bis 12. November 2021
Konferenz: Bildung Digitalisierung
Über 100 Speaker füllen das Programm der sechsten Leitkonferenz vom Forum Bildung Digitalisierung. Der Blick auf das Programm lohnt sich. Vorträge, Projektvorstellungen, Sessions und Panels – es ist alles dabei. Das Forum findet komplett digital statt. Anmeldung und Teilnahme sind kostenlos. Programm & Anmeldung
1. und 2. Dezember 2021
Kongress: TECHTIDE
Das niedersächsische Wirtschaftsministerium lädt zur Digitalisierungskonferenz Techtide. Anfang Dezember diskutieren Digitalisierungs-Professionals, aus Wirtschaft, Bildungswesen, Forschung, Zivilgesellschaft, Politik und Medien über die digitale Transformation in Wirtschaft und Gesellschaft. Den Anstoß gibt eine Thesensammlung, die ein Expertenkreis vor Beginn des Kongresses formuliert. Anmeldung in kürze möglich. Infos & Anmeldung (in Kürze)
