manche Ereignisse sind derart raumgreifend, dass es schwerfällt, direkt zur alltäglichen Routine überzugehen: Dass es um Vorwürfe der Verschwendung von Steuergeldern geht, war seit dem Bericht des Bundesrechnungshofs im Februar bekannt. Dass die Staatsanwaltschaft München I gegen unbekannt bei Fraunhofer ermittelt, hatten wir selbst im März exklusiv berichtet. Doch als gestern Vormittag die Staatsanwaltschaft bestätigte, dass nun gegen frühere Vorstandsmitglieder der Fraunhofer-Gesellschaft ermittelt werde, genauer gegen “Prof. Dr. N., Prof. Dr. K. und Dipl.-Kfm. M. sowie gegen den Beschuldigten Prof. Dr. W.”, wurde das Ausmaß des Skandals noch einmal eindrücklich bewusst. Der Anfangsverdacht lautet: Untreue. In diesem Alert haben wir gestern die Informationen für Sie zusammengestellt.
Mit dem anhaltenden Krieg Russlands gegen die Ukraine verändert sich der Umgang mit Zivilklauseln und Wehrforschung an deutschen Hochschulen. Die frühere Forschungsministerin Annette Schavan (CDU) hat im Gespräch mit Table.Media zu einer aktiveren Kooperation geraten, um den Forschungsstandort nicht zu gefährden. Universitäten müssten die Diskussion um die Zivilklausel führen. “Wenn schon Zeitenwende”, sagte Schavan, “dann heißt das auch, technologisch etwas zu ändern”.
Besonders beschäftigt hat mich eine Äußerung der früheren Forschungsministerin, die 2008 das erste Programm zur zivilen Sicherheitsforschung einführte: An die intensiven Diskussionen zum Start von Ganzkörper-Scannern an Flughäfen erinnert, erklärt Schavan: “Wir waren davon überzeugt, von Freunden umgeben zu sein und dass die Welt peu à peu die Freiheit und die Demokratie entdecken würde. Leider hat es sich anders entwickelt.”
Gemeinsam mit meinem Kollegen Gabriel Bub habe ich die aktuelle Debatte um die Zivilklausel recherchiert.
Wir wünschen Ihnen eine gute Lektüre,

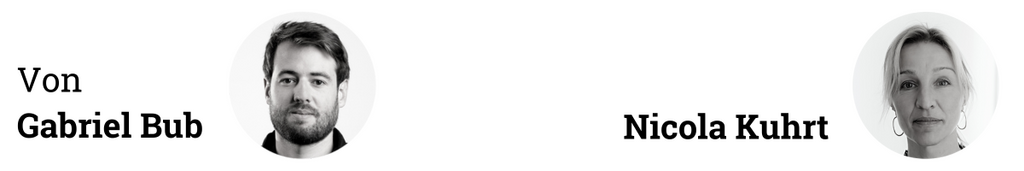
Vor dem Hintergrund des Krieges gegen die Ukraine und der Waffenlieferungen in Richtung Kiew gibt es in den Hochschulen zwar keine öffentlichen Diskussionen über eine Öffnung für militärisch nutzbare Forschung. Doch es mehren sich Stimmen, die eine neue Richtung fordern.
“Universitäten müssen die Diskussion um die Zivilklausel führen. Wenn schon Zeitenwende, wenn wir also sagen, wir müssen jetzt wieder fähiger und resilient werden, dann heißt das auch, technologisch etwas zu ändern. Und nicht nur in unserer Gedankenführung”, erklärt Annette Schavan (CDU), die als frühere Bundesforschungsministerin 2008 das erste zivile Sicherheitsforschungsprogramm einführte. “Meine Argumentation war und ist es bis heute: Wenn ich etwas nicht will, muss ich dennoch viel davon verstehen“, sagt Schavan. Weil man sonst irgendwann gar nicht mehr mitreden könne, und die eigene Forschungspolitik isoliere.
Wie stark sich die Zeiten geändert haben, fällt auf beim Blick zurück auf die damaligen Debatten, etwa zum Ganzkörper-Scanner am Flughafen, sagt Schavan. Dies sei aber in einer Stimmung erfolgt, die sie nie kleinreden würde: “Wir waren davon überzeugt, von Freunden umgeben zu sein und dass die Welt peu à peu die Freiheit und die Demokratie entdecken würde. Leider hat es sich anders entwickelt.”
Schavan merkt an, dass sie den Umgang mit der Zivilklausel schon 2008 nicht konsequent fand. “Angesichts dessen, was wir aktuell erleben, gilt das einmal mehr: Wir können uns nicht vornehm zurückhalten”, sagt Schavan. “Es geht um uns, es geht um Erkenntnisse, Erkenntnisfortschritt, den man nicht einfach als unverantwortlich oder unethisch abtun darf.”
Der erste in der Wissenschaftscommunity, der laut forderte, die Zivilklausel an Hochschulen zu überdenken, war Jan Wörner, Präsident der Akademien der Technikwissenschaften (acatech). “Frieden braucht moderne Verteidigung”, erklärte er bereits im vergangenen Jahr. Die bestehenden Regeln sollten im Sinne einer friedenssichernden Forschung kritisch überarbeitet werden. Die Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) kritisierte derweil die mangelnden Synergien zwischen militärischer und ziviler Forschung. Ihr Vorsitzender Uwe Cantner fordert eine Lockerung der Klauseln.
Aus dem Verteidigungsministerium (BMVg) kommt die Aufforderung eines Umdenkens in Sachen Zivilklausel. “Die Angehörigen der Bundeswehr dienen dem Frieden und unserem Schutz. Sie haben ein Anrecht auf die bestmögliche Ausrüstung und somit auch auf universitäre Forschung und Entwicklung in unserem Land”, erklärt eine Sprecherin. “Zivilklauseln sind aus dieser Sicht eine Einschränkung der Freiheit von Lehre und Forschung.”
Für das BMVg sei die Kooperation mit Universitäten eine kostengünstige Möglichkeit, Ausrüstungsentscheidungen zu prüfen, “den Stand der Forschung in den einzelnen Fachdisziplinen durch Integration in die Forschungslandschaft abzugleichen und zu erweitern”, wie eine Sprecherin auf Anfrage mitteilt. Weiterer Nebeneffekt: Das Ministerium kann sich und die Forschungseinrichtungen des Bundes für den studentischen Nachwuchs bekannter machen.
Neben den Bundeswehruniversitäten in Hamburg und München kooperiere das Verteidigungsministerium zur wehrtechnischen Forschung mit mehreren Universitäten, darunter Koblenz, Duisburg, Erlangen, Siegen, Hannover und Braunschweig. Wozu konkret, will das Ministerium mit Verweis auf “eingestufte Informationen” nicht sagen. Nur, dass die Kooperationen mit Universitäten – einschließlich Kooperationen im medizinischen Bereich – jährlich einen einstelligen Millionenbereich kosten. Vergleichsweise wenig Geld.
Deutsche Rüstungskonzerne halten sich bedeckt. Die Panzerbauer Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann, begründen dies mit “der strategischen Bedeutung für die Forschung und Entwicklung des Unternehmens”. Auch die Fraunhofer-Institute, die im Verbund Verteidigungs- und Sicherheitsforschung (VVS) forschen, wollen zu Fragen, die “potenziell sicherheitskritische Forschungsbereiche betreffen”, nichts sagen.
Und die Hochschulen selbst? Hier zeichnet sich ein wechselhaftes Bild. Viele haben Zivilklauseln in ihren Grundordnungen oder Leitbildern festgeschrieben oder in einem Senatsbeschluss verankert. Die meisten der derzeit bestehenden rund 75 Zivilklauseln entstanden in der den frühen 2010er Jahren.
Während viele Häuser wie die Uni Bremen oder Bonn auf ihre bestehende Zivilklausel verweisen, deuten andere auf Probleme hin. Genannt werden möchten sie nicht. Die Umsetzung der Zivilklausel selbst sei kaum möglich. Es fehlten vernünftige Kriterien zur Beurteilung von Forschungsprojekten. Zudem wird die Einhaltung der Auflagen kaum kontrolliert. Die Zivilklausel sei doch “mausetot”, fasste es Joachim Krause vom Institut für Sicherheitspolitik der Universität Kiel einmal ganz deutlich zusammen.
Mit Blick auf Forderungen aus der Politik, Zivilklauseln generell zu streichen, erklärt Walter Rosenthal, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz auf Nachfrage, dass diese im deutschen Hochschulsystem nicht die Regel seien. Dort, wo es sie gebe, handle es sich um institutionelle, die Forschungsfreiheit der einzelnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aber rechtlich nicht beschränkende Selbstverpflichtungen, an der jeweiligen Hochschule prinzipiell für friedliche Zwecke zu forschen. Der HRK-Präsident betonte, dass die wichtigste Funktion entsprechender Klauseln die “kontinuierliche Einladung zur wissenschaftsethischen Reflexion über mögliche Folgen der eigenen Forschung” sei.
Auf eben diese verweisen auch die Deutsche Forschungsgemeinschaft und die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina in ihren gemeinsamen Empfehlungen zum Umgang mit sicherheitsrelevanter Forschung: Das Risiko möglicher missbräuchlicher Verwendung von Forschungsergebnissen gegenüber den Chancen abzuwägen, stelle besondere Anforderungen an die Verantwortung und Selbstkontrolle Forschender, heißt es. Diese gelte für alle Bereiche der Forschung und sei in Zeiten globaler Aufrüstung besonders anspruchsvoll.
Ein Sprecher der Universität der Bundeswehr München berichtet, man nehme derzeit eine höhere Akzeptanz der Wehrforschung wahr. Das sei rein subjektiv und nicht durch Daten belegbar. Wie die Wehrforschung aber weitermachen sollte, könne nur “durch das Zusammenspiel von Politik und Industrie beantwortet werden”.
Wer demnächst das KI-System ChatGPT für seinen Betrieb nutzen will, könnte durch den derzeit geplanten EU AI Act hart ausgebremst werden. “Wenn es mit der Gesetzgebung ganz schlecht läuft, dann zieht ein simpler Kundendialog mithilfe eines Chatbots einen Rattenschwanz von Dokumentations- und Auskunftspflichten nach sich, der jede Innovation abwürgt”, sagt Aljoscha Burchardt, Principal Researcher am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Berlin.
Im Mai warnten 150 Chefs europäischer Tech-Unternehmen in einem offenen Brief vor dem Gesetz. In seiner jetzigen Form gefährde es die KI-Zukunft Europas: Es bürde der Wirtschaft enorme Haftungsrisiken und Compliancekosten auf, erzwinge die Auslagerung innovativer Firmenteile in Länder außerhalb der EU und schrecke Investoren ab. Die Problematik besteht weiterhin.
“Beim Internet hat Europa viel verschlafen, das darf uns mit KI nicht noch einmal passieren”, mahnt Gerard de Melo, Professor am Hasso-Plattner-Institut und an der Universität Potsdam. Um die besten Köpfe und Start-up-Gründer auf dem Kontinent zu halten, sei ein flexibler Rechtsrahmen wichtig. “Die USA als Weltmeister der KI, Europa als Weltmeister der KI-Regulierung”, zitiert Philipp Hacker, Rechtswissenschaftler an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder), ein Spötterwort. “Die Gefahr ist real, aber wir sollten und können sie abwenden.”

Für die Optimierung des EU AI Acts bleiben noch gut drei Monate Zeit. Anfang Juni hat das Europaparlament seine Position zum Gesetz verabschiedet. Seither wird der Text im sogenannten Trilog mit der EU-Kommission und den Mitgliedsstaaten abgestimmt. Bis zum Jahresende soll eine Einigung gefunden werden, damit das Regelwerk mit Beginn des neuen Jahres offiziell in Kraft treten kann. Anschließend haben die Unternehmen etwa zwei Jahre Zeit, um sich an die neuen Rahmenbedingungen anzupassen. Dann gilt das Gesetz auch in der Praxis.
Auf welche Änderungen kommt es in jetzt an? Jörg Bienert, Präsident des KI-Bundesverbands, plädiert zunächst für eine engere Definition von KI: “Derzeit fällt praktisch jede Software unter den Begriff, was ihre Entwicklung und Anwendung mit vielen neuen Vorschriften belastet.” Gleiches gelte für die Einstufung von Basismodellen wie ChatGPT als Hochrisikoanwendung. Die Modelle sind so gut wie die Daten, mit denen sie regelmäßig neu trainiert werden. Bienert: “Wenn das aber jedes Mal einen Wust an Bürokratie nach sich zieht, wie für Hochrisikoanwendungen typisch, erlahmt der Innovationselan.” Für das KI-Gesetz bedeutet das auch: Basismodelle sollten nur dann als hochriskant eingestuft werden, wenn sie für entsprechend heikle Tätigkeiten eingesetzt werden – und nicht bloß zur Gestaltung von Geburtstagskarten oder für die Praxisorganisation beim Arzt.
DFKI-Forscher Aljoscha Burchardt plädiert für eine schlanke, agile Regulierung: “Das Gesetz sollte nicht alle Probleme auflisten, die passieren könnten. Es sollte aber dafür sorgen, dass wir, wenn etwas passiert, wenn die KI tatsächlich Probleme macht, Gewehr bei Fuß stehen.”
Über Deutschlands Abschneiden im weltweiten KI-Rennen entscheiden nicht allein Rechtsfragen. “Wir haben eine gute Basis in der KI-Forschung”, lobt Jörg Bienert. “Es mangelt bei uns jedoch an Praxistransfer, an Mut und Investitionsbereitschaft, was die Voraussetzungen für disruptive Entwicklungen à la ChatGPT sind.” Das Potenzial von KI sei gewaltig und reiche von neuen Produkten und Dienstleistungen bis hin zur Umwälzung des gesamten Arbeitsmarktes. Ausschöpfen lasse es sich mithilfe eines KI-Hochleistungsrechenzentrums, wo unter anderem große, vertrauenswürdige Basismodelle made in Germany trainiert werden könnten. Den Weg dorthin skizziert der KI-Bundesverband in seiner Machbarkeitsstudie “Große KI-Modelle für Deutschland”. Bienert: “Für das neue Zentrum brauchen wir staatliche Investitionen von 300 bis 400 Millionen Euro, was im Vergleich zu den 10 Milliarden für Intel bescheiden ist.” Gerechtfertigt sei die Investition allemal, schließlich gehe es um die digitale Souveränität Deutschlands und Europas.
Ob Google, Microsoft und Co. sich einholen lassen, darf bezweifelt werden. Auf Anhieb erfolgversprechend wirken jedoch Spezialanwendungen, etwa für Medizin, Verwaltung oder Industrie, die auf europäischen und überseeischen Big-Tech-Konzernen nicht zur Verfügung stehenden Daten basieren. “Hier sehe ich große Chancen für kleine und mittlere Unternehmen”, sagt Philipp Hacker. KMU seien häufig die Innovationstreiber im KI-Bereich und verdienten massive öffentliche Unterstützung.
Entscheidend sei am Ende ein innovationsfreundliches, unbürokratisches KI-Ökosystem, sagt Gerard de Melo. “Weil es das in den USA und in Kanada gibt, geht die gründungswillige KI-Welt heute vor allem dorthin.” Um Europa für die wählerische Klientel attraktiver zu machen, müsse man an vielen Schrauben drehen. Eine davon heißt den nächsten Wochen: EU AI Act.
Die Texte der Table.Media-Serie “Der globale Wettlauf um Künstliche Intelligenz” finden Sie hier.
Was erwarten Sie von der Ampel-Koalition in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode?
Mit dem Start der Haushaltsberatungen des Bundestages geht die Regierungszeit der Ampel-Koalition in die zweite Hälfte. Welche politischen Themen sollte die Bundesregierung in den kommenden Monaten anpacken, in welchen Politikfeldern erwarten Sie Einigungen? Diese und andere Fragen zur Zukunft der Ampel – aber auch zur Bewertung der ersten Hälfte der Legislatur und der Leistungen der Ministerinnen und Minister – stellt Table.Media in einer Umfrage. (Jetzt an Umfrage teilnehmen)
12. September 2023, 16:30 Uhr, Berlin Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Einstein-Saal, Jägerstraße 22, 10117 Berlin / Online
Diskussion ChatGPT und Co. in der Forschung Mehr
14. September 2023, 11:00 Uhr, WZB, Reichpietschufer 50, 10785 Berlin
Diskussion Junge Wissenschaft trifft Politik – mit Lisa Paus Mehr
27. September 2023, Hauptstadtrepräsentanz der Deutschen Telekom AG, Berlin
Tagung Helmholtz-Jahrestagung 2023 Mehr
27.-29. September 2023, Freie Universität Berlin
Gemeinsame Konferenz der Berliner Hochschulen Open-Access-Tage 2023 “Visionen gestalten” Mehr
28. September 2023, 18-21.30 Uhr, Medizinhistorisches Museum Berlin
Diskussionsveranstaltung der Arbeitsgruppe “Hochschulen als MINT-Innovationsmotor” im Nationalen MINT Forum Any other subject: Wie die Erweiterung des MINT-Begriffs neue Zielgruppen erschließt Mehr
1.-10. November 2023, Berlin
Wissenschaftsfestival Berlin Science Week Mehr
7.-9. November 2023, Berlin
Konferenz Falling Walls Science Summit 2023 Mehr
16. November 2023, Wilhelm Büchner Hochschule, Darmstadt
Tagung WBH Wissenschaftsforum 2023 – “Transformation gestalten” Mehr
In den ersten 20 Monaten ihrer Regierungsarbeit hat die Ampel-Koalition bereits knapp zwei Drittel (64 Prozent) ihres sehr ambitionierten Koalitionsvertrages entweder umgesetzt (38 Prozent) oder mit der Umsetzung begonnen (26 Prozent). Das BMBF liegt mit rund einem Drittel umgesetzter und einem Viertel begonnener Vorhaben jedoch unter dem Durchschnitt der Ministerien. Das ist das Ergebnis einer gemeinsamen Studie der Bertelsmann Stiftung, der Universität Trier und der Berliner Denkfabrik Progressives Zentrum.
Zur Einordnung: Insgesamt hatte sich die aktuelle Regierung deutlich mehr vorgenommen als die Koalitionen zuvor. Im Bereich Bildung und Forschung gab es 29 Vorhaben, die sechs Prozent am Gesamtprogramm der Ampel ausmachen. Im Jahr 2018 betrug der Anteil nur vier Prozent. Von den 29 Versprechen waren 25 sogenannte Änderungsversprechen und vier Status-quo-Versprechen.
Eingelöst wurden beispielsweise die Versprechen über zusätzliche Mittel für die Exzellenzstrategie, die weitere Unterstützung und Dynamisierung des Pakts für Forschung und Innovation und die Erhöhung der institutionellen Förderung von DAAD und Alexander von Humboldt-Stiftung.
Als “angegangen” werten die Autoren das Forschungsdatengesetz und das Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Hier lägen Entwürfe vor, es gebe aber noch keinen klaren Zeitplan für die Verabschiedung der Gesetze.
Noch nichts Konkretes gibt es zum Bund-Länder-Programm zur Förderung von alternativen Karrieren außerhalb der Professur, beim Diversity-Management und im Bereich moderne Governance-, Personal- und Organisationsstrukturen. Auch von der Plattform zur Rekrutierung von internationalen Spitzen-Wissenschaftlern fehlt noch jegliche Spur.
Interessant ist, dass die Autoren die Umsetzung der Dati mit der Einrichtung der Geschäftsstelle beim BMBF und der Veröffentlichung der Pilotförderrichtlinie als vollständig erfüllt erachten. Das dürften Kreise jenseits des BMBF anders sehen. Auch dass die Einberufung eines Bildungsgipfels als vollzogen gilt, obwohl von einem Gipfel kaum die Rede sein konnte, zeigt die Schwachstellen der Studie.
Beim BMWK steht die für den Herbst angekündigte Raumfahrtstrategie noch aus. Bereits seit einem Jahr veröffentlicht ist hingegen die Start-up-Strategie. Im Bereich Gesundheit hat das BMG die Digitalisierungsstrategie bereits fertiggestellt – in Verbindung damit angegangen wurden das Gesundheitsdatennutzungsgesetz, Registergesetz und die elektronische Patientenakte (ePA).
Die Wahrnehmung der Bürger hingegen widerspricht dem Ergebnis der Recherche. Wohl durch den vermehrten Streit in der Regierung als auch die schlechte Kommunikation denkt über die Hälfte der Bevölkerung, dass die Ampel nur einen kleinen Teil oder kaum Versprechen umgesetzt habe. Das ergab eine parallel zu der Recherche durchgeführte Umfrage des Allensbach-Instituts im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung. mw
Die komplette Bewertung der Umsetzung der Vorhaben im BMBF sehen Sie hier.
Rund ein Jahr nachdem die Bundesregierung die Start-up-Strategie beschlossen hat, gehen die Meinungen über Erfolg und Fortschritt des Vorhabens auseinander: Unternehmen hatten mehr erwartet, das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) hingegen ist zufrieden. Mehr als 40 Prozent der rund 130 Maßnahmen seien bereits umgesetzt, heißt es im ersten Fortschrittsbericht. Überdies seien 50 Prozent der Maßnahmen angestoßen und zehn Prozent noch nicht gestartet. Das Dokument wird am heutigen Dienstag vorgestellt, Auszüge daraus wurden am Montag vorab bekannt. Als “Meilenstein” bezeichnet Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in einem Bericht des Handelsblatts beispielsweise das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das die Anwerbung von Talenten aus dem Ausland deutlich vereinfachen soll.
Ziel der Ende Juli 2022 beschlossenen Strategie ist es, Start-up-Ökosysteme in Deutschland und Europa zu stärken. Zu den zehn Handlungsfeldern, denen die insgesamt 130 Maßnahmen zugeordnet sind, zählt, die Finanzierung zu stärken, Ausgründungen aus der Wissenschaft zu vereinfachen und Start-ups den Zugang zu Daten zu erleichtern.
Etwas schneller und deutlich kritischer haben Wirtschaftsverbände Bilanz gezogen. Ende Juli erhielt die Politik vom Digitalverband Bitkom lediglich die Note “ausreichend” für das erste Jahr Start-up-Strategie. Die Note resultiert aus einer Befragung von 203 Tech-Start-ups im Auftrag des Verbands, bei der lediglich ein Prozent der Befragten die Leistung für “sehr gut” hielten und sechs Prozent die Note “gut” gaben. “Das Tempo bei der Umsetzung der Vorhaben muss in der zweiten Hälfte der Legislatur erhöht werden”, sagte Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst.
Mehr Tempo mahnte auch der Start-up-Verband in seiner ausführlichen Bilanz der Strategie an. “Die Bundesregierung muss Start-up-Themen mit mehr Priorität vorantreiben – die nächsten 12 Monate sind zur Umsetzung der Startup-Strategie entscheidend”, sagte Christian Miele, Vorstandsvorsitzender des Verbands. Von der Bundesregierung wünsche er sich außerdem insgesamt mehr Fokus auf Zukunftsthemen.
Im Handlungsfeld “Ausgründungen aus der Wissenschaft” begrüßt der Verband grundsätzlich den neuen Wettbewerb der Start-up-Factories, in deren Rahmen fünf bis zehn exzellenzorientierte Projekte gefördert werden. Kritisiert wird das drohende Auslaufen des Programms Exist Potentiale. Der Verband warnt vor einem Zerbrechen der über Jahre aufgebauten Strukturen. “Insgesamt sollte dem Thema wissensbasierter Ausgründungen, auch wenn es sich dabei oft um technische Fragestellungen handelt, deutlich mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden”, heißt es. Das sei erforderlich, um das “herausragende Potenzial unserer Forschungslandschaft noch besser nutzen können”. abg
Bei der Reformierung der Projektträger und der Projektförderung will das BMBF weiter auf einen kontinuierlichen Austausch setzen, sieht aber nach Veröffentlichung des Positionspapiers der Projektträger keine Notwendigkeit für ein besonderes Dialogformat oder sofortige Maßnahmen. “Ein ,Werkstattgespräch’ zu diesem Themenkomplex ist seitens BMBF nicht geplant und auch nicht notwendig, da es institutionalisierte regelmäßige Austauschformate, die sich bewährt haben, bereits gibt, auch unter Einschluss der Projektträger”, teilte eine Ministeriumssprecherin mit.
Das BMBF reagierte mit der Mitteilung auf die Berichterstattung von Table.Media, nachdem die Bundesregierung eine langfristig angelegte Reform der Projektförderung in Deutschland plane. Der SPD-Bundestagsabgeordneter Holger Becker hatte im Gespräch mit Table.Media gesagt, dass das BMBF im vierten Quartal ein gemeinsames Werkstattgespräch mit Berichterstattern der Regierungsparteien und Vertretern von Projektträgern vereinbart habe. Das Ministerium verneinte dies nun.
Die Projektträger des Ministeriums seien ohnehin mit ihrer Expertise in den Vereinfachungs-, Verbesserungs- und Digitalisierungsprozess eng eingebunden. “Das aktuelle Papier des PT-Netzwerks ist ein Beitrag zu diesem regelmäßigen Dialog und wird auf der Fachebene zwischen BMBF und den vom BMBF beauftragten Projektträgern diskutiert werden”, sagte die Sprecherin. Soweit Erfahrungen neuer Instrumente eine Übertragung auf die Breite der Projektförderung nahelegen, werde dies nach positiver Evaluation berücksichtigt.
Das Netzwerk der Projektträger hatte in dem vor zwei Wochen erschienenen Positionspapier eine Flexibilisierung der Projektförderung gefordert. Die PT wollen erreichen, dass das Sprind-Freiheitsgesetz auch für sie gilt. Konkret hatten sie die Bundesregierung aufgefordert, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Auswahlverfahren schlanker und die Fachaufsicht sowie die Finanzierungsbedingungen flexibilisiert werden.
Bei seiner Keynote auf der Eröffnungsveranstaltung der Hauptstadt-Dependance des DLR Projektträgers am vergangenen Donnerstag vermied BMBF-Staatssekretär Mario Brandenburg konkret zu einzelnen Forderungen Stellung zu beziehen oder Zusagen an die Projektträger zu machen. Der EFI-Vorsitzende Uwe Cantner erneuerte dort seine Forderung, dass das Innovationssystem in Deutschland eine Auffrischung brauche. Im Gespräch mit Table.Media hatte er sich bereits in der vergangenen Woche hinter die Forderungen der Projektträger gestellt. tg

Grenzen überwinden und Menschen mit unterschiedlichen Interessen zusammenführen: Darum sei es schon bei ihrem ersten Job gegangen, erzählt Andrea Frank. Bevor sie zum Stifterverband kam, war die gebürtige Rheinländerin Anfang der 2000er Jahre bei der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) unter anderem für Wissenschaftskooperationen in Südosteuropa zuständig. Nach den Umbrüchen und Jugoslawienkriegen des vorherigen Jahrzehnts war das Ziel, die Wissenschaftslandschaft in der Region grenzübergreifend zu stärken.
Am Shkodrasee an der Grenze zwischen Albanien und Montenegro brachte Frank Wissenschaftler aus beiden Ländern für ein gemeinsames Projekt zusammen, in einer Zeit, in der die beiden Nachbarländer kaum Kontakt zueinander hatten. “Damals habe ich gespürt, wie Wissenschaft starre Grenzen überwindet”, erinnert sich Frank.
So sieht die 51-Jährige auch ihre Aufgabe beim Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, dessen stellvertretende Generalsekretärin sie seit 2022 ist. Am Pariser Platz in Berlin sitzt Frank, an der “Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft”, wie sie sagt, koordiniert die programmatische Arbeit, tauscht sich mit Partnerorganisationen und Mitgliedern aus.
Rund 33 Millionen Euro im Jahr wendet der Stifterverband auf, finanziert aus den Beiträgen und Spenden seiner rund 3.500 Mitgliedsunternehmen und -stiftungen, aber auch aus öffentlichen Geldern. Ergänzend zu eigenen Initiativen in den Bereichen Wissenschaft und Bildung fördert er Hochschulen und Forschungseinrichtungen sowie aktuell mehr als 50 Stiftungsprofessuren.
Manche Wissenschaftsvertreter sehen diese Arbeit kritisch und befürchten eine übermäßige Einflussnahme der Wirtschaft auf die Forschung an Hochschulen. Die Anliegen einzelner Unternehmen oder Mitglieder umzusetzen, sei nicht die Idee des Stifterverbandes, entgegnet Frank. “Gemeinsam mit unseren Mitgliedern setzen wir uns ein für relevante Veränderungen im Bildungs- und Wissenschaftssystem und schauen auf die Anforderungen von Wirtschaft und Gesellschaft insgesamt.”
Eines dieser Kernanliegen ist in ihren Augen, im Angesicht des gesellschaftlichen Wandels schnell ausreichend Menschen mit den richtigen Kompetenzen auszubilden. “Exzellente Forschung und bedarfsorientierte Ausbildung müssen nicht im Widerspruch stehen”, sagt Frank. Es sei dennoch oft schwierig, dieses Spannungsfeld zu überwinden. “Weltweit verändern sich Schulen und Hochschulen rasant. Wir müssen Traditionen überwinden und schnell neue Perspektiven für das Lernen entwickeln, um den Bedarf zu decken. Dies passiert schon lange nicht mehr ausschließlich in staatlichen Bildungsinstitutionen.”
Immer wieder kommt Frank auf Themen zu sprechen, bei denen ihr vor allem auf staatlicher Seite Kooperationsbereitschaft und Schnelligkeit fehlen: Lehrkräftebildung, außerschulische Mint-Bildung, Gründungskultur oder digitale Lehre an Hochschulen – die Liste ist lang.
Mit Blick auf die sinkenden Ressourcen in den nächsten Jahren, meint Frank zum Schluss, könnte es gerade diese Knappheit sein, die die Kooperationsbereitschaft staatlicher, aber auch privater Akteure vergrößert und notwendige Reformen möglich macht. Manchmal braucht es offenbar den Anstoß von außen, um eine Grenze zu überwinden. Frank spricht hier aus Erfahrung. Valentin Petri
Peter Britz wird neuer Präsident der Hochschule Weserbergland in Hameln. Er wechselt von der Hochschule Hamm-Lippstadt, wo er Professor für Technisches Umweltmanagement war und den Fachbereich 2 geleitet hat.
Derek von Krogh ist der neue Künstlerische Direktor und Geschäftsführer der Popakademie Baden-Württemberg in Mannheim. Er folgt auf Udo Dahmen, der diese Funktion seit 2003 innehatte.
Friederike Otto, Klimaforscherin am Imperial College London und Mitgründerin der Initiative World-Weather-Attribution, erhält den diesjährigen Deutschen Umweltpreis der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Sie teilt sich die mit 500.000 Euro dotierte Auszeichnung mit der Holzbau-Unternehmerin Dagmar Fritz-Kramer, Geschäftsführerin des Allgäuer Familienbetriebs Bau-Fritz GmbH & Co.KG. Überreicht wird der Preis am 29. Oktober in Lübeck von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.
Peer Schmidt wurde als Vizepräsident für Studium und Lehre an der BTU Cottbus-Senftenberg wiedergewählt. Er leitet dort das Fachgebiet Anorganische Chemie. Seine erste Amtszeit als Vizepräsident trat er 2020 an.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!
Europe.Table. Big Tech-Lobbybudget von 40 Millionen. Die zehn größten Digitalkonzerne – darunter Meta, Google, Apple, Microsoft und Amazon – sind mit einem Lobbybudget von 40 Millionen Euro für mehr als ein Drittel der Lobbyausgaben des Sektors in Brüssel verantwortlich. Mehr.
Security.Table. BAE Systems strebt Prototyp von Überschallkampfflugzeug bis 2027 an. Die Partner des britisch-italienisch-japanischen Global Combat Air Programme (GCAP) haben sich für den Bau eines neuen Kampfjets ehrgeizige Ziele gesetzt: Die Konzeptphase soll bis Ende 2025 abgeschlossen sein, ein Prototyp 2027 abheben und das Überschallkampfflugzeug der neuesten Generation 2035 auf den Markt kommen. Mehr.

In der TV-Werbung hat sich Captain Iglo früher auf Schatzsuche begeben und am Ende eine Truhe mit gold-braunen Fischstäbchen gefunden. Leckereien vom Grund des Meeres, nur echt mit der Goldkruste! Ob die neue Spezies, die US-Meeresforscher am 30. August im Golf von Alaska entdeckt haben, auch essbar ist, ist noch ungeklärt. Es könnte sich bei dem “goldenen Ei” oder dem “gelben Hut” um eine gänzlich neue Art oder ein unbekanntes Lebensstadium einer bestehenden Art handeln, da sind sich die Wissenschaftler noch nicht sicher.
“Die ersten Gedanken reichten von einem toten Schwammansatz über eine Koralle bis hin zu einer Eihülle”, teilten die Forscher selbst mit. Bis die Forschenden im Labor die Wahrheit über die neue, beinahe mystische Lebensform ans Licht bringen, sind der Fantasie aber keine Grenzen gesetzt: Ist es das Ei des Kolumbus oder ein Meeres-ALF? Hat der Organismus tatsächlich Gold eingelagert? Oder kann er so viel CO₂ speichern, dass wir mit seiner Züchtung den Klimawandel stoppen? Die Lösung ist vermutlich unspektakulärer, aber für einige Tage darf die Menschheit dank eines schlammigen goldenen Klumpens mal wieder träumen. Tim Gabel
manche Ereignisse sind derart raumgreifend, dass es schwerfällt, direkt zur alltäglichen Routine überzugehen: Dass es um Vorwürfe der Verschwendung von Steuergeldern geht, war seit dem Bericht des Bundesrechnungshofs im Februar bekannt. Dass die Staatsanwaltschaft München I gegen unbekannt bei Fraunhofer ermittelt, hatten wir selbst im März exklusiv berichtet. Doch als gestern Vormittag die Staatsanwaltschaft bestätigte, dass nun gegen frühere Vorstandsmitglieder der Fraunhofer-Gesellschaft ermittelt werde, genauer gegen “Prof. Dr. N., Prof. Dr. K. und Dipl.-Kfm. M. sowie gegen den Beschuldigten Prof. Dr. W.”, wurde das Ausmaß des Skandals noch einmal eindrücklich bewusst. Der Anfangsverdacht lautet: Untreue. In diesem Alert haben wir gestern die Informationen für Sie zusammengestellt.
Mit dem anhaltenden Krieg Russlands gegen die Ukraine verändert sich der Umgang mit Zivilklauseln und Wehrforschung an deutschen Hochschulen. Die frühere Forschungsministerin Annette Schavan (CDU) hat im Gespräch mit Table.Media zu einer aktiveren Kooperation geraten, um den Forschungsstandort nicht zu gefährden. Universitäten müssten die Diskussion um die Zivilklausel führen. “Wenn schon Zeitenwende”, sagte Schavan, “dann heißt das auch, technologisch etwas zu ändern”.
Besonders beschäftigt hat mich eine Äußerung der früheren Forschungsministerin, die 2008 das erste Programm zur zivilen Sicherheitsforschung einführte: An die intensiven Diskussionen zum Start von Ganzkörper-Scannern an Flughäfen erinnert, erklärt Schavan: “Wir waren davon überzeugt, von Freunden umgeben zu sein und dass die Welt peu à peu die Freiheit und die Demokratie entdecken würde. Leider hat es sich anders entwickelt.”
Gemeinsam mit meinem Kollegen Gabriel Bub habe ich die aktuelle Debatte um die Zivilklausel recherchiert.
Wir wünschen Ihnen eine gute Lektüre,

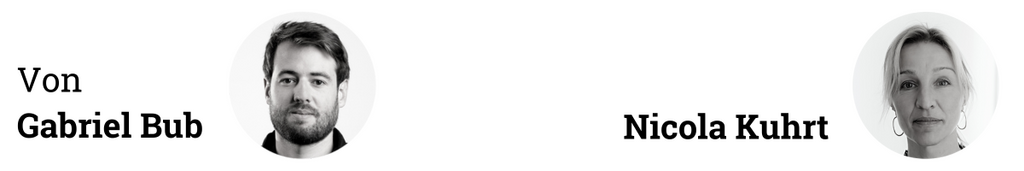
Vor dem Hintergrund des Krieges gegen die Ukraine und der Waffenlieferungen in Richtung Kiew gibt es in den Hochschulen zwar keine öffentlichen Diskussionen über eine Öffnung für militärisch nutzbare Forschung. Doch es mehren sich Stimmen, die eine neue Richtung fordern.
“Universitäten müssen die Diskussion um die Zivilklausel führen. Wenn schon Zeitenwende, wenn wir also sagen, wir müssen jetzt wieder fähiger und resilient werden, dann heißt das auch, technologisch etwas zu ändern. Und nicht nur in unserer Gedankenführung”, erklärt Annette Schavan (CDU), die als frühere Bundesforschungsministerin 2008 das erste zivile Sicherheitsforschungsprogramm einführte. “Meine Argumentation war und ist es bis heute: Wenn ich etwas nicht will, muss ich dennoch viel davon verstehen“, sagt Schavan. Weil man sonst irgendwann gar nicht mehr mitreden könne, und die eigene Forschungspolitik isoliere.
Wie stark sich die Zeiten geändert haben, fällt auf beim Blick zurück auf die damaligen Debatten, etwa zum Ganzkörper-Scanner am Flughafen, sagt Schavan. Dies sei aber in einer Stimmung erfolgt, die sie nie kleinreden würde: “Wir waren davon überzeugt, von Freunden umgeben zu sein und dass die Welt peu à peu die Freiheit und die Demokratie entdecken würde. Leider hat es sich anders entwickelt.”
Schavan merkt an, dass sie den Umgang mit der Zivilklausel schon 2008 nicht konsequent fand. “Angesichts dessen, was wir aktuell erleben, gilt das einmal mehr: Wir können uns nicht vornehm zurückhalten”, sagt Schavan. “Es geht um uns, es geht um Erkenntnisse, Erkenntnisfortschritt, den man nicht einfach als unverantwortlich oder unethisch abtun darf.”
Der erste in der Wissenschaftscommunity, der laut forderte, die Zivilklausel an Hochschulen zu überdenken, war Jan Wörner, Präsident der Akademien der Technikwissenschaften (acatech). “Frieden braucht moderne Verteidigung”, erklärte er bereits im vergangenen Jahr. Die bestehenden Regeln sollten im Sinne einer friedenssichernden Forschung kritisch überarbeitet werden. Die Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) kritisierte derweil die mangelnden Synergien zwischen militärischer und ziviler Forschung. Ihr Vorsitzender Uwe Cantner fordert eine Lockerung der Klauseln.
Aus dem Verteidigungsministerium (BMVg) kommt die Aufforderung eines Umdenkens in Sachen Zivilklausel. “Die Angehörigen der Bundeswehr dienen dem Frieden und unserem Schutz. Sie haben ein Anrecht auf die bestmögliche Ausrüstung und somit auch auf universitäre Forschung und Entwicklung in unserem Land”, erklärt eine Sprecherin. “Zivilklauseln sind aus dieser Sicht eine Einschränkung der Freiheit von Lehre und Forschung.”
Für das BMVg sei die Kooperation mit Universitäten eine kostengünstige Möglichkeit, Ausrüstungsentscheidungen zu prüfen, “den Stand der Forschung in den einzelnen Fachdisziplinen durch Integration in die Forschungslandschaft abzugleichen und zu erweitern”, wie eine Sprecherin auf Anfrage mitteilt. Weiterer Nebeneffekt: Das Ministerium kann sich und die Forschungseinrichtungen des Bundes für den studentischen Nachwuchs bekannter machen.
Neben den Bundeswehruniversitäten in Hamburg und München kooperiere das Verteidigungsministerium zur wehrtechnischen Forschung mit mehreren Universitäten, darunter Koblenz, Duisburg, Erlangen, Siegen, Hannover und Braunschweig. Wozu konkret, will das Ministerium mit Verweis auf “eingestufte Informationen” nicht sagen. Nur, dass die Kooperationen mit Universitäten – einschließlich Kooperationen im medizinischen Bereich – jährlich einen einstelligen Millionenbereich kosten. Vergleichsweise wenig Geld.
Deutsche Rüstungskonzerne halten sich bedeckt. Die Panzerbauer Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann, begründen dies mit “der strategischen Bedeutung für die Forschung und Entwicklung des Unternehmens”. Auch die Fraunhofer-Institute, die im Verbund Verteidigungs- und Sicherheitsforschung (VVS) forschen, wollen zu Fragen, die “potenziell sicherheitskritische Forschungsbereiche betreffen”, nichts sagen.
Und die Hochschulen selbst? Hier zeichnet sich ein wechselhaftes Bild. Viele haben Zivilklauseln in ihren Grundordnungen oder Leitbildern festgeschrieben oder in einem Senatsbeschluss verankert. Die meisten der derzeit bestehenden rund 75 Zivilklauseln entstanden in der den frühen 2010er Jahren.
Während viele Häuser wie die Uni Bremen oder Bonn auf ihre bestehende Zivilklausel verweisen, deuten andere auf Probleme hin. Genannt werden möchten sie nicht. Die Umsetzung der Zivilklausel selbst sei kaum möglich. Es fehlten vernünftige Kriterien zur Beurteilung von Forschungsprojekten. Zudem wird die Einhaltung der Auflagen kaum kontrolliert. Die Zivilklausel sei doch “mausetot”, fasste es Joachim Krause vom Institut für Sicherheitspolitik der Universität Kiel einmal ganz deutlich zusammen.
Mit Blick auf Forderungen aus der Politik, Zivilklauseln generell zu streichen, erklärt Walter Rosenthal, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz auf Nachfrage, dass diese im deutschen Hochschulsystem nicht die Regel seien. Dort, wo es sie gebe, handle es sich um institutionelle, die Forschungsfreiheit der einzelnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aber rechtlich nicht beschränkende Selbstverpflichtungen, an der jeweiligen Hochschule prinzipiell für friedliche Zwecke zu forschen. Der HRK-Präsident betonte, dass die wichtigste Funktion entsprechender Klauseln die “kontinuierliche Einladung zur wissenschaftsethischen Reflexion über mögliche Folgen der eigenen Forschung” sei.
Auf eben diese verweisen auch die Deutsche Forschungsgemeinschaft und die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina in ihren gemeinsamen Empfehlungen zum Umgang mit sicherheitsrelevanter Forschung: Das Risiko möglicher missbräuchlicher Verwendung von Forschungsergebnissen gegenüber den Chancen abzuwägen, stelle besondere Anforderungen an die Verantwortung und Selbstkontrolle Forschender, heißt es. Diese gelte für alle Bereiche der Forschung und sei in Zeiten globaler Aufrüstung besonders anspruchsvoll.
Ein Sprecher der Universität der Bundeswehr München berichtet, man nehme derzeit eine höhere Akzeptanz der Wehrforschung wahr. Das sei rein subjektiv und nicht durch Daten belegbar. Wie die Wehrforschung aber weitermachen sollte, könne nur “durch das Zusammenspiel von Politik und Industrie beantwortet werden”.
Wer demnächst das KI-System ChatGPT für seinen Betrieb nutzen will, könnte durch den derzeit geplanten EU AI Act hart ausgebremst werden. “Wenn es mit der Gesetzgebung ganz schlecht läuft, dann zieht ein simpler Kundendialog mithilfe eines Chatbots einen Rattenschwanz von Dokumentations- und Auskunftspflichten nach sich, der jede Innovation abwürgt”, sagt Aljoscha Burchardt, Principal Researcher am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Berlin.
Im Mai warnten 150 Chefs europäischer Tech-Unternehmen in einem offenen Brief vor dem Gesetz. In seiner jetzigen Form gefährde es die KI-Zukunft Europas: Es bürde der Wirtschaft enorme Haftungsrisiken und Compliancekosten auf, erzwinge die Auslagerung innovativer Firmenteile in Länder außerhalb der EU und schrecke Investoren ab. Die Problematik besteht weiterhin.
“Beim Internet hat Europa viel verschlafen, das darf uns mit KI nicht noch einmal passieren”, mahnt Gerard de Melo, Professor am Hasso-Plattner-Institut und an der Universität Potsdam. Um die besten Köpfe und Start-up-Gründer auf dem Kontinent zu halten, sei ein flexibler Rechtsrahmen wichtig. “Die USA als Weltmeister der KI, Europa als Weltmeister der KI-Regulierung”, zitiert Philipp Hacker, Rechtswissenschaftler an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder), ein Spötterwort. “Die Gefahr ist real, aber wir sollten und können sie abwenden.”

Für die Optimierung des EU AI Acts bleiben noch gut drei Monate Zeit. Anfang Juni hat das Europaparlament seine Position zum Gesetz verabschiedet. Seither wird der Text im sogenannten Trilog mit der EU-Kommission und den Mitgliedsstaaten abgestimmt. Bis zum Jahresende soll eine Einigung gefunden werden, damit das Regelwerk mit Beginn des neuen Jahres offiziell in Kraft treten kann. Anschließend haben die Unternehmen etwa zwei Jahre Zeit, um sich an die neuen Rahmenbedingungen anzupassen. Dann gilt das Gesetz auch in der Praxis.
Auf welche Änderungen kommt es in jetzt an? Jörg Bienert, Präsident des KI-Bundesverbands, plädiert zunächst für eine engere Definition von KI: “Derzeit fällt praktisch jede Software unter den Begriff, was ihre Entwicklung und Anwendung mit vielen neuen Vorschriften belastet.” Gleiches gelte für die Einstufung von Basismodellen wie ChatGPT als Hochrisikoanwendung. Die Modelle sind so gut wie die Daten, mit denen sie regelmäßig neu trainiert werden. Bienert: “Wenn das aber jedes Mal einen Wust an Bürokratie nach sich zieht, wie für Hochrisikoanwendungen typisch, erlahmt der Innovationselan.” Für das KI-Gesetz bedeutet das auch: Basismodelle sollten nur dann als hochriskant eingestuft werden, wenn sie für entsprechend heikle Tätigkeiten eingesetzt werden – und nicht bloß zur Gestaltung von Geburtstagskarten oder für die Praxisorganisation beim Arzt.
DFKI-Forscher Aljoscha Burchardt plädiert für eine schlanke, agile Regulierung: “Das Gesetz sollte nicht alle Probleme auflisten, die passieren könnten. Es sollte aber dafür sorgen, dass wir, wenn etwas passiert, wenn die KI tatsächlich Probleme macht, Gewehr bei Fuß stehen.”
Über Deutschlands Abschneiden im weltweiten KI-Rennen entscheiden nicht allein Rechtsfragen. “Wir haben eine gute Basis in der KI-Forschung”, lobt Jörg Bienert. “Es mangelt bei uns jedoch an Praxistransfer, an Mut und Investitionsbereitschaft, was die Voraussetzungen für disruptive Entwicklungen à la ChatGPT sind.” Das Potenzial von KI sei gewaltig und reiche von neuen Produkten und Dienstleistungen bis hin zur Umwälzung des gesamten Arbeitsmarktes. Ausschöpfen lasse es sich mithilfe eines KI-Hochleistungsrechenzentrums, wo unter anderem große, vertrauenswürdige Basismodelle made in Germany trainiert werden könnten. Den Weg dorthin skizziert der KI-Bundesverband in seiner Machbarkeitsstudie “Große KI-Modelle für Deutschland”. Bienert: “Für das neue Zentrum brauchen wir staatliche Investitionen von 300 bis 400 Millionen Euro, was im Vergleich zu den 10 Milliarden für Intel bescheiden ist.” Gerechtfertigt sei die Investition allemal, schließlich gehe es um die digitale Souveränität Deutschlands und Europas.
Ob Google, Microsoft und Co. sich einholen lassen, darf bezweifelt werden. Auf Anhieb erfolgversprechend wirken jedoch Spezialanwendungen, etwa für Medizin, Verwaltung oder Industrie, die auf europäischen und überseeischen Big-Tech-Konzernen nicht zur Verfügung stehenden Daten basieren. “Hier sehe ich große Chancen für kleine und mittlere Unternehmen”, sagt Philipp Hacker. KMU seien häufig die Innovationstreiber im KI-Bereich und verdienten massive öffentliche Unterstützung.
Entscheidend sei am Ende ein innovationsfreundliches, unbürokratisches KI-Ökosystem, sagt Gerard de Melo. “Weil es das in den USA und in Kanada gibt, geht die gründungswillige KI-Welt heute vor allem dorthin.” Um Europa für die wählerische Klientel attraktiver zu machen, müsse man an vielen Schrauben drehen. Eine davon heißt den nächsten Wochen: EU AI Act.
Die Texte der Table.Media-Serie “Der globale Wettlauf um Künstliche Intelligenz” finden Sie hier.
Was erwarten Sie von der Ampel-Koalition in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode?
Mit dem Start der Haushaltsberatungen des Bundestages geht die Regierungszeit der Ampel-Koalition in die zweite Hälfte. Welche politischen Themen sollte die Bundesregierung in den kommenden Monaten anpacken, in welchen Politikfeldern erwarten Sie Einigungen? Diese und andere Fragen zur Zukunft der Ampel – aber auch zur Bewertung der ersten Hälfte der Legislatur und der Leistungen der Ministerinnen und Minister – stellt Table.Media in einer Umfrage. (Jetzt an Umfrage teilnehmen)
12. September 2023, 16:30 Uhr, Berlin Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Einstein-Saal, Jägerstraße 22, 10117 Berlin / Online
Diskussion ChatGPT und Co. in der Forschung Mehr
14. September 2023, 11:00 Uhr, WZB, Reichpietschufer 50, 10785 Berlin
Diskussion Junge Wissenschaft trifft Politik – mit Lisa Paus Mehr
27. September 2023, Hauptstadtrepräsentanz der Deutschen Telekom AG, Berlin
Tagung Helmholtz-Jahrestagung 2023 Mehr
27.-29. September 2023, Freie Universität Berlin
Gemeinsame Konferenz der Berliner Hochschulen Open-Access-Tage 2023 “Visionen gestalten” Mehr
28. September 2023, 18-21.30 Uhr, Medizinhistorisches Museum Berlin
Diskussionsveranstaltung der Arbeitsgruppe “Hochschulen als MINT-Innovationsmotor” im Nationalen MINT Forum Any other subject: Wie die Erweiterung des MINT-Begriffs neue Zielgruppen erschließt Mehr
1.-10. November 2023, Berlin
Wissenschaftsfestival Berlin Science Week Mehr
7.-9. November 2023, Berlin
Konferenz Falling Walls Science Summit 2023 Mehr
16. November 2023, Wilhelm Büchner Hochschule, Darmstadt
Tagung WBH Wissenschaftsforum 2023 – “Transformation gestalten” Mehr
In den ersten 20 Monaten ihrer Regierungsarbeit hat die Ampel-Koalition bereits knapp zwei Drittel (64 Prozent) ihres sehr ambitionierten Koalitionsvertrages entweder umgesetzt (38 Prozent) oder mit der Umsetzung begonnen (26 Prozent). Das BMBF liegt mit rund einem Drittel umgesetzter und einem Viertel begonnener Vorhaben jedoch unter dem Durchschnitt der Ministerien. Das ist das Ergebnis einer gemeinsamen Studie der Bertelsmann Stiftung, der Universität Trier und der Berliner Denkfabrik Progressives Zentrum.
Zur Einordnung: Insgesamt hatte sich die aktuelle Regierung deutlich mehr vorgenommen als die Koalitionen zuvor. Im Bereich Bildung und Forschung gab es 29 Vorhaben, die sechs Prozent am Gesamtprogramm der Ampel ausmachen. Im Jahr 2018 betrug der Anteil nur vier Prozent. Von den 29 Versprechen waren 25 sogenannte Änderungsversprechen und vier Status-quo-Versprechen.
Eingelöst wurden beispielsweise die Versprechen über zusätzliche Mittel für die Exzellenzstrategie, die weitere Unterstützung und Dynamisierung des Pakts für Forschung und Innovation und die Erhöhung der institutionellen Förderung von DAAD und Alexander von Humboldt-Stiftung.
Als “angegangen” werten die Autoren das Forschungsdatengesetz und das Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Hier lägen Entwürfe vor, es gebe aber noch keinen klaren Zeitplan für die Verabschiedung der Gesetze.
Noch nichts Konkretes gibt es zum Bund-Länder-Programm zur Förderung von alternativen Karrieren außerhalb der Professur, beim Diversity-Management und im Bereich moderne Governance-, Personal- und Organisationsstrukturen. Auch von der Plattform zur Rekrutierung von internationalen Spitzen-Wissenschaftlern fehlt noch jegliche Spur.
Interessant ist, dass die Autoren die Umsetzung der Dati mit der Einrichtung der Geschäftsstelle beim BMBF und der Veröffentlichung der Pilotförderrichtlinie als vollständig erfüllt erachten. Das dürften Kreise jenseits des BMBF anders sehen. Auch dass die Einberufung eines Bildungsgipfels als vollzogen gilt, obwohl von einem Gipfel kaum die Rede sein konnte, zeigt die Schwachstellen der Studie.
Beim BMWK steht die für den Herbst angekündigte Raumfahrtstrategie noch aus. Bereits seit einem Jahr veröffentlicht ist hingegen die Start-up-Strategie. Im Bereich Gesundheit hat das BMG die Digitalisierungsstrategie bereits fertiggestellt – in Verbindung damit angegangen wurden das Gesundheitsdatennutzungsgesetz, Registergesetz und die elektronische Patientenakte (ePA).
Die Wahrnehmung der Bürger hingegen widerspricht dem Ergebnis der Recherche. Wohl durch den vermehrten Streit in der Regierung als auch die schlechte Kommunikation denkt über die Hälfte der Bevölkerung, dass die Ampel nur einen kleinen Teil oder kaum Versprechen umgesetzt habe. Das ergab eine parallel zu der Recherche durchgeführte Umfrage des Allensbach-Instituts im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung. mw
Die komplette Bewertung der Umsetzung der Vorhaben im BMBF sehen Sie hier.
Rund ein Jahr nachdem die Bundesregierung die Start-up-Strategie beschlossen hat, gehen die Meinungen über Erfolg und Fortschritt des Vorhabens auseinander: Unternehmen hatten mehr erwartet, das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) hingegen ist zufrieden. Mehr als 40 Prozent der rund 130 Maßnahmen seien bereits umgesetzt, heißt es im ersten Fortschrittsbericht. Überdies seien 50 Prozent der Maßnahmen angestoßen und zehn Prozent noch nicht gestartet. Das Dokument wird am heutigen Dienstag vorgestellt, Auszüge daraus wurden am Montag vorab bekannt. Als “Meilenstein” bezeichnet Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in einem Bericht des Handelsblatts beispielsweise das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das die Anwerbung von Talenten aus dem Ausland deutlich vereinfachen soll.
Ziel der Ende Juli 2022 beschlossenen Strategie ist es, Start-up-Ökosysteme in Deutschland und Europa zu stärken. Zu den zehn Handlungsfeldern, denen die insgesamt 130 Maßnahmen zugeordnet sind, zählt, die Finanzierung zu stärken, Ausgründungen aus der Wissenschaft zu vereinfachen und Start-ups den Zugang zu Daten zu erleichtern.
Etwas schneller und deutlich kritischer haben Wirtschaftsverbände Bilanz gezogen. Ende Juli erhielt die Politik vom Digitalverband Bitkom lediglich die Note “ausreichend” für das erste Jahr Start-up-Strategie. Die Note resultiert aus einer Befragung von 203 Tech-Start-ups im Auftrag des Verbands, bei der lediglich ein Prozent der Befragten die Leistung für “sehr gut” hielten und sechs Prozent die Note “gut” gaben. “Das Tempo bei der Umsetzung der Vorhaben muss in der zweiten Hälfte der Legislatur erhöht werden”, sagte Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst.
Mehr Tempo mahnte auch der Start-up-Verband in seiner ausführlichen Bilanz der Strategie an. “Die Bundesregierung muss Start-up-Themen mit mehr Priorität vorantreiben – die nächsten 12 Monate sind zur Umsetzung der Startup-Strategie entscheidend”, sagte Christian Miele, Vorstandsvorsitzender des Verbands. Von der Bundesregierung wünsche er sich außerdem insgesamt mehr Fokus auf Zukunftsthemen.
Im Handlungsfeld “Ausgründungen aus der Wissenschaft” begrüßt der Verband grundsätzlich den neuen Wettbewerb der Start-up-Factories, in deren Rahmen fünf bis zehn exzellenzorientierte Projekte gefördert werden. Kritisiert wird das drohende Auslaufen des Programms Exist Potentiale. Der Verband warnt vor einem Zerbrechen der über Jahre aufgebauten Strukturen. “Insgesamt sollte dem Thema wissensbasierter Ausgründungen, auch wenn es sich dabei oft um technische Fragestellungen handelt, deutlich mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden”, heißt es. Das sei erforderlich, um das “herausragende Potenzial unserer Forschungslandschaft noch besser nutzen können”. abg
Bei der Reformierung der Projektträger und der Projektförderung will das BMBF weiter auf einen kontinuierlichen Austausch setzen, sieht aber nach Veröffentlichung des Positionspapiers der Projektträger keine Notwendigkeit für ein besonderes Dialogformat oder sofortige Maßnahmen. “Ein ,Werkstattgespräch’ zu diesem Themenkomplex ist seitens BMBF nicht geplant und auch nicht notwendig, da es institutionalisierte regelmäßige Austauschformate, die sich bewährt haben, bereits gibt, auch unter Einschluss der Projektträger”, teilte eine Ministeriumssprecherin mit.
Das BMBF reagierte mit der Mitteilung auf die Berichterstattung von Table.Media, nachdem die Bundesregierung eine langfristig angelegte Reform der Projektförderung in Deutschland plane. Der SPD-Bundestagsabgeordneter Holger Becker hatte im Gespräch mit Table.Media gesagt, dass das BMBF im vierten Quartal ein gemeinsames Werkstattgespräch mit Berichterstattern der Regierungsparteien und Vertretern von Projektträgern vereinbart habe. Das Ministerium verneinte dies nun.
Die Projektträger des Ministeriums seien ohnehin mit ihrer Expertise in den Vereinfachungs-, Verbesserungs- und Digitalisierungsprozess eng eingebunden. “Das aktuelle Papier des PT-Netzwerks ist ein Beitrag zu diesem regelmäßigen Dialog und wird auf der Fachebene zwischen BMBF und den vom BMBF beauftragten Projektträgern diskutiert werden”, sagte die Sprecherin. Soweit Erfahrungen neuer Instrumente eine Übertragung auf die Breite der Projektförderung nahelegen, werde dies nach positiver Evaluation berücksichtigt.
Das Netzwerk der Projektträger hatte in dem vor zwei Wochen erschienenen Positionspapier eine Flexibilisierung der Projektförderung gefordert. Die PT wollen erreichen, dass das Sprind-Freiheitsgesetz auch für sie gilt. Konkret hatten sie die Bundesregierung aufgefordert, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Auswahlverfahren schlanker und die Fachaufsicht sowie die Finanzierungsbedingungen flexibilisiert werden.
Bei seiner Keynote auf der Eröffnungsveranstaltung der Hauptstadt-Dependance des DLR Projektträgers am vergangenen Donnerstag vermied BMBF-Staatssekretär Mario Brandenburg konkret zu einzelnen Forderungen Stellung zu beziehen oder Zusagen an die Projektträger zu machen. Der EFI-Vorsitzende Uwe Cantner erneuerte dort seine Forderung, dass das Innovationssystem in Deutschland eine Auffrischung brauche. Im Gespräch mit Table.Media hatte er sich bereits in der vergangenen Woche hinter die Forderungen der Projektträger gestellt. tg

Grenzen überwinden und Menschen mit unterschiedlichen Interessen zusammenführen: Darum sei es schon bei ihrem ersten Job gegangen, erzählt Andrea Frank. Bevor sie zum Stifterverband kam, war die gebürtige Rheinländerin Anfang der 2000er Jahre bei der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) unter anderem für Wissenschaftskooperationen in Südosteuropa zuständig. Nach den Umbrüchen und Jugoslawienkriegen des vorherigen Jahrzehnts war das Ziel, die Wissenschaftslandschaft in der Region grenzübergreifend zu stärken.
Am Shkodrasee an der Grenze zwischen Albanien und Montenegro brachte Frank Wissenschaftler aus beiden Ländern für ein gemeinsames Projekt zusammen, in einer Zeit, in der die beiden Nachbarländer kaum Kontakt zueinander hatten. “Damals habe ich gespürt, wie Wissenschaft starre Grenzen überwindet”, erinnert sich Frank.
So sieht die 51-Jährige auch ihre Aufgabe beim Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, dessen stellvertretende Generalsekretärin sie seit 2022 ist. Am Pariser Platz in Berlin sitzt Frank, an der “Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft”, wie sie sagt, koordiniert die programmatische Arbeit, tauscht sich mit Partnerorganisationen und Mitgliedern aus.
Rund 33 Millionen Euro im Jahr wendet der Stifterverband auf, finanziert aus den Beiträgen und Spenden seiner rund 3.500 Mitgliedsunternehmen und -stiftungen, aber auch aus öffentlichen Geldern. Ergänzend zu eigenen Initiativen in den Bereichen Wissenschaft und Bildung fördert er Hochschulen und Forschungseinrichtungen sowie aktuell mehr als 50 Stiftungsprofessuren.
Manche Wissenschaftsvertreter sehen diese Arbeit kritisch und befürchten eine übermäßige Einflussnahme der Wirtschaft auf die Forschung an Hochschulen. Die Anliegen einzelner Unternehmen oder Mitglieder umzusetzen, sei nicht die Idee des Stifterverbandes, entgegnet Frank. “Gemeinsam mit unseren Mitgliedern setzen wir uns ein für relevante Veränderungen im Bildungs- und Wissenschaftssystem und schauen auf die Anforderungen von Wirtschaft und Gesellschaft insgesamt.”
Eines dieser Kernanliegen ist in ihren Augen, im Angesicht des gesellschaftlichen Wandels schnell ausreichend Menschen mit den richtigen Kompetenzen auszubilden. “Exzellente Forschung und bedarfsorientierte Ausbildung müssen nicht im Widerspruch stehen”, sagt Frank. Es sei dennoch oft schwierig, dieses Spannungsfeld zu überwinden. “Weltweit verändern sich Schulen und Hochschulen rasant. Wir müssen Traditionen überwinden und schnell neue Perspektiven für das Lernen entwickeln, um den Bedarf zu decken. Dies passiert schon lange nicht mehr ausschließlich in staatlichen Bildungsinstitutionen.”
Immer wieder kommt Frank auf Themen zu sprechen, bei denen ihr vor allem auf staatlicher Seite Kooperationsbereitschaft und Schnelligkeit fehlen: Lehrkräftebildung, außerschulische Mint-Bildung, Gründungskultur oder digitale Lehre an Hochschulen – die Liste ist lang.
Mit Blick auf die sinkenden Ressourcen in den nächsten Jahren, meint Frank zum Schluss, könnte es gerade diese Knappheit sein, die die Kooperationsbereitschaft staatlicher, aber auch privater Akteure vergrößert und notwendige Reformen möglich macht. Manchmal braucht es offenbar den Anstoß von außen, um eine Grenze zu überwinden. Frank spricht hier aus Erfahrung. Valentin Petri
Peter Britz wird neuer Präsident der Hochschule Weserbergland in Hameln. Er wechselt von der Hochschule Hamm-Lippstadt, wo er Professor für Technisches Umweltmanagement war und den Fachbereich 2 geleitet hat.
Derek von Krogh ist der neue Künstlerische Direktor und Geschäftsführer der Popakademie Baden-Württemberg in Mannheim. Er folgt auf Udo Dahmen, der diese Funktion seit 2003 innehatte.
Friederike Otto, Klimaforscherin am Imperial College London und Mitgründerin der Initiative World-Weather-Attribution, erhält den diesjährigen Deutschen Umweltpreis der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Sie teilt sich die mit 500.000 Euro dotierte Auszeichnung mit der Holzbau-Unternehmerin Dagmar Fritz-Kramer, Geschäftsführerin des Allgäuer Familienbetriebs Bau-Fritz GmbH & Co.KG. Überreicht wird der Preis am 29. Oktober in Lübeck von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.
Peer Schmidt wurde als Vizepräsident für Studium und Lehre an der BTU Cottbus-Senftenberg wiedergewählt. Er leitet dort das Fachgebiet Anorganische Chemie. Seine erste Amtszeit als Vizepräsident trat er 2020 an.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!
Europe.Table. Big Tech-Lobbybudget von 40 Millionen. Die zehn größten Digitalkonzerne – darunter Meta, Google, Apple, Microsoft und Amazon – sind mit einem Lobbybudget von 40 Millionen Euro für mehr als ein Drittel der Lobbyausgaben des Sektors in Brüssel verantwortlich. Mehr.
Security.Table. BAE Systems strebt Prototyp von Überschallkampfflugzeug bis 2027 an. Die Partner des britisch-italienisch-japanischen Global Combat Air Programme (GCAP) haben sich für den Bau eines neuen Kampfjets ehrgeizige Ziele gesetzt: Die Konzeptphase soll bis Ende 2025 abgeschlossen sein, ein Prototyp 2027 abheben und das Überschallkampfflugzeug der neuesten Generation 2035 auf den Markt kommen. Mehr.

In der TV-Werbung hat sich Captain Iglo früher auf Schatzsuche begeben und am Ende eine Truhe mit gold-braunen Fischstäbchen gefunden. Leckereien vom Grund des Meeres, nur echt mit der Goldkruste! Ob die neue Spezies, die US-Meeresforscher am 30. August im Golf von Alaska entdeckt haben, auch essbar ist, ist noch ungeklärt. Es könnte sich bei dem “goldenen Ei” oder dem “gelben Hut” um eine gänzlich neue Art oder ein unbekanntes Lebensstadium einer bestehenden Art handeln, da sind sich die Wissenschaftler noch nicht sicher.
“Die ersten Gedanken reichten von einem toten Schwammansatz über eine Koralle bis hin zu einer Eihülle”, teilten die Forscher selbst mit. Bis die Forschenden im Labor die Wahrheit über die neue, beinahe mystische Lebensform ans Licht bringen, sind der Fantasie aber keine Grenzen gesetzt: Ist es das Ei des Kolumbus oder ein Meeres-ALF? Hat der Organismus tatsächlich Gold eingelagert? Oder kann er so viel CO₂ speichern, dass wir mit seiner Züchtung den Klimawandel stoppen? Die Lösung ist vermutlich unspektakulärer, aber für einige Tage darf die Menschheit dank eines schlammigen goldenen Klumpens mal wieder träumen. Tim Gabel
