Endspurt in Sachen Wissenschaftszeitvertragsgesetz: Mit der 1. Lesung des Gesetzesentwurfs beginnt am morgigen Mittwoch nach zahllosen Stakeholder-Dialogen und Debatten der parlamentarische Prozess. Mein Kollege Tim Gabel hat mit Parlamentariern der Koalition, Beschäftigten-Initiativen und Gewerkschaften über ihre Erwartungen gesprochen. Dabei kristallisiert sich heraus: auch der zweite Vorschlag des BMBF zur Befristungshöchstdauer in der Postdoc-Phase, die “4 + 2-Regelung” wird wohl keinen Bestand haben. Stattdessen bevorzugen die Ampelparteien vermutlich eine teilweise Lockerung der Tarifsperre.
Diese ganz abzuschaffen, fordert hingegen die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft GEW. In seinem Standpunkt für diese Ausgabe fasst Andreas Keller, stellvertretender Vorsitzender und Hochschulexperte der GEW, seine Positionen und Forderungen exklusiv zusammen, bevor sie in einem Positionspapier zum Start der Parlamentsdebatte am Mittwoch veröffentlicht werden soll. Dass die Zeit für Maximalforderungen abgelaufen ist, meint dagegen die Berichterstatterin der Grünen, Laura Kraft. Im Interview mit dem Research.Table zur WissZeitVG-Novelle äußert sie sich zur Rolle der Grünen als Mediator in der Debatte. Die Konfrontation sucht Kraft dagegen beim Thema Bund-Länder-Programm für mehr Dauerstellen. Sie wirft dem BMBF “Uninspiriertheit” und “Unwillen” vor. Mit dem Bericht des Ministeriums an den Haushaltsausschuss könne man “nichts anfangen”.
Schadet das BMBF mit seiner Fördermittelaffäre dem Wissenschaftsstandort Deutschland nachhaltig? Die Frage kann man sich nach der Lektüre des aktuellen Jahresberichts der Organisation “Scholars at Risk” stellen. Im “Free to Think“-Report der Initiative – einem internationalen Netzwerk von über 650 Hochschuleinrichtungen in mehr als 40 Ländern, das sich für den Schutz von gefährdeten Forschenden und Studierenden einsetzt – wird die Affäre als bedenkliche Entwicklung in Deutschland eingestuft. Meine Kollegin Anne Brüning hat mit Lars Lott gesprochen, der den Academic Freedom Index mit erarbeitet und mit BBAW-Präsident Christoph Markschies. Er beobachtet das Thema als Kuratoriumsmitglied des BMBF-Wissenschaftsjahres “Freiheit” ganz genau.
Kommen Sie gut in diesen Dienstag,

Die Novelle des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG) kommt am morgigen Mittwoch auf die Tagesordnung des Parlaments. Der “Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Befristungsrechts für die Wissenschaft” wird am morgigen Mittwoch in 1. Lesung verhandelt. Das Bundeskabinett hatte am 27. März 2024 den Gesetzentwurf zur Änderung des WissZeitVG beschlossen. Beschäftigten-Initiativen, Gewerkschaften und Opposition zeigten sich damals enttäuscht über das Papier.
SPD und Grüne hatten in den Kabinettsverhandlungen Ressortvorbehalte eingelegt. Im Disput mit dem FDP-geführten Forschungsministerium konnte man aber schließlich doch keine Änderungen bei der umstrittenen Höchstbefristungsdauer für Postdocs oder der Lockerung der Tarifsperre erwirken. Ein kürzlich erschienener BMBF-Bericht legt zudem nahe, dass auch das im Koalitionsvertrag vereinbarte Bund-Länder-Programm für mehr Dauerstellen neben der Professur in dieser Legislatur kaum noch Chancen hat.
Das Programm sollte das WissZeitVG flankieren und den Hochschulen neben den darin enthaltenen gesetzlichen Regeln zur Vermeidung von Kettenverträgen Anreize bieten, ihr System auf mehr Dauerstellen auszurichten. Das BMBF war per Maßgabebeschluss aus dem Haushaltsausschuss dazu aufgefordert worden, ein Konzept für das Programm zu erarbeiten. In der vergangenen Woche reichte das Ministerium seinen Bericht ein – allerdings ohne ein ausgearbeitetes Konzept und mit dem Hinweis, dass mit den Ländern keine Einigung in Sicht sei. Die Länder haben das inzwischen auf Anfrage von Table.Briefings bestätigt und begründet.
Die parlamentarische Debatte wird nun also Aufschluss darüber geben, wie weitgehend die Regierungskoalition ihre Versprechen aus dem Koalitionsvertrag einhalten wird. Das BMBF hatte deutlich gemacht, dass man bei den umstrittenen Punkten wenig kompromissbereit ist. Grüne und SPD stehen vor dem Dilemma, dass man, um etwas vorweisen zu können, die Novelle zwar unbedingt verabschieden will, sie in der jetzigen Form von Gewerkschaften und Beschäftigten-Initiativen allerdings nicht als Verbesserung, sondern eher als Verschlechterung angesehen wird.
Bei der SPD zeigt man sich trotzdem zuversichtlich: “Ich freue mich, dass wir jetzt nach langer Zeit endlich das parlamentarische Verfahren aufnehmen können. Die Beschäftigten an den Hochschulen warten darauf, dass wir deutliche Verbesserungen am Gesetz vornehmen werden”, sagt Berichterstatterin Carolin Wagner auf Anfrage von Table.Briefings. Der Kabinettsentwurf enthalte bereits spürbare Verbesserungen. “Wir erwarten jetzt, dass wir auch in der Postdoc-Phase die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stärken werden.” Ganz sicher werde man über “den Sinn und Unsinn der Tarifsperre” sprechen müssen.
Nachdem Bundesministerin Bettina Stark-Watzinger in ihrem Zuleitungsschreiben an das Bundeskabinett einen Zusammenhang zwischen der Regelung der Postdoc-Phase und der Ermöglichung tariflicher Vereinbarungen hergestellt habe, “bin ich durchaus zuversichtlich, dass wir auch die Koalitionspartner an unserer Seite haben”. Mit Blick auf das Bund-Länder-Programm springt Wagner ihren Regierungskollegen aus dem BMBF zur Seite: “Dass die Länder die ausgestreckte Hand des Bundes für ein Bund-Länder-Programm nicht ergriffen haben, ist bedauerlich und irritierend zugleich.” Das Vorhaben sei zu wichtig, als dass man es nicht weiter verfolgen sollte.
Nach Stephan Seiter, Berichterstatter der FDP, soll die WissZeitVG-Novelle nicht zur “Verschlimmbesserung” werden, die viele zum Beispiel in der Kürzung der Postdoc-Höchstbefristung erkennen würden. “Die “4+2”-Regelung findet daher keine Unterstützung mehr“, sagt Seiter Table.Briefings. Die Jahresformel, die das FDP-geführte BMBF in seinen Referentenentwurf geschrieben hatte, ist damit vermutlich schon vor Beginn der Bundestags-Debatte Geschichte. Die Komplexität des Wirkbereichs der WissZeitVG-Novelle berge große Risiken, das Wissenschaftssystem auf einen Schlag zu überfordern, warnt Seiter weiter. Das wolle die Koalition vermeiden: “Wir schauen jetzt gemeinsam, was noch geht.”
Mit Blick auf die parlamentarische Debatte erneuerten auch die Beschäftigten-Initiativen noch einmal ihre Forderungen: “Für die WissZeitVG-Reform wurden verlässliche und planbare Karrierewege versprochen. Ohne die ist die deutsche Wissenschaft als Arbeitsort nicht attraktiv – in Zeiten des Fachkräftemangels ist das fatal”, sagt Amrei Bahr von der Initiative #IchbinHanna. Es sei umso dringender, dass die Versprechen der Regierung eingehalten werden: “Mit Anschlusszusage nach zwei Jahren und Befristungshöchstquote. Wir sind zuversichtlich, dass das Parlament die Relevanz dieser Maßnahmen für den Wissenschaftsstandort und seine Beschäftigten sieht und sich entsprechend positioniert.”
Elke Hannack, stellvertretende DGB-Vorsitzende, fordert, dass die Fraktionen im Bundestag jetzt die Chance nutzen müssen, das Befristungsunwesen in der Wissenschaft zu beenden. “Der Gesetzentwurf schafft das nicht und muss daher dringend nachgebessert werden. Wir brauchen Dauerstellen für Daueraufgaben in Lehre und Forschung und für Promovierende Verträge, die den tatsächlichen Promotionszeiten entsprechen”, sagt Hannack. Der DGB erwarte, dass der Gesetzgeber endlich die Tarifsperre für den Wissenschaftsbereich streicht – “ohne Wenn und Aber”.

Frau Kraft, seit Beginn der Legislatur laufen die Verhandlungen zur Novelle des WissZeitVG. Die letzte Chance auf Einigung in der Koalition gibt es im parlamentarischen Verfahren. Am Mittwoch geht’s los. Was sind Ihre Erwartungen?
Ich glaube, wir sind uns in der Koalition einig, dass wir eine Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes machen wollen und das Projekt nicht scheitern soll. Ich finde es gut, wenn wir das proaktiv wieder aufnehmen. Wir sollten das Ziel haben, das parlamentarische Verfahren jetzt zügig zum Abschluss zu bringen. Die Beschäftigten und die Wissenschaftsorganisationen brauchen Verlässlichkeit. Die Community ist inzwischen maximal verunsichert, weil keiner weiß, wie das Gesetz am Ende ausgestaltet sein wird. Alle wollen Klarheit haben und endlich eine Entscheidung von uns.
Ihre SPD-Kollegin Carolin Wagner hat noch deutlichen Änderungsbedarf am Kabinettsentwurf angemeldet. Auch Ihre Partei hat nur unter Vorbehalt zugestimmt. Aus dem Ministerium war zum Schluss aber kein Signal zum Kompromiss mehr zu vernehmen. Was macht Sie optimistisch, dass man sich jetzt schnell einigen kann?
Man muss ehrlich sein: Es sind fast alle Argumente ausgetauscht. Der Prozess war bereits sehr lang und hat etliche Stellungnahmen produziert. Ich finde es wichtig, dass das, worauf wir uns einigen konnten, auch Gesetz wird. Denn auch in der jetzigen Version des Gesetzentwurfs stehen Verbesserungen für die Beschäftigten. Darüber hinaus wollen wir noch ein paar Punkte einbringen. Das war eine Bedingung bei der Kabinettsentscheidung. Das BMBF hat das zugesichert und es ist thematisch ausdifferenziert worden. Die Tarifsperre ist ein Bereich, den wir uns nochmal im Detail anschauen wollen, aber nicht der einzige. Diese Detailarbeit werden wir im parlamentarischen Verfahren angehen.
Die FDP ist inzwischen ganz von der Anschlusszusage in der Postdoc-Phase abgerückt, die SPD bleibt bei der Forderung nach der “2 + 4-Regelung”. Kommt den Grünen die Rolle des politischen Mediators zu?
Wir sind an einer praxistauglichen und funktionierenden Lösung interessiert. Es können sich alle in ihren Maximalforderungen ergehen, aber dann kommen wir nicht zu einer Gesetzesänderung. Die FDP hat im Mai geäußert, dass sie selbst nicht mehr von der “4 + 2-Regelung” überzeugt ist, was die Befristungshöchstdauer in der Postdoc-Phase angeht. Es gibt keine Gruppe mehr – von den Beschäftigten, über die Verbände bis hin zu den Hochschulleitungen – die das einen sinnvollen Weg finden. Es muss eine Alternative her. Politische Formelkompromisse funktionieren nicht. Das haben wir schon an den Eckpunkten gesehen, die zurück in die sogenannte “Montagehalle” mussten. Und beim Gesetzesentwurf des BMBF sehen wir es wieder.
Damit müsste das Ministerium zum zweiten Mal von einer Befristungshöchstdauer abrücken, die das Haus selbst vorgeschlagen hat und es bleibt bei den sechs Jahren des bisherigen Gesetzes?
Für uns als Grüne ist klar, dass mit uns keine Gesetzesreform zu machen ist, dass die Situation der Beschäftigten verschlechtern würde, sondern wir wollen strukturelle Verbesserungen erreichen. Aber es muss ein Gesetz sein, was in der Praxis funktioniert, was stimmig ist, was gute Rahmenbedingungen schafft und die Wissenschaft letzten Endes nicht noch behindert. Dazu gehören verbesserte Beschäftigungsverhältnisse und planbare und gute Karrierewege. Deswegen diskutieren wir jetzt schon so lange über das WissZeitVG.
Wie könnte ein praxistauglicher Kompromiss – mit Blick auf die Tarifsperre – am Ende aussehen? Die Länder warnen vor einem “Regelungs-Flickenteppich”.
Man muss die Tarifsperre nicht ganz streichen oder komplett bestehen lassen. Man kann sie zum Beispiel für einzelne Bereiche öffnen, die man definiert und begrenzen kann – etwa für die Befristungsdauer, die Vertragslänge oder aber die Anzahl an Verträgen. Man muss sich en détail anschauen, welche Auswirkungen das in der Praxis hat. Diese Arbeit müssen wir jetzt im parlamentarischen Verfahren erledigen. Uns ist darüber hinaus auch wichtig, dass die Intention des Gesetzgebers, also mehr Dauerstellen für Daueraufgaben, in der Gesetzesbegründung nochmal deutlicher herausgearbeitet wird. Derzeit werden viele Spielräume, die das bestehende WissZeitVG bietet, nicht genutzt oder zum Nachteil der Beschäftigten ausgelegt. Da kommt es rechtlich gesehen auf jede Formulierung an.
Für mehr Dauerstellen neben der Professur sollte ein flankierendes Bund-Länder-Programm sorgen. Warum hat es die Ampel als so wichtig erachtet, dass es als Ergänzung zum WissZeitVG in den Koalitionsvertrag geschrieben wurde?
Das WissZeitVG kann nicht alle Probleme des Wissenschaftssystems lösen und wird allein keine einzige Dauerstelle schaffen. Wenn im Gesetz zum Beispiel eine Anschlusszusage vorgesehen ist, es aber keine zusätzliche Dauerstelle gibt, dann ist das wie eine Karotte vor der Nase, die man trotzdem nie erreichen kann. Das Bund-Länder-Programm wäre eine wichtige Brücke, um es Ländern und Hochschulen möglich zu machen, entsprechende Stellen zu schaffen. Deswegen ist es uns so wichtig, dass das Programm kommt. Wir haben diesen Konsens in den Koalitionsvertrag geschrieben und ihn mit einer Mehrheit aus der Mitte des Parlamentes im Haushaltsausschuss erneuert, als das BMBF per Maßgabebeschluss im Oktober 2023 verpflichtet wurde, ein Konzept dafür vorzulegen.
Das BMBF hat fristgerecht einen Bericht dazu vorgelegt. Sie waren in Ihrer ersten Reaktion darauf nicht gerade begeistert. Warum?
Das, was jetzt dem Haushaltsausschuss vorgelegt wurde, ist kein Konzept. Das ist eine Gesprächsnotiz, bestenfalls. Es ist eine Verschriftlichung der Uninspiriertheit und des scheinbaren Unwillens im Ministerium. Das muss ich einfach so beim Namen nennen. Die Bewertung obliegt jetzt zunächst dem Haushaltsausschuss, aber meine fachpolitische Einschätzung ist, dass man damit nicht arbeiten kann. Damit kann niemand etwas anfangen. Der einzige Vorschlag des BMBF ist ein Expertengremium, also die Gründung eines Arbeitskreises.
Das BMBF verweist auf den Wissenschaftsrat, der sich mit neuen Stellenkategorien neben der Professur beschäftigt. Reicht denn die Zeit in der Legislatur noch für ein Programm, wenn die Ergebnisse des Rates im Frühjahr 2025 erscheinen sollen?
Die Forderungen, für strukturelle Verbesserungen in der Wissenschaft zu sorgen und diese politisch zu flankieren, ist nicht neu. Die existiert nicht erst seit unserem Koalitionsvertrag. Der Wissenschaftsrat hat sich vor zehn Jahren schon einmal mit der Thematik befasst und tut es jetzt wieder. Darauf sollte man nicht warten. Das, was das BMBF macht – in dieser Legislatur in bekannter Manier – ist Bund-Länder-Ping Pong zu spielen. Wenn ein Ministerium die Situation für Beschäftigte verbessern und den Standort attraktiver machen will, muss es mehr tun, als ein paar Notizen als Konzept zu verkaufen. Das macht mich ehrlicherweise ein bisschen ratlos, denn man stampft ein solches Programm nicht mal so aus dem Boden.
Die letzte Chance wäre die Bereinigungssitzung für den Haushalt im November. Bislang finden sich dort kein Titel und keine Finanzmittel für ein Bund-Länder-Programm. Wird es Bestandteil der Verhandlungen sein?
Wir sind in einer haushälterisch schwierigen Lage und auch einzelne Länder scheinen nicht mehr motiviert zu sein. Das habe ich vor anderthalb Jahren noch anders wahrgenommen. Aber wenn man von Seiten des BMBF gleich so in Gespräche geht, dass man Haushaltsmittel für ein Bund-Länder-Programm ausschließt, wie soll das dann funktionieren? Es braucht finanzielle Mittel, um Dauerstellen zu schaffen. Das müsste allen Beteiligten klar sein und da bräuchte es zumindest ein Signal. Aber es wurde ja nicht mal ein einziger symbolischer Euro eingestellt. Dem BMBF scheint es mindestens an politischem Willen zu fehlen. Für mich ist das Thema aber noch nicht vom Tisch.
Unter den 18 Ländern, in denen der vor einigen Tagen veröffentlichte Bericht 2024 “Free to Think” der in New York ansässigen Advocacy-Organisation Scholars at Risk bedenkliche Entwicklungen und Trends auflistet, findet sich erstmals auch Deutschland. Im Kapitel “Regional Pressures on Higher Education Communities” hinter China und Kolumbien und vor Hongkong, Indien und Iran eingereiht zu sein, ist auf den ersten Blick kein gutes Zeichen.
Zu den Ereignissen, die der Free to Think-Bericht nennt, zählen:
Auf der Plattform X spießte die im Verlauf der BMBF-Fördermittel-Affäre geschasste Staatssekretärin Döring die Einträge im Scholars at Risk-Bericht auf. Deutschland sei im Academic Freedom Index jüngst auf Platz 11 abgerutscht, schrieb sie und fragte: “Wird es weiter bergab gehen, nachdem die #Fördergeldaffäre im #BMBF es im Wissenschaftsjahr ‘Freiheit’ nun in den Jahresbericht von @ScholarsAtRisk geschafft hat?”
Beantworten lässt sich diese Frage erst, wenn im März der neue Academic Freedom Index (AFI) erscheint, der von Forschenden um Katrin Kinzelbach von der Universität Erlangen-Nürnberg und Staffan Lindberg vom V-Dem Institut der Universität Göteborg erarbeitet wird. “Meine Vermutung ist, dass die Fördermittelaffäre sich auf den Indikator auswirkt, der Freiheit von Forschung und Lehre erfasst. Ob es so kommt und wie groß der Effekt ist, bleibt abzuwarten”, sagt Lars Lott, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Projekts im Gespräch mit Table.Briefings.
Dass Deutschland jüngst im AFI abgestürzt sei, ist aus Sicht des Politikwissenschaftlers aber nicht richtig. Bei den im März veröffentlichten Ergebnissen für das Jahr 2023 habe Deutschland einen Punktwert von 0,93 erreicht und befinde sich damit erneut unter den besten zehn Prozent der 179 bewerteten Länder. Im Jahr 2019 habe der Wert 0,97 betragen.
“Von Absturz würde ich nur dann sprechen, wenn der Punktwert sich so verschlechtert, dass er außerhalb des Unsicherheitsintervalls des Vergleichsjahres liegt.” Wegen des relativ großen Unsicherheitsintervalls – das sich dadurch erklärt, dass sich Wissenschaftsfreiheit nicht objektiv messen, sondern nur durch Experten einschätzen lässt – hält er auch nichts davon, die AFI-Liste als Ranking zu behandeln. “Dazu liegen viele Länder zu dicht beieinander.”
Bei der Interpretation des Free to Think-Berichts gibt Lars Lott zu bedenken, dass es sich um einen Ereignisreport handelt. “Er differenziert nicht die Art und Intensität der Ereignisse und inwiefern sie sich auf die Wissenschaftsfreiheit auswirken.” Das Ziel von Scholars at Risk sei es, Aufmerksamkeit für das Thema zu erzielen. “Das ist wichtig und das machen sie sehr gut. Ihr Ziel ist es aber nicht, möglichst gute wissenschaftliche Daten zu generieren.”
Auch BBAW-Präsident Christoph Markschies, der als Kuratoriumsmitglied des BMBF-Wissenschaftsjahres “Freiheit” das Thema genau verfolgt, sieht keinen Absturz Deutschlands. “Ich persönlich glaube nicht, dass die grundgesetzlich garantierte Wissenschaftsfreiheit in Deutschland abgenommen hat”, sagt er auf Anfrage von Table.Briefings. “Im Gegenteil”, ergänzt er. Die letzten Monate hätten gezeigt, dass sie energisch verteidigt werde.
“Wer auch nur ein wenig internationale Kontakte pflegt, weiß allerdings, dass im Ausland spätestens seit dem 7. Oktober 2023 gelegentlich anders darüber gedacht wird und der Bericht von Scholars at Risk kann als Ausdruck entsprechender Sorgen um die Wissenschaftsfreiheit hierzulande gelesen werden.” Da helfe dann nur geduldiges Erklären und Hinweise auf gern auch in Deutschland übersehene Details. Als Beispiel nennt er die “überaus gewaltsamen Umstände” der Besetzungen an zwei Berliner Universitäten, zudem noch durch universitätsfremde Aktivisten.
Gegen Alarmismus spricht zudem eine empirische Studie des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW), die Anfang Oktober veröffentlicht wurde. Demnach ist es an deutschen Hochschulen insgesamt gut bis sehr gut um die akademische Redefreiheit bestellt. Strukturelle Einschränkungen oder gar eine systematische Kultur des Cancelns seien nicht feststellbar.


Heide Ahrens – Generalsekretärin der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)
Die Generalsekretärin der DFG pendelte in ihrem Berufsleben zwischen Wissenschaftsmanagement und Politik: Heide Ahrens war Bremer Wissenschaftssenatorin (2017 bis 2020), Abteilungsleiterin im schleswig-holsteinischen Wissenschaftsministerium (2011 bis 2017), Vizepräsidentin der Universität Oldenburg (2007 bis 2011), davor Dezernentin an der Universität Bremen, Programmmanagerin beim Stifterverband, Referatsleiterin bei der AvH. Sie hat Politologie, Kommunikationswissenschaften und Germanistik studiert und berufsbegleitend promoviert. Sie kennt das deutsche Wissenschaftssystem also aus allen Blickwinkeln. Bei der DFG ist sie seit 2020 im Amt, zusammen mit der ebenfalls seit 2020 amtierenden Präsidentin Katja Becker bildet sie den Vorstand. Eine der ersten Taten: eine Compliance-Ordnung für den Vorstand erarbeiten lassen.

Jörn Hasler – Leiter der Leitungsabteilung im Bundesministerium für Bildung und Forschung
Er ist einer von mehreren Führungskräften im BMBF, die lange Jahre in der Bundeswehr gedient haben. Hasler ist seit März 2022 Leiter der Leitungsabteilung und damit zuständig für den direkten Stab der Ministerin sowie für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im BMBF. Zurzeit steht er zusätzlich kommissarisch der Grundsatzabteilung vor. Der bisherige Chef dieser Abteilung 1, Roland Philippi (FDP), folgte auf die entlassene Staatssekretärin Sabine Döring. Hasler war über 30 Jahre bei der Bundeswehr. Als studierter Staatswissenschaftler von der Bundeswehr-Uni in München hat sich Hasler an der französischen “École de Guerre” (Schule des Kriegs) und der Führungsakademie der Bundeswehr zum Oberst ausbilden lassen. Vor seinem Wechsel ins BMBF war er Referent bei der FDP und wurde von Christian Lindner zum kommissarischen Leiter der Fraktionsgeschäftsstelle und später zum Fraktionsgeschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion berufen.

Armin Reinartz – Leiter Abteilung 2, Europäische und Internationale Zusammenarbeit in Bildung und Forschung, im Bundesministerium für Bildung und Forschung
Im Zuge der komplizierter werdenden Forschungsbeziehungen mit China wird hierzulande von Experten mehr China-Kompetenz gefordert. Das BMBF hat diese an entscheidender Stelle bereits im Haus. Armin Reinartz studierte Moderne Chinawissenschaften an der Universität zu Köln und der Peking University. Er baute für die Friedrich-Naumann-Stiftung 2016 die neue Greater China Unit (China, Hongkong, Taiwan) und den Global Innovation Hub in Hongkong auf. Seit 2022 ist Reinartz Leiter der Abteilung “Europäische und internationale Zusammenarbeit in Bildung und Forschung” im BMBF – mit Blick auf Zeitenwende, internationale Forschungssicherheit und China-Strategie eine zentrale Abteilung des BMBF in dieser Legislatur.
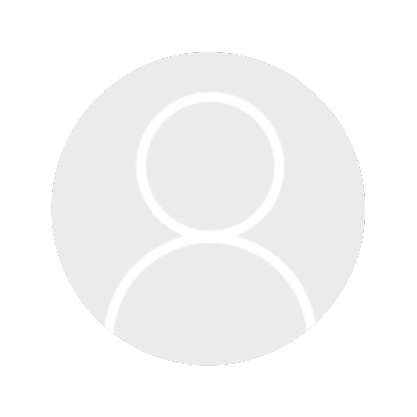
Jochen Zachgo – Leitung Abteilung 4, Hochschul- und Wissenschaftssystem, im Bundesministerium für Bildung und Forschung
Der Ministerialdirigent leitet seit 2023 die Abteilung 4, “Hochschul- und Wissenschaftssystem sowie Bildungsfinanzierung” im BMBF. Er folgte in dieser Position auf Ulrich Schüller. Zachgo ist unter anderem für die Entwicklung und Umsetzung von Bildungs- und Forschungspolitiken zuständig, die das Hochschulsystem in Deutschland betreffen. Zuvor war er als Unterabteilungsleiter in der Zentralabteilung des BMBF tätig, wo er unter anderem für Haushaltsfragen verantwortlich war. Die Abteilung 4 gilt als die zentrale Einheit für die Forschung innerhalb des BMBF. Die Paktorganisationen fallen in Zachgos Zuständigkeit, ebenso wie die Exzellenzstrategie. Daneben sind auch die Themen Forschungsdaten und Forschungsinfrastrukturen hier angesiedelt.

Tina Klüwer – Leitung Abteilung 5, Forschung für technologische Souveränität und Innovationen, im Bundesministerium für Bildung und Forschung
Seit Dezember 2023 leitet Tina Klüwer die BMBF-Abteilung 5, eine lange vakante Position. Bereits im Juni 2023 hatte Bettina Stark-Watzinger Klüwers Vorgängerin, die Informatikerin Ina Schieferdecker, entlassen, was bis heute nicht näher erklärt worden ist. Klüwer hat sich lautlos in ihre neue Stelle eingefügt. Vor dem Schritt ins BMBF leitete sie das Künstliche Intelligenz Entrepreneurship Zentrum der Berliner Universitäten. Klüwer, die in Computerlinguistik an der Universität des Saarlandes promoviert hat, lernte das Agieren im politischen Rahmen 2017 kennen – als Mitglied der Enquete-Kommission “Künstliche Intelligenz” des Deutschen Bundestags. Sie saß im Beirat für technologische Souveränität und im Zukunftsrat des Kanzlers.

Simone Schwanitz – Generalsekretärin der Max-Planck-Gesellschaft (MPG)
Seit Februar 2022 ist Simone Schwanitz Generalsekretärin der MPG. Die Diplom-Politologin leitet die Generalverwaltung und hat die 84 Institute sowie die Organe und Gremien der Grundlagenforschungsorganisation im Blick. Auch mit den Ministerien und der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern hat sie regelmäßig zu tun. Das ist vertrautes Terrain, denn sie wechselte zur MPG aus dem baden-württembergischen Wissenschaftsministerium, wo sie die Abteilung für Forschung, Technologietransfer, Digitalisierung und Europa leitete. Bei der Reise des MPG-Präsidenten Patrick Cramer, der vor seinem Amtsantritt von August 2022 bis April 2023 alle Institute der Gesellschaft besuchte, war Schwanitz an einigen Orten mit dabei.

Bettina Böhm – Generalsekretärin der Leibniz-Gemeinschaft
In der politischen Öffentlichkeit wird Präsidentin Martina Brockmeier als Gesicht der Leibniz-Gemeinschaft wahrgenommen. Ihre Generalsekretärin Bettina Böhm pflegt derweil Kontakte im politischen und parlamentarischen Raum und vertritt die Forschungsgemeinschaft in Gremien wie der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK). Die promovierte Juristin macht den Job seit Januar 2018. Verwaltungserfahrung sammelte sie an den Universitäten Bielefeld und Dortmund. Sie war Kanzlerin der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und wechselte später als Personalleiterin zur Europäischen Weltraumorganisation ESA nach Paris.

Franziska Broer – Geschäftsführerin der Helmholtz-Gemeinschaft
Die Wirtschafts- und Rechtswissenschaftlerin Franziska Broer ist seit acht Jahren Geschäftsführerin der Helmholtz-Gemeinschaft. Sie verantwortet die globale Geschäftstätigkeit der Forschungsorganisation mit Büros in Berlin, Bonn, Brüssel, Moskau und Peking und unterstützt den Präsidenten bei der internationalen Repräsentanz. Als Mitglied des Präsidiums ist Broer maßgeblich verantwortlich für die strategische Führung der Gemeinschaft. Ihre Expertise in den Bereichen Gesundheitsmanagement und Wissenschaftsadministration hat sie sich in verschiedenen Führungspositionen innerhalb der Helmholtz-Gemeinschaft erworben. Zuvor absolvierte sie unter anderem an der Charité Berlin den Studiengang Consumer Healthcare.

Ralf Beste – Leiter der Abteilung Kultur und Gesellschaft im Auswärtigen Amt
Ralf Beste koordiniert die Auswärtige Kultur-, Bildungs- und Wissenschaftspolitik der Bundesregierung. Gemeinsam mit Anke Reiffenstuel, die als Beauftragte für Außenwissenschafts-, Bildungs- und Forschungspolitik in seiner Abteilung arbeitet, ist er für die deutsche Außenwissenschaftsdiplomatie in der Zeitenwende zuständig. Die Förderung von DAAD und AvH sind Bestes Abteilung zugeordnet. Während Deutschland sich aus Kooperationen mit Russland weitestgehend zurückgezogen hat und auch im Verhältnis zu China vorsichtiger wird, arbeiten Beste und Reiffenstuel daran, dass Deutschland im internationalen Wettbewerb um die klügsten Köpfe besser wird, zum Beispiel durch die Vereinfachung von Visa-Verfahren für ausländische Forschende.

Christina Decker – Abteilungsleiterin Digital- und Innovationspolitik im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz
Aus Sicht der Forschungs- und Innovationspolitik leitet Christina Decker die wichtigste Abteilung im BMWK. In ihren Bereich fallen die Industrieforschung wie das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) sowie die Sprind. Die vormalige Unterabteilungsleiterin für Außenwirtschaftsrecht und Exportkontrolle in der Europaabteilung (EC) im BMWK bekleidet ihr Amt erst seit dem 1. Juni 2024. In ihrer Begrüßungsrede auf dem Mittelstand-Digital Kongress hob sie die Bedeutung von Netzwerken aus Wissenschaft- und Transfereinrichtungen für die deutsche Wettbewerbsfähigkeit hervor. Erste Bewährungsprobe könnte die Vorbereitung der Haushaltsverhandlungen sein, wo zum Beispiel für ZIM Kürzungen drohen.
15. Oktober 2024, Konzerthaus am Gendarmenmarkt, Berlin
acatech Festveranstaltung Wissen, Wandel, Wettbewerb Mehr
30. Oktober – 1. November 2024, Heidelberg
Konferenz Wissenswerte Mehr
4. November 2024, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung
Diskussion Bedrohte Wissenschaft: Ungeliebte Wahrheit Mehr
7.-9. November 2024, Berlin
Konferenz Falling Walls Science Summit 2024 Mehr
28. November 2024, Berlin
Tagung Tag der Hochschulmedizin Mehr
Der diesjährige GWK-Bericht zu Frauen in Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen macht deutlich, dass der Anteil von Frauen an Professuren und in Führungspositionen insgesamt weiterhin nur langsam steigt. Das bedeutet, dass der Frauenanteil nach dem Studium mit jeder Qualifikations- und Karrierestufe weiter abnimmt. Die sogenannte Leaky Pipeline bleibt also bestehen. Damit gehe dem Wissenschafts- und Innovationssystem erhebliches Potenzial verloren, schreibt die GWK.
Die anhaltende Ungleichheit zeigt sich auch bei der Betrachtung nach Besoldungsgruppen: Der Anteil der W1-Professorinnen an den Hochschulen liegt bei 48,7 Prozent, der Anteil der C3/W2-Professorinnen bei 28,6 Prozent und der Anteil der C4/W3-Professorinnen nur noch bei 23,8 Prozent.
Der GWK-Bericht analysiert zudem die Frauenanteile in den außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Der Frauenanteil an Führungspositionen bei der Fraunhofer-Gesellschaft, der Helmholtz-Gemeinschaft, der Max-Planck-Gesellschaft (MPG) und der Leibniz-Gemeinschaft ist im Vergleichszeitraum von 2013 bis 2023 insgesamt von 13,5 auf 24,2 Prozent gewachsen. Dabei zeigen sich deutliche Unterschiede: Während der Anteil bei Max-Planck bei rund 32 Prozent und bei Leibniz bei etwas unter 31 Prozent liegt, beträgt er bei Fraunhofer nur knapp neun Prozent (unsere Analyse dazu hier).
Maßnahmen wie das Professorinnenprogramm von Bund und Ländern sollen helfen, dieses Ungleichgewicht zu beseitigen. Auch die im Pakt für Forschung und Innovation festgeschriebenen Mittelaufwüchse sind mit konkreten Zielsetzungen zur Gewinnung von weiblichen Nachwuchs- und Führungskräften verbunden.
Trotz dieser Maßnahmen wachse der Anteil an Professorinnen jedoch mit weniger als vier Prozent jährlich in den vergangenen zehn Jahren nur skandalös langsam, sagte Birgitt Riegraf, Präsidentin der Universität Paderborn auf Anfrage von Table.Briefings. Auf allen Ebenen des Wissenschaftssystems müsse noch umfassender und entschiedener gehandelt werden. mw
Der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner verkündete am gestrigen Montag in der Bundespressekonferenz die von der Bundesregierung nominierten Mitglieder des Deutschen Ethikrates. Neu berufen werden sollen:
Zudem soll der katholische Moraltheologe Jochen Sautermeister im Februar kommenden Jahres dem dann ausscheidenden Mitglied Armin Grunwald vom Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse am Karlsruher Institut für Technologie nachfolgen.
Für eine zweite Amtszeit nominiert wurden:
Die Mitglieder werden endgültig von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) für eine Amtszeit von vier Jahren berufen. Bereits im Juni hatte der Bundestag elf Mitglieder in den Ethikrat gewählt. Der Ethikrat hatte zuletzt die monatelange Verzögerung bei der Berufung der Mitglieder durch die Bundesregierung ungewöhnlich scharf kritisiert und davor gewarnt, die Arbeitsfähigkeit des Gremiums aufs Spiel zu setzen. mw
Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht in diesem Jahr an die in den USA tätigen Ökonomen Daron Acemoglu, Simon Johnson und James A. Robinson. Sie werden für ihre Arbeiten darüber ausgezeichnet, welche Rolle Institutionen für den Wohlstand von Nationen spielen. Das gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm bekannt. Acemoglu war vorab von mehreren Ökonomen als ein Favorit auf den diesjährigen Preis genannt worden.
Der Ökonom reagiert überrascht und begeistert, dass er in diesem Jahr zu den Wirtschaftsnobelpreisträgern zählt. “Das ist einfach ein echter Schock und eine großartige Nachricht. Danke!”, sagte der 57-Jährige, als er zu der Preisbekanntgabe in Stockholm zugeschaltet wurde. “So etwas erwartet man nie”, sagte er. “Es ist eine große Überraschung und Ehre.”
Die drei Preisträger hätten anhand ihrer Forschung zum Aufbau von politischen und wirtschaftlichen Systemen in der Kolonialzeit demonstriert, wie wichtig gesellschaftliche Institutionen für den Wohlstand eines Landes seien, erklärte die Akademie in ihrer Würdigung. Gesellschaften mit einem schwachen Rechtsstaat und ausbeuterischen Institutionen erzeugten weder Wirtschaftswachstum noch einen Wandel zum Besseren.
Während die Einführung von durch Mitbestimmung geprägten Institutionen langfristig allen zugutekomme, brächten ausbeuterische Institutionen lediglich kurzfristige Vorteile für die Machthabenden, erklärte die Akademie. Die Forschung von Acemoglu, Johnson und Robinson helfe dabei, die Hintergründe dazu besser zu verstehen.
“Die Verringerung der riesigen Einkommensunterschiede zwischen Ländern ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit”, sagte der Vorsitzende des zuständigen Preiskomitees, Jakob Svensson. Dank der bahnbrechenden Erkenntnisse der Preisträger habe man ein viel tieferes Verständnis für die Grundursachen entwickeln können, warum manche Länder erfolgreich seien und andere scheiterten.
Damit sind alle Nobelpreisträger dieses Jahres gekürt. In der vergangenen Woche waren bereits die Nobelpreise in den übrigen Preiskategorien vergeben worden. Während die Auszeichnungen in den wissenschaftlichen Kategorien Medizin, Physik und Chemie diesmal allesamt männlichen Forschern aus Nordamerika und Großbritannien zugesprochen wurden, gingen die Literatur- und Friedensnobelpreise jeweils nach Asien: Mit ihnen werden in diesem Jahr die südkoreanische Schriftstellerin Han Kang und die japanische Anti-Atomwaffen-Organisation Nihon Hidankyo ausgezeichnet.
Im Gegensatz zu diesen fünf Kategorien geht der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften nicht auf das Testament des Dynamit-Erfinders Alfred Nobel (1833-1896) zurück. Er wird seit Ende der 1960er Jahre von der schwedischen Zentralbank gestiftet. Er wird dennoch ebenso wie die weiteren Preise an Nobels Todestag am 10. Dezember feierlich überreicht und ist auch mit demselben Preisgeld wie die anderen Auszeichnungen verbunden – in diesem Jahr sind das elf Millionen schwedische Kronen (knapp 970.000 Euro) pro Kategorie.
Im vergangenen Jahr war die US-Ökonomin Claudia Goldin mit dem Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnet worden. Die Professorin der Elite-Universität Harvard wurde damit für ihre Forschung zur Rolle von Frauen auf dem Arbeitsmarkt geehrt. Nach Elinor Ostrom 2009 und Esther Duflo 2019 war Goldin damit erst die dritte Frau unter den bislang mehr als 90 ausgezeichneten Wirtschaftsnobelpreisträgern. nik /dpa
Als Ergebnis eines EU-weiten Vergabeverfahrens wurde ein Konsortium unter Leitung des Instituts für angewandte Sozialwissenschaft (infas) mit der Durchführung der Evaluation des Startchancen-Programms beauftragt. Das gab das BMBF am Montag bekannt. Laut Mitteilung handelt es sich um die komplexeste Programmevaluation, die das Ministerium jemals in Auftrag gegeben hat. Das Auftragsvolumen beträgt für die gesamte Programmlaufzeit fast 50 Millionen Euro.
Das ist das Konsortium:
Laut Ausschreibung hat der neue Verbund die Aufgabe “der begleitenden und bilanzierenden Evaluation einschließlich Erfolgskontrolle” zu leisten. Sie umfasse “die Zielerreichungskontrolle, die Wirkungskontrolle und die Wirtschaftlichkeitskontrolle“. Das Startchancen-Programm wird dabei nicht nur abschließend, sondern fortlaufend, also auch während der Programmlaufzeit, evaluiert. Erkenntnisse aus dem Prozess fließen in die Steuerung ein – im Sinne eines lernenden Programms.
Von Beginn an hat das BMBF geplant, die beiden Aufgaben der wissenschaftlichen Begleitung und der Evaluation an unterschiedliche Forschungsverbünde zu vergeben. Das Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation (DIPF) steht seit Juli fest als Spitze des Verbunds für die wissenschaftliche Begleitung. Dieser Verbund umfasst insgesamt 20 wissenschaftliche Institute und Hochschulen. Hier stellt der Bund rund 100 Millionen Euro über zehn Jahre zur Verfügung.
Insgesamt hat das BMBF laut der Verwaltungsvereinbarung mit den Ländern 200 Millionen Euro “für wissenschaftliche Begleitung, Evaluierung und Programmbegleitung” eingeplant. Das Startchancen-Programm wird von der Ampel als größtes schulpolitisches Projekt seit Jahrzehnten bezeichnet. Bund und Länder wollen mit Start 1. August 2024 über die kommenden zehn Jahre jeweils zehn Milliarden Euro investieren. Etwa 4.000 Schulen in herausfordernden Lagen sollen vom Startchancen-Programm profitieren. Bis zum Programmende soll an diesen Schulen die Zahl der Schülerinnen und Schüler halbiert sein, die die Mindeststandards in Mathematik und Deutsch verfehlen. hs/mw
Verlinkungen/Downloads:
t-online: Sexismus und Mobbing an Frankfurter Institut. Fast die Hälfte der Mitarbeiter des renommierten Ernst-Strüngmann-Instituts in Frankfurt am Main hat sich mit einem Brandbrief an den Stiftungsrat gewandt. Sie berichten von einem Klima des Mobbings und des Sexismus an dem Institut. Die Vorwürfe sollen schon längere Zeit bekannt sein. Die Beschuldigten bestreiten die in dem Brief erhobenen Vorwürfe. (“Harte Vorwürfe gegen bedeutendes Forschungsinstitut”)
Chemietechnik: Covestro investiert in Forschung und Entwicklung. Das Leverkusener Chemieunternehmen Covestro will weltweit 100 Millionen Euro in seine Infrastruktur zum Entwickeln von Zukunftstechnologien investieren. Für Covestro ist vor allem die Digitalisierung der Forschung und Entwicklung ein wichtiger Baustein auf dem Weg in die Zukunft. (“Covestro investiert 100 Millionen Euro in F&E-Infrastruktur”)
Süddeutsche: Bayern reagiert auf Antisemitismus an den Unis. Auch in Bayern gelten Universitäten und Hochschulen seit dem Angriff der Hamas auf Israel als Brennpunkte des Judenhasses. Die Landesregierung will nun mit einem Aktionsplan auf die Vorfälle reagieren. Die Lage ist an den bayerischen Hochschulen sehr unterschiedlich. (“Akademischer Antisemitismus”)
RNZ: Mehr Senioren an den Hochschulen. Immer mehr Senioren im Südwesten beginnen ein Studium und besuchen die Hörsäle der Universitäten. Nach Angaben des Wissenschaftsministeriums gingen 477 Menschen im Alter von 60 Jahren und darüber im Wintersemester 2022/23 in Vorlesungen und Seminare. Im Vergleich zum Wintersemester zehn Jahre zuvor bedeutet diese Anzahl nahezu eine Verdoppelung der studierenden Senioren. (“Immer mehr Senioren studieren an den Universitäten im Land”)
Tagesspiegel: Manipulation in der Hirnforschung. Eliezer Masliah, ein prominenter und vielzitierter Hirnforscher, der bis vor kurzem als Direktor des National Institute on Aging (NIA) bei den US-amerikanischen National Institutes of Health (NIH) tätig war, steht unter Verdacht, schwerwiegendes wissenschaftliches Fehlverhalten begangen zu haben. In über 130 seiner Veröffentlichungen wurden “fragwürdige Bilder und Daten” festgestellt. Obwohl bisher kein eindeutiger Betrug nachgewiesen wurde, weisen die Art und der Umfang der Manipulationen darauf hin, dass es sich um mehr als nur “Flüchtigkeitsfehler und Nachlässigkeiten” handelt. (“Die Selbstkorrektur der Forschung funktioniert nicht mehr”)

Endlich berät der Bundestag die Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG). Wenn aber die Ampelkoalition den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf durchwinkt, stößt sie nicht nur Hunderttausende Wissenschaftler*innen vor den Kopf, sondern verrät ihren eigenen Koalitionsvertrag. “Gute Wissenschaft braucht verlässliche Arbeitsbedingungen. Deswegen wollen wir das Wissenschaftszeitvertragsgesetz auf Basis der Evaluation reformieren”, ist im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP vom Dezember 2021 zu lesen.
Außerdem kündigte die Koalition an, “dass in der Wissenschaft Dauerstellen für Daueraufgaben geschaffen werden” sollen. Dass die Ampelkoalition damit den Slogan der GEW-Kampagne “Dauerstellen für Daueraufgaben” zitiert, hat bereits große Erwartungen geweckt. Die Befunde der 2022 veröffentlichten Gesetzesevaluation haben den Handlungsbedarf mit Daten untermauert. 84 Prozent der wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen an Unis und 78 Prozent an HAWs sind befristet beschäftigt. Die durchschnittliche Laufzeit der Zeitverträge beträgt an Unis 18, an HAWs 15 Monate.
Die entgrenzte Befristungspraxis ist nicht nur unfair, sie untergräbt auch die Qualität von Forschung, Lehre und Studium. Folgerichtig packte die Regierung die Gesetzesreform an. Ein zentrales Ziel wird im Koalitionsvertrag dargestellt: “Dabei wollen wir die Planbarkeit und Verbindlichkeit in der Post-Doc-Phase deutlich erhöhen und frühzeitiger Perspektiven für alternative Karrieren schaffen.”
Die GEW hat in ihrem Dresdner Gesetzentwurf für ein Wissenschaftsentfristungsgesetz das Instrument der Entfristungszusage für Postdocs konzipiert: Ein Zeitvertrag muss entfristet werden, wenn vereinbarte Ziele in Forschung und Lehre erreicht werden. Der Regierungsentwurf greift zwar die GEW-Entfristungszusage als “Anschlusszusage” auf, begeht aber als Ausdruck eines Formelkompromisses zwischen SPD und FDP einen kapitalen Fehler.
Ist die Anschlusszusage erst nach vier Jahren Postdoc-Befristung obligatorisch, wie es die Ampel plant, wird das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Wissenschaftseinrichtungen müssten keine Dauerstellenkonzepte entwickeln, sondern könnten einfach den Druck auf die Postdocs erhöhen. Die müssten eben noch schneller berufungsfähig werden oder wenigstens rechtzeitig ein Drittmittelprojekt für eine Vertragsverlängerung an Land ziehen. Wer Postdocs wirklich Planbarkeit und Verbindlichkeit geben möchte, muss ihnen von Anfang Dauerstelle oder Anschlusszusage anbieten.
Ein weiteres Versprechen aus dem Koalitionsvertrag lautet: “Wir wollen die Vertragslaufzeiten von Promotionsstellen an die gesamte erwartbare Projektlaufzeit knüpfen”. Nach Angaben des Bundesberichts Wissenschaftlicher Nachwuchs beträgt die durchschnittliche Promotionsdauer (ohne Medizin) 5,7 Jahre. Die Mindestvertragslaufzeit von drei Jahren im Regierungsentwurf bleibt nicht nur weit dahinter zurück. Als unverbindliche Soll-Bestimmung lässt sie den Arbeitgebern überdies Raum für viel kürzere Laufzeiten. Konsequent wäre eine Regellaufzeit von sechs Jahren mit einer verbindlichen Untergrenze von vier Jahren, wie sie die GEW im Dresdner Gesetzentwurf ausbuchstabiert hat.
Weiter wollen die Ampelparteien laut Koalitionsvertrag “die familien- und behindertenpolitische Komponente für alle verbindlich machen”. Nach dieser Komponente können Zeitverträge verlängert werden, wenn Beschäftigte Kinder betreuen oder behindert beziehungsweise chronisch krank sind. Können heißt nicht müssen: Laut WissZeitVG-Evaluation schließen 42 Prozent der Hochschulen und Forschungseinrichtungen prinzipiell die Möglichkeit aus, die Komponenten zu nutzen. Die GEW fordert daher, aus der Kann- eine Muss-Bestimmung zu machen. Der Regierungsentwurf dazu: Fehlanzeige.
Immerhin aber plant die Ampel, den Anspruch auf Vertragsverlängerung bei Mutterschutz und Elternzeit auch Drittmittelbeschäftigten zugutekommen zu lassen. Damit soll zum Beispiel ausgeschlossen werden, dass junge Forscherinnen im Wochenbett auf die Straße gesetzt werden. Der gewählte Weg eines Vorrangs der Qualifizierungsbefristung ist jedoch nicht nur unnötig kompliziert, sondern läuft ins Leere, sobald die Höchstdauer von sechs Jahren erschöpft ist. Konsequenter wäre die Gleichstellung der Drittmittelbeschäftigten mit ihren aus Haushaltsmitteln finanzierten Kolleg*innen.
Ein Leitmotiv des gesamten Koalitionsvertrags ist schließlich die Tarifbindung. Doch statt endlich die unsägliche Tarifsperre aus dem WissZeitVG zu streichen und Arbeitgebern und Gewerkschaften die Chance zu geben, sachgerechte Befristungsregeln auszuhandeln, doktert die Ampelkoalition an ihr herum. Ein Armutszeugnis.
Das geltende WissZeitVG stellt Arbeitgebern in Hochschule und Forschung eine Lizenz zum Befristen aus. Allen Appellen zum Trotz haben sie nicht nachweisen können, dass sie verantwortungsbewusst mit ihr umgehen können und wollen. Es ist höchste Zeit, dass die Ampelkoalition ihre eigenen Versprechen einlöst und dem Befristungsmissbrauch einen Riegel vorschiebt – durch eine umfassende Reform des WissZeitVG.
Andreas Keller ist stellvertretender Vorsitzender und Vorstandsmitglied für Hochschule und Forschung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW).

Einzelne Atome mittels Röntgenstrahlung zu untersuchen, klang bis vor Kurzem nach Science-Fiction. Es brauchte schon mehr Material, um ein brauchbares Signal zu erhalten. Wenigstens ein paar Attogramm (Trillionstel Gramm), was immer noch um die 10.000 Atome bedeuten würde. Dem Forscher Saw Wai Hla gelang jedoch, was niemand alsbald für möglich gehalten hatte. Passenderweise lautet sein Motto “Grenzen verschieben”.
Der Professor für Physik an der Ohio University und Forscher am Argonne National Laboratory hat mit seinem Team einzelne Atome zuerst mit einem speziellen Mikroskop sichtbar gemacht und schließlich mithilfe von Röntgenstrahlung ihre Eigenschaften erkundet. Im Frühjahr 2023 veröffentlichte die Gruppe ihren Durchbruch im Fachmagazin “Nature”, das ihn gleich zur Titeloptik der Printausgabe machte. Im November kommt er als Gewinner des Falling Walls Science Breakthrough of the Year 2024 in der Kategorie Physik nach Berlin.
Bereits das Mikroskopieren einzelner Atome ist eine Wissenschaft für sich. Lichtwellen sind viel zu lang, um so kleine Strukturen abbilden zu können. Stattdessen nutzt man beispielsweise Rastertunnelmikroskope. Eine sehr feine Spitze, meist aus Wolfram, wird dabei sehr dicht über die Probe geführt. Obwohl sich die beiden nicht berühren, kann zwischen der Spitze und dem Objekt ein elektrischer Strom fließen. “Tunnelstrom” nennen Physiker dieses Quantenphänomen.

Die Stärke des Tunnelstroms hängt wesentlich vom Abstand der beiden “Elektroden” ab. Befindet sich die Nadel direkt über einem Atom, ist die Distanz kürzer – und der Strom größer – als über einer Lücke im Kristall. So berechnet der Computer aus zig Strommessungen ein Bild. Hla wollte sich nicht mit einem Bild begnügen. Ihn interessierten die chemischen Eigenschaften einzelner Atome, also welche Bindungen sie mit anderen Atomen eingehen.
Dazu kombinierten die Forscher das Rastertunnelmikroskop mit einer brillanten Röntgenquelle (Synchrotron) und einer mikroskopisch kleinen Elektrode, die sie an der Spitze aufbrachten. Diese sammelt just jene Elektronen ein, die zuvor von der Röntgenstrahlung angeregt wurden. Je nachdem, um welches Atom es sich handelt und wie seine Bindungen sind, ergibt sich ein typisches Spektrum an Messwerten. In der Fachwelt ist das Verfahren unter dem Namen SX-STM (Synchrotron X-ray Scanning Tunneling Microscopy) bekannt.
Zwölf Jahre hat Saw Wai Hla daran gearbeitet, unter anderem mit Volker Rose, der in Aachen und Jülich studierte und forschte, ehe er zum Argonne National Lab ging. Auch Saw Wai Hla war länger in Deutschland, an der Uni Hamburg sowie der FU Berlin und dem Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik. “Er ist immer freundlich, positiv, durch nichts zu erschüttern”, sagt Stefan Fölsch vom Drude-Institut. “Nicht so introvertiert und verstiegen in die Wissenschaft, sondern ein Mann der Tat.”
Sein wissenschaftlicher Weg nahm einige Wendungen: Nach dem Physikstudium an der Yangon University (Myanmar) ging es nach Triest (Italien) und Lubljana (Slowenien), wo er promovierte, schließlich erneut Triest und Berlin, ehe er 2001 an der University Ohio anfing. Die ersten Röntgenaufnahmen gelangen von Eisen und Terbium, einem Atom der Seltenen Erden. Sie dienten der Demonstration und hatten noch keinen unmittelbaren Nutzen. Doch es könnten viele Entdeckungen folgen, meint Hla.
Das ähnele der Erfindung der ersten Computer, die heute überall seien. Mittlerweile gelinge es seinem Team bereits, verschiedene Metallatome und deren chemische Zustände in komplexen Molekülen zu erfassen, berichtet Hla Table.Briefings. Damit ließen sich molekulare Systeme für Energieanwendungen designen. Auf diese Weise könnten High-Tech-Geräte wie Smartphones und HD-Bildschirme effizienter arbeiten. Das spart Energie und reduziert den Materialbedarf an Seltenerdmetallen. Schließlich ist deren Gewinnung teils mit erheblichen Umweltbelastungen verbunden. Ein effektiver Einsatz ist umso vorteilhafter. Ralf Nestler
Saw Wai Hla ist Gewinner des Falling Walls Science Breakthrough of the Year 2024 in der Kategorie Physik. Er spricht am 9. November 2024 um 9:30 Uhr auf dem Falling Walls Science Summit in Berlin. Das Programm des Summit finden Sie hier, weitere Porträts der Table.Briefings-Reihe “Breakthrough-Minds” lesen Sie hier.
Johannes Schaller ist neuer Präsident der Deutschen Hochschule für Gesundheit und Sport. Der Psychologe löst Gunnar Mau an der Spitze der privaten Hochschule ab. Als Professor für Gesundheitspsychologie und später als Präsident der SRH Hochschule für Gesundheit hat Schaller die akademische Entwicklung im Gesundheitssektor in den vergangenen maßgeblich mitgeprägt.
Cordelia Schmid, Forschungsdirektorin am französischen Forschungsinstitut INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique) in Grenoble, hat vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und der KIT Freundeskreis und Fördergesellschaft die Heinrich-Hertz-Gastprofessur 2024 verliehen bekommen. Ausgezeichnet wird die Informatikerin für ihre herausragenden Forschungsleistungen auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an research@table.media!
Bildung.Table. Zukunftskompetenzen: Warum die Arbeitgeber einen Digitalpakt II fordern. Angesichts neuer Herausforderungen für die Wirtschaft fordert die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände, entsprechende Kompetenzen zu fördern. Eine Fortsetzung des Digitalpakts halten sie dabei für zentral. Aber auch eine datenbasierte Schulentwicklung. Mehr
Bildung.Table. Aufstiegs-Bafög: Über welche Punkte der Reform noch gestritten wird. Am Donnerstag debattiert der Bundestag zum ersten Mal über die Reform des Aufstiegs-Bafögs. In der Koalition gibt es Unmut über den Regierungsentwurf. Mehr
Europe.Table. Energienetze: Wie die Infrastruktur zusammengedacht werden soll. Viele Sektoren stehen vor einer Elektrifizierung, gleichzeitig müssen Netze für Wasserstoff, CO₂ und Fernwärme auf- und ausgebaut werden. Europäische Experten skizzieren nun Schritte zu einer gemeinsamen Netzplanung, um Synergien zu heben. Mehr
ESG.Table. Soziale Investitionen: Warum Finanzinstitute ein europäisches Rahmenwerk fordern. Nachhaltigkeitsbanken und kirchliche Finanzinstitute fordern von der EU-Kommission eine Definition sozialer Investitionen. Dies würde es nachhaltigen Investoren erleichtern, in soziale Infrastruktur zu investieren. Mehr
Endspurt in Sachen Wissenschaftszeitvertragsgesetz: Mit der 1. Lesung des Gesetzesentwurfs beginnt am morgigen Mittwoch nach zahllosen Stakeholder-Dialogen und Debatten der parlamentarische Prozess. Mein Kollege Tim Gabel hat mit Parlamentariern der Koalition, Beschäftigten-Initiativen und Gewerkschaften über ihre Erwartungen gesprochen. Dabei kristallisiert sich heraus: auch der zweite Vorschlag des BMBF zur Befristungshöchstdauer in der Postdoc-Phase, die “4 + 2-Regelung” wird wohl keinen Bestand haben. Stattdessen bevorzugen die Ampelparteien vermutlich eine teilweise Lockerung der Tarifsperre.
Diese ganz abzuschaffen, fordert hingegen die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft GEW. In seinem Standpunkt für diese Ausgabe fasst Andreas Keller, stellvertretender Vorsitzender und Hochschulexperte der GEW, seine Positionen und Forderungen exklusiv zusammen, bevor sie in einem Positionspapier zum Start der Parlamentsdebatte am Mittwoch veröffentlicht werden soll. Dass die Zeit für Maximalforderungen abgelaufen ist, meint dagegen die Berichterstatterin der Grünen, Laura Kraft. Im Interview mit dem Research.Table zur WissZeitVG-Novelle äußert sie sich zur Rolle der Grünen als Mediator in der Debatte. Die Konfrontation sucht Kraft dagegen beim Thema Bund-Länder-Programm für mehr Dauerstellen. Sie wirft dem BMBF “Uninspiriertheit” und “Unwillen” vor. Mit dem Bericht des Ministeriums an den Haushaltsausschuss könne man “nichts anfangen”.
Schadet das BMBF mit seiner Fördermittelaffäre dem Wissenschaftsstandort Deutschland nachhaltig? Die Frage kann man sich nach der Lektüre des aktuellen Jahresberichts der Organisation “Scholars at Risk” stellen. Im “Free to Think“-Report der Initiative – einem internationalen Netzwerk von über 650 Hochschuleinrichtungen in mehr als 40 Ländern, das sich für den Schutz von gefährdeten Forschenden und Studierenden einsetzt – wird die Affäre als bedenkliche Entwicklung in Deutschland eingestuft. Meine Kollegin Anne Brüning hat mit Lars Lott gesprochen, der den Academic Freedom Index mit erarbeitet und mit BBAW-Präsident Christoph Markschies. Er beobachtet das Thema als Kuratoriumsmitglied des BMBF-Wissenschaftsjahres “Freiheit” ganz genau.
Kommen Sie gut in diesen Dienstag,

Die Novelle des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG) kommt am morgigen Mittwoch auf die Tagesordnung des Parlaments. Der “Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Befristungsrechts für die Wissenschaft” wird am morgigen Mittwoch in 1. Lesung verhandelt. Das Bundeskabinett hatte am 27. März 2024 den Gesetzentwurf zur Änderung des WissZeitVG beschlossen. Beschäftigten-Initiativen, Gewerkschaften und Opposition zeigten sich damals enttäuscht über das Papier.
SPD und Grüne hatten in den Kabinettsverhandlungen Ressortvorbehalte eingelegt. Im Disput mit dem FDP-geführten Forschungsministerium konnte man aber schließlich doch keine Änderungen bei der umstrittenen Höchstbefristungsdauer für Postdocs oder der Lockerung der Tarifsperre erwirken. Ein kürzlich erschienener BMBF-Bericht legt zudem nahe, dass auch das im Koalitionsvertrag vereinbarte Bund-Länder-Programm für mehr Dauerstellen neben der Professur in dieser Legislatur kaum noch Chancen hat.
Das Programm sollte das WissZeitVG flankieren und den Hochschulen neben den darin enthaltenen gesetzlichen Regeln zur Vermeidung von Kettenverträgen Anreize bieten, ihr System auf mehr Dauerstellen auszurichten. Das BMBF war per Maßgabebeschluss aus dem Haushaltsausschuss dazu aufgefordert worden, ein Konzept für das Programm zu erarbeiten. In der vergangenen Woche reichte das Ministerium seinen Bericht ein – allerdings ohne ein ausgearbeitetes Konzept und mit dem Hinweis, dass mit den Ländern keine Einigung in Sicht sei. Die Länder haben das inzwischen auf Anfrage von Table.Briefings bestätigt und begründet.
Die parlamentarische Debatte wird nun also Aufschluss darüber geben, wie weitgehend die Regierungskoalition ihre Versprechen aus dem Koalitionsvertrag einhalten wird. Das BMBF hatte deutlich gemacht, dass man bei den umstrittenen Punkten wenig kompromissbereit ist. Grüne und SPD stehen vor dem Dilemma, dass man, um etwas vorweisen zu können, die Novelle zwar unbedingt verabschieden will, sie in der jetzigen Form von Gewerkschaften und Beschäftigten-Initiativen allerdings nicht als Verbesserung, sondern eher als Verschlechterung angesehen wird.
Bei der SPD zeigt man sich trotzdem zuversichtlich: “Ich freue mich, dass wir jetzt nach langer Zeit endlich das parlamentarische Verfahren aufnehmen können. Die Beschäftigten an den Hochschulen warten darauf, dass wir deutliche Verbesserungen am Gesetz vornehmen werden”, sagt Berichterstatterin Carolin Wagner auf Anfrage von Table.Briefings. Der Kabinettsentwurf enthalte bereits spürbare Verbesserungen. “Wir erwarten jetzt, dass wir auch in der Postdoc-Phase die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stärken werden.” Ganz sicher werde man über “den Sinn und Unsinn der Tarifsperre” sprechen müssen.
Nachdem Bundesministerin Bettina Stark-Watzinger in ihrem Zuleitungsschreiben an das Bundeskabinett einen Zusammenhang zwischen der Regelung der Postdoc-Phase und der Ermöglichung tariflicher Vereinbarungen hergestellt habe, “bin ich durchaus zuversichtlich, dass wir auch die Koalitionspartner an unserer Seite haben”. Mit Blick auf das Bund-Länder-Programm springt Wagner ihren Regierungskollegen aus dem BMBF zur Seite: “Dass die Länder die ausgestreckte Hand des Bundes für ein Bund-Länder-Programm nicht ergriffen haben, ist bedauerlich und irritierend zugleich.” Das Vorhaben sei zu wichtig, als dass man es nicht weiter verfolgen sollte.
Nach Stephan Seiter, Berichterstatter der FDP, soll die WissZeitVG-Novelle nicht zur “Verschlimmbesserung” werden, die viele zum Beispiel in der Kürzung der Postdoc-Höchstbefristung erkennen würden. “Die “4+2”-Regelung findet daher keine Unterstützung mehr“, sagt Seiter Table.Briefings. Die Jahresformel, die das FDP-geführte BMBF in seinen Referentenentwurf geschrieben hatte, ist damit vermutlich schon vor Beginn der Bundestags-Debatte Geschichte. Die Komplexität des Wirkbereichs der WissZeitVG-Novelle berge große Risiken, das Wissenschaftssystem auf einen Schlag zu überfordern, warnt Seiter weiter. Das wolle die Koalition vermeiden: “Wir schauen jetzt gemeinsam, was noch geht.”
Mit Blick auf die parlamentarische Debatte erneuerten auch die Beschäftigten-Initiativen noch einmal ihre Forderungen: “Für die WissZeitVG-Reform wurden verlässliche und planbare Karrierewege versprochen. Ohne die ist die deutsche Wissenschaft als Arbeitsort nicht attraktiv – in Zeiten des Fachkräftemangels ist das fatal”, sagt Amrei Bahr von der Initiative #IchbinHanna. Es sei umso dringender, dass die Versprechen der Regierung eingehalten werden: “Mit Anschlusszusage nach zwei Jahren und Befristungshöchstquote. Wir sind zuversichtlich, dass das Parlament die Relevanz dieser Maßnahmen für den Wissenschaftsstandort und seine Beschäftigten sieht und sich entsprechend positioniert.”
Elke Hannack, stellvertretende DGB-Vorsitzende, fordert, dass die Fraktionen im Bundestag jetzt die Chance nutzen müssen, das Befristungsunwesen in der Wissenschaft zu beenden. “Der Gesetzentwurf schafft das nicht und muss daher dringend nachgebessert werden. Wir brauchen Dauerstellen für Daueraufgaben in Lehre und Forschung und für Promovierende Verträge, die den tatsächlichen Promotionszeiten entsprechen”, sagt Hannack. Der DGB erwarte, dass der Gesetzgeber endlich die Tarifsperre für den Wissenschaftsbereich streicht – “ohne Wenn und Aber”.

Frau Kraft, seit Beginn der Legislatur laufen die Verhandlungen zur Novelle des WissZeitVG. Die letzte Chance auf Einigung in der Koalition gibt es im parlamentarischen Verfahren. Am Mittwoch geht’s los. Was sind Ihre Erwartungen?
Ich glaube, wir sind uns in der Koalition einig, dass wir eine Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes machen wollen und das Projekt nicht scheitern soll. Ich finde es gut, wenn wir das proaktiv wieder aufnehmen. Wir sollten das Ziel haben, das parlamentarische Verfahren jetzt zügig zum Abschluss zu bringen. Die Beschäftigten und die Wissenschaftsorganisationen brauchen Verlässlichkeit. Die Community ist inzwischen maximal verunsichert, weil keiner weiß, wie das Gesetz am Ende ausgestaltet sein wird. Alle wollen Klarheit haben und endlich eine Entscheidung von uns.
Ihre SPD-Kollegin Carolin Wagner hat noch deutlichen Änderungsbedarf am Kabinettsentwurf angemeldet. Auch Ihre Partei hat nur unter Vorbehalt zugestimmt. Aus dem Ministerium war zum Schluss aber kein Signal zum Kompromiss mehr zu vernehmen. Was macht Sie optimistisch, dass man sich jetzt schnell einigen kann?
Man muss ehrlich sein: Es sind fast alle Argumente ausgetauscht. Der Prozess war bereits sehr lang und hat etliche Stellungnahmen produziert. Ich finde es wichtig, dass das, worauf wir uns einigen konnten, auch Gesetz wird. Denn auch in der jetzigen Version des Gesetzentwurfs stehen Verbesserungen für die Beschäftigten. Darüber hinaus wollen wir noch ein paar Punkte einbringen. Das war eine Bedingung bei der Kabinettsentscheidung. Das BMBF hat das zugesichert und es ist thematisch ausdifferenziert worden. Die Tarifsperre ist ein Bereich, den wir uns nochmal im Detail anschauen wollen, aber nicht der einzige. Diese Detailarbeit werden wir im parlamentarischen Verfahren angehen.
Die FDP ist inzwischen ganz von der Anschlusszusage in der Postdoc-Phase abgerückt, die SPD bleibt bei der Forderung nach der “2 + 4-Regelung”. Kommt den Grünen die Rolle des politischen Mediators zu?
Wir sind an einer praxistauglichen und funktionierenden Lösung interessiert. Es können sich alle in ihren Maximalforderungen ergehen, aber dann kommen wir nicht zu einer Gesetzesänderung. Die FDP hat im Mai geäußert, dass sie selbst nicht mehr von der “4 + 2-Regelung” überzeugt ist, was die Befristungshöchstdauer in der Postdoc-Phase angeht. Es gibt keine Gruppe mehr – von den Beschäftigten, über die Verbände bis hin zu den Hochschulleitungen – die das einen sinnvollen Weg finden. Es muss eine Alternative her. Politische Formelkompromisse funktionieren nicht. Das haben wir schon an den Eckpunkten gesehen, die zurück in die sogenannte “Montagehalle” mussten. Und beim Gesetzesentwurf des BMBF sehen wir es wieder.
Damit müsste das Ministerium zum zweiten Mal von einer Befristungshöchstdauer abrücken, die das Haus selbst vorgeschlagen hat und es bleibt bei den sechs Jahren des bisherigen Gesetzes?
Für uns als Grüne ist klar, dass mit uns keine Gesetzesreform zu machen ist, dass die Situation der Beschäftigten verschlechtern würde, sondern wir wollen strukturelle Verbesserungen erreichen. Aber es muss ein Gesetz sein, was in der Praxis funktioniert, was stimmig ist, was gute Rahmenbedingungen schafft und die Wissenschaft letzten Endes nicht noch behindert. Dazu gehören verbesserte Beschäftigungsverhältnisse und planbare und gute Karrierewege. Deswegen diskutieren wir jetzt schon so lange über das WissZeitVG.
Wie könnte ein praxistauglicher Kompromiss – mit Blick auf die Tarifsperre – am Ende aussehen? Die Länder warnen vor einem “Regelungs-Flickenteppich”.
Man muss die Tarifsperre nicht ganz streichen oder komplett bestehen lassen. Man kann sie zum Beispiel für einzelne Bereiche öffnen, die man definiert und begrenzen kann – etwa für die Befristungsdauer, die Vertragslänge oder aber die Anzahl an Verträgen. Man muss sich en détail anschauen, welche Auswirkungen das in der Praxis hat. Diese Arbeit müssen wir jetzt im parlamentarischen Verfahren erledigen. Uns ist darüber hinaus auch wichtig, dass die Intention des Gesetzgebers, also mehr Dauerstellen für Daueraufgaben, in der Gesetzesbegründung nochmal deutlicher herausgearbeitet wird. Derzeit werden viele Spielräume, die das bestehende WissZeitVG bietet, nicht genutzt oder zum Nachteil der Beschäftigten ausgelegt. Da kommt es rechtlich gesehen auf jede Formulierung an.
Für mehr Dauerstellen neben der Professur sollte ein flankierendes Bund-Länder-Programm sorgen. Warum hat es die Ampel als so wichtig erachtet, dass es als Ergänzung zum WissZeitVG in den Koalitionsvertrag geschrieben wurde?
Das WissZeitVG kann nicht alle Probleme des Wissenschaftssystems lösen und wird allein keine einzige Dauerstelle schaffen. Wenn im Gesetz zum Beispiel eine Anschlusszusage vorgesehen ist, es aber keine zusätzliche Dauerstelle gibt, dann ist das wie eine Karotte vor der Nase, die man trotzdem nie erreichen kann. Das Bund-Länder-Programm wäre eine wichtige Brücke, um es Ländern und Hochschulen möglich zu machen, entsprechende Stellen zu schaffen. Deswegen ist es uns so wichtig, dass das Programm kommt. Wir haben diesen Konsens in den Koalitionsvertrag geschrieben und ihn mit einer Mehrheit aus der Mitte des Parlamentes im Haushaltsausschuss erneuert, als das BMBF per Maßgabebeschluss im Oktober 2023 verpflichtet wurde, ein Konzept dafür vorzulegen.
Das BMBF hat fristgerecht einen Bericht dazu vorgelegt. Sie waren in Ihrer ersten Reaktion darauf nicht gerade begeistert. Warum?
Das, was jetzt dem Haushaltsausschuss vorgelegt wurde, ist kein Konzept. Das ist eine Gesprächsnotiz, bestenfalls. Es ist eine Verschriftlichung der Uninspiriertheit und des scheinbaren Unwillens im Ministerium. Das muss ich einfach so beim Namen nennen. Die Bewertung obliegt jetzt zunächst dem Haushaltsausschuss, aber meine fachpolitische Einschätzung ist, dass man damit nicht arbeiten kann. Damit kann niemand etwas anfangen. Der einzige Vorschlag des BMBF ist ein Expertengremium, also die Gründung eines Arbeitskreises.
Das BMBF verweist auf den Wissenschaftsrat, der sich mit neuen Stellenkategorien neben der Professur beschäftigt. Reicht denn die Zeit in der Legislatur noch für ein Programm, wenn die Ergebnisse des Rates im Frühjahr 2025 erscheinen sollen?
Die Forderungen, für strukturelle Verbesserungen in der Wissenschaft zu sorgen und diese politisch zu flankieren, ist nicht neu. Die existiert nicht erst seit unserem Koalitionsvertrag. Der Wissenschaftsrat hat sich vor zehn Jahren schon einmal mit der Thematik befasst und tut es jetzt wieder. Darauf sollte man nicht warten. Das, was das BMBF macht – in dieser Legislatur in bekannter Manier – ist Bund-Länder-Ping Pong zu spielen. Wenn ein Ministerium die Situation für Beschäftigte verbessern und den Standort attraktiver machen will, muss es mehr tun, als ein paar Notizen als Konzept zu verkaufen. Das macht mich ehrlicherweise ein bisschen ratlos, denn man stampft ein solches Programm nicht mal so aus dem Boden.
Die letzte Chance wäre die Bereinigungssitzung für den Haushalt im November. Bislang finden sich dort kein Titel und keine Finanzmittel für ein Bund-Länder-Programm. Wird es Bestandteil der Verhandlungen sein?
Wir sind in einer haushälterisch schwierigen Lage und auch einzelne Länder scheinen nicht mehr motiviert zu sein. Das habe ich vor anderthalb Jahren noch anders wahrgenommen. Aber wenn man von Seiten des BMBF gleich so in Gespräche geht, dass man Haushaltsmittel für ein Bund-Länder-Programm ausschließt, wie soll das dann funktionieren? Es braucht finanzielle Mittel, um Dauerstellen zu schaffen. Das müsste allen Beteiligten klar sein und da bräuchte es zumindest ein Signal. Aber es wurde ja nicht mal ein einziger symbolischer Euro eingestellt. Dem BMBF scheint es mindestens an politischem Willen zu fehlen. Für mich ist das Thema aber noch nicht vom Tisch.
Unter den 18 Ländern, in denen der vor einigen Tagen veröffentlichte Bericht 2024 “Free to Think” der in New York ansässigen Advocacy-Organisation Scholars at Risk bedenkliche Entwicklungen und Trends auflistet, findet sich erstmals auch Deutschland. Im Kapitel “Regional Pressures on Higher Education Communities” hinter China und Kolumbien und vor Hongkong, Indien und Iran eingereiht zu sein, ist auf den ersten Blick kein gutes Zeichen.
Zu den Ereignissen, die der Free to Think-Bericht nennt, zählen:
Auf der Plattform X spießte die im Verlauf der BMBF-Fördermittel-Affäre geschasste Staatssekretärin Döring die Einträge im Scholars at Risk-Bericht auf. Deutschland sei im Academic Freedom Index jüngst auf Platz 11 abgerutscht, schrieb sie und fragte: “Wird es weiter bergab gehen, nachdem die #Fördergeldaffäre im #BMBF es im Wissenschaftsjahr ‘Freiheit’ nun in den Jahresbericht von @ScholarsAtRisk geschafft hat?”
Beantworten lässt sich diese Frage erst, wenn im März der neue Academic Freedom Index (AFI) erscheint, der von Forschenden um Katrin Kinzelbach von der Universität Erlangen-Nürnberg und Staffan Lindberg vom V-Dem Institut der Universität Göteborg erarbeitet wird. “Meine Vermutung ist, dass die Fördermittelaffäre sich auf den Indikator auswirkt, der Freiheit von Forschung und Lehre erfasst. Ob es so kommt und wie groß der Effekt ist, bleibt abzuwarten”, sagt Lars Lott, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Projekts im Gespräch mit Table.Briefings.
Dass Deutschland jüngst im AFI abgestürzt sei, ist aus Sicht des Politikwissenschaftlers aber nicht richtig. Bei den im März veröffentlichten Ergebnissen für das Jahr 2023 habe Deutschland einen Punktwert von 0,93 erreicht und befinde sich damit erneut unter den besten zehn Prozent der 179 bewerteten Länder. Im Jahr 2019 habe der Wert 0,97 betragen.
“Von Absturz würde ich nur dann sprechen, wenn der Punktwert sich so verschlechtert, dass er außerhalb des Unsicherheitsintervalls des Vergleichsjahres liegt.” Wegen des relativ großen Unsicherheitsintervalls – das sich dadurch erklärt, dass sich Wissenschaftsfreiheit nicht objektiv messen, sondern nur durch Experten einschätzen lässt – hält er auch nichts davon, die AFI-Liste als Ranking zu behandeln. “Dazu liegen viele Länder zu dicht beieinander.”
Bei der Interpretation des Free to Think-Berichts gibt Lars Lott zu bedenken, dass es sich um einen Ereignisreport handelt. “Er differenziert nicht die Art und Intensität der Ereignisse und inwiefern sie sich auf die Wissenschaftsfreiheit auswirken.” Das Ziel von Scholars at Risk sei es, Aufmerksamkeit für das Thema zu erzielen. “Das ist wichtig und das machen sie sehr gut. Ihr Ziel ist es aber nicht, möglichst gute wissenschaftliche Daten zu generieren.”
Auch BBAW-Präsident Christoph Markschies, der als Kuratoriumsmitglied des BMBF-Wissenschaftsjahres “Freiheit” das Thema genau verfolgt, sieht keinen Absturz Deutschlands. “Ich persönlich glaube nicht, dass die grundgesetzlich garantierte Wissenschaftsfreiheit in Deutschland abgenommen hat”, sagt er auf Anfrage von Table.Briefings. “Im Gegenteil”, ergänzt er. Die letzten Monate hätten gezeigt, dass sie energisch verteidigt werde.
“Wer auch nur ein wenig internationale Kontakte pflegt, weiß allerdings, dass im Ausland spätestens seit dem 7. Oktober 2023 gelegentlich anders darüber gedacht wird und der Bericht von Scholars at Risk kann als Ausdruck entsprechender Sorgen um die Wissenschaftsfreiheit hierzulande gelesen werden.” Da helfe dann nur geduldiges Erklären und Hinweise auf gern auch in Deutschland übersehene Details. Als Beispiel nennt er die “überaus gewaltsamen Umstände” der Besetzungen an zwei Berliner Universitäten, zudem noch durch universitätsfremde Aktivisten.
Gegen Alarmismus spricht zudem eine empirische Studie des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW), die Anfang Oktober veröffentlicht wurde. Demnach ist es an deutschen Hochschulen insgesamt gut bis sehr gut um die akademische Redefreiheit bestellt. Strukturelle Einschränkungen oder gar eine systematische Kultur des Cancelns seien nicht feststellbar.


Heide Ahrens – Generalsekretärin der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)
Die Generalsekretärin der DFG pendelte in ihrem Berufsleben zwischen Wissenschaftsmanagement und Politik: Heide Ahrens war Bremer Wissenschaftssenatorin (2017 bis 2020), Abteilungsleiterin im schleswig-holsteinischen Wissenschaftsministerium (2011 bis 2017), Vizepräsidentin der Universität Oldenburg (2007 bis 2011), davor Dezernentin an der Universität Bremen, Programmmanagerin beim Stifterverband, Referatsleiterin bei der AvH. Sie hat Politologie, Kommunikationswissenschaften und Germanistik studiert und berufsbegleitend promoviert. Sie kennt das deutsche Wissenschaftssystem also aus allen Blickwinkeln. Bei der DFG ist sie seit 2020 im Amt, zusammen mit der ebenfalls seit 2020 amtierenden Präsidentin Katja Becker bildet sie den Vorstand. Eine der ersten Taten: eine Compliance-Ordnung für den Vorstand erarbeiten lassen.

Jörn Hasler – Leiter der Leitungsabteilung im Bundesministerium für Bildung und Forschung
Er ist einer von mehreren Führungskräften im BMBF, die lange Jahre in der Bundeswehr gedient haben. Hasler ist seit März 2022 Leiter der Leitungsabteilung und damit zuständig für den direkten Stab der Ministerin sowie für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im BMBF. Zurzeit steht er zusätzlich kommissarisch der Grundsatzabteilung vor. Der bisherige Chef dieser Abteilung 1, Roland Philippi (FDP), folgte auf die entlassene Staatssekretärin Sabine Döring. Hasler war über 30 Jahre bei der Bundeswehr. Als studierter Staatswissenschaftler von der Bundeswehr-Uni in München hat sich Hasler an der französischen “École de Guerre” (Schule des Kriegs) und der Führungsakademie der Bundeswehr zum Oberst ausbilden lassen. Vor seinem Wechsel ins BMBF war er Referent bei der FDP und wurde von Christian Lindner zum kommissarischen Leiter der Fraktionsgeschäftsstelle und später zum Fraktionsgeschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion berufen.

Armin Reinartz – Leiter Abteilung 2, Europäische und Internationale Zusammenarbeit in Bildung und Forschung, im Bundesministerium für Bildung und Forschung
Im Zuge der komplizierter werdenden Forschungsbeziehungen mit China wird hierzulande von Experten mehr China-Kompetenz gefordert. Das BMBF hat diese an entscheidender Stelle bereits im Haus. Armin Reinartz studierte Moderne Chinawissenschaften an der Universität zu Köln und der Peking University. Er baute für die Friedrich-Naumann-Stiftung 2016 die neue Greater China Unit (China, Hongkong, Taiwan) und den Global Innovation Hub in Hongkong auf. Seit 2022 ist Reinartz Leiter der Abteilung “Europäische und internationale Zusammenarbeit in Bildung und Forschung” im BMBF – mit Blick auf Zeitenwende, internationale Forschungssicherheit und China-Strategie eine zentrale Abteilung des BMBF in dieser Legislatur.
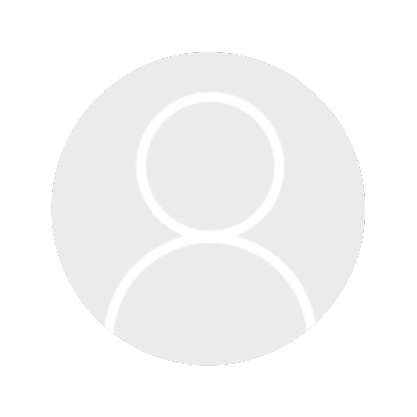
Jochen Zachgo – Leitung Abteilung 4, Hochschul- und Wissenschaftssystem, im Bundesministerium für Bildung und Forschung
Der Ministerialdirigent leitet seit 2023 die Abteilung 4, “Hochschul- und Wissenschaftssystem sowie Bildungsfinanzierung” im BMBF. Er folgte in dieser Position auf Ulrich Schüller. Zachgo ist unter anderem für die Entwicklung und Umsetzung von Bildungs- und Forschungspolitiken zuständig, die das Hochschulsystem in Deutschland betreffen. Zuvor war er als Unterabteilungsleiter in der Zentralabteilung des BMBF tätig, wo er unter anderem für Haushaltsfragen verantwortlich war. Die Abteilung 4 gilt als die zentrale Einheit für die Forschung innerhalb des BMBF. Die Paktorganisationen fallen in Zachgos Zuständigkeit, ebenso wie die Exzellenzstrategie. Daneben sind auch die Themen Forschungsdaten und Forschungsinfrastrukturen hier angesiedelt.

Tina Klüwer – Leitung Abteilung 5, Forschung für technologische Souveränität und Innovationen, im Bundesministerium für Bildung und Forschung
Seit Dezember 2023 leitet Tina Klüwer die BMBF-Abteilung 5, eine lange vakante Position. Bereits im Juni 2023 hatte Bettina Stark-Watzinger Klüwers Vorgängerin, die Informatikerin Ina Schieferdecker, entlassen, was bis heute nicht näher erklärt worden ist. Klüwer hat sich lautlos in ihre neue Stelle eingefügt. Vor dem Schritt ins BMBF leitete sie das Künstliche Intelligenz Entrepreneurship Zentrum der Berliner Universitäten. Klüwer, die in Computerlinguistik an der Universität des Saarlandes promoviert hat, lernte das Agieren im politischen Rahmen 2017 kennen – als Mitglied der Enquete-Kommission “Künstliche Intelligenz” des Deutschen Bundestags. Sie saß im Beirat für technologische Souveränität und im Zukunftsrat des Kanzlers.

Simone Schwanitz – Generalsekretärin der Max-Planck-Gesellschaft (MPG)
Seit Februar 2022 ist Simone Schwanitz Generalsekretärin der MPG. Die Diplom-Politologin leitet die Generalverwaltung und hat die 84 Institute sowie die Organe und Gremien der Grundlagenforschungsorganisation im Blick. Auch mit den Ministerien und der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern hat sie regelmäßig zu tun. Das ist vertrautes Terrain, denn sie wechselte zur MPG aus dem baden-württembergischen Wissenschaftsministerium, wo sie die Abteilung für Forschung, Technologietransfer, Digitalisierung und Europa leitete. Bei der Reise des MPG-Präsidenten Patrick Cramer, der vor seinem Amtsantritt von August 2022 bis April 2023 alle Institute der Gesellschaft besuchte, war Schwanitz an einigen Orten mit dabei.

Bettina Böhm – Generalsekretärin der Leibniz-Gemeinschaft
In der politischen Öffentlichkeit wird Präsidentin Martina Brockmeier als Gesicht der Leibniz-Gemeinschaft wahrgenommen. Ihre Generalsekretärin Bettina Böhm pflegt derweil Kontakte im politischen und parlamentarischen Raum und vertritt die Forschungsgemeinschaft in Gremien wie der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK). Die promovierte Juristin macht den Job seit Januar 2018. Verwaltungserfahrung sammelte sie an den Universitäten Bielefeld und Dortmund. Sie war Kanzlerin der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und wechselte später als Personalleiterin zur Europäischen Weltraumorganisation ESA nach Paris.

Franziska Broer – Geschäftsführerin der Helmholtz-Gemeinschaft
Die Wirtschafts- und Rechtswissenschaftlerin Franziska Broer ist seit acht Jahren Geschäftsführerin der Helmholtz-Gemeinschaft. Sie verantwortet die globale Geschäftstätigkeit der Forschungsorganisation mit Büros in Berlin, Bonn, Brüssel, Moskau und Peking und unterstützt den Präsidenten bei der internationalen Repräsentanz. Als Mitglied des Präsidiums ist Broer maßgeblich verantwortlich für die strategische Führung der Gemeinschaft. Ihre Expertise in den Bereichen Gesundheitsmanagement und Wissenschaftsadministration hat sie sich in verschiedenen Führungspositionen innerhalb der Helmholtz-Gemeinschaft erworben. Zuvor absolvierte sie unter anderem an der Charité Berlin den Studiengang Consumer Healthcare.

Ralf Beste – Leiter der Abteilung Kultur und Gesellschaft im Auswärtigen Amt
Ralf Beste koordiniert die Auswärtige Kultur-, Bildungs- und Wissenschaftspolitik der Bundesregierung. Gemeinsam mit Anke Reiffenstuel, die als Beauftragte für Außenwissenschafts-, Bildungs- und Forschungspolitik in seiner Abteilung arbeitet, ist er für die deutsche Außenwissenschaftsdiplomatie in der Zeitenwende zuständig. Die Förderung von DAAD und AvH sind Bestes Abteilung zugeordnet. Während Deutschland sich aus Kooperationen mit Russland weitestgehend zurückgezogen hat und auch im Verhältnis zu China vorsichtiger wird, arbeiten Beste und Reiffenstuel daran, dass Deutschland im internationalen Wettbewerb um die klügsten Köpfe besser wird, zum Beispiel durch die Vereinfachung von Visa-Verfahren für ausländische Forschende.

Christina Decker – Abteilungsleiterin Digital- und Innovationspolitik im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz
Aus Sicht der Forschungs- und Innovationspolitik leitet Christina Decker die wichtigste Abteilung im BMWK. In ihren Bereich fallen die Industrieforschung wie das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) sowie die Sprind. Die vormalige Unterabteilungsleiterin für Außenwirtschaftsrecht und Exportkontrolle in der Europaabteilung (EC) im BMWK bekleidet ihr Amt erst seit dem 1. Juni 2024. In ihrer Begrüßungsrede auf dem Mittelstand-Digital Kongress hob sie die Bedeutung von Netzwerken aus Wissenschaft- und Transfereinrichtungen für die deutsche Wettbewerbsfähigkeit hervor. Erste Bewährungsprobe könnte die Vorbereitung der Haushaltsverhandlungen sein, wo zum Beispiel für ZIM Kürzungen drohen.
15. Oktober 2024, Konzerthaus am Gendarmenmarkt, Berlin
acatech Festveranstaltung Wissen, Wandel, Wettbewerb Mehr
30. Oktober – 1. November 2024, Heidelberg
Konferenz Wissenswerte Mehr
4. November 2024, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung
Diskussion Bedrohte Wissenschaft: Ungeliebte Wahrheit Mehr
7.-9. November 2024, Berlin
Konferenz Falling Walls Science Summit 2024 Mehr
28. November 2024, Berlin
Tagung Tag der Hochschulmedizin Mehr
Der diesjährige GWK-Bericht zu Frauen in Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen macht deutlich, dass der Anteil von Frauen an Professuren und in Führungspositionen insgesamt weiterhin nur langsam steigt. Das bedeutet, dass der Frauenanteil nach dem Studium mit jeder Qualifikations- und Karrierestufe weiter abnimmt. Die sogenannte Leaky Pipeline bleibt also bestehen. Damit gehe dem Wissenschafts- und Innovationssystem erhebliches Potenzial verloren, schreibt die GWK.
Die anhaltende Ungleichheit zeigt sich auch bei der Betrachtung nach Besoldungsgruppen: Der Anteil der W1-Professorinnen an den Hochschulen liegt bei 48,7 Prozent, der Anteil der C3/W2-Professorinnen bei 28,6 Prozent und der Anteil der C4/W3-Professorinnen nur noch bei 23,8 Prozent.
Der GWK-Bericht analysiert zudem die Frauenanteile in den außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Der Frauenanteil an Führungspositionen bei der Fraunhofer-Gesellschaft, der Helmholtz-Gemeinschaft, der Max-Planck-Gesellschaft (MPG) und der Leibniz-Gemeinschaft ist im Vergleichszeitraum von 2013 bis 2023 insgesamt von 13,5 auf 24,2 Prozent gewachsen. Dabei zeigen sich deutliche Unterschiede: Während der Anteil bei Max-Planck bei rund 32 Prozent und bei Leibniz bei etwas unter 31 Prozent liegt, beträgt er bei Fraunhofer nur knapp neun Prozent (unsere Analyse dazu hier).
Maßnahmen wie das Professorinnenprogramm von Bund und Ländern sollen helfen, dieses Ungleichgewicht zu beseitigen. Auch die im Pakt für Forschung und Innovation festgeschriebenen Mittelaufwüchse sind mit konkreten Zielsetzungen zur Gewinnung von weiblichen Nachwuchs- und Führungskräften verbunden.
Trotz dieser Maßnahmen wachse der Anteil an Professorinnen jedoch mit weniger als vier Prozent jährlich in den vergangenen zehn Jahren nur skandalös langsam, sagte Birgitt Riegraf, Präsidentin der Universität Paderborn auf Anfrage von Table.Briefings. Auf allen Ebenen des Wissenschaftssystems müsse noch umfassender und entschiedener gehandelt werden. mw
Der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner verkündete am gestrigen Montag in der Bundespressekonferenz die von der Bundesregierung nominierten Mitglieder des Deutschen Ethikrates. Neu berufen werden sollen:
Zudem soll der katholische Moraltheologe Jochen Sautermeister im Februar kommenden Jahres dem dann ausscheidenden Mitglied Armin Grunwald vom Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse am Karlsruher Institut für Technologie nachfolgen.
Für eine zweite Amtszeit nominiert wurden:
Die Mitglieder werden endgültig von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) für eine Amtszeit von vier Jahren berufen. Bereits im Juni hatte der Bundestag elf Mitglieder in den Ethikrat gewählt. Der Ethikrat hatte zuletzt die monatelange Verzögerung bei der Berufung der Mitglieder durch die Bundesregierung ungewöhnlich scharf kritisiert und davor gewarnt, die Arbeitsfähigkeit des Gremiums aufs Spiel zu setzen. mw
Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht in diesem Jahr an die in den USA tätigen Ökonomen Daron Acemoglu, Simon Johnson und James A. Robinson. Sie werden für ihre Arbeiten darüber ausgezeichnet, welche Rolle Institutionen für den Wohlstand von Nationen spielen. Das gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm bekannt. Acemoglu war vorab von mehreren Ökonomen als ein Favorit auf den diesjährigen Preis genannt worden.
Der Ökonom reagiert überrascht und begeistert, dass er in diesem Jahr zu den Wirtschaftsnobelpreisträgern zählt. “Das ist einfach ein echter Schock und eine großartige Nachricht. Danke!”, sagte der 57-Jährige, als er zu der Preisbekanntgabe in Stockholm zugeschaltet wurde. “So etwas erwartet man nie”, sagte er. “Es ist eine große Überraschung und Ehre.”
Die drei Preisträger hätten anhand ihrer Forschung zum Aufbau von politischen und wirtschaftlichen Systemen in der Kolonialzeit demonstriert, wie wichtig gesellschaftliche Institutionen für den Wohlstand eines Landes seien, erklärte die Akademie in ihrer Würdigung. Gesellschaften mit einem schwachen Rechtsstaat und ausbeuterischen Institutionen erzeugten weder Wirtschaftswachstum noch einen Wandel zum Besseren.
Während die Einführung von durch Mitbestimmung geprägten Institutionen langfristig allen zugutekomme, brächten ausbeuterische Institutionen lediglich kurzfristige Vorteile für die Machthabenden, erklärte die Akademie. Die Forschung von Acemoglu, Johnson und Robinson helfe dabei, die Hintergründe dazu besser zu verstehen.
“Die Verringerung der riesigen Einkommensunterschiede zwischen Ländern ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit”, sagte der Vorsitzende des zuständigen Preiskomitees, Jakob Svensson. Dank der bahnbrechenden Erkenntnisse der Preisträger habe man ein viel tieferes Verständnis für die Grundursachen entwickeln können, warum manche Länder erfolgreich seien und andere scheiterten.
Damit sind alle Nobelpreisträger dieses Jahres gekürt. In der vergangenen Woche waren bereits die Nobelpreise in den übrigen Preiskategorien vergeben worden. Während die Auszeichnungen in den wissenschaftlichen Kategorien Medizin, Physik und Chemie diesmal allesamt männlichen Forschern aus Nordamerika und Großbritannien zugesprochen wurden, gingen die Literatur- und Friedensnobelpreise jeweils nach Asien: Mit ihnen werden in diesem Jahr die südkoreanische Schriftstellerin Han Kang und die japanische Anti-Atomwaffen-Organisation Nihon Hidankyo ausgezeichnet.
Im Gegensatz zu diesen fünf Kategorien geht der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften nicht auf das Testament des Dynamit-Erfinders Alfred Nobel (1833-1896) zurück. Er wird seit Ende der 1960er Jahre von der schwedischen Zentralbank gestiftet. Er wird dennoch ebenso wie die weiteren Preise an Nobels Todestag am 10. Dezember feierlich überreicht und ist auch mit demselben Preisgeld wie die anderen Auszeichnungen verbunden – in diesem Jahr sind das elf Millionen schwedische Kronen (knapp 970.000 Euro) pro Kategorie.
Im vergangenen Jahr war die US-Ökonomin Claudia Goldin mit dem Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnet worden. Die Professorin der Elite-Universität Harvard wurde damit für ihre Forschung zur Rolle von Frauen auf dem Arbeitsmarkt geehrt. Nach Elinor Ostrom 2009 und Esther Duflo 2019 war Goldin damit erst die dritte Frau unter den bislang mehr als 90 ausgezeichneten Wirtschaftsnobelpreisträgern. nik /dpa
Als Ergebnis eines EU-weiten Vergabeverfahrens wurde ein Konsortium unter Leitung des Instituts für angewandte Sozialwissenschaft (infas) mit der Durchführung der Evaluation des Startchancen-Programms beauftragt. Das gab das BMBF am Montag bekannt. Laut Mitteilung handelt es sich um die komplexeste Programmevaluation, die das Ministerium jemals in Auftrag gegeben hat. Das Auftragsvolumen beträgt für die gesamte Programmlaufzeit fast 50 Millionen Euro.
Das ist das Konsortium:
Laut Ausschreibung hat der neue Verbund die Aufgabe “der begleitenden und bilanzierenden Evaluation einschließlich Erfolgskontrolle” zu leisten. Sie umfasse “die Zielerreichungskontrolle, die Wirkungskontrolle und die Wirtschaftlichkeitskontrolle“. Das Startchancen-Programm wird dabei nicht nur abschließend, sondern fortlaufend, also auch während der Programmlaufzeit, evaluiert. Erkenntnisse aus dem Prozess fließen in die Steuerung ein – im Sinne eines lernenden Programms.
Von Beginn an hat das BMBF geplant, die beiden Aufgaben der wissenschaftlichen Begleitung und der Evaluation an unterschiedliche Forschungsverbünde zu vergeben. Das Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation (DIPF) steht seit Juli fest als Spitze des Verbunds für die wissenschaftliche Begleitung. Dieser Verbund umfasst insgesamt 20 wissenschaftliche Institute und Hochschulen. Hier stellt der Bund rund 100 Millionen Euro über zehn Jahre zur Verfügung.
Insgesamt hat das BMBF laut der Verwaltungsvereinbarung mit den Ländern 200 Millionen Euro “für wissenschaftliche Begleitung, Evaluierung und Programmbegleitung” eingeplant. Das Startchancen-Programm wird von der Ampel als größtes schulpolitisches Projekt seit Jahrzehnten bezeichnet. Bund und Länder wollen mit Start 1. August 2024 über die kommenden zehn Jahre jeweils zehn Milliarden Euro investieren. Etwa 4.000 Schulen in herausfordernden Lagen sollen vom Startchancen-Programm profitieren. Bis zum Programmende soll an diesen Schulen die Zahl der Schülerinnen und Schüler halbiert sein, die die Mindeststandards in Mathematik und Deutsch verfehlen. hs/mw
Verlinkungen/Downloads:
t-online: Sexismus und Mobbing an Frankfurter Institut. Fast die Hälfte der Mitarbeiter des renommierten Ernst-Strüngmann-Instituts in Frankfurt am Main hat sich mit einem Brandbrief an den Stiftungsrat gewandt. Sie berichten von einem Klima des Mobbings und des Sexismus an dem Institut. Die Vorwürfe sollen schon längere Zeit bekannt sein. Die Beschuldigten bestreiten die in dem Brief erhobenen Vorwürfe. (“Harte Vorwürfe gegen bedeutendes Forschungsinstitut”)
Chemietechnik: Covestro investiert in Forschung und Entwicklung. Das Leverkusener Chemieunternehmen Covestro will weltweit 100 Millionen Euro in seine Infrastruktur zum Entwickeln von Zukunftstechnologien investieren. Für Covestro ist vor allem die Digitalisierung der Forschung und Entwicklung ein wichtiger Baustein auf dem Weg in die Zukunft. (“Covestro investiert 100 Millionen Euro in F&E-Infrastruktur”)
Süddeutsche: Bayern reagiert auf Antisemitismus an den Unis. Auch in Bayern gelten Universitäten und Hochschulen seit dem Angriff der Hamas auf Israel als Brennpunkte des Judenhasses. Die Landesregierung will nun mit einem Aktionsplan auf die Vorfälle reagieren. Die Lage ist an den bayerischen Hochschulen sehr unterschiedlich. (“Akademischer Antisemitismus”)
RNZ: Mehr Senioren an den Hochschulen. Immer mehr Senioren im Südwesten beginnen ein Studium und besuchen die Hörsäle der Universitäten. Nach Angaben des Wissenschaftsministeriums gingen 477 Menschen im Alter von 60 Jahren und darüber im Wintersemester 2022/23 in Vorlesungen und Seminare. Im Vergleich zum Wintersemester zehn Jahre zuvor bedeutet diese Anzahl nahezu eine Verdoppelung der studierenden Senioren. (“Immer mehr Senioren studieren an den Universitäten im Land”)
Tagesspiegel: Manipulation in der Hirnforschung. Eliezer Masliah, ein prominenter und vielzitierter Hirnforscher, der bis vor kurzem als Direktor des National Institute on Aging (NIA) bei den US-amerikanischen National Institutes of Health (NIH) tätig war, steht unter Verdacht, schwerwiegendes wissenschaftliches Fehlverhalten begangen zu haben. In über 130 seiner Veröffentlichungen wurden “fragwürdige Bilder und Daten” festgestellt. Obwohl bisher kein eindeutiger Betrug nachgewiesen wurde, weisen die Art und der Umfang der Manipulationen darauf hin, dass es sich um mehr als nur “Flüchtigkeitsfehler und Nachlässigkeiten” handelt. (“Die Selbstkorrektur der Forschung funktioniert nicht mehr”)

Endlich berät der Bundestag die Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG). Wenn aber die Ampelkoalition den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf durchwinkt, stößt sie nicht nur Hunderttausende Wissenschaftler*innen vor den Kopf, sondern verrät ihren eigenen Koalitionsvertrag. “Gute Wissenschaft braucht verlässliche Arbeitsbedingungen. Deswegen wollen wir das Wissenschaftszeitvertragsgesetz auf Basis der Evaluation reformieren”, ist im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP vom Dezember 2021 zu lesen.
Außerdem kündigte die Koalition an, “dass in der Wissenschaft Dauerstellen für Daueraufgaben geschaffen werden” sollen. Dass die Ampelkoalition damit den Slogan der GEW-Kampagne “Dauerstellen für Daueraufgaben” zitiert, hat bereits große Erwartungen geweckt. Die Befunde der 2022 veröffentlichten Gesetzesevaluation haben den Handlungsbedarf mit Daten untermauert. 84 Prozent der wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen an Unis und 78 Prozent an HAWs sind befristet beschäftigt. Die durchschnittliche Laufzeit der Zeitverträge beträgt an Unis 18, an HAWs 15 Monate.
Die entgrenzte Befristungspraxis ist nicht nur unfair, sie untergräbt auch die Qualität von Forschung, Lehre und Studium. Folgerichtig packte die Regierung die Gesetzesreform an. Ein zentrales Ziel wird im Koalitionsvertrag dargestellt: “Dabei wollen wir die Planbarkeit und Verbindlichkeit in der Post-Doc-Phase deutlich erhöhen und frühzeitiger Perspektiven für alternative Karrieren schaffen.”
Die GEW hat in ihrem Dresdner Gesetzentwurf für ein Wissenschaftsentfristungsgesetz das Instrument der Entfristungszusage für Postdocs konzipiert: Ein Zeitvertrag muss entfristet werden, wenn vereinbarte Ziele in Forschung und Lehre erreicht werden. Der Regierungsentwurf greift zwar die GEW-Entfristungszusage als “Anschlusszusage” auf, begeht aber als Ausdruck eines Formelkompromisses zwischen SPD und FDP einen kapitalen Fehler.
Ist die Anschlusszusage erst nach vier Jahren Postdoc-Befristung obligatorisch, wie es die Ampel plant, wird das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Wissenschaftseinrichtungen müssten keine Dauerstellenkonzepte entwickeln, sondern könnten einfach den Druck auf die Postdocs erhöhen. Die müssten eben noch schneller berufungsfähig werden oder wenigstens rechtzeitig ein Drittmittelprojekt für eine Vertragsverlängerung an Land ziehen. Wer Postdocs wirklich Planbarkeit und Verbindlichkeit geben möchte, muss ihnen von Anfang Dauerstelle oder Anschlusszusage anbieten.
Ein weiteres Versprechen aus dem Koalitionsvertrag lautet: “Wir wollen die Vertragslaufzeiten von Promotionsstellen an die gesamte erwartbare Projektlaufzeit knüpfen”. Nach Angaben des Bundesberichts Wissenschaftlicher Nachwuchs beträgt die durchschnittliche Promotionsdauer (ohne Medizin) 5,7 Jahre. Die Mindestvertragslaufzeit von drei Jahren im Regierungsentwurf bleibt nicht nur weit dahinter zurück. Als unverbindliche Soll-Bestimmung lässt sie den Arbeitgebern überdies Raum für viel kürzere Laufzeiten. Konsequent wäre eine Regellaufzeit von sechs Jahren mit einer verbindlichen Untergrenze von vier Jahren, wie sie die GEW im Dresdner Gesetzentwurf ausbuchstabiert hat.
Weiter wollen die Ampelparteien laut Koalitionsvertrag “die familien- und behindertenpolitische Komponente für alle verbindlich machen”. Nach dieser Komponente können Zeitverträge verlängert werden, wenn Beschäftigte Kinder betreuen oder behindert beziehungsweise chronisch krank sind. Können heißt nicht müssen: Laut WissZeitVG-Evaluation schließen 42 Prozent der Hochschulen und Forschungseinrichtungen prinzipiell die Möglichkeit aus, die Komponenten zu nutzen. Die GEW fordert daher, aus der Kann- eine Muss-Bestimmung zu machen. Der Regierungsentwurf dazu: Fehlanzeige.
Immerhin aber plant die Ampel, den Anspruch auf Vertragsverlängerung bei Mutterschutz und Elternzeit auch Drittmittelbeschäftigten zugutekommen zu lassen. Damit soll zum Beispiel ausgeschlossen werden, dass junge Forscherinnen im Wochenbett auf die Straße gesetzt werden. Der gewählte Weg eines Vorrangs der Qualifizierungsbefristung ist jedoch nicht nur unnötig kompliziert, sondern läuft ins Leere, sobald die Höchstdauer von sechs Jahren erschöpft ist. Konsequenter wäre die Gleichstellung der Drittmittelbeschäftigten mit ihren aus Haushaltsmitteln finanzierten Kolleg*innen.
Ein Leitmotiv des gesamten Koalitionsvertrags ist schließlich die Tarifbindung. Doch statt endlich die unsägliche Tarifsperre aus dem WissZeitVG zu streichen und Arbeitgebern und Gewerkschaften die Chance zu geben, sachgerechte Befristungsregeln auszuhandeln, doktert die Ampelkoalition an ihr herum. Ein Armutszeugnis.
Das geltende WissZeitVG stellt Arbeitgebern in Hochschule und Forschung eine Lizenz zum Befristen aus. Allen Appellen zum Trotz haben sie nicht nachweisen können, dass sie verantwortungsbewusst mit ihr umgehen können und wollen. Es ist höchste Zeit, dass die Ampelkoalition ihre eigenen Versprechen einlöst und dem Befristungsmissbrauch einen Riegel vorschiebt – durch eine umfassende Reform des WissZeitVG.
Andreas Keller ist stellvertretender Vorsitzender und Vorstandsmitglied für Hochschule und Forschung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW).

Einzelne Atome mittels Röntgenstrahlung zu untersuchen, klang bis vor Kurzem nach Science-Fiction. Es brauchte schon mehr Material, um ein brauchbares Signal zu erhalten. Wenigstens ein paar Attogramm (Trillionstel Gramm), was immer noch um die 10.000 Atome bedeuten würde. Dem Forscher Saw Wai Hla gelang jedoch, was niemand alsbald für möglich gehalten hatte. Passenderweise lautet sein Motto “Grenzen verschieben”.
Der Professor für Physik an der Ohio University und Forscher am Argonne National Laboratory hat mit seinem Team einzelne Atome zuerst mit einem speziellen Mikroskop sichtbar gemacht und schließlich mithilfe von Röntgenstrahlung ihre Eigenschaften erkundet. Im Frühjahr 2023 veröffentlichte die Gruppe ihren Durchbruch im Fachmagazin “Nature”, das ihn gleich zur Titeloptik der Printausgabe machte. Im November kommt er als Gewinner des Falling Walls Science Breakthrough of the Year 2024 in der Kategorie Physik nach Berlin.
Bereits das Mikroskopieren einzelner Atome ist eine Wissenschaft für sich. Lichtwellen sind viel zu lang, um so kleine Strukturen abbilden zu können. Stattdessen nutzt man beispielsweise Rastertunnelmikroskope. Eine sehr feine Spitze, meist aus Wolfram, wird dabei sehr dicht über die Probe geführt. Obwohl sich die beiden nicht berühren, kann zwischen der Spitze und dem Objekt ein elektrischer Strom fließen. “Tunnelstrom” nennen Physiker dieses Quantenphänomen.

Die Stärke des Tunnelstroms hängt wesentlich vom Abstand der beiden “Elektroden” ab. Befindet sich die Nadel direkt über einem Atom, ist die Distanz kürzer – und der Strom größer – als über einer Lücke im Kristall. So berechnet der Computer aus zig Strommessungen ein Bild. Hla wollte sich nicht mit einem Bild begnügen. Ihn interessierten die chemischen Eigenschaften einzelner Atome, also welche Bindungen sie mit anderen Atomen eingehen.
Dazu kombinierten die Forscher das Rastertunnelmikroskop mit einer brillanten Röntgenquelle (Synchrotron) und einer mikroskopisch kleinen Elektrode, die sie an der Spitze aufbrachten. Diese sammelt just jene Elektronen ein, die zuvor von der Röntgenstrahlung angeregt wurden. Je nachdem, um welches Atom es sich handelt und wie seine Bindungen sind, ergibt sich ein typisches Spektrum an Messwerten. In der Fachwelt ist das Verfahren unter dem Namen SX-STM (Synchrotron X-ray Scanning Tunneling Microscopy) bekannt.
Zwölf Jahre hat Saw Wai Hla daran gearbeitet, unter anderem mit Volker Rose, der in Aachen und Jülich studierte und forschte, ehe er zum Argonne National Lab ging. Auch Saw Wai Hla war länger in Deutschland, an der Uni Hamburg sowie der FU Berlin und dem Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik. “Er ist immer freundlich, positiv, durch nichts zu erschüttern”, sagt Stefan Fölsch vom Drude-Institut. “Nicht so introvertiert und verstiegen in die Wissenschaft, sondern ein Mann der Tat.”
Sein wissenschaftlicher Weg nahm einige Wendungen: Nach dem Physikstudium an der Yangon University (Myanmar) ging es nach Triest (Italien) und Lubljana (Slowenien), wo er promovierte, schließlich erneut Triest und Berlin, ehe er 2001 an der University Ohio anfing. Die ersten Röntgenaufnahmen gelangen von Eisen und Terbium, einem Atom der Seltenen Erden. Sie dienten der Demonstration und hatten noch keinen unmittelbaren Nutzen. Doch es könnten viele Entdeckungen folgen, meint Hla.
Das ähnele der Erfindung der ersten Computer, die heute überall seien. Mittlerweile gelinge es seinem Team bereits, verschiedene Metallatome und deren chemische Zustände in komplexen Molekülen zu erfassen, berichtet Hla Table.Briefings. Damit ließen sich molekulare Systeme für Energieanwendungen designen. Auf diese Weise könnten High-Tech-Geräte wie Smartphones und HD-Bildschirme effizienter arbeiten. Das spart Energie und reduziert den Materialbedarf an Seltenerdmetallen. Schließlich ist deren Gewinnung teils mit erheblichen Umweltbelastungen verbunden. Ein effektiver Einsatz ist umso vorteilhafter. Ralf Nestler
Saw Wai Hla ist Gewinner des Falling Walls Science Breakthrough of the Year 2024 in der Kategorie Physik. Er spricht am 9. November 2024 um 9:30 Uhr auf dem Falling Walls Science Summit in Berlin. Das Programm des Summit finden Sie hier, weitere Porträts der Table.Briefings-Reihe “Breakthrough-Minds” lesen Sie hier.
Johannes Schaller ist neuer Präsident der Deutschen Hochschule für Gesundheit und Sport. Der Psychologe löst Gunnar Mau an der Spitze der privaten Hochschule ab. Als Professor für Gesundheitspsychologie und später als Präsident der SRH Hochschule für Gesundheit hat Schaller die akademische Entwicklung im Gesundheitssektor in den vergangenen maßgeblich mitgeprägt.
Cordelia Schmid, Forschungsdirektorin am französischen Forschungsinstitut INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique) in Grenoble, hat vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und der KIT Freundeskreis und Fördergesellschaft die Heinrich-Hertz-Gastprofessur 2024 verliehen bekommen. Ausgezeichnet wird die Informatikerin für ihre herausragenden Forschungsleistungen auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an research@table.media!
Bildung.Table. Zukunftskompetenzen: Warum die Arbeitgeber einen Digitalpakt II fordern. Angesichts neuer Herausforderungen für die Wirtschaft fordert die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände, entsprechende Kompetenzen zu fördern. Eine Fortsetzung des Digitalpakts halten sie dabei für zentral. Aber auch eine datenbasierte Schulentwicklung. Mehr
Bildung.Table. Aufstiegs-Bafög: Über welche Punkte der Reform noch gestritten wird. Am Donnerstag debattiert der Bundestag zum ersten Mal über die Reform des Aufstiegs-Bafögs. In der Koalition gibt es Unmut über den Regierungsentwurf. Mehr
Europe.Table. Energienetze: Wie die Infrastruktur zusammengedacht werden soll. Viele Sektoren stehen vor einer Elektrifizierung, gleichzeitig müssen Netze für Wasserstoff, CO₂ und Fernwärme auf- und ausgebaut werden. Europäische Experten skizzieren nun Schritte zu einer gemeinsamen Netzplanung, um Synergien zu heben. Mehr
ESG.Table. Soziale Investitionen: Warum Finanzinstitute ein europäisches Rahmenwerk fordern. Nachhaltigkeitsbanken und kirchliche Finanzinstitute fordern von der EU-Kommission eine Definition sozialer Investitionen. Dies würde es nachhaltigen Investoren erleichtern, in soziale Infrastruktur zu investieren. Mehr
