die Woche begann mit einem Paukenschlag: Die Meldung, dass Marvel Fusion die Entwicklung eines Kernfusion-Kraftwerks jetzt in den USA vorantreiben wird, sorgte für deutliche Kritik in der Wissenscommunity. Derartige Investitionsentscheidungen müssten endlich Weckrufe für Deutschland sein, sagte uns Helmut Schönenberger, Geschäftsführer der Unternehmer TUM aus München. “Unser Land verliert jeden Tag mehr den Anschluss an die führenden Technologie- und Wirtschaftsnationen. Beim Wachstum sind wir jetzt schon Schlusslicht der Industrienationen.”
Immerhin: Am Dienstag konnte Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger dann Erfreuliches für den Standort vermelden: Der taiwanesischer Chiphersteller TSMC kommt nach Dresden. Mit im Gepäck: Einige Milliarden, viele Arbeitsplätze.
Doch die Freude über den nächsten Chip-Konzern, der in Ostdeutschland investieren wird, hält sich in Grenzen: Die Chips, die produziert werden sollen, sind zwar besser als ursprünglich angenommen, doch im Vergleich zu dem, was TSMC in den USA herstellt, längst überholt. Mein Kollege Finn Mayer-Kuckuck berichtet.
Thomas Sattelberger blickt derweil mahnend auf das ostdeutsche Chipwunder: Für Deutschland und die Region gehe es nun darum, die drei Wachstumsbedingungen einer Hightech-Region zu gewährleisten, sagt der frühere Parlamentarische Staatssekretär für Bildung und Forschung: Talent, Technologie und Toleranz. Und genau das könnte schwierig werden. Es gebe berechtigte Befürchtungen, dass die Nachfrage an qualifizierten Fachkräften nicht gedeckt werden könnte.
Zum Wochenausklang möchte ich Ihnen noch Teil fünf unserer Serie “Politikberatung, quo vadis?” empfehlen. Martin Renz berichtet über das System in den USA, etwa über das Office of Science and Technology Policy, das sich stark um das Präsidentenamt zentriert. Der Chef des OSTP, der Science Advisor to the President, ist dennoch deutlich weniger einflussreich als es vielleicht zunächst den Anschein macht, sagt dazu Roger Pielke. Ein ausführliches Interview mit dem renommierten Berater und Verfasser des Honest-Broker-Konzepts lesen Sie hier, alle Texte der Serie finden Sie hier.
Ich wünsche Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre,
Wenn Ihnen der Research.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail weitergeleitet wurde: Hier können Sie sich für den Research.Table kostenlos anmelden.


In den USA ist die wissenschaftliche Politikberatung stark von Washington geprägt und zentriert sich insbesondere um das Präsidentenamt. Wichtige staatliche Beratungseinrichtungen sind die der deutschen Leopoldina ähnelnde National Academies of the Sciences, Engineering, and Medicine (NASEM) und das im Weißen Haus angesiedelte Office of Science and Technology Policy (OSTP). Dessen Hauptaufgabe ist es, den Präsidenten über relevante Entwicklungen im Bereich von Wissenschaft und Technologie zu beraten.
Der Chef des OSTP, der Science Advisor to the President, ist deutlich weniger einflussreich als es vielleicht zunächst den Anschein macht, betont Roger Pielke im Gespräch mit Table.Media. Der Professor an der University of Colorado Boulder ist beim Thema wissenschaftliche Politikberatung wohl der meistzitierte Wissenschaftler überhaupt. Als Idealtypus des Beraters hat Pielke den einflussreichen Honest-Broker beschrieben. Der ehrenhafte Vermittler versucht, Wissenschaft mit Politik zu verbinden, dabei aber nicht parteiisch zu werden.
Weil das OSTP nicht vom Präsidenten selbst, sondern 1976 per Gesetz vom Kongress etabliert wurde, sei dessen Chef im Unterschied zu vielen anderen Beratern des Präsidenten im Zweifel gesetzlich dazu verpflichtet, vor dem Kongress auszusagen. Daher gehöre er selten zum inneren Beraterkreis des Präsidenten und auch während der Corona-Pandemie wurde das OSTP von Ad-Hoc-Beratungsstrukturen wie der White House Coronavirus Taskforce in den Schatten gestellt. Letzterer gehörte etwa Gesundheitsexperte Anthony Fauci an.
Unabhängig davon, dass der Chef des OSTP dadurch in den USA strukturell marginalisiert wird, ist seine Funktion durchaus interessant, weil sie der wissenschaftlichen Politikberatung ein Gesicht gibt. Trotzdem kann sich Martin Thunert, Experte für Politikberatung an der Universität Heidelberg, einen deutschen Chief Science Advisor nur schwer vorstellen. In einem Mehrparteiensystem sei die Ansiedlung eines solchen Experten im Kanzleramt oder an einem spezifischen Ministerium nur schwer vorzustellen, sagte Thunert.
Minister aus anderen Parteien würden möglicherweise mit Argwohn auf diese Person schauen und ihre eigenen Kompetenzen aufbauen. Das würde die ressortübergreifende Tätigkeit eines Experten enorm erschweren, meint Martin Thunert. In Deutschland, wo durch die Ressortforschung bereits eine konkurrierende Beratungsstruktur etabliert ist und Exekutivmacht sowieso weniger zentralisiert ist, wäre gar nicht klar, wozu das Amt so eines wissenschaftlichen Chefberaters funktionell noch gut wäre.
Thunert gibt zu bedenken, dass diese aus dem Präsidial- und Zweiparteiensystem der USA erwachsenden Unterschiede sich auch aus historischen Konstellationen heraus entwickelt haben. Insgesamt sei die wissenschaftliche Politikberatung in Deutschland schon immer dezentraler als in den USA. Daraus folge zwar nicht, dass Deutschland zu einer “zerklüfteten” Beratungsstruktur verdammt sei, es sei aber zu beachten, dass man “nationale oder regionale Spezifika nicht mit einer einzigen Reform wegwischen und in eine vorgeblich modernere Matrix übersetzen kann”.
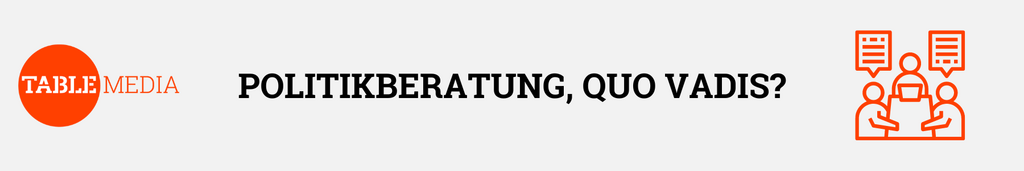
Einrichtungen wie die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (gegründet 1700) oder die Leopoldina (gegründet 1652) seien deutlich älter als die 1863 gegründete US-amerikanische National Academy of Sciences (NAS). Zu beachten sei aber, dass die inzwischen in der NASEM eingegliederte NAS von Anfang an eine nationale Akademie war. In Deutschland existierte derweil bis zur Erhebung der Leopoldina zur Nationalakademie im Jahr 2008 keine vergleichbare Einrichtung nach dem 2. Weltkrieg.
Ein weiterer, eher informeller Unterschied zwischen Deutschland und den USA ist die Selbstverständlichkeit, mit der in den Vereinigten Staaten ein Karrierewechsel zwischen Wissenschaft, Beratung und Politik möglich ist. Annette Heuser, die während der Amtszeiten von Barack Obama das Washington-Büro der Bertelsmann-Stiftung aufgebaut und geleitet hat, bezieht sich dabei auf das sogenannte “Revolving Door”-Prinzip, das insbesondere in den USA gängige Praxis ist.
Die Drehtür steht für die Rotation vieler Politiker und Wissenschaftler zwischen aktiver Politik, Wissenschaft und Wirtschaft. Dieser Wechsel liefert den Spezialisten Erfahrungswissen in unterschiedlichen Systemen. Das deutsche System sei leider undurchlässiger, sagt Annette Heuser. Es herrsche gerade in der deutschen Wissenschaft immer noch die Sorge vor, die eigene Glaubwürdigkeit durch Beratungsaktivitäten zu gefährden, erzählt Heuser. “Im Unterschied zu den USA wird in Deutschland der Wert solcher Karrierewechsel weniger anerkannt.”
Die engmaschigere Vernetzung zwischen Beratung und Politik kann auch im Krisenfall von Nutzen sein, sagt Heuser. So sei es in den USA üblich, Testläufe durchzuführen, in welchen sich größere Thinktanks gemeinsam mit dem US-Innen- und Verteidigungsministerium auf potenzielle Krisenszenarien vorbereiten, beispielsweise Angriffe auf die kritische Infrastruktur. Solche “Trockenübungen” hält Heuser in Zeiten von Klimakrise und Ukrainekrieg auch in Deutschland für eine gute Idee.
Trotz der intensiveren Vernetzung auf der informellen Ebene fehlt aber auch in den USA ein formalisierter Mechanismus, der Ad-hoc-Beratung in Krisensituationen vorbereitet und Auswahlkriterien für Beraterrollen transparent macht. Roger Pielke merkt hierzu kritisch an: “Während der gesamten Zeit der Pandemie, sowohl unter Trump als auch unter Biden, gab es kein hochrangiges Beratungsgremium zu Covid. Für mich ist das ein massives institutionelles Versagen.” Hier könnte vielleicht die Scientific Advisory Group for Emergencies (Sage) aus Großbritannien ein Vorbild sein – sowohl für Deutschland als auch für die USA. Martin Renz
Ein ausführliches Interview mit Roger Pielke zu seinem Honest-Broker-Konzept und der wissenschaftlichen Politikberatung in den USA finden sie hier
In Teil 6 lesen Sie, wie Politikberatung in Großbritannien läuft. Alle Teile der Serie “Politikberatung, quo vadis?” finden Sie gesammelt hier.
Weitere Informationen:
National Academies of the Sciences, Engineering, and Medicine (NASEM)
Office of Science and Technology Policy (OSTP)
An gleich drei Grundüberzeugungen der künftigen Wasserstoffwelt rüttelt eine neue Analyse, welche die Generaldirektion Energie vor wenigen Tagen veröffentlichte.
Erstellt hat die Studie “The impact of industry transition on a CO₂-neutral European energy system” das Fraunhofer ISI in Karlsruhe im Rahmen von METIS. Ergebnisse dieses Langzeitprojekts zieht die Kommission immer wieder für ihre energiepolitischen Entscheidungen heran.
Grundlage waren Annahmen aus einem Dekarbonisierungsszenario für die Industrie aus der EU-Initiative “Clean Planet for All” aus dem Jahr 2018. Die Forscher modellierten nun den Energiebedarf für das produzierende Gewerbe und leiteten daraus die wirtschaftlichsten Ausbaupfade für die Strom- und Wasserstofferzeugung ab. Weil es sich um eine rein techno-ökonomische Analyse handelt, wurden keine politischen Restriktionen wie die Resilienz der Energieversorgung unterstellt. Trotzdem stellen die Ergebnisse so manche Überzeugung infrage, die in der Wasserstoff-Debatte bislang als gesichert galt.
“Die mitteleuropäischen Länder, darunter Deutschland, Belgien und die Niederlande, haben trotz ihres großen Wasserstoffbedarfs nur eine minimale oder gar keine Wasserstoffproduktion durch Elektrolyse”, heißt es in dem Bericht. Die Elektrolysekapazitäten in der Bundesrepublik sehen die Fraunhofer-Forscher 2050 bei “0 GW”. Dabei strebt die Bundesregierung in ihrer kürzlich aktualisierten Nationalen Wasserstoffstrategie schon bis 2030 zehn Gigawatt an.
Den Grund sieht der EU-Bericht in der Kostenstruktur einer Wasserstoffwirtschaft. Die Kosten für den Transport von H2 seien gegenüber der Produktion gering und benachbarte Länder hätten günstigere Bedingungen. Die führenden Wasserstoffproduzenten in Europa, gestaffelt nach ihren Elektrolyse-Kapazitäten in Gigawatt, wären im Jahr 2050:
“Frankreich hat viele gute Windstandorte“, begründet Fraunhofer-Studienleiter Tobias Fleiter den Spitzenplatz. Beim unterstellten Erneuerbaren-Ausbau in Frankreich zeigen sich aber auch die ersten Grenzen der Studie. Die Berechnungen ergeben für Frankreich 320 Gigawatt Photovoltaik und 300 Gigawatt Windenergie an Land. Die politischen Ziele der französischen Regierung für 2050 bleiben bisher aber deutlich dahinter zurück.
In seiner Belfort-Rede im Februar vergangenen Jahres habe Staatspräsident Emmanuel Macron 100 Gigawatt Photovoltaik und 40 Gigawatt Offshore-Wind als Ziele gesetzt, erklärt das Deutsch-französische Büro für die Energiewende. Auch der jährliche Zubau an Onshore-Wind ist derzeit gering.
Gleichzeitig nimmt die Fraunhofer-Studie an, dass die Stromproduktion der französischen AKW von 360 Terawattstunden im Jahr 2021 auf 206 Terawattstunden zur Mitte des Jahrhunderts zurückgeht. Plausibel ist das nur, wenn man annimmt, dass alte Meiler weitaus schneller stillgelegt als neue errichtet werden. Bei höheren Anteilen von Atomstrom wären die Elektrolysekapazitäten wohl geringer, schätzt Fleiter.
Ein leicht anderes Bild ergibt sich auch in einem Szenario, in dem nur 70 Prozent der europäischen Erneuerbaren-Potenziale ausgeschöpft werden. Dann mache Elektrolyse auch in Deutschland Sinn, sagt Co-Autor Khaled Al-Dabbas. Die Kapazitäten seien aber immer noch gering. Auch in einem unveröffentlichten Szenario mit geringeren Leitungskapazitäten gebe es eine höhere Wasserstoffproduktion in Deutschland. “Für Deutschland würde es aber auf jeden Fall die Kosten senken, die europäische Integration stärker mitzudenken”, resümiert Fleiter.
Entgegen vieler politischer Initiativen in Brüssel und Berlin halten die Forscher die Selbstversorgung mit Wasserstoff für Europa nicht nur für möglich, sondern sogar für günstiger als Importe. “Das war auch für die Kommission interessant”, verrät Fleiter. “Es zeigt, wie gewaltig und kostengünstig die Erneuerbaren-Potenziale in der EU noch sind.”
Ein leicht anderes Bild ergibt sich wieder bei einem um 30 Prozent vermindertem Erneuerbaren-Ausbau. Nötig wäre ein minimaler Import von 160 Terawattstunden Wasserstoff per Pipeline aus Marokko – angesichts einer Erzeugung von 3.000 Terawattstunden in Europa ein immer noch geringer Anteil.
Schiffstransporte von Wasserstoffderivaten und Grundprodukten für die Düngemittel-, Chemie- und Stahlindustrie könnten dennoch eine bedeutende Rolle spielen. Denn in einem weiteren Szenario hat das ISI berechnet, welche Folgen es hätte, wenn Ammoniak, Ethylen und Eisenschwamm nicht mehr in Europa hergestellt, sondern importiert würden. Wenn man nur diese drei Produkte ersetzt, würde der Wasserstoffbedarf um ein Drittel sinken. “Wir hätten fast ein anderes Energiesystem”, sagt Fleiter.
Zum einen wären die Importe von Wasserstoffderivaten gerade in Deutschland deutlich geringer. Überflüssig wären damit aber auch die meisten Offshore-Windparks. Die nötigen Kapazitäten würden sich um 60 Prozent verringern. Auch viele Solaranlagen auf Dächern würden rein ökonomisch gesehen nicht benötigt.
Viele Unternehmen aus den Grundstoffindustrien hätten aber noch unterschiedliche Präferenzen für die Dekarbonisierung, berichtet Fleiter: “Einige wollen grünen Methanol und Ammoniak importieren, andere lieber Wasserstoff.” Je nach Strategie würden manche Fertigungsstufen in der EU verbleiben, andere nicht. Der Wasserstoffbedarf der Industrie sei eben noch sehr unsicher und nicht unbedingt eine No-regret-Maßnahme, wie oft angenommen.
Neu: Agrifood.Table Professional Briefing – jetzt kostenlos anmelden. Wie unsere Lebensgrundlagen geschaffen, gesichert und reguliert werden. Für die entscheidenden Köpfe in Landwirtschaft und Ernährung in Politik und Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft, Verbänden und NGO. Von Table.Media. (Anmelden)
6. September 2023, Allianz Forum, Pariser Platz 6, Berlin
Preisverleihung Unipreneurs: Die besten Professorinnen und Professoren für Startups Mehr
11.-13. September 2023, Osnabrück
18. Jahrestagung der Gesellschaft für Hochschulforschung Das Zusammenspiel von Hochschulforschung und Hochschulentwicklung: Empirie, Transfer und Wirkungen Mehr
20.-22. September 2023, Hyperion Hotel, Leipzig
Konferenz SEMANTiCS und Language Intelligence 2023 Mehr
27.-29. September 2023, Freie Universität Berlin
Gemeinsame Konferenz der Berliner Hochschulen Open-Access-Tage 2023 “Visionen gestalten” Mehr
Der taiwanische Weltmarktführer TSMC baut ein Chip-Werk in Dresden. Die Eckpunkte des Projekts entsprechen sehr genau den Berichten von Table.Media vom Mai und aus dem vergangenen Jahr, die noch auf informierten Quellen beruhten:
Die genaue Investitionssumme steht offiziell noch nicht fest, weil sie von staatlicher Förderung abhängt, die ihrerseits noch nicht formal freigegeben ist. Sie wird aber sicher in der Größenordnung von zehn Milliarden Euro liegen. Rund die Hälfte davon kommt als Förderung vom Staat. Nur so hat die TSMC-Angabe Sinn, maximal dreieinhalb Milliarden Euro an Eigenmitteln zur Verfügung zu stellen.
Ohne die hohe Subvention wäre TSMC sicher nicht gekommen. Die Ausgabe entspricht aber sowohl den Sicherheits- und China-Strategien der Bundesregierung als auch dem europäischen Vorgehen. In der Mitteilung von TSMC ist ausdrücklich der EU-Chips-Act erwähnt. Die Unternehmen wollen also Mittel aus den europäischen Töpfen abrufen.
In der Fabrik sollen vor allem zwei Klassen von Mikrochips entstehen:
Diese Art von Chips entspricht dem Stand, der um 2015 herum neu und modern war. Das ist immerhin besser als ursprünglich angenommen – die ersten Berichte über das Werk waren nur von 22 Nanometer-Technik ausgegangen, die wiederum um 2010 herum aktuell war.
Doch auch 12 Nanometer sind nicht die Vorhut der Technologie-Entwicklung. Im Vergleich mit den TSMC-Investitionen in den USA wirkt das besonders schmerzhaft: Dort stellt das taiwanische Unternehmen modernste Produkte her. Was TSMC dagegen nach Dresden bringt, heißt im Jargon “reife Technologie”.
Der deutschen Fahrzeugbranche sind diese Chips aktuell dennoch zu modern. Sie brauche deutlich einfachere Ware mit Strukturbreiten um 90 Nanometer, sagte ein Sprecher des Verbands der Automobilindustrie (VDA) am Dienstag in Berlin. Die Autoindustrie benötige zwar durchaus auch die Technologien, die bei ESMC entstehen werden. Dennoch werde der direkte Effekt des Werks in Dresden auf die eigene Unabhängigkeit nur begrenzt sein.
Der Präsident des RWI-Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung, Christoph Schmidt, ist skeptisch. Es sei zweifelhaft, dass die Subvention dem Land langfristig mehr bringe, “als wenn man die gleichen Mittel in die Forschung und Entwicklung etwa von Speichertechnologien oder in die Infrastruktur für den Import und Transport von Wasserstoff stecken würde”, sagte Schmidt der “Rheinischen Post”.
In ihrer Erklärung hoben die Chip-Unternehmen hervor, dass mit der Investition 2000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Diese Botschaft wird in der Branche aber nicht nur Beifall auslösen, denn die Halbleiter-Hersteller haben derzeit ohnehin schon Probleme, ihre offenen Stellen besetzen zu können.
Fachkräfte werden händeringend gesucht, die die neuen Chip-Werke in Sachsen und Sachsen-Anhalt werden zu einer Herausforderung für die Hochschulen in ganz Deutschland, die für den notwendigen Nachwuchs sorgen müssen. Das Institut für Halbleiter- und Mikrosystemtechnik an der Technischen Universität Dresden allein wird diese Aufgabe nicht meistern können. fmk / nik
Laut einem Bericht der Financial Times haben die Wissenschaftler am Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) ihren viel beachtetes Fusionsexperiment aus dem Dezember wiederholt und diesmal einen leicht höheren Nettoenergiegewinn erzielt. Der Fusionsreaktor der National Ignition Facility (NIF) des Labors erzeugte mithilfe von Lasern genügend Wärme und Druck, um Deuterium und Tritium – Isotope von Wasserstoff – in ein Plasma umzuwandeln, in dem eine Fusion stattfinden kann.
Die Laser geben 2,1 Megajoule Energie ab, der Reaktor produzierte damals etwa 2,5 Megajoule, was einer Steigerung von etwa 20 Prozent entspricht. Berichten zufolge hat das Labor nun eine zweite Zündung erfolgreich durchgeführt. Dabei wurde laut Financial Times der Nettogewinn noch einmal erhöht und der Reaktor produziert etwa 3,5 Megajoule. Laut dem Bericht fand das Experiment am 30. Juli statt.
Gegenüber dem Wissenschaftsmagazin New Scientist bestätigten die Forscher des LLNL das Experiment: “Seitdem wir im Dezember 2022 zum ersten Mal die Fusionszündung an der National Ignition Facility demonstriert haben, führen wir weiterhin Experimente durch, um dieses aufregende neue wissenschaftliche Regime zu untersuchen. In einem am 30. Juli durchgeführten Experiment haben wir die Zündung am NIF wiederholt. Die Analyse dieser Ergebnisse ist im Gange.”
Das Experiment war international auf viel Beachtung gestoßen, weil Wissenschaftler zum ersten Mal einen Nettogewinn durch die laserbasierte Kernfusion erreichen konnten. Allerdings bezieht sich dieses Energie-Plus nur darauf, dass die Leistung des Reaktors höher ist, als die Leistung des Lasers.
Im Interview mit Table.Media hatte Max-Planck-Forscherin Sibylle Günter zum Experiment im Dezember erklärt: “Das ist ein tolles Ergebnis. Doch für die Erzeugung der eingesetzten Laserenergie von 2,1 Megajoule war etwa 150-mal mehr Energie notwendig als in der Reaktorkammer ankam. Also ist die eingesetzte Energie um mehr als einen Faktor 100 höher als das, was an Wärmeenergie am Ende frei wurde.” Bis zu einem kommerziell nutzbaren Fusionsreaktor sei es noch ein sehr weiter Weg, sagte Günter im Januar.
Trotzdem hatten die Ergebnisse des NIF auch für Deutschland eine Signalwirkung. Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger hatte im Zusammenhang mit den Ereignissen davon gesprochen, dass es innerhalb eines Jahrzehnts erste Fusionskraftwerke auch in Deutschland geben könne. Inzwischen hat sie sich von dieser ambitionierten Schätzung distanziert. Sie setzt sich aber weiter dafür ein, die laser- und magnetbasierten Verfahren technologieoffen zu fördern. Bislang hatte Europa mit Iter einen Schwerpunkt auf Magnetfusions-Verfahren gelegt. tg
Der Start der neuen europäischen Trägerrakete Ariane 6 verschiebt sich weiter. Der Erstflug werde nun für 2024 anvisiert, schrieb der Chef der in Paris sitzenden europäischen Raumfahrtagentur Esa, Josef Aschbacher, am Dienstag auf Twitter. Einen genaueren Launch-Zeitraum könne man erst nach weiteren Tests im September nennen. Ursprünglich sollte die Rakete bereits 2020 starten, dies wurde mehrfach verschoben. Zuletzt hatte die Esa geschätzt, dass die Ariane 6 erstmals im letzten Quartal 2023 abheben werde.
Die Ariane 6 soll Satelliten für kommerzielle und öffentliche Auftraggeber ins All befördern und ist deutlich günstiger als ihre Vorgängerin. Europas Raumfahrt soll sie wettbewerbsfähiger machen. Anfang Juli war zum letzten Mal eine Ariane-5-Rakete ins All gestartet. Seitdem hat die Esa keine eigenen Mittel mehr, um große Satelliten in den Weltraum zu bringen. Der verschobene Erstflug der Ariane 6 bedeutet, dass diese Situation länger andauern wird.
Das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum (DLR) teilte auf Anfrage von Table.Media mit, dass die Verschiebung des Ariane-6-Erststarts nach 2024 für die Weltraumforschung und den Betrieb von Weltraummissionen in Europa handhabbar sei. Mit dem letzten Start einer Ariane 5 am 6. Juli 2023 habe Deutschland mit der Heinrich-Hertz-Mission noch einen wichtigen Satelliten in den Orbit gebracht.
Der für 2024 geplante Ariane-Start der Asteroidenmission Hera wurde bereits auf eine Falcon 9-Trägerrakete umgelegt. Die nächsten Ariane-Starts einer europäischen Mission im Erdbeobachtungsprogramm mit großer deutscher Beteiligung wären Meteosat Third Generation (MTG) und Metop-SG im Jahr 2025. Im Wissenschaftsprogramm soll die Exoplaneten-Mission Plato im Jahr 2026 wieder mit Ariane starten.
Schwerer wiegen würden die Umplanungen der Starts, die für die Sojus-Träger vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou gelistet waren, und die aufgrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gestrichen wurden, teilte das DLR mit. Davon sei etwa das gerade gestartete europäische Weltraumteleskop Euclid betroffen gewesen, das schließlich am 1. Juli 2023 mit einer Falcon 9 von SpaceX gestartet wurde – der erste Esa-Start mit einer Falcon 9 überhaupt. Vom Wegfall der Sojus seien ebenso die bereits geplanten Starts des europäischen Satellitennavigationssystems Galileo betroffen. tg mit dpa
Elon Musks Firma Neuralink, die das Gehirn mithilfe von Implantaten mit einem Computer verbinden will, hat sich frisches Geld bei Investoren besorgt. Die 280 Millionen Dollar schwere Finanzierungsrunde sei vom Wagniskapitalgeber Founders Fund des Technologie-Investors Peter Thiel angeführt worden, teilte Neuralink mit. Das geplante Gerät der Firma soll mit feinen Elektroden direkt mit dem menschlichen Gehirn verbunden werden.
Neuralink forscht zunächst an medizinischen Anwendungen. Das erste Ziel ist, dass Menschen, die sich nicht bewegen können, durch ihre Gedanken einen Computer bedienen. Später soll es darum gehen, Sehkraft und Sprache mithilfe von Technologie wiederherzustellen – und Tech-Milliardär Musk spricht auch von einer Zukunft, in der Menschen durch die Verbindung zum Computer ihre Fähigkeiten erweitern. Neuralink bekam in diesem Jahr in den USA die Zulassung für klinische Tests an Menschen. tg/dpa
Forschung & Lehre. Wie sich Universitäten vor Cyberangriffen schützen. Die Universität Gießen wurde 2019 Opfer eines Cyberangriffs. Nach dem Vorfall wurden verschiedene Maßnahmen ergriffen, um sich besser vor zukünftigen Angriffen zu schützen. Die Hochschule hat ihre IT-Sicherheitsstruktur neu aufgestellt und Bewusstsein für sicherheitsrelevante Themen geschaffen. Die Lehre aus dem Vorfall: Universitäten sollten in IT-Sicherheit investieren und Kooperationen und Beratungsangebote auf nationaler Ebene etablieren. Mehr
RiffReporter. “Wir ertrinken in Daten”: Projekt will deutsche Forschungsdaten nutzbarer machen. Beispielhaft für ein Projekt der TU Darmstadt beschreibt der Artikel, an welche Hürden Forscher stoßen, wenn sie Daten öffentlich zugänglich machen wollen. Die Herausforderungen dabei sind, Daten hochwertig, nachhaltig und ethisch vertretbar bereitzustellen und dabei eine neue wissenschaftliche Fehlerkultur zu etablieren. Die entscheidende Frage ist zudem, welche Daten überhaupt relevant sind. Mehr
ScienceBlog. Many People Feel Their Jobs Are Pointless. Soziologen der Universität Zürich haben in einer Studie herausgefunden, dass ein beträchtlicher Anteil der Arbeitnehmer ihre Arbeit als sozial nutzlos empfindet. Besonders gilt das in Finanz-, Vertriebs- und Managementberufen. Aus den Ergebnissen der Gruppe um Simon Walo lässt sich erkennen, dass die Art des Berufs einen großen Einfluss auf die wahrgenommene Sinnlosigkeit hat, unabhängig von Routine, Autonomie oder Managementqualität. Mehr
Rudolf Gross ist seit 1. August 2023 Wissenschaftlicher Leiter des Munich Quantum Valley (MQV) und Geschäftsführer des Munich Quantum Valley e.V. Der Physiker übernimmt die Aufgaben von Rainer Blatt.
Jan Tuckermann von der Universität Ulm ist seit Juli Präsident der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie (DGE). Der Biologe leitet in Ulm das Institut für Molekulare Endokrinologie der Tiere.
Hans-Georg Kräusslich ist zum neuen Präsidenten der Heidelberger Akademie der Wissenschaften gewählt worden. Die Amtszeit des Virologen beginnt zum 1. Oktober 2023. Er folgt dem Historiker Bernd Schneidmüller.
Sven Tode wird neuer Präsident der Hochschule Flensburg. Der 58-jährige Historiker und SPD-Politiker der Hamburgischen Bürgerschaft löst den bisherigen Präsidenten Christoph Jansen ab.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!
Bildung.Table. Nordrhein-Westfalens Schulministerin über Abbau von Bürokratie und Aufbau von KI. Sie will die Fehler ihrer Vorgänger vergessen und Grundschulen in den Mittelpunkt ihrer Politik stellen. Im Gespräch mit Table.Media erklärt Dorothee Feller, wie sie die überbordende Bürokratie abbauen will – die Eltern erzeugen. Mehr
Bildung.Table. Brückenklassen: Planlos ins neue Schuljahr. Der Ukraine-Krieg drängt Schulen die Frage auf, wie Integration gelingen kann. Bayern behauptet, ein erfolgreiches Modell entwickelt zu haben. Doch Lernziele für Brückenklassen existieren kaum – genauso wie Daten über den erfolgreichen Übergang in Regelklassen. Mehr
China.Table. Wie KI in China der Überwachung und Manipulation dient. Künstliche Intelligenz hat die Möglichkeiten für die chinesische Regierung zur Überwachung ihrer Bürger drastisch erhöht. Die Unternehmen können immer neue Innovationen entwickeln, weil der Staat sie mit wertvollen Datensätzen versorgt. Alarmierend: China exportiert die Technik auch ins Ausland. Mehr
China.Table. Chinesische Heimat in Hamburg. In Hamburg steht das einzige chinesische Seemannsheim der Welt. Seine Ursprünge reichen hundert Jahre zurück und erzählen auch die Geschichte der Familie Chen. Die Aufgaben haben sich geändert, der Besitz jedoch bleibt – bald in vierter Generation. Mehr
Climate.Table. KI im Klimaschutz: Potenziale und Risiken. Künstliche Intelligenz kann auch für den Klimaschutz genutzt werden. Unternehmensberatungen und Wissenschaftler sehen noch viel ungenutztes Potenzial. Doch es bestehen auch Risiken durch einen erhöhten Energieverbrauch und klimaschädliche Anwendungen. Mehr
ESG.Table. Künstliche Intelligenz ist eine “extraktive Industrie”. Weil Daten fehlen und Tech-Konzerne mauern, fallen Ökobilanzen von Künstlicher Intelligenz schwer. Erste Analysen zeigen aber: Nachhaltig ist die Technologie bislang kaum. Mehr
Security.Table. Russlands nukleare Geopolitik im Mittelmeerraum. Moskaus Konzern Rosatom baut im Mittelmeerraum mehrere neue Atomkraftwerke. Putins Regime macht damit nicht nur andere Autokraten von sich abhängig. Es befördert auch das Risiko der Verbreitung von Nuklearwaffen. Mehr
Die Würfel sind gefallen, soweit man das bei einem so komplexen Multimilliarden-Projekt wie der Magdeburger Chipfabrik jemals final sagen kann. Überwiegend nicht-europäische Chiphersteller werden aus dem 180 Milliarden starken Schattenhaushalt des Klima- und Transformationsfonds mit 20 Milliarden subventioniert: vor dem Hintergrund geopolitischer Konflikte, der Notwendigkeit der Lieferketten-Diversifizierung und technologischer Souveränität in ausgewählten Hightech-Bereichen politisch so entschieden.
10 Milliarden dieser Beihilfe werden für ein neues Wafer-Werk von Intel in Magdeburg ausgegeben – die FAZ betitelte es einst als das Wunder von Magdeburg. 5 Milliarden sind für eine Chipfabrik der Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) in Dresden vorgesehen. TSMC hat gestern final den Bau der Fabrik beschlossen. Infineon bekommt eine Milliarde für ein Halbleiterwerk in Dresden und ZF/Wolfsspeed rund 750 Millionen für eine Siliciumkarbid-Chip Anlage im Saarland.
Ich will mich auf die Hauptinvestition in Magdeburg konzentrieren, verkneife mir also über Sinn oder Unsinn dieser Milliarden-Beihilfe, über Probleme in der Versorgungssicherheit, Wasserknappheit, hohe Energiepreise zu schreiben und fokussiere mich auf die Umsetzung in Magdeburg, also die Themen Fachkräftesicherung und Erweiterung oder Optimierung eines Semiconductor-Ökosystems, insbesondere auch in der Forschung.
Standortentscheidungen sind hochkomplex, betreffen sie doch meist nicht nur eine Entity, sondern ein gesamtes Ökosystem. Erst recht, wenn es um High- und Deep-Tech geht. Vor über 20 Jahren veröffentlichte der US-amerikanische Ökonom und Soziologe Richard Florida sein bahnbrechendes Werk ‘The Rise of the Creative Class’, in welchem er die Bedingungen für das Wachstum einer Hightech-Region postulierte: Talent, Technologie und Toleranz.
Drei Faktoren, die auch zentral für die Standortentscheidung einer Hightech-Fabrik sind. Schließlich will Intel 3000 Mitarbeitende einstellen, mehr als 2000 davon als Spezialisten in der Chipfertigung. Fachleute sagen mir, dass wir bei Arbeitskräftestrukturen in Halbleiter-Foundries von ca. 30 Prozent akademischen Experten, rund 40 Prozent Spezialisten wie Meister und Techniker und weiteren 30 Prozent Operators, als Fachkräften mit Berufsabschluss und Angelernten auszugehen haben.
Und nicht nur das: Intel sprach in meiner Zeit als Staatssekretär von weiteren bis zu 17.000 Techies, die über die Jahre im sich neu entwickelnden Ökosystem rund um die Foundry tätig sein werden. Diese Zahl scheint unter Einbezug des Ökosystems in Dresden hoch gegriffen, doch selbst bei einer Halbierung sprechen wir von erheblichen vieltausendfachen Spezialisten- und Expertenbedarfen in Magdeburg
Ich folge Gabor Steingarts Morning Briefing nicht, wenn es simplifizierend formuliert, es sei zutiefst unanständig, wie die Ampel das von deutschen Bürgerinnen und Bürgern hart erarbeitete Steuergeld einem US-Konzern in den Rachen werfe, nur weil er verspreche, Arbeitsplätze zu schaffen.
Tiefschürfender kommentieren Wissenschaftler wie Oliver Holtemöller, stellvertretender Präsident des Leibnitz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle: Niemand stehe Schlange, um in Sachsen-Anhalt arbeiten zu dürfen – und dies in einer Stadt ohne Flughafen, ohne regelmäßigen Intercity-Anschluss und ohne ausreichende internationale Schulinfrastruktur!
Noch dazu in Bundesland, in dem die Bevölkerung seit vielen Jahren schrumpft (derzeit: 2,2 Millionen Einwohner) und so alt ist wie in kaum einem anderen Teil Deutschlands. Angesichts der skizzierten Qualifikationsstruktur der Foundry und wohl auch des prognostizierten Magdeburger Ökosystems hilft auch nicht der Verweis auf 25.000 Arbeitslose im Norden von Sachsen-Anhalt, mit dem der Chef der örtlichen Arbeitsagentur, Matthias Kaschte, die Experten- und Spezialistenlücke kleinredete. Zudem wird Magdeburg im Arbeitskräftewettbewerb mit dem Chipzentrum Dresden deutlich kannibalisiert werden. Die Ansiedlung von TSMC wird dies verstärken.
Da wäre es schon interessant, an der Elektrotechnik-Fakultät der Technischen Universität Braunschweig mal zu fragen, wie viel Absolventen sich, denn einen Arbeitsplatz bei Intel in Magdeburg vorstellen können. Und es wäre interessant, die Universität Magdeburg zu fragen, wie viele Absolventen von Mikroelektronik-Studiengängen oder verwandten Fachrichtungen sie 2025-bis 2030 bereitstellen kann.
Holtemöller spricht auch den massiven Standortnachteil Fremdenfeindlichkeit an, was einer heranwachsenden internationalen Tech-Community von Beginn an den Wasserhahn abdreht. Hier hat Regierungschef Haselhoff, der stark auf Zuwanderung setzt, ein fast nicht durch zu bohrendes dickes Brett vor der Brust. Eine aktuelle Wahlprognose spricht von 26 Prozent für die AFD in Sachsen-Anhalt, in dessen Landeshauptstadt Magdeburg jüngst der Parteitag der AfD stattgefunden hat.
Bei der Analyse der akademischen Semiconductor-Forschung stellt man fest, dass es in ganz Europa eigentlich nur einen ganz großen Spieler gibt, die IMEC im belgischen Leuven in enger Kooperation mit der Universität in Leuven, gefolgt von der CEA-Leti in Grenoble, dem wohl größten französischen Forschungsinstitut für Elektronik und Informationstechnologie – allerdings abgeschlagen von den USA. Deutschland ist hier unter ferner liefen.
Um den Vergleich zu illustrieren: 2019 hat das IMEC fast 50 Prozent der angefragten europäischen Research Papers für die führenden Konferenzen auf diesem Feld beigesteuert. Zum Vergleich mit Deutschland: Während der Fraunhofer Mikroelektronik-Verbund und insbesondere Dresden von 1995 bis 2022 ganze 62 Papers beigetragen hat, trug das IMEC allein zwischen 2010 bis 2022, also in weniger als der Hälfte der Jahre, mit rund 240 Veröffentlichungen das Vierfache bei.
Die Stiftung Neue Verantwortung hat dazu im Juni dieses Jahres eine Studie mit dem Titel “Who is developing the chips of the future?” veröffentlicht. Unter den weltweit Top 20 jeweils aus Unternehmensforschung und aus akademischer Forschung beitragenden Organisationen ist in dieser Studie auf der Seite der Wirtschaft Infineon das einzige genannte deutsche Unternehmen, welches aber seit 2010 immer weniger an Forschungspapers beiträgt. Auf der akademischen Seite also eine komplette Nullnummer.
Dies deckt sich auch mit der Aussage von Experten, dass Fraunhofer in Fachgesprächen mit IMEC und LETI kaum proaktiv und IMEC voll im Lead ist. Da seit 2010 die ‘Research Power’ der EU-Semiconductor-Industrie abnimmt, nehmen zudem auch die innereuropäischen Kooperationen zwischen beiden Forschungsektoren ab, beziehungsweise verlagern sich im akademischen Forschungsbereich hin zu Kooperationen mit außereuropäischen Firmen.
Natürlich sprechen wir hier nur über den Indikator “research paper”, aber er ist der zentrale und einzige derzeit verfügbare Indikator. Übrigens war in der Studie nicht die geringste Rede von der Universität Magdeburg und deren etwaiger Forschungsleistung.
Üblicherweise schreibe ich hier zum Schluss unter der Headline ‘innovating innovation’ meine Handlungsempfehlungen. Heute geht es mir darum, die Umsetzungsrisiken dieser Investition zu mitigieren.
1. Die Bundesregierung hat eine quantitative und qualitative Analyse zur Fachkräftesicherung vorzulegen, die regionale wie überregionale bzw. internationale Talentquellen benennt. Das muss Hand in Hand gehen mit einem Maßnahmenplan zur Gewinnung und Bindung. Dies alles Intel zu überlassen, wäre fahrlässig. Globale Konzerne haben ihre nomadische Logik.
2. Das Land Sachsen-Anhalt und die Stadt Magdeburg haben auf den Feldern schulische und hochschulische Bildung, Wohnungsangebote, Freizeitinfrastruktur, Integrationsinitiativen, Willkommenskultur ein Planungskonzept für eine internationale Tech- Community zu erarbeiten.
3. Die deutsche Mikroelektronik-Industrie und ihre Zulieferer formulieren ihre Forderungen an den Aufbau des Magdeburger Ökosystems und den Einbezug der Magdeburger Initiative in das weitgefasstere Dresdner Ökosystem, aber bitte schön mit einer Stimme. Und die klar!
4. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hat ein unabhängiges und internationales Review der Stärken und Schwächen des Mikroelektronik-Verbundes von Fraunhofer und der Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutschland (FMD) im europäischen und internationalen Vergleich zu initiieren. Verbunden damit ist ein Maßnahmenplan zur Steigerung der Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit der angewandten Forschung auf dem Feld.
5.TU Dresden-Professor Hubert Lakner, gleichzeitig Chef des Dresdner Fraunhofer-Instituts für Photonische Mikrosysteme (IMPS), sowie Albert Heuberger, Chef des Mikroelektronik Verbunds, berichten auf Grundlage des Reviews und dessen Forderungen zur Stärkung des Dresdener wie generell der deutschen Seite im europäischen Ökosystem zu Projektfortschritt anhand von Output -und Impactfaktoren.
Mit Blick auf die obigen Punkte wäre es innovativ, wenn die interessierte Community halbjährlich in einer öffentlichen Online-Projekt-Review Fragen stellen und – anhand einer fortschrittsorientierten Indikatorik – Feedback geben könnte.
die Woche begann mit einem Paukenschlag: Die Meldung, dass Marvel Fusion die Entwicklung eines Kernfusion-Kraftwerks jetzt in den USA vorantreiben wird, sorgte für deutliche Kritik in der Wissenscommunity. Derartige Investitionsentscheidungen müssten endlich Weckrufe für Deutschland sein, sagte uns Helmut Schönenberger, Geschäftsführer der Unternehmer TUM aus München. “Unser Land verliert jeden Tag mehr den Anschluss an die führenden Technologie- und Wirtschaftsnationen. Beim Wachstum sind wir jetzt schon Schlusslicht der Industrienationen.”
Immerhin: Am Dienstag konnte Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger dann Erfreuliches für den Standort vermelden: Der taiwanesischer Chiphersteller TSMC kommt nach Dresden. Mit im Gepäck: Einige Milliarden, viele Arbeitsplätze.
Doch die Freude über den nächsten Chip-Konzern, der in Ostdeutschland investieren wird, hält sich in Grenzen: Die Chips, die produziert werden sollen, sind zwar besser als ursprünglich angenommen, doch im Vergleich zu dem, was TSMC in den USA herstellt, längst überholt. Mein Kollege Finn Mayer-Kuckuck berichtet.
Thomas Sattelberger blickt derweil mahnend auf das ostdeutsche Chipwunder: Für Deutschland und die Region gehe es nun darum, die drei Wachstumsbedingungen einer Hightech-Region zu gewährleisten, sagt der frühere Parlamentarische Staatssekretär für Bildung und Forschung: Talent, Technologie und Toleranz. Und genau das könnte schwierig werden. Es gebe berechtigte Befürchtungen, dass die Nachfrage an qualifizierten Fachkräften nicht gedeckt werden könnte.
Zum Wochenausklang möchte ich Ihnen noch Teil fünf unserer Serie “Politikberatung, quo vadis?” empfehlen. Martin Renz berichtet über das System in den USA, etwa über das Office of Science and Technology Policy, das sich stark um das Präsidentenamt zentriert. Der Chef des OSTP, der Science Advisor to the President, ist dennoch deutlich weniger einflussreich als es vielleicht zunächst den Anschein macht, sagt dazu Roger Pielke. Ein ausführliches Interview mit dem renommierten Berater und Verfasser des Honest-Broker-Konzepts lesen Sie hier, alle Texte der Serie finden Sie hier.
Ich wünsche Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre,
Wenn Ihnen der Research.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail weitergeleitet wurde: Hier können Sie sich für den Research.Table kostenlos anmelden.


In den USA ist die wissenschaftliche Politikberatung stark von Washington geprägt und zentriert sich insbesondere um das Präsidentenamt. Wichtige staatliche Beratungseinrichtungen sind die der deutschen Leopoldina ähnelnde National Academies of the Sciences, Engineering, and Medicine (NASEM) und das im Weißen Haus angesiedelte Office of Science and Technology Policy (OSTP). Dessen Hauptaufgabe ist es, den Präsidenten über relevante Entwicklungen im Bereich von Wissenschaft und Technologie zu beraten.
Der Chef des OSTP, der Science Advisor to the President, ist deutlich weniger einflussreich als es vielleicht zunächst den Anschein macht, betont Roger Pielke im Gespräch mit Table.Media. Der Professor an der University of Colorado Boulder ist beim Thema wissenschaftliche Politikberatung wohl der meistzitierte Wissenschaftler überhaupt. Als Idealtypus des Beraters hat Pielke den einflussreichen Honest-Broker beschrieben. Der ehrenhafte Vermittler versucht, Wissenschaft mit Politik zu verbinden, dabei aber nicht parteiisch zu werden.
Weil das OSTP nicht vom Präsidenten selbst, sondern 1976 per Gesetz vom Kongress etabliert wurde, sei dessen Chef im Unterschied zu vielen anderen Beratern des Präsidenten im Zweifel gesetzlich dazu verpflichtet, vor dem Kongress auszusagen. Daher gehöre er selten zum inneren Beraterkreis des Präsidenten und auch während der Corona-Pandemie wurde das OSTP von Ad-Hoc-Beratungsstrukturen wie der White House Coronavirus Taskforce in den Schatten gestellt. Letzterer gehörte etwa Gesundheitsexperte Anthony Fauci an.
Unabhängig davon, dass der Chef des OSTP dadurch in den USA strukturell marginalisiert wird, ist seine Funktion durchaus interessant, weil sie der wissenschaftlichen Politikberatung ein Gesicht gibt. Trotzdem kann sich Martin Thunert, Experte für Politikberatung an der Universität Heidelberg, einen deutschen Chief Science Advisor nur schwer vorstellen. In einem Mehrparteiensystem sei die Ansiedlung eines solchen Experten im Kanzleramt oder an einem spezifischen Ministerium nur schwer vorzustellen, sagte Thunert.
Minister aus anderen Parteien würden möglicherweise mit Argwohn auf diese Person schauen und ihre eigenen Kompetenzen aufbauen. Das würde die ressortübergreifende Tätigkeit eines Experten enorm erschweren, meint Martin Thunert. In Deutschland, wo durch die Ressortforschung bereits eine konkurrierende Beratungsstruktur etabliert ist und Exekutivmacht sowieso weniger zentralisiert ist, wäre gar nicht klar, wozu das Amt so eines wissenschaftlichen Chefberaters funktionell noch gut wäre.
Thunert gibt zu bedenken, dass diese aus dem Präsidial- und Zweiparteiensystem der USA erwachsenden Unterschiede sich auch aus historischen Konstellationen heraus entwickelt haben. Insgesamt sei die wissenschaftliche Politikberatung in Deutschland schon immer dezentraler als in den USA. Daraus folge zwar nicht, dass Deutschland zu einer “zerklüfteten” Beratungsstruktur verdammt sei, es sei aber zu beachten, dass man “nationale oder regionale Spezifika nicht mit einer einzigen Reform wegwischen und in eine vorgeblich modernere Matrix übersetzen kann”.
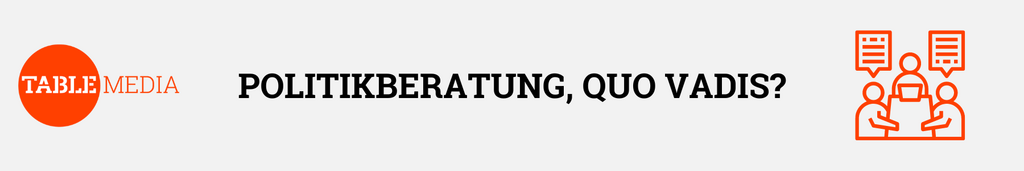
Einrichtungen wie die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (gegründet 1700) oder die Leopoldina (gegründet 1652) seien deutlich älter als die 1863 gegründete US-amerikanische National Academy of Sciences (NAS). Zu beachten sei aber, dass die inzwischen in der NASEM eingegliederte NAS von Anfang an eine nationale Akademie war. In Deutschland existierte derweil bis zur Erhebung der Leopoldina zur Nationalakademie im Jahr 2008 keine vergleichbare Einrichtung nach dem 2. Weltkrieg.
Ein weiterer, eher informeller Unterschied zwischen Deutschland und den USA ist die Selbstverständlichkeit, mit der in den Vereinigten Staaten ein Karrierewechsel zwischen Wissenschaft, Beratung und Politik möglich ist. Annette Heuser, die während der Amtszeiten von Barack Obama das Washington-Büro der Bertelsmann-Stiftung aufgebaut und geleitet hat, bezieht sich dabei auf das sogenannte “Revolving Door”-Prinzip, das insbesondere in den USA gängige Praxis ist.
Die Drehtür steht für die Rotation vieler Politiker und Wissenschaftler zwischen aktiver Politik, Wissenschaft und Wirtschaft. Dieser Wechsel liefert den Spezialisten Erfahrungswissen in unterschiedlichen Systemen. Das deutsche System sei leider undurchlässiger, sagt Annette Heuser. Es herrsche gerade in der deutschen Wissenschaft immer noch die Sorge vor, die eigene Glaubwürdigkeit durch Beratungsaktivitäten zu gefährden, erzählt Heuser. “Im Unterschied zu den USA wird in Deutschland der Wert solcher Karrierewechsel weniger anerkannt.”
Die engmaschigere Vernetzung zwischen Beratung und Politik kann auch im Krisenfall von Nutzen sein, sagt Heuser. So sei es in den USA üblich, Testläufe durchzuführen, in welchen sich größere Thinktanks gemeinsam mit dem US-Innen- und Verteidigungsministerium auf potenzielle Krisenszenarien vorbereiten, beispielsweise Angriffe auf die kritische Infrastruktur. Solche “Trockenübungen” hält Heuser in Zeiten von Klimakrise und Ukrainekrieg auch in Deutschland für eine gute Idee.
Trotz der intensiveren Vernetzung auf der informellen Ebene fehlt aber auch in den USA ein formalisierter Mechanismus, der Ad-hoc-Beratung in Krisensituationen vorbereitet und Auswahlkriterien für Beraterrollen transparent macht. Roger Pielke merkt hierzu kritisch an: “Während der gesamten Zeit der Pandemie, sowohl unter Trump als auch unter Biden, gab es kein hochrangiges Beratungsgremium zu Covid. Für mich ist das ein massives institutionelles Versagen.” Hier könnte vielleicht die Scientific Advisory Group for Emergencies (Sage) aus Großbritannien ein Vorbild sein – sowohl für Deutschland als auch für die USA. Martin Renz
Ein ausführliches Interview mit Roger Pielke zu seinem Honest-Broker-Konzept und der wissenschaftlichen Politikberatung in den USA finden sie hier
In Teil 6 lesen Sie, wie Politikberatung in Großbritannien läuft. Alle Teile der Serie “Politikberatung, quo vadis?” finden Sie gesammelt hier.
Weitere Informationen:
National Academies of the Sciences, Engineering, and Medicine (NASEM)
Office of Science and Technology Policy (OSTP)
An gleich drei Grundüberzeugungen der künftigen Wasserstoffwelt rüttelt eine neue Analyse, welche die Generaldirektion Energie vor wenigen Tagen veröffentlichte.
Erstellt hat die Studie “The impact of industry transition on a CO₂-neutral European energy system” das Fraunhofer ISI in Karlsruhe im Rahmen von METIS. Ergebnisse dieses Langzeitprojekts zieht die Kommission immer wieder für ihre energiepolitischen Entscheidungen heran.
Grundlage waren Annahmen aus einem Dekarbonisierungsszenario für die Industrie aus der EU-Initiative “Clean Planet for All” aus dem Jahr 2018. Die Forscher modellierten nun den Energiebedarf für das produzierende Gewerbe und leiteten daraus die wirtschaftlichsten Ausbaupfade für die Strom- und Wasserstofferzeugung ab. Weil es sich um eine rein techno-ökonomische Analyse handelt, wurden keine politischen Restriktionen wie die Resilienz der Energieversorgung unterstellt. Trotzdem stellen die Ergebnisse so manche Überzeugung infrage, die in der Wasserstoff-Debatte bislang als gesichert galt.
“Die mitteleuropäischen Länder, darunter Deutschland, Belgien und die Niederlande, haben trotz ihres großen Wasserstoffbedarfs nur eine minimale oder gar keine Wasserstoffproduktion durch Elektrolyse”, heißt es in dem Bericht. Die Elektrolysekapazitäten in der Bundesrepublik sehen die Fraunhofer-Forscher 2050 bei “0 GW”. Dabei strebt die Bundesregierung in ihrer kürzlich aktualisierten Nationalen Wasserstoffstrategie schon bis 2030 zehn Gigawatt an.
Den Grund sieht der EU-Bericht in der Kostenstruktur einer Wasserstoffwirtschaft. Die Kosten für den Transport von H2 seien gegenüber der Produktion gering und benachbarte Länder hätten günstigere Bedingungen. Die führenden Wasserstoffproduzenten in Europa, gestaffelt nach ihren Elektrolyse-Kapazitäten in Gigawatt, wären im Jahr 2050:
“Frankreich hat viele gute Windstandorte“, begründet Fraunhofer-Studienleiter Tobias Fleiter den Spitzenplatz. Beim unterstellten Erneuerbaren-Ausbau in Frankreich zeigen sich aber auch die ersten Grenzen der Studie. Die Berechnungen ergeben für Frankreich 320 Gigawatt Photovoltaik und 300 Gigawatt Windenergie an Land. Die politischen Ziele der französischen Regierung für 2050 bleiben bisher aber deutlich dahinter zurück.
In seiner Belfort-Rede im Februar vergangenen Jahres habe Staatspräsident Emmanuel Macron 100 Gigawatt Photovoltaik und 40 Gigawatt Offshore-Wind als Ziele gesetzt, erklärt das Deutsch-französische Büro für die Energiewende. Auch der jährliche Zubau an Onshore-Wind ist derzeit gering.
Gleichzeitig nimmt die Fraunhofer-Studie an, dass die Stromproduktion der französischen AKW von 360 Terawattstunden im Jahr 2021 auf 206 Terawattstunden zur Mitte des Jahrhunderts zurückgeht. Plausibel ist das nur, wenn man annimmt, dass alte Meiler weitaus schneller stillgelegt als neue errichtet werden. Bei höheren Anteilen von Atomstrom wären die Elektrolysekapazitäten wohl geringer, schätzt Fleiter.
Ein leicht anderes Bild ergibt sich auch in einem Szenario, in dem nur 70 Prozent der europäischen Erneuerbaren-Potenziale ausgeschöpft werden. Dann mache Elektrolyse auch in Deutschland Sinn, sagt Co-Autor Khaled Al-Dabbas. Die Kapazitäten seien aber immer noch gering. Auch in einem unveröffentlichten Szenario mit geringeren Leitungskapazitäten gebe es eine höhere Wasserstoffproduktion in Deutschland. “Für Deutschland würde es aber auf jeden Fall die Kosten senken, die europäische Integration stärker mitzudenken”, resümiert Fleiter.
Entgegen vieler politischer Initiativen in Brüssel und Berlin halten die Forscher die Selbstversorgung mit Wasserstoff für Europa nicht nur für möglich, sondern sogar für günstiger als Importe. “Das war auch für die Kommission interessant”, verrät Fleiter. “Es zeigt, wie gewaltig und kostengünstig die Erneuerbaren-Potenziale in der EU noch sind.”
Ein leicht anderes Bild ergibt sich wieder bei einem um 30 Prozent vermindertem Erneuerbaren-Ausbau. Nötig wäre ein minimaler Import von 160 Terawattstunden Wasserstoff per Pipeline aus Marokko – angesichts einer Erzeugung von 3.000 Terawattstunden in Europa ein immer noch geringer Anteil.
Schiffstransporte von Wasserstoffderivaten und Grundprodukten für die Düngemittel-, Chemie- und Stahlindustrie könnten dennoch eine bedeutende Rolle spielen. Denn in einem weiteren Szenario hat das ISI berechnet, welche Folgen es hätte, wenn Ammoniak, Ethylen und Eisenschwamm nicht mehr in Europa hergestellt, sondern importiert würden. Wenn man nur diese drei Produkte ersetzt, würde der Wasserstoffbedarf um ein Drittel sinken. “Wir hätten fast ein anderes Energiesystem”, sagt Fleiter.
Zum einen wären die Importe von Wasserstoffderivaten gerade in Deutschland deutlich geringer. Überflüssig wären damit aber auch die meisten Offshore-Windparks. Die nötigen Kapazitäten würden sich um 60 Prozent verringern. Auch viele Solaranlagen auf Dächern würden rein ökonomisch gesehen nicht benötigt.
Viele Unternehmen aus den Grundstoffindustrien hätten aber noch unterschiedliche Präferenzen für die Dekarbonisierung, berichtet Fleiter: “Einige wollen grünen Methanol und Ammoniak importieren, andere lieber Wasserstoff.” Je nach Strategie würden manche Fertigungsstufen in der EU verbleiben, andere nicht. Der Wasserstoffbedarf der Industrie sei eben noch sehr unsicher und nicht unbedingt eine No-regret-Maßnahme, wie oft angenommen.
Neu: Agrifood.Table Professional Briefing – jetzt kostenlos anmelden. Wie unsere Lebensgrundlagen geschaffen, gesichert und reguliert werden. Für die entscheidenden Köpfe in Landwirtschaft und Ernährung in Politik und Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft, Verbänden und NGO. Von Table.Media. (Anmelden)
6. September 2023, Allianz Forum, Pariser Platz 6, Berlin
Preisverleihung Unipreneurs: Die besten Professorinnen und Professoren für Startups Mehr
11.-13. September 2023, Osnabrück
18. Jahrestagung der Gesellschaft für Hochschulforschung Das Zusammenspiel von Hochschulforschung und Hochschulentwicklung: Empirie, Transfer und Wirkungen Mehr
20.-22. September 2023, Hyperion Hotel, Leipzig
Konferenz SEMANTiCS und Language Intelligence 2023 Mehr
27.-29. September 2023, Freie Universität Berlin
Gemeinsame Konferenz der Berliner Hochschulen Open-Access-Tage 2023 “Visionen gestalten” Mehr
Der taiwanische Weltmarktführer TSMC baut ein Chip-Werk in Dresden. Die Eckpunkte des Projekts entsprechen sehr genau den Berichten von Table.Media vom Mai und aus dem vergangenen Jahr, die noch auf informierten Quellen beruhten:
Die genaue Investitionssumme steht offiziell noch nicht fest, weil sie von staatlicher Förderung abhängt, die ihrerseits noch nicht formal freigegeben ist. Sie wird aber sicher in der Größenordnung von zehn Milliarden Euro liegen. Rund die Hälfte davon kommt als Förderung vom Staat. Nur so hat die TSMC-Angabe Sinn, maximal dreieinhalb Milliarden Euro an Eigenmitteln zur Verfügung zu stellen.
Ohne die hohe Subvention wäre TSMC sicher nicht gekommen. Die Ausgabe entspricht aber sowohl den Sicherheits- und China-Strategien der Bundesregierung als auch dem europäischen Vorgehen. In der Mitteilung von TSMC ist ausdrücklich der EU-Chips-Act erwähnt. Die Unternehmen wollen also Mittel aus den europäischen Töpfen abrufen.
In der Fabrik sollen vor allem zwei Klassen von Mikrochips entstehen:
Diese Art von Chips entspricht dem Stand, der um 2015 herum neu und modern war. Das ist immerhin besser als ursprünglich angenommen – die ersten Berichte über das Werk waren nur von 22 Nanometer-Technik ausgegangen, die wiederum um 2010 herum aktuell war.
Doch auch 12 Nanometer sind nicht die Vorhut der Technologie-Entwicklung. Im Vergleich mit den TSMC-Investitionen in den USA wirkt das besonders schmerzhaft: Dort stellt das taiwanische Unternehmen modernste Produkte her. Was TSMC dagegen nach Dresden bringt, heißt im Jargon “reife Technologie”.
Der deutschen Fahrzeugbranche sind diese Chips aktuell dennoch zu modern. Sie brauche deutlich einfachere Ware mit Strukturbreiten um 90 Nanometer, sagte ein Sprecher des Verbands der Automobilindustrie (VDA) am Dienstag in Berlin. Die Autoindustrie benötige zwar durchaus auch die Technologien, die bei ESMC entstehen werden. Dennoch werde der direkte Effekt des Werks in Dresden auf die eigene Unabhängigkeit nur begrenzt sein.
Der Präsident des RWI-Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung, Christoph Schmidt, ist skeptisch. Es sei zweifelhaft, dass die Subvention dem Land langfristig mehr bringe, “als wenn man die gleichen Mittel in die Forschung und Entwicklung etwa von Speichertechnologien oder in die Infrastruktur für den Import und Transport von Wasserstoff stecken würde”, sagte Schmidt der “Rheinischen Post”.
In ihrer Erklärung hoben die Chip-Unternehmen hervor, dass mit der Investition 2000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Diese Botschaft wird in der Branche aber nicht nur Beifall auslösen, denn die Halbleiter-Hersteller haben derzeit ohnehin schon Probleme, ihre offenen Stellen besetzen zu können.
Fachkräfte werden händeringend gesucht, die die neuen Chip-Werke in Sachsen und Sachsen-Anhalt werden zu einer Herausforderung für die Hochschulen in ganz Deutschland, die für den notwendigen Nachwuchs sorgen müssen. Das Institut für Halbleiter- und Mikrosystemtechnik an der Technischen Universität Dresden allein wird diese Aufgabe nicht meistern können. fmk / nik
Laut einem Bericht der Financial Times haben die Wissenschaftler am Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) ihren viel beachtetes Fusionsexperiment aus dem Dezember wiederholt und diesmal einen leicht höheren Nettoenergiegewinn erzielt. Der Fusionsreaktor der National Ignition Facility (NIF) des Labors erzeugte mithilfe von Lasern genügend Wärme und Druck, um Deuterium und Tritium – Isotope von Wasserstoff – in ein Plasma umzuwandeln, in dem eine Fusion stattfinden kann.
Die Laser geben 2,1 Megajoule Energie ab, der Reaktor produzierte damals etwa 2,5 Megajoule, was einer Steigerung von etwa 20 Prozent entspricht. Berichten zufolge hat das Labor nun eine zweite Zündung erfolgreich durchgeführt. Dabei wurde laut Financial Times der Nettogewinn noch einmal erhöht und der Reaktor produziert etwa 3,5 Megajoule. Laut dem Bericht fand das Experiment am 30. Juli statt.
Gegenüber dem Wissenschaftsmagazin New Scientist bestätigten die Forscher des LLNL das Experiment: “Seitdem wir im Dezember 2022 zum ersten Mal die Fusionszündung an der National Ignition Facility demonstriert haben, führen wir weiterhin Experimente durch, um dieses aufregende neue wissenschaftliche Regime zu untersuchen. In einem am 30. Juli durchgeführten Experiment haben wir die Zündung am NIF wiederholt. Die Analyse dieser Ergebnisse ist im Gange.”
Das Experiment war international auf viel Beachtung gestoßen, weil Wissenschaftler zum ersten Mal einen Nettogewinn durch die laserbasierte Kernfusion erreichen konnten. Allerdings bezieht sich dieses Energie-Plus nur darauf, dass die Leistung des Reaktors höher ist, als die Leistung des Lasers.
Im Interview mit Table.Media hatte Max-Planck-Forscherin Sibylle Günter zum Experiment im Dezember erklärt: “Das ist ein tolles Ergebnis. Doch für die Erzeugung der eingesetzten Laserenergie von 2,1 Megajoule war etwa 150-mal mehr Energie notwendig als in der Reaktorkammer ankam. Also ist die eingesetzte Energie um mehr als einen Faktor 100 höher als das, was an Wärmeenergie am Ende frei wurde.” Bis zu einem kommerziell nutzbaren Fusionsreaktor sei es noch ein sehr weiter Weg, sagte Günter im Januar.
Trotzdem hatten die Ergebnisse des NIF auch für Deutschland eine Signalwirkung. Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger hatte im Zusammenhang mit den Ereignissen davon gesprochen, dass es innerhalb eines Jahrzehnts erste Fusionskraftwerke auch in Deutschland geben könne. Inzwischen hat sie sich von dieser ambitionierten Schätzung distanziert. Sie setzt sich aber weiter dafür ein, die laser- und magnetbasierten Verfahren technologieoffen zu fördern. Bislang hatte Europa mit Iter einen Schwerpunkt auf Magnetfusions-Verfahren gelegt. tg
Der Start der neuen europäischen Trägerrakete Ariane 6 verschiebt sich weiter. Der Erstflug werde nun für 2024 anvisiert, schrieb der Chef der in Paris sitzenden europäischen Raumfahrtagentur Esa, Josef Aschbacher, am Dienstag auf Twitter. Einen genaueren Launch-Zeitraum könne man erst nach weiteren Tests im September nennen. Ursprünglich sollte die Rakete bereits 2020 starten, dies wurde mehrfach verschoben. Zuletzt hatte die Esa geschätzt, dass die Ariane 6 erstmals im letzten Quartal 2023 abheben werde.
Die Ariane 6 soll Satelliten für kommerzielle und öffentliche Auftraggeber ins All befördern und ist deutlich günstiger als ihre Vorgängerin. Europas Raumfahrt soll sie wettbewerbsfähiger machen. Anfang Juli war zum letzten Mal eine Ariane-5-Rakete ins All gestartet. Seitdem hat die Esa keine eigenen Mittel mehr, um große Satelliten in den Weltraum zu bringen. Der verschobene Erstflug der Ariane 6 bedeutet, dass diese Situation länger andauern wird.
Das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum (DLR) teilte auf Anfrage von Table.Media mit, dass die Verschiebung des Ariane-6-Erststarts nach 2024 für die Weltraumforschung und den Betrieb von Weltraummissionen in Europa handhabbar sei. Mit dem letzten Start einer Ariane 5 am 6. Juli 2023 habe Deutschland mit der Heinrich-Hertz-Mission noch einen wichtigen Satelliten in den Orbit gebracht.
Der für 2024 geplante Ariane-Start der Asteroidenmission Hera wurde bereits auf eine Falcon 9-Trägerrakete umgelegt. Die nächsten Ariane-Starts einer europäischen Mission im Erdbeobachtungsprogramm mit großer deutscher Beteiligung wären Meteosat Third Generation (MTG) und Metop-SG im Jahr 2025. Im Wissenschaftsprogramm soll die Exoplaneten-Mission Plato im Jahr 2026 wieder mit Ariane starten.
Schwerer wiegen würden die Umplanungen der Starts, die für die Sojus-Träger vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou gelistet waren, und die aufgrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gestrichen wurden, teilte das DLR mit. Davon sei etwa das gerade gestartete europäische Weltraumteleskop Euclid betroffen gewesen, das schließlich am 1. Juli 2023 mit einer Falcon 9 von SpaceX gestartet wurde – der erste Esa-Start mit einer Falcon 9 überhaupt. Vom Wegfall der Sojus seien ebenso die bereits geplanten Starts des europäischen Satellitennavigationssystems Galileo betroffen. tg mit dpa
Elon Musks Firma Neuralink, die das Gehirn mithilfe von Implantaten mit einem Computer verbinden will, hat sich frisches Geld bei Investoren besorgt. Die 280 Millionen Dollar schwere Finanzierungsrunde sei vom Wagniskapitalgeber Founders Fund des Technologie-Investors Peter Thiel angeführt worden, teilte Neuralink mit. Das geplante Gerät der Firma soll mit feinen Elektroden direkt mit dem menschlichen Gehirn verbunden werden.
Neuralink forscht zunächst an medizinischen Anwendungen. Das erste Ziel ist, dass Menschen, die sich nicht bewegen können, durch ihre Gedanken einen Computer bedienen. Später soll es darum gehen, Sehkraft und Sprache mithilfe von Technologie wiederherzustellen – und Tech-Milliardär Musk spricht auch von einer Zukunft, in der Menschen durch die Verbindung zum Computer ihre Fähigkeiten erweitern. Neuralink bekam in diesem Jahr in den USA die Zulassung für klinische Tests an Menschen. tg/dpa
Forschung & Lehre. Wie sich Universitäten vor Cyberangriffen schützen. Die Universität Gießen wurde 2019 Opfer eines Cyberangriffs. Nach dem Vorfall wurden verschiedene Maßnahmen ergriffen, um sich besser vor zukünftigen Angriffen zu schützen. Die Hochschule hat ihre IT-Sicherheitsstruktur neu aufgestellt und Bewusstsein für sicherheitsrelevante Themen geschaffen. Die Lehre aus dem Vorfall: Universitäten sollten in IT-Sicherheit investieren und Kooperationen und Beratungsangebote auf nationaler Ebene etablieren. Mehr
RiffReporter. “Wir ertrinken in Daten”: Projekt will deutsche Forschungsdaten nutzbarer machen. Beispielhaft für ein Projekt der TU Darmstadt beschreibt der Artikel, an welche Hürden Forscher stoßen, wenn sie Daten öffentlich zugänglich machen wollen. Die Herausforderungen dabei sind, Daten hochwertig, nachhaltig und ethisch vertretbar bereitzustellen und dabei eine neue wissenschaftliche Fehlerkultur zu etablieren. Die entscheidende Frage ist zudem, welche Daten überhaupt relevant sind. Mehr
ScienceBlog. Many People Feel Their Jobs Are Pointless. Soziologen der Universität Zürich haben in einer Studie herausgefunden, dass ein beträchtlicher Anteil der Arbeitnehmer ihre Arbeit als sozial nutzlos empfindet. Besonders gilt das in Finanz-, Vertriebs- und Managementberufen. Aus den Ergebnissen der Gruppe um Simon Walo lässt sich erkennen, dass die Art des Berufs einen großen Einfluss auf die wahrgenommene Sinnlosigkeit hat, unabhängig von Routine, Autonomie oder Managementqualität. Mehr
Rudolf Gross ist seit 1. August 2023 Wissenschaftlicher Leiter des Munich Quantum Valley (MQV) und Geschäftsführer des Munich Quantum Valley e.V. Der Physiker übernimmt die Aufgaben von Rainer Blatt.
Jan Tuckermann von der Universität Ulm ist seit Juli Präsident der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie (DGE). Der Biologe leitet in Ulm das Institut für Molekulare Endokrinologie der Tiere.
Hans-Georg Kräusslich ist zum neuen Präsidenten der Heidelberger Akademie der Wissenschaften gewählt worden. Die Amtszeit des Virologen beginnt zum 1. Oktober 2023. Er folgt dem Historiker Bernd Schneidmüller.
Sven Tode wird neuer Präsident der Hochschule Flensburg. Der 58-jährige Historiker und SPD-Politiker der Hamburgischen Bürgerschaft löst den bisherigen Präsidenten Christoph Jansen ab.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!
Bildung.Table. Nordrhein-Westfalens Schulministerin über Abbau von Bürokratie und Aufbau von KI. Sie will die Fehler ihrer Vorgänger vergessen und Grundschulen in den Mittelpunkt ihrer Politik stellen. Im Gespräch mit Table.Media erklärt Dorothee Feller, wie sie die überbordende Bürokratie abbauen will – die Eltern erzeugen. Mehr
Bildung.Table. Brückenklassen: Planlos ins neue Schuljahr. Der Ukraine-Krieg drängt Schulen die Frage auf, wie Integration gelingen kann. Bayern behauptet, ein erfolgreiches Modell entwickelt zu haben. Doch Lernziele für Brückenklassen existieren kaum – genauso wie Daten über den erfolgreichen Übergang in Regelklassen. Mehr
China.Table. Wie KI in China der Überwachung und Manipulation dient. Künstliche Intelligenz hat die Möglichkeiten für die chinesische Regierung zur Überwachung ihrer Bürger drastisch erhöht. Die Unternehmen können immer neue Innovationen entwickeln, weil der Staat sie mit wertvollen Datensätzen versorgt. Alarmierend: China exportiert die Technik auch ins Ausland. Mehr
China.Table. Chinesische Heimat in Hamburg. In Hamburg steht das einzige chinesische Seemannsheim der Welt. Seine Ursprünge reichen hundert Jahre zurück und erzählen auch die Geschichte der Familie Chen. Die Aufgaben haben sich geändert, der Besitz jedoch bleibt – bald in vierter Generation. Mehr
Climate.Table. KI im Klimaschutz: Potenziale und Risiken. Künstliche Intelligenz kann auch für den Klimaschutz genutzt werden. Unternehmensberatungen und Wissenschaftler sehen noch viel ungenutztes Potenzial. Doch es bestehen auch Risiken durch einen erhöhten Energieverbrauch und klimaschädliche Anwendungen. Mehr
ESG.Table. Künstliche Intelligenz ist eine “extraktive Industrie”. Weil Daten fehlen und Tech-Konzerne mauern, fallen Ökobilanzen von Künstlicher Intelligenz schwer. Erste Analysen zeigen aber: Nachhaltig ist die Technologie bislang kaum. Mehr
Security.Table. Russlands nukleare Geopolitik im Mittelmeerraum. Moskaus Konzern Rosatom baut im Mittelmeerraum mehrere neue Atomkraftwerke. Putins Regime macht damit nicht nur andere Autokraten von sich abhängig. Es befördert auch das Risiko der Verbreitung von Nuklearwaffen. Mehr
Die Würfel sind gefallen, soweit man das bei einem so komplexen Multimilliarden-Projekt wie der Magdeburger Chipfabrik jemals final sagen kann. Überwiegend nicht-europäische Chiphersteller werden aus dem 180 Milliarden starken Schattenhaushalt des Klima- und Transformationsfonds mit 20 Milliarden subventioniert: vor dem Hintergrund geopolitischer Konflikte, der Notwendigkeit der Lieferketten-Diversifizierung und technologischer Souveränität in ausgewählten Hightech-Bereichen politisch so entschieden.
10 Milliarden dieser Beihilfe werden für ein neues Wafer-Werk von Intel in Magdeburg ausgegeben – die FAZ betitelte es einst als das Wunder von Magdeburg. 5 Milliarden sind für eine Chipfabrik der Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) in Dresden vorgesehen. TSMC hat gestern final den Bau der Fabrik beschlossen. Infineon bekommt eine Milliarde für ein Halbleiterwerk in Dresden und ZF/Wolfsspeed rund 750 Millionen für eine Siliciumkarbid-Chip Anlage im Saarland.
Ich will mich auf die Hauptinvestition in Magdeburg konzentrieren, verkneife mir also über Sinn oder Unsinn dieser Milliarden-Beihilfe, über Probleme in der Versorgungssicherheit, Wasserknappheit, hohe Energiepreise zu schreiben und fokussiere mich auf die Umsetzung in Magdeburg, also die Themen Fachkräftesicherung und Erweiterung oder Optimierung eines Semiconductor-Ökosystems, insbesondere auch in der Forschung.
Standortentscheidungen sind hochkomplex, betreffen sie doch meist nicht nur eine Entity, sondern ein gesamtes Ökosystem. Erst recht, wenn es um High- und Deep-Tech geht. Vor über 20 Jahren veröffentlichte der US-amerikanische Ökonom und Soziologe Richard Florida sein bahnbrechendes Werk ‘The Rise of the Creative Class’, in welchem er die Bedingungen für das Wachstum einer Hightech-Region postulierte: Talent, Technologie und Toleranz.
Drei Faktoren, die auch zentral für die Standortentscheidung einer Hightech-Fabrik sind. Schließlich will Intel 3000 Mitarbeitende einstellen, mehr als 2000 davon als Spezialisten in der Chipfertigung. Fachleute sagen mir, dass wir bei Arbeitskräftestrukturen in Halbleiter-Foundries von ca. 30 Prozent akademischen Experten, rund 40 Prozent Spezialisten wie Meister und Techniker und weiteren 30 Prozent Operators, als Fachkräften mit Berufsabschluss und Angelernten auszugehen haben.
Und nicht nur das: Intel sprach in meiner Zeit als Staatssekretär von weiteren bis zu 17.000 Techies, die über die Jahre im sich neu entwickelnden Ökosystem rund um die Foundry tätig sein werden. Diese Zahl scheint unter Einbezug des Ökosystems in Dresden hoch gegriffen, doch selbst bei einer Halbierung sprechen wir von erheblichen vieltausendfachen Spezialisten- und Expertenbedarfen in Magdeburg
Ich folge Gabor Steingarts Morning Briefing nicht, wenn es simplifizierend formuliert, es sei zutiefst unanständig, wie die Ampel das von deutschen Bürgerinnen und Bürgern hart erarbeitete Steuergeld einem US-Konzern in den Rachen werfe, nur weil er verspreche, Arbeitsplätze zu schaffen.
Tiefschürfender kommentieren Wissenschaftler wie Oliver Holtemöller, stellvertretender Präsident des Leibnitz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle: Niemand stehe Schlange, um in Sachsen-Anhalt arbeiten zu dürfen – und dies in einer Stadt ohne Flughafen, ohne regelmäßigen Intercity-Anschluss und ohne ausreichende internationale Schulinfrastruktur!
Noch dazu in Bundesland, in dem die Bevölkerung seit vielen Jahren schrumpft (derzeit: 2,2 Millionen Einwohner) und so alt ist wie in kaum einem anderen Teil Deutschlands. Angesichts der skizzierten Qualifikationsstruktur der Foundry und wohl auch des prognostizierten Magdeburger Ökosystems hilft auch nicht der Verweis auf 25.000 Arbeitslose im Norden von Sachsen-Anhalt, mit dem der Chef der örtlichen Arbeitsagentur, Matthias Kaschte, die Experten- und Spezialistenlücke kleinredete. Zudem wird Magdeburg im Arbeitskräftewettbewerb mit dem Chipzentrum Dresden deutlich kannibalisiert werden. Die Ansiedlung von TSMC wird dies verstärken.
Da wäre es schon interessant, an der Elektrotechnik-Fakultät der Technischen Universität Braunschweig mal zu fragen, wie viel Absolventen sich, denn einen Arbeitsplatz bei Intel in Magdeburg vorstellen können. Und es wäre interessant, die Universität Magdeburg zu fragen, wie viele Absolventen von Mikroelektronik-Studiengängen oder verwandten Fachrichtungen sie 2025-bis 2030 bereitstellen kann.
Holtemöller spricht auch den massiven Standortnachteil Fremdenfeindlichkeit an, was einer heranwachsenden internationalen Tech-Community von Beginn an den Wasserhahn abdreht. Hier hat Regierungschef Haselhoff, der stark auf Zuwanderung setzt, ein fast nicht durch zu bohrendes dickes Brett vor der Brust. Eine aktuelle Wahlprognose spricht von 26 Prozent für die AFD in Sachsen-Anhalt, in dessen Landeshauptstadt Magdeburg jüngst der Parteitag der AfD stattgefunden hat.
Bei der Analyse der akademischen Semiconductor-Forschung stellt man fest, dass es in ganz Europa eigentlich nur einen ganz großen Spieler gibt, die IMEC im belgischen Leuven in enger Kooperation mit der Universität in Leuven, gefolgt von der CEA-Leti in Grenoble, dem wohl größten französischen Forschungsinstitut für Elektronik und Informationstechnologie – allerdings abgeschlagen von den USA. Deutschland ist hier unter ferner liefen.
Um den Vergleich zu illustrieren: 2019 hat das IMEC fast 50 Prozent der angefragten europäischen Research Papers für die führenden Konferenzen auf diesem Feld beigesteuert. Zum Vergleich mit Deutschland: Während der Fraunhofer Mikroelektronik-Verbund und insbesondere Dresden von 1995 bis 2022 ganze 62 Papers beigetragen hat, trug das IMEC allein zwischen 2010 bis 2022, also in weniger als der Hälfte der Jahre, mit rund 240 Veröffentlichungen das Vierfache bei.
Die Stiftung Neue Verantwortung hat dazu im Juni dieses Jahres eine Studie mit dem Titel “Who is developing the chips of the future?” veröffentlicht. Unter den weltweit Top 20 jeweils aus Unternehmensforschung und aus akademischer Forschung beitragenden Organisationen ist in dieser Studie auf der Seite der Wirtschaft Infineon das einzige genannte deutsche Unternehmen, welches aber seit 2010 immer weniger an Forschungspapers beiträgt. Auf der akademischen Seite also eine komplette Nullnummer.
Dies deckt sich auch mit der Aussage von Experten, dass Fraunhofer in Fachgesprächen mit IMEC und LETI kaum proaktiv und IMEC voll im Lead ist. Da seit 2010 die ‘Research Power’ der EU-Semiconductor-Industrie abnimmt, nehmen zudem auch die innereuropäischen Kooperationen zwischen beiden Forschungsektoren ab, beziehungsweise verlagern sich im akademischen Forschungsbereich hin zu Kooperationen mit außereuropäischen Firmen.
Natürlich sprechen wir hier nur über den Indikator “research paper”, aber er ist der zentrale und einzige derzeit verfügbare Indikator. Übrigens war in der Studie nicht die geringste Rede von der Universität Magdeburg und deren etwaiger Forschungsleistung.
Üblicherweise schreibe ich hier zum Schluss unter der Headline ‘innovating innovation’ meine Handlungsempfehlungen. Heute geht es mir darum, die Umsetzungsrisiken dieser Investition zu mitigieren.
1. Die Bundesregierung hat eine quantitative und qualitative Analyse zur Fachkräftesicherung vorzulegen, die regionale wie überregionale bzw. internationale Talentquellen benennt. Das muss Hand in Hand gehen mit einem Maßnahmenplan zur Gewinnung und Bindung. Dies alles Intel zu überlassen, wäre fahrlässig. Globale Konzerne haben ihre nomadische Logik.
2. Das Land Sachsen-Anhalt und die Stadt Magdeburg haben auf den Feldern schulische und hochschulische Bildung, Wohnungsangebote, Freizeitinfrastruktur, Integrationsinitiativen, Willkommenskultur ein Planungskonzept für eine internationale Tech- Community zu erarbeiten.
3. Die deutsche Mikroelektronik-Industrie und ihre Zulieferer formulieren ihre Forderungen an den Aufbau des Magdeburger Ökosystems und den Einbezug der Magdeburger Initiative in das weitgefasstere Dresdner Ökosystem, aber bitte schön mit einer Stimme. Und die klar!
4. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hat ein unabhängiges und internationales Review der Stärken und Schwächen des Mikroelektronik-Verbundes von Fraunhofer und der Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutschland (FMD) im europäischen und internationalen Vergleich zu initiieren. Verbunden damit ist ein Maßnahmenplan zur Steigerung der Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit der angewandten Forschung auf dem Feld.
5.TU Dresden-Professor Hubert Lakner, gleichzeitig Chef des Dresdner Fraunhofer-Instituts für Photonische Mikrosysteme (IMPS), sowie Albert Heuberger, Chef des Mikroelektronik Verbunds, berichten auf Grundlage des Reviews und dessen Forderungen zur Stärkung des Dresdener wie generell der deutschen Seite im europäischen Ökosystem zu Projektfortschritt anhand von Output -und Impactfaktoren.
Mit Blick auf die obigen Punkte wäre es innovativ, wenn die interessierte Community halbjährlich in einer öffentlichen Online-Projekt-Review Fragen stellen und – anhand einer fortschrittsorientierten Indikatorik – Feedback geben könnte.
