die EU-Politik kehrt langsam aus der Sommerpause zurück und steht vor wichtigen Entscheidungen für Forschung und Innovation. Aus der Wissenschaftscommunity werden dabei Fortschritte bei der Umsetzung zur Schaffung einer “fünften Grundfreiheit” des Binnenmarktes erwartet – im Blick auf den freien Austausch von Forschung, Innovation, Wissen und Bildung. Auch die Frage, wer nächster Forschungskommissar– oder kommissarin wird, ist noch unbeantwortet. Welche großen Themen in den kommenden Monaten noch wichtig werden, berichtet Martin Greenacre von unserem Kooperationspartner Science Business.
Deutsche Unternehmen bauen ihre Forschungsaktivitäten in China aus, wie aus einem Bericht der Deutschen Auslandshandelskammer (AHK) in China hervorgeht. Laut “Innovationsreport 2024” sei eine starke Forschungspräsenz in China unerlässlich. Nur so sei es möglich, nicht von chinesischen Konkurrenten abgehängt zu werden. Eine Entwicklung trotz oder gerade wegen der anhaltenden Debatte über “De-Risking”? Jörn Petring berichtet.
“Deutschland fällt in zentralen Innovationsfeldern zunehmend hinter globale, klar fokussierte Mitbewerber zurück”, schreiben Irene Bertschek vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung und Dirk Hoke, CEO von Volocopter, in einem aktuellen Impulspapier für den Deutschen Zukunftsrat. Muss Deutschland erst in allen Bereichen abschmieren, bevor die Wissenschaftscommunity aufwacht, fragt denn auch Thomas Sattelberger in seinem neusten Rigorosum. Zu einer offenen und ehrlichen Debatte gehöre, sich endlich drängenden Fragen zu stellen, etwa wo Aufholjagden noch Sinn ergeben – und wo man sich in der staatlichen Förderung von Technologien verabschieden muss, weil man bereits abgeschlagen sei.
Ich wünsche Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre,


Nach mehreren Krisenjahren geprägt von Krieg, der Pandemie und wirtschaftlichen Herausforderungen boten die jüngsten Europawahlen und die anschließende Sommerpause Gelegenheit, innezuhalten und Bilanz zu ziehen. Doch welche Entwicklungen beschäftigen die Forschungs- und Innovationsgemeinschaft in diesem Herbst? Das derzeitige geopolitische Klima hat F&I-Themen fest in die Mainstream-Debatte eingebracht und daran dürfte sich wohl so schnell nichts ändern. Um diese Themen wird es in den kommenden Monaten gehen:
Zunächst stellt sich die Frage: Wer wird der nächste Kommissar oder Kommissarin für Innovation, Forschung, Kultur, Bildung und Jugend? Seit 2023 hat die Bulgarin Iliana Ivanova das Amt inne, nachdem ihre Landsfrau Mariya Gabriel in die nationale Politik zurückgekehrt war. Doch erst am Freitag haben alle Länder ihre Kommissionskandidaten für die kommende Amtszeit vorgeschlagen, nur Belgien verpasst die Frist.
Zunächst stellt sich die Frage: Wer wird der nächste Kommissar oder Kommissarin für Innovation, Forschung, Kultur, Bildung und Jugend? Seit 2023 hat die Bulgarin Iliana Ivanova das Amt inne, nachdem ihre Landsfrau Mariya Gabriel in die nationale Politik zurückgekehrt war. Und wer kommt nun? Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte den Mitgliedstaaten bis zum 30. August Zeit gegeben, potenzielle Nachfolger für das Kommissionskollegium zu nominieren, bevor sie die Ressorts zuteilen wird. Erst am Freitag hatten alle Länder ihre Kommissionskandidaten vorgeschlagen, nur Belgien verpasste die Frist. Dabei hat von der Leyen eigentlich beabsichtigt, ebenso viele Männer wie Frauen in die Kommission zu berufen. Doch so wie es jetzt aussieht, wird dieses Vorhaben scheitern. Denn nur sieben Regierungen haben Politikerinnen nominiert.
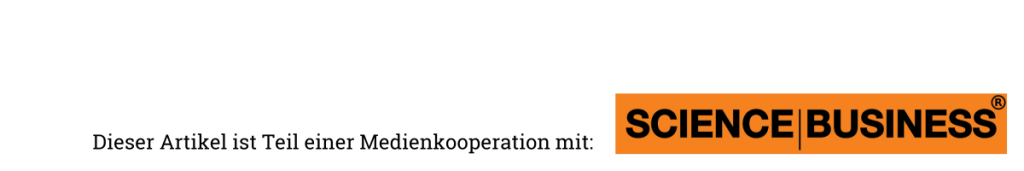
Wer auch immer als neuer Kommissar oder Kommissarin für Forschung nominiert wird, wird sich anschließend den Fragen der Mitglieder des EU-Parlaments im Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie (ITRE) sowie im Ausschuss für Kultur und Bildung stellen. Die Anhörungen werden wahrscheinlich Mitte/Ende September oder Oktober stattfinden.
Zum ersten Mal wird von der Leyens Team ein Kommissar für Verteidigung angehören. Während ihrer Kandidatur zur Wiederwahl versprach sie, eine “echte europäische Verteidigungsunion” aufzubauen und ein Weißbuch über die Zukunft der europäischen Verteidigung vorzulegen.
Das Weißbuch, das in den ersten 100 Tagen ihres neuen Mandats erscheinen soll, wird den Investitionsbedarf aufzeigen. Angesichts der dringend notwendigen Versorgung der Ukraine mit Munition stehen Forschung und Innovation vielleicht nicht ganz oben auf der Liste, dennoch versprach von der Leyen, den Europäischen Verteidigungsfonds zu stärken, der auch F&E-Projekte fördert.
Im Vorfeld ihrer Wiederwahl betonte von der Leyen gegenüber den Mitgliedern des Europäischen Parlaments, Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit habe für sie oberste Priorität. Aber vielleicht muss das Vorzeigeprojekt dieser neuen Strategie – der Vorschlag für einen europäischen Wettbewerbsfähigkeitsfonds – bis zum nächsten langfristigen EU-Haushaltsplan für 2028-2034 warten. Die Kommission soll ihren Vorschlag für diesen Haushalt bis Mitte 2025 veröffentlichen.
Allerdings gibt es in von der Leyens politischen Leitlinien mehrere Vorschläge, die noch vor Jahresende vorgelegt werden könnten und eventuell Elemente aus dem Bereich Forschung und Entwicklung enthalten. So plant sie beispielsweise, in ihren ersten 100 Tagen einen “Clean Industrial Deal” vorzuschlagen, um die “Schaffung von Leitmärkten für alles von sauberem Stahl bis zu sauberen Technologien” zu unterstützen und “Planung, Ausschreibung und Genehmigung beschleunigen”.
Weitere Vorschläge dürften von dem mit Spannung erwarteten Bericht des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi über die Wettbewerbsfähigkeit der EU abhängen. Dieser sollte der Kommission eigentlich im Laufe des Sommers vorgelegt werden, doch die Veröffentlichung wurde verschoben und dürfte nun im Herbst erfolgen.
Alle Augen werden auf die unabhängige Expertengruppe gerichtet sein, die die Kommission bei der Zwischenbewertung von Horizont Europa und seinem Nachfolger, dem 10. EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation (FP10) beraten soll. Das Expertenfeedback dürfte bei der Ausgestaltung des nächsten Rahmenprogramms eine wichtige Rolle spielen.

Die 15-köpfige Expertengruppe unter der Leitung des ehemaligen portugiesischen Forschungsministers Manuel Heitor trifft sich monatlich seit Januar und soll der Kommission am 16. Oktober ihren Bericht vorlegen.
Nachdem die Kommission die Empfehlungen berücksichtigt hat, wird sie Anfang nächsten Jahres ihre Zwischenbewertung von “Horizont Europa” veröffentlichen und anschließend ihren Vorschlag für das FP10 bis Mitte 2025 vorlegen.
Aufgrund des Übergangs nach den Wahlen verzögert sich die Veröffentlichung der Arbeitsprogramme von Horizont Europa für 2025. Diese werden voraussichtlich im März oder April 2025 verabschiedet werden. Da die Kommission ihren Strategieplan für die letzten Jahre von Horizont Europa bereits vorgelegt hat, der auch neun neue öffentlich-private Partnerschaften vorsieht, lässt sich bereits erahnen, worum es gehen wird.
Erwartet werden die Arbeitsprogramme der Säule II für große Forschungskooperationen, Forschungsinfrastrukturen und das “Widening“-Programm für Zusammenhalt in der Forschung. Für andere Teile von Horizont Europa, wie den Europäischen Forschungsrat und die Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahmen, hat die Kommission die laufenden Arbeitsprogramme bis 2025 verlängert.
Neben den Ergebnissen des Draghi-Berichts erwartet die F&I-Gemeinschaft auch Fortschritte bei der Umsetzung der Empfehlungen von Enrico Letta zur Schaffung einer “fünften Grundfreiheit” des Binnenmarktes im Hinblick auf den freien Austausch von Forschung, Innovation, Wissen und Bildung.
Insider erwarten, dass die neue Zusammensetzung der Kommission die Richtung vorgeben. “F&I war noch nie so entscheidend für die politischen Leitlinien des Kommissionspräsidenten vor dem Start einer neuen Europäischen Kommission”, sagte Kurt Deketelaere, Generalsekretär der League of European Research Universities. “Hoffentlich wird sich dies im F&I-Portfolio und seinem Verantwortlichen widerspiegeln.”
Deketelaere erhofft sich, dass Forschung, Innovation und Bildung ein eigenständiges Ressort bleiben und nicht in ein größeres Ressort für Wettbewerbsfähigkeit, Binnenmarkt oder Wirtschaft integriert werden. Dies sei bereits in “einigen Mitgliedstaaten” der Fall. Laut Deketelaer hänge viel davon ab, wer für diese Rolle ausgewählt werde. “Hoffen wir, dass wir jemanden mit Erfahrung und Fachwissen über Europa, Forschung, Innovation und Bildung bekommen.”
Deketelaere fordert auch die Mitgliedsstaaten auf, sich zu engagieren. “Sie können damit anfangen, den jährlichen Zirkus der Ablehnung des von der Europäischen Kommission vorgeschlagenen und vom Europäischen Parlament unterstützten Jahresbudgets von Horizont Europa zu beenden”, sagte er. Der Rat schlug vor, den Horizon-Haushalt für 2025 um 400 Millionen Euro zu kürzen. Von Martin Greenacre
Dieser Beitrag ist eine übersetzte Version eines Artikels von Science|Business . Mit einem Redaktionsteam, das in Brüssel und in der gesamten EU arbeitet, ist Science|Business Europas wichtigste englischsprachige Quelle für fundierte Berichterstattung über Forschungs- und Innovationspolitik.
Die Obleute des Forschungsausschusses haben in ihrem Vorbereitungstreffen am Freitagvormittag beschlossen, die geschasste Staatssekretärin Sabine Döring nicht eigens zu der neuerlichen Anhörung zur Fördermittel-Affäre zu bitten. In dem Termin soll Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) zum zweiten Mal befragt werden. Das Treffen war auf Wunsch der CDU/CSU-Fraktion anberaumt worden. Sie hatten gebeten, nicht nur die frühere Staatssekretärin einzuladen, sondern auch Jochen Zachgo, Leiter der BMBF-Abteilung 4 (Hochschulen).
“Wir haben mit Koalitionsmehrheit entschieden, Sabine Döring und Jochen Zachgo nicht einzuladen”, sagt Oliver Kaczmarek (SPD) Table.Briefings. Die frühere Staatssekretärin unterliege der Verschwiegenheitspflicht, diese könne nur die Ministerin oder das Verwaltungsgericht Minden aufheben. Der Abteilungsleiter werde die Dinge wissen, die im Haus allgemein bekannt sind. Man sei außerdem ein Fach- und kein Untersuchungsausschuss, sagt der Obmann. Die CDU/CSU-Fraktion könne einen solchen gern beantragen.
Man lege im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung großen Wert auf sachgerechte Arbeit und “lehne parteitaktische Vorschläge zum Ablauf der Sondersitzung am 10. September daher ab”, sagt Stephan Seiter (FDP). Man sehe keinen Anlass zur Vorladung aktiver oder ehemaliger Ministerialbeamter, da Bundesministerin Stark-Watzinger persönlich als Ressortchefin der Gesprächseinladung in den Ausschuss folge.
Bezüglich der Akten, aus denen die in der Kritik stehenden Vorgänge dokumentiert sind, sei zugesichert worden, dass die Ausschussmitglieder diese in der kommenden Woche erhalten werden, sagt Kaczmarek. Diese Papiere würden wohl derzeit noch zusammengetragen. Um welche Art Akten es sich dabei dann handele, werde man sehen, sagt der SPD-Politiker. Großes auch öffentliches Interesse gibt es an der Kommunikation der Hausspitze auf der Plattform Wire – hier waren einzelne Posts öffentlich geworden, in denen sich die Ministerin und engste Mitarbeiter zu den heiklen Fragen der Fördermittel-Affäre ausgetauscht hatten.
Dritter Beschluss aus der Obleute-Sitzung: Die Art der Befragung in der Sondersitzung soll erfolgen wie immer. “Sollten aber einzelne Mitglieder des Ausschusses ihr Anliegen nicht beantwortet sehen, sollen sie erneut die Möglichkeit der Frage haben.”
Ausschussvorsitzender Kai Gehring ergänzt: “Ausschuss und das Parlament haben weiter ein großes Interesse daran, zur Aufklärung und Transparenz in der Sache beizutragen und Wissenschaftsfreiheit zu schützen”. Es sei aber Aufgabe des Ministeriums und der Ressortchefin, Licht ins Dunkle der Vorwürfe zu bringen. Die Obleute hätten mehrheitlich entschieden, dass in der Sondersitzung ausschließlich die Ministerin selbst als politisch Verantwortliche Rede und Antwort steht.
Bettina Stark-Watzinger hatte die Einladung zur erneuten Sondersitzung am 10. September, die ihr der Ausschussvorsitzende Kai Gehring überbracht hatte, angenommen. Sie hatte allerdings erklärt, dass sie allein kommen werde, was massive Kritik seitens der Opposition und auch aus der Wissenschaftscommunity nach sich zog.
Gehring hatte zur Vorbereitung des Treffens eine Befragung der Obleute angestrengt. Das Zustandekommen einer Entscheidung per Umlaufbeschluss wurde allerdings durch die Koalition blockiert: Wie Laura Kraft (Grüne), Oliver Kaczmarek (SPD) und Stephan Seiter (FDP) dem Ausschussvorsitzenden Gehring schrieben, wolle man zunächst eine formale Sondersitzung der Obleute einberufen – die nun am Freitag stattgefunden hat.
Das Verhalten der Obleute der Ampel wurde als Taktik gewertet, um Zeit zu gewinnen. Dabei besteht das Problem, einerseits erklärtermaßen eine Aufklärung zu wollen, andererseits aber im Sinne der Koalitionstreue nicht gegen die FDP zu stimmen.
Sabine Döring hat dann die Mitglieder des Forschungsausschusses und vor allem den Vorsitzenden Kai Gehring in der vergangenen Woche unter neuerlichen Druck gesetzt. In einem Schreiben hatte sie ihre Teilnahme an der Sondersitzung am 10. September angeboten. Man müsse sie nur einladen.
In der Sache steht jetzt eine zusätzliche Entscheidung des Verwaltungsgerichts in Minden noch aus. Nach Informationen von Table.Briefrings gibt es noch Fristen, bis zu denen sich die verschiedenen Verfahrensbeteiligten äußern können. Sollte das Gericht entscheiden, dass sich Sabine Döring in der Sondersitzung zu Wort melden darf, würde diese sicherlich komplett anders verlaufen.
Die Absage der Obleute des Ausschusses in Richtung Sabine Döring war in der Wissenschaftscommunity erwartet worden oder, wie es im Wiarda-Blog hieß, der Ausschuss werde sich “für das Nicht-Wissen entscheiden. Was, apropos Schaden für die Demokratie, tatsächlich einer sein würde.
Von der CDU/CSU-Fraktion kommt denn auch deutliche Kritik an der Entscheidung der Obleute: “Die Ampel-Fraktionen legen es bewusst darauf an, dass die allseits geforderte Transparenz in der Fördermittel-Affäre genau nicht entsteht. SPD und Grüne begeben sich damit selbst in die politische Mithaftung”, sagt Thomas Jarzombek. Es sei offensichtlich, dass die Aussagen Sabine Dörings einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung leisten können. Es sei zu hoffen, dass diese Transparenz durch das Verwaltungsgericht Minden hergestellt wird und es die ehemalige Staatssekretärin von der Verschwiegenheitspflicht entbindet.
Bettina Stark-Watzinger wird nun also allein in die Sondersitzung am 10. September gehen. Die Sitzung wird öffentlich stattfinden und kann im Livestream online mitverfolgt werden. Die Chancen, dass die Forschungsministerin nicht ungebremst kritischen Fragen ausgesetzt sein wird, stehen gut. Die Runde, die um 8 Uhr beginnt, muss pünktlich um 9.45 Uhr enden. Im Anschluss gedenkt der Bundestag seiner ersten konstituierenden Sitzung vor 70 Jahren. Die Teilnahme ist Pflicht.

Frau Hmaidi, China ist das einzige Land, das spezifische Exportkontrollen für Technologie eingeführt hat. Wie setzt es diese Kontrollen um?
Tatsächlich handelt es sich um das einzige Land, das wir finden konnten, das nicht nur Dual-Use-Güter kontrolliert, sondern explizit eine Liste von kontrollierten Technologien führt. Beijing hat dazu seine vorhandenen Instrumente, wie das Investment Screening, stark erweitert. Es hat dadurch einen viel detaillierteren Überblick über die Technologieflüsse als Europas Regierungen.
Warum kann das zum Problem werden?
Diese Maßnahmen sind besonders relevant für uns, wenn es um chinesische Investitionen etwa in Elektroautofabriken geht. Die chinesische Regierung entscheidet sehr genau, welche ihrer Unternehmen wo in Europa Fabriken für welche Produkte bauen.
Das ist ja eine erhebliche Asymmetrie. Die Europäer haben jahrzehntelang in China investiert und ihre Technologien herausgerückt, ohne dass der Staat wusste, was läuft.
In der Tat fehlt in den meisten Fällen in Europa eine detaillierte Erfassung und Kontrolle von Technologietransfers. Zwar gibt es internationale Abkommen wie das Wassenaar-Abkommen für Dual-Use-Technologien, aber für viele Produkte fehlen umfassende Daten, wann sie in welcher Menge übertragen wurden. Selbst innerhalb Europas sind die Zusammenarbeit und der Informationsaustausch zwischen Ländern wie Deutschland und Frankreich noch lückenhaft.
Zuletzt war in Deutschland der Gedanke aufgekommen, man könne in der EU eine Solarindustrie gemeinsam mit China ansiedeln. Doch Ihren Forschungsergebnissen zufolge läge das gar nicht in Chinas Interesse.
Schon seit Ende 2022 diskutierte die chinesische Regierung über die Aufnahme von Solartechnologien in ihre Kontrollliste. Letztlich wurde diese Technologie jedoch nicht aufgenommen, da die chinesischen Solarhersteller Bedenken geäußert haben. Sie befürchteten, dass Exportbeschränkungen zu Marktanteilsverlusten in Südostasien führen könnten und dass europäische Länder versuchen, ihre Lieferketten unabhängig von China zu gestalten.
Wo könnte China künftig Druck auf die EU ausüben?
Industrierohstoffe wie Gallium und Germanium sind bereits von chinesischen Ausfuhrkontrollen betroffen. Es geht aber auch um Dinge wie die Lizenz für Nutzung der Technologie für die Herstellung von Magneten für Windturbinen. Oder Algorithmen, etwa den von TikTok. Das alles fällt unter Chinas Technologie-Exportkontrollen. Zusätzlich sind auch Drohnen und Materialien für kugelsichere Westen von Exportkontrollen betroffen, von denen viele von deutschen Mittelständlern hergestellt werden.
Welches Szenario entwerfen Sie für den Konfliktfall?
China könnte bestimmte Materialien einfach nicht mehr liefern. Zudem könnten chinesische Unternehmen keine Produktionsstätten für Technologien wie Windturbinen in Deutschland mehr ansiedeln.
Was sollte Europa jetzt tun, angesichts Chinas Nutzung von Technologie in Handelskonflikten?
Der erste Schritt ist das Sammeln von Informationen über Chinas Fortschritte in verschiedenen Technologien und auch zu Europas eigenen Aktivitäten und Fähigkeiten. Wichtig ist, dies auf europäischer Ebene zu tun, um ein umfassendes Bild zu erhalten. Zudem benötigen wir in den Ministerien mehr Technologie- und Industrieexperten, da derzeit oft nur Juristen oder langjährige Bürokraten tätig sind. Es muss eine neue Kompetenz im Bereich Technologien aufgebaut werden.
Besonderen Ärger erregt in Brüssel derzeit das chinesische Vorgehen, militärisch relevante Waren mit Russland zu teilen, ohne offiziell Waffen oder auch nur Dual-Use-Güter an den befreundeten Nachbarn zu liefern. Wie klappt dieser Spagat?
China weiß genau, welche Kontrollen es offiziell durchführen kann, ohne die eigenen Unternehmen zu behindern oder Russland zu schaden, und dabei zugleich international gut aussieht. Oft ist die Umsetzung dieser Kontrollen so gestaltet, dass sie chinesische Unternehmen nicht betreffen. Wenn Europa ein Unternehmen sanktioniert, tritt zudem oft einfach das Nächste in Erscheinung. Dieses kann dann wieder so lange Geschäfte machen, bis es seinerseits von der EU sanktioniert wird. Darüber hinaus waren beispielsweise chinesische Exportkontrollen für Drohnen so konzipiert, dass kommerzielle chinesische Drohnen nicht betroffen waren. Die haben aber bedeutsame Anwendungen auf dem Schlachtfeld.
Wie reagiert Europa auf diese Herausforderungen?
Europa war bisher zu passiv und hat versucht, mit China zu diskutieren, anstatt konsequent Sanktionen zu verhängen, die es europäischen Firmen verbieten würde, mit chinesischen Firmen auf der Sanktionsliste zu handeln.
Liegt das Kernproblem darin, dass mit China ein Systemrivale so viel wichtige Technologie auf so hohem Niveau herstellt?
Das Problem ist weniger die Qualität der Technologie, sondern dass die chinesische Produktion günstiger ist. Lange Zeit galt das Credo, dass günstiger besser ist, ohne zu erkennen, wie strategisch China diese Marktmacht aufgebaut hat. Chinas Regierung und Unternehmen sind bereit, kurzfristige finanzielle Nachteile in Kauf zu nehmen, um langfristig Abhängigkeiten aufzubauen und die Handelsketten um China herum in seinem Sinne neu zu gestalten.
Lohnt es sich daher, um krisenfester zu werden, Waren zu höheren Preisen in Europa herzustellen?
Es ist wichtig, strategisch zu analysieren, welche Produkte wir vorrätig halten müssen, auch wenn das höhere Kosten verursacht. In manchen Fällen können Zölle sinnvoll sein, um zu verhindern, dass chinesische Produkte die Preise unterbieten. Allerdings wäre es kontraproduktiv, wenn Europa, die USA, Japan und Südkorea alle die gleichen Produkte teurer als in China herstellen und dadurch Überkapazitäten erzeugen. Stattdessen sollten westliche Länder ihre Produktion koordinieren und bestehende Vorteile nutzen, wie Europas Position in der Produktion von Leistungshalbleitern.
Sind Subventionen ein geeignetes Mittel, um mehr technologische Sicherheit zu erreichen?
Es gibt auch die Möglichkeit, Industrien zeitweise zu subventionieren, um sie langfristig wettbewerbsfähig zu machen, wie China es bei Elektroautos vorgemacht hat. Es ist aber nicht realistisch, alle Industrien zu subventionieren. Daher muss entschieden werden, welche Industrien so wichtig sind, dass Subventionen sich lohnen. Das könnte zum Beispiel die Chip-Industrie sein, deren Produkte für viele andere Branchen essenziell sind, oder 5G, wo Deutschland und Europa aus Gründen der technologischen Sicherheit eigene Anbieter benötigen. Wir subventionieren ja auch jetzt schon die Landwirtschaft, weil Nahrung essenziell ist.
Wer soll in Europa die Entscheidungen treffen, welche Wirtschaftszweige so wichtig sind, dass sie Förderung verdienen?
Nur die Politik kann diese Prioritäten setzen und bestimmen, wie viel das kosten darf.
Antonia Hmaidi ist Senior Analyst bei der Berliner Denkfabrik Merics, dem Mercator Institute for China Studies. Anlass für das Interview ist ein neuer Report, den Hmaidi zusammen mit Rebecca Arcesati und François Chimits verfasst hat: Keeping value chains at home – How China controls foreign access to technology and what it means for Europe.
12. September 2024, 17:30 Uhr, Table.Briefings, Wöhlertstr. 12-13, 10115 Berlin
Salon des Berlin Institute for Scholarly Publishing BISP Salon I: The Changing Geography of Global Research Mehr
12./13. September 2024, FU Berlin
Jahrestagung des Netzwerks Wissenschaftsmanagement Für Freiheit in Krisenzeiten. Perspektiven aus dem Wissenschaftsmanagement Mehr
12. – 15. September 2024, Potsdam
133. Versammlung der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Wissenschaft für unser Leben von morgen Mehr
18. September 2024, Alte Münze, Berlin
InnoNation Festival Scaling Solutions Mehr
19. September 2024, ab 11 Uhr, Körber-Stiftung, Hamburg
Hamburg Science Summit 2024 “Europe’s Path Towards Tech Sovereignty” Mehr
24. September 2024, 10:30 bis 16:15 Uhr, Haus der Commerzbank, Pariser Platz 1, 10117 Berlin
Forum Hochschulräte Starke Marken, klarer Kern: Strategische Schwerpunktsetzung und Markenbildung bei Hochschulen Mehr
25. September 2024, 8:00 bis 9:15 Uhr im BASECAMP, Mittelstraße 51-53, 10117 Berlin
Frühstücks-Austausch: Gipfel für Forschung und Innovation Follow-up Innovationen in Europa – Katalysatoren, Kompetenzen und Kooperationen am Beispiel von KI: Gespräch über Umsetzungsschritte für mehr Geschwindigkeit bei Innovation und Forschung Zur Anmeldung
25. September 2024, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU)
Jahreskolloquium des Bayerischen Wissenschaftsforums Transformationskompetenz in Wissenschaft und Hochschule Mehr
26. September 2024, 12:00 bis 13:00 Uhr, Webinar
CHE talk feat. DAAD KIWi Connect Transfer und Internationalisierung – Warum ist es sinnvoll, beides gemeinsam zu denken und was braucht es hierzu? Mehr
26./27. September 2024, Leopoldina, Jägerberg 1, 06108 Halle (Saale) und Online
Jahresversammlung 2024 der Leopoldina Ursprung und Beginn des Lebens Mehr
3. /4. Oktober 2024, Universität Helsinki, Finnland
2024 EUA FUNDING FORUM Sense & sustainability: future paths for university finances Mehr
8. /9. Oktober 2024 an der TU Berlin
bundesweite Tagung zu Machtmissbrauch an Hochschulen “Our UNIverse: Empowered to speak up” Mehr
Mit vier themenoffenen Programmlinien haben Bund und Länder ihre Vereinbarung zur Förderung der anwendungsorientierten Forschung an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) jetzt konkretisiert. Als Förderrichtlinien veröffentlicht wurden HAW-ForschungsAkzente, HAW-ForschungsPraxis, HAW-EuropaNetzwerke und HAW-ForschungsraumQualifizierung, teilte die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK) mit. Insgesamt sollen im Rahmen des Programms bis zum Jahr 2030 Fördergelder in Höhe von knapp 500 Millionen Euro bereitgestellt werden.
Die Programmlinie HAW-ForschungsAkzente sieht vor, Forschungsvorhaben mit hohem innovativem Charakter zu fördern, die zur Vertiefung von bestehenden und zur Entwicklung von neuen Forschungsschwerpunkten an der Hochschule beitragen. Auch gehören Vorhaben, die eine Weiterentwicklung des Forschungsprofils der Hochschule zum Ziel haben, in diese Förderlinie.
Der Ausbau von Forschungskooperationen zwischen HAWs und Praxispartnern außerhalb der Hochschule steht im Fokus von HAW-ForschungsPraxis. Dabei können die Hochschulen sowohl mit Unternehmen zusammenarbeiten als auch beispielsweise mit Kommunen, Vereinen oder Verbänden. Bei beiden Förderlinien wird die Qualität der Anträge wissenschaftlich begutachtet.
Eine höhere Beteiligung deutscher HAWs an internationalen Förderinstrumenten ist das Ziel von HAW-EuropaNetzwerke. Mit den Fördergeldern sollen die Hochschulen dabei unterstützt werden, sich an europäischen und internationalen Forschungsprojekten zu beteiligen oder ihre Leitung zu übernehmen. Die Programmlinie HAW-ForschungsraumQualifizierung schließlich fokussiert sich auf die forschungsnahe Förderung von Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern. al
Trotz oder womöglich auch wegen der anhaltenden Debatte über “De-Risking” bauen deutsche Unternehmen ihre Forschungsaktivitäten in China aus. Das geht aus einem Bericht der Deutschen Auslandshandelskammer (AHK) in China hervor. Abweichend von den Argumenten deutscher Politiker argumentiert die Kammer in ihrem “Innovationsreport 2024”, dass eine starke Forschungspräsenz in China unerlässlich sei. Nur so sei es möglich, nicht von chinesischen Konkurrenten abgehängt zu werden.
Der auf einer Umfrage basierende Report zeigt, dass deutsche Unternehmen ihre Forschungs- und Entwicklungsarbeit vermehrt lokalisieren. Damit wollen sie die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Produkte stärken und mehr Kunden in China erreichen. Gleichzeitig nutzen deutsche Firmen die Volksrepublik zunehmend als Innovationszentrum für globale Märkte.
“Deutsche Unternehmen in China investieren in lokale Innovationen und strategische Partnerschaften mit Kunden und Zulieferern, um in dem umkämpften und dynamischen Marktumfeld wettbewerbsfähig zu bleiben”, sagt Martin Klose, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Deutschen Handelskammer in Süd- und Südwestchina.
Die Unternehmen könnten “einen Wettbewerbsvorteil erlangen, indem sie mit Partnern innerhalb des chinesischen Ökosystems zusammenarbeiten”, sagt auch Tunde Laleye, Partner und General Manager in China des Beratungsunternehmens BearingPoint, das am Report mitwirkte. Durch eine stärkere Präsenz in China würden Forschungszyklen verkürzt und die Zeit bis zur Markteinführung beschleunigt.
Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:
“Was Innovationskraft angeht, sind chinesische Unternehmen ihren deutschen Konkurrenten dicht auf den Fersen und liegen teilweise schon vorne“, warnt Kammer-Vorstand Klose. “Genau deshalb schnellen auch deutsche Investitionen in China in die Höhe, besonders in der Automobilindustrie”, so Klose weiter. “Auch wenn der Abstand geringer wird, bin ich zuversichtlich, dass deutsche Unternehmen sich behaupten werden. Sie punkten weiterhin mit Qualität und optimieren lokal ihre Produkte und Dienstleistungen – was sie wiederum auch in den globalen Märkten stärker macht.” jp

Christian Mölling gehört zum überschaubaren Kreis der Zeitenwende-Erklärer. Er ordnet ein, kritisiert, regt an und sagte kurz vor seinem Jobwechsel gegenüber Table.Briefings: “Irgendwann ist es gut, weiterzuziehen.” Nicht zuletzt deshalb, weil Entscheidungen von Führungspersonen korrigierbar sein müssten, seien regelmäßige Wechsel wichtig.
Diese Woche beginnt Mölling als Direktor des Programms Europas Zukunft bei der Bertelsmann-Stiftung und bekommt dort “eine doppelte Aufgabe”, wie er sagt: Seinen Verantwortungsbereich Europa will er nachschärfen, das Thema Sicherheit soll eine größere Rolle spielen. Wie viele andere Stiftungen in Deutschland habe auch Bertelsmann mit dem Thema Sicherheit und Verteidigung “in den letzten Jahrzehnten sehr gefremdelt”. Zur strategischen Aufstellung gehöre aber auch, die guten Arbeitsergebnisse aller Kolleginnen und Kollegen in Entscheidungsprozesse einzuspielen, dass “gute Politik möglich wird”.
Europa befinde sich derzeit “in der wahrscheinlich kritischsten Phase der letzten siebzig Jahre”, sagt Mölling. Von Krieg bis Klimakrise gebe es eine Reihe existentieller Herausforderungen. Die Frage sei: Wie kann die Bertelsmann-Stiftung in diesen Zeiten ihre Ressourcen sinnvoll einsetzen, um ihre Ziele zu erreichen?
Zuletzt war Mölling stellvertretender Direktor des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) und Leiter des Zentrums für Sicherheit und Verteidigung. Vor seiner Tätigkeit bei der DGAP arbeitete er beim German Marshall Fund of the United States (GMF), in der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), am Center for Security Studies der ETH Zürich sowie am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg.
Wenn der 1973 in Bad Oeynhausen geborene Politikwissenschaftler über seinen Werdegang spricht, kommt er vom Kleinen ins Grundsätzliche. Erst mit Anfang dreißig – nach Studium der Politik-, Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaften an den Universitäten in Duisburg und Warwick – habe er gemerkt, dass er einen Doktortitel brauche, um Projektleiterstellen zu bekommen. “Und heute würde ich sagen: zu Recht.” Mit seiner Promotion an der Ludwig-Maximilians-Universität in München habe er “Leidensfähigkeit” gelernt – was für akademischen Erfolg wichtiger sei als “Brillianz”.
Es ist viel Understatement. Möllings Sicht auf die deutsche Debattenkultur kommt ohne solches Understatement daher. “Dass in der medialen Debatte immer wieder Leute zu Experten gemacht werden, es aber nicht sind, finde ich ziemlich schwierig: Da werden Meinung und Wissen oder begründete Einschätzung gleichgesetzt.” Weil man die medialen Regeln aber nicht ändern könne, gibt er viele Interviews, schreibt Gastbeiträge, macht Hintergrund-Briefings. Anfragen nehme er an, wann immer es gehe, sagt er. “Es gibt den ersten Kristallisationspunkt nach einem Ereignis, das erste Interview, an dem sich der politisch-mediale Diskurs dann entlang hangelt.” Und wenn man dann die Möglichkeit nicht nutze und meinungs-, aber nicht unbedingt wissensstarken Beiträgen die Deutungshoheit lasse, dann, habe man danach “den Scherbenhaufen in der Diskussion, den man nicht mehr weggekehrt kriegt”.
In Westdeutschland habe es nach Gründung der Bundesrepublik eine “schwere Auseinandersetzung” darum gegeben, wie wissenschaftlich und wie politisch Friedensforschung sein sollte und was das richtige Verhältnis zu Politik und zur Friedensbewegung wäre. Mit der politischen Ideologisierung sei auch früh die Ausrichtung gekommen: Dabei seien “die Sicherheitspolitiker fast ganz rausgeflogen, auch aus den Förderlinien”. Das wirke bis heute nach: So gebe es in Großbritannien oder Skandinavien eine Reihe guter Universitäten, die ohne Probleme Verteidigung und Konfliktforschung zusammen unterrichten, “hier in Deutschland aber haben Sie noch immer mit einem ideologischen Bias zu kämpfen, der die weitgehende Wissensfreiheit beim Thema Verteidigung auch bei Forschenden erklärt: kein Lehrstuhl, keine Seminare”.
Deshalb ist es ihm wichtig, Diskurse mitzuprägen. Man müsse für das Thema und die Art der Arbeit brennen, um auch am Freitagnachmittag da zu sein. Und Krisen begännen schließlich “meistens freitagnachmittags – empirisch gefühlt”. Gabriel Bub
Katrin Böhning-Gaese ist neue Wissenschaftliche Geschäftsführerin des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ). Sie folgt auf Rolf Altenburger, der das Zentrum seit 2022 leitete. Die Biologin war 14 Jahre lang Direktorin des Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrum.
Yafang Cheng wurde zum Wissenschaftlichen Mitglied der Max-Planck-Gesellschaft sowie als neue Direktorin am Max-Planck-Institut für Chemie ernannt. Sie soll dort eine Abteilung für Aerosolforschung aufbauen. Cheng erforscht die grundlegenden Mechanismen atmosphärischer Aerosolprozesse und deren Auswirkungen auf Luftqualität und Klima.
Torsten Fischer, bisher Leiter der Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen (KoWi), hat die Position des Administrativen Direktors am Leibniz-Zentrum für Archäologie (LEIZA) übernommen. Als Mitglied des Direktoriums wird er maßgeblich die strategische Ausrichtung des LEIZA mitgestalten. Er folgt auf Heinrich Baßler, der Ende August in den Ruhestand getreten ist.
Hendrik Streeck, Direktor des Instituts für Virologie am Uniklinikum Bonn, will für die CDU in den Bundestag. Die Bonner CDU nominierte ihn als Direktkandidaten für die Bundestagswahl im kommenden Jahr. Er kandidiere, “weil wir einen positiven Aufbruch, einen authentischen Politikwandel aus der Mitte brauchen”, schrieb Streeck auf X.
Franziska Tanneberger, Leiterin des Greifswald Moor Centrum in Mecklenburg-Vorpommern, und Elektrotechnik-Ingenieur Thomas Speidel aus Nürtingen bei Stuttgart werden in diesem Jahr mit dem Deutschen Umweltpreis der Deutschen Bundesstiftung Umwelt ausgezeichnet. Sie teilen sich den Preis von insgesamt 500.000 Euro. Er zählt zu den höchstdotierten Umwelt-Auszeichnungen Europas. Speidel hat als Geschäftsführer der ads-tec Energy innovative batteriegepufferte Hochleistungssysteme entwickelt. Sie ermöglichen etwa das Stromtanken binnen Minuten statt Stunden. Die Moorforscherin Tanneberger gilt als treibende Kraft bei der Revitalisierung und Wiedervernässung von Mooren sowie als Brückenbauerin zwischen Wissenschaft, Politik und Landwirtschaft.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an research@table.media!
Berlin.Table. Doppelwahl in Ostdeutschland: Eine Abstimmung wird zur politischen Abstrafung der Ampel. Die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen sind ein unmissverständlicher Fingerzeig in Richtung Berlin. Insbesondere bei der SPD neigt sich die Geduld der Parteiführung dem Ende entgegen. Die Schonzeit für Olaf Scholz ist vorbei. Mehr
Berlin.Table. Der Erfolg der AfD und der Blick von außen: Was die Welt denkt. Waren die Wahlen in Sachsen und Thüringen eine Frustwahl? Oder gar eine Zäsur? Und welche Auswirkungen könnten sie für das gesamte Land haben? Table.Briefings hat ausländische Journalisten und Wissenschaftler gefragt. Mehr
Bildung.Table. Digitalpakt II: Wie viel Geld der Bund geben will. Lange vehement von den Ländern eingefordert, liegt die Zahl nun auf dem Tisch: 2,5 Milliarden Euro will der Bund für den Digitalpakt II geben. Laufzeit: 2025 bis 2030. Hinter dem Digitalpakt I bleibt die Summe damit deutlich zurück. Entsprechend fällt die Reaktion von Schleswig-Holsteins Kultusministerin Karin Prien aus. Mehr
Europe.Table. Neue EU-Kommission: Nur sieben Frauen nominiert. Die letzten Namen sind bekannt, nur Belgien hat die Frist verpasst: Italien nominiert Raffaele Fitto, Bulgarien Ekaterina Sachariewa und Julian Popow. Klar ist: Von der Leyen wird die Kommission nicht paritätisch mit Männern und Frauen besetzen können. Mehr
Tagesschau: Wie innovativ ist Deutschland? In traditionellen Branchen wie Auto, Chemie und Maschinenbau gehört Deutschland nach wie vor zu den weltweit innovativsten Ländern. Anders sieht es aus, wenn es um IT oder KI geht. Auf diesen Feldern wird die Bundesrepublik von den USA und China abgehängt. (“Wie viel Hightech schafft Deutschland?“)
taz: Innovationsfähigkeit und Zeitenwende. Der Zukunftsrat hat Vorschläge zur Zukunft des Wissenschaftsstandorts Deutschland gemacht. Künftig soll stärker darauf geachtet werden, dass Forschungsergebnisse auch den Sprung in die Märkte schaffen. Und um auch im Bereich Militärtechnik weltweit vorne mit dabei sein zu können, werden sich Hochschulen von der Zivilklausel verabschieden müssen, die ihnen die Zusammenarbeit mit Rüstungsunternehmen untersagt. (“Vom Labor auf den Markt“)
Handelsblatt: Chemische Industrie forscht lieber im Ausland. Als Produktionsstandort steht Deutschland schon lange unter Druck. Doch nun ist auch der Forschungsbereich in Gefahr. Die chemische Industrie verlagert zunehmend ihre Forschung ins Ausland. (“Deutsche Chemieindustrie verlagert Forschung immer mehr ins Ausland“)
FAZ: Regulierungen allein schaffen keine Innovationen. Die Europäische Union hat sich entschieden, auch im Bereich Künstlicher Intelligenz einen Regulierungsrahmen zu schaffen. Die Hoffnung ist, dass der Rest der Welt dem alten Kontinent auf seinem Weg folgt. Viel zu wenig kümmert sich Europa allerdings darum, auch bei den Innovationen Spitze zu sein. (“Verpasst Europa den KI-Zug?“)
Die Mauer des Schweigens, die Omerta einer eingeschworenen Gemeinschaft, bröckelt. Während bisher die unangenehmen Wahrheiten zum deutschen Wissenschafts-, Forschungs- und Innovationssystem von unbequemen Außenseitern adressiert wurden, melden sich jetzt auch erste Stimmen aus der Community selbst.
Der von mir sehr geschätzte Georg Schütte, Staatssekretär a.D., heute experimentierfreudiger Chef der VolkswagenStiftung, und der intellektuell scharfe Volker Meyer-Guckel, Generalsekretär des Stifterverbands, sprechen in ihrem Impulspapier über den Verlust an Innovationskraft und internationaler Wettbewerbsfähigkeit. Sie sprechen über ineffiziente Strukturen, über geringe Dynamik im Vergleich zu internationalen Wettbewerbern, über den nötigen Wechsel von einer Wettbewerbs- auch zu einer Wirkungslogik, über kostenträchtige Doppelung von Forschungskapazitäten hierzulande und in Summe von einer nationalen Kraftanstrengung für die Weiterentwicklung des deutschen Wissenschaftssystems. Das kommt zu einem Zeitpunkt, zu dem der Elefant im Raum unübersehbar geworden ist.
Weder die HRK noch die Außeruniversitären Forschungseinrichtungen (AuF) rührten sich zu der für sie problematischen Ansage. Dafür durfte der Chef der Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI), Uwe Cantner , gestelzt abmoderieren – “….würde der Diagnose, die Wissenschaft stecke in einem tiefen Tal, nicht ohne weiteres folgen”. Seine eigene Kollegin in der EFI-Kommission, Irene Bertschek vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, konterkarierte diese Aussage kurz danach. In ihrem aktuellen Impulspapier für den Zukunftsrat des Bundeskanzlers, welches sie zusammen mit dem CEO von Volocopter, Dirk Hoke, erarbeitet hat, schreibt sie: “Deutschland fällt in zentralen Innovationsfeldern zunehmend hinter globale, klar fokussierte Mitbewerber zurück.”
Muss Deutschland erst in allen Technologiebereichen abschmieren, bevor die Wissenschaftscommunity endlich aufwacht? Manchmal erinnert es mich an die Allegorie vom Frosch im Wasserglas, welches mehr und mehr erhitzt wird.
Das im Impulspapier beschriebene und im Zukunftsrat vorgetragene ”Technologie – Grid” ist brutal-nüchtern. Es bescheinigt nur in drei von elf Schlüssel- und Zukunftstechnologien Verbesserungen seit dem Start der Ampel. In den acht übrigen Technologiefeldern gab es in der Forschungspolitik seit 2021 nicht nur keine Verbesserung, sondern teils sogar Verschlechterungen. Dem Plädoyer Bertscheks und Hokes für eine “auf der strategischen Ebene, ehrliche und Commitment-orientierte Debatte” kann ich mich nur anschließen. Die Rosstäuscherei muss ein Ende haben.
Zu einer offenen und ehrlichen Debatte gehört auch, dass man sich die Karten legt und folgende Fragen diskutiert:
Doch nach der intellektuellen Denksportaufgabe der strategischen Priorisierung kommt der operative Schmerz des Abbaus von Mehrfachkapazitäten. Und zuallererst die ehrenpusselige Festlegung, welche Forschungsstätte den Lead erhält - da kann es nur um wissenschaftliche Exzellenz gehen. Past Merit! Dieser zeigt sich meist bei den Forschungspersönlichkeiten, um die sich die besten jungen Forscherinnen und Forscher scharen. Denn diese sehen nicht nur Past Merit, sondern auch ihre Zukunft. Ich gehe jede Wette ein, dass der Zukunftsrat darüber nicht gesprochen hat.
Wenn Bertschek und Hoke in ihrem Impulspapier dann davon schreiben, dass der Transfer-Output auf ein Niveau gehoben werden müsse, das dem hohen Input entspreche, dann bezweifle ich, dass die Entscheider im Zukunftsrat überhaupt in der Konsequenz verstanden haben, was das heißt. In der Betriebswirtschaft nennt man das “break even” – man erzielt gerade mal so viel Umsatz, wie man benötigt, um die Kosten zu decken, also nur die Milliarden wieder hereinholt, die man hineingesteckt hat.
Dass Irene Bertschek so argumentiert, kann ich aufgrund ihres Werdegangs gerade noch nachvollziehen. Dass Dirk Hoke so argumentiert, lässt nicht nur für Volocopter nichts Gutes ahnen. Deutschland braucht doch ein Mehrfaches an Umsatz aus innovativen Produkten und Services, um den Abstieg in einen Aufstieg zu drehen.
Wichtig ist nichtsdestotrotz, dass die beiden Autoren den Output strapazieren. Angesichts der verheerenden 2023er-Ausgründungszahlen der fetten Katzen - gemeint sind Fraunhofer & Co (Ausnahme in 2023 Max Planck) - und der desaströsen Evaluierung (wenn man die politische Sprache dekodieren kann) der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz für die ersten drei Jahre des fortgeschriebenen Pakts für Forschung und Innovation (PFI IV) für diese fetten Katzen, ist das überfällig gewesen. Zur Erinnerung, meine frühere Kolumne: ”Alle schwätzen vom Transfer, aber nichts passiert!”
Deswegen habe ich auch in dieser Kolumne bewusst den Begriff “Omerta” gewählt: Die immer wieder gleichen Spieler aus Politik, Wissenschaft und Forschung sowie aus der Stiftungswelt sitzen immer wieder in den gleichen Runden zusammen, wie alte Ehepaare - die Wissenschaft nennt das homosoziale Reproduktion. Sie erzählen sich immer wieder die gleichen Geschichten so oft, dass jeder jedem glaubt. Gleichzeitig werden eine unsägliche Geheimhaltung und ein Popanz um Treffen wie das des Zukunftsrats und seiner Papiere gemacht. Obwohl Deutschland den Sense of Urgency zum Thema Zukunft dringend bräuchte. Und das setzt Transparenz und Offenheit voraus.
die EU-Politik kehrt langsam aus der Sommerpause zurück und steht vor wichtigen Entscheidungen für Forschung und Innovation. Aus der Wissenschaftscommunity werden dabei Fortschritte bei der Umsetzung zur Schaffung einer “fünften Grundfreiheit” des Binnenmarktes erwartet – im Blick auf den freien Austausch von Forschung, Innovation, Wissen und Bildung. Auch die Frage, wer nächster Forschungskommissar– oder kommissarin wird, ist noch unbeantwortet. Welche großen Themen in den kommenden Monaten noch wichtig werden, berichtet Martin Greenacre von unserem Kooperationspartner Science Business.
Deutsche Unternehmen bauen ihre Forschungsaktivitäten in China aus, wie aus einem Bericht der Deutschen Auslandshandelskammer (AHK) in China hervorgeht. Laut “Innovationsreport 2024” sei eine starke Forschungspräsenz in China unerlässlich. Nur so sei es möglich, nicht von chinesischen Konkurrenten abgehängt zu werden. Eine Entwicklung trotz oder gerade wegen der anhaltenden Debatte über “De-Risking”? Jörn Petring berichtet.
“Deutschland fällt in zentralen Innovationsfeldern zunehmend hinter globale, klar fokussierte Mitbewerber zurück”, schreiben Irene Bertschek vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung und Dirk Hoke, CEO von Volocopter, in einem aktuellen Impulspapier für den Deutschen Zukunftsrat. Muss Deutschland erst in allen Bereichen abschmieren, bevor die Wissenschaftscommunity aufwacht, fragt denn auch Thomas Sattelberger in seinem neusten Rigorosum. Zu einer offenen und ehrlichen Debatte gehöre, sich endlich drängenden Fragen zu stellen, etwa wo Aufholjagden noch Sinn ergeben – und wo man sich in der staatlichen Förderung von Technologien verabschieden muss, weil man bereits abgeschlagen sei.
Ich wünsche Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre,


Nach mehreren Krisenjahren geprägt von Krieg, der Pandemie und wirtschaftlichen Herausforderungen boten die jüngsten Europawahlen und die anschließende Sommerpause Gelegenheit, innezuhalten und Bilanz zu ziehen. Doch welche Entwicklungen beschäftigen die Forschungs- und Innovationsgemeinschaft in diesem Herbst? Das derzeitige geopolitische Klima hat F&I-Themen fest in die Mainstream-Debatte eingebracht und daran dürfte sich wohl so schnell nichts ändern. Um diese Themen wird es in den kommenden Monaten gehen:
Zunächst stellt sich die Frage: Wer wird der nächste Kommissar oder Kommissarin für Innovation, Forschung, Kultur, Bildung und Jugend? Seit 2023 hat die Bulgarin Iliana Ivanova das Amt inne, nachdem ihre Landsfrau Mariya Gabriel in die nationale Politik zurückgekehrt war. Doch erst am Freitag haben alle Länder ihre Kommissionskandidaten für die kommende Amtszeit vorgeschlagen, nur Belgien verpasst die Frist.
Zunächst stellt sich die Frage: Wer wird der nächste Kommissar oder Kommissarin für Innovation, Forschung, Kultur, Bildung und Jugend? Seit 2023 hat die Bulgarin Iliana Ivanova das Amt inne, nachdem ihre Landsfrau Mariya Gabriel in die nationale Politik zurückgekehrt war. Und wer kommt nun? Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte den Mitgliedstaaten bis zum 30. August Zeit gegeben, potenzielle Nachfolger für das Kommissionskollegium zu nominieren, bevor sie die Ressorts zuteilen wird. Erst am Freitag hatten alle Länder ihre Kommissionskandidaten vorgeschlagen, nur Belgien verpasste die Frist. Dabei hat von der Leyen eigentlich beabsichtigt, ebenso viele Männer wie Frauen in die Kommission zu berufen. Doch so wie es jetzt aussieht, wird dieses Vorhaben scheitern. Denn nur sieben Regierungen haben Politikerinnen nominiert.
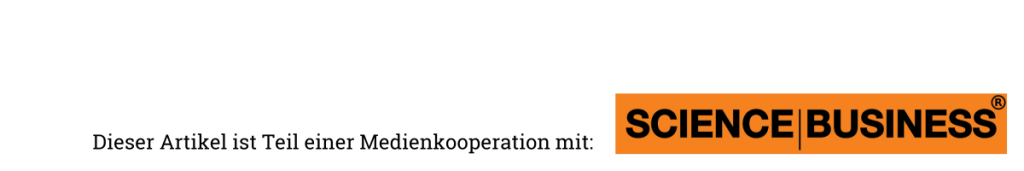
Wer auch immer als neuer Kommissar oder Kommissarin für Forschung nominiert wird, wird sich anschließend den Fragen der Mitglieder des EU-Parlaments im Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie (ITRE) sowie im Ausschuss für Kultur und Bildung stellen. Die Anhörungen werden wahrscheinlich Mitte/Ende September oder Oktober stattfinden.
Zum ersten Mal wird von der Leyens Team ein Kommissar für Verteidigung angehören. Während ihrer Kandidatur zur Wiederwahl versprach sie, eine “echte europäische Verteidigungsunion” aufzubauen und ein Weißbuch über die Zukunft der europäischen Verteidigung vorzulegen.
Das Weißbuch, das in den ersten 100 Tagen ihres neuen Mandats erscheinen soll, wird den Investitionsbedarf aufzeigen. Angesichts der dringend notwendigen Versorgung der Ukraine mit Munition stehen Forschung und Innovation vielleicht nicht ganz oben auf der Liste, dennoch versprach von der Leyen, den Europäischen Verteidigungsfonds zu stärken, der auch F&E-Projekte fördert.
Im Vorfeld ihrer Wiederwahl betonte von der Leyen gegenüber den Mitgliedern des Europäischen Parlaments, Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit habe für sie oberste Priorität. Aber vielleicht muss das Vorzeigeprojekt dieser neuen Strategie – der Vorschlag für einen europäischen Wettbewerbsfähigkeitsfonds – bis zum nächsten langfristigen EU-Haushaltsplan für 2028-2034 warten. Die Kommission soll ihren Vorschlag für diesen Haushalt bis Mitte 2025 veröffentlichen.
Allerdings gibt es in von der Leyens politischen Leitlinien mehrere Vorschläge, die noch vor Jahresende vorgelegt werden könnten und eventuell Elemente aus dem Bereich Forschung und Entwicklung enthalten. So plant sie beispielsweise, in ihren ersten 100 Tagen einen “Clean Industrial Deal” vorzuschlagen, um die “Schaffung von Leitmärkten für alles von sauberem Stahl bis zu sauberen Technologien” zu unterstützen und “Planung, Ausschreibung und Genehmigung beschleunigen”.
Weitere Vorschläge dürften von dem mit Spannung erwarteten Bericht des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi über die Wettbewerbsfähigkeit der EU abhängen. Dieser sollte der Kommission eigentlich im Laufe des Sommers vorgelegt werden, doch die Veröffentlichung wurde verschoben und dürfte nun im Herbst erfolgen.
Alle Augen werden auf die unabhängige Expertengruppe gerichtet sein, die die Kommission bei der Zwischenbewertung von Horizont Europa und seinem Nachfolger, dem 10. EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation (FP10) beraten soll. Das Expertenfeedback dürfte bei der Ausgestaltung des nächsten Rahmenprogramms eine wichtige Rolle spielen.

Die 15-köpfige Expertengruppe unter der Leitung des ehemaligen portugiesischen Forschungsministers Manuel Heitor trifft sich monatlich seit Januar und soll der Kommission am 16. Oktober ihren Bericht vorlegen.
Nachdem die Kommission die Empfehlungen berücksichtigt hat, wird sie Anfang nächsten Jahres ihre Zwischenbewertung von “Horizont Europa” veröffentlichen und anschließend ihren Vorschlag für das FP10 bis Mitte 2025 vorlegen.
Aufgrund des Übergangs nach den Wahlen verzögert sich die Veröffentlichung der Arbeitsprogramme von Horizont Europa für 2025. Diese werden voraussichtlich im März oder April 2025 verabschiedet werden. Da die Kommission ihren Strategieplan für die letzten Jahre von Horizont Europa bereits vorgelegt hat, der auch neun neue öffentlich-private Partnerschaften vorsieht, lässt sich bereits erahnen, worum es gehen wird.
Erwartet werden die Arbeitsprogramme der Säule II für große Forschungskooperationen, Forschungsinfrastrukturen und das “Widening“-Programm für Zusammenhalt in der Forschung. Für andere Teile von Horizont Europa, wie den Europäischen Forschungsrat und die Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahmen, hat die Kommission die laufenden Arbeitsprogramme bis 2025 verlängert.
Neben den Ergebnissen des Draghi-Berichts erwartet die F&I-Gemeinschaft auch Fortschritte bei der Umsetzung der Empfehlungen von Enrico Letta zur Schaffung einer “fünften Grundfreiheit” des Binnenmarktes im Hinblick auf den freien Austausch von Forschung, Innovation, Wissen und Bildung.
Insider erwarten, dass die neue Zusammensetzung der Kommission die Richtung vorgeben. “F&I war noch nie so entscheidend für die politischen Leitlinien des Kommissionspräsidenten vor dem Start einer neuen Europäischen Kommission”, sagte Kurt Deketelaere, Generalsekretär der League of European Research Universities. “Hoffentlich wird sich dies im F&I-Portfolio und seinem Verantwortlichen widerspiegeln.”
Deketelaere erhofft sich, dass Forschung, Innovation und Bildung ein eigenständiges Ressort bleiben und nicht in ein größeres Ressort für Wettbewerbsfähigkeit, Binnenmarkt oder Wirtschaft integriert werden. Dies sei bereits in “einigen Mitgliedstaaten” der Fall. Laut Deketelaer hänge viel davon ab, wer für diese Rolle ausgewählt werde. “Hoffen wir, dass wir jemanden mit Erfahrung und Fachwissen über Europa, Forschung, Innovation und Bildung bekommen.”
Deketelaere fordert auch die Mitgliedsstaaten auf, sich zu engagieren. “Sie können damit anfangen, den jährlichen Zirkus der Ablehnung des von der Europäischen Kommission vorgeschlagenen und vom Europäischen Parlament unterstützten Jahresbudgets von Horizont Europa zu beenden”, sagte er. Der Rat schlug vor, den Horizon-Haushalt für 2025 um 400 Millionen Euro zu kürzen. Von Martin Greenacre
Dieser Beitrag ist eine übersetzte Version eines Artikels von Science|Business . Mit einem Redaktionsteam, das in Brüssel und in der gesamten EU arbeitet, ist Science|Business Europas wichtigste englischsprachige Quelle für fundierte Berichterstattung über Forschungs- und Innovationspolitik.
Die Obleute des Forschungsausschusses haben in ihrem Vorbereitungstreffen am Freitagvormittag beschlossen, die geschasste Staatssekretärin Sabine Döring nicht eigens zu der neuerlichen Anhörung zur Fördermittel-Affäre zu bitten. In dem Termin soll Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) zum zweiten Mal befragt werden. Das Treffen war auf Wunsch der CDU/CSU-Fraktion anberaumt worden. Sie hatten gebeten, nicht nur die frühere Staatssekretärin einzuladen, sondern auch Jochen Zachgo, Leiter der BMBF-Abteilung 4 (Hochschulen).
“Wir haben mit Koalitionsmehrheit entschieden, Sabine Döring und Jochen Zachgo nicht einzuladen”, sagt Oliver Kaczmarek (SPD) Table.Briefings. Die frühere Staatssekretärin unterliege der Verschwiegenheitspflicht, diese könne nur die Ministerin oder das Verwaltungsgericht Minden aufheben. Der Abteilungsleiter werde die Dinge wissen, die im Haus allgemein bekannt sind. Man sei außerdem ein Fach- und kein Untersuchungsausschuss, sagt der Obmann. Die CDU/CSU-Fraktion könne einen solchen gern beantragen.
Man lege im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung großen Wert auf sachgerechte Arbeit und “lehne parteitaktische Vorschläge zum Ablauf der Sondersitzung am 10. September daher ab”, sagt Stephan Seiter (FDP). Man sehe keinen Anlass zur Vorladung aktiver oder ehemaliger Ministerialbeamter, da Bundesministerin Stark-Watzinger persönlich als Ressortchefin der Gesprächseinladung in den Ausschuss folge.
Bezüglich der Akten, aus denen die in der Kritik stehenden Vorgänge dokumentiert sind, sei zugesichert worden, dass die Ausschussmitglieder diese in der kommenden Woche erhalten werden, sagt Kaczmarek. Diese Papiere würden wohl derzeit noch zusammengetragen. Um welche Art Akten es sich dabei dann handele, werde man sehen, sagt der SPD-Politiker. Großes auch öffentliches Interesse gibt es an der Kommunikation der Hausspitze auf der Plattform Wire – hier waren einzelne Posts öffentlich geworden, in denen sich die Ministerin und engste Mitarbeiter zu den heiklen Fragen der Fördermittel-Affäre ausgetauscht hatten.
Dritter Beschluss aus der Obleute-Sitzung: Die Art der Befragung in der Sondersitzung soll erfolgen wie immer. “Sollten aber einzelne Mitglieder des Ausschusses ihr Anliegen nicht beantwortet sehen, sollen sie erneut die Möglichkeit der Frage haben.”
Ausschussvorsitzender Kai Gehring ergänzt: “Ausschuss und das Parlament haben weiter ein großes Interesse daran, zur Aufklärung und Transparenz in der Sache beizutragen und Wissenschaftsfreiheit zu schützen”. Es sei aber Aufgabe des Ministeriums und der Ressortchefin, Licht ins Dunkle der Vorwürfe zu bringen. Die Obleute hätten mehrheitlich entschieden, dass in der Sondersitzung ausschließlich die Ministerin selbst als politisch Verantwortliche Rede und Antwort steht.
Bettina Stark-Watzinger hatte die Einladung zur erneuten Sondersitzung am 10. September, die ihr der Ausschussvorsitzende Kai Gehring überbracht hatte, angenommen. Sie hatte allerdings erklärt, dass sie allein kommen werde, was massive Kritik seitens der Opposition und auch aus der Wissenschaftscommunity nach sich zog.
Gehring hatte zur Vorbereitung des Treffens eine Befragung der Obleute angestrengt. Das Zustandekommen einer Entscheidung per Umlaufbeschluss wurde allerdings durch die Koalition blockiert: Wie Laura Kraft (Grüne), Oliver Kaczmarek (SPD) und Stephan Seiter (FDP) dem Ausschussvorsitzenden Gehring schrieben, wolle man zunächst eine formale Sondersitzung der Obleute einberufen – die nun am Freitag stattgefunden hat.
Das Verhalten der Obleute der Ampel wurde als Taktik gewertet, um Zeit zu gewinnen. Dabei besteht das Problem, einerseits erklärtermaßen eine Aufklärung zu wollen, andererseits aber im Sinne der Koalitionstreue nicht gegen die FDP zu stimmen.
Sabine Döring hat dann die Mitglieder des Forschungsausschusses und vor allem den Vorsitzenden Kai Gehring in der vergangenen Woche unter neuerlichen Druck gesetzt. In einem Schreiben hatte sie ihre Teilnahme an der Sondersitzung am 10. September angeboten. Man müsse sie nur einladen.
In der Sache steht jetzt eine zusätzliche Entscheidung des Verwaltungsgerichts in Minden noch aus. Nach Informationen von Table.Briefrings gibt es noch Fristen, bis zu denen sich die verschiedenen Verfahrensbeteiligten äußern können. Sollte das Gericht entscheiden, dass sich Sabine Döring in der Sondersitzung zu Wort melden darf, würde diese sicherlich komplett anders verlaufen.
Die Absage der Obleute des Ausschusses in Richtung Sabine Döring war in der Wissenschaftscommunity erwartet worden oder, wie es im Wiarda-Blog hieß, der Ausschuss werde sich “für das Nicht-Wissen entscheiden. Was, apropos Schaden für die Demokratie, tatsächlich einer sein würde.
Von der CDU/CSU-Fraktion kommt denn auch deutliche Kritik an der Entscheidung der Obleute: “Die Ampel-Fraktionen legen es bewusst darauf an, dass die allseits geforderte Transparenz in der Fördermittel-Affäre genau nicht entsteht. SPD und Grüne begeben sich damit selbst in die politische Mithaftung”, sagt Thomas Jarzombek. Es sei offensichtlich, dass die Aussagen Sabine Dörings einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung leisten können. Es sei zu hoffen, dass diese Transparenz durch das Verwaltungsgericht Minden hergestellt wird und es die ehemalige Staatssekretärin von der Verschwiegenheitspflicht entbindet.
Bettina Stark-Watzinger wird nun also allein in die Sondersitzung am 10. September gehen. Die Sitzung wird öffentlich stattfinden und kann im Livestream online mitverfolgt werden. Die Chancen, dass die Forschungsministerin nicht ungebremst kritischen Fragen ausgesetzt sein wird, stehen gut. Die Runde, die um 8 Uhr beginnt, muss pünktlich um 9.45 Uhr enden. Im Anschluss gedenkt der Bundestag seiner ersten konstituierenden Sitzung vor 70 Jahren. Die Teilnahme ist Pflicht.

Frau Hmaidi, China ist das einzige Land, das spezifische Exportkontrollen für Technologie eingeführt hat. Wie setzt es diese Kontrollen um?
Tatsächlich handelt es sich um das einzige Land, das wir finden konnten, das nicht nur Dual-Use-Güter kontrolliert, sondern explizit eine Liste von kontrollierten Technologien führt. Beijing hat dazu seine vorhandenen Instrumente, wie das Investment Screening, stark erweitert. Es hat dadurch einen viel detaillierteren Überblick über die Technologieflüsse als Europas Regierungen.
Warum kann das zum Problem werden?
Diese Maßnahmen sind besonders relevant für uns, wenn es um chinesische Investitionen etwa in Elektroautofabriken geht. Die chinesische Regierung entscheidet sehr genau, welche ihrer Unternehmen wo in Europa Fabriken für welche Produkte bauen.
Das ist ja eine erhebliche Asymmetrie. Die Europäer haben jahrzehntelang in China investiert und ihre Technologien herausgerückt, ohne dass der Staat wusste, was läuft.
In der Tat fehlt in den meisten Fällen in Europa eine detaillierte Erfassung und Kontrolle von Technologietransfers. Zwar gibt es internationale Abkommen wie das Wassenaar-Abkommen für Dual-Use-Technologien, aber für viele Produkte fehlen umfassende Daten, wann sie in welcher Menge übertragen wurden. Selbst innerhalb Europas sind die Zusammenarbeit und der Informationsaustausch zwischen Ländern wie Deutschland und Frankreich noch lückenhaft.
Zuletzt war in Deutschland der Gedanke aufgekommen, man könne in der EU eine Solarindustrie gemeinsam mit China ansiedeln. Doch Ihren Forschungsergebnissen zufolge läge das gar nicht in Chinas Interesse.
Schon seit Ende 2022 diskutierte die chinesische Regierung über die Aufnahme von Solartechnologien in ihre Kontrollliste. Letztlich wurde diese Technologie jedoch nicht aufgenommen, da die chinesischen Solarhersteller Bedenken geäußert haben. Sie befürchteten, dass Exportbeschränkungen zu Marktanteilsverlusten in Südostasien führen könnten und dass europäische Länder versuchen, ihre Lieferketten unabhängig von China zu gestalten.
Wo könnte China künftig Druck auf die EU ausüben?
Industrierohstoffe wie Gallium und Germanium sind bereits von chinesischen Ausfuhrkontrollen betroffen. Es geht aber auch um Dinge wie die Lizenz für Nutzung der Technologie für die Herstellung von Magneten für Windturbinen. Oder Algorithmen, etwa den von TikTok. Das alles fällt unter Chinas Technologie-Exportkontrollen. Zusätzlich sind auch Drohnen und Materialien für kugelsichere Westen von Exportkontrollen betroffen, von denen viele von deutschen Mittelständlern hergestellt werden.
Welches Szenario entwerfen Sie für den Konfliktfall?
China könnte bestimmte Materialien einfach nicht mehr liefern. Zudem könnten chinesische Unternehmen keine Produktionsstätten für Technologien wie Windturbinen in Deutschland mehr ansiedeln.
Was sollte Europa jetzt tun, angesichts Chinas Nutzung von Technologie in Handelskonflikten?
Der erste Schritt ist das Sammeln von Informationen über Chinas Fortschritte in verschiedenen Technologien und auch zu Europas eigenen Aktivitäten und Fähigkeiten. Wichtig ist, dies auf europäischer Ebene zu tun, um ein umfassendes Bild zu erhalten. Zudem benötigen wir in den Ministerien mehr Technologie- und Industrieexperten, da derzeit oft nur Juristen oder langjährige Bürokraten tätig sind. Es muss eine neue Kompetenz im Bereich Technologien aufgebaut werden.
Besonderen Ärger erregt in Brüssel derzeit das chinesische Vorgehen, militärisch relevante Waren mit Russland zu teilen, ohne offiziell Waffen oder auch nur Dual-Use-Güter an den befreundeten Nachbarn zu liefern. Wie klappt dieser Spagat?
China weiß genau, welche Kontrollen es offiziell durchführen kann, ohne die eigenen Unternehmen zu behindern oder Russland zu schaden, und dabei zugleich international gut aussieht. Oft ist die Umsetzung dieser Kontrollen so gestaltet, dass sie chinesische Unternehmen nicht betreffen. Wenn Europa ein Unternehmen sanktioniert, tritt zudem oft einfach das Nächste in Erscheinung. Dieses kann dann wieder so lange Geschäfte machen, bis es seinerseits von der EU sanktioniert wird. Darüber hinaus waren beispielsweise chinesische Exportkontrollen für Drohnen so konzipiert, dass kommerzielle chinesische Drohnen nicht betroffen waren. Die haben aber bedeutsame Anwendungen auf dem Schlachtfeld.
Wie reagiert Europa auf diese Herausforderungen?
Europa war bisher zu passiv und hat versucht, mit China zu diskutieren, anstatt konsequent Sanktionen zu verhängen, die es europäischen Firmen verbieten würde, mit chinesischen Firmen auf der Sanktionsliste zu handeln.
Liegt das Kernproblem darin, dass mit China ein Systemrivale so viel wichtige Technologie auf so hohem Niveau herstellt?
Das Problem ist weniger die Qualität der Technologie, sondern dass die chinesische Produktion günstiger ist. Lange Zeit galt das Credo, dass günstiger besser ist, ohne zu erkennen, wie strategisch China diese Marktmacht aufgebaut hat. Chinas Regierung und Unternehmen sind bereit, kurzfristige finanzielle Nachteile in Kauf zu nehmen, um langfristig Abhängigkeiten aufzubauen und die Handelsketten um China herum in seinem Sinne neu zu gestalten.
Lohnt es sich daher, um krisenfester zu werden, Waren zu höheren Preisen in Europa herzustellen?
Es ist wichtig, strategisch zu analysieren, welche Produkte wir vorrätig halten müssen, auch wenn das höhere Kosten verursacht. In manchen Fällen können Zölle sinnvoll sein, um zu verhindern, dass chinesische Produkte die Preise unterbieten. Allerdings wäre es kontraproduktiv, wenn Europa, die USA, Japan und Südkorea alle die gleichen Produkte teurer als in China herstellen und dadurch Überkapazitäten erzeugen. Stattdessen sollten westliche Länder ihre Produktion koordinieren und bestehende Vorteile nutzen, wie Europas Position in der Produktion von Leistungshalbleitern.
Sind Subventionen ein geeignetes Mittel, um mehr technologische Sicherheit zu erreichen?
Es gibt auch die Möglichkeit, Industrien zeitweise zu subventionieren, um sie langfristig wettbewerbsfähig zu machen, wie China es bei Elektroautos vorgemacht hat. Es ist aber nicht realistisch, alle Industrien zu subventionieren. Daher muss entschieden werden, welche Industrien so wichtig sind, dass Subventionen sich lohnen. Das könnte zum Beispiel die Chip-Industrie sein, deren Produkte für viele andere Branchen essenziell sind, oder 5G, wo Deutschland und Europa aus Gründen der technologischen Sicherheit eigene Anbieter benötigen. Wir subventionieren ja auch jetzt schon die Landwirtschaft, weil Nahrung essenziell ist.
Wer soll in Europa die Entscheidungen treffen, welche Wirtschaftszweige so wichtig sind, dass sie Förderung verdienen?
Nur die Politik kann diese Prioritäten setzen und bestimmen, wie viel das kosten darf.
Antonia Hmaidi ist Senior Analyst bei der Berliner Denkfabrik Merics, dem Mercator Institute for China Studies. Anlass für das Interview ist ein neuer Report, den Hmaidi zusammen mit Rebecca Arcesati und François Chimits verfasst hat: Keeping value chains at home – How China controls foreign access to technology and what it means for Europe.
12. September 2024, 17:30 Uhr, Table.Briefings, Wöhlertstr. 12-13, 10115 Berlin
Salon des Berlin Institute for Scholarly Publishing BISP Salon I: The Changing Geography of Global Research Mehr
12./13. September 2024, FU Berlin
Jahrestagung des Netzwerks Wissenschaftsmanagement Für Freiheit in Krisenzeiten. Perspektiven aus dem Wissenschaftsmanagement Mehr
12. – 15. September 2024, Potsdam
133. Versammlung der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Wissenschaft für unser Leben von morgen Mehr
18. September 2024, Alte Münze, Berlin
InnoNation Festival Scaling Solutions Mehr
19. September 2024, ab 11 Uhr, Körber-Stiftung, Hamburg
Hamburg Science Summit 2024 “Europe’s Path Towards Tech Sovereignty” Mehr
24. September 2024, 10:30 bis 16:15 Uhr, Haus der Commerzbank, Pariser Platz 1, 10117 Berlin
Forum Hochschulräte Starke Marken, klarer Kern: Strategische Schwerpunktsetzung und Markenbildung bei Hochschulen Mehr
25. September 2024, 8:00 bis 9:15 Uhr im BASECAMP, Mittelstraße 51-53, 10117 Berlin
Frühstücks-Austausch: Gipfel für Forschung und Innovation Follow-up Innovationen in Europa – Katalysatoren, Kompetenzen und Kooperationen am Beispiel von KI: Gespräch über Umsetzungsschritte für mehr Geschwindigkeit bei Innovation und Forschung Zur Anmeldung
25. September 2024, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU)
Jahreskolloquium des Bayerischen Wissenschaftsforums Transformationskompetenz in Wissenschaft und Hochschule Mehr
26. September 2024, 12:00 bis 13:00 Uhr, Webinar
CHE talk feat. DAAD KIWi Connect Transfer und Internationalisierung – Warum ist es sinnvoll, beides gemeinsam zu denken und was braucht es hierzu? Mehr
26./27. September 2024, Leopoldina, Jägerberg 1, 06108 Halle (Saale) und Online
Jahresversammlung 2024 der Leopoldina Ursprung und Beginn des Lebens Mehr
3. /4. Oktober 2024, Universität Helsinki, Finnland
2024 EUA FUNDING FORUM Sense & sustainability: future paths for university finances Mehr
8. /9. Oktober 2024 an der TU Berlin
bundesweite Tagung zu Machtmissbrauch an Hochschulen “Our UNIverse: Empowered to speak up” Mehr
Mit vier themenoffenen Programmlinien haben Bund und Länder ihre Vereinbarung zur Förderung der anwendungsorientierten Forschung an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) jetzt konkretisiert. Als Förderrichtlinien veröffentlicht wurden HAW-ForschungsAkzente, HAW-ForschungsPraxis, HAW-EuropaNetzwerke und HAW-ForschungsraumQualifizierung, teilte die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK) mit. Insgesamt sollen im Rahmen des Programms bis zum Jahr 2030 Fördergelder in Höhe von knapp 500 Millionen Euro bereitgestellt werden.
Die Programmlinie HAW-ForschungsAkzente sieht vor, Forschungsvorhaben mit hohem innovativem Charakter zu fördern, die zur Vertiefung von bestehenden und zur Entwicklung von neuen Forschungsschwerpunkten an der Hochschule beitragen. Auch gehören Vorhaben, die eine Weiterentwicklung des Forschungsprofils der Hochschule zum Ziel haben, in diese Förderlinie.
Der Ausbau von Forschungskooperationen zwischen HAWs und Praxispartnern außerhalb der Hochschule steht im Fokus von HAW-ForschungsPraxis. Dabei können die Hochschulen sowohl mit Unternehmen zusammenarbeiten als auch beispielsweise mit Kommunen, Vereinen oder Verbänden. Bei beiden Förderlinien wird die Qualität der Anträge wissenschaftlich begutachtet.
Eine höhere Beteiligung deutscher HAWs an internationalen Förderinstrumenten ist das Ziel von HAW-EuropaNetzwerke. Mit den Fördergeldern sollen die Hochschulen dabei unterstützt werden, sich an europäischen und internationalen Forschungsprojekten zu beteiligen oder ihre Leitung zu übernehmen. Die Programmlinie HAW-ForschungsraumQualifizierung schließlich fokussiert sich auf die forschungsnahe Förderung von Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern. al
Trotz oder womöglich auch wegen der anhaltenden Debatte über “De-Risking” bauen deutsche Unternehmen ihre Forschungsaktivitäten in China aus. Das geht aus einem Bericht der Deutschen Auslandshandelskammer (AHK) in China hervor. Abweichend von den Argumenten deutscher Politiker argumentiert die Kammer in ihrem “Innovationsreport 2024”, dass eine starke Forschungspräsenz in China unerlässlich sei. Nur so sei es möglich, nicht von chinesischen Konkurrenten abgehängt zu werden.
Der auf einer Umfrage basierende Report zeigt, dass deutsche Unternehmen ihre Forschungs- und Entwicklungsarbeit vermehrt lokalisieren. Damit wollen sie die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Produkte stärken und mehr Kunden in China erreichen. Gleichzeitig nutzen deutsche Firmen die Volksrepublik zunehmend als Innovationszentrum für globale Märkte.
“Deutsche Unternehmen in China investieren in lokale Innovationen und strategische Partnerschaften mit Kunden und Zulieferern, um in dem umkämpften und dynamischen Marktumfeld wettbewerbsfähig zu bleiben”, sagt Martin Klose, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Deutschen Handelskammer in Süd- und Südwestchina.
Die Unternehmen könnten “einen Wettbewerbsvorteil erlangen, indem sie mit Partnern innerhalb des chinesischen Ökosystems zusammenarbeiten”, sagt auch Tunde Laleye, Partner und General Manager in China des Beratungsunternehmens BearingPoint, das am Report mitwirkte. Durch eine stärkere Präsenz in China würden Forschungszyklen verkürzt und die Zeit bis zur Markteinführung beschleunigt.
Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:
“Was Innovationskraft angeht, sind chinesische Unternehmen ihren deutschen Konkurrenten dicht auf den Fersen und liegen teilweise schon vorne“, warnt Kammer-Vorstand Klose. “Genau deshalb schnellen auch deutsche Investitionen in China in die Höhe, besonders in der Automobilindustrie”, so Klose weiter. “Auch wenn der Abstand geringer wird, bin ich zuversichtlich, dass deutsche Unternehmen sich behaupten werden. Sie punkten weiterhin mit Qualität und optimieren lokal ihre Produkte und Dienstleistungen – was sie wiederum auch in den globalen Märkten stärker macht.” jp

Christian Mölling gehört zum überschaubaren Kreis der Zeitenwende-Erklärer. Er ordnet ein, kritisiert, regt an und sagte kurz vor seinem Jobwechsel gegenüber Table.Briefings: “Irgendwann ist es gut, weiterzuziehen.” Nicht zuletzt deshalb, weil Entscheidungen von Führungspersonen korrigierbar sein müssten, seien regelmäßige Wechsel wichtig.
Diese Woche beginnt Mölling als Direktor des Programms Europas Zukunft bei der Bertelsmann-Stiftung und bekommt dort “eine doppelte Aufgabe”, wie er sagt: Seinen Verantwortungsbereich Europa will er nachschärfen, das Thema Sicherheit soll eine größere Rolle spielen. Wie viele andere Stiftungen in Deutschland habe auch Bertelsmann mit dem Thema Sicherheit und Verteidigung “in den letzten Jahrzehnten sehr gefremdelt”. Zur strategischen Aufstellung gehöre aber auch, die guten Arbeitsergebnisse aller Kolleginnen und Kollegen in Entscheidungsprozesse einzuspielen, dass “gute Politik möglich wird”.
Europa befinde sich derzeit “in der wahrscheinlich kritischsten Phase der letzten siebzig Jahre”, sagt Mölling. Von Krieg bis Klimakrise gebe es eine Reihe existentieller Herausforderungen. Die Frage sei: Wie kann die Bertelsmann-Stiftung in diesen Zeiten ihre Ressourcen sinnvoll einsetzen, um ihre Ziele zu erreichen?
Zuletzt war Mölling stellvertretender Direktor des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) und Leiter des Zentrums für Sicherheit und Verteidigung. Vor seiner Tätigkeit bei der DGAP arbeitete er beim German Marshall Fund of the United States (GMF), in der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), am Center for Security Studies der ETH Zürich sowie am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg.
Wenn der 1973 in Bad Oeynhausen geborene Politikwissenschaftler über seinen Werdegang spricht, kommt er vom Kleinen ins Grundsätzliche. Erst mit Anfang dreißig – nach Studium der Politik-, Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaften an den Universitäten in Duisburg und Warwick – habe er gemerkt, dass er einen Doktortitel brauche, um Projektleiterstellen zu bekommen. “Und heute würde ich sagen: zu Recht.” Mit seiner Promotion an der Ludwig-Maximilians-Universität in München habe er “Leidensfähigkeit” gelernt – was für akademischen Erfolg wichtiger sei als “Brillianz”.
Es ist viel Understatement. Möllings Sicht auf die deutsche Debattenkultur kommt ohne solches Understatement daher. “Dass in der medialen Debatte immer wieder Leute zu Experten gemacht werden, es aber nicht sind, finde ich ziemlich schwierig: Da werden Meinung und Wissen oder begründete Einschätzung gleichgesetzt.” Weil man die medialen Regeln aber nicht ändern könne, gibt er viele Interviews, schreibt Gastbeiträge, macht Hintergrund-Briefings. Anfragen nehme er an, wann immer es gehe, sagt er. “Es gibt den ersten Kristallisationspunkt nach einem Ereignis, das erste Interview, an dem sich der politisch-mediale Diskurs dann entlang hangelt.” Und wenn man dann die Möglichkeit nicht nutze und meinungs-, aber nicht unbedingt wissensstarken Beiträgen die Deutungshoheit lasse, dann, habe man danach “den Scherbenhaufen in der Diskussion, den man nicht mehr weggekehrt kriegt”.
In Westdeutschland habe es nach Gründung der Bundesrepublik eine “schwere Auseinandersetzung” darum gegeben, wie wissenschaftlich und wie politisch Friedensforschung sein sollte und was das richtige Verhältnis zu Politik und zur Friedensbewegung wäre. Mit der politischen Ideologisierung sei auch früh die Ausrichtung gekommen: Dabei seien “die Sicherheitspolitiker fast ganz rausgeflogen, auch aus den Förderlinien”. Das wirke bis heute nach: So gebe es in Großbritannien oder Skandinavien eine Reihe guter Universitäten, die ohne Probleme Verteidigung und Konfliktforschung zusammen unterrichten, “hier in Deutschland aber haben Sie noch immer mit einem ideologischen Bias zu kämpfen, der die weitgehende Wissensfreiheit beim Thema Verteidigung auch bei Forschenden erklärt: kein Lehrstuhl, keine Seminare”.
Deshalb ist es ihm wichtig, Diskurse mitzuprägen. Man müsse für das Thema und die Art der Arbeit brennen, um auch am Freitagnachmittag da zu sein. Und Krisen begännen schließlich “meistens freitagnachmittags – empirisch gefühlt”. Gabriel Bub
Katrin Böhning-Gaese ist neue Wissenschaftliche Geschäftsführerin des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ). Sie folgt auf Rolf Altenburger, der das Zentrum seit 2022 leitete. Die Biologin war 14 Jahre lang Direktorin des Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrum.
Yafang Cheng wurde zum Wissenschaftlichen Mitglied der Max-Planck-Gesellschaft sowie als neue Direktorin am Max-Planck-Institut für Chemie ernannt. Sie soll dort eine Abteilung für Aerosolforschung aufbauen. Cheng erforscht die grundlegenden Mechanismen atmosphärischer Aerosolprozesse und deren Auswirkungen auf Luftqualität und Klima.
Torsten Fischer, bisher Leiter der Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen (KoWi), hat die Position des Administrativen Direktors am Leibniz-Zentrum für Archäologie (LEIZA) übernommen. Als Mitglied des Direktoriums wird er maßgeblich die strategische Ausrichtung des LEIZA mitgestalten. Er folgt auf Heinrich Baßler, der Ende August in den Ruhestand getreten ist.
Hendrik Streeck, Direktor des Instituts für Virologie am Uniklinikum Bonn, will für die CDU in den Bundestag. Die Bonner CDU nominierte ihn als Direktkandidaten für die Bundestagswahl im kommenden Jahr. Er kandidiere, “weil wir einen positiven Aufbruch, einen authentischen Politikwandel aus der Mitte brauchen”, schrieb Streeck auf X.
Franziska Tanneberger, Leiterin des Greifswald Moor Centrum in Mecklenburg-Vorpommern, und Elektrotechnik-Ingenieur Thomas Speidel aus Nürtingen bei Stuttgart werden in diesem Jahr mit dem Deutschen Umweltpreis der Deutschen Bundesstiftung Umwelt ausgezeichnet. Sie teilen sich den Preis von insgesamt 500.000 Euro. Er zählt zu den höchstdotierten Umwelt-Auszeichnungen Europas. Speidel hat als Geschäftsführer der ads-tec Energy innovative batteriegepufferte Hochleistungssysteme entwickelt. Sie ermöglichen etwa das Stromtanken binnen Minuten statt Stunden. Die Moorforscherin Tanneberger gilt als treibende Kraft bei der Revitalisierung und Wiedervernässung von Mooren sowie als Brückenbauerin zwischen Wissenschaft, Politik und Landwirtschaft.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an research@table.media!
Berlin.Table. Doppelwahl in Ostdeutschland: Eine Abstimmung wird zur politischen Abstrafung der Ampel. Die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen sind ein unmissverständlicher Fingerzeig in Richtung Berlin. Insbesondere bei der SPD neigt sich die Geduld der Parteiführung dem Ende entgegen. Die Schonzeit für Olaf Scholz ist vorbei. Mehr
Berlin.Table. Der Erfolg der AfD und der Blick von außen: Was die Welt denkt. Waren die Wahlen in Sachsen und Thüringen eine Frustwahl? Oder gar eine Zäsur? Und welche Auswirkungen könnten sie für das gesamte Land haben? Table.Briefings hat ausländische Journalisten und Wissenschaftler gefragt. Mehr
Bildung.Table. Digitalpakt II: Wie viel Geld der Bund geben will. Lange vehement von den Ländern eingefordert, liegt die Zahl nun auf dem Tisch: 2,5 Milliarden Euro will der Bund für den Digitalpakt II geben. Laufzeit: 2025 bis 2030. Hinter dem Digitalpakt I bleibt die Summe damit deutlich zurück. Entsprechend fällt die Reaktion von Schleswig-Holsteins Kultusministerin Karin Prien aus. Mehr
Europe.Table. Neue EU-Kommission: Nur sieben Frauen nominiert. Die letzten Namen sind bekannt, nur Belgien hat die Frist verpasst: Italien nominiert Raffaele Fitto, Bulgarien Ekaterina Sachariewa und Julian Popow. Klar ist: Von der Leyen wird die Kommission nicht paritätisch mit Männern und Frauen besetzen können. Mehr
Tagesschau: Wie innovativ ist Deutschland? In traditionellen Branchen wie Auto, Chemie und Maschinenbau gehört Deutschland nach wie vor zu den weltweit innovativsten Ländern. Anders sieht es aus, wenn es um IT oder KI geht. Auf diesen Feldern wird die Bundesrepublik von den USA und China abgehängt. (“Wie viel Hightech schafft Deutschland?“)
taz: Innovationsfähigkeit und Zeitenwende. Der Zukunftsrat hat Vorschläge zur Zukunft des Wissenschaftsstandorts Deutschland gemacht. Künftig soll stärker darauf geachtet werden, dass Forschungsergebnisse auch den Sprung in die Märkte schaffen. Und um auch im Bereich Militärtechnik weltweit vorne mit dabei sein zu können, werden sich Hochschulen von der Zivilklausel verabschieden müssen, die ihnen die Zusammenarbeit mit Rüstungsunternehmen untersagt. (“Vom Labor auf den Markt“)
Handelsblatt: Chemische Industrie forscht lieber im Ausland. Als Produktionsstandort steht Deutschland schon lange unter Druck. Doch nun ist auch der Forschungsbereich in Gefahr. Die chemische Industrie verlagert zunehmend ihre Forschung ins Ausland. (“Deutsche Chemieindustrie verlagert Forschung immer mehr ins Ausland“)
FAZ: Regulierungen allein schaffen keine Innovationen. Die Europäische Union hat sich entschieden, auch im Bereich Künstlicher Intelligenz einen Regulierungsrahmen zu schaffen. Die Hoffnung ist, dass der Rest der Welt dem alten Kontinent auf seinem Weg folgt. Viel zu wenig kümmert sich Europa allerdings darum, auch bei den Innovationen Spitze zu sein. (“Verpasst Europa den KI-Zug?“)
Die Mauer des Schweigens, die Omerta einer eingeschworenen Gemeinschaft, bröckelt. Während bisher die unangenehmen Wahrheiten zum deutschen Wissenschafts-, Forschungs- und Innovationssystem von unbequemen Außenseitern adressiert wurden, melden sich jetzt auch erste Stimmen aus der Community selbst.
Der von mir sehr geschätzte Georg Schütte, Staatssekretär a.D., heute experimentierfreudiger Chef der VolkswagenStiftung, und der intellektuell scharfe Volker Meyer-Guckel, Generalsekretär des Stifterverbands, sprechen in ihrem Impulspapier über den Verlust an Innovationskraft und internationaler Wettbewerbsfähigkeit. Sie sprechen über ineffiziente Strukturen, über geringe Dynamik im Vergleich zu internationalen Wettbewerbern, über den nötigen Wechsel von einer Wettbewerbs- auch zu einer Wirkungslogik, über kostenträchtige Doppelung von Forschungskapazitäten hierzulande und in Summe von einer nationalen Kraftanstrengung für die Weiterentwicklung des deutschen Wissenschaftssystems. Das kommt zu einem Zeitpunkt, zu dem der Elefant im Raum unübersehbar geworden ist.
Weder die HRK noch die Außeruniversitären Forschungseinrichtungen (AuF) rührten sich zu der für sie problematischen Ansage. Dafür durfte der Chef der Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI), Uwe Cantner , gestelzt abmoderieren – “….würde der Diagnose, die Wissenschaft stecke in einem tiefen Tal, nicht ohne weiteres folgen”. Seine eigene Kollegin in der EFI-Kommission, Irene Bertschek vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, konterkarierte diese Aussage kurz danach. In ihrem aktuellen Impulspapier für den Zukunftsrat des Bundeskanzlers, welches sie zusammen mit dem CEO von Volocopter, Dirk Hoke, erarbeitet hat, schreibt sie: “Deutschland fällt in zentralen Innovationsfeldern zunehmend hinter globale, klar fokussierte Mitbewerber zurück.”
Muss Deutschland erst in allen Technologiebereichen abschmieren, bevor die Wissenschaftscommunity endlich aufwacht? Manchmal erinnert es mich an die Allegorie vom Frosch im Wasserglas, welches mehr und mehr erhitzt wird.
Das im Impulspapier beschriebene und im Zukunftsrat vorgetragene ”Technologie – Grid” ist brutal-nüchtern. Es bescheinigt nur in drei von elf Schlüssel- und Zukunftstechnologien Verbesserungen seit dem Start der Ampel. In den acht übrigen Technologiefeldern gab es in der Forschungspolitik seit 2021 nicht nur keine Verbesserung, sondern teils sogar Verschlechterungen. Dem Plädoyer Bertscheks und Hokes für eine “auf der strategischen Ebene, ehrliche und Commitment-orientierte Debatte” kann ich mich nur anschließen. Die Rosstäuscherei muss ein Ende haben.
Zu einer offenen und ehrlichen Debatte gehört auch, dass man sich die Karten legt und folgende Fragen diskutiert:
Doch nach der intellektuellen Denksportaufgabe der strategischen Priorisierung kommt der operative Schmerz des Abbaus von Mehrfachkapazitäten. Und zuallererst die ehrenpusselige Festlegung, welche Forschungsstätte den Lead erhält - da kann es nur um wissenschaftliche Exzellenz gehen. Past Merit! Dieser zeigt sich meist bei den Forschungspersönlichkeiten, um die sich die besten jungen Forscherinnen und Forscher scharen. Denn diese sehen nicht nur Past Merit, sondern auch ihre Zukunft. Ich gehe jede Wette ein, dass der Zukunftsrat darüber nicht gesprochen hat.
Wenn Bertschek und Hoke in ihrem Impulspapier dann davon schreiben, dass der Transfer-Output auf ein Niveau gehoben werden müsse, das dem hohen Input entspreche, dann bezweifle ich, dass die Entscheider im Zukunftsrat überhaupt in der Konsequenz verstanden haben, was das heißt. In der Betriebswirtschaft nennt man das “break even” – man erzielt gerade mal so viel Umsatz, wie man benötigt, um die Kosten zu decken, also nur die Milliarden wieder hereinholt, die man hineingesteckt hat.
Dass Irene Bertschek so argumentiert, kann ich aufgrund ihres Werdegangs gerade noch nachvollziehen. Dass Dirk Hoke so argumentiert, lässt nicht nur für Volocopter nichts Gutes ahnen. Deutschland braucht doch ein Mehrfaches an Umsatz aus innovativen Produkten und Services, um den Abstieg in einen Aufstieg zu drehen.
Wichtig ist nichtsdestotrotz, dass die beiden Autoren den Output strapazieren. Angesichts der verheerenden 2023er-Ausgründungszahlen der fetten Katzen - gemeint sind Fraunhofer & Co (Ausnahme in 2023 Max Planck) - und der desaströsen Evaluierung (wenn man die politische Sprache dekodieren kann) der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz für die ersten drei Jahre des fortgeschriebenen Pakts für Forschung und Innovation (PFI IV) für diese fetten Katzen, ist das überfällig gewesen. Zur Erinnerung, meine frühere Kolumne: ”Alle schwätzen vom Transfer, aber nichts passiert!”
Deswegen habe ich auch in dieser Kolumne bewusst den Begriff “Omerta” gewählt: Die immer wieder gleichen Spieler aus Politik, Wissenschaft und Forschung sowie aus der Stiftungswelt sitzen immer wieder in den gleichen Runden zusammen, wie alte Ehepaare - die Wissenschaft nennt das homosoziale Reproduktion. Sie erzählen sich immer wieder die gleichen Geschichten so oft, dass jeder jedem glaubt. Gleichzeitig werden eine unsägliche Geheimhaltung und ein Popanz um Treffen wie das des Zukunftsrats und seiner Papiere gemacht. Obwohl Deutschland den Sense of Urgency zum Thema Zukunft dringend bräuchte. Und das setzt Transparenz und Offenheit voraus.
