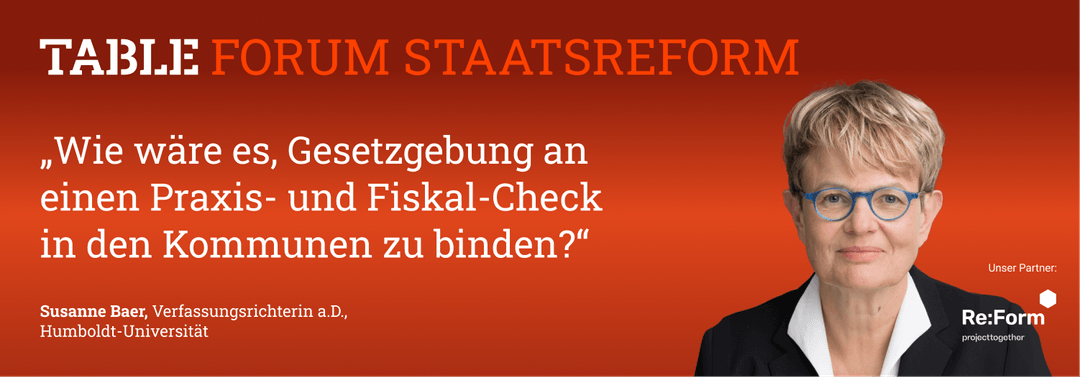
Von Susanne Baer
Die Kommunen sind der Ort, an dem Staat und Demokratie erlebbar werden. Wir sollten sie im Zuge einer umfassenden und notwendigen Staatsreform stärken. Das Grundgesetz weist den Weg. Ein Vorschlag: Auf lokaler Ebene, wie beim Bundesverfassungsgericht üblich, die Amtszeiten begrenzen. Das schafft mehr Konsens und fördert den Mut, das Neue zu wagen.
Überall ist Krise. Die Kriege, die Bildung, die Wirtschaft, eine marode Infrastruktur, das Klima dramatisch schlecht. Auch dem Rechtsstaat geht es nicht gut: Gerichte sind schlecht ausgestattet, es entstehen Gerechtigkeitslücken; zur Verwaltung fällt vielen nur „Bürokratisierung“ ein. Die Demokratie ist zwar als Regierungsform gewollt, aber es gibt ein gefährliches „Demokratiedefizit“, und „der Gesetzgeber“ wird als elitär denunziert, als übergriffig oder überfordert wahrgenommen.
Seit Jahren soll sich das ändern, und jetzt ist höchste Zeit. Auch deshalb rufen viele nach einer grundlegenden Staatsreform. Ohne sie ist jede noch so gute Politik – ob bei Bildung, Gesundheit oder Energie – nicht umsetzbar. Oder genauer: Ohne einen grundlegenden Wandel vor allem in der Verwaltung, wo Menschen dem Staat vor Ort begegnen, wo der Staat erfahrbar sein muss, funktionieren sollte, spürbar wird, werden sich Krisen vertiefen, nicht aber lösen lassen.
Der demokratische Rechtsstaat passiert vor Ort, lokal, jeden Tag – vor allem in den Kommunen. Hier werden Probleme deutlich, aber hier wird auch Veränderung sofort sichtbar, denn in den Kommunen wird staatliches Handeln erlebt. Wenn der Staat hier nicht mehr funktioniert, wird es gefährlich. Wie wäre es also, wenn wir in den Kommunen dafür sorgen, dass mehr Menschen mitreden können und Mut belohnt wird, um etwaigen Reformstau zu überwinden?
Das Grundgesetz gibt uns – in großem Einklang mit den Landesverfassungen – mit, worum es in der Sache geht. Menschenwürde, Freiheit, Gleichheit, im „demokratischen und sozialen Bundesstaat“, in dem auch Mehrheiten an die Verfassung gebunden sind (Artikel 20), in Europa (Artikel 23) dem Frieden der Welt zu dienen (Präambel). Das ist wunderbar. Aber es ist nicht alles. Es gibt im Bund auch den Artikel 28, der von den Gemeinden handelt. Dort spielt die Musik. Dort zeigt sich, was der Staat leistet, dort leben wir, dort muss die rechtsstaatliche Demokratie funktionieren. Und dort lässt sich etwas tun.
Wie wäre es also, die Kommunen prominenter zu machen? Artikel 28 ist schon jetzt wegweisend, indem er lokale Demokratie ausdrücklich europäisiert, denn es dürfen auch EU-Angehörige wählen und gewählt werden. Die Idee dahinter: Wer hier lebt, kann und soll sich einbringen, denn erst das ist lebendige Demokratie.
Wie wäre es also, lokal tatsächlich alle zu beteiligen, die vor Ort sind – nicht ganz kurz, sondern dauerhaft, die bleiben wollen und beitragen zu dem, was dann auch Heimat ist, und noch dazu wirklich chancengleich, auch mit Blick auf das Geschlecht? Wie ließen sich Kommunen außerdem nicht nur formal zusammenbinden, sondern lösungsorientierte Netzwerke fördern, als Technikregion, als Pharma-Nest, als Urlaubs-Hub und ähnliche Zukunfts-Zonen? Wie wäre es darüber hinaus, diese lokal starken, aktiv getragenen Kommunen in der Bundespolitik sichtbarer zu machen, in einem erweiterten Bundesrat und durch neue Formen der Beteiligung an Gesetzgebungsverfahren?
Unsere Demokratie ist veränderbar, und Veränderung tut Not, um sie zu bewahren. Wer in der Gemeinde wählen und gewählt werden kann, hat demokratische Erfolgserlebnisse, im Wir, im Miteinander. Wenn wirklich alle gefragt und dabei sind, die in der Gemeinde leben, könnte das dazu beitragen, Blockaden zu durchbrechen.
Und es geht noch mehr. Schon jetzt sieht Artikel 28 vor, dass Gemeinden das Recht haben, ihre Angelegenheiten in eigener Verantwortung zu regeln; tatsächlich ersticken sie aber oft daran, vor allem Vorgaben aus Bund und Ländern umsetzen zu müssen, in bisher engen finanziellen Rahmen. Das führt Kommunen bis zur Insolvenz, und es fehlt ihnen dann nicht an Ideen, sondern an ausreichenden Mitteln. Wie wäre es also, Gesetzgebung zwingend an einen Praxis-Check und einen Fiskal-Check in den Kommunen zu binden?
In den Kommunen selbst sind viele engagiert, und ihre Ideen sollten wir beherzter aufgreifen. Eine weitere kommt aus dem Bundesverfassungsgericht, nicht als Entscheidung, sondern als Erfahrung damit, wie es arbeitet. Als Gericht, das über die Grundlagen unseres Zusammenlebens in immer wieder neuen Konflikten entscheidet, muss „Karlsruhe“ Tradiertes hinterfragen und den Mut haben, neue Wege zu eröffnen, um neuen Herausforderungen begegnen zu können.
In den Anfangsjahren waren das Entscheidungen zur Meinungsfreiheit und zur Gleichberechtigung, später zum Datenschutz und zur Demokratie, auch in Europa. Im März 2021 war es die Entscheidung zum Klimaschutz: Der Gesetzgeber muss, so der Erste Senat, nicht nur aktuell vorhandene Interessen berücksichtigen und ausgleichen, sondern auch an die Freiheit der nachfolgenden Generationen denken. Da hat das Gericht eine Tür zur Zukunft aufgemacht. Nicht zufällig, sondern divers zusammengesetzt und in aufwändigen Verfahren. So löst es bestenfalls Blockaden der in Wahlperioden kurzfristiger und nationaler tickenden Politik. Wie kann das auch andernorts gelingen?
Das Bundesverfassungsgericht ist für solche Impulse erdacht worden; es ist dafür konstruiert. Wie wäre es also, auch für andere Ämter eine begrenzte Amtszeit einzuführen, gerade in den Kommunen? Im Bundesverfassungsgericht beträgt sie 12 Jahre und es gibt keine Wiederwahl. Das fördert die gemeinsame Arbeit am Konsens; das lässt Raum für den erforderlichen Mut, notfalls zu intervenieren. Man muss miteinander gut auskommen, sich aber nirgendwo beliebt machen; die Arbeit an der Sache steht im Vordergrund, nicht der Verbleib im Amt. Ließe sich daraus für eine Demokratie lernen, die Krisen bewältigen muss, indem sie auch ungewöhnliche Lösungswege beschreitet, die, wie die Beratungen im Verfassungsgericht, konstruktiv funktioniert, nicht polarisierend?
Klar ist: Das deutsche Grundgesetz ist auch deshalb ein Exportschlager, weil ein unabhängiges Gericht mit nicht lebenslang ernannten Richterinnen und Richtern in aufwändigen Verfahren vormacht, dass in großen Kontroversen sachlicher Konsens zu finden ist. Es setzt Urteile gegen Vorurteile. Nur so kann es eben auch politische Blockaden lösen. Wie wäre es also, ein kleines Stück Verfassungsgericht in die Kommunen zu bringen? Nicht ganz so streng, aber: Die Amtszeit begrenzen, mit höchstens einer Wiederwahl? Ließe sich so auch über das Berufsbeamtentum auf Lebenszeit, die Laufbahn- und Besoldungsstrukturen nochmals kritisch nachdenken, für mehr Mut und mehr Projektarbeit gerade im öffentlichen Dienst, als Dienst an den öffentlichen Angelegenheiten, die uns alle etwas angehen? Wichtig wäre, dass Menschen Neues wagen und mit der Umsetzung beginnen können, aber das muss ermöglicht werden, und dann müssen auch mal Neue ran. Also: Kein Abo auf’s Amt, nirgends?
Begrenzte Amtszeit, nur eine Wiederwahl – das könnte bedeuten, längerfristige Ziele zu setzen, in breiter Einigkeit, aber auch innovative Schritte gehen zu können, ganz praktisch, vor Ort. In den Kommunen wird es spürbar, auf sie kommt es an. Jedenfalls wird die Arbeit miteinander am Konsens dringend gebraucht. Eine lebendige, kommunale Demokratie kann viel leisten. Da braucht es Mut, kein Abo auf’s Amt. Es könnte ja sein, dass sich dann etwas bewegt.
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Susanne Baer, LL.M. ist Verfassungsrichterin a.D. und Professorin an der Humboldt Universität zu Berlin.