mehr Transparenz auf EU-Ebene, das hatte sich die Bundesregierung eigentlich in den Koalitionsvertrag geschrieben. Doch bei zwei aktuellen Beispielen gibt sich Berlin geheimniskrämerisch. Table.Media wollte wissen, wie weit die Bundesregierung den Beihilferahmen TCTF gerne lockern würde, also die finanzielle Unterfütterung des Net-Zero Industry Acts. Doch nach unserem Auskunftsantrag an die Kommission Mitte Februar schickte die Generaldirektion Wettbewerb gestern eine offizielle Ablehnung: Die Bundesregierung habe den Zugang zu dem Dokument verweigert!
“Im vorliegenden Fall waren die deutschen Behörden der Ansicht, dass die deutsche Stellungnahme zum TCF sensible Informationen darstellt, da sie sich auf Krisenmaßnahmen bezieht und Informationen über eine schwerwiegende Störung des deutschen Wirtschaftsgeschehens enthält”, schreibt die DG Comp. Dass Table.Media die deutsche Position dann Anfang März veröffentlicht hatte – geschenkt!
Die kurios späte Antwort der Kommission offenbart die fragwürdigen Argumente deutscher Beamter. Denn die Antwort Berlins enthielt keine sensiblen Informationen über die deutsche Wirtschaft. Vielmehr setzte sich die Bundesregierung unter anderem dafür ein, dass die großzügigsten Fördermöglichkeiten auch für nicht ganz so strukturschwache Regionen in Deutschland gelten sollten.
Einen Schritt rückwärts macht die Bundesregierung zudem mit dem jahrelang gepflegten Verzeichnis deutscher Interessenvertretungen in Brüssel. “Die bisher an dieser Stelle eingepflegte Liste wird in Zukunft nicht mehr aktualisiert und wurde von der Webseite entfernt”, steht inzwischen auf der Seite der Ständigen Vertretung.
Doch war die Liste nicht ohnehin überflüssig geworden seit der Einführung des EU-Transparenzregisters? Immerhin hatten Lobbywächter mit der deutschen Liste einen groben Eindruck, welche Verbände und Unternehmen Kontakte in die StäV halten – und zwar nicht nur zu den EU-Botschaftern, deren Treffen mit Lobbyisten weiterhin ausgewiesen werden. Kontakte zu einfachen StäV-Mitarbeitern und Ministerialbeamten in Berlin hatte aber auch das alte Verzeichnis nicht im Einzelnen ausgewiesen. Das wäre doch mal ein Beitrag zu mehr Transparenz in der deutschen EU-Politik!
Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre.

Die EU-Gesetze enthalten erhebliche Lücken und gehen nicht auf alle Ursachen der Bodendegradation ein. Das schreibt die Kommission in ihrem Vorschlag für eine neue Richtlinie zur Bodengesundheit in Europa. Ein Entwurf liegt Table.Media vor. 60 bis 70 Prozent der Böden in der EU seien in einem schlechten Gesundheitszustand, heißt es darin – mit negativen Auswirkungen für Menschen, Umwelt, Klima und Wirtschaft. Zudem steige das Risiko für katastrophale Folgen des Klimawandels wie Überschwemmungen und Waldbrände.
Auf dieser wissenschaftlichen Bestandsaufnahme aufbauend begründet die Kommission ihr neues Gesetz und beruft sich auf eine Untersuchung der Generaldirektion Forschung und Innovation von 2020. Darin enthalten sind auch Empfehlungen für Grenzwerte und Ziele zur Kohlenstoffkonzentration, Bodenversiegelung, Bodenrecycling und Bodenverschmutzung, damit 75 Prozent der europäischen Böden bis 2030 gesund sind.
Es wirkt daher widersprüchlich, dass die Kommission in ihrem Richtlinienvorschlag eben keine Ziele und Grenzwerte vorschlägt. Stattdessen konzentriert sich der Text auf Vorgaben zu Datenerhebung und Monitoring der Bodengesundheit. So sollen Mitgliedstaaten verpflichtet werden, unter anderem Daten zu erheben über folgende Parameter der Böden:
Zudem gibt die Kommission Methoden und Probengrößen vor und will die Mitgliedstaaten verpflichten, die Daten öffentlich zugänglich zu machen.
Zwar sind im Anhang des Vorschlags teils auch Grenzwerte für die einzelnen Parameter hinterlegt, ab welchem Wert ein Boden als “gesund” einzustufen ist. Auch sind Mitgliedstaaten dazu angehalten, Maßnahmen zur Verbesserung der Bodengesundheit zu identifizieren. Doch es gibt in der Richtlinie keine Formulierung mit der Pflicht, diese Grenzwerte einzuhalten und Maßnahmen umzusetzen. Dabei schreibt die Kommission selbst, dass gesunde Böden sich sehr langsam bilden und ihre Gesundheit erhalten oder verbessert werden könne, “wenn geeignete Maßnahmen ergriffen und umgesetzt werden”.
Es ist kein Geheimnis, dass die Kommission ursprünglich geplant hatte, ambitionierte Ziele und Maßnahmen von den Ländern einzufordern. Doch der politische Druck war zu groß. Insbesondere die europäischen Christdemokraten (EVP), aber auch Teile der liberalen Renew-Fraktion wehren sich gegen strengere Regeln, die auch Auswirkungen auf die Landwirte und die Lebensmittelproduktion haben könnten. Das betrifft vorrangig die Naturschutzgesetze des Green Deals, aber auch eine Richtlinie zu Industrieemissionen. Beim Streit um das Renaturierungsgesetz zeigt sich dieser Konflikt bisher am deutlichsten. Ein ambitioniertes Bodengesundheitsgesetz hätte den Streit weiter angefacht und wahrscheinlich eine weitere Blockade der EVP nach sich gezogen.
Nun ärgern sich jedoch Umweltschützer über das Einlenken der Kommission. Sie fordern seit Jahren strengere Regeln, da sie der Auffassung sind, Landwirte sowie die Biodiversität durch bessere Bodengesundheit zu schützen. Es sei ein “weiterer Schlag für den europäischen Green Deal“, wenn die Kommission ihre Bodenschutzvorschriften aufweicht, sagte Ariel Brunner, Regionaldirektor Europa bei der NGO Birdlife, zu Table.Media. Es sei tragisch, “wie die Agrarlobby die Bemühungen sabotiert, die Landwirtschaft zu schützen.”
Bernhard Krüsken, Generalsekretär des Deutschen Bauernverbands, sagt, dass bereits eine Vielzahl von Richtlinien, Verordnungen, Strategien und Regelwerken direkt und indirekt den Schutz der Böden sicherstellen. Beim Bodenschutz fange man daher nicht bei null an, verteidigt er den Ansatz der Kommission, keine verbindlichen Grenzwerte festzulegen. Strengere Regeln fordert Krüsken jedoch für “das wohl größte Umweltproblem in Sachen Bodenschutz”: den Flächenverbrauch durch Versiegelung und Überbauung durch Siedlungs- und Verkehrsmaßnahmen. Denn auch hier macht die Kommission lediglich Vorgaben zur Überwachung des Status quo.
Benoit Biteau (Grüne), stellvertretender Vorsitzender des Landwirtschaftsausschusses im EU-Parlament, kritisiert, dass der “Überwachungsrahmen” der Kommission Daten liefere, die man bereits habe. Man wisse bereits: “Zwei Drittel der Böden in Europa sind nicht gesund!” Er kündigt an, dass die Grünen im Parlament den Vorschlag der Kommission verschärfen wollen.
Auch das europäische Umweltbüro (EEB) fordert ein deutlich höheres Ambitionsniveau. “Um bis 2050 gesunde Böden zu erreichen, müssen rechtsverbindliche Ziele, verbindliche Pläne, eine umfassende Überwachung der Indikatoren für die biologische Vielfalt der Böden und die Anwendung des Verursacherprinzips eingeführt werden”, fordert Caroline Heinzel, Referentin für Bodenpolitik des EEB. Ein ehrgeiziges Bodengesundheitsgesetz sei die einzige Möglichkeit, die Verschlechterung der Böden umzukehren und sie zu schützen.
Eine Analyse, der auch die Kommission nicht widerspricht. Doch traut sie sich offensichtlich nicht zu, für die nötigen Maßnahmen ausreichende politische Unterstützung zu mobilisieren. Mit Claire Stam
In den riesigen Silos am Rhein des Raiffeisen-Kraftfutterwerks Kehl lagert konventionell und ökologisch erzeugtes Getreide; in jedem Fall aber ist es frei von Gentechnik. Das Unternehmen besteht seit 1963 und setzt mit Nutz- und Heimtierfutter 65 Millionen Euro im Jahr um. Gegen die grüne Gentechnik hat sich Firmenleiter Bernhard Stoll schon 1998 strikt entschieden, aus Überzeugung, wie er sagt. Der Erfolg seiner Entscheidung gibt Stoll recht. Schweinezüchter und Milchviehhalter kaufen sein Futter statt Gen-Soja oder Gen-Mais aus Übersee – und können so der Kundschaft gentechnikfreie Milch, Käse oder Fleisch garantieren.
Am Donnerstag war Stoll in Berlin, bei der Jahresversammlung des Verbands Lebensmittel ohne Gentechnik. Bei den Mitgliedern herrscht Aufruhr, seit geleakte Pläne der EU-Kommission für eine Deregulierung des strengen Gentechnikrechts die Runde machen – samt Lockerung der Kennzeichnungspflicht. “Ich betrachte das als Entmündigung des Verbrauchers”, sagt Bernhard Stoll. Und als Angriff auf sein Geschäftsmodell: “Brüssel schickt sich an, nachhaltige Unternehmenswerte zu vernichten.”
16 Milliarden Euro im Jahr setzen Produkte mit dem Label “Ohne Gentechnik” um. Die Angst der Anbieter: Wenn die Deregulierung kommt, könnten bald überall in Europa Pflanzen aus dem Genlabor wachsen. Denn die bisher bekannten EU-Pläne überlassen das Schwierigste den Mitgliedstaaten: zu verhindern, dass Neuzüchtungen sich unkontrolliert auskreuzen können. Oder dass eine Vermischung stattfindet, weil dieselben Maschinen gentechnisch verändertes und gentechnikfreies Saatgut ausbringen.
“Es gibt so viele Risiken einer Verschleppung”, warnt Futterhändler Stoll. “Wenn das kommt, brauchen wir ein engmaschiges Monitoring.” Mindestens aber müsse die Kommission von jedem gentechnisch veränderten Saatgut Referenzmaterial verlangen – damit Betroffene und Behörden im Zweifel Proben ziehen und rückverfolgen können, was da wächst.
Doch Möglichkeiten zur Rückverfolgbarkeit der Gen-Saat sieht der bisherige Entwurf nicht vor. Die EU-Kommission strebt offenbar eine 180-Grad-Wende in Sachen Gentechnik an. Pflanzen, die mit den “neuen genomischen Techniken” (NGT), also etwa der Genschere Crispr/Cas, gezüchtet wurden und in die dabei kein artfremdes Genmaterial eingebaut wurde, sollen demnach nicht mehr der strengen Risikobewertung für gentechnisch veränderte Organismen (GVO) unterliegen. Für Produkte, die NGT enthalten, soll darüber hinaus die Kennzeichnungspflicht wegfallen.
Für viele Pflanzenzüchter ist das eine frohe Kunde. Seit der Europäische Gerichtshof 2018 geurteilt hat, dass auch mit den neuen NGT-Präzisionstechniken genveränderte Organismen entstünden und diese deshalb dieselben Hürden passieren müssten wie die alten GVO, lobbyieren Züchter und Forscher massiv für eine Deregulierung – unterstützt von Politikern aus FDP und Union.
Die EU-Kommission hat sich wissenschaftliche Expertise für ihre Pläne eingeholt: Die Europäische Lebensmittelbehörde (EFSA) kam bei der Prüfung der NGT-Pflanzenzüchtungen zum Ergebnis, dass von diesen praktisch keine Gefahr ausgehe. Die NGT haben laut EFSA sogar ein deutlich reduziertes Potenzial, “unbeabsichtigte Effekte” hervorzurufen – nicht nur gegenüber den alten gentechnischen Verfahren, sondern sogar gegenüber herkömmlicher Züchtung. Denn auch bei dieser können durch den Einsatz von Radioaktivität oder Chemie unbeabsichtigte Mutationen entstehen.
Das sieht nicht jede Behörde in Europa so. Das Bundesamt für Naturschutz (BfN) hält die Aussage für falsch, dass mit NGT-Pflanzen generell weniger Risiken einhergehen. Auch die Anwendung von NGT könne zu unbeabsichtigten genomischen Veränderungen führen, schreibt das BfN. Das Einfügen neuer Eigenschaften in eine Pflanze berge immer das Risiko negativer Auswirkungen auf Ökosysteme und die biologische Vielfalt. “Sollte es beispielsweise gelingen, eine trockenresistente Feldfrucht zu entwickeln, so könnte diese invasiv werden, weil sie auf einmal Habitate besiedeln könnte, in denen sie vorher nicht überleben konnte”, warnt Deutschlands oberste Naturschutzbehörde. Ein schwerwiegendes Gegenargument, zumal die EU-Kommission ihre Pläne ausdrücklich mit den Zielen begründet, mit den NGT zu mehr Biodiversität und Klimaresilienz auf den Feldern beizutragen.
Die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch hat schon jetzt, noch vor der offiziellen Version der EU-Pläne am Mittwoch, mehr als 62.000 Unterschriften unter ihrer Petition “Gentechnik muss erkennbar bleiben” gesammelt. Am Donnerstag haben Aktivisten diese dem Bundeslandwirtschaftsministerium übergeben. Die Beschneidung der Wahlfreiheit des Verbrauchers durch die Lockerung der Kennzeichnungspflicht ist freilich nicht nur aus Sicht von Foodwatch ein No-Go. Auch Politiker von SPD und Grünen teilen diese Sicht.
“Ohne Kennzeichnung ist eine Rückverfolgbarkeit unmöglich, und das wäre ein Verstoß gegen das Vorsorgeprinzip. Ohne Kennzeichnung gibt es keine Transparenz”, sagte Matthias Miersch, Vizevorsitzender der SPD-Fraktion, nach Bekanntwerden des Leaks. “Das macht die SPD nicht mit.” Und der Grünen-MdB Karl Bär nannte den Vorschlag einen Frontalangriff auf das europäische Modell. Bärs Kritik: “Pflanzen mit bis zu 20 gentechnischen Veränderungen sollen als gleichwertig mit konventionell gezüchteten Pflanzen gelten” und “ungekennzeichnet auf dem Teller” landen. Der Vorschlag würde das Ende der ökologischen Landwirtschaft einläuten, weil diese sich mit immer mehr Aufwand vor Kontamination schützen müsste.
Für diese düstere Vision gibt es reale Gründe. Denn während die NGT-gezüchteten Pflanzen den herkömmlich gezüchteten gleichgestellt werden sollen, wenn es sich um konventionelle Landwirtschaft handelt, sollen sie für Bio-Bauern weiterhin echte Gentechnik und damit verboten bleiben. Nur: Wer soll die Kosten tragen, um nachzuweisen, dass in Bio-Produkten nicht aus Versehen NGT-Pflanzen gelandet sind? Und: Wie soll das technisch möglich sein? Die EU-Kommission schreibt selbst, die Nachweisbarkeit von NGT sei nicht gegeben, da ihr Genom dem natürlicher Pflanzen zu stark ähnele. Laut Entwurf will Brüssel die Lösung dieses Dilemmas den Mitgliedsstaaten überlassen.
Doch die Gegner der Deregulierung haben noch andere Sorgen. Großkonzerne könnten die neue Gentechnik nutzen, um Saatgut über Patente zu kontrollieren und die landwirtschaftlichen Betriebe von diesen Patenten abhängig zu machen, sagte Manuel Wiemann von Foodwatch. Dies führe zu einer höheren genetischen Uniformität – was wiederum einen höheren Pestizideinsatz zur Folge habe, so der Foodwatch-Mann.
Das sieht auch die ehemalige Landwirtschaftsministerin Renate Künast so, heute Sprecherin für Landwirtschaft und Ernährung der Grünen-Fraktion so. “Ich würde es für einen massiven Fehler halten, wenn wir uns bei der Ernährung dieser Welt abhängig machen von einigen, die Patente haben“, erklärt Künast zum Streit um die NGT. 80 Prozent der Landwirte auf der Welt seien Kleinbauern.
Sie vertraue einer anderen wissenschaflichen Expertise als der jener Forscher, die mit Crispr/Cas und Co bereits forschen. Der des Weltagrarrats der Vereinten Nationen, dem Hunderte Wissenschaftler zuarbeiten. Für die Ernährungssouveränität auf der Welt empfiehlt der Weltagrarbericht agrarökologische Wege. Also eine Landwirtschaft, die wenig Input von außen braucht und mit den natürlichen Gegebenheiten vor Ort arbeitet. Mit agrarökologischem Knowhow kann jede Kleinbäuerin ihr eigenes Feld bestellen, ohne Chemikalien gegen Schädlinge oder teures Saatgut aus Genlaboren. Künast: “Wenn wir die Artenvielfalt nicht erhalten, kommen wir in Teufels Küche.”
Widerstand formiert sich freilich auch schon vor Ort in Brüssel. Benoit Biteau, Grünen-Europaabgeordneter und erster stellvertretender Vorsitzender des Landwirtschaftsausschusses des Europäischen Parlaments, sagte gegenüber Table.Media, der Vorschlag der Kommission habe keine Chance. Schließlich hätten eine Reihe von Ländern bereits ihre Ablehnung zum Ausdruck gebracht. “Wir werden im Europäischen Parlament alles in unserer Macht Stehende tun, um diesen Text abzuwehren”, sagte der Franzose. “Der Kampf hat gerade erst begonnen.”
Die Autoindustrie appelliert an die Kommission, die Ursprungsregeln für E-Autos im Brexit-Freihandelsabkommen (TCA) neu zu verhandeln. Sollte die Passage nicht geändert werden, werden ab Januar Zölle von zehn Prozent auf batterieelektrische Autos (BEV) beim Export ins Vereinigte Königreich erhoben. “Die Kommission sollte sich im Einvernehmen mit den Mitgliedstaaten für eine Verlängerung der derzeit geltenden Ursprungsregeln im TCA über den 1. Januar 2024 hinaus stark machen”, sagt Karoline Kampermann vom Verband der Automobilindustrie (VDA).
Hintergrund ist: Laut TCA treten im Januar neue Regeln für Batterien und E-Autos in Kraft. Ab Januar müssen demnach 60 Prozent der Batterien und 45 Prozent der Fahrzeuge aus der Produktion in Europa oder UK stammen, damit weiter Zollfreiheit zwischen Festland und der Insel herrscht. Da der Aufbau von Kapazitäten zur Batterieproduktion in Europa schleppender verläuft als geplant, wird die europäische Industrie nach Schätzungen 2024 allenfalls auf die Hälfte der geforderten Ursprungsanteile kommen.
Derzeit haben die europäischen Hersteller einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Anbietern aus China: Die chinesischen Hersteller müssen die Zölle aktuell bezahlen.
Im TCA, das unter Hochdruck in den letzten Tagen vor Heiligabend 2020 verhandelt wurde, wurde bei den Mindestanteilen für zollfreie E-Autos drei Phasen vereinbart:
Der Europäische Rechnungshof hatte gewarnt, dass der Aufbau von Kapazitäten zum Bau von Batterien hinter den Plänen zurückbleibe. 2022 wurden demnach in der EU nur Kapazitäten für 16 Gigawattstunden installiert, angekündigt waren 66 Gigawattstunden Leistung. Mehrere Hersteller haben ihre Ankündigungen, in Europa neue Fabriken zu bauen, zuletzt zurückgezogen. Angesichts der lukrativen Förderbedingungen in den USA durch den IRA wollen sie nun mit der Investition in die USA gehen.
Laut einer Analyse von Benchmark steigt die bis 2031 zugesagte Kapazität in der Batterieproduktion in den USA seit Ankündigung des IRA massiv an. Während bislang die EU stets vorne lag bei den Ankündigungen für den Bau von Batteriefabriken, liegen jetzt die USA vorne.
Um die Zölle zu verhindern, müsste die britische Seite einer Änderung des TCA zustimmen. Die Regierung des Vereinigten Königreichs hat zu erkennen gegeben, dass sie bei den Ursprungsregelungen gesprächsbereit sei und auch kein Interesse an der Einführung von Zöllen habe.
Die europäischen Hersteller warnen, dass Zölle in Höhe von zehn Prozent E-Autos aus Europa im Wettbewerb mit der Konkurrenz aus China zurückwerfen. Kampermann: “Sie wären auch eine Belastung für Kunden, die sich ein E-Fahrzeug anschaffen möchten. Somit würde nicht zuletzt der weitere Hochlauf der Elektromobilität in Europa empfindlich behindert.”
Gerade für die deutschen Hersteller ist der britische Markt wichtig. Das Vereinigte Königreich liegt beim Export der deutschen Automobilindustrie auf Platz drei nach den USA und China. 2022 exportierten Hersteller und Zulieferer Waren für 19 Milliarden Euro nach Großbritannien. Im Gegenzug wurden Waren im Wert von 4,9 Milliarden Euro importiert.
Die deutschen Marken hatten 2022 einen Marktanteil von 46,7 Prozent bei den Neuzulassungen von Pkw. Beim Export von E-Autos in Länder außerhalb der EU lag Großbritannien 2022 auf Platz eins. Aus deutschen Werken wurden 88.000 E-Autos nach England exportiert, auf Platz zwei lagen die USA, wohin 70.000 E-Fahrzeuge gingen. Der Export nach China rangiert auf Platz 5 mit 18.000 E-Autos.
05.07.-06.07.2023, Brüssel (Belgien)
ForumEurope, Conference The European Space Forum 2023
Against the backdrop of the recently released EU Space Strategy for Security and Defence, this event will bring together key stakeholders to discuss challenges and opportunities for Europe as a strong and resilient leader in the global space market. INFO & REGISTRATION
05.07.2023 – 09:00-10:30 Uhr, Brüssel (Belgien)
FES, Roundtable Montenegro’s EU Integration and the Future of European Enlargement Policy
In light of the Montenegro presidential and parliamentary elections, Friedrich Ebert Foundation (FES) is organising a roundtable discussion on the future of EU enlargement policy. INFO & REGISTRATION
05.07.2023 – 17:00-20:00 Uhr, Berlin
KAS, Konferenz Die Zukunft der Handelsbeziehungen zwischen der EU und Lateinamerika
Im Vorfeld des EU-CELAC Gipfels diskutiert die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) mit dem Präsidialamtsminister von Uruguay, dem Kabinettschef des Vizepräsidenten der EU-Kommission sowie der wirtschaftspolitischen Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion über Möglichkeiten zur Vertiefung der Handelsbeziehungen und politischen Partnerschaft zwischen der EU und Lateinamerika. INFOS & ANMELDUNG
05.07.2023 – 18:30 Uhr, Brüssel (Belgien)/online
EU-Vertretung Baden-Württemberg, Podiumsdiskussion Vernetzen, verstehen, verändern – Strategiedialog Landwirtschaft
In Rahmen dieser Veranstaltung werden die Chancen des Formats Strategiedialog Landwirtschaft als Beispiel zur Umsetzung der Farm to Fork Strategie präsentiert und mit Vertreterinnen und Vertretern aus dem Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission diskutiert. INFOS & ANMELDUNG
05.07.2023 – 19:00-20:30 Uhr, Brüssel (Belgien)
HSS, Podiumsdiskussion Europas innovative Wettbewerbsfähigkeit – Fähigkeitsprofile für disruptive Technologien
Die Hanns-Seidel-Stiftung (HSS) veranstaltet einen Innovationsgipfel, um anhand von Expertendiskussionen die für Europas Zukunft entscheidenden Fähigkeiten und Rahmenbedingungen für ein Kompetenzportfolio-Management im Hinblick auf disruptive Technologien als entscheidende Standortfaktoren zu ermitteln. ANMELDUNG
06.07.-07.07.2023, Genf (Schweiz)
ITU, Conference AI for Good: Global Summit 2023
The summit organised by the International Telecommunication Union (ITU) provides an action-oriented United Nations platform promoting AI to advance health, climate, gender, inclusive prosperity, sustainable infrastructure, and other global development priorities. INFO & REGISTRATION
06.07.-07.07.2023, online
EUI, Conference Climate, Energy and Environmental Justices and Transitions: Rethinking Global Environmental law
The European University Institute (EUI) conference focuses on the varieties of legal responses to global environmental problems and their impact on justice, hosting several legal and economics scholars to present their papers. INFO & REGISTRATION
06.07.2023 – 12:24-13:00 Uhr, online
EAB, Vortrag Europa und China
Der Direktor der Europäische Akademie Berlin (EAB) spricht mit Dr. Mikko Huotari, Direktor des Mercator Institute for China Studies, über die Perspektive der bilateralen Beziehungen zwischen der EU und China. INFOS
06.07.2023 – 12:30-13:30 Uhr, Berlin
Tagesspiegel, Diskussion Vertrauenswürdige KI – Wie viel Regulierung braucht es wirklich?
Expertinnen und Experten aus Politik und Wissenschaft diskutieren über die Zukunft und Regulierung von künstlicher Intelligenz, unter anderem mit dem Europaabgeordneten Sergey Lagodinsky und dem Staatssekretär im Bundesministerium für Digitales und Verkehr. INFOS & ANMELDUNG
06.07.2023 – 13:00-16:30 Uhr, Brüssel (Belgien)
FEAD, Workshop How to make the circular economy work? A new alliance between the waste management and manufacturing industries
The European Waste Management Association (FEAD) is bringing together experts, policymakers, and industry leaders to explore how the EU institutions can enhance Member States’ performance in achieving circular economy targets, with a focus on the potential role of a new alliance between the waste management and manufacturing industries. INFO & REGISTRATION
06.07.2023 – 15:00-18:00 Uhr, Brüssel (Belgien)
Eurogas, Conference European Renewable Gas: Evolution or Revolution?
The conference will address the challenges in scaling up renewable hydrogen and biomethane to deliver the climate objectives; it features a welcome speech by the Eurogas president, a keynote speech by the European Commissioner for Energy and discussion panels. INFO & REGISTRATION
06.07.2023 – 18:00-19:00 Uhr, online
KAS, Diskussion Steht Spanien vor einem Regierungswechsel? Die Bedeutung der Parlamentswahlen für Spanien und Europa
Die Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) befasst sich mit den anstehenden Parlamentswahlen in Spanien und den Auswirkungen eines möglichen Regierungswechsels. INFOS & ANMELDUNG
Die EU kommt bei der Umstellung auf eine Kreislaufwirtschaft kaum voran. Zu diesem Urteil kommt ein gestern veröffentlichter Sonderbericht des Europäischen Rechnungshofs. Die zwei Aktionspläne der EU-Kommission und bereitgestellte Mittel in Höhe von zehn Milliarden Euro hätten die Umstellung in den Mitgliedstaaten nur wenig vorangebracht. Insbesondere mangele es an einer kreislauforientierten Gestaltung von Produkten und Herstellungsverfahren, heißt es in dem Bericht. Das EU-Ziel, in diesem Jahrzehnt doppelt so viele Materialien zu recyceln wie im vorigen Jahrzehnt, scheine außer Reichweite, erklärten die Prüfer.
Die Zirkularitätsrate, also der Anteil recycelter und wieder in die Wirtschaft zurückgeführter Materialien, sei zwischen 2015 und 2021 in allen Mitgliedstaaten um durchschnittlich nur 0,4 Prozentpunkte gestiegen. In sieben Ländern (Litauen, Schweden, Rumänien, Dänemark, Luxemburg, Finnland und Polen) sei die Rate in diesem Zeitraum sogar gesunken.
Die EU habe zwar zwischen 2016 und 2020 mehr als zehn Milliarden Euro für ökologische Innovationen und die Unterstützung der Unternehmen beim Umstieg auf die Kreislaufwirtschaft bereitgestellt. Die Mitgliedstaaten hätten jedoch den Großteil dieses Geldes für die Abfallbewirtschaftung ausgegeben, anstatt in kreislauforientiertes Design zu investieren und so die Entstehung von Müll zu vermeiden.
“Materialien zu erhalten und möglichst wenig Abfall zu erzeugen, ist unerlässlich, wenn die EU ressourceneffizient werden und die Umweltziele ihres Grünen Deals erreichen will,” erklärte Annemie Turtelboom, Mitglied des Rechnungshofs. “Doch hat die EU-Politik bisher ihr Ziel verfehlt, da der Übergang zur Kreislaufwirtschaft in den europäischen Ländern leider kaum noch vorankommt.”
Die Kommission hat bislang zwei Aktionspläne entwickelt, um die Umstellung voranzubringen: Der erste Plan von 2015 enthielt 54 konkrete Maßnahmen. Mit dem zweiten Plan aus dem Jahr 2020 kamen 35 neue Maßnahmen hinzu, und es wurde das Ziel festgelegt, die Zirkularitätsrate bis 2030 zu verdoppeln. Die beiden Pläne waren nicht verbindlich, sollten den Mitgliedsstaaten aber dabei helfen, verstärkt Maßnahmen zur Förderung der Kreislaufwirtschaft zu ergreifen. Im Juni 2022 verfügten laut dem Sonderbericht fast alle EU-Länder über eine nationale Strategie für die Kreislaufwirtschaft oder waren dabei, eine solche Strategie zu entwickeln.
Auch die Maßnahmen aus den Aktionsplänen, mit denen Innovationen und Investitionen ermöglicht werden sollten, haben laut Rechnungshof kaum wirksam zu einer Kreislaufwirtschaft beigetragen. Sie hätten allenfalls in geringfügigem Umfang dazu geführt, dass Unternehmen sicherere Produkte herstellen oder Zugang zu innovativen Technologien bekommen, um ihre Herstellungsverfahren nachhaltiger zu gestalten.
Die Prüfer heben in ihrer Analyse auch das Problem des geplanten Verschleißes (geplante Obsoleszenz) hervor, einer Praxis, durch die die Nutzungsdauer eines Produkts künstlich begrenzt wird, damit es ersetzt werden muss. Die Kommission sei zu dem Schluss gekommen, dass es nicht möglich sei, geplanten Verschleiß aufzudecken. Die Nachhaltigkeit von Produkten würde sich jedoch eindeutig verbessern, wenn sich diese Praxis unterbinden ließe. leo
Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sieht eine entschlossene Umsetzung der eigenen Politik als beste Antwort auf das Erstarken von Extremisten in der EU. Die Parteien der demokratischen Mitte müssten “zeigen, dass wir eine klare Vorstellung davon haben, wie wir den sich vollziehenden Wandel angehen wollen”, sagte sie. Es gehe darum, Herausforderungen wie den Ukraine-Krieg oder den Klimawandel entschlossen anzugehen und zugleich damit verbundene Chancen zu ergreifen.
Die CDU-Politikerin äußerte sich in Madrid bei der Auftaktveranstaltung der spanischen Ratspräsidentschaft. Spanien hat zum 1. Juli den rotierenden Vorsitz im Rat der EU übernommen. In dem Land wird am 23. Juli ein neues Parlament gewählt. Umfragen lassen ein starkes Abschneiden der rechtsnationalen Vox-Partei erwarten. In anderen EU-Ländern hatten Rechtsaußen-Parteien zuletzt bei Wahlen zugelegt. In Deutschland erreicht die AfD neue Umfragehöhen. Das hat auch in der CDU/CSU eine intensive Debatte um den Umgang mit der Partei ausgelöst.
Der spanische Regierungschef Pedro Sánchez wies Befürchtungen zurück, die Ratspräsidentschaft seines Landes könne durch die vorgezogene Parlamentswahl Schaden nehmen. Es sei nicht das erste Mal, dass während einer Ratspräsidentschaft gewählt werde, sagte der Sozialist. Angesichts der Erfahrung seines Landes werde “absolute Normalität” während des Ratsvorsitzes herrschen.
Auch von der Leyen zeigte sich zuversichtlich. “Ich setze darauf, dass die spanische Regierung und die Institutionen in der Lage sein werden, eine effiziente Präsidentschaft auszuüben – wie auch immer die Wahlen ausgehen”.
Die Regierung in Madrid hat in ihrem Programm für die kommenden sechs Monate die Wettbewerbsfähigkeit der EU und die Wirtschaftsbeziehungen zu den lateinamerikanischen Ländern zu ihren Top-Prioritäten erhoben. Am 17. und 18. Juli findet in Brüssel der erste Gipfel der EU-Staaten mit der Gemeinschaft der Lateinamerikanischen und karibischen Staaten (CELAC) seit acht Jahren statt. Ziel sei es unter anderem, bis Jahresende das Handelsabkommen mit den Mercosur-Staaten abzuschließen, sagte von der Leyen. tho
Die EU erwägt laut “Financial Times” Zugeständnisse an Russland, um die Verlängerung des Getreide-Abkommens zu erreichen. Demnach könnte der mit Sanktionen belegten staatlichen Landwirtschaftsbank (Rosselchosbank) erlaubt werden, eine neue Tochtergesellschaft zu gründen und sich über diese wieder an das weltweite Finanzsystem anzuschließen. Russland hatte die Wiederaufnahme der Bank in das internationale Zahlungssystem Swift als eine seiner Bedingungen für eine erneute Verlängerung des Deals zur Ausfuhr von ukrainischem Getreide genannt.
Die EU-Kommission lehnte eine Stellungnahme zu dem Bericht ab. Die Regierung in Moskau äußerte sich nicht direkt zu dem Bericht, sieht aber nach eigenen Angaben keinen Grund für eine Verlängerung des Abkommens. Schließlich habe es keine Fortschritte bei der Erfüllung jener Vereinbarungen des Abkommens gegeben, die sich auf russische Exporte beziehen. Nach Ansicht der Regierung in Moskau werden die russischen Lebensmittel- und Düngemittelausfuhren durch Hindernisse etwa bei Versicherungen und eben der Zahlungsabwicklung beeinträchtigt.
Das Abkommen soll trotz des Krieges den Export von Getreide und Düngemitteln aus der Ukraine über das Schwarze Meer ermöglichen. Es wurde erstmals im Juli 2022 von Russland und der Ukraine unter Vermittlung der Türkei und den UN vereinbart und seitdem dreimal verlängert. Es läuft noch im Juli aus. Der nun von der Regierung in Moskau vorgelegte Vorschlag wurde laut FT bei Gesprächen ins Spiel gebracht, die von den UN vermittelt wurden. Demnach soll die staatliche Agrarbank nach einer Wiedereingliederung in Swift Zahlungen im Zusammenhang mit Getreideexporten abwickeln. Im Zuge westlicher Sanktionen wegen des Ukraine-Kriegs waren große russische Banken von dem Swift-System abgekoppelt worden. rtr
Den EU-Wettbewerbshütern reichen offenbar die Zugeständnisse von Microsoft im Streit um die Bürosoftware Office nicht aus. Die EU werde eine förmliche Wettbewerbsuntersuchung einleiten, nachdem Gespräche zur Abwendung eines solchen Schrittes keine Lösung gebracht hätten. Das sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.
Mit Zugeständnissen wollte der US-Konzern Wettbewerbsbedenken wegen seines Kommunikationsprogramms Teams zerstreuen. Die EU ist auf eine Beschwerde des US-Konzerns Salesforce hin tätig geworden, der mit Slack einen Wettbewerber von Teams anbietet.
Microsoft hat angeboten, den Preis seines Office-Produkts ohne die Teams-App zu senken. Die Europäische Kommission habe eine stärkere Preissenkung gefordert, heißt es in Brüssel. Die Kommission lehnte eine Stellungnahme ab. Microsoft erklärte, weiterhin kooperativ mit der Kommission zusammenzuarbeiten. Der Konzern sei offen für pragmatische Lösungen, die den Bedenken der Wettbewerbshüter Rechnung trügen. rtr

Alexander Schuster muss derzeit viele Fragen beantworten: “Viele unsere europäischen Partner können sich keinen Reim auf die deutsche Zeitenwende machen”, sagt der sicherheitspolitische Experte der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS). Da bestehe viel Erklärungsbedarf, auch unter Fachleuten in anderen Ländern, denn bislang sei wenig zu sehen.
Aus seiner Sicht müsste neben dem Sondervermögen von 100 Milliarden Euro auch der Wehretat auf mindestens zwei Prozent des BIP steigen, sagt Schuster. Sonst stünde der Bundeswehr weniger Geld zur Verfügung, weil der Unterhalt der neuen Ausrüstung – unter anderem die F-35 – steigen und den Haushalt weiter belasten werde.
Schusters Arbeit bei der CDU-nahen politischen Stiftung besteht aus der Analyse und Erklärung von europäischer Sicherheitspolitik. Dafür pflegt er ein grenzüberschreitendes Netzwerk, in Frankreich arbeitet die KAS etwa mit der Fondation pour la recherche stratégique (FRS) zusammen, einem Thinktank, der dem Verteidigungsministerium nahesteht.
Auf europäischer Ebene lobt der Sicherheitsexperte unter anderem den Strategischen Kompass und die Europäische Friedensfazilität. Trotzdem müsse Europa handlungsfähiger werden: Die Landes- und Bündnisverteidigung im Rahmen der NATO müsse gesichert werden – bisher sei das nur dank der Unterstützung der USA möglich.
Dafür bräuchte die EU unter anderem einen eigenen Sicherheitsrat, argumentiert Schuster. “Das wäre ein tolles und wirkungsvolles Instrument, wenn der Europäischer Sicherheitsrat ein permanentes Gremium mit operativen Befugnissen wäre.” Damit ließen sich der europäische Pfeiler in der NATO stärken und die Briten in die europäische Sicherheitsarchitektur einbinden.
Seine Ideen schreibt Schuster in Policy Paper, die auch auf der KAS-Webseite veröffentlicht werden. Wichtige Zielgruppe sind unter anderem die Abgeordneten des Bundestags. “Der Austausch mit der Unionsfraktion ist gut.”
Aufgewachsen ist der heute 36-Jährige in Landshut. Europa sei ihm früh präsent gewesen, erzählt Schuster. Die Familie seines Vaters ist in den 1970er-Jahren aus Siebenbürgen vor dem kommunistischem System geflohen. Er studierte Politikwissenschaft und Geschichte in Regensburg. Den Master absolvierte er in drei Semestern, arbeitete als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Professor Stephan Bierling. Bierling ist auch Vertrauensdozent bei der KAS.
So fügte sich, was zusammengehört. “Die Adenauer-Stiftung hat mir eine weltanschauliche Heimat geboten”, erzählt Schuster. “Für mich war der Weg zur KAS alternativlos.” Er ist in der Endphase der Dissertation. Für seine Promotion bekam er ein Stipendium bei der Stiftung. Seit Oktober vergangenen Jahres arbeitet er auch für die Adenauer-Stiftung. Tom Schmidtgen
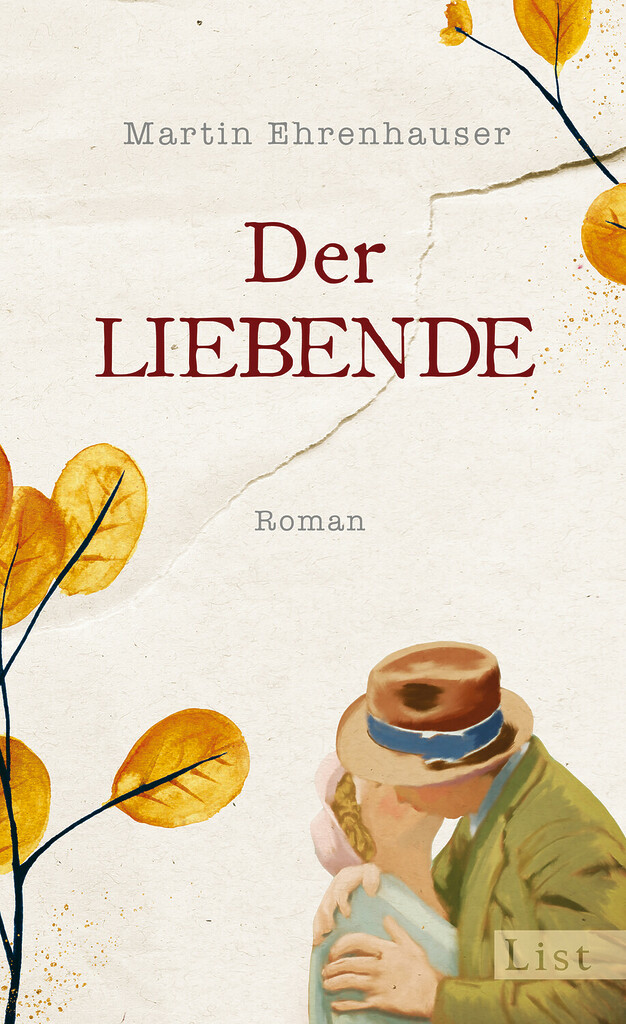
Warum schreiben Politiker Bücher? Das fragen sich Journalisten jedes Mal, wenn ein ehemaliger oder aktueller Minister oder Abgeordneter ein Buch schreibt. Oder in den meisten Fällen: schreiben lässt. Gerhard Schröder, Annalena Baerbock, Heiko Maas, Sigmar Gabriel, sie alle haben es vorgemacht.
Seltener sind Politiker, die ihre Bücher selbst schreiben – und dann auch noch Romane. Bestes Beispiel: Die Erotikromane des Bruno Le Maire oder die Thriller des Thierry Breton.
Nun gesellt sich ein ehemaliger österreichischer EU-Parlamentarier dazu: Martin Ehrenhauser war von 2009 bis 2014 fraktionsloser Abgeordneter in Brüssel und setzte sich für “Demokratie, Kontrolle und Gerechtigkeit” ein. Dabei hat Ehrenhauser, Geburtsjahr 1978, gerne polarisiert: 2017 etwa campte er vor und im Wiener Ballhaus, um gegen die Bankenrettung auf Kosten der staatlichen Sozialausgaben zu protestieren.
Nun aber hat Martin Ehrenhauser einen Roman geschrieben. Und zwar einen Liebesroman, der hauptsächlich in Brüssel spielt und ein bisschen auch in Knokke. So politisch wie des Ehrenhausers Karriere bisher war, so apolitisch ist der Roman.
“Der Liebende” (List Verlag), vermarktet als “Brüsseler Roman”, erzählt die Geschichte eines etwas einsamen österreichischen Priesters, Monsieur Haslinger, der nun in Rente ist. Er pflegt seine Balkonpflanzen, liest, spaziert und steht deutschsprachigen Patienten bei. Und er verliebt sich nach und nach in seine neue Nachbarin, eine ehemalige Diplomatin, intelligent und kokett – und, wie man später erfährt, sterbenskrank.
Der Roman spielt zwar in Brüssel, aber nicht in meinem Brüssel. Das Brüssel des Martin Ehrenhauser ist sauber und gepflegt, ja es erinnert viel eher an das London aus dem Film “Notting Hill” (mit Hugh Grant und Julia Roberts). Kein Müll, kein Straßenlärm, keine Armut. Gepflegte Balkone, achtsame Nachbarn, im Biomüll findet man statt ekligen Fleischresten kranke Pflänzchen, die der Priester wieder aufpäppelt.
Dieses Brüssel erstreckt sich hauptsächlich von Ixelles via Chatelain bis Saint Gilles (aber nur die schönen Straßen). In Knokke, dem Ferienort für wohlhabende Belgier und halb Luxemburg, sind die Strände leer und romantisch. Ja, nicht einmal das verbaute EU-Viertel kommt im Roman vor. Alle Menschen gehen respektvoll miteinander um, Nachbarn entschuldigen sich, wenn sie zu laut feiern und sogar Exil-Österreicher sprechen flämisch und französisch. Auch auf dem Chatelainer Markt geht es irgendwie ruhiger und idyllischer zu als im echten Ixelles
Der Liebende ist kein literarisches Meisterwerk. Es ist ein nettes, etwas kitschiges Büchlein, das sich gut liest. In meinem Fall hat ein luftverschmutztes, heißes Wochenende gereicht (die Luft des fiktiven Brüssel ist übrigens sauber und duftet nach Blumen). Im EU-freien August am Strand ist es sicherlich ein guter Begleiter, falls einen die Nostalgie nach einem idealisierten, entschleunigten Brüssel ohne EU-Kram und soziale Brennpunkte umtreibt. Vielleicht verkürzt es auch das Warten auf die nächste Merkel-Biografie oder Jean-Claude Junckers Skandal-Memoiren. Charlotte Wirth
mehr Transparenz auf EU-Ebene, das hatte sich die Bundesregierung eigentlich in den Koalitionsvertrag geschrieben. Doch bei zwei aktuellen Beispielen gibt sich Berlin geheimniskrämerisch. Table.Media wollte wissen, wie weit die Bundesregierung den Beihilferahmen TCTF gerne lockern würde, also die finanzielle Unterfütterung des Net-Zero Industry Acts. Doch nach unserem Auskunftsantrag an die Kommission Mitte Februar schickte die Generaldirektion Wettbewerb gestern eine offizielle Ablehnung: Die Bundesregierung habe den Zugang zu dem Dokument verweigert!
“Im vorliegenden Fall waren die deutschen Behörden der Ansicht, dass die deutsche Stellungnahme zum TCF sensible Informationen darstellt, da sie sich auf Krisenmaßnahmen bezieht und Informationen über eine schwerwiegende Störung des deutschen Wirtschaftsgeschehens enthält”, schreibt die DG Comp. Dass Table.Media die deutsche Position dann Anfang März veröffentlicht hatte – geschenkt!
Die kurios späte Antwort der Kommission offenbart die fragwürdigen Argumente deutscher Beamter. Denn die Antwort Berlins enthielt keine sensiblen Informationen über die deutsche Wirtschaft. Vielmehr setzte sich die Bundesregierung unter anderem dafür ein, dass die großzügigsten Fördermöglichkeiten auch für nicht ganz so strukturschwache Regionen in Deutschland gelten sollten.
Einen Schritt rückwärts macht die Bundesregierung zudem mit dem jahrelang gepflegten Verzeichnis deutscher Interessenvertretungen in Brüssel. “Die bisher an dieser Stelle eingepflegte Liste wird in Zukunft nicht mehr aktualisiert und wurde von der Webseite entfernt”, steht inzwischen auf der Seite der Ständigen Vertretung.
Doch war die Liste nicht ohnehin überflüssig geworden seit der Einführung des EU-Transparenzregisters? Immerhin hatten Lobbywächter mit der deutschen Liste einen groben Eindruck, welche Verbände und Unternehmen Kontakte in die StäV halten – und zwar nicht nur zu den EU-Botschaftern, deren Treffen mit Lobbyisten weiterhin ausgewiesen werden. Kontakte zu einfachen StäV-Mitarbeitern und Ministerialbeamten in Berlin hatte aber auch das alte Verzeichnis nicht im Einzelnen ausgewiesen. Das wäre doch mal ein Beitrag zu mehr Transparenz in der deutschen EU-Politik!
Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre.

Die EU-Gesetze enthalten erhebliche Lücken und gehen nicht auf alle Ursachen der Bodendegradation ein. Das schreibt die Kommission in ihrem Vorschlag für eine neue Richtlinie zur Bodengesundheit in Europa. Ein Entwurf liegt Table.Media vor. 60 bis 70 Prozent der Böden in der EU seien in einem schlechten Gesundheitszustand, heißt es darin – mit negativen Auswirkungen für Menschen, Umwelt, Klima und Wirtschaft. Zudem steige das Risiko für katastrophale Folgen des Klimawandels wie Überschwemmungen und Waldbrände.
Auf dieser wissenschaftlichen Bestandsaufnahme aufbauend begründet die Kommission ihr neues Gesetz und beruft sich auf eine Untersuchung der Generaldirektion Forschung und Innovation von 2020. Darin enthalten sind auch Empfehlungen für Grenzwerte und Ziele zur Kohlenstoffkonzentration, Bodenversiegelung, Bodenrecycling und Bodenverschmutzung, damit 75 Prozent der europäischen Böden bis 2030 gesund sind.
Es wirkt daher widersprüchlich, dass die Kommission in ihrem Richtlinienvorschlag eben keine Ziele und Grenzwerte vorschlägt. Stattdessen konzentriert sich der Text auf Vorgaben zu Datenerhebung und Monitoring der Bodengesundheit. So sollen Mitgliedstaaten verpflichtet werden, unter anderem Daten zu erheben über folgende Parameter der Böden:
Zudem gibt die Kommission Methoden und Probengrößen vor und will die Mitgliedstaaten verpflichten, die Daten öffentlich zugänglich zu machen.
Zwar sind im Anhang des Vorschlags teils auch Grenzwerte für die einzelnen Parameter hinterlegt, ab welchem Wert ein Boden als “gesund” einzustufen ist. Auch sind Mitgliedstaaten dazu angehalten, Maßnahmen zur Verbesserung der Bodengesundheit zu identifizieren. Doch es gibt in der Richtlinie keine Formulierung mit der Pflicht, diese Grenzwerte einzuhalten und Maßnahmen umzusetzen. Dabei schreibt die Kommission selbst, dass gesunde Böden sich sehr langsam bilden und ihre Gesundheit erhalten oder verbessert werden könne, “wenn geeignete Maßnahmen ergriffen und umgesetzt werden”.
Es ist kein Geheimnis, dass die Kommission ursprünglich geplant hatte, ambitionierte Ziele und Maßnahmen von den Ländern einzufordern. Doch der politische Druck war zu groß. Insbesondere die europäischen Christdemokraten (EVP), aber auch Teile der liberalen Renew-Fraktion wehren sich gegen strengere Regeln, die auch Auswirkungen auf die Landwirte und die Lebensmittelproduktion haben könnten. Das betrifft vorrangig die Naturschutzgesetze des Green Deals, aber auch eine Richtlinie zu Industrieemissionen. Beim Streit um das Renaturierungsgesetz zeigt sich dieser Konflikt bisher am deutlichsten. Ein ambitioniertes Bodengesundheitsgesetz hätte den Streit weiter angefacht und wahrscheinlich eine weitere Blockade der EVP nach sich gezogen.
Nun ärgern sich jedoch Umweltschützer über das Einlenken der Kommission. Sie fordern seit Jahren strengere Regeln, da sie der Auffassung sind, Landwirte sowie die Biodiversität durch bessere Bodengesundheit zu schützen. Es sei ein “weiterer Schlag für den europäischen Green Deal“, wenn die Kommission ihre Bodenschutzvorschriften aufweicht, sagte Ariel Brunner, Regionaldirektor Europa bei der NGO Birdlife, zu Table.Media. Es sei tragisch, “wie die Agrarlobby die Bemühungen sabotiert, die Landwirtschaft zu schützen.”
Bernhard Krüsken, Generalsekretär des Deutschen Bauernverbands, sagt, dass bereits eine Vielzahl von Richtlinien, Verordnungen, Strategien und Regelwerken direkt und indirekt den Schutz der Böden sicherstellen. Beim Bodenschutz fange man daher nicht bei null an, verteidigt er den Ansatz der Kommission, keine verbindlichen Grenzwerte festzulegen. Strengere Regeln fordert Krüsken jedoch für “das wohl größte Umweltproblem in Sachen Bodenschutz”: den Flächenverbrauch durch Versiegelung und Überbauung durch Siedlungs- und Verkehrsmaßnahmen. Denn auch hier macht die Kommission lediglich Vorgaben zur Überwachung des Status quo.
Benoit Biteau (Grüne), stellvertretender Vorsitzender des Landwirtschaftsausschusses im EU-Parlament, kritisiert, dass der “Überwachungsrahmen” der Kommission Daten liefere, die man bereits habe. Man wisse bereits: “Zwei Drittel der Böden in Europa sind nicht gesund!” Er kündigt an, dass die Grünen im Parlament den Vorschlag der Kommission verschärfen wollen.
Auch das europäische Umweltbüro (EEB) fordert ein deutlich höheres Ambitionsniveau. “Um bis 2050 gesunde Böden zu erreichen, müssen rechtsverbindliche Ziele, verbindliche Pläne, eine umfassende Überwachung der Indikatoren für die biologische Vielfalt der Böden und die Anwendung des Verursacherprinzips eingeführt werden”, fordert Caroline Heinzel, Referentin für Bodenpolitik des EEB. Ein ehrgeiziges Bodengesundheitsgesetz sei die einzige Möglichkeit, die Verschlechterung der Böden umzukehren und sie zu schützen.
Eine Analyse, der auch die Kommission nicht widerspricht. Doch traut sie sich offensichtlich nicht zu, für die nötigen Maßnahmen ausreichende politische Unterstützung zu mobilisieren. Mit Claire Stam
In den riesigen Silos am Rhein des Raiffeisen-Kraftfutterwerks Kehl lagert konventionell und ökologisch erzeugtes Getreide; in jedem Fall aber ist es frei von Gentechnik. Das Unternehmen besteht seit 1963 und setzt mit Nutz- und Heimtierfutter 65 Millionen Euro im Jahr um. Gegen die grüne Gentechnik hat sich Firmenleiter Bernhard Stoll schon 1998 strikt entschieden, aus Überzeugung, wie er sagt. Der Erfolg seiner Entscheidung gibt Stoll recht. Schweinezüchter und Milchviehhalter kaufen sein Futter statt Gen-Soja oder Gen-Mais aus Übersee – und können so der Kundschaft gentechnikfreie Milch, Käse oder Fleisch garantieren.
Am Donnerstag war Stoll in Berlin, bei der Jahresversammlung des Verbands Lebensmittel ohne Gentechnik. Bei den Mitgliedern herrscht Aufruhr, seit geleakte Pläne der EU-Kommission für eine Deregulierung des strengen Gentechnikrechts die Runde machen – samt Lockerung der Kennzeichnungspflicht. “Ich betrachte das als Entmündigung des Verbrauchers”, sagt Bernhard Stoll. Und als Angriff auf sein Geschäftsmodell: “Brüssel schickt sich an, nachhaltige Unternehmenswerte zu vernichten.”
16 Milliarden Euro im Jahr setzen Produkte mit dem Label “Ohne Gentechnik” um. Die Angst der Anbieter: Wenn die Deregulierung kommt, könnten bald überall in Europa Pflanzen aus dem Genlabor wachsen. Denn die bisher bekannten EU-Pläne überlassen das Schwierigste den Mitgliedstaaten: zu verhindern, dass Neuzüchtungen sich unkontrolliert auskreuzen können. Oder dass eine Vermischung stattfindet, weil dieselben Maschinen gentechnisch verändertes und gentechnikfreies Saatgut ausbringen.
“Es gibt so viele Risiken einer Verschleppung”, warnt Futterhändler Stoll. “Wenn das kommt, brauchen wir ein engmaschiges Monitoring.” Mindestens aber müsse die Kommission von jedem gentechnisch veränderten Saatgut Referenzmaterial verlangen – damit Betroffene und Behörden im Zweifel Proben ziehen und rückverfolgen können, was da wächst.
Doch Möglichkeiten zur Rückverfolgbarkeit der Gen-Saat sieht der bisherige Entwurf nicht vor. Die EU-Kommission strebt offenbar eine 180-Grad-Wende in Sachen Gentechnik an. Pflanzen, die mit den “neuen genomischen Techniken” (NGT), also etwa der Genschere Crispr/Cas, gezüchtet wurden und in die dabei kein artfremdes Genmaterial eingebaut wurde, sollen demnach nicht mehr der strengen Risikobewertung für gentechnisch veränderte Organismen (GVO) unterliegen. Für Produkte, die NGT enthalten, soll darüber hinaus die Kennzeichnungspflicht wegfallen.
Für viele Pflanzenzüchter ist das eine frohe Kunde. Seit der Europäische Gerichtshof 2018 geurteilt hat, dass auch mit den neuen NGT-Präzisionstechniken genveränderte Organismen entstünden und diese deshalb dieselben Hürden passieren müssten wie die alten GVO, lobbyieren Züchter und Forscher massiv für eine Deregulierung – unterstützt von Politikern aus FDP und Union.
Die EU-Kommission hat sich wissenschaftliche Expertise für ihre Pläne eingeholt: Die Europäische Lebensmittelbehörde (EFSA) kam bei der Prüfung der NGT-Pflanzenzüchtungen zum Ergebnis, dass von diesen praktisch keine Gefahr ausgehe. Die NGT haben laut EFSA sogar ein deutlich reduziertes Potenzial, “unbeabsichtigte Effekte” hervorzurufen – nicht nur gegenüber den alten gentechnischen Verfahren, sondern sogar gegenüber herkömmlicher Züchtung. Denn auch bei dieser können durch den Einsatz von Radioaktivität oder Chemie unbeabsichtigte Mutationen entstehen.
Das sieht nicht jede Behörde in Europa so. Das Bundesamt für Naturschutz (BfN) hält die Aussage für falsch, dass mit NGT-Pflanzen generell weniger Risiken einhergehen. Auch die Anwendung von NGT könne zu unbeabsichtigten genomischen Veränderungen führen, schreibt das BfN. Das Einfügen neuer Eigenschaften in eine Pflanze berge immer das Risiko negativer Auswirkungen auf Ökosysteme und die biologische Vielfalt. “Sollte es beispielsweise gelingen, eine trockenresistente Feldfrucht zu entwickeln, so könnte diese invasiv werden, weil sie auf einmal Habitate besiedeln könnte, in denen sie vorher nicht überleben konnte”, warnt Deutschlands oberste Naturschutzbehörde. Ein schwerwiegendes Gegenargument, zumal die EU-Kommission ihre Pläne ausdrücklich mit den Zielen begründet, mit den NGT zu mehr Biodiversität und Klimaresilienz auf den Feldern beizutragen.
Die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch hat schon jetzt, noch vor der offiziellen Version der EU-Pläne am Mittwoch, mehr als 62.000 Unterschriften unter ihrer Petition “Gentechnik muss erkennbar bleiben” gesammelt. Am Donnerstag haben Aktivisten diese dem Bundeslandwirtschaftsministerium übergeben. Die Beschneidung der Wahlfreiheit des Verbrauchers durch die Lockerung der Kennzeichnungspflicht ist freilich nicht nur aus Sicht von Foodwatch ein No-Go. Auch Politiker von SPD und Grünen teilen diese Sicht.
“Ohne Kennzeichnung ist eine Rückverfolgbarkeit unmöglich, und das wäre ein Verstoß gegen das Vorsorgeprinzip. Ohne Kennzeichnung gibt es keine Transparenz”, sagte Matthias Miersch, Vizevorsitzender der SPD-Fraktion, nach Bekanntwerden des Leaks. “Das macht die SPD nicht mit.” Und der Grünen-MdB Karl Bär nannte den Vorschlag einen Frontalangriff auf das europäische Modell. Bärs Kritik: “Pflanzen mit bis zu 20 gentechnischen Veränderungen sollen als gleichwertig mit konventionell gezüchteten Pflanzen gelten” und “ungekennzeichnet auf dem Teller” landen. Der Vorschlag würde das Ende der ökologischen Landwirtschaft einläuten, weil diese sich mit immer mehr Aufwand vor Kontamination schützen müsste.
Für diese düstere Vision gibt es reale Gründe. Denn während die NGT-gezüchteten Pflanzen den herkömmlich gezüchteten gleichgestellt werden sollen, wenn es sich um konventionelle Landwirtschaft handelt, sollen sie für Bio-Bauern weiterhin echte Gentechnik und damit verboten bleiben. Nur: Wer soll die Kosten tragen, um nachzuweisen, dass in Bio-Produkten nicht aus Versehen NGT-Pflanzen gelandet sind? Und: Wie soll das technisch möglich sein? Die EU-Kommission schreibt selbst, die Nachweisbarkeit von NGT sei nicht gegeben, da ihr Genom dem natürlicher Pflanzen zu stark ähnele. Laut Entwurf will Brüssel die Lösung dieses Dilemmas den Mitgliedsstaaten überlassen.
Doch die Gegner der Deregulierung haben noch andere Sorgen. Großkonzerne könnten die neue Gentechnik nutzen, um Saatgut über Patente zu kontrollieren und die landwirtschaftlichen Betriebe von diesen Patenten abhängig zu machen, sagte Manuel Wiemann von Foodwatch. Dies führe zu einer höheren genetischen Uniformität – was wiederum einen höheren Pestizideinsatz zur Folge habe, so der Foodwatch-Mann.
Das sieht auch die ehemalige Landwirtschaftsministerin Renate Künast so, heute Sprecherin für Landwirtschaft und Ernährung der Grünen-Fraktion so. “Ich würde es für einen massiven Fehler halten, wenn wir uns bei der Ernährung dieser Welt abhängig machen von einigen, die Patente haben“, erklärt Künast zum Streit um die NGT. 80 Prozent der Landwirte auf der Welt seien Kleinbauern.
Sie vertraue einer anderen wissenschaflichen Expertise als der jener Forscher, die mit Crispr/Cas und Co bereits forschen. Der des Weltagrarrats der Vereinten Nationen, dem Hunderte Wissenschaftler zuarbeiten. Für die Ernährungssouveränität auf der Welt empfiehlt der Weltagrarbericht agrarökologische Wege. Also eine Landwirtschaft, die wenig Input von außen braucht und mit den natürlichen Gegebenheiten vor Ort arbeitet. Mit agrarökologischem Knowhow kann jede Kleinbäuerin ihr eigenes Feld bestellen, ohne Chemikalien gegen Schädlinge oder teures Saatgut aus Genlaboren. Künast: “Wenn wir die Artenvielfalt nicht erhalten, kommen wir in Teufels Küche.”
Widerstand formiert sich freilich auch schon vor Ort in Brüssel. Benoit Biteau, Grünen-Europaabgeordneter und erster stellvertretender Vorsitzender des Landwirtschaftsausschusses des Europäischen Parlaments, sagte gegenüber Table.Media, der Vorschlag der Kommission habe keine Chance. Schließlich hätten eine Reihe von Ländern bereits ihre Ablehnung zum Ausdruck gebracht. “Wir werden im Europäischen Parlament alles in unserer Macht Stehende tun, um diesen Text abzuwehren”, sagte der Franzose. “Der Kampf hat gerade erst begonnen.”
Die Autoindustrie appelliert an die Kommission, die Ursprungsregeln für E-Autos im Brexit-Freihandelsabkommen (TCA) neu zu verhandeln. Sollte die Passage nicht geändert werden, werden ab Januar Zölle von zehn Prozent auf batterieelektrische Autos (BEV) beim Export ins Vereinigte Königreich erhoben. “Die Kommission sollte sich im Einvernehmen mit den Mitgliedstaaten für eine Verlängerung der derzeit geltenden Ursprungsregeln im TCA über den 1. Januar 2024 hinaus stark machen”, sagt Karoline Kampermann vom Verband der Automobilindustrie (VDA).
Hintergrund ist: Laut TCA treten im Januar neue Regeln für Batterien und E-Autos in Kraft. Ab Januar müssen demnach 60 Prozent der Batterien und 45 Prozent der Fahrzeuge aus der Produktion in Europa oder UK stammen, damit weiter Zollfreiheit zwischen Festland und der Insel herrscht. Da der Aufbau von Kapazitäten zur Batterieproduktion in Europa schleppender verläuft als geplant, wird die europäische Industrie nach Schätzungen 2024 allenfalls auf die Hälfte der geforderten Ursprungsanteile kommen.
Derzeit haben die europäischen Hersteller einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Anbietern aus China: Die chinesischen Hersteller müssen die Zölle aktuell bezahlen.
Im TCA, das unter Hochdruck in den letzten Tagen vor Heiligabend 2020 verhandelt wurde, wurde bei den Mindestanteilen für zollfreie E-Autos drei Phasen vereinbart:
Der Europäische Rechnungshof hatte gewarnt, dass der Aufbau von Kapazitäten zum Bau von Batterien hinter den Plänen zurückbleibe. 2022 wurden demnach in der EU nur Kapazitäten für 16 Gigawattstunden installiert, angekündigt waren 66 Gigawattstunden Leistung. Mehrere Hersteller haben ihre Ankündigungen, in Europa neue Fabriken zu bauen, zuletzt zurückgezogen. Angesichts der lukrativen Förderbedingungen in den USA durch den IRA wollen sie nun mit der Investition in die USA gehen.
Laut einer Analyse von Benchmark steigt die bis 2031 zugesagte Kapazität in der Batterieproduktion in den USA seit Ankündigung des IRA massiv an. Während bislang die EU stets vorne lag bei den Ankündigungen für den Bau von Batteriefabriken, liegen jetzt die USA vorne.
Um die Zölle zu verhindern, müsste die britische Seite einer Änderung des TCA zustimmen. Die Regierung des Vereinigten Königreichs hat zu erkennen gegeben, dass sie bei den Ursprungsregelungen gesprächsbereit sei und auch kein Interesse an der Einführung von Zöllen habe.
Die europäischen Hersteller warnen, dass Zölle in Höhe von zehn Prozent E-Autos aus Europa im Wettbewerb mit der Konkurrenz aus China zurückwerfen. Kampermann: “Sie wären auch eine Belastung für Kunden, die sich ein E-Fahrzeug anschaffen möchten. Somit würde nicht zuletzt der weitere Hochlauf der Elektromobilität in Europa empfindlich behindert.”
Gerade für die deutschen Hersteller ist der britische Markt wichtig. Das Vereinigte Königreich liegt beim Export der deutschen Automobilindustrie auf Platz drei nach den USA und China. 2022 exportierten Hersteller und Zulieferer Waren für 19 Milliarden Euro nach Großbritannien. Im Gegenzug wurden Waren im Wert von 4,9 Milliarden Euro importiert.
Die deutschen Marken hatten 2022 einen Marktanteil von 46,7 Prozent bei den Neuzulassungen von Pkw. Beim Export von E-Autos in Länder außerhalb der EU lag Großbritannien 2022 auf Platz eins. Aus deutschen Werken wurden 88.000 E-Autos nach England exportiert, auf Platz zwei lagen die USA, wohin 70.000 E-Fahrzeuge gingen. Der Export nach China rangiert auf Platz 5 mit 18.000 E-Autos.
05.07.-06.07.2023, Brüssel (Belgien)
ForumEurope, Conference The European Space Forum 2023
Against the backdrop of the recently released EU Space Strategy for Security and Defence, this event will bring together key stakeholders to discuss challenges and opportunities for Europe as a strong and resilient leader in the global space market. INFO & REGISTRATION
05.07.2023 – 09:00-10:30 Uhr, Brüssel (Belgien)
FES, Roundtable Montenegro’s EU Integration and the Future of European Enlargement Policy
In light of the Montenegro presidential and parliamentary elections, Friedrich Ebert Foundation (FES) is organising a roundtable discussion on the future of EU enlargement policy. INFO & REGISTRATION
05.07.2023 – 17:00-20:00 Uhr, Berlin
KAS, Konferenz Die Zukunft der Handelsbeziehungen zwischen der EU und Lateinamerika
Im Vorfeld des EU-CELAC Gipfels diskutiert die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) mit dem Präsidialamtsminister von Uruguay, dem Kabinettschef des Vizepräsidenten der EU-Kommission sowie der wirtschaftspolitischen Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion über Möglichkeiten zur Vertiefung der Handelsbeziehungen und politischen Partnerschaft zwischen der EU und Lateinamerika. INFOS & ANMELDUNG
05.07.2023 – 18:30 Uhr, Brüssel (Belgien)/online
EU-Vertretung Baden-Württemberg, Podiumsdiskussion Vernetzen, verstehen, verändern – Strategiedialog Landwirtschaft
In Rahmen dieser Veranstaltung werden die Chancen des Formats Strategiedialog Landwirtschaft als Beispiel zur Umsetzung der Farm to Fork Strategie präsentiert und mit Vertreterinnen und Vertretern aus dem Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission diskutiert. INFOS & ANMELDUNG
05.07.2023 – 19:00-20:30 Uhr, Brüssel (Belgien)
HSS, Podiumsdiskussion Europas innovative Wettbewerbsfähigkeit – Fähigkeitsprofile für disruptive Technologien
Die Hanns-Seidel-Stiftung (HSS) veranstaltet einen Innovationsgipfel, um anhand von Expertendiskussionen die für Europas Zukunft entscheidenden Fähigkeiten und Rahmenbedingungen für ein Kompetenzportfolio-Management im Hinblick auf disruptive Technologien als entscheidende Standortfaktoren zu ermitteln. ANMELDUNG
06.07.-07.07.2023, Genf (Schweiz)
ITU, Conference AI for Good: Global Summit 2023
The summit organised by the International Telecommunication Union (ITU) provides an action-oriented United Nations platform promoting AI to advance health, climate, gender, inclusive prosperity, sustainable infrastructure, and other global development priorities. INFO & REGISTRATION
06.07.-07.07.2023, online
EUI, Conference Climate, Energy and Environmental Justices and Transitions: Rethinking Global Environmental law
The European University Institute (EUI) conference focuses on the varieties of legal responses to global environmental problems and their impact on justice, hosting several legal and economics scholars to present their papers. INFO & REGISTRATION
06.07.2023 – 12:24-13:00 Uhr, online
EAB, Vortrag Europa und China
Der Direktor der Europäische Akademie Berlin (EAB) spricht mit Dr. Mikko Huotari, Direktor des Mercator Institute for China Studies, über die Perspektive der bilateralen Beziehungen zwischen der EU und China. INFOS
06.07.2023 – 12:30-13:30 Uhr, Berlin
Tagesspiegel, Diskussion Vertrauenswürdige KI – Wie viel Regulierung braucht es wirklich?
Expertinnen und Experten aus Politik und Wissenschaft diskutieren über die Zukunft und Regulierung von künstlicher Intelligenz, unter anderem mit dem Europaabgeordneten Sergey Lagodinsky und dem Staatssekretär im Bundesministerium für Digitales und Verkehr. INFOS & ANMELDUNG
06.07.2023 – 13:00-16:30 Uhr, Brüssel (Belgien)
FEAD, Workshop How to make the circular economy work? A new alliance between the waste management and manufacturing industries
The European Waste Management Association (FEAD) is bringing together experts, policymakers, and industry leaders to explore how the EU institutions can enhance Member States’ performance in achieving circular economy targets, with a focus on the potential role of a new alliance between the waste management and manufacturing industries. INFO & REGISTRATION
06.07.2023 – 15:00-18:00 Uhr, Brüssel (Belgien)
Eurogas, Conference European Renewable Gas: Evolution or Revolution?
The conference will address the challenges in scaling up renewable hydrogen and biomethane to deliver the climate objectives; it features a welcome speech by the Eurogas president, a keynote speech by the European Commissioner for Energy and discussion panels. INFO & REGISTRATION
06.07.2023 – 18:00-19:00 Uhr, online
KAS, Diskussion Steht Spanien vor einem Regierungswechsel? Die Bedeutung der Parlamentswahlen für Spanien und Europa
Die Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) befasst sich mit den anstehenden Parlamentswahlen in Spanien und den Auswirkungen eines möglichen Regierungswechsels. INFOS & ANMELDUNG
Die EU kommt bei der Umstellung auf eine Kreislaufwirtschaft kaum voran. Zu diesem Urteil kommt ein gestern veröffentlichter Sonderbericht des Europäischen Rechnungshofs. Die zwei Aktionspläne der EU-Kommission und bereitgestellte Mittel in Höhe von zehn Milliarden Euro hätten die Umstellung in den Mitgliedstaaten nur wenig vorangebracht. Insbesondere mangele es an einer kreislauforientierten Gestaltung von Produkten und Herstellungsverfahren, heißt es in dem Bericht. Das EU-Ziel, in diesem Jahrzehnt doppelt so viele Materialien zu recyceln wie im vorigen Jahrzehnt, scheine außer Reichweite, erklärten die Prüfer.
Die Zirkularitätsrate, also der Anteil recycelter und wieder in die Wirtschaft zurückgeführter Materialien, sei zwischen 2015 und 2021 in allen Mitgliedstaaten um durchschnittlich nur 0,4 Prozentpunkte gestiegen. In sieben Ländern (Litauen, Schweden, Rumänien, Dänemark, Luxemburg, Finnland und Polen) sei die Rate in diesem Zeitraum sogar gesunken.
Die EU habe zwar zwischen 2016 und 2020 mehr als zehn Milliarden Euro für ökologische Innovationen und die Unterstützung der Unternehmen beim Umstieg auf die Kreislaufwirtschaft bereitgestellt. Die Mitgliedstaaten hätten jedoch den Großteil dieses Geldes für die Abfallbewirtschaftung ausgegeben, anstatt in kreislauforientiertes Design zu investieren und so die Entstehung von Müll zu vermeiden.
“Materialien zu erhalten und möglichst wenig Abfall zu erzeugen, ist unerlässlich, wenn die EU ressourceneffizient werden und die Umweltziele ihres Grünen Deals erreichen will,” erklärte Annemie Turtelboom, Mitglied des Rechnungshofs. “Doch hat die EU-Politik bisher ihr Ziel verfehlt, da der Übergang zur Kreislaufwirtschaft in den europäischen Ländern leider kaum noch vorankommt.”
Die Kommission hat bislang zwei Aktionspläne entwickelt, um die Umstellung voranzubringen: Der erste Plan von 2015 enthielt 54 konkrete Maßnahmen. Mit dem zweiten Plan aus dem Jahr 2020 kamen 35 neue Maßnahmen hinzu, und es wurde das Ziel festgelegt, die Zirkularitätsrate bis 2030 zu verdoppeln. Die beiden Pläne waren nicht verbindlich, sollten den Mitgliedsstaaten aber dabei helfen, verstärkt Maßnahmen zur Förderung der Kreislaufwirtschaft zu ergreifen. Im Juni 2022 verfügten laut dem Sonderbericht fast alle EU-Länder über eine nationale Strategie für die Kreislaufwirtschaft oder waren dabei, eine solche Strategie zu entwickeln.
Auch die Maßnahmen aus den Aktionsplänen, mit denen Innovationen und Investitionen ermöglicht werden sollten, haben laut Rechnungshof kaum wirksam zu einer Kreislaufwirtschaft beigetragen. Sie hätten allenfalls in geringfügigem Umfang dazu geführt, dass Unternehmen sicherere Produkte herstellen oder Zugang zu innovativen Technologien bekommen, um ihre Herstellungsverfahren nachhaltiger zu gestalten.
Die Prüfer heben in ihrer Analyse auch das Problem des geplanten Verschleißes (geplante Obsoleszenz) hervor, einer Praxis, durch die die Nutzungsdauer eines Produkts künstlich begrenzt wird, damit es ersetzt werden muss. Die Kommission sei zu dem Schluss gekommen, dass es nicht möglich sei, geplanten Verschleiß aufzudecken. Die Nachhaltigkeit von Produkten würde sich jedoch eindeutig verbessern, wenn sich diese Praxis unterbinden ließe. leo
Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sieht eine entschlossene Umsetzung der eigenen Politik als beste Antwort auf das Erstarken von Extremisten in der EU. Die Parteien der demokratischen Mitte müssten “zeigen, dass wir eine klare Vorstellung davon haben, wie wir den sich vollziehenden Wandel angehen wollen”, sagte sie. Es gehe darum, Herausforderungen wie den Ukraine-Krieg oder den Klimawandel entschlossen anzugehen und zugleich damit verbundene Chancen zu ergreifen.
Die CDU-Politikerin äußerte sich in Madrid bei der Auftaktveranstaltung der spanischen Ratspräsidentschaft. Spanien hat zum 1. Juli den rotierenden Vorsitz im Rat der EU übernommen. In dem Land wird am 23. Juli ein neues Parlament gewählt. Umfragen lassen ein starkes Abschneiden der rechtsnationalen Vox-Partei erwarten. In anderen EU-Ländern hatten Rechtsaußen-Parteien zuletzt bei Wahlen zugelegt. In Deutschland erreicht die AfD neue Umfragehöhen. Das hat auch in der CDU/CSU eine intensive Debatte um den Umgang mit der Partei ausgelöst.
Der spanische Regierungschef Pedro Sánchez wies Befürchtungen zurück, die Ratspräsidentschaft seines Landes könne durch die vorgezogene Parlamentswahl Schaden nehmen. Es sei nicht das erste Mal, dass während einer Ratspräsidentschaft gewählt werde, sagte der Sozialist. Angesichts der Erfahrung seines Landes werde “absolute Normalität” während des Ratsvorsitzes herrschen.
Auch von der Leyen zeigte sich zuversichtlich. “Ich setze darauf, dass die spanische Regierung und die Institutionen in der Lage sein werden, eine effiziente Präsidentschaft auszuüben – wie auch immer die Wahlen ausgehen”.
Die Regierung in Madrid hat in ihrem Programm für die kommenden sechs Monate die Wettbewerbsfähigkeit der EU und die Wirtschaftsbeziehungen zu den lateinamerikanischen Ländern zu ihren Top-Prioritäten erhoben. Am 17. und 18. Juli findet in Brüssel der erste Gipfel der EU-Staaten mit der Gemeinschaft der Lateinamerikanischen und karibischen Staaten (CELAC) seit acht Jahren statt. Ziel sei es unter anderem, bis Jahresende das Handelsabkommen mit den Mercosur-Staaten abzuschließen, sagte von der Leyen. tho
Die EU erwägt laut “Financial Times” Zugeständnisse an Russland, um die Verlängerung des Getreide-Abkommens zu erreichen. Demnach könnte der mit Sanktionen belegten staatlichen Landwirtschaftsbank (Rosselchosbank) erlaubt werden, eine neue Tochtergesellschaft zu gründen und sich über diese wieder an das weltweite Finanzsystem anzuschließen. Russland hatte die Wiederaufnahme der Bank in das internationale Zahlungssystem Swift als eine seiner Bedingungen für eine erneute Verlängerung des Deals zur Ausfuhr von ukrainischem Getreide genannt.
Die EU-Kommission lehnte eine Stellungnahme zu dem Bericht ab. Die Regierung in Moskau äußerte sich nicht direkt zu dem Bericht, sieht aber nach eigenen Angaben keinen Grund für eine Verlängerung des Abkommens. Schließlich habe es keine Fortschritte bei der Erfüllung jener Vereinbarungen des Abkommens gegeben, die sich auf russische Exporte beziehen. Nach Ansicht der Regierung in Moskau werden die russischen Lebensmittel- und Düngemittelausfuhren durch Hindernisse etwa bei Versicherungen und eben der Zahlungsabwicklung beeinträchtigt.
Das Abkommen soll trotz des Krieges den Export von Getreide und Düngemitteln aus der Ukraine über das Schwarze Meer ermöglichen. Es wurde erstmals im Juli 2022 von Russland und der Ukraine unter Vermittlung der Türkei und den UN vereinbart und seitdem dreimal verlängert. Es läuft noch im Juli aus. Der nun von der Regierung in Moskau vorgelegte Vorschlag wurde laut FT bei Gesprächen ins Spiel gebracht, die von den UN vermittelt wurden. Demnach soll die staatliche Agrarbank nach einer Wiedereingliederung in Swift Zahlungen im Zusammenhang mit Getreideexporten abwickeln. Im Zuge westlicher Sanktionen wegen des Ukraine-Kriegs waren große russische Banken von dem Swift-System abgekoppelt worden. rtr
Den EU-Wettbewerbshütern reichen offenbar die Zugeständnisse von Microsoft im Streit um die Bürosoftware Office nicht aus. Die EU werde eine förmliche Wettbewerbsuntersuchung einleiten, nachdem Gespräche zur Abwendung eines solchen Schrittes keine Lösung gebracht hätten. Das sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.
Mit Zugeständnissen wollte der US-Konzern Wettbewerbsbedenken wegen seines Kommunikationsprogramms Teams zerstreuen. Die EU ist auf eine Beschwerde des US-Konzerns Salesforce hin tätig geworden, der mit Slack einen Wettbewerber von Teams anbietet.
Microsoft hat angeboten, den Preis seines Office-Produkts ohne die Teams-App zu senken. Die Europäische Kommission habe eine stärkere Preissenkung gefordert, heißt es in Brüssel. Die Kommission lehnte eine Stellungnahme ab. Microsoft erklärte, weiterhin kooperativ mit der Kommission zusammenzuarbeiten. Der Konzern sei offen für pragmatische Lösungen, die den Bedenken der Wettbewerbshüter Rechnung trügen. rtr

Alexander Schuster muss derzeit viele Fragen beantworten: “Viele unsere europäischen Partner können sich keinen Reim auf die deutsche Zeitenwende machen”, sagt der sicherheitspolitische Experte der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS). Da bestehe viel Erklärungsbedarf, auch unter Fachleuten in anderen Ländern, denn bislang sei wenig zu sehen.
Aus seiner Sicht müsste neben dem Sondervermögen von 100 Milliarden Euro auch der Wehretat auf mindestens zwei Prozent des BIP steigen, sagt Schuster. Sonst stünde der Bundeswehr weniger Geld zur Verfügung, weil der Unterhalt der neuen Ausrüstung – unter anderem die F-35 – steigen und den Haushalt weiter belasten werde.
Schusters Arbeit bei der CDU-nahen politischen Stiftung besteht aus der Analyse und Erklärung von europäischer Sicherheitspolitik. Dafür pflegt er ein grenzüberschreitendes Netzwerk, in Frankreich arbeitet die KAS etwa mit der Fondation pour la recherche stratégique (FRS) zusammen, einem Thinktank, der dem Verteidigungsministerium nahesteht.
Auf europäischer Ebene lobt der Sicherheitsexperte unter anderem den Strategischen Kompass und die Europäische Friedensfazilität. Trotzdem müsse Europa handlungsfähiger werden: Die Landes- und Bündnisverteidigung im Rahmen der NATO müsse gesichert werden – bisher sei das nur dank der Unterstützung der USA möglich.
Dafür bräuchte die EU unter anderem einen eigenen Sicherheitsrat, argumentiert Schuster. “Das wäre ein tolles und wirkungsvolles Instrument, wenn der Europäischer Sicherheitsrat ein permanentes Gremium mit operativen Befugnissen wäre.” Damit ließen sich der europäische Pfeiler in der NATO stärken und die Briten in die europäische Sicherheitsarchitektur einbinden.
Seine Ideen schreibt Schuster in Policy Paper, die auch auf der KAS-Webseite veröffentlicht werden. Wichtige Zielgruppe sind unter anderem die Abgeordneten des Bundestags. “Der Austausch mit der Unionsfraktion ist gut.”
Aufgewachsen ist der heute 36-Jährige in Landshut. Europa sei ihm früh präsent gewesen, erzählt Schuster. Die Familie seines Vaters ist in den 1970er-Jahren aus Siebenbürgen vor dem kommunistischem System geflohen. Er studierte Politikwissenschaft und Geschichte in Regensburg. Den Master absolvierte er in drei Semestern, arbeitete als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Professor Stephan Bierling. Bierling ist auch Vertrauensdozent bei der KAS.
So fügte sich, was zusammengehört. “Die Adenauer-Stiftung hat mir eine weltanschauliche Heimat geboten”, erzählt Schuster. “Für mich war der Weg zur KAS alternativlos.” Er ist in der Endphase der Dissertation. Für seine Promotion bekam er ein Stipendium bei der Stiftung. Seit Oktober vergangenen Jahres arbeitet er auch für die Adenauer-Stiftung. Tom Schmidtgen
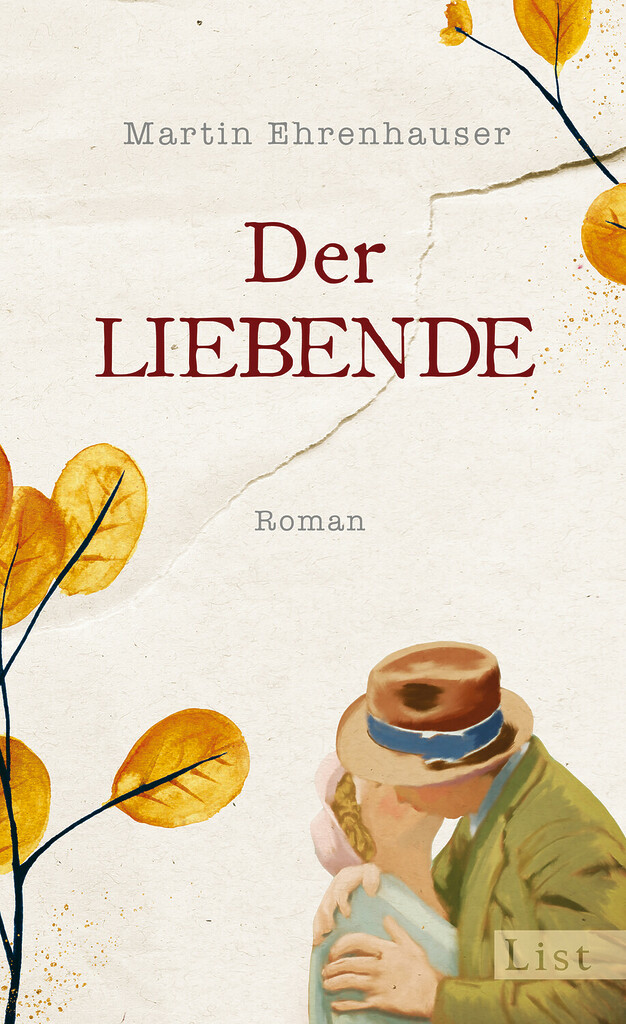
Warum schreiben Politiker Bücher? Das fragen sich Journalisten jedes Mal, wenn ein ehemaliger oder aktueller Minister oder Abgeordneter ein Buch schreibt. Oder in den meisten Fällen: schreiben lässt. Gerhard Schröder, Annalena Baerbock, Heiko Maas, Sigmar Gabriel, sie alle haben es vorgemacht.
Seltener sind Politiker, die ihre Bücher selbst schreiben – und dann auch noch Romane. Bestes Beispiel: Die Erotikromane des Bruno Le Maire oder die Thriller des Thierry Breton.
Nun gesellt sich ein ehemaliger österreichischer EU-Parlamentarier dazu: Martin Ehrenhauser war von 2009 bis 2014 fraktionsloser Abgeordneter in Brüssel und setzte sich für “Demokratie, Kontrolle und Gerechtigkeit” ein. Dabei hat Ehrenhauser, Geburtsjahr 1978, gerne polarisiert: 2017 etwa campte er vor und im Wiener Ballhaus, um gegen die Bankenrettung auf Kosten der staatlichen Sozialausgaben zu protestieren.
Nun aber hat Martin Ehrenhauser einen Roman geschrieben. Und zwar einen Liebesroman, der hauptsächlich in Brüssel spielt und ein bisschen auch in Knokke. So politisch wie des Ehrenhausers Karriere bisher war, so apolitisch ist der Roman.
“Der Liebende” (List Verlag), vermarktet als “Brüsseler Roman”, erzählt die Geschichte eines etwas einsamen österreichischen Priesters, Monsieur Haslinger, der nun in Rente ist. Er pflegt seine Balkonpflanzen, liest, spaziert und steht deutschsprachigen Patienten bei. Und er verliebt sich nach und nach in seine neue Nachbarin, eine ehemalige Diplomatin, intelligent und kokett – und, wie man später erfährt, sterbenskrank.
Der Roman spielt zwar in Brüssel, aber nicht in meinem Brüssel. Das Brüssel des Martin Ehrenhauser ist sauber und gepflegt, ja es erinnert viel eher an das London aus dem Film “Notting Hill” (mit Hugh Grant und Julia Roberts). Kein Müll, kein Straßenlärm, keine Armut. Gepflegte Balkone, achtsame Nachbarn, im Biomüll findet man statt ekligen Fleischresten kranke Pflänzchen, die der Priester wieder aufpäppelt.
Dieses Brüssel erstreckt sich hauptsächlich von Ixelles via Chatelain bis Saint Gilles (aber nur die schönen Straßen). In Knokke, dem Ferienort für wohlhabende Belgier und halb Luxemburg, sind die Strände leer und romantisch. Ja, nicht einmal das verbaute EU-Viertel kommt im Roman vor. Alle Menschen gehen respektvoll miteinander um, Nachbarn entschuldigen sich, wenn sie zu laut feiern und sogar Exil-Österreicher sprechen flämisch und französisch. Auch auf dem Chatelainer Markt geht es irgendwie ruhiger und idyllischer zu als im echten Ixelles
Der Liebende ist kein literarisches Meisterwerk. Es ist ein nettes, etwas kitschiges Büchlein, das sich gut liest. In meinem Fall hat ein luftverschmutztes, heißes Wochenende gereicht (die Luft des fiktiven Brüssel ist übrigens sauber und duftet nach Blumen). Im EU-freien August am Strand ist es sicherlich ein guter Begleiter, falls einen die Nostalgie nach einem idealisierten, entschleunigten Brüssel ohne EU-Kram und soziale Brennpunkte umtreibt. Vielleicht verkürzt es auch das Warten auf die nächste Merkel-Biografie oder Jean-Claude Junckers Skandal-Memoiren. Charlotte Wirth
