die politischen Kräfteverhältnisse in Italien sind in diesen Tagen schwer in Bewegung. Am Freitag wird das Kabinett in Rom voraussichtlich den Entwurf für eine Verfassungsreform auf den Weg bringen – eine vorläufige Einigung wurde gestern Abend vermeldet. Durch das neue Wahlrecht verspricht die rechtskonservative Regierung von Giorgia Meloni dem Land mehr Stabilität. Doch die stärksten linken Oppositionskräfte, die Fünf-Sterne-Bewegung und die Partito Democratico (PD), sehen die Kontrollmechanismen der Verfassung von 1948 in Gefahr.
Kern der Pläne ist die Direktwahl des Regierungschefs. Wahlbündnisse müssten künftig einen Kandidaten aufstellen. Für die Opposition würde es außerdem schwieriger, zu einer neuen Regierungsmehrheit beizutragen, wenn ein Ministerpräsident sich nicht mehr auf eine Mehrheit stützen kann. Für die Reform bräuchte es aber entweder ein Referendum oder eine Zweidrittelmehrheit in beiden Kammern des Parlaments – schwer vorstellbar angesichts der Zersplitterung der italienischen Parteienlandschaft.
Zu neuer Einigkeit finden unterdessen die linken Parteien rund um die Sozialdemokraten der PD. Das Bündnis will bei der Europawahl im kommenden Jahr einen Erfolg gegen die Fratelli d’Italia von Meloni feiern. Doch die möglichen Partner sind zerstritten und angesichts der geopolitischen Lage tief gespalten. Warum eine 150.000-Einwohner-Stadt in Apulien die Linken dennoch hoffen lässt, lesen Sie in unserer Analyse.
Ich wünsche eine angenehme Lektüre.


Vor wenigen Tagen fanden in Foggia Bürgermeisterwahlen statt. Maria Aida Episcopo konnte sich bereits im ersten Wahlgang durchsetzen – mit 52 Prozent der Wählerstimmen ist sie die neue Chefin der Stadt in Apulien. Das Bemerkenswerte: Hinter der Kandidatin, die von der Fünf-Sterne-Bewegung vorgeschlagen worden war, versammelte sich ein Bündnis, das quasi alle Parteien des linken Zentrums Italiens vereinte. Der Partito Democratico (PD), Italia Viva, Azione – all jene Parteien also, die auf nationaler Ebene auf keinen gemeinsamen Nenner kommen. “Gemeinsam gewinnt man”, sagte die Vorsitzende des PD, Elly Schlein, und fügte hinzu: “Eine Alternative zur Rechten, sie existiert.”
Schlein ist seit März Parteichefin des PD, der etwa mit den deutschen Sozialdemokraten verglichen werden kann. Die 38-Jährige galt bei ihrer Wahl als die Hoffnungsträgerin, um der Ikone der Rechten, Ministerpräsidentin Giorgia Meloni von den Fratelli d’Italia, die Stirn zu bieten. Meloni selbst gratulierte Schlein damals als eine der ersten. “Ich hoffe, dass die Wahl einer jungen Frau an die Parteispitze der Linken dabei helfen wird, nach vorne und nicht immer nur rückwärts zu schauen.” Schlein selbst sagte: “Das Wahlergebnis ist ein klares Mandat, die Partei von Grund auf neu auszurichten.”
Bei den Parlamentswahlen vor rund einem Jahr hatte der PD 19 Prozent der Stimmen geholt. Nach einem kurzen Absturz auf 14 Prozent Ende 2022 liegt die Partei seit Monaten relativ konstant knapp unter der 20-Prozent-Marke. Damit belegt sie Platz zwei hinter den regierenden ultrarechten Fratelli d’Italia (derzeit 28,7 Prozent).
Nach einigen Kommunalwahlen steht die Probe für Elly Schlein nun bevor: die Europawahlen im Juni 2024. Die neue Vorsitzende scheint die notwendige inhaltliche Neuausrichtung ihres PD erst einmal hintan zu stellen. Sie weiß: Nur im Bündnis mit anderen Parteien ist dem Rechtsblock von Melonis Regierungskoalition aus ihren Fratelli, Matteo Salvinis Lega und der Forza Italia beizukommen. Der Zusammenschluss ist quasi die einzige Chance, dem rechten Block kräftemäßig etwas entgegenzustellen.
Kommt es bei der Europawahl zu einem weiteren Polen-Moment? Dort hat die liberalkonservative Bürgerkoalition von Donald Tusk die Parlamentswahl vor wenigen Tagen zwar nicht gewonnen, aber der Regierungspartei PiS die Regierungsmehrheit abgerungen. Und Europawahlen waren in Italien schon oft für Überraschungen gut: Bei der Wahl 2019 schoss die Lega von Matteo Salvini auf 34,3 Prozent – ein Zugewinn von 28 Prozentpunkten im Vergleich zur Wahl fünf Jahre zuvor. 2014 konnte der PD des damals frisch als Ministerpräsident eingesetzten Vorsitzenden Matteo Renzi sogar 40 Prozent der Stimmen holen.
Für die kommende Europawahl dürfte der meiste Stimmenzuwachs in Italien wohl den Fratelli d’Italia vorbehalten sein. Die Partei von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni kam 2019 bei den Europawahlen auf 6,5 Prozent. In den nationalen Umfragen liegt sie derzeit bei 28.
Doch welches Bündnis könnte sich gegen die Rechte in Italien formieren? Nach seinem Rücktritt als Premier nach dem verlorenen Verfassungsreferendum im Dezember 2016 ist Renzi mit dem PD nicht mehr zu vereinen. Er hat seine eigene Partei gegründet: Italia Viva (IV). Und versucht schon länger, diese zum Initiator eines dritten starken Pols zu machen. Doch seine IV kommt derzeit auf nur 2,4 Prozent in den Umfragen. Und ein Zusammenschluss mit einem seiner Erzfeinde Carlo Calenda von der Kleinpartei Azione ist erst vor wenigen Tagen gescheitert. Bei den Europawahlen könnten beide nun an der Vier-Prozent-Hürde scheitern. Mit dem PD haben beide, sowohl Renzi als auch Calenda, aber wohl für immer gebrochen.
Bleibt also für Elly Schlein niemand anderes als Conte und seine Fünf-Sterne-Bewegung. Ob sich daraus aber tatsächlich bis Juni ein starkes neues Bündnis formiert, ist fraglich. Was auf lokaler Ebene mancherorts funktionieren mag, ist nicht auf Europa zu übertragen. Schon bei der Frage der Waffenlieferungen an die Ukraine spalten sich die Geister. Elly Schlein ist Atlantikerin, Giuseppe Contes Partei ist im Juni 2022 über die Frage auseinander gebrochen. Der damalige Außenminister Luigi Di Maio, Befürworter italienischer Waffenlieferungen und lange Zeit Parteichef, trat im Zwist mit Conte sogar aus der Bewegung aus. Conte spricht sich immer wieder gegen weitere Waffenlieferungen an die Ukraine aus.
Zuletzt zeigt der Nahost-Krieg, wie weit entfernt man doch voneinander ist. Conte beteiligt sich an italienweiten Demonstrationen für den Frieden, seine Partei steht ohnehin hinter ihm. Schlein hat es da schwerer: Um die unterschiedlichen Lager in ihrer Partei nicht zu verärgern, fährt sie einen Kurs des Sowohl-als-auch. Die Hamas müsse klar verurteilt, aber palästinensische Zivilisten geschützt werden. Kampf gegen jegliche Form des Antisemitismus, aber auch gegen Islamfeindlichkeit.
Für Schlein ist die Lage heikler als für Conte. Eine zu starke Fokussierung auf die Fünf-Sterne-Bewegung könnte ihr auf die Füße fallen. Noch fehlt eine echte inhaltliche Neuausrichtung ihrer eigenen Partei. Die muss die neue Vorsitzende noch liefern. Dass sie es bisher nicht getan hat, enttäuscht bereits viele. Und Conte und seine Fünf Sterne haben sich schon oft als sehr flexibel erwiesen, was ihre Partnerwahl angeht. Nach der Wahl 2018 haben sie zunächst mit dem Rechtspopulisten Matteo Salvini koaliert, 2019 dann waren die Sozialdemokraten, die vorher der absolute Erzfeind waren, plötzlich gut genug – vor allem, um an der Macht zu bleiben.
So könnte auch der erneute Kuschelkurs weniger Schlein gelten, als dass es sich um taktische Spielchen von Conte handelt: Die Abgeordneten der Fünf-Sterne-Bewegung sind im Europaparlament noch immer fraktionslos. Kooperiert die Bewegung zu Hause enger mit dem PD, könnte auch in Brüssel ein Beitritt in die sozialdemokratische Fraktion S&D wieder Thema werden. Almut Siefert
02.11.2023 – 10:00-15:00 Uhr, online
Handelsblatt, Seminar Brennpunkte des Energierechts
Das Seminar vermittelt praxisnahes Wissen zu Grundlagen und aktuellen Entwicklungen des Energierechts, darunter ein Überblick über die Energiemärkte und das Energiewirtschaftsrecht, die Gasmangellage und Auswirkungen durch Dekarbonisierung. INFOS & ANMELDUNG
02.11.2023 – 12:24-13:00 Uhr, online
EAB, Vortrag Verhältnis EU-USA – Live Video-Interview mit Elmar Theveßen
Die Europäischen Akademie Berlin (EAB) spricht im Rahmen der Veranstaltungsreihe ‘Digitaler Countdown zur Europawahl’ mit Elmar Theveßen, Leiter des ZDF-Studios in Washington und langjähriger Experte für internationale Politik und die USA. INFOS
02.11.2023 – 17:00-18:00 Uhr, online
D21, Vortrag KI for Future? Ökologische Nachhaltigkeitsbewertung von Künstlicher Intelligenz
Bei der Veranstaltung der Dialogreihe “Digital Responsibility” wird ein Tool zur Nachhaltigkeitsbewertung von KI mit Fokus auf die ökologische Dimension vorgestellt und anschließend aus unternehmerischer Perspektive diskutiert. INFOS

Die Verhandlungen zwischen der EU-Kommission und der Regierung von Australien über ein umfassendes Freihandelsabkommen (FTA) sind vorerst gescheitert. Am Rande eines Treffens der G7-Handelsminister in Osaka hätte der Deal am Wochenende perfekt gemacht werden sollen. Doch in der Nacht zu Montag sind die Gespräche abgebrochen worden. Die australische Seite lehnte einen von der EU vorgelegten Vorschlag ab. Ausschlaggebend waren Bestimmungen zum Austausch von Agrarprodukten.
Hersteller aus Australien wollten einen höheren zollfreien Zugang ihrer Produkte zum EU-Markt durchsetzen. Die EU-Seite habe ihr Angebot für Rind, Lamm und Zucker, das seit drei Monaten auf dem Tisch liegt, nur geringfügig verbessert, hieß es. EU-Chefunterhändler Valdis Dombrovskis sagte: “Leider waren unsere australischen Partner nicht bereit, auf der Basis der zuvor vereinbarten Ziele abzuschließen.”
Die Verhandlungen liefen seit 2018. Die EU hatte gehofft, vor allem Zugang zu wichtigen Bodenschätzen zu bekommen, die für den Green Deal benötigt werden. Australien ist einer der führenden Lieferanten auf dem Weltmarkt von Lithium, Seltenen Erden, Kobalt und Wasserstoff. Die EU hofft zudem, wie die USA, Japan, China und Korea und andere Mitglieder der Trans-Pazifischen Partnerschaft bevorzugten Zugang zum Markt Australiens zu bekommen. Ein Abkommen hätte dazu beitragen können, die Wirtschaftsleistung der EU bis 2030 um 3,9 Milliarden Euro zu vergrößern, hieß es in Brüssel.
Nun wird befürchtet, dass die Gespräche mindestens im EU-Wahljahr 2024 brach liegen und frühestens 2025 ein Durchbruch möglich ist.
Bernd Lange (SPD), Chef des Handelsausschusses im Europaparlament, nannte das Scheitern der Verhandlungen “sehr bedauerlich”. Weiter sagte er Table.Media: “Auf australischer Seite sind die zollfreien Quoten für Rindfleisch und Schafsfleisch derart zum Dogma geworden, dass man gar nicht mehr einen Kompromiss finden konnte.”
Er habe zudem den Eindruck, dass Australiens Regierung “aufgrund innenpolitischer Entwicklungen” nicht sehr stark in Richtung eines Abkommens unterwegs sei. Es sei “absurd”, “so ein wichtiges Abkommen über stabile Marktzugänge, Transformation, fossilfreie Energieerzeugung, Nachhaltigkeit bei Arbeitnehmerrechten und Umweltstandards und vieles mehr an ein paar Tausend Tonnen zollfreiem Fleisch scheitern zu lassen”. Die fragmentierte Globalisierung und die geopolitische Entwicklung erforderten ein anderes Vorgehen. “Da muss man auch einmal über den Schatten springen.” mgr
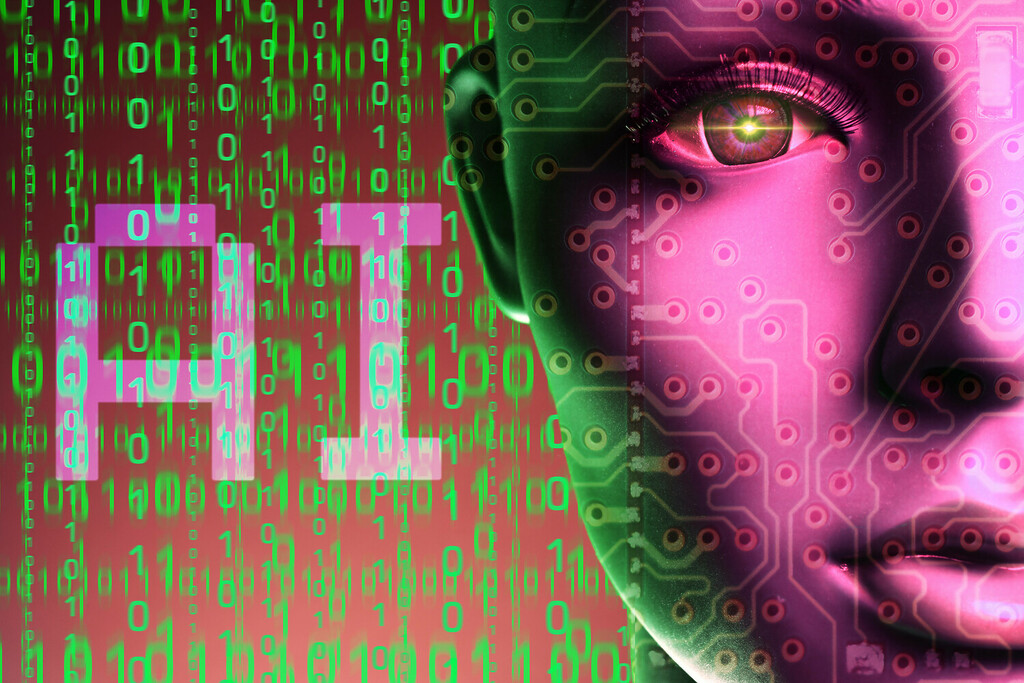
Während die Verhandlungen auf EU-Ebene zum AI Act nur zäh vorankommen, unterzeichnen die EU und Deutschland auf internationaler Ebene immer neue Vereinbarungen, um die Risiken von Künstlicher Intelligenz (KI) in den Griff zu bekommen.
Die Leitlinien für KI und der freiwillige Verhaltenskodex, auf den sich die G7-Staaten im Rahmen des G7 Hiroshima AI Process unter der Führung Japans geeinigt haben und der am Montag veröffentlicht wurde, sollen auf internationaler Ebene die rechtsverbindlichen Vorschriften ergänzen, die die EU derzeit mit dem AI Act ausarbeitet.
Die elf Leitprinzipien sollen Organisationen, die fortschrittliche KI-Systeme wie Basismodelle und generative KI entwickeln oder einsetzen, eine Orientierungshilfe bieten. Diese Prinzipien enthalten Verpflichtungen zur Eindämmung von Risiken und Missbrauch sowie zur Ermittlung von Schwachstellen und die Meldung von Sicherheitsvorfällen. Dazu gehört auch ein Kennzeichnungssystem, das es den Nutzern ermöglicht, KI-generierte Inhalte zu identifizieren. Auf der Grundlage der Leitlinien haben die G7 den Verhaltenskodex ausgearbeitet, mit dem sie die verantwortungsvolle KI-Governance weltweit fördern wollen.
Beide Dokumente wollen die G7 bei Bedarf überprüfen und aktualisieren, um sie an die sich rasant entwickelnde Technologie anzupassen.
In Rom trafen am Montag der italienische Minister für Unternehmen, Adolfo Urso, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire mit Branchenvertretern der drei Länder zusammen, um “der industriellen Zusammenarbeit in Bereichen von strategischer Bedeutung” wie KI neue Impulse zu verleihen. Das teilte das Bundeswirtschaftsministerium am Montag mit. Demnach will Italien 2024 während seiner G7-Präsidentschaft eine Diskussion zu denselben Themen auf G7-Ebene fördern.
Diese “neuartige Zusammenarbeit” zwischen Italien, Deutschland und Frankreich ziele darauf ab, sowohl Nachfrage als auch Angebot vor dem Hintergrund des sich entwickelnden geopolitischen Szenarios wirksam zu unterstützen, heißt es in der Mitteilung des BMWK weiter. Es gehe darum, “einer weltweit wettbewerbsfähigen europäischen KI-Industrie” den Weg zu ebnen. Zu diesem Zweck hätten sich die drei Minister darauf geeinigt, “den Verwaltungsaufwand zu verringern und die Verfahren für länderübergreifende Projekte zu vereinfachen”. So wollen sie europäischen Start-ups ermöglichen, an Projekten zum digitalen und grünen Wandel teilzunehmen.
Ebenfalls am Montag kam der Präsidentenerlass von US-Präsident Joe Biden, der unter anderem vorsieht, dass bei Programmen, die potenziell gefährlich für die nationale Sicherheit, Wirtschaft oder Gesundheit werden könnten, die Entwickler die US-Regierung bereits beim Anlernen der KI-Modelle unterrichten müssen. Die Entwickler werden auch verpflichtet, die Ergebnisse von Sicherheitstests mit den Behörden zu teilen.
Die US-Regierung befürchtet unter anderem, dass mit KI gefährliche Schadsoftware oder auch biologische Waffen entwickelt werden könnten. Zum Testen von KI-Programmen sollen Standards festgelegt werden – und das Ministerium für Heimatschutz soll sie auch für kritische Infrastruktur anwenden. Globale Risiken von KI sollen in dieser Woche auch Thema beim AI-Safety-Summit in Großbritannien sein.
Biden will gleichzeitig den Einsatz von KI in der Regierung beschleunigen und so die USA als KI-Entwicklungsstandort stärken. Dafür sollen die Behörden mehr KI-Experten einstellen. Für Experten aus anderen Ländern soll es einfacher werden, in den USA zu arbeiten. vis

Die Europäische Union plant, die Länder des westlichen Balkans mit Investitionen von sechs Milliarden Euro bei den Reformen zu unterstützen, die für den EU-Beitritt erforderlich sind, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montag in der nordmazedonischen Hauptstadt Skopje.
Nordmazedonien, Albanien, Kosovo, Serbien, Montenegro und Bosnien und Herzegowina müssten das “Fenster der Gelegenheit” für die Erweiterung der EU nutzen. Nordmazedonien muss unter anderem eine effiziente öffentliche Verwaltung aufbauen und wie von Bulgarien gefordert die Verfassung ändern, um die Bulgaren als Minderheit anzuerkennen. Grundlage für die Reformen der Staaten ist der neue Wachstumsplan der EU für die Region.
“Diese Reformen werden mit Investitionen einhergehen”, sagte von der Leyen während einer Pressekonferenz mit dem nordmazedonischen Premierminister Dimitar Kovacevski zu Beginn ihrer Westbalkanreise.
Im weiteren Verlauf des Tages besuchte sie den Kosovo, wo sie das Land aufforderte, der serbischen Minderheit mehr Autonomie zu gewähren und einen Gemeindeverband zu gründen, der sich um sie kümmern soll. Serbien und Montenegro waren die ersten Länder in der Region, die EU-Beitrittsgespräche aufnahmen. Albanien und Nordmazedonien begannen im vergangenen Jahr Gespräche. Bosnien und der Kosovo hinken ihren Nachbarn in diesem Prozess jedoch noch weit hinterher. rtr

Mit 659 Millionen Euro soll der französische Batteriehersteller Verkor in einem Forschungs- und Entwicklungsprojekt unterstützt werden. Die EU-Kommission hat im Rahmen der EU-Beihilfevorschriften eine entsprechende französische Maßnahme genehmigt. Das Geld soll in die Erforschung und Entwicklung neuer Verfahren zur Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge fließen. Damit soll das Projekt bis Ende 2026 abgedeckt sein.
Das Vorhaben von Verkor wird sich laut Angaben der Kommission auf vier Schwerpunkte konzentrieren:
Die Maßnahme ist Teil des französischen Transformationsplans “France 2030”. Verkor wird mit weiteren, im September von Investoren generierten Geldern unter anderem den Bau einer ersten Gigafactory in Dunkerque und die Herstellung von Hochleistungsbatteriezellen mit niedrigem Kohlenstoffgehalt vorantreiben. leo

Der Plan eines Critical Raw Materials Club, mit dem die EU die Beschaffungsmöglichkeiten für kritische Rohstoffe diversifizieren will, ist laut einem neuen Forschungspapier des Jacques Delors Centres ein vielversprechendes Modell für eine erfolgreiche Rohstoffdiplomatie. Allerdings müsse die EU dafür glaubwürdige Anfangsfinanzierungen bei der Gründung des Clubs bereitstellen und ihr fragmentiertes
Modell der Entwicklungsfinanzierung straffen, heißt es darin. Das Papier wird heute veröffentlicht und lag Table.Media vorab vor.
Die EU-Kommission strebt mit dem Raw Materials Club an, ein kooperatives Forum für ressourcenreiche Länder und Verbraucherländer zu gründen, um die Kooperation in der Rohstoffpolitik zu verbessern, Investitionen anzuschieben und ressourcenreiche Länder in ihrem Ziel zu unterstützen, lokale Verarbeitungskapazitäten aufzubauen. Mit dem Club will sie die von den USA angeführte Minerals Security Partnership (MSP) ergänzen. Das erste Treffen soll noch in diesem Jahr stattfinden.
In dem Papier argumentiert der Autor Francesco Findeisen, ein Club mit einem hybriden Design, der mit freiwilligen Verpflichtungen, minimaler Struktur und einer begrenzten Mitgliederanzahl beginne und einen Prozess definiere, um sich in eine ambitioniertere und verbindliche Struktur zu entwickeln, sei das vielversprechendste Modell. Jedoch sei dieser Ansatz als solcher ungenügend. Um erfolgreich zu sein, müsse die EU glaubwürdige Anfangsfinanzierungen bei der Gründung des Clubs bereitstellen und ihr fragmentiertes Entwicklungsförderungsmodell rationalisieren. leo

Die EU-Kommission hat deutsche Beihilfen zur Unterstützung des Fischereisektors in Höhe von 20 Millionen Euro genehmigt. Die Gelder sollen vor den Auswirkungen des EU-Austritts des Vereinigten Königreichs schützen.
Ziel sei es, Fischereibetriebe für Einkommensverluste im Zusammenhang mit den Brexit-bedingten Kürzungen der Fischereiquoten zu entschädigen, erklärte die Kommission am Montag. Eigentümer von Fangschiffen mit einer Länge bis zu 24 Metern können für maximal 15 Prozent der geschätzten Einkommensverluste entschädigt werden. Besitzer längerer Schiffe haben Anspruch auf Entschädigung für maximal zehn Prozent der Einkommensverluste. Die Regelung läuft bis Ende des Jahres. luk

Die Slowakei hat mit Richard Takáč einen neuen Landwirtschaftsminister. Der 41-Jährige ist Teil der neuen Regierung unter Premierminister Robert Fico, teilt der Nachrichtendienst Agra Europe mit. Anfang Oktober hatte die SMER-SD unter ihrem Vorsitzenden Fico die Wahlen gewonnen. Takáč ist seit 2020 stellvertretender Vorsitzender der SMER-SD. Diese gilt als linkspopulistisch und -national sowie russlandfreundlich. Takáč ist seit 2020 Abgeordneter im Nationalrat der Slowakei. Zuvor soll er unter anderem als Geschäftsmann in der Möbelbranche tätig gewesen sein. Slowakischen Medienberichten zufolge ist er Absolvent der landwirtschaftlichen Universität in Nitra.
Die SMER-SD hat mit der von ihr vor drei Jahren abgespaltenen Hlas-SD sowie der rechtsradikalen SNS eine Koalition gebildet. Aufgrund der Zusammenarbeit mit der SNS hatte die Progressive Allianz der Sozialdemokraten (S&D) im Europaparlament kürzlich die drei Abgeordneten der SMER-SD aus ihren Reihen ausgeschlossen. Die vollständige Liste des slowakischen Kabinetts ist hier zu finden.
Beobachter in Brüssel befürchten, dass Fico mit seiner als prorussisch geltenden Regierung erneut ein Problemfall für die EU werden könnte. Fico war 2020 als Ministerpräsident nach der Affäre um den Mord an dem Investigativ-Journalisten Ján Kuciak und seiner Verlobten zurückgetreten. Kuciak war mafiösen Strukturen, die bis in die Regierung gereicht haben sollen, nachgegangen. Konkret ging es dabei auch um Betrügereien mit EU-Agrarbeihilfen im großen Stil.
Dem neuerdings für den Green Deal zuständigen geschäftsführenden Vizepräsidenten der EU-Kommission, dem Slowaken Maroš Šefčovič, wird eine Nähe zur SMER-SD nachgesagt. Als dieser bei der Präsidentenwahl 2019 angetreten war, erfolgte dies mit Unterstützung der SMER-SD. red

Wer wissen möchte, wo der Gesetzgebungsprozess in Sachen Künstlicher Intelligenz in Europa aktuell steht, der sollte Kai Zenner kennen. Wie kein anderer informiert er die interessierte Öffentlichkeit über LinkedIn, X und seinen Blog über den Fortgang des Dossiers und tritt auf unzähligen Veranstaltungen als Experte für die Regulierung von KI auf. Er versuche das Verfahren etwas transparenter zu machen, sagt er. Und macht sich damit nicht nur Freunde.
Seit August 2017 leitet Kai Zenner das Büro des Europaabgeordneten Axel Voss (EVP) in Brüssel und ist zugleich sein Berater für Digitalpolitik. “Wir sind seit 2017 überzeugt, dass KI massiven Einfluss auf unser Leben hat und haben wird”, sagt er. Das Ziel einer Regulierung sollte daher sein, die Gesellschaft vor Gefahren zu schützen, ohne zugleich Innovation zu stark zu hemmen. Und natürlich seien Voss und er überzeugt, “ein gutes Gespür und viele Ideen für diesen Mittelweg zu haben”.
Dass Zenner in der Digitalpolitik gelandet ist, war keineswegs von Beginn an ausgemacht. Auf das Thema ist er erst in Brüssel gestoßen, als er von 2015 bis 2017 Research Associate bei der Konrad-Adenauer-Stiftung war. Das war sein erster Job nach dem Studium und einigen Praktika – und wie er sagt, ein guter Abschluss für seine Ausbildung. Dort startete er die Eventserie Think digital!, seither hat ihn das Thema nicht mehr losgelassen. In dieser Zeit hat er auch Axel Voss kennengelernt, der seinerseits auf vielen Podien zum Thema Digitales und KI zu Gast war.
Kai Zenner ist 1985 in Oldenburg in Niedersachsen geboren und im beschaulichen Bad Zwischenahn aufgewachsen. Wenn er ein bisschen was erleben wollte, fuhr er als Teenager mit seinen Freunden nach Oldenburg. Sein erster kindlicher Berufswunsch war Banker, weil sein Großvater in einem Nachbarort eine Volksbankfiliale leitete. Doch bald fand er für sich eine andere Leidenschaft: “Politik und Geschichte haben mich immer sehr interessiert”, erinnert er sich. “Als Kind habe ich immer mal wieder alle Flaggen der Welt gemalt und alles sehr systematisch aufgedröselt.” Auch die Gespräche über Geschichte mit seinen Großeltern haben ihn inspiriert und die Geschichtsbücher, die er las.
Nach dem Abitur mit Leistungskurs Geschichte begann er 2005 sein Politikstudium in Bremen. “Für mich war eigentlich immer klar, dass ich etwas mit Politik machen möchte”, sagt Zenner. Noch lieber hätte er zwar Geschichte studiert, aber damals seien die Verhältnisse am Arbeitsmarkt so ungünstig gewesen, dass es schwer geworden wäre, dort einen guten Job zu finden. Und Bremen war ideal für ihn: ein Stück weit weg von zu Hause, aber nicht zu weit. “Ich spiele immer ein bisschen auf Sicherheit”, erklärt er. “Ich schaue mir eine Sache erst einmal an und erst, wenn ich sicher bin, traue ich mir Dinge zu.”
Dem Bachelor in Politik folgte der Wechsel nach Freiburg zum Jurastudium, um seinen Lebenslauf etwas interessanter zu gestalten, wie er sagt. “Freiburg war der große Wurf, weiter weg von meinem Heimatdorf ging es eigentlich in Deutschland nicht.” Es seien mit die schönsten zwei Jahre seines Lebens gewesen. Dennoch wechselte er nach der Zwischenprüfung nach Münster, wo er Europarecht und Völkerrecht als Schwerpunkte wählen konnte. “Das war genau das, was mich hauptsächlich an Jura interessiert hatte.” Richter oder Anwalt zu werden, sei für ihn nie infrage gekommen.
Sein Politikstudium schloss Zenner während eines Auslandsjahres an der Universität Edinburgh in Schottland mit einem Master in International Relations mit Schwerpunkt auf Sicherheitsstudien, Außenpolitik und internationalem Recht ab. Seine Masterarbeit schrieb er über Ausnahmezustände in der Geschichte. Sein Doppelstudium habe viel Zeit in Anspruch genommen, aber: “In meinem Berufsalltag hat es mit sehr geholfen, dass ich mit Jura und Politik zwei Standbeine habe”, erzählt er rückblickend.
Bei diversen Praktika während des Studiums und auch danach testete er weiter, was ihm gefällt und was nicht – auch, um die für ihn so wichtige Sicherheit zu gewinnen. Gefallen haben ihm das Praktikum beim CDU-Bundestagsabgeordneten Thomas Kossenday und beim Bundespresseamt. “Die haben mich vollends überzeugt, dass ich im politischen Umfeld aktiv sein möchte.”
Bei seiner Arbeit braucht Zenner viel Freiraum. Ein Chef, der ihm Leitlinien setzt und ihn dann machen lässt, was er für richtig hält, “das sind für mich die besten Chefs. Unter diesen Chefs blühe ich auf“, sagt er. Axel Voss sei so ein Chef. In der Brasserie London auf dem Place du Luxembourg unweit des EU-Parlaments fand 2017 das Bewerbungsgespräch statt. “Wir haben zwei Stunden gesprochen”, erinnert er sich. “Ich fand es toll, weil er mir auf Augenhöhe begegnet ist.”
Und dann ging die Arbeit am Thema KI bald los, lange bevor die Kommission 2021 ihren Vorschlag zum AI Act vorlegte. Im Wahlkampf 2019 schrieb Kai Zenner ein digitales Manifesto. “Da haben Axel Voss und ich Vorschläge gemacht, wo die neue Kommission unter Ursula von der Leyen digitalpolitisch tätig werden sollte.” Es folgte im Rechtsausschuss der Initiativbericht zu Künstlicher Intelligenz, der AIDA-Sonderausschuss, die Arbeit an der KI-Haftung und vieles mehr.
Auch für das kommende Mandat hat Zenner Pläne – wenn es denn auch diesmal gelingt, dass Axel Voss wieder ins EU-Parlament einzieht. Die geplante ePrivacy-Verordnung oder gegebenenfalls eine Revision der DSGVO, das Gesetz über kollektive Sammelklagen sowie die neue KI-Haftungsrichtlinie, “das sind die Themen, für die wir brennen”, sagt er. “Deswegen sehen wir unsere Mission noch nicht als beendet an.”
Viel Nachdenken über das kommende Mandat tut er allerdings noch nicht: Im Moment gebe er 200 Prozent für die Verhandlungen zum AI Act, um sie noch in diesem Jahr abschließen zu können. 2023 erhielt er die Auszeichnung als “Best MEP Assistent” für seinen weit über seine Pflichten hinausgehenden Einsatz. Für seine Frau und seinen zweijährigen Sohn bleibe da im Moment wenig Zeit, für Freunde oder Hobbys so gut wie gar keine.
Ob er sich vorstellen kann, anstatt Assistent zu sein, selbst einmal Politiker zu werden? “Deutscher Europaabgeordneter zu werden, wäre eine spannende Option”, meint er. Allerdings müsste er dafür in einem Wahlkreis leben und ständig zwischen Deutschland und Brüssel pendeln. “Das kann ich mir aktuell nicht vorstellen: Brüssel ist für mich und meine Familie der Lebensmittelpunkt.” Corinna Visser
die politischen Kräfteverhältnisse in Italien sind in diesen Tagen schwer in Bewegung. Am Freitag wird das Kabinett in Rom voraussichtlich den Entwurf für eine Verfassungsreform auf den Weg bringen – eine vorläufige Einigung wurde gestern Abend vermeldet. Durch das neue Wahlrecht verspricht die rechtskonservative Regierung von Giorgia Meloni dem Land mehr Stabilität. Doch die stärksten linken Oppositionskräfte, die Fünf-Sterne-Bewegung und die Partito Democratico (PD), sehen die Kontrollmechanismen der Verfassung von 1948 in Gefahr.
Kern der Pläne ist die Direktwahl des Regierungschefs. Wahlbündnisse müssten künftig einen Kandidaten aufstellen. Für die Opposition würde es außerdem schwieriger, zu einer neuen Regierungsmehrheit beizutragen, wenn ein Ministerpräsident sich nicht mehr auf eine Mehrheit stützen kann. Für die Reform bräuchte es aber entweder ein Referendum oder eine Zweidrittelmehrheit in beiden Kammern des Parlaments – schwer vorstellbar angesichts der Zersplitterung der italienischen Parteienlandschaft.
Zu neuer Einigkeit finden unterdessen die linken Parteien rund um die Sozialdemokraten der PD. Das Bündnis will bei der Europawahl im kommenden Jahr einen Erfolg gegen die Fratelli d’Italia von Meloni feiern. Doch die möglichen Partner sind zerstritten und angesichts der geopolitischen Lage tief gespalten. Warum eine 150.000-Einwohner-Stadt in Apulien die Linken dennoch hoffen lässt, lesen Sie in unserer Analyse.
Ich wünsche eine angenehme Lektüre.


Vor wenigen Tagen fanden in Foggia Bürgermeisterwahlen statt. Maria Aida Episcopo konnte sich bereits im ersten Wahlgang durchsetzen – mit 52 Prozent der Wählerstimmen ist sie die neue Chefin der Stadt in Apulien. Das Bemerkenswerte: Hinter der Kandidatin, die von der Fünf-Sterne-Bewegung vorgeschlagen worden war, versammelte sich ein Bündnis, das quasi alle Parteien des linken Zentrums Italiens vereinte. Der Partito Democratico (PD), Italia Viva, Azione – all jene Parteien also, die auf nationaler Ebene auf keinen gemeinsamen Nenner kommen. “Gemeinsam gewinnt man”, sagte die Vorsitzende des PD, Elly Schlein, und fügte hinzu: “Eine Alternative zur Rechten, sie existiert.”
Schlein ist seit März Parteichefin des PD, der etwa mit den deutschen Sozialdemokraten verglichen werden kann. Die 38-Jährige galt bei ihrer Wahl als die Hoffnungsträgerin, um der Ikone der Rechten, Ministerpräsidentin Giorgia Meloni von den Fratelli d’Italia, die Stirn zu bieten. Meloni selbst gratulierte Schlein damals als eine der ersten. “Ich hoffe, dass die Wahl einer jungen Frau an die Parteispitze der Linken dabei helfen wird, nach vorne und nicht immer nur rückwärts zu schauen.” Schlein selbst sagte: “Das Wahlergebnis ist ein klares Mandat, die Partei von Grund auf neu auszurichten.”
Bei den Parlamentswahlen vor rund einem Jahr hatte der PD 19 Prozent der Stimmen geholt. Nach einem kurzen Absturz auf 14 Prozent Ende 2022 liegt die Partei seit Monaten relativ konstant knapp unter der 20-Prozent-Marke. Damit belegt sie Platz zwei hinter den regierenden ultrarechten Fratelli d’Italia (derzeit 28,7 Prozent).
Nach einigen Kommunalwahlen steht die Probe für Elly Schlein nun bevor: die Europawahlen im Juni 2024. Die neue Vorsitzende scheint die notwendige inhaltliche Neuausrichtung ihres PD erst einmal hintan zu stellen. Sie weiß: Nur im Bündnis mit anderen Parteien ist dem Rechtsblock von Melonis Regierungskoalition aus ihren Fratelli, Matteo Salvinis Lega und der Forza Italia beizukommen. Der Zusammenschluss ist quasi die einzige Chance, dem rechten Block kräftemäßig etwas entgegenzustellen.
Kommt es bei der Europawahl zu einem weiteren Polen-Moment? Dort hat die liberalkonservative Bürgerkoalition von Donald Tusk die Parlamentswahl vor wenigen Tagen zwar nicht gewonnen, aber der Regierungspartei PiS die Regierungsmehrheit abgerungen. Und Europawahlen waren in Italien schon oft für Überraschungen gut: Bei der Wahl 2019 schoss die Lega von Matteo Salvini auf 34,3 Prozent – ein Zugewinn von 28 Prozentpunkten im Vergleich zur Wahl fünf Jahre zuvor. 2014 konnte der PD des damals frisch als Ministerpräsident eingesetzten Vorsitzenden Matteo Renzi sogar 40 Prozent der Stimmen holen.
Für die kommende Europawahl dürfte der meiste Stimmenzuwachs in Italien wohl den Fratelli d’Italia vorbehalten sein. Die Partei von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni kam 2019 bei den Europawahlen auf 6,5 Prozent. In den nationalen Umfragen liegt sie derzeit bei 28.
Doch welches Bündnis könnte sich gegen die Rechte in Italien formieren? Nach seinem Rücktritt als Premier nach dem verlorenen Verfassungsreferendum im Dezember 2016 ist Renzi mit dem PD nicht mehr zu vereinen. Er hat seine eigene Partei gegründet: Italia Viva (IV). Und versucht schon länger, diese zum Initiator eines dritten starken Pols zu machen. Doch seine IV kommt derzeit auf nur 2,4 Prozent in den Umfragen. Und ein Zusammenschluss mit einem seiner Erzfeinde Carlo Calenda von der Kleinpartei Azione ist erst vor wenigen Tagen gescheitert. Bei den Europawahlen könnten beide nun an der Vier-Prozent-Hürde scheitern. Mit dem PD haben beide, sowohl Renzi als auch Calenda, aber wohl für immer gebrochen.
Bleibt also für Elly Schlein niemand anderes als Conte und seine Fünf-Sterne-Bewegung. Ob sich daraus aber tatsächlich bis Juni ein starkes neues Bündnis formiert, ist fraglich. Was auf lokaler Ebene mancherorts funktionieren mag, ist nicht auf Europa zu übertragen. Schon bei der Frage der Waffenlieferungen an die Ukraine spalten sich die Geister. Elly Schlein ist Atlantikerin, Giuseppe Contes Partei ist im Juni 2022 über die Frage auseinander gebrochen. Der damalige Außenminister Luigi Di Maio, Befürworter italienischer Waffenlieferungen und lange Zeit Parteichef, trat im Zwist mit Conte sogar aus der Bewegung aus. Conte spricht sich immer wieder gegen weitere Waffenlieferungen an die Ukraine aus.
Zuletzt zeigt der Nahost-Krieg, wie weit entfernt man doch voneinander ist. Conte beteiligt sich an italienweiten Demonstrationen für den Frieden, seine Partei steht ohnehin hinter ihm. Schlein hat es da schwerer: Um die unterschiedlichen Lager in ihrer Partei nicht zu verärgern, fährt sie einen Kurs des Sowohl-als-auch. Die Hamas müsse klar verurteilt, aber palästinensische Zivilisten geschützt werden. Kampf gegen jegliche Form des Antisemitismus, aber auch gegen Islamfeindlichkeit.
Für Schlein ist die Lage heikler als für Conte. Eine zu starke Fokussierung auf die Fünf-Sterne-Bewegung könnte ihr auf die Füße fallen. Noch fehlt eine echte inhaltliche Neuausrichtung ihrer eigenen Partei. Die muss die neue Vorsitzende noch liefern. Dass sie es bisher nicht getan hat, enttäuscht bereits viele. Und Conte und seine Fünf Sterne haben sich schon oft als sehr flexibel erwiesen, was ihre Partnerwahl angeht. Nach der Wahl 2018 haben sie zunächst mit dem Rechtspopulisten Matteo Salvini koaliert, 2019 dann waren die Sozialdemokraten, die vorher der absolute Erzfeind waren, plötzlich gut genug – vor allem, um an der Macht zu bleiben.
So könnte auch der erneute Kuschelkurs weniger Schlein gelten, als dass es sich um taktische Spielchen von Conte handelt: Die Abgeordneten der Fünf-Sterne-Bewegung sind im Europaparlament noch immer fraktionslos. Kooperiert die Bewegung zu Hause enger mit dem PD, könnte auch in Brüssel ein Beitritt in die sozialdemokratische Fraktion S&D wieder Thema werden. Almut Siefert
02.11.2023 – 10:00-15:00 Uhr, online
Handelsblatt, Seminar Brennpunkte des Energierechts
Das Seminar vermittelt praxisnahes Wissen zu Grundlagen und aktuellen Entwicklungen des Energierechts, darunter ein Überblick über die Energiemärkte und das Energiewirtschaftsrecht, die Gasmangellage und Auswirkungen durch Dekarbonisierung. INFOS & ANMELDUNG
02.11.2023 – 12:24-13:00 Uhr, online
EAB, Vortrag Verhältnis EU-USA – Live Video-Interview mit Elmar Theveßen
Die Europäischen Akademie Berlin (EAB) spricht im Rahmen der Veranstaltungsreihe ‘Digitaler Countdown zur Europawahl’ mit Elmar Theveßen, Leiter des ZDF-Studios in Washington und langjähriger Experte für internationale Politik und die USA. INFOS
02.11.2023 – 17:00-18:00 Uhr, online
D21, Vortrag KI for Future? Ökologische Nachhaltigkeitsbewertung von Künstlicher Intelligenz
Bei der Veranstaltung der Dialogreihe “Digital Responsibility” wird ein Tool zur Nachhaltigkeitsbewertung von KI mit Fokus auf die ökologische Dimension vorgestellt und anschließend aus unternehmerischer Perspektive diskutiert. INFOS

Die Verhandlungen zwischen der EU-Kommission und der Regierung von Australien über ein umfassendes Freihandelsabkommen (FTA) sind vorerst gescheitert. Am Rande eines Treffens der G7-Handelsminister in Osaka hätte der Deal am Wochenende perfekt gemacht werden sollen. Doch in der Nacht zu Montag sind die Gespräche abgebrochen worden. Die australische Seite lehnte einen von der EU vorgelegten Vorschlag ab. Ausschlaggebend waren Bestimmungen zum Austausch von Agrarprodukten.
Hersteller aus Australien wollten einen höheren zollfreien Zugang ihrer Produkte zum EU-Markt durchsetzen. Die EU-Seite habe ihr Angebot für Rind, Lamm und Zucker, das seit drei Monaten auf dem Tisch liegt, nur geringfügig verbessert, hieß es. EU-Chefunterhändler Valdis Dombrovskis sagte: “Leider waren unsere australischen Partner nicht bereit, auf der Basis der zuvor vereinbarten Ziele abzuschließen.”
Die Verhandlungen liefen seit 2018. Die EU hatte gehofft, vor allem Zugang zu wichtigen Bodenschätzen zu bekommen, die für den Green Deal benötigt werden. Australien ist einer der führenden Lieferanten auf dem Weltmarkt von Lithium, Seltenen Erden, Kobalt und Wasserstoff. Die EU hofft zudem, wie die USA, Japan, China und Korea und andere Mitglieder der Trans-Pazifischen Partnerschaft bevorzugten Zugang zum Markt Australiens zu bekommen. Ein Abkommen hätte dazu beitragen können, die Wirtschaftsleistung der EU bis 2030 um 3,9 Milliarden Euro zu vergrößern, hieß es in Brüssel.
Nun wird befürchtet, dass die Gespräche mindestens im EU-Wahljahr 2024 brach liegen und frühestens 2025 ein Durchbruch möglich ist.
Bernd Lange (SPD), Chef des Handelsausschusses im Europaparlament, nannte das Scheitern der Verhandlungen “sehr bedauerlich”. Weiter sagte er Table.Media: “Auf australischer Seite sind die zollfreien Quoten für Rindfleisch und Schafsfleisch derart zum Dogma geworden, dass man gar nicht mehr einen Kompromiss finden konnte.”
Er habe zudem den Eindruck, dass Australiens Regierung “aufgrund innenpolitischer Entwicklungen” nicht sehr stark in Richtung eines Abkommens unterwegs sei. Es sei “absurd”, “so ein wichtiges Abkommen über stabile Marktzugänge, Transformation, fossilfreie Energieerzeugung, Nachhaltigkeit bei Arbeitnehmerrechten und Umweltstandards und vieles mehr an ein paar Tausend Tonnen zollfreiem Fleisch scheitern zu lassen”. Die fragmentierte Globalisierung und die geopolitische Entwicklung erforderten ein anderes Vorgehen. “Da muss man auch einmal über den Schatten springen.” mgr
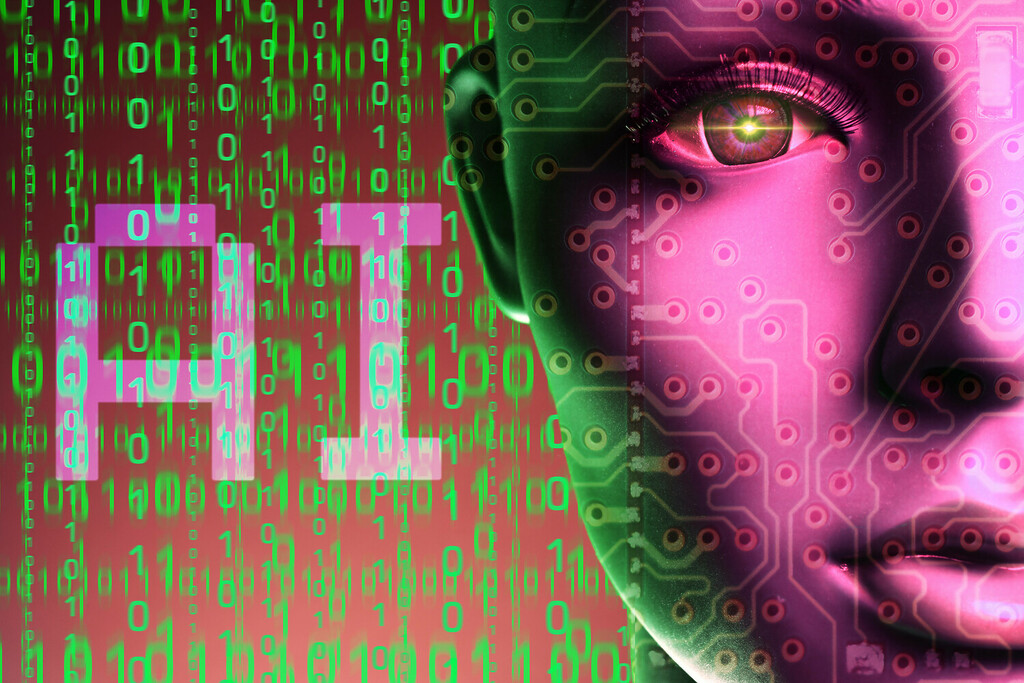
Während die Verhandlungen auf EU-Ebene zum AI Act nur zäh vorankommen, unterzeichnen die EU und Deutschland auf internationaler Ebene immer neue Vereinbarungen, um die Risiken von Künstlicher Intelligenz (KI) in den Griff zu bekommen.
Die Leitlinien für KI und der freiwillige Verhaltenskodex, auf den sich die G7-Staaten im Rahmen des G7 Hiroshima AI Process unter der Führung Japans geeinigt haben und der am Montag veröffentlicht wurde, sollen auf internationaler Ebene die rechtsverbindlichen Vorschriften ergänzen, die die EU derzeit mit dem AI Act ausarbeitet.
Die elf Leitprinzipien sollen Organisationen, die fortschrittliche KI-Systeme wie Basismodelle und generative KI entwickeln oder einsetzen, eine Orientierungshilfe bieten. Diese Prinzipien enthalten Verpflichtungen zur Eindämmung von Risiken und Missbrauch sowie zur Ermittlung von Schwachstellen und die Meldung von Sicherheitsvorfällen. Dazu gehört auch ein Kennzeichnungssystem, das es den Nutzern ermöglicht, KI-generierte Inhalte zu identifizieren. Auf der Grundlage der Leitlinien haben die G7 den Verhaltenskodex ausgearbeitet, mit dem sie die verantwortungsvolle KI-Governance weltweit fördern wollen.
Beide Dokumente wollen die G7 bei Bedarf überprüfen und aktualisieren, um sie an die sich rasant entwickelnde Technologie anzupassen.
In Rom trafen am Montag der italienische Minister für Unternehmen, Adolfo Urso, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire mit Branchenvertretern der drei Länder zusammen, um “der industriellen Zusammenarbeit in Bereichen von strategischer Bedeutung” wie KI neue Impulse zu verleihen. Das teilte das Bundeswirtschaftsministerium am Montag mit. Demnach will Italien 2024 während seiner G7-Präsidentschaft eine Diskussion zu denselben Themen auf G7-Ebene fördern.
Diese “neuartige Zusammenarbeit” zwischen Italien, Deutschland und Frankreich ziele darauf ab, sowohl Nachfrage als auch Angebot vor dem Hintergrund des sich entwickelnden geopolitischen Szenarios wirksam zu unterstützen, heißt es in der Mitteilung des BMWK weiter. Es gehe darum, “einer weltweit wettbewerbsfähigen europäischen KI-Industrie” den Weg zu ebnen. Zu diesem Zweck hätten sich die drei Minister darauf geeinigt, “den Verwaltungsaufwand zu verringern und die Verfahren für länderübergreifende Projekte zu vereinfachen”. So wollen sie europäischen Start-ups ermöglichen, an Projekten zum digitalen und grünen Wandel teilzunehmen.
Ebenfalls am Montag kam der Präsidentenerlass von US-Präsident Joe Biden, der unter anderem vorsieht, dass bei Programmen, die potenziell gefährlich für die nationale Sicherheit, Wirtschaft oder Gesundheit werden könnten, die Entwickler die US-Regierung bereits beim Anlernen der KI-Modelle unterrichten müssen. Die Entwickler werden auch verpflichtet, die Ergebnisse von Sicherheitstests mit den Behörden zu teilen.
Die US-Regierung befürchtet unter anderem, dass mit KI gefährliche Schadsoftware oder auch biologische Waffen entwickelt werden könnten. Zum Testen von KI-Programmen sollen Standards festgelegt werden – und das Ministerium für Heimatschutz soll sie auch für kritische Infrastruktur anwenden. Globale Risiken von KI sollen in dieser Woche auch Thema beim AI-Safety-Summit in Großbritannien sein.
Biden will gleichzeitig den Einsatz von KI in der Regierung beschleunigen und so die USA als KI-Entwicklungsstandort stärken. Dafür sollen die Behörden mehr KI-Experten einstellen. Für Experten aus anderen Ländern soll es einfacher werden, in den USA zu arbeiten. vis

Die Europäische Union plant, die Länder des westlichen Balkans mit Investitionen von sechs Milliarden Euro bei den Reformen zu unterstützen, die für den EU-Beitritt erforderlich sind, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montag in der nordmazedonischen Hauptstadt Skopje.
Nordmazedonien, Albanien, Kosovo, Serbien, Montenegro und Bosnien und Herzegowina müssten das “Fenster der Gelegenheit” für die Erweiterung der EU nutzen. Nordmazedonien muss unter anderem eine effiziente öffentliche Verwaltung aufbauen und wie von Bulgarien gefordert die Verfassung ändern, um die Bulgaren als Minderheit anzuerkennen. Grundlage für die Reformen der Staaten ist der neue Wachstumsplan der EU für die Region.
“Diese Reformen werden mit Investitionen einhergehen”, sagte von der Leyen während einer Pressekonferenz mit dem nordmazedonischen Premierminister Dimitar Kovacevski zu Beginn ihrer Westbalkanreise.
Im weiteren Verlauf des Tages besuchte sie den Kosovo, wo sie das Land aufforderte, der serbischen Minderheit mehr Autonomie zu gewähren und einen Gemeindeverband zu gründen, der sich um sie kümmern soll. Serbien und Montenegro waren die ersten Länder in der Region, die EU-Beitrittsgespräche aufnahmen. Albanien und Nordmazedonien begannen im vergangenen Jahr Gespräche. Bosnien und der Kosovo hinken ihren Nachbarn in diesem Prozess jedoch noch weit hinterher. rtr

Mit 659 Millionen Euro soll der französische Batteriehersteller Verkor in einem Forschungs- und Entwicklungsprojekt unterstützt werden. Die EU-Kommission hat im Rahmen der EU-Beihilfevorschriften eine entsprechende französische Maßnahme genehmigt. Das Geld soll in die Erforschung und Entwicklung neuer Verfahren zur Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge fließen. Damit soll das Projekt bis Ende 2026 abgedeckt sein.
Das Vorhaben von Verkor wird sich laut Angaben der Kommission auf vier Schwerpunkte konzentrieren:
Die Maßnahme ist Teil des französischen Transformationsplans “France 2030”. Verkor wird mit weiteren, im September von Investoren generierten Geldern unter anderem den Bau einer ersten Gigafactory in Dunkerque und die Herstellung von Hochleistungsbatteriezellen mit niedrigem Kohlenstoffgehalt vorantreiben. leo

Der Plan eines Critical Raw Materials Club, mit dem die EU die Beschaffungsmöglichkeiten für kritische Rohstoffe diversifizieren will, ist laut einem neuen Forschungspapier des Jacques Delors Centres ein vielversprechendes Modell für eine erfolgreiche Rohstoffdiplomatie. Allerdings müsse die EU dafür glaubwürdige Anfangsfinanzierungen bei der Gründung des Clubs bereitstellen und ihr fragmentiertes
Modell der Entwicklungsfinanzierung straffen, heißt es darin. Das Papier wird heute veröffentlicht und lag Table.Media vorab vor.
Die EU-Kommission strebt mit dem Raw Materials Club an, ein kooperatives Forum für ressourcenreiche Länder und Verbraucherländer zu gründen, um die Kooperation in der Rohstoffpolitik zu verbessern, Investitionen anzuschieben und ressourcenreiche Länder in ihrem Ziel zu unterstützen, lokale Verarbeitungskapazitäten aufzubauen. Mit dem Club will sie die von den USA angeführte Minerals Security Partnership (MSP) ergänzen. Das erste Treffen soll noch in diesem Jahr stattfinden.
In dem Papier argumentiert der Autor Francesco Findeisen, ein Club mit einem hybriden Design, der mit freiwilligen Verpflichtungen, minimaler Struktur und einer begrenzten Mitgliederanzahl beginne und einen Prozess definiere, um sich in eine ambitioniertere und verbindliche Struktur zu entwickeln, sei das vielversprechendste Modell. Jedoch sei dieser Ansatz als solcher ungenügend. Um erfolgreich zu sein, müsse die EU glaubwürdige Anfangsfinanzierungen bei der Gründung des Clubs bereitstellen und ihr fragmentiertes Entwicklungsförderungsmodell rationalisieren. leo

Die EU-Kommission hat deutsche Beihilfen zur Unterstützung des Fischereisektors in Höhe von 20 Millionen Euro genehmigt. Die Gelder sollen vor den Auswirkungen des EU-Austritts des Vereinigten Königreichs schützen.
Ziel sei es, Fischereibetriebe für Einkommensverluste im Zusammenhang mit den Brexit-bedingten Kürzungen der Fischereiquoten zu entschädigen, erklärte die Kommission am Montag. Eigentümer von Fangschiffen mit einer Länge bis zu 24 Metern können für maximal 15 Prozent der geschätzten Einkommensverluste entschädigt werden. Besitzer längerer Schiffe haben Anspruch auf Entschädigung für maximal zehn Prozent der Einkommensverluste. Die Regelung läuft bis Ende des Jahres. luk

Die Slowakei hat mit Richard Takáč einen neuen Landwirtschaftsminister. Der 41-Jährige ist Teil der neuen Regierung unter Premierminister Robert Fico, teilt der Nachrichtendienst Agra Europe mit. Anfang Oktober hatte die SMER-SD unter ihrem Vorsitzenden Fico die Wahlen gewonnen. Takáč ist seit 2020 stellvertretender Vorsitzender der SMER-SD. Diese gilt als linkspopulistisch und -national sowie russlandfreundlich. Takáč ist seit 2020 Abgeordneter im Nationalrat der Slowakei. Zuvor soll er unter anderem als Geschäftsmann in der Möbelbranche tätig gewesen sein. Slowakischen Medienberichten zufolge ist er Absolvent der landwirtschaftlichen Universität in Nitra.
Die SMER-SD hat mit der von ihr vor drei Jahren abgespaltenen Hlas-SD sowie der rechtsradikalen SNS eine Koalition gebildet. Aufgrund der Zusammenarbeit mit der SNS hatte die Progressive Allianz der Sozialdemokraten (S&D) im Europaparlament kürzlich die drei Abgeordneten der SMER-SD aus ihren Reihen ausgeschlossen. Die vollständige Liste des slowakischen Kabinetts ist hier zu finden.
Beobachter in Brüssel befürchten, dass Fico mit seiner als prorussisch geltenden Regierung erneut ein Problemfall für die EU werden könnte. Fico war 2020 als Ministerpräsident nach der Affäre um den Mord an dem Investigativ-Journalisten Ján Kuciak und seiner Verlobten zurückgetreten. Kuciak war mafiösen Strukturen, die bis in die Regierung gereicht haben sollen, nachgegangen. Konkret ging es dabei auch um Betrügereien mit EU-Agrarbeihilfen im großen Stil.
Dem neuerdings für den Green Deal zuständigen geschäftsführenden Vizepräsidenten der EU-Kommission, dem Slowaken Maroš Šefčovič, wird eine Nähe zur SMER-SD nachgesagt. Als dieser bei der Präsidentenwahl 2019 angetreten war, erfolgte dies mit Unterstützung der SMER-SD. red

Wer wissen möchte, wo der Gesetzgebungsprozess in Sachen Künstlicher Intelligenz in Europa aktuell steht, der sollte Kai Zenner kennen. Wie kein anderer informiert er die interessierte Öffentlichkeit über LinkedIn, X und seinen Blog über den Fortgang des Dossiers und tritt auf unzähligen Veranstaltungen als Experte für die Regulierung von KI auf. Er versuche das Verfahren etwas transparenter zu machen, sagt er. Und macht sich damit nicht nur Freunde.
Seit August 2017 leitet Kai Zenner das Büro des Europaabgeordneten Axel Voss (EVP) in Brüssel und ist zugleich sein Berater für Digitalpolitik. “Wir sind seit 2017 überzeugt, dass KI massiven Einfluss auf unser Leben hat und haben wird”, sagt er. Das Ziel einer Regulierung sollte daher sein, die Gesellschaft vor Gefahren zu schützen, ohne zugleich Innovation zu stark zu hemmen. Und natürlich seien Voss und er überzeugt, “ein gutes Gespür und viele Ideen für diesen Mittelweg zu haben”.
Dass Zenner in der Digitalpolitik gelandet ist, war keineswegs von Beginn an ausgemacht. Auf das Thema ist er erst in Brüssel gestoßen, als er von 2015 bis 2017 Research Associate bei der Konrad-Adenauer-Stiftung war. Das war sein erster Job nach dem Studium und einigen Praktika – und wie er sagt, ein guter Abschluss für seine Ausbildung. Dort startete er die Eventserie Think digital!, seither hat ihn das Thema nicht mehr losgelassen. In dieser Zeit hat er auch Axel Voss kennengelernt, der seinerseits auf vielen Podien zum Thema Digitales und KI zu Gast war.
Kai Zenner ist 1985 in Oldenburg in Niedersachsen geboren und im beschaulichen Bad Zwischenahn aufgewachsen. Wenn er ein bisschen was erleben wollte, fuhr er als Teenager mit seinen Freunden nach Oldenburg. Sein erster kindlicher Berufswunsch war Banker, weil sein Großvater in einem Nachbarort eine Volksbankfiliale leitete. Doch bald fand er für sich eine andere Leidenschaft: “Politik und Geschichte haben mich immer sehr interessiert”, erinnert er sich. “Als Kind habe ich immer mal wieder alle Flaggen der Welt gemalt und alles sehr systematisch aufgedröselt.” Auch die Gespräche über Geschichte mit seinen Großeltern haben ihn inspiriert und die Geschichtsbücher, die er las.
Nach dem Abitur mit Leistungskurs Geschichte begann er 2005 sein Politikstudium in Bremen. “Für mich war eigentlich immer klar, dass ich etwas mit Politik machen möchte”, sagt Zenner. Noch lieber hätte er zwar Geschichte studiert, aber damals seien die Verhältnisse am Arbeitsmarkt so ungünstig gewesen, dass es schwer geworden wäre, dort einen guten Job zu finden. Und Bremen war ideal für ihn: ein Stück weit weg von zu Hause, aber nicht zu weit. “Ich spiele immer ein bisschen auf Sicherheit”, erklärt er. “Ich schaue mir eine Sache erst einmal an und erst, wenn ich sicher bin, traue ich mir Dinge zu.”
Dem Bachelor in Politik folgte der Wechsel nach Freiburg zum Jurastudium, um seinen Lebenslauf etwas interessanter zu gestalten, wie er sagt. “Freiburg war der große Wurf, weiter weg von meinem Heimatdorf ging es eigentlich in Deutschland nicht.” Es seien mit die schönsten zwei Jahre seines Lebens gewesen. Dennoch wechselte er nach der Zwischenprüfung nach Münster, wo er Europarecht und Völkerrecht als Schwerpunkte wählen konnte. “Das war genau das, was mich hauptsächlich an Jura interessiert hatte.” Richter oder Anwalt zu werden, sei für ihn nie infrage gekommen.
Sein Politikstudium schloss Zenner während eines Auslandsjahres an der Universität Edinburgh in Schottland mit einem Master in International Relations mit Schwerpunkt auf Sicherheitsstudien, Außenpolitik und internationalem Recht ab. Seine Masterarbeit schrieb er über Ausnahmezustände in der Geschichte. Sein Doppelstudium habe viel Zeit in Anspruch genommen, aber: “In meinem Berufsalltag hat es mit sehr geholfen, dass ich mit Jura und Politik zwei Standbeine habe”, erzählt er rückblickend.
Bei diversen Praktika während des Studiums und auch danach testete er weiter, was ihm gefällt und was nicht – auch, um die für ihn so wichtige Sicherheit zu gewinnen. Gefallen haben ihm das Praktikum beim CDU-Bundestagsabgeordneten Thomas Kossenday und beim Bundespresseamt. “Die haben mich vollends überzeugt, dass ich im politischen Umfeld aktiv sein möchte.”
Bei seiner Arbeit braucht Zenner viel Freiraum. Ein Chef, der ihm Leitlinien setzt und ihn dann machen lässt, was er für richtig hält, “das sind für mich die besten Chefs. Unter diesen Chefs blühe ich auf“, sagt er. Axel Voss sei so ein Chef. In der Brasserie London auf dem Place du Luxembourg unweit des EU-Parlaments fand 2017 das Bewerbungsgespräch statt. “Wir haben zwei Stunden gesprochen”, erinnert er sich. “Ich fand es toll, weil er mir auf Augenhöhe begegnet ist.”
Und dann ging die Arbeit am Thema KI bald los, lange bevor die Kommission 2021 ihren Vorschlag zum AI Act vorlegte. Im Wahlkampf 2019 schrieb Kai Zenner ein digitales Manifesto. “Da haben Axel Voss und ich Vorschläge gemacht, wo die neue Kommission unter Ursula von der Leyen digitalpolitisch tätig werden sollte.” Es folgte im Rechtsausschuss der Initiativbericht zu Künstlicher Intelligenz, der AIDA-Sonderausschuss, die Arbeit an der KI-Haftung und vieles mehr.
Auch für das kommende Mandat hat Zenner Pläne – wenn es denn auch diesmal gelingt, dass Axel Voss wieder ins EU-Parlament einzieht. Die geplante ePrivacy-Verordnung oder gegebenenfalls eine Revision der DSGVO, das Gesetz über kollektive Sammelklagen sowie die neue KI-Haftungsrichtlinie, “das sind die Themen, für die wir brennen”, sagt er. “Deswegen sehen wir unsere Mission noch nicht als beendet an.”
Viel Nachdenken über das kommende Mandat tut er allerdings noch nicht: Im Moment gebe er 200 Prozent für die Verhandlungen zum AI Act, um sie noch in diesem Jahr abschließen zu können. 2023 erhielt er die Auszeichnung als “Best MEP Assistent” für seinen weit über seine Pflichten hinausgehenden Einsatz. Für seine Frau und seinen zweijährigen Sohn bleibe da im Moment wenig Zeit, für Freunde oder Hobbys so gut wie gar keine.
Ob er sich vorstellen kann, anstatt Assistent zu sein, selbst einmal Politiker zu werden? “Deutscher Europaabgeordneter zu werden, wäre eine spannende Option”, meint er. Allerdings müsste er dafür in einem Wahlkreis leben und ständig zwischen Deutschland und Brüssel pendeln. “Das kann ich mir aktuell nicht vorstellen: Brüssel ist für mich und meine Familie der Lebensmittelpunkt.” Corinna Visser
