dieser Tage reisen viele Politiker in den Nahen Osten, um zu einer Lösung für den Gaza-Krieg beizutragen und auch, um endlich eine Freilassung der Geiseln zu erreichen. So war der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Sonntag in Katar und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Jordanien. Es gibt Anzeichen dafür, dass sich in der Frage der Geiseln etwas bewegt.
Am heutigen Montag ist von der Leyen in einer anderen Mission unterwegs. Sie wird, wie auch die Staats- und Regierungschefs zahlreicher afrikanischer Staaten, zum Afrika-Gipfel in Berlin erwartet. Hauptthemen der Konferenz Compact with Africa sind die Stärkung privater Investitionen auf dem Kontinent und die Zusammenarbeit bei nachhaltiger Energieversorgung. Compact with Africa geht auf eine Initiative Deutschlands während seines G20-Vorsitzes im Jahr 2017 zurück.
Zu dem Gipfel reisen neben von der Leyen auch EU-Ratspräsident Charles Michel, Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron und der niederländische Regierungschef Mark Rutte nach Berlin. Wie es heißt, will Bundeskanzler Olaf Scholz die Konferenz auch zu bilateralen Gesprächen mit einzelnen Staats- und Regierungschefs nutzen. Meine Kollegen vom Africa.Table planen zu Compact with Africa eine gesonderte Berichterstattung.
Um Nachhaltigkeit geht es diese Woche auch bei einigen Abstimmungen im Europäischen Parlament während der Sitzungswoche in Straßburg, wie meine Kollegin und Kollegen Leonie Düngefeld, Markus Grabitz und Lukas Scheid berichten.
Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche,

Am Mittwoch wird sich die Arbeitsgruppe Parlament 2024 zu ihrer Abschlusssitzung treffen. Parlamentspräsidentin Roberta Metsola hatte die Arbeitsgruppe im Frühjahr ins Leben gerufen. Sie tagte bislang 17 Mal. Ziel der Arbeitsgruppe ist es, sich auf Reformen in fünf Bereichen zu verständigen.
Die Fraktionschefs (Konferenz der Präsidenten) sollen, so der Plan, die Reformen in einer Sitzung vor der Dezember-Plenarwoche beschließen. Dann würde die informelle Arbeitsgruppe zur Geschäftsordnung des Parlaments den Auftrag bekommen, mit Unterstützung der Parlamentsverwaltung die Ergebnisse in einen Bericht zu kleiden. Dieser Arbeitsgruppe gehören unter anderem Vize-Präsident Rainer Wieland (CDU), Gaby Bischoff (SPD) und Helmut Scholz (Linke) an. Der Bericht soll vom Verfassungsausschuss (AFCO) beraten und bis zur letzten Sitzungswoche vor der Wahl Ende April vom Plenum beschlossen werden.
Die Reformvorschläge im Einzelnen:
Die Gesetzgebungsarbeit in den 20 ständigen Fachausschüssen des Europaparlaments soll schneller werden. Daher sollen künftig nicht mehr so viele beratende Ausschüsse beteiligt werden. Für beteiligte, nicht federführende Ausschüsse soll eine neue Form der Stellungnahme entwickelt werden. Ein Ausschuss soll nur beteiligt werden, wenn er wesentliche Kompetenzen für ein Dossier hat. Der Berichterstatter eines beteiligten, nicht federführenden Ausschusses soll an Treffen der Schattenberichterstatter und Vorbereitungstreffen von Trilogen teilnehmen. Der federführende Ausschuss soll verpflichtet werden, Amendments der mit beratenden Ausschüsse abzustimmen. Beteiligte, nicht federführende Ausschüsse sollen die Möglichkeit bekommen, abgelehnte Anträge wieder im Plenum zur Abstimmung zu stellen.
Diskutiert wird bei der Gesetzgebung auch, das Vorgehen bei gemeinsamen Ausschüssen (joint commitees) zu ändern. Künftig sollen höchstens drei Ausschüsse beteiligt werden, ohne dass ein Ausschuss die Federführung bekommt. Bislang gibt es Co-Vorsitzende. Das soll abgeschafft werden zugunsten eines Vorsitzes, der von Sitzung zu Sitzung wechselt. Von jedem Ausschuss soll ein Berichterstatter benannt werden.
Das Vorhaben, einen Ad-hoc-Ausschuss einzusetzen, stößt auf Widerstand in den Fraktionen. Der Ad-hoc-Ausschuss soll gebildet werden, wenn bei komplizierten Dossiers der Querschnittgesetzgebung mehr als drei Ausschüsse beteiligt sind. Ausschussvorsitzende und AFCO-Mitglieder befürchten, dass der Ad-hoc-Ausschuss zum Standard würde. Der Vorschlag des Generalsekretariats für einen neuen Zuschnitt der Ausschüsse gilt ebenfalls als chancenlos. Führende Vertreter des Parlaments kritisieren hinter vorgehaltener Hand, dass die Verwaltung damit ihre Kompetenzen überschritten habe. Er werde nicht weiter verfolgt.
Triloge sind inoffizielle Vermittlungsverfahren zwischen den Co-Gesetzgebern Parlament und Rat unter Beteiligung der Kommission. Das reguläre Vermittlungsverfahren wurde das letzte Mal vor zwölf Jahren angewendet. Triloge sind mittlerweile Standard. Versuche, das formelle Vermittlungsverfahren wiederzubeleben, dürften keinen Erfolg haben. Es soll Richtlinien für Triloge geben, die von der Konferenz der Ausschussvorsitzenden erarbeitet werden. Es soll Regeln für “Technische Meetings” (ITMs) geben wie etwa:
Es soll Obergrenzen bei der Anzahl von Mitgliedern der Verhandlungsgruppen bei Trilogen seitens des Parlaments geben. Es sollen Regeln aufgestellt werden, wann Mitglieder der Verhandlungsgruppen in Trilogen das Wort ergreifen dürfen. Zumindest in der Schlussphase von Trilogen soll der Rat den Fachminister schicken, der zuständige Kommissar soll ebenfalls dabei sein. Der zuständige Ausschussvorsitzende soll die Verhandlungen in der Schlussphase überwachen. Bislang kam es vor, dass Trilogdeals unter vier oder sechs Augen in “Auszeiten” geschmiedet wurden. Um dies zu verhindern, soll es Regeln für Auszeiten geben. Deals mit dem Rat außerhalb von Trilogverhandlungen sollen ausgeschlossen werden.
Die überwachende und kontrollierende Rolle des Parlaments (Scrutiny) soll gestärkt werden. Es soll “special scrutiny hearings” geben. So soll das Parlament die Gelegenheit bekommen, auf Ereignisse von politischer Bedeutung schneller zu reagieren. Die Fraktionschefs sollen entscheiden, wann die “special scrutiny hearings” angesetzt werden. Es soll dafür spezielle Räume geben, auch für die Bekanntgabe von vertraulichen Informationen.
Die Kommission wird aufgefordert, bei der Erstellung ihres Arbeitsprogramms Hinweise zu den Auswirkungen auf den EU-Haushalt zu geben. Die Kommission soll Gesetzgebungsvorschläge direkt nach der Annahme im College im Plenum vorstellen. Dies gilt unter der Voraussetzung, dass die Folgenabschätzung schon vorliegt.
Das Parlament beansprucht mehr Mitsprache beim Zuschnitt der Portfolios der Kommissare. Der gewählte Kommissionspräsident soll die Struktur seiner Kommission mit dem Parlament absprechen. Die Regeln für die Anhörungen der Kandidaten für die Kommission sollen verändert werden.
Bei der Kontrolle des EU-Haushalts und des Mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) soll der Haushaltsausschuss (BUDG) neue Kompetenzen bekommen. Dafür soll eine neue eigenständige Regel geschaffen werden neben den bestehenden allgemeinen Regeln für die Zusammenarbeit zwischen Gesetzgebungsausschüssen. Die Kontroll- und Entlastungsfunktionen des Parlaments sollen qualitativ gestärkt werden. Sollte das Parlament die Entlastung verweigern oder zeitlich verschieben, sollen die daraus folgenden Konsequenzen konkreter formuliert werden.
Das Plenum soll attraktiver werden. Dafür sollen Änderungen der Tagesordnung in letzter Minute reduziert werden. Ebenso die Zahl der Resolutionen, die am Donnerstag abgestimmt werden. Neue Tagesordnungspunkte sollen nicht vor 9 und nach 22 Uhr aufgesetzt werden. Debatten sollen nicht mehr nach 22 Uhr stattfinden. Im Plenum sollen häufiger wichtige Debatten (“key debates”) angesetzt werden. Währenddessen sollen konkurrierende Sitzungen etwa der Fraktionen, der Fraktionschefs, der Chefs der Ausschüsse und des Präsidiums sowie Triloge begrenzt werden. Weitere Vorschläge:
Die Außenbeziehungen des Parlaments sollen reformiert werden. Bei den Beziehungen zu Nicht-EU-Ländern soll das Parlament Abschied nehmen vom Ansatz der Parlamentsgremien (“parliamentary-body-based” approach) zugunsten eines länderbezogenen Ansatzes (“country-based” approach). Die Zahl der Delegationen und ihre Zusammenarbeit mit den Ausschüssen soll überprüft werden.

Die Parteispitze der Linken kann den Parteitag als Erfolg für sich und ihren Kurs verbuchen. Das Europa-Wahlprogramm wurde mit großer Mehrheit beschlossen. Die meisten Änderungsanträge hatte der Vorstand bereits im Vorfeld ausgeräumt, über den Rest beschieden die Delegierten zumeist zugunsten des Entwurfs. Die Forderung für einen gesetzlichen Mindestlohn in Deutschland wurde auf Antrag der Delegierten von 14 auf 15 Euro angehoben und ein automatischer Inflationsausgleich ins Programm mit aufgenommen.
Die Delegierten wählten den Parteivorsitzenden Martin Schirdewan mit fast 87 Prozent erneut zum Spitzenkandidaten für die Europawahl. Er sieht seine Partei geschlossen. Das macht er auch daran fest, dass der Name Sahra Wagenknecht kaum fiel. Sie hatte im September mit einigen Anhängern die Linke verlassen und bereitet die Gründung einer eigenen Partei vor. “Es gibt einen kämpferischen Geist für die Erneuerung, aber auch die Stärkung dieser Partei. Wir wollen gute Ergebnisse erzielen”, sagte Schirdewan zu Table.Media.
Auch die Vorschläge des Parteivorstands für die Kandidatenliste wurden von den Delegierten angenommen. Auf Platz zwei steht die Klima- und Flüchtlingsaktivistin Carola Rackete, die als Parteilose für die Linke antritt. Sie bekam fast 78 Prozent der Stimmen. Die Gewerkschafterin Özlem Demirel tritt auf Platz drei an und der ebenfalls parteilose Aktivist und Arzt Gerhard Trabert, konnte mit 96 Prozent auf Platz 4 ein besseres Ergebnis holen als der Parteivorsitzende. Die Journalistin Ines Schwerdtner aus Sachsen-Anhalt konnte sich Platz 5 sichern. Bei der Europawahl 2019 erreichte die Linke 5,5 Prozent der Stimmen und fünf Mandate.
Sich von einer Wagenknecht-Partei abzusetzen, die eventuell ebenfalls bei der Europawahl antritt, wird der Linken mit ihrem Programm nicht schwerfallen. Sie spricht sich deutlich gegen Abschottung und für Klimaschutz aus. Themen, bei denen Wagenknecht einen eher konservativen Kurs fährt.
Viel mehr wird es eine Herausforderung für die Vorsitzenden, die ganze Linkspartei hinter ihrem Programm zu versammeln. Denn obwohl die Konflikte der verschiedenen Parteiströmungen beim Parteitag nicht offen ausbrachen, fremdeln einige Landesverbände – besonders in Ostdeutschland – weiterhin mit der Erneuerung. Sie befürchten, dass die Linke eine Mischung aus Grünen und SPD werden könnte. Für diesen Konflikt steht die Spitzenkandidatin Carola Rackete, die vor allem ein urbanes linkes Milieu anspricht, aber auf dem Land in Sachsen oder Sachsen-Anhalt, mit vielen alteingesessenen Mitgliedern, auf Skepsis stößt.
Auf die Frage, wie sie mit der Kluft im Zuspruch der Partei umgehen wolle, sagte Rackete zu Table.Media: “Wenn man praktisch zusammenarbeitet und sich kennenlernt, sind die Vorurteile schnell ausgeräumt.” Nach dem Parteitag in Sachsen sei sie in den vergangenen Wochen in der Lausitz unterwegs gewesen. Dort ginge es vor allem darum, dass die EU-Gelder für den Strukturwandel auch ankommen. “Die werden an die Bundesregierung überwiesen und 15 Prozent davon gehen gerade in die Lausitz. Da trifft Kommunalpolitik konkret auf Europapolitik.”
Im Wahlprogramm gehe es immer um die Frage, wie Klimaschutz sozial gerecht ausgestaltet werden könne. Große Konzerne will die Linke entmachten. Als Beispiel nennt Rackete das Verbot der sogenannten “Share-Deals”, die die Linke verbieten will. “Eigentlich dürfen nur Landwirte Äcker kaufen, aber indem Konzerne per Share-Deal in Bauernhöfe investieren, erhalten sie auch das Recht dazu”, sagt Rackete. “Sie treiben damit gerade die Pachtpreise in einigen Regionen in die Höhe. In Ostdeutschland haben sich die Preise in den letzten 15 Jahre verdoppelt.”
Auch Schirdewan betont, das Thema soziale Gerechtigkeit als Kernthema der Linken durchziehe das gesamte Programm. Aber man müsse damit gleichzeitig die großen Fragen der Klimakrise beantworten. Es brauche einen Umbau der Industrie in klimaneutrale Wirtschaft. Die Linke fordert dafür ein großes Investitionsprogramm. “Das ist nicht zu viel”, sagt Schirdewan. “Das sind genau die Antworten, die wir in dieser gesellschaftlichen Situation geben müssen.” Als Hauptgegner im Wahlkampf machten alle Spitzenkandidaten die rechten Parteien aus.


Der europäische Green Deal ist ein Paket politischer Initiativen, mit dem die EU ihr Ziel erreichen und bis 2050 klimaneutral sein will. Einige Gesetzesvorschläge aus diesem Paket stehen in dieser Woche im Plenum des Europaparlaments in Straßburg zur Abstimmung:
Der Net Zero Industry Act (NZIA) ist die europäische Reaktion auf den US-amerikanischen Inflation Reduction Act (IRA). Ziel des Gesetzesvorhabens ist, die Technologien für die Dekarbonisierung in Europa zu industrialisieren. 40 Prozent der Null-Emissions-Technologien sollen hier produziert werden und einen globalen Marktanteil von 25 Prozent an diesen Technologien erobern.
Am Dienstag stimmt das EU-Parlament über seine Position ab, sodass noch in diesem Monat die Trilog-Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten beginnen können. Das Thema hat vor allem deshalb Eile, weil der NZIA eine Abwanderungswelle europäischer Unternehmen in die USA verhindern soll, wegen der Steuererleichterungen, die der IRA bietet.
Überraschungen werden bei der Abstimmung im Parlament nicht erwartet, da die drei großen Fraktionen EVP, S&D und Renew im Industrieausschuss einen Deal ausgehandelt haben, der eine komfortable Mehrheit im Plenum bekommen dürfte. Im Trilog könnten einige Punkte des NZIA allerdings noch mal etwas kontroverser diskutiert werden.
Die Abstimmung am Mittwoch zur Verordnung zum nachhaltigen Einsatz von Pflanzenschutzmitteln (SUR) – auch bekannt als Pestizide-Verordnung – ist dagegen noch lange nicht ausgemacht. Strittig ist zum einen, um wie viel Prozent die Mitgliedstaaten den Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln absenken müssen und in welchem Zeitraum. Zum anderen geht es um die Frage, ob in Schutzgebieten ein Totalverbot von Pflanzenschutzmitteln kommt. Die EVP versucht, Koalitionen mit Teilen von Renew und Sozialdemokraten zu schmieden, um die Position des Umweltausschusses (ENVI) in den beiden strittigen Fragen abzuändern.
ENVI ist für ein Verbot von chemischen Pflanzenschutzmitteln in allen Natura-2000 und FFH-Schutzgebieten sowie in Parks, auf Spielplätzen und sonstigen Flächen, wo sich auch Kinder, Alte und Kranke aufhalten. Erlaubt wären nur noch biologische Pflanzenschutzmittel und solche Mittel, die auch im Ökolandbau eingesetzt werden dürfen. Die Mitgliedstaaten sollen allerdings über Ausnahmen in besonderen Fällen verfügen können.
Diese Position könnte einschneidende Folgen für die Landwirte gerade in Deutschland haben, da zahlreiche Schutzgebiete für die intensive Landwirtschaft genutzt und dort bislang Pestizide eingesetzt werden. Die EVP will deshalb die Natura-2000- und FFH-Vogelschutzgebiete von dem Verbot für chemische Pestizide ausnehmen.
ENVI will zudem den Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln bis 2030 halbieren. Dagegen formiert sich ebenfalls Widerstand. Im Plenum dürfte zur Abstimmung gestellt werden, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln bis 2035, also fünf Jahre später, nicht um 50 Prozent zu reduzieren, sondern nur “mindestens um 35 Prozent” und bezogen auf den Zeitraum 2011 bis 2013. Die Mitgliedstaaten sollen die Möglichkeit haben, das individuelle Ziel zu erhöhen.
Ebenfalls am Mittwoch stimmt das Parlament über die Verpackungsverordnung ab, eines der Gesetzesverfahren mit obskuren Lobbykampagnen und überdramatisierenden Medienberichten. Die deutschen Bierkästen, die französischen Camembert-Holzschachteln und die kleinen Zuckertüten, die zum Heißgetränk in Cafés serviert werden – wegen der kleinteiligen Bestimmungen der Verordnung ranken sich Befürchtungen um allerlei Verbote. Der Höhepunkt der Lobbyaktionen war wohl erreicht, als vergangene Woche Schilder an den Türen der Abgeordnetenbüros in Brüssel angebracht wurden, die vor dem Untergang der Coffee-to-go-Becher warnten.
Ziel der Verordnung ist, unnötige Verpackungen zu verbieten oder zu minimieren, Einwegverpackungen zu verhindern und Mehrwegsysteme zu fördern. Jede Verpackung soll ab 2030 recycelbar sein. Vor der finalen Abstimmung müssen die Parlamentarier noch über an die hundert Änderungsanträge abstimmen. Es bleiben also noch viele offene Fragen, etwa zu Einwegprodukten in der Gastronomie oder zu Ausnahmen für bestimmte Produkte.
Am Dienstag stimmt das Parlament über die Position zu CO₂-Flottengrenzwerten für schwere Nutzfahrzeuge ab. Es wird versucht, die Verschärfungen des Umweltausschusses (ENVI) gegenüber dem Kommissionsvorschlag zurückzunehmen und eine Öffnung für synthetische Kraftstoffe sowie die Anrechnung von CO₂-neutralen Kraftstoffen im Rechtstext zu erreichen. Es wird mit einem knappen Ausgang der Abstimmung gerechnet.
Am Dienstag stimmt das Plenum ebenfalls über die Richtlinie zum Recht auf Reparatur ab. In seinem Bericht fordert der Binnenmarktausschuss (IMCO), Verkäufer zu verpflichten, innerhalb der gesetzlichen Garantiezeit eine kostenlose Reparatur anzubieten. Es sei denn, sie ist teurer als ein Austausch, sie ist faktisch unmöglich oder sie ist für den Verbraucher unpraktisch. Darüber hinaus sollen Anreize für die Verbraucher geschaffen werden, innerhalb der Gewährleistungsfrist die Reparatur dem Ersatz vorzuziehen, so etwa die Verlängerung der gesetzlichen Garantie um ein Jahr für reparierte Produkte. Die Mitgliedstaaten sollen die Reparatur durch finanzielle Anreize wie Gutscheine und nationale Reparaturfonds fördern.
Ebenfalls auf der Agenda des Novemberplenums ist die Abstimmung am Dienstag über die COP28-Resolution, die die Erwartungen des EU-Parlaments an die UN-Klimakonferenz in Dubai widerspiegelt. Auch der Zertifizierungsrahmen für CO₂-Entnahmen wird am Dienstag abgestimmt. Dabei geht es um die Frage, welche Formen der CO₂-Entnahmen als dauerhaft gelten und ob Unternehmen sich klimaneutral nennen dürfen, wenn ihre neutrale CO₂-Bilanz auf CO₂-Offsets beruht.
EU-Parlament, Rat und Kommission haben sich im Trilog auf politischer Ebene über die Überarbeitung der Abfallverbringungsverordnung geeinigt. Die neuen Vorschriften sollen sicherstellen, dass die EU mehr Verantwortung für ihre Abfälle übernimmt und ihre ökologischen Herausforderungen nicht in Drittländer exportiert, erklärte die Kommission. Sie sollen auch die Nutzung von Abfällen als Ressource erleichtern.
Der Export von Kunststoffabfällen aus der EU in Nicht-OECD-Länder wird verboten, mit Ausnahmen unter strengen Bedingungen. Andere, für das Recycling geeignete Abfälle, werden nur dann aus der EU in Nicht-OECD-Länder ausgeführt, wenn sicher ist, dass diese nachhaltig damit umgehen können. Digitalisierte Verfahren sollen es erleichtern, Abfälle zum Recycling innerhalb der EU zu verbringen.
Auch die Durchsetzung und Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des illegalen Handels mit Abfällen wird verstärkt. Die Verordnung soll die neue Richtlinie über den strafrechtlichen Schutz der Umwelt ergänzen, über die sich die EU-Institutionen Ende vergangener Woche ebenfalls geeinigt haben.
Die derzeit geltende Abfallverbringungsverordnung stammt aus dem Jahr 2006. Seitdem sind die Ausfuhren von Abfällen aus der EU in Drittländer erheblich gestiegen, insbesondere in Nicht-OECD-Länder.
Das Europäische Parlament und der Rat müssen die Verordnung nun noch förmlich annehmen. 20 Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt tritt sie dann in Kraft. leo
Die EU-Botschafter haben am Freitag der Ratsposition für den Zertifizierungsrahmen für CO₂-Entnahmen zugestimmt. Die Bundesregierung hat trotz einiger Vorbehalte gegen den Vorschlag der spanischen Ratspräsidentschaft zugestimmt, jedoch eine Protokollnotiz eingebracht. Diese Zusatzerklärung, die Table.Media vorliegt, legt die Probleme Deutschlands mit dem derzeitigen Text dar.
Demnach hält die Bundesregierung insbesondere die derzeitige Regelung in der Ratsposition über CO₂-Entnahmen durch Biomasse für problematisch. Sie fordert, dass die Treibhausgas-Bilanzierung von Biomassenutzung auch die Emissionen aus Anbau, Ernte, Verarbeitung und Transport von Biomasse einbezieht. Der derzeitige Ratstext legt lediglich fest, dass Emissionen bei der Verbrennung berücksichtigt werden.
Sollten die Emissionen bei der Verbrennung abgeschieden und gespeichert werden, wäre die Treibhausgas-Bilanz auf dem Papier negativ. Es würde also so aussehen, dass der Atmosphäre CO₂ entzogen worden wäre. Faktisch wäre durch die Biomassenutzung allerdings keine Mehrentnahme erfolgt. Die Bundesregierung fürchtet dadurch Fehlanreize für die Biomassenutzung und mangelnde Integrität der CO₂-Entnahmezertifikate.
Für eine entsprechende Änderung des Ratstexts im Sinne Deutschlands hat es offenbar keine Mehrheit gegeben, weshalb die Bundesregierung die Protokollerklärung eingebracht hat. Der Ministerrat muss dem Text noch formal zustimmen. Das EU-Parlament stimmt am Dienstag über seine Position ab, sodass die Trilog-Verhandlungen noch im November beginnen können. luk
Bei seinem Besuch in Peking hat EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra den chinesischen Klimabeauftragten Xie Zhenhua indirekt aufgefordert, sich an der Finanzierung von durch den Klimawandel verursachten Schäden und Verlusten (Loss & Damage) zu beteiligen. Alle Parteien, die einen Beitrag zur Klimafinanzierung leisten können, sollten dies tun, betonte Hoekstra nach eigenen Angaben in dem Gespräch. Dies gelte insbesondere für den Fonds für Loss & Damage. Er habe auch an die Rolle der EU als weltweit größter Geber internationaler Klimafinanzierung erinnert, heißt es.
Westliche Industrieländer verlangen schon länger, dass große Emittenten wie China oder Öl- und Gas-produzierende Länder sich an der internationalen Klimafinanzierung beteiligen. China ist gemessen an den kumulierten CO₂-Emissionen seit der Industrialisierung bereits jetzt der drittgrößte CO₂-Emittent – nach den USA und den EU-Staaten. Voraussichtlich 2025 wird China die EU jedoch überholen, wodurch die Rufe nach einer Beteiligung Chinas immer lauter werden.
Auf der COP28 will die EU sich dafür einsetzen, dass neue Geldquellen für die Klimafinanzierung ausgemacht werden. Wer in den Fonds für Loss & Damage einzahlt, gilt als eines der heikelsten Themen der Verhandlungen in Dubai. luk
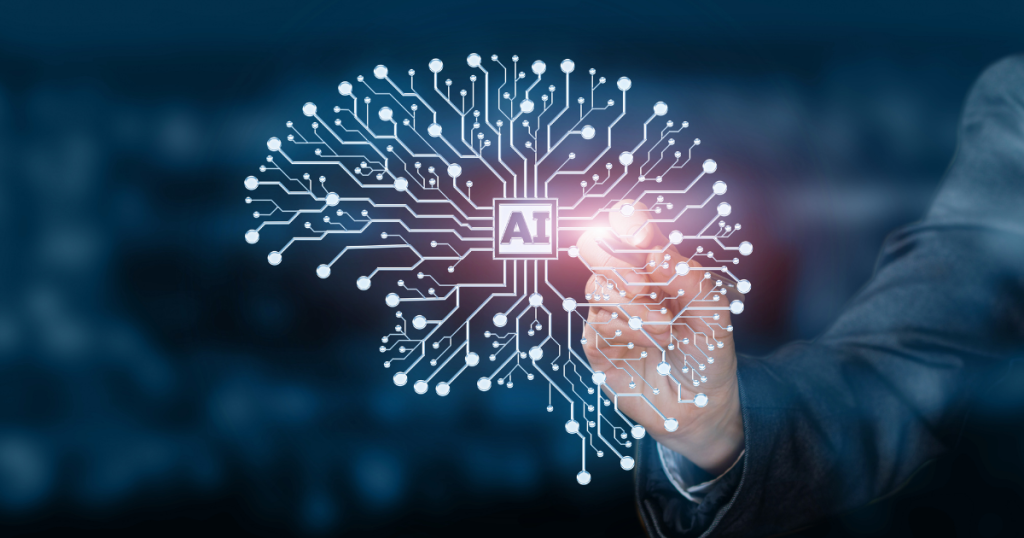
Deutschland, Frankreich und Italien haben sich auf eine gemeinsame Position zur Behandlung von Basismodellen (Foundation Models) und allgemeinen KI-Systemen (GPAI) im AI Act verständigt. Wichtigster Punkt: Bei Foundation Models lehnen die drei Länder eine gesetzliche Regulierung ab. Statt unerprobte Gesetze einzuführen, schlagen sie für die Zwischenzeit eine “verpflichtende Selbstregulierung durch Verhaltenskodizes” vor. Das geht aus einem Non-Paper der drei Länder hervor, das Table.Media vorliegt.
Derzeit verhandeln EU-Kommission, Parlament und Rat den AI Act im Trilog. Es soll die weltweit erste gesetzliche Regulierung Künstlicher Intelligenz werden, darum gibt es hier noch keine Vorbilder. Weil Deutschland, Frankreich und Italien die von der Kommission vorgeschlagene Regulierung von Foundation Models und GPAI ablehnten, war es zuletzt zum Abbruch der Verhandlungen gekommen. Das Parlament, das Foundations Models und GPAI in den AI Act einbeziehen will, wollte den zweistufigen Ansatz der Kommission mittragen.
Das Trio schlägt nun statt harter Regulierung vor, dass die Verhaltenskodizes den auf G7-Ebene im Hiroshima-Prozess definierten Prinzipien folgen könnten. Dies gewährleiste die notwendige Transparenz und den Informationsfluss in der Wertschöpfungskette sowie die Sicherheit der Grundmodelle gegen Missbrauch, heißt es in dem Non-Paper.
Insgesamt fordern die Länder, Definitionen und Abgrenzungen besondere Aufmerksamkeit zu schenken. “Wir sollten eine gründliche Diskussion zu diesem Thema fortsetzen.” Demnach sind sie überzeugt, dass eine Regulierung allgemeiner KI-Systeme dem risikobasierten Ansatz des AI Acts mehr entspreche. Die Risiken lägen hier eher in der Anwendung von KI-Systemen als in der Technologie selbst.
Jedoch wären Entwickler von Foundation Models bei dem Vorschlag der drei Länder verpflichtet, Model Cards zu definieren. Model Cards sind eine Art Beipackzettel, die in strukturierter Form Auskunft über Leistungsmerkmale des jeweiligen KI-Models geben sollen. Beispiele für solche Leistungsmerkmale seien: Anzahl der Parameter, vorgesehene Verwendung und potenzielle Einschränkungen, Ergebnisse von Studien zu Vorurteilen, Red-Teaming für Sicherheitsbewertungen.
Die Länder schlagen außerdem ein KI-Governance-Gremium vor. Das könne helfen, Richtlinien zu entwickeln und die Anwendung von Model Cards überprüfen.
Anfangs soll es bei Verstößen keine Sanktionen geben. Nach einer Beobachtungsphase könne dann ein Sanktionssystem eingerichtet werden, “das auf einer angemessenen Analyse und Bewertung der identifizierten Fehler und der besten Vorgehensweise zu deren Behebung basiert”. vis
Apple wehrt sich gegen die Einstufung seiner Plattformdienste als Torwächter (Gatekeeper) im Sinne das Digital Markets Act (DMA). Das Unternehmen habe Klagen gegen Entscheidungen der EU-Kommission eingereicht, teilte der Gerichtshof der Europäischen Union in einem Beitrag auf X mit.
Im September hatte die Kommission 22 Gatekeeper-Dienste designiert, die von sechs Technologieunternehmen betrieben werden: Microsoft, Apple, Google (Alphabet), Amazon, Meta und TikTok (ByteDance).
Zwar veröffentlichte der Gerichtshof keine Einzelheiten der rechtlichen Anfechtung von Apple. Bloomberg News berichtete jedoch vergangene Woche, dass das Unternehmen die Aufnahme seines App Store in die Liste der Gatekeeper anfechten würde.
Auch Meta und TikTok hatten bereits Berufung gegen die Entscheidung der Kommission eingelegt, ihre Dienste aufzunehmen. In seinem Einspruch erklärte Meta, dass es mit der Entscheidung der Kommission, seine Messenger- und Marketplace-Dienste unter das DMA zu stellen, nicht einverstanden sei. Die Einbeziehung von Facebook, Whatsapp oder Instagram focht Meta nicht an.
TikTok erklärte, seine Plattform, “die seit etwas mehr als fünf Jahren in Europa tätig ist, ist weit davon entfernt, ein Torwächter zu sein, und ist wohl der fähigste Herausforderer der etablierten Plattformunternehmen”.
Microsoft und Google erklärten, die Entscheidung nicht anfechten zu wollen. Die Einspruchsfrist ist am 16. November abgelaufen. rtr
Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat schlagartig die Bedrohung westlicher Gesellschaften durch Cyberangriffe deutlich gemacht. Diese Entwicklung mache ein besseres Verständnis der digitalen Bedrohungslandschaft erforderlich, mit der die EU konfrontiert sei, schreiben die Forscher des Centrums für Europäische Politik (cep) in einer aktuellen Studie zu Social Media in der Geopolitik, die Table.Media vorliegt.
So drohe der globale Kampf um kritische Rohstoffe inzwischen auch auf Social-Media-Plattformen wie X ausgetragen zu werden. Mögliche Waffen seien Desinformation, Fake News und Propaganda, schreibt das cep.
“Europa will strategisch unabhängiger werden. Gezielte Falschinformationen und Unwahrheiten im digitalen Raum bedrohen die geplante Rohstoffstrategie der Europäischen Union“, sagt cep-Ökonom André Wolf. Soziale Medien böten ein ideales Einfallstor für Manipulation.
Wolf hat zusammen mit cep-Digitalexperte Anselm Küsters einen großen Daten-Pool auf X untersucht, der nach eigenen Angaben insgesamt rund vier Millionen Tweets mit 126 Millionen Wörtern umfasste, die in einem Zeitraum zwischen 2012 und 2022 verfasst wurden. Im Mittelpunkt standen besonders reichweitenstarke Tweets über kritische Rohstoffe, wie sie die EU definiert, sowie Nachrichten der wichtigsten 234 internationalen Verbände und Unternehmen.
“Wir sehen deutlich, dass die EU in digitalen Netzwerken nicht ausreichend geschützt ist”, sagte Küsters. “Wir konnten auf Twitter zahlreiche Beispiele finden, die belegen, wie Vorhaben der EU verhindert werden sollen.” Er ist überzeugt, dass bisher den Markt beherrschende Staaten wie China gezielt die Unabhängigkeitsbemühungen Europas unterlaufen wollen.
Die Kommission ist in den Trilogverhandlungen mit Rat und Parlament unlängst zu einer Einigung über den Critical Raw Materials Act gekommen. Küsters forderte die EU auf, die Einfallstore für Manipulation zu schließen, bevor es zu spät sein. “Der Critical Raw Materials Act lässt die Gefahren und Bedrohungen aus dem digitalen Raum außer Acht.” vis
Der Landesparteitag der Sozialdemokraten im Saarland hat am Samstag Christian Petry für Platz eins der Landesliste für die Europawahl nominiert. Das teilte die Saar-SPD am Wochenende mit. Petry ist derzeit europapolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion und kümmert sich im Europaausschuss um finanz- und wirtschaftspolitische Themen. Ihm werden Chancen auf einen aussichtsreichen Platz auf der Bundesliste der Genossen zugeschrieben, obwohl die Saar-SPD 2019 keinen solchen Platz erhielt.
Petrys Ersatzkandidat wurde Joshua Dirks. Auf den Plätzen zwei bis vier folgen Christine Jung (Albana Terstena), Theresa Stolz-Fernandez (Diana Vasic) und Timo Stockhorst (Ruben Henschke). Ihre Bundesliste stellt die SPD Ende Januar zusammen.
Auch die FDP in Bremen hat ihre Wahl getroffen: Sie wird mit Celine Eberhardt als Spitzenkandidatin in die Europawahl im kommenden Jahr gehen. Die 25-Jährige erhielt am Samstag bei einer Landesvertreterversammlung breite Zustimmung, wie die Partei mitteilte. Auf Platz 2 der Landesliste wählten die Bremer Liberalen Elias Fabian Michels. ber
Gut sechs Wochen nach dem Großangriff der Hamas auf Israel wächst die Hoffnung auf eine baldige Freilassung von einigen der damals in den Gazastreifen verschleppten Geiseln. Der israelische Botschafter in den USA, Michael Herzog, sagte am Sonntag dem US-Fernsehsender ABC, er hoffe, dass es in den kommenden Tagen eine Einigung gebe und eine nennenswerte Zahl von Geiseln freigelassen werden könne.
Zuvor hatte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu einen Bericht der Washington Post dementiert, wonach Israel, die USA und die Hamas sich auf eine fünftägige Kampfpause und die Freilassung Dutzender Frauen und Kindern geeinigt haben sollen.
Die Washington Post berichtete unter Berufung auf eine sechsseitige Vereinbarung sowie damit vertraute Personen weiter, die Freilassung von Geiseln könnte in den nächsten Tagen beginnen, sofern es nicht noch zu Problemen komme. Es sei geplant, dass beide Seiten die Kampfhandlungen für mindestens fünf Tage einstellen, während alle 24 Stunden mindestens 50 Geiseln in Gruppen freigelassen werden sollten.
Katar bestätigte indirekt fortgeschrittene Verhandlungen über eine Geiselfreilassung im Gazastreifen. Man sei zuversichtlicher als zuletzt, dass es zu einer Vereinbarung komme, sagt Ministerpräsident Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani auf einer Pressekonferenz mit dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell. Die Herausforderungen im Zusammenhang damit seien inzwischen nur noch sehr gering. Die Gespräche würden aber noch andauern. Die strittigen Punkte bezögen sich auf praktische und logistische Fragen.
Ebenfalls am Sonntag traf sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit dem jordanischen König Abdullah II. Sie kündigte an, mit Jordanien zusammenzuarbeiten, damit mehr humanitäre Hilfe in den Gazastreifen gelangen könne. Von der Leyen verurteilte “die inakzeptable Gewalt von Extremisten im Westjordanland”. Sie schrieb auf der Online-Plattform X, der Kreislauf der Gewalt müsse durchbrochen werden. “Eine Zwei-Staaten-Lösung ist der einzige Weg, um Frieden zu erreichen”, sagte die EU-Kommissionspräsidentin. rtr/dpa

Es ist erst wenige Wochen her, Anfang Oktober, da hat die Europäische Kommission Christian Tietje mit einem der renommierten Jean-Monnet-Lehrstühle ausgezeichnet. Für den Rechtswissenschaftler Tietje ist der Lehrstuhl die Gelegenheit, sich endlich in Ruhe mit einem Gebiet zu beschäftigen, das ihn schon länger umtreibt: die “Werteorientierte Nachbarschafts- und Handelspolitik der EU”.
So lautet der offizielle Titel des Projekts, das die EU über einen Zeitraum von drei Jahren mit insgesamt 50.000 Euro mit dem Ziel unterstützt, den europäischen Einigungsprozess voranzubringen. Die EU verfolge bereits seit langem die Idee der werteorientierten Handelspolitik, sagt Tietje. “Aber das Gebiet ist kaum erforscht.”
Dem Professor für Öffentliches Recht, Europarecht und Internationales Wirtschaftsrecht an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) geht es bei dem Projekt zum einen um den Wertekanon, den die EU vertritt, wie die Menschenrechte oder den Umweltschutz. Zum anderen beschäftigt er sich mit der Frage, wie die Handelspartner diese Aspekte sehen und wie sich diese Werte neben den wirtschaftlichen Interessen berücksichtigen lassen.
Aus diesem Grund möchte Tietje gemeinsam mit Partnern aus Nicht-EU-Ländern die Idee der werteorientierten europäischen Außenwirtschaftspolitik diskutieren und dazu Publikationen verfassen. Er möchte mit seinem Team die Idee aber auch in die Öffentlichkeit tragen, in Schulen zum Beispiel. Dabei will er vor allem eines vermitteln: dass solche Themen – und das internationale Wirtschaftsrecht überhaupt – alles andere als dröge sind.
“Es gibt kein Rechtsgebiet, das spannender und vielschichtiger ist“, schwärmt der gebürtige Niedersachse. Nirgendwo sonst in der Juristerei würden so viele unterschiedliche Akteure wie Staaten, Unternehmen oder Nichtregierungsorganisationen (NGO) und verschiedene Rechtsnormen wie das Handelsrecht, Verbraucherrecht oder das Völkerrecht zusammenkommen.
Dass Tietje den Jean-Monnet-Lehrstuhl gewinnen konnte, ist eigentlich keine Überraschung. Sein ganzes Berufsleben lang befasst er sich mit der EU-Außenwirtschaftspolitik und dem Europa- sowie dem Völkerrecht. Das macht ihn auch zu einem gefragten Gutachter und Schiedsrichter bei internationalen Verfahren. Wegen seines strammen Terminkalenders nimmt er jedoch nur Aufträge an, die sich um spannende Rechtsfragen drehen. Die vertieft der Professor dann in seinen Seminaren und Vorlesungen.
Tietje, der 1967 in Walsrode geboren ist, ging in Verden an der Aller zur Schule. Als er sich 1987 an der Christian-Albrechts-Universität Kiel einschrieb, wollte er eigentlich in die Politik gehen. Diesen Plan hat Tietje aber schnell verworfen. Wann genau der Kipppunkt kam, ist schwer zu sagen. Ein latentes Interesse an internationalen Themen muss er aber schon immer gehabt haben. Denn warum sollte jemand sonst neben Jura Volkskunde studieren?
Ein Masterstudium, das Tietje nach seinem Examen an der US-amerikanischen University of Michigan Law School absolvierte, tat sein Übriges. Denn dort durfte er bei dem seinerzeit führenden internationalen Wirtschaftsrechtler John H. Jackson studieren. Sein Interesse war endgültig geweckt. Als nach seiner Habilitation im Jahr 2001 ein Lehrstuhl für Internationales Wirtschaftsrecht an der MLU frei wurde, zögerte er nicht lange und bewarb sich.
Manchmal werde er darauf angesprochen, wie es sich so als “Wessi” im Osten lebe. “Sehr gut”, ist dann seine lakonische Antwort. Tietje hätte durchaus die Möglichkeit gehabt, seine Karriere anderenorts fortzusetzen. Es gab Angebote verschiedener Universitäten. Die hat er alle abgelehnt. Denn zu internationalen Wirtschaftsthemen lasse sich auch in Halle gut forschen. Sabine Philipp
dieser Tage reisen viele Politiker in den Nahen Osten, um zu einer Lösung für den Gaza-Krieg beizutragen und auch, um endlich eine Freilassung der Geiseln zu erreichen. So war der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Sonntag in Katar und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Jordanien. Es gibt Anzeichen dafür, dass sich in der Frage der Geiseln etwas bewegt.
Am heutigen Montag ist von der Leyen in einer anderen Mission unterwegs. Sie wird, wie auch die Staats- und Regierungschefs zahlreicher afrikanischer Staaten, zum Afrika-Gipfel in Berlin erwartet. Hauptthemen der Konferenz Compact with Africa sind die Stärkung privater Investitionen auf dem Kontinent und die Zusammenarbeit bei nachhaltiger Energieversorgung. Compact with Africa geht auf eine Initiative Deutschlands während seines G20-Vorsitzes im Jahr 2017 zurück.
Zu dem Gipfel reisen neben von der Leyen auch EU-Ratspräsident Charles Michel, Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron und der niederländische Regierungschef Mark Rutte nach Berlin. Wie es heißt, will Bundeskanzler Olaf Scholz die Konferenz auch zu bilateralen Gesprächen mit einzelnen Staats- und Regierungschefs nutzen. Meine Kollegen vom Africa.Table planen zu Compact with Africa eine gesonderte Berichterstattung.
Um Nachhaltigkeit geht es diese Woche auch bei einigen Abstimmungen im Europäischen Parlament während der Sitzungswoche in Straßburg, wie meine Kollegin und Kollegen Leonie Düngefeld, Markus Grabitz und Lukas Scheid berichten.
Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche,

Am Mittwoch wird sich die Arbeitsgruppe Parlament 2024 zu ihrer Abschlusssitzung treffen. Parlamentspräsidentin Roberta Metsola hatte die Arbeitsgruppe im Frühjahr ins Leben gerufen. Sie tagte bislang 17 Mal. Ziel der Arbeitsgruppe ist es, sich auf Reformen in fünf Bereichen zu verständigen.
Die Fraktionschefs (Konferenz der Präsidenten) sollen, so der Plan, die Reformen in einer Sitzung vor der Dezember-Plenarwoche beschließen. Dann würde die informelle Arbeitsgruppe zur Geschäftsordnung des Parlaments den Auftrag bekommen, mit Unterstützung der Parlamentsverwaltung die Ergebnisse in einen Bericht zu kleiden. Dieser Arbeitsgruppe gehören unter anderem Vize-Präsident Rainer Wieland (CDU), Gaby Bischoff (SPD) und Helmut Scholz (Linke) an. Der Bericht soll vom Verfassungsausschuss (AFCO) beraten und bis zur letzten Sitzungswoche vor der Wahl Ende April vom Plenum beschlossen werden.
Die Reformvorschläge im Einzelnen:
Die Gesetzgebungsarbeit in den 20 ständigen Fachausschüssen des Europaparlaments soll schneller werden. Daher sollen künftig nicht mehr so viele beratende Ausschüsse beteiligt werden. Für beteiligte, nicht federführende Ausschüsse soll eine neue Form der Stellungnahme entwickelt werden. Ein Ausschuss soll nur beteiligt werden, wenn er wesentliche Kompetenzen für ein Dossier hat. Der Berichterstatter eines beteiligten, nicht federführenden Ausschusses soll an Treffen der Schattenberichterstatter und Vorbereitungstreffen von Trilogen teilnehmen. Der federführende Ausschuss soll verpflichtet werden, Amendments der mit beratenden Ausschüsse abzustimmen. Beteiligte, nicht federführende Ausschüsse sollen die Möglichkeit bekommen, abgelehnte Anträge wieder im Plenum zur Abstimmung zu stellen.
Diskutiert wird bei der Gesetzgebung auch, das Vorgehen bei gemeinsamen Ausschüssen (joint commitees) zu ändern. Künftig sollen höchstens drei Ausschüsse beteiligt werden, ohne dass ein Ausschuss die Federführung bekommt. Bislang gibt es Co-Vorsitzende. Das soll abgeschafft werden zugunsten eines Vorsitzes, der von Sitzung zu Sitzung wechselt. Von jedem Ausschuss soll ein Berichterstatter benannt werden.
Das Vorhaben, einen Ad-hoc-Ausschuss einzusetzen, stößt auf Widerstand in den Fraktionen. Der Ad-hoc-Ausschuss soll gebildet werden, wenn bei komplizierten Dossiers der Querschnittgesetzgebung mehr als drei Ausschüsse beteiligt sind. Ausschussvorsitzende und AFCO-Mitglieder befürchten, dass der Ad-hoc-Ausschuss zum Standard würde. Der Vorschlag des Generalsekretariats für einen neuen Zuschnitt der Ausschüsse gilt ebenfalls als chancenlos. Führende Vertreter des Parlaments kritisieren hinter vorgehaltener Hand, dass die Verwaltung damit ihre Kompetenzen überschritten habe. Er werde nicht weiter verfolgt.
Triloge sind inoffizielle Vermittlungsverfahren zwischen den Co-Gesetzgebern Parlament und Rat unter Beteiligung der Kommission. Das reguläre Vermittlungsverfahren wurde das letzte Mal vor zwölf Jahren angewendet. Triloge sind mittlerweile Standard. Versuche, das formelle Vermittlungsverfahren wiederzubeleben, dürften keinen Erfolg haben. Es soll Richtlinien für Triloge geben, die von der Konferenz der Ausschussvorsitzenden erarbeitet werden. Es soll Regeln für “Technische Meetings” (ITMs) geben wie etwa:
Es soll Obergrenzen bei der Anzahl von Mitgliedern der Verhandlungsgruppen bei Trilogen seitens des Parlaments geben. Es sollen Regeln aufgestellt werden, wann Mitglieder der Verhandlungsgruppen in Trilogen das Wort ergreifen dürfen. Zumindest in der Schlussphase von Trilogen soll der Rat den Fachminister schicken, der zuständige Kommissar soll ebenfalls dabei sein. Der zuständige Ausschussvorsitzende soll die Verhandlungen in der Schlussphase überwachen. Bislang kam es vor, dass Trilogdeals unter vier oder sechs Augen in “Auszeiten” geschmiedet wurden. Um dies zu verhindern, soll es Regeln für Auszeiten geben. Deals mit dem Rat außerhalb von Trilogverhandlungen sollen ausgeschlossen werden.
Die überwachende und kontrollierende Rolle des Parlaments (Scrutiny) soll gestärkt werden. Es soll “special scrutiny hearings” geben. So soll das Parlament die Gelegenheit bekommen, auf Ereignisse von politischer Bedeutung schneller zu reagieren. Die Fraktionschefs sollen entscheiden, wann die “special scrutiny hearings” angesetzt werden. Es soll dafür spezielle Räume geben, auch für die Bekanntgabe von vertraulichen Informationen.
Die Kommission wird aufgefordert, bei der Erstellung ihres Arbeitsprogramms Hinweise zu den Auswirkungen auf den EU-Haushalt zu geben. Die Kommission soll Gesetzgebungsvorschläge direkt nach der Annahme im College im Plenum vorstellen. Dies gilt unter der Voraussetzung, dass die Folgenabschätzung schon vorliegt.
Das Parlament beansprucht mehr Mitsprache beim Zuschnitt der Portfolios der Kommissare. Der gewählte Kommissionspräsident soll die Struktur seiner Kommission mit dem Parlament absprechen. Die Regeln für die Anhörungen der Kandidaten für die Kommission sollen verändert werden.
Bei der Kontrolle des EU-Haushalts und des Mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) soll der Haushaltsausschuss (BUDG) neue Kompetenzen bekommen. Dafür soll eine neue eigenständige Regel geschaffen werden neben den bestehenden allgemeinen Regeln für die Zusammenarbeit zwischen Gesetzgebungsausschüssen. Die Kontroll- und Entlastungsfunktionen des Parlaments sollen qualitativ gestärkt werden. Sollte das Parlament die Entlastung verweigern oder zeitlich verschieben, sollen die daraus folgenden Konsequenzen konkreter formuliert werden.
Das Plenum soll attraktiver werden. Dafür sollen Änderungen der Tagesordnung in letzter Minute reduziert werden. Ebenso die Zahl der Resolutionen, die am Donnerstag abgestimmt werden. Neue Tagesordnungspunkte sollen nicht vor 9 und nach 22 Uhr aufgesetzt werden. Debatten sollen nicht mehr nach 22 Uhr stattfinden. Im Plenum sollen häufiger wichtige Debatten (“key debates”) angesetzt werden. Währenddessen sollen konkurrierende Sitzungen etwa der Fraktionen, der Fraktionschefs, der Chefs der Ausschüsse und des Präsidiums sowie Triloge begrenzt werden. Weitere Vorschläge:
Die Außenbeziehungen des Parlaments sollen reformiert werden. Bei den Beziehungen zu Nicht-EU-Ländern soll das Parlament Abschied nehmen vom Ansatz der Parlamentsgremien (“parliamentary-body-based” approach) zugunsten eines länderbezogenen Ansatzes (“country-based” approach). Die Zahl der Delegationen und ihre Zusammenarbeit mit den Ausschüssen soll überprüft werden.

Die Parteispitze der Linken kann den Parteitag als Erfolg für sich und ihren Kurs verbuchen. Das Europa-Wahlprogramm wurde mit großer Mehrheit beschlossen. Die meisten Änderungsanträge hatte der Vorstand bereits im Vorfeld ausgeräumt, über den Rest beschieden die Delegierten zumeist zugunsten des Entwurfs. Die Forderung für einen gesetzlichen Mindestlohn in Deutschland wurde auf Antrag der Delegierten von 14 auf 15 Euro angehoben und ein automatischer Inflationsausgleich ins Programm mit aufgenommen.
Die Delegierten wählten den Parteivorsitzenden Martin Schirdewan mit fast 87 Prozent erneut zum Spitzenkandidaten für die Europawahl. Er sieht seine Partei geschlossen. Das macht er auch daran fest, dass der Name Sahra Wagenknecht kaum fiel. Sie hatte im September mit einigen Anhängern die Linke verlassen und bereitet die Gründung einer eigenen Partei vor. “Es gibt einen kämpferischen Geist für die Erneuerung, aber auch die Stärkung dieser Partei. Wir wollen gute Ergebnisse erzielen”, sagte Schirdewan zu Table.Media.
Auch die Vorschläge des Parteivorstands für die Kandidatenliste wurden von den Delegierten angenommen. Auf Platz zwei steht die Klima- und Flüchtlingsaktivistin Carola Rackete, die als Parteilose für die Linke antritt. Sie bekam fast 78 Prozent der Stimmen. Die Gewerkschafterin Özlem Demirel tritt auf Platz drei an und der ebenfalls parteilose Aktivist und Arzt Gerhard Trabert, konnte mit 96 Prozent auf Platz 4 ein besseres Ergebnis holen als der Parteivorsitzende. Die Journalistin Ines Schwerdtner aus Sachsen-Anhalt konnte sich Platz 5 sichern. Bei der Europawahl 2019 erreichte die Linke 5,5 Prozent der Stimmen und fünf Mandate.
Sich von einer Wagenknecht-Partei abzusetzen, die eventuell ebenfalls bei der Europawahl antritt, wird der Linken mit ihrem Programm nicht schwerfallen. Sie spricht sich deutlich gegen Abschottung und für Klimaschutz aus. Themen, bei denen Wagenknecht einen eher konservativen Kurs fährt.
Viel mehr wird es eine Herausforderung für die Vorsitzenden, die ganze Linkspartei hinter ihrem Programm zu versammeln. Denn obwohl die Konflikte der verschiedenen Parteiströmungen beim Parteitag nicht offen ausbrachen, fremdeln einige Landesverbände – besonders in Ostdeutschland – weiterhin mit der Erneuerung. Sie befürchten, dass die Linke eine Mischung aus Grünen und SPD werden könnte. Für diesen Konflikt steht die Spitzenkandidatin Carola Rackete, die vor allem ein urbanes linkes Milieu anspricht, aber auf dem Land in Sachsen oder Sachsen-Anhalt, mit vielen alteingesessenen Mitgliedern, auf Skepsis stößt.
Auf die Frage, wie sie mit der Kluft im Zuspruch der Partei umgehen wolle, sagte Rackete zu Table.Media: “Wenn man praktisch zusammenarbeitet und sich kennenlernt, sind die Vorurteile schnell ausgeräumt.” Nach dem Parteitag in Sachsen sei sie in den vergangenen Wochen in der Lausitz unterwegs gewesen. Dort ginge es vor allem darum, dass die EU-Gelder für den Strukturwandel auch ankommen. “Die werden an die Bundesregierung überwiesen und 15 Prozent davon gehen gerade in die Lausitz. Da trifft Kommunalpolitik konkret auf Europapolitik.”
Im Wahlprogramm gehe es immer um die Frage, wie Klimaschutz sozial gerecht ausgestaltet werden könne. Große Konzerne will die Linke entmachten. Als Beispiel nennt Rackete das Verbot der sogenannten “Share-Deals”, die die Linke verbieten will. “Eigentlich dürfen nur Landwirte Äcker kaufen, aber indem Konzerne per Share-Deal in Bauernhöfe investieren, erhalten sie auch das Recht dazu”, sagt Rackete. “Sie treiben damit gerade die Pachtpreise in einigen Regionen in die Höhe. In Ostdeutschland haben sich die Preise in den letzten 15 Jahre verdoppelt.”
Auch Schirdewan betont, das Thema soziale Gerechtigkeit als Kernthema der Linken durchziehe das gesamte Programm. Aber man müsse damit gleichzeitig die großen Fragen der Klimakrise beantworten. Es brauche einen Umbau der Industrie in klimaneutrale Wirtschaft. Die Linke fordert dafür ein großes Investitionsprogramm. “Das ist nicht zu viel”, sagt Schirdewan. “Das sind genau die Antworten, die wir in dieser gesellschaftlichen Situation geben müssen.” Als Hauptgegner im Wahlkampf machten alle Spitzenkandidaten die rechten Parteien aus.


Der europäische Green Deal ist ein Paket politischer Initiativen, mit dem die EU ihr Ziel erreichen und bis 2050 klimaneutral sein will. Einige Gesetzesvorschläge aus diesem Paket stehen in dieser Woche im Plenum des Europaparlaments in Straßburg zur Abstimmung:
Der Net Zero Industry Act (NZIA) ist die europäische Reaktion auf den US-amerikanischen Inflation Reduction Act (IRA). Ziel des Gesetzesvorhabens ist, die Technologien für die Dekarbonisierung in Europa zu industrialisieren. 40 Prozent der Null-Emissions-Technologien sollen hier produziert werden und einen globalen Marktanteil von 25 Prozent an diesen Technologien erobern.
Am Dienstag stimmt das EU-Parlament über seine Position ab, sodass noch in diesem Monat die Trilog-Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten beginnen können. Das Thema hat vor allem deshalb Eile, weil der NZIA eine Abwanderungswelle europäischer Unternehmen in die USA verhindern soll, wegen der Steuererleichterungen, die der IRA bietet.
Überraschungen werden bei der Abstimmung im Parlament nicht erwartet, da die drei großen Fraktionen EVP, S&D und Renew im Industrieausschuss einen Deal ausgehandelt haben, der eine komfortable Mehrheit im Plenum bekommen dürfte. Im Trilog könnten einige Punkte des NZIA allerdings noch mal etwas kontroverser diskutiert werden.
Die Abstimmung am Mittwoch zur Verordnung zum nachhaltigen Einsatz von Pflanzenschutzmitteln (SUR) – auch bekannt als Pestizide-Verordnung – ist dagegen noch lange nicht ausgemacht. Strittig ist zum einen, um wie viel Prozent die Mitgliedstaaten den Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln absenken müssen und in welchem Zeitraum. Zum anderen geht es um die Frage, ob in Schutzgebieten ein Totalverbot von Pflanzenschutzmitteln kommt. Die EVP versucht, Koalitionen mit Teilen von Renew und Sozialdemokraten zu schmieden, um die Position des Umweltausschusses (ENVI) in den beiden strittigen Fragen abzuändern.
ENVI ist für ein Verbot von chemischen Pflanzenschutzmitteln in allen Natura-2000 und FFH-Schutzgebieten sowie in Parks, auf Spielplätzen und sonstigen Flächen, wo sich auch Kinder, Alte und Kranke aufhalten. Erlaubt wären nur noch biologische Pflanzenschutzmittel und solche Mittel, die auch im Ökolandbau eingesetzt werden dürfen. Die Mitgliedstaaten sollen allerdings über Ausnahmen in besonderen Fällen verfügen können.
Diese Position könnte einschneidende Folgen für die Landwirte gerade in Deutschland haben, da zahlreiche Schutzgebiete für die intensive Landwirtschaft genutzt und dort bislang Pestizide eingesetzt werden. Die EVP will deshalb die Natura-2000- und FFH-Vogelschutzgebiete von dem Verbot für chemische Pestizide ausnehmen.
ENVI will zudem den Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln bis 2030 halbieren. Dagegen formiert sich ebenfalls Widerstand. Im Plenum dürfte zur Abstimmung gestellt werden, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln bis 2035, also fünf Jahre später, nicht um 50 Prozent zu reduzieren, sondern nur “mindestens um 35 Prozent” und bezogen auf den Zeitraum 2011 bis 2013. Die Mitgliedstaaten sollen die Möglichkeit haben, das individuelle Ziel zu erhöhen.
Ebenfalls am Mittwoch stimmt das Parlament über die Verpackungsverordnung ab, eines der Gesetzesverfahren mit obskuren Lobbykampagnen und überdramatisierenden Medienberichten. Die deutschen Bierkästen, die französischen Camembert-Holzschachteln und die kleinen Zuckertüten, die zum Heißgetränk in Cafés serviert werden – wegen der kleinteiligen Bestimmungen der Verordnung ranken sich Befürchtungen um allerlei Verbote. Der Höhepunkt der Lobbyaktionen war wohl erreicht, als vergangene Woche Schilder an den Türen der Abgeordnetenbüros in Brüssel angebracht wurden, die vor dem Untergang der Coffee-to-go-Becher warnten.
Ziel der Verordnung ist, unnötige Verpackungen zu verbieten oder zu minimieren, Einwegverpackungen zu verhindern und Mehrwegsysteme zu fördern. Jede Verpackung soll ab 2030 recycelbar sein. Vor der finalen Abstimmung müssen die Parlamentarier noch über an die hundert Änderungsanträge abstimmen. Es bleiben also noch viele offene Fragen, etwa zu Einwegprodukten in der Gastronomie oder zu Ausnahmen für bestimmte Produkte.
Am Dienstag stimmt das Parlament über die Position zu CO₂-Flottengrenzwerten für schwere Nutzfahrzeuge ab. Es wird versucht, die Verschärfungen des Umweltausschusses (ENVI) gegenüber dem Kommissionsvorschlag zurückzunehmen und eine Öffnung für synthetische Kraftstoffe sowie die Anrechnung von CO₂-neutralen Kraftstoffen im Rechtstext zu erreichen. Es wird mit einem knappen Ausgang der Abstimmung gerechnet.
Am Dienstag stimmt das Plenum ebenfalls über die Richtlinie zum Recht auf Reparatur ab. In seinem Bericht fordert der Binnenmarktausschuss (IMCO), Verkäufer zu verpflichten, innerhalb der gesetzlichen Garantiezeit eine kostenlose Reparatur anzubieten. Es sei denn, sie ist teurer als ein Austausch, sie ist faktisch unmöglich oder sie ist für den Verbraucher unpraktisch. Darüber hinaus sollen Anreize für die Verbraucher geschaffen werden, innerhalb der Gewährleistungsfrist die Reparatur dem Ersatz vorzuziehen, so etwa die Verlängerung der gesetzlichen Garantie um ein Jahr für reparierte Produkte. Die Mitgliedstaaten sollen die Reparatur durch finanzielle Anreize wie Gutscheine und nationale Reparaturfonds fördern.
Ebenfalls auf der Agenda des Novemberplenums ist die Abstimmung am Dienstag über die COP28-Resolution, die die Erwartungen des EU-Parlaments an die UN-Klimakonferenz in Dubai widerspiegelt. Auch der Zertifizierungsrahmen für CO₂-Entnahmen wird am Dienstag abgestimmt. Dabei geht es um die Frage, welche Formen der CO₂-Entnahmen als dauerhaft gelten und ob Unternehmen sich klimaneutral nennen dürfen, wenn ihre neutrale CO₂-Bilanz auf CO₂-Offsets beruht.
EU-Parlament, Rat und Kommission haben sich im Trilog auf politischer Ebene über die Überarbeitung der Abfallverbringungsverordnung geeinigt. Die neuen Vorschriften sollen sicherstellen, dass die EU mehr Verantwortung für ihre Abfälle übernimmt und ihre ökologischen Herausforderungen nicht in Drittländer exportiert, erklärte die Kommission. Sie sollen auch die Nutzung von Abfällen als Ressource erleichtern.
Der Export von Kunststoffabfällen aus der EU in Nicht-OECD-Länder wird verboten, mit Ausnahmen unter strengen Bedingungen. Andere, für das Recycling geeignete Abfälle, werden nur dann aus der EU in Nicht-OECD-Länder ausgeführt, wenn sicher ist, dass diese nachhaltig damit umgehen können. Digitalisierte Verfahren sollen es erleichtern, Abfälle zum Recycling innerhalb der EU zu verbringen.
Auch die Durchsetzung und Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des illegalen Handels mit Abfällen wird verstärkt. Die Verordnung soll die neue Richtlinie über den strafrechtlichen Schutz der Umwelt ergänzen, über die sich die EU-Institutionen Ende vergangener Woche ebenfalls geeinigt haben.
Die derzeit geltende Abfallverbringungsverordnung stammt aus dem Jahr 2006. Seitdem sind die Ausfuhren von Abfällen aus der EU in Drittländer erheblich gestiegen, insbesondere in Nicht-OECD-Länder.
Das Europäische Parlament und der Rat müssen die Verordnung nun noch förmlich annehmen. 20 Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt tritt sie dann in Kraft. leo
Die EU-Botschafter haben am Freitag der Ratsposition für den Zertifizierungsrahmen für CO₂-Entnahmen zugestimmt. Die Bundesregierung hat trotz einiger Vorbehalte gegen den Vorschlag der spanischen Ratspräsidentschaft zugestimmt, jedoch eine Protokollnotiz eingebracht. Diese Zusatzerklärung, die Table.Media vorliegt, legt die Probleme Deutschlands mit dem derzeitigen Text dar.
Demnach hält die Bundesregierung insbesondere die derzeitige Regelung in der Ratsposition über CO₂-Entnahmen durch Biomasse für problematisch. Sie fordert, dass die Treibhausgas-Bilanzierung von Biomassenutzung auch die Emissionen aus Anbau, Ernte, Verarbeitung und Transport von Biomasse einbezieht. Der derzeitige Ratstext legt lediglich fest, dass Emissionen bei der Verbrennung berücksichtigt werden.
Sollten die Emissionen bei der Verbrennung abgeschieden und gespeichert werden, wäre die Treibhausgas-Bilanz auf dem Papier negativ. Es würde also so aussehen, dass der Atmosphäre CO₂ entzogen worden wäre. Faktisch wäre durch die Biomassenutzung allerdings keine Mehrentnahme erfolgt. Die Bundesregierung fürchtet dadurch Fehlanreize für die Biomassenutzung und mangelnde Integrität der CO₂-Entnahmezertifikate.
Für eine entsprechende Änderung des Ratstexts im Sinne Deutschlands hat es offenbar keine Mehrheit gegeben, weshalb die Bundesregierung die Protokollerklärung eingebracht hat. Der Ministerrat muss dem Text noch formal zustimmen. Das EU-Parlament stimmt am Dienstag über seine Position ab, sodass die Trilog-Verhandlungen noch im November beginnen können. luk
Bei seinem Besuch in Peking hat EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra den chinesischen Klimabeauftragten Xie Zhenhua indirekt aufgefordert, sich an der Finanzierung von durch den Klimawandel verursachten Schäden und Verlusten (Loss & Damage) zu beteiligen. Alle Parteien, die einen Beitrag zur Klimafinanzierung leisten können, sollten dies tun, betonte Hoekstra nach eigenen Angaben in dem Gespräch. Dies gelte insbesondere für den Fonds für Loss & Damage. Er habe auch an die Rolle der EU als weltweit größter Geber internationaler Klimafinanzierung erinnert, heißt es.
Westliche Industrieländer verlangen schon länger, dass große Emittenten wie China oder Öl- und Gas-produzierende Länder sich an der internationalen Klimafinanzierung beteiligen. China ist gemessen an den kumulierten CO₂-Emissionen seit der Industrialisierung bereits jetzt der drittgrößte CO₂-Emittent – nach den USA und den EU-Staaten. Voraussichtlich 2025 wird China die EU jedoch überholen, wodurch die Rufe nach einer Beteiligung Chinas immer lauter werden.
Auf der COP28 will die EU sich dafür einsetzen, dass neue Geldquellen für die Klimafinanzierung ausgemacht werden. Wer in den Fonds für Loss & Damage einzahlt, gilt als eines der heikelsten Themen der Verhandlungen in Dubai. luk
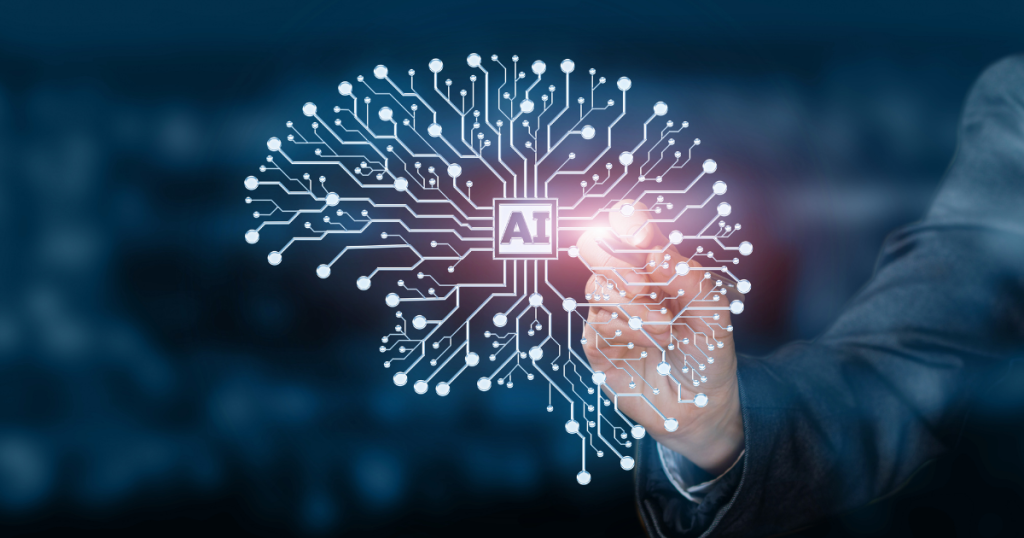
Deutschland, Frankreich und Italien haben sich auf eine gemeinsame Position zur Behandlung von Basismodellen (Foundation Models) und allgemeinen KI-Systemen (GPAI) im AI Act verständigt. Wichtigster Punkt: Bei Foundation Models lehnen die drei Länder eine gesetzliche Regulierung ab. Statt unerprobte Gesetze einzuführen, schlagen sie für die Zwischenzeit eine “verpflichtende Selbstregulierung durch Verhaltenskodizes” vor. Das geht aus einem Non-Paper der drei Länder hervor, das Table.Media vorliegt.
Derzeit verhandeln EU-Kommission, Parlament und Rat den AI Act im Trilog. Es soll die weltweit erste gesetzliche Regulierung Künstlicher Intelligenz werden, darum gibt es hier noch keine Vorbilder. Weil Deutschland, Frankreich und Italien die von der Kommission vorgeschlagene Regulierung von Foundation Models und GPAI ablehnten, war es zuletzt zum Abbruch der Verhandlungen gekommen. Das Parlament, das Foundations Models und GPAI in den AI Act einbeziehen will, wollte den zweistufigen Ansatz der Kommission mittragen.
Das Trio schlägt nun statt harter Regulierung vor, dass die Verhaltenskodizes den auf G7-Ebene im Hiroshima-Prozess definierten Prinzipien folgen könnten. Dies gewährleiste die notwendige Transparenz und den Informationsfluss in der Wertschöpfungskette sowie die Sicherheit der Grundmodelle gegen Missbrauch, heißt es in dem Non-Paper.
Insgesamt fordern die Länder, Definitionen und Abgrenzungen besondere Aufmerksamkeit zu schenken. “Wir sollten eine gründliche Diskussion zu diesem Thema fortsetzen.” Demnach sind sie überzeugt, dass eine Regulierung allgemeiner KI-Systeme dem risikobasierten Ansatz des AI Acts mehr entspreche. Die Risiken lägen hier eher in der Anwendung von KI-Systemen als in der Technologie selbst.
Jedoch wären Entwickler von Foundation Models bei dem Vorschlag der drei Länder verpflichtet, Model Cards zu definieren. Model Cards sind eine Art Beipackzettel, die in strukturierter Form Auskunft über Leistungsmerkmale des jeweiligen KI-Models geben sollen. Beispiele für solche Leistungsmerkmale seien: Anzahl der Parameter, vorgesehene Verwendung und potenzielle Einschränkungen, Ergebnisse von Studien zu Vorurteilen, Red-Teaming für Sicherheitsbewertungen.
Die Länder schlagen außerdem ein KI-Governance-Gremium vor. Das könne helfen, Richtlinien zu entwickeln und die Anwendung von Model Cards überprüfen.
Anfangs soll es bei Verstößen keine Sanktionen geben. Nach einer Beobachtungsphase könne dann ein Sanktionssystem eingerichtet werden, “das auf einer angemessenen Analyse und Bewertung der identifizierten Fehler und der besten Vorgehensweise zu deren Behebung basiert”. vis
Apple wehrt sich gegen die Einstufung seiner Plattformdienste als Torwächter (Gatekeeper) im Sinne das Digital Markets Act (DMA). Das Unternehmen habe Klagen gegen Entscheidungen der EU-Kommission eingereicht, teilte der Gerichtshof der Europäischen Union in einem Beitrag auf X mit.
Im September hatte die Kommission 22 Gatekeeper-Dienste designiert, die von sechs Technologieunternehmen betrieben werden: Microsoft, Apple, Google (Alphabet), Amazon, Meta und TikTok (ByteDance).
Zwar veröffentlichte der Gerichtshof keine Einzelheiten der rechtlichen Anfechtung von Apple. Bloomberg News berichtete jedoch vergangene Woche, dass das Unternehmen die Aufnahme seines App Store in die Liste der Gatekeeper anfechten würde.
Auch Meta und TikTok hatten bereits Berufung gegen die Entscheidung der Kommission eingelegt, ihre Dienste aufzunehmen. In seinem Einspruch erklärte Meta, dass es mit der Entscheidung der Kommission, seine Messenger- und Marketplace-Dienste unter das DMA zu stellen, nicht einverstanden sei. Die Einbeziehung von Facebook, Whatsapp oder Instagram focht Meta nicht an.
TikTok erklärte, seine Plattform, “die seit etwas mehr als fünf Jahren in Europa tätig ist, ist weit davon entfernt, ein Torwächter zu sein, und ist wohl der fähigste Herausforderer der etablierten Plattformunternehmen”.
Microsoft und Google erklärten, die Entscheidung nicht anfechten zu wollen. Die Einspruchsfrist ist am 16. November abgelaufen. rtr
Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat schlagartig die Bedrohung westlicher Gesellschaften durch Cyberangriffe deutlich gemacht. Diese Entwicklung mache ein besseres Verständnis der digitalen Bedrohungslandschaft erforderlich, mit der die EU konfrontiert sei, schreiben die Forscher des Centrums für Europäische Politik (cep) in einer aktuellen Studie zu Social Media in der Geopolitik, die Table.Media vorliegt.
So drohe der globale Kampf um kritische Rohstoffe inzwischen auch auf Social-Media-Plattformen wie X ausgetragen zu werden. Mögliche Waffen seien Desinformation, Fake News und Propaganda, schreibt das cep.
“Europa will strategisch unabhängiger werden. Gezielte Falschinformationen und Unwahrheiten im digitalen Raum bedrohen die geplante Rohstoffstrategie der Europäischen Union“, sagt cep-Ökonom André Wolf. Soziale Medien böten ein ideales Einfallstor für Manipulation.
Wolf hat zusammen mit cep-Digitalexperte Anselm Küsters einen großen Daten-Pool auf X untersucht, der nach eigenen Angaben insgesamt rund vier Millionen Tweets mit 126 Millionen Wörtern umfasste, die in einem Zeitraum zwischen 2012 und 2022 verfasst wurden. Im Mittelpunkt standen besonders reichweitenstarke Tweets über kritische Rohstoffe, wie sie die EU definiert, sowie Nachrichten der wichtigsten 234 internationalen Verbände und Unternehmen.
“Wir sehen deutlich, dass die EU in digitalen Netzwerken nicht ausreichend geschützt ist”, sagte Küsters. “Wir konnten auf Twitter zahlreiche Beispiele finden, die belegen, wie Vorhaben der EU verhindert werden sollen.” Er ist überzeugt, dass bisher den Markt beherrschende Staaten wie China gezielt die Unabhängigkeitsbemühungen Europas unterlaufen wollen.
Die Kommission ist in den Trilogverhandlungen mit Rat und Parlament unlängst zu einer Einigung über den Critical Raw Materials Act gekommen. Küsters forderte die EU auf, die Einfallstore für Manipulation zu schließen, bevor es zu spät sein. “Der Critical Raw Materials Act lässt die Gefahren und Bedrohungen aus dem digitalen Raum außer Acht.” vis
Der Landesparteitag der Sozialdemokraten im Saarland hat am Samstag Christian Petry für Platz eins der Landesliste für die Europawahl nominiert. Das teilte die Saar-SPD am Wochenende mit. Petry ist derzeit europapolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion und kümmert sich im Europaausschuss um finanz- und wirtschaftspolitische Themen. Ihm werden Chancen auf einen aussichtsreichen Platz auf der Bundesliste der Genossen zugeschrieben, obwohl die Saar-SPD 2019 keinen solchen Platz erhielt.
Petrys Ersatzkandidat wurde Joshua Dirks. Auf den Plätzen zwei bis vier folgen Christine Jung (Albana Terstena), Theresa Stolz-Fernandez (Diana Vasic) und Timo Stockhorst (Ruben Henschke). Ihre Bundesliste stellt die SPD Ende Januar zusammen.
Auch die FDP in Bremen hat ihre Wahl getroffen: Sie wird mit Celine Eberhardt als Spitzenkandidatin in die Europawahl im kommenden Jahr gehen. Die 25-Jährige erhielt am Samstag bei einer Landesvertreterversammlung breite Zustimmung, wie die Partei mitteilte. Auf Platz 2 der Landesliste wählten die Bremer Liberalen Elias Fabian Michels. ber
Gut sechs Wochen nach dem Großangriff der Hamas auf Israel wächst die Hoffnung auf eine baldige Freilassung von einigen der damals in den Gazastreifen verschleppten Geiseln. Der israelische Botschafter in den USA, Michael Herzog, sagte am Sonntag dem US-Fernsehsender ABC, er hoffe, dass es in den kommenden Tagen eine Einigung gebe und eine nennenswerte Zahl von Geiseln freigelassen werden könne.
Zuvor hatte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu einen Bericht der Washington Post dementiert, wonach Israel, die USA und die Hamas sich auf eine fünftägige Kampfpause und die Freilassung Dutzender Frauen und Kindern geeinigt haben sollen.
Die Washington Post berichtete unter Berufung auf eine sechsseitige Vereinbarung sowie damit vertraute Personen weiter, die Freilassung von Geiseln könnte in den nächsten Tagen beginnen, sofern es nicht noch zu Problemen komme. Es sei geplant, dass beide Seiten die Kampfhandlungen für mindestens fünf Tage einstellen, während alle 24 Stunden mindestens 50 Geiseln in Gruppen freigelassen werden sollten.
Katar bestätigte indirekt fortgeschrittene Verhandlungen über eine Geiselfreilassung im Gazastreifen. Man sei zuversichtlicher als zuletzt, dass es zu einer Vereinbarung komme, sagt Ministerpräsident Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani auf einer Pressekonferenz mit dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell. Die Herausforderungen im Zusammenhang damit seien inzwischen nur noch sehr gering. Die Gespräche würden aber noch andauern. Die strittigen Punkte bezögen sich auf praktische und logistische Fragen.
Ebenfalls am Sonntag traf sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit dem jordanischen König Abdullah II. Sie kündigte an, mit Jordanien zusammenzuarbeiten, damit mehr humanitäre Hilfe in den Gazastreifen gelangen könne. Von der Leyen verurteilte “die inakzeptable Gewalt von Extremisten im Westjordanland”. Sie schrieb auf der Online-Plattform X, der Kreislauf der Gewalt müsse durchbrochen werden. “Eine Zwei-Staaten-Lösung ist der einzige Weg, um Frieden zu erreichen”, sagte die EU-Kommissionspräsidentin. rtr/dpa

Es ist erst wenige Wochen her, Anfang Oktober, da hat die Europäische Kommission Christian Tietje mit einem der renommierten Jean-Monnet-Lehrstühle ausgezeichnet. Für den Rechtswissenschaftler Tietje ist der Lehrstuhl die Gelegenheit, sich endlich in Ruhe mit einem Gebiet zu beschäftigen, das ihn schon länger umtreibt: die “Werteorientierte Nachbarschafts- und Handelspolitik der EU”.
So lautet der offizielle Titel des Projekts, das die EU über einen Zeitraum von drei Jahren mit insgesamt 50.000 Euro mit dem Ziel unterstützt, den europäischen Einigungsprozess voranzubringen. Die EU verfolge bereits seit langem die Idee der werteorientierten Handelspolitik, sagt Tietje. “Aber das Gebiet ist kaum erforscht.”
Dem Professor für Öffentliches Recht, Europarecht und Internationales Wirtschaftsrecht an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) geht es bei dem Projekt zum einen um den Wertekanon, den die EU vertritt, wie die Menschenrechte oder den Umweltschutz. Zum anderen beschäftigt er sich mit der Frage, wie die Handelspartner diese Aspekte sehen und wie sich diese Werte neben den wirtschaftlichen Interessen berücksichtigen lassen.
Aus diesem Grund möchte Tietje gemeinsam mit Partnern aus Nicht-EU-Ländern die Idee der werteorientierten europäischen Außenwirtschaftspolitik diskutieren und dazu Publikationen verfassen. Er möchte mit seinem Team die Idee aber auch in die Öffentlichkeit tragen, in Schulen zum Beispiel. Dabei will er vor allem eines vermitteln: dass solche Themen – und das internationale Wirtschaftsrecht überhaupt – alles andere als dröge sind.
“Es gibt kein Rechtsgebiet, das spannender und vielschichtiger ist“, schwärmt der gebürtige Niedersachse. Nirgendwo sonst in der Juristerei würden so viele unterschiedliche Akteure wie Staaten, Unternehmen oder Nichtregierungsorganisationen (NGO) und verschiedene Rechtsnormen wie das Handelsrecht, Verbraucherrecht oder das Völkerrecht zusammenkommen.
Dass Tietje den Jean-Monnet-Lehrstuhl gewinnen konnte, ist eigentlich keine Überraschung. Sein ganzes Berufsleben lang befasst er sich mit der EU-Außenwirtschaftspolitik und dem Europa- sowie dem Völkerrecht. Das macht ihn auch zu einem gefragten Gutachter und Schiedsrichter bei internationalen Verfahren. Wegen seines strammen Terminkalenders nimmt er jedoch nur Aufträge an, die sich um spannende Rechtsfragen drehen. Die vertieft der Professor dann in seinen Seminaren und Vorlesungen.
Tietje, der 1967 in Walsrode geboren ist, ging in Verden an der Aller zur Schule. Als er sich 1987 an der Christian-Albrechts-Universität Kiel einschrieb, wollte er eigentlich in die Politik gehen. Diesen Plan hat Tietje aber schnell verworfen. Wann genau der Kipppunkt kam, ist schwer zu sagen. Ein latentes Interesse an internationalen Themen muss er aber schon immer gehabt haben. Denn warum sollte jemand sonst neben Jura Volkskunde studieren?
Ein Masterstudium, das Tietje nach seinem Examen an der US-amerikanischen University of Michigan Law School absolvierte, tat sein Übriges. Denn dort durfte er bei dem seinerzeit führenden internationalen Wirtschaftsrechtler John H. Jackson studieren. Sein Interesse war endgültig geweckt. Als nach seiner Habilitation im Jahr 2001 ein Lehrstuhl für Internationales Wirtschaftsrecht an der MLU frei wurde, zögerte er nicht lange und bewarb sich.
Manchmal werde er darauf angesprochen, wie es sich so als “Wessi” im Osten lebe. “Sehr gut”, ist dann seine lakonische Antwort. Tietje hätte durchaus die Möglichkeit gehabt, seine Karriere anderenorts fortzusetzen. Es gab Angebote verschiedener Universitäten. Die hat er alle abgelehnt. Denn zu internationalen Wirtschaftsthemen lasse sich auch in Halle gut forschen. Sabine Philipp
