Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat in letzter Zeit vor allem für Zwist auf dem internationalen Parkett oder zumindest nicht für weniger davon gesorgt. Umstrittene Aussagen zu Taiwan, Beharren auf AKWs für Klimaschutz und über Monate eine harte Linie zur Plattformarbeitsrichtlinie. Heute, mit dem Start des zweitägigen “Gipfels für einen neuen globalen Finanzierungspakt” in Paris, könnte es Macron gelingen, sich wieder einmal positiv ins Licht zu rücken.
Bei dem Gipfel soll ein wenig bekannter Teil des Pariser Klimaschutzabkommens mehr Aufmerksamkeit zukommen: die Frage nach der Finanzierung und dem Finanzsystem. Macron will bei dem zweitägigen Treffen die diversen Debatten dazu unter einem Dach zusammenführen. Es geht beispielsweise um Partnerschaften für grünes Wachstum oder die Weiterentwicklung von multilateralen Entwicklungsbanken. Auch private Investoren sollen besser eingebunden werden.
Zumindest angesichts der Liste der Teilnehmer kann Macron in der Mission “Einigen statt Spalten” schon einmal einen Teilerfolg für sich verbuchen: Zahlreiche bedeutende Akteure der Weltbühne haben ihr Kommen angekündigt. Von Bundeskanzler Olaf Scholz, Lula da Silva, Chinas Premier Li Qiang bis hin zu UN-Generalsekretär António Guterres, Weltbankchefin Kristalina Georgiewa und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Wenn dann am Ende noch ein passabler “operativer” Fahrplan mit praktischen Maßnahmen herauskommt, dann wäre noch einiges mehr erreicht. Mehr dazu lesen Sie in unserer Analyse von Claire Stam.


Mit seinem “Gipfel für einen neuen globalen Finanzpakt” will der französische Präsident Emmanuel Macron ab heute der internationalen Klimafinanzierung neuen Schwung, einen neuen Rahmen und neue Geldgeber verschaffen. Das zweitägige Treffen in Paris soll die diversen Debatten über Klimafinanzen unter einem Dach zusammenführen. Es soll private Investoren verstärkt für die Kapitalbedürfnisse der globalen Klimawende in die Pflicht nehmen.
Und es soll allgemein die Aufmerksamkeit auf das bislang oft vernachlässigte dritte Ziel des Pariser Abkommens aus Artikel 2 I c richten: Nämlich neben der Begrenzung der Temperatur und der Anpassung an den Klimawandel die “Finanzflüsse kompatibel zu machen mit einem Pfad Richtung niedriger Emissionen von Treibhausgasen und einer klimafesten Entwicklung.”
Die Organisatoren hoffen auf eine “gemeinsame Diagnose” der Herausforderungen und einer “neuen politischen Vision”, die zu “greifbaren, umsetzbaren” Ergebnissen führen sollen, heißt es aus dem Élysée-Palast. Nicht geplant ist eine Wort für Wort ausgehandelte gemeinsamen Erklärung, sondern ein “operativer” Fahrplan mit praktischen Maßnahmen.
Macron hatte das Ganze auf dem G20-Gipfel im November 2022 angekündigt, nachdem er die “Bridgetown Initiative” von Mia Mottley, der Premierministerin von Barbados, unterstützt hatte. Mottley wird prominenter Gast in Paris sein. Ihre Agenda sieht ein globales Finanzsystem vor, das sich an den Bedürfnissen der am stärksten gefährdeten Länder orientiert: Es soll insgesamt Finanzmittel von 100 Milliarden Dollar mobilisieren, insbesondere aus dem Privatsektor. Diese sollen die Kapitalkosten in den Entwicklungsländern senken, um die Folgen des Klimawandels zu bewältigen. Das gilt zusätzlich zu den 100 Milliarden Dollar, die die Industrieländer ab 2020 dem Globalen Süden versprochen haben und die sie bisher nicht vollständig geliefert haben.
Kurz vor Beginn des Gipfels in Paris haben Staats- und Regierungschefs die Forderung nach einer klimafesten Reform des Finanzsystems unterstützt und nach einem “neuen globalen Konsens” in dieser Frage gedrängt, darunter US-Präsident Joe Biden, Bundeskanzler Olaf Scholz, Brasiliens Präsident Lula da Silva, Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa und die Chefin der EU-Kommission Ursula von der Leyen.
Ohnehin haben die G20 eine Reform der Bretton-Woods-Finanzarchitektur gefordert, die angesichts der Herausforderungen des 21. Jahrhunderts nicht mehr funktionsfähig sei. “Die Klimafrage kollidiert mit der Agenda der Reform der Bretton-Woods-Institutionen“, analysiert Philippe Zaouati, CEO von Mirova, einer auf nachhaltige Investitionen spezialisierten Vermögensverwaltungsgesellschaft.
Der französische Investor ist der Ansicht, dass das gesamte System “überdacht” und an die neuen klimatischen Gegebenheiten “angepasst” werden muss. Und das setzt eine stärkere Beteiligung des privaten Finanzsektors voraus. “Öffentliche Entwicklungshilfe ist gut, aber nicht alles”, betont Zaouati. “Derzeit sind zum Beispiel Pensionsfonds noch viel zu zögerlich, um in südliche Länder zu investieren. Dabei besteht gerade dort ein großer Investitionsbedarf.”
Die bisherigen Debatten haben aus Sicht von Paris ein Problem: Sie finden über zahlreiche Kanäle statt, die nicht unbedingt miteinander übereinstimmen und als entfernt voneinander gelten: beim Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank, bei den UN-Klimaverhandlungen, bei G7 und G20. “Diese internationalen Foren sind derzeit Gegenstand unzusammenhängender Aktionen, was die Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen betrifft. Dieser Gipfel soll einen gemeinsamen Rahmen schaffen“, sagt Laurence Tubiana, Vorsitzende der European Climate Foundation und Architektin des Pariser Abkommens. Sie fordert die Umsetzung des Finanzziels des Pariser Abkommens.
Paris strebt an, die zwei Tage im Palais Brongniart zum Knotenpunkt dieser verschiedenen Verhandlungsräume zu machen. Macron will trotz der Spannungen zwischen China und den USA, dem Krieg in der Ukraine und der tiefen Verärgerung der Länder des Südens erfolgreich sein. Der geopolitische Kontext ist “sehr kompliziert”, bemerkt Bertrand Badré, Direktor des Fonds für verantwortungsbewusste Investitionen Blue Orange Capital und ehemaliger Generaldirektor für Finanzen der Weltbank. “Es gibt immer weniger Lust, sich zu einigen.” Aber “wenn es uns nicht gelingt, den Entwicklungsländern in der Frage der Finanzierung entgegenzukommen, werden sie nicht am Verhandlungstisch sitzen bleiben und mit der Extraktion von Kohle, Öl und Gas beginnen”, befürchtet er.
Es haben sich rund 50 Staats- und Regierungschefs angekündigt. Neben der charismatischen Mia Mottley aus Barbados hat auch der Präsident Brasiliens, Lula da Silva, bereits seine Teilnahme zugesagt. Auch China dürfte mit seinem Premierminister Li Qiang hochrangig vertreten sein. UN-Generalsekretär António Guterres kommt ebenso wie die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, der deutsche Bundeskanzler, Olaf Scholz oder die Präsidenten von Ghana, Nana Akufo-Addo, Senegal, Macky Sall und Kenia, William Ruto. Die USA werden voraussichtlich durch den Klimagesandten John Kerry und Finanzministerin Janet Yellen vertreten sein.
Die wichtigsten internationalen Organisationen, große Stiftungen, der Privatsektor, der akademische Sektor und die Zivilgesellschaft werden ebenfalls anwesend sein. Unter ihnen: der neue Präsident der Weltbank, Ajay Banga, der seit dem 1. Juni im Amt ist und für den dieser Gipfel das erste große internationale Treffen sein wird. Außerdem werden die geschäftsführende Direktorin des IWF, Kristalina Georgieva, und Mafalda Duarte, die sich anschickt, die Leitung des Grünen Klimafonds zu übernehmen, auf dem Gipfel sprechen. Christine Lagarde, die Präsidentin der Europäischen Zentralbank und ehemalige Chefin des IWF, wird ebenfalls vor Ort sein, wie auch Mark Carney, ehemaliger Gouverneur der Bank of England, der die Initiative Gfanz (Glasgow Financial Alliance for Net Zero) ins Leben gerufen hat.
Geplant sind sechs Round Table-Gespräche zu folgenden Themen:

Sie haben gerade Ihr Amt angetreten. Was ist Ihrer Meinung nach in dieser frühen Phase Ihrer Amtszeit das drängendste Thema?
Im Moment ist die ganze Diskussion über De-Risking unser Hauptanliegen. In Europa wird viel darüber geredet, in China auch. Wir sind der Meinung, dass noch einiges getan werden muss, um dieses Konzept mit Inhalt zu füllen. Wir müssen uns genauer ansehen, was es in Europa bedeutet – und zugleich darüber nachdenken, wie es im chinesischen Kontext gesehen wird. Tatsächlich betreibt China seit zehn Jahren De-Risking. Sie nennen es nur anders: “Made in China 2025”, “Dualer Kreislauf” oder “14. Fünfjahresplan”.
Wie kann dann das De-Risking der EU klappen?
Wir müssen gründlich analysieren, was als Risiko und als Schwachstelle wahrnehmbar ist. Wir müssen uns die Handels- und Produktionsströme ansehen, um besser zu verstehen, was De-Risking für das eigentliche Geschäft bedeutet. Das hat Priorität. Das wird aber ein wenig Nachdenken erfordern und kann nicht über Nacht gelingen. Die Wortwahl spielt eine große Rolle. De-Risking bestimmt als Konzept die gesamte Agenda – ebenso wie die Einteilung der EU von 2019, China als “Partner, Konkurrenten und strategischen Rivalen” zu sehen. Wir müssen uns wirklich über das Konzept De-Risking selbst und seine Auswirkungen im Klaren sein.
China ist immer noch ein wichtiger Handelspartner für die meisten Länder in Europa, insbesondere für Deutschland. Eine Diversifizierung wird kompliziert werden. Welche Trends erwarten Sie?
Viele Dinge werden sich nicht wirklich ändern. Was das verarbeitende Gewerbe betrifft, so hat China seinen Anteil am weltweiten Export weiter erhöht. Was wir derzeit sehen, ist, dass die Regierung weiterhin einen Schwerpunkt auf angebotsseitige Unterstützung der Exportproduktion legt. Zum Beispiel durch erleichterten Zugang zu Krediten. China wird auch weiterhin eine recht starke Exportproduktion aufweisen, was zusätzlich durch die Abschwächung des Renminbi gefördert wird, zumindest kurzfristig.
Das klingt für die chinesische Konjunktur erst mal nicht schlecht.
Andererseits kommt der schwache Yuan aber den chinesischen Haushalten nicht gerade zugute, denn er verteuert importierte Waren. Das zeigt, dass die staatliche Unterstützung jetzt eher der Angebotsseite als der Nachfrageseite zugutekommt. Derzeit gibt es nicht viele Maßnahmen, die das Konsumwachstum fördern. Aber genau das würden wir gerne sehen.
Was würde helfen, den Konsum anzukurbeln?
Die Menschen in China müssen das Gefühl haben, dass sich der Immobiliensektor stabilisiert. 70 Prozent des Vermögens der privaten Haushalte sind in Immobilien gebunden, und solange die Menschen nicht wissen, wie es mit den Immobilien weitergeht, werden sie sich in ihrem Konsumverhalten zurückhalten.
Wie sehen Sie die derzeitige wirtschaftliche Lage Chinas im Allgemeinen nach dem Ende von Null-Covid?
Es ist noch zu früh für eine Bewertung. Wir haben gesehen, dass die Dinge im ersten Quartal relativ gut liefen, gefolgt von einer gewissen Abschwächung im zweiten Quartal. Wir sind etwas besorgt, denn wir sehen Schwächen in einigen Sektoren – vor allem bei hochwertigen Industriegütern. Die Dienstleistungen schneiden besser ab. In drei Monaten werden wir vielleicht ein klareres Bild haben.
Wie sehr trifft diese Wachstumsunsicherheit die europäischen Unternehmen?
Meiner Beobachtung nach verlieren die BIP-Zahlen immer mehr an Bedeutung. Man muss sich eher einzelne Sektoren genauer ansehen. Als die Wirtschaft der Volksrepublik zwölf Prozent pro Jahr wuchs, konnte jeder dort wachsen. Jetzt, wo sich das Wachstum abschwächt, ist es nicht mehr universell. Aber in einigen Sektoren gibt es in China immer noch erhebliche Chancen.
Welche Sektoren könnten das sein?
Wir haben bereits in einem unserer Papiere darauf hingewiesen, dass China in den verschiedenen Branchen unterschiedliche Bedeutung haben wird. Es gibt Branchen, in denen China in Zukunft mehr als die Hälfte der weltweiten Nachfrage ausmachen wird. Und es gibt andere, die einfach so kompliziert sind, dass man sich fragen könnte: Ist China wirklich etwas für mich? Wenn Sie also Spezialchemikalien herstellen, dann ist China der richtige Ort für Sie. Wenn Sie aber digitale Plattformen oder digitale Inhalte herstellen, dann könnte China etwas schwieriger sein.
Die Unternehmen beklagen sich über die verschiedenen Sicherheitsgesetze, die ihnen das Leben immer schwerer machen. Gleichzeitig arbeitet Europa an Gesetzen, die Unternehmen zwingen, ihre Wertschöpfungsketten im Ausland zu bewerten und zu kontrollieren. Was bedeutet das alles für etablierte oder auch neue Lieferketten in China? Und wie können sich Unternehmen – insbesondere kleine und mittlere Firmen (KMU) – in diesem komplizierten Umfeld zurechtfinden?
Wenn Sie kein sehr großes Unternehmen sind und den Punkt kommen, an dem Sie zwei getrennte Wertschöpfungsketten aufbauen und betreiben müssen – eine für den Westen und eine für China – könnten die Kosten verschreckend hoch werden. Ich würde lieber in eine Lieferkette investieren, die sehr gut funktioniert, in einem Markt, den ich kenne, als zwei aufzubauen – und die zweite dann in einem Markt zu betreiben, mit dem ich nicht so gut vertraut bin. Das trägt zu der Unsicherheit bei, die viele Unternehmen derzeit empfinden und die sich auch in unserer neuen Umfrage zum Geschäftsklima widerspiegelt.
Hat das konkrete Folgen in den europäischen Unternehmen?
Das beginnt, sich auf Investitionsentscheidungen auszuwirken. Wenn ich nicht mit einem gewissen Maß an Sicherheit vorhersagen kann, wie die Welt in fünf Jahren aussehen wird und ob China dann der richtige Ort für mich ist, werde ich nicht investieren. Ich kenne kein einziges KMU, das sich seit dem Beginn von Covid in China niedergelassen hat. Das hat auch nicht nur mit der Politik zu tun. Viele unserer Unternehmen waren während der Pandemie erschüttert, als sie erkannten, wie anfällig ihre Lieferketten waren und wie abhängig sie von einem einzigen Standort geworden waren.
Was können die Unternehmen in dieser Situation tun?
Die Leute sitzen über ihren Taschenrechnern und versuchen herauszufinden, welche Investitionen sie tätigen müssen – und wie diese Investitionen zu den erwarteten Gewinnen passen, die sie auf dem chinesischen Markt erzielen könnten. Und je mehr die Kosten für eine etwaige Trennung der Lieferkette steigen, desto höher wird die Schwelle, ab der es für Unternehmen interessant wird, sich hier in China niederzulassen.
Wie macht sich das in China bemerkbar?
Das stellt ein Risiko dar und schränkt die Vielfalt an Größe und Art der Unternehmen ein, die ein längerfristiges Interesse an einem Engagement in China haben. Ich denke, das sind genau die Art von Gesprächen, die wir mit der chinesischen Regierung führen müssen: Verordnungen und Beschränkungen haben Konsequenzen im wirklichen Leben und Konsequenzen in Form investierter Euros und US-Dollars. Peking hat noch einiges zu tun, um der internationalen Geschäftswelt zu zeigen, dass China ein effizienter und berechenbarer Ort ist, an dem sich Unternehmen niederlassen können.
Stimmt es, dass die lokalen Regierungen nach wie vor stark bestrebt sind, ausländische Unternehmen anzuziehen – auch wenn die Zentralregierung heutzutage mehr Wert auf Sicherheit und Stabilität als auf die Wirtschaft legt?
Ja, die meisten Provinzen und Gemeinden sind sehr daran interessiert, ausländische Investitionen anzuziehen – vor allem unter den derzeitigen Umständen einer sich abschwächenden Wirtschaft. Ich denke, alles, was die Wirtschaftstätigkeit ankurbelt, ist willkommen. Das stelle ich persönlich fest, wenn ich auf Reisen bin. Es gibt ein großes Interesse daran, mit der ausländischen Geschäftswelt in Kontakt zu treten – und wir wissen das natürlich zu schätzen.
Peking sendet eine nicht ganz so offene Botschaft.
Ehrlich gesagt, waren viele von uns nach dem KPCh-Kongress im Oktober etwas besorgt, weil der Schwerpunkt so sehr auf Sicherheit und Eigenständigkeit lag, was in eine andere Richtung zu gehen schien. Aber dann hatten wir den Nationalen Volkskongress im März, auf dem viel mehr über die unerschütterliche Unterstützung von Reformen und Öffnung gesprochen wurde, was schön zu hören war.
Was denken Sie, in welche Richtung es künftig gehen wird?
Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir nicht wirklich, welche Seite sich durchsetzen wird. Es ist wunderbar, dass die lokalen Regierungen mit uns reden wollen. Wir freuen uns über die Aufmerksamkeit. Aber wird das auch zu Ergebnissen vor Ort führen? Ich denke, das bleibt abzuwarten.
Jens Eskelund lebt seit 25 Jahren in China und ist Hauptvertreter der dänischen Unternehmensgruppe Maersk. Er war bereits zwei Amtszeiten lang Vizepräsident der EU-Kammer – von 2019 bis 2021 und von Oktober 2022 bis Mai 2023 – und war seit der Gründung der Kammer auch aktiv an den Arbeitsgruppen beteiligt. Er war außerdem Vorstandsmitglied und Vorsitzender der dänischen Handelskammer in China.
22.06.2023 – 08:30-09:30 Uhr, online
DGAP, Discussion Morning Briefing on Geopolitical Challenges
The German Council on Foreign Relations (DGAP) looks at the European Commission’s Economic Security Strategy. INFOS & REGISTRATION
23.06.2023 – 08:45-14:30 Uhr, London (UK)/online
GMF, Conference Building A Transparent and Accountable Ukraine: Key Steps to Recovery
The German Marshall Fund (GMF) brings together officials from governments, donor agencies, and civil society to discuss how Ukraine can prepare for a process of recovery and reconstruction that promotes digitalization, strong governance, transparency, and integrity. INFOS & REGISTRATION
23.06.2023 – 09:00-18:00 Uhr, Neapel (Italien)
EC, Conference 1st Conference on Sustainable Banking and Finance CSBF 2023
The European Commission (EC) aims at stimulating the discussion about the bidirectional nature of the relationship between climate change and finance. INFOS & REGISTRATION
23.06.2023 – 09:30-12:30 Uhr, Brüssel (Belgien)/online
SGI Europe, Conference The EU Single Market at 30: What role for SGIs?
SGI Europe reflects the discussion about the bidirectional nature of the relationship between climate change and finance. INFOS & REGISTRATION
24.06.-25.06.2023, Amsterdam (Niederlande)
Steconf, Conference 3rd International Conference on Innovation in Renewable Energy and Power
Steconf addresses global and regional trends, innovative application frameworks, and current research. INFOS & REGISTRATION
26.06.-30.06.2023, Trier
ERA, Seminar Summer Course on European Intellectual Property Law
The Academy of European Law (ERA) provides a thorough introduction to European intellectual property law. INFOS & REGISTRATION
26.06.2023 – 15:00-17:15 Uhr, online
FZE, Konferenz Die Energiewirtschaft und Gaia-X
Das Forum für Zukunftsenergien (FZE) diskutiert das Gaia-X-Projekt im Kontext der Digitalisierung der deutschen Industrie. INFOS & ANMELDUNG
27.06.-01.07.2023, Champaign-Urbana, Illinois (USA)
Aspen Institute, Conference U.S.-German Forum on Future Agriculture
Das Aspen Institute (AI) beleuchtet Lösungsansätze für eine nachhaltige Zukunft der Landwirtschaft und des ländlichen Raums. INFOS & REGISTRATION
27.06.-29.06.2023, Prag (Tschechien)
Conference International Flow Battery Forum 2023
The conference addresses the central role that flow batteries play in the energy storage sector. INFOS & REGISTRATION
27.06.-28.06.2023, München
SZ, Konferenz Nachhaltigkeitsgipfel
Die Süddeutsche Zeitung (SZ) widmet sich der Frage, ob Deutschland den Umbau hin zu einer grünen Wirtschaft schafft. INFOS & ANMELDUNG
27.06.2023 – 10:30-16:45 Uhr, Brüssel (Belgien)/online
Bruegel Future of Work and Inclusive Growth Annual Conference 2023
Bruegel discusses necessary skills demanded by the AI and green sectors, examines the impact of technology adoption on labour markets, and addresses the growing inequality brought on by digitalisation of capital. INFOS & REGISTRATION
27.06.2023 – 14:30-16:30 Uhr, Brüssel (Belgien)/online
ERCST, Discussion EU Climate Policy & Electricity Market
The European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition (ERCST) addresses the interactions between EU climate policy and the electricity market. INFOS & REGISTRATION
27.06.2023 – 16:30-18:30 Uhr, Leipzig
DIHK, Diskussion Aus Alt mach Neu: Wege in die zirkuläre Wertschöpfung in der Automobilindustrie
Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) geht der Frage nach, was regulatorische und gesetzlichen Rahmenbedingungen für eine Circular Economy sind. INFOS & ANMELDUNG
27.06.2023 – 17:30-18:15 Uhr, Berlin
EBD, Diskussion Die türkische Präsidentschaftswahl und die europäisch-türkischen Beziehungen – Ist es Zeit für eine “Zeitenwende”?
Die Europäische Bewegung Deutschland (EBD) beschäftigt sich mit der Bedeutung der türkischen Präsidentschaftswahl für die europäisch-türkischen Beziehungen. INFOS & ANMELDUNG
Die Kommission hofft, lange Vakanzen an der Spitze der Vertretungen in mehreren Mitgliedstaaten zu beenden, indem sie die Posten deutlich attraktiver macht. Nach Information von Table.Media werden die Vertretungen der Kommission in Berlin, Warschau und Budapest aufgewertet. Der Leiter – er oder sie ist der Vertreter der Kommission in dem jeweiligen Mitgliedstaat – bekleidet künftig den Rang eines Direktors.
Direktoren sind in den Besoldungsgruppen AD 13 und 14 eingestuft und verdienen im Grundgehalt zu Beginn ihrer Dienstzeit 14.644,53 Euro monatlich, beziehungsweise 16.569,31 Euro monatlich. Allerdings greift je nach Standort ein Berichtigungskoeffizient (Polen derzeit 70,1; Ungarn derzeit 69,9), wodurch die Grundgehälter dort deutlich niedriger sind.
Jörg Wojahn, der Vertreter der Kommission in Berlin, räumt nach Informationen von Table.Media im Sommer seinen Posten. Hinweise, wonach Martin Selmayr, der Vertreter der Kommission in Österreich und ehemaliger Generalsekretär der Kommission, nach Berlin wechselt, gelten indes als Spekulation.
Mit der Hochstufung des Vertreters in Berlin, Warschau und Budapest ziehen die jeweiligen Vertretungen mit Paris gleich, wo bereits bisher der Leiter im Direktorenrang arbeitet. Wie zu hören ist, gibt es Unmut in Italien und Spanien: Die Regierungen bestehen darauf, dass die Kommission auch die Vertreter in ihren Ländern zu Direktoren macht.
Bislang wurden die Leiter der Vertretungen als Gruppenleiter (head of unit) eingestuft und verdienen im Grundgehalt zu Beginn ihrer Amtszeit in den Besoldungsstufen AD 9 bis AD 12. Das sind in Deutschland etwa zwischen 8.936,26 Euro und 12.943,31 Euro monatlich.
Die Leitung der Regionalvertretung der Kommission in München ist seit September 2020 vakant, das Büro in Bonn wird seit September 2021 kommissarisch aus Berlin geleitet. Um die Posten attraktiver zu machen, hat sich die Kommission entschieden, die Leiter der Regionalbüros künftig als Gruppenleiter einzustufen. Bislang hatten sie keinen ausgewiesenen Rang.
Die Regionalvertretung in Bonn, die demnächst nach Köln umziehen soll, ist zuständig für Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen und das Saarland. In diesen Bundesländern wohnen rund 30 Millionen Bürger. Dies entspricht in etwa der addierten Einwohnerzahl der Mitgliedstaaten Portugal, Schweden und Tschechien. Die Regionalvertretung in München ist zuständig für Baden-Württemberg und Bayern. In diesen Bundesländern wohnen etwa 25 Millionen Menschen. Die betroffenen Landesregierungen hatten wiederholt bei der Kommission gegen die Vakanzen protestiert. Die Vertretungen unterstehen direkt der Kommissionspräsidentin. Die Besetzung der Posten fällt in die Kompetenz Ursula von der Leyen.
Da etwa in München mindestens zwei Bewerbungsrunden, bei denen nur Kommissionsbeamte infrage kamen, ohne Besetzung der Leitungsposition zu Ende gingen, hat die Kommission bei dem gerade laufenden Verfahren auch externe Bewerber zugelassen.
Die Höherstufung der Leiter der Regionalbüros in den Rang von Gruppenleitern stößt auf Kritik: Während Gruppenleiter in der Kommission Personalverantwortung für 15 bis 20 Beamte haben, arbeiten etwa im Regionalbüro in Bonn nur noch insgesamt drei Mitarbeiter. Eine so geringe Zahl von Mitarbeitern passe nicht zu dem Posten eines Gruppenleiters, heißt es in der Behörde. mgr
Die EU macht Ernst damit, die Schlupflöcher in ihrem Sanktionsregime gegenüber Russland zu schließen. Die Botschafter der Mitgliedstaaten haben am Mittwoch dem elften Sanktionspaket zugestimmt. Es sieht erstmals ein Instrument vor, um Unternehmen und Drittstaaten mit Strafmaßnahmen zu belegen, die Umgehungsgeschäfte betreiben oder sich dafür als Plattform anbieten.
Das Sanktionspaket werde Putins Kriegsmaschinerie mit verschärften Ausfuhrbeschränkungen einen weiteren Schlag versetzen und auf Einrichtungen abzielen, die den Kreml unterstützen, begrüßte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Einigung. Das Instrument gegen die Umgehung von Sanktionen werde Russland daran hindern, sanktionierte Güter in die Hände zu bekommen.
Allerdings musste die EU-Kommission ihren ursprünglichen Vorschlag von Ende April mehrfach überarbeiten und das Instrument entschärfen. Dies auf Druck Deutschlands und weiterer Staaten. “Wir müssen verhindern, dass Russland sanktionierte kriegswichtige Güter über Drittstaaten erhält”, heißt es in einer Weisung aus Berlin noch letzte Woche. Die Bekämpfung von Sanktionsumgehung habe zwar höchste Priorität. Gleichzeitig dürften aber Drittstaaten nicht auf die Seite Russlands getrieben werden.
Deutschland zog seinen Prüfvorbehalt erst vor der letzten Runde im AstV zurück. Das Instrument gegen Drittstaaten soll jetzt in einem vorsichtig abgestuften Verfahren und nur in letzter Instanz zum Einsatz kommen. Bevor Strafmaßnahmen gegen Drittstaaten verhängt werden können, muss die EU-Kommission nachweisen, dass alle anderen diplomatischen Bemühungen gescheitert sind. Das elfte Sanktionspaket schaffe “in letzter Instanz, neue außergewöhnliche Maßnahmen”, um den Verkauf, Transfer oder Export von sensiblen dual-use Gütern und Technologie in Drittstaaten einzuschränken, sagten nun Diplomaten. Die EU-Staaten müssten Strafmaßnahmen gegen Drittstaaten jeweils im Konsens zustimmen.
Konkret werden Drittstaaten ins Visier genommen, die über längere Zeit als Schlupflöcher dienen und mit Blick auf Umgehungsgeschäfte als “besonders hohes Risiko” eingeschätzt werden. Gelistet werden sollen nur Firmen und Drittstaaten, wenn es einen deutlichen Bezug zu kriegsrelevanten Gütern aus der EU gibt. Es brauche eine klare Abgrenzung zu extraterritorialen Sanktionen, wie die EU sie sonst ablehne, sagten Deutschland und andere Mitgliedstaaten.
Teil des Pakets ist auch ein Hafenanlaufverbot für Schiffe, die in Ship-to-Ship-Transfers zur Umgehung des Ölimportverbots auf dem Seeweg involviert sind. 71 Personen und 33 Entitäten werden zudem gelistet, weil sie im Verdacht stehen, unter anderem an der Deportation von ukrainischen Kindern nach Russland beteiligt zu sein. Neu können künftig auch Personen und Entitäten mit Strafmaßnahmen wie Einreise- und Kontensperren belegt werden, wenn sie sich an der Umgehung von Sanktionen beteiligen.
Die EU-Kommission wollte eigentlich sieben chinesische Firmen mit Sanktionen belegen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur afp ist jetzt nur die Listung von drei mehrheitlich russisch kontrollierten Firmen mit Sitz in Hongkong vorgesehen.
Die Mitgliedstaaten müssen nun bis Freitag im schriftlichen Verfahren die Einigung im AstV noch formell absegnen. Das elfte Sanktionspaket könnte noch dann noch am selben Tag der Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft treten. sti
Die Ukraine muss weiter auf den Start von Beitrittsgesprächen mit der EU warten. Der EU-Gipfel in der kommenden Woche in Brüssel will das Land zu zusätzlichen Reformen ermuntern, jedoch kein Datum für den Start von Verhandlungen nennen. Dies geht aus einem Entwurf der Schlussfolgerungen für das Gipfeltreffen hervor, der Table.Media vorliegt. Der Europäische Rat erkenne die “substanziellen Bemühungen” der Ukraine an, heißt es in dem Dokument. “Er ermuntert die Ukraine, auf seinem Reformpfad fortzufahren.” Eine Beitrittskonferenz wird jedoch nicht in Aussicht gestellt.
Die Ukraine hatte den Start von Verhandlungen noch in diesem Jahr gefordert. Die EU-Kommission hat dies jedoch von sieben Bedingungen abhängig gemacht. Bisher seien nur zwei der sieben Kriterien erfüllt, hieß es bei einem Treffen der EU-Botschafter am Mittwoch in Brüssel. “Die Haupthürden für die Ukraine sind die Reform des Verfassungsgerichts und der Kampf gegen die Korruption und die Oligarchen“, sagte ein Diplomat. Umgesetzt habe die Ukraine dagegen die Empfehlungen, den politischen Einfluss auf die Medien zu verringern und das Justizsystem zu reformieren.
Die EU-Staaten müssen die Aufnahme von Beitrittsgesprächen einstimmig beschließen. Als Grundlage gilt ein Fortschrittsbericht zu den Kandidatenländern, den die EU-Kommission im Oktober vorlegen will. Erweiterungskommissar Olivér Várhelyi hat gestern nur einen mündlichen Zwischenbericht gegeben.
Vor einem Jahr hatte der EU-Gipfel beschlossen, der Ukraine den Kandidatenstatus zu verleihen. Vor allem Polen und die baltischen Länder fordern seitdem den schnellen Start von Beitrittsverhandlungen. Deutschland steht auf der Bremse – und verweist auf die EU-Kommission. eb
Bei einer Geberkonferenz in London sind mehrere Milliarden an Hilfen für die Ukraine von den Staats- und Regierungschefs zugesagt worden. Londons Premier Rishi Sunak stellte verschiedene Unterstützungsmaßnahmen vor, darunter zusätzliche Garantien in Höhe von drei Milliarden Dollar, um Kredite der Weltbank freizusetzen. Diese beinhalten Zusagen über 20 Millionen Pfund (rund 23 Millionen Euro), um den Zugang zur Multilateralen Investitionsgarantie-Agentur der Weltbank zu verbessern, die politische Risiken für Projekte absichert.
Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, erklärte, die EU werde der Ukraine 50 Milliarden Euro für die Jahre 2024 bis 2027 zur Verfügung stellen, während US-Außenminister Antony Blinken 1,3 Milliarden Dollar an zusätzlicher Hilfe anbot. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock erklärte, Berlin biete für 2023 zusätzliche 381 Millionen Euro an humanitärer Hilfe an.
Der ukrainische Premierminister Denys Schmyhal sagte am Mittwoch, er rechne mit der Zusage von fast sieben Milliarden Dollar an Hilfsgeldern, nachdem er auf einer Londoner Konferenz erklärt hatte, Kiew stehe aufgrund des russischen Krieges vor dem größten Wiederaufbauprojekt in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg.
Sunak adressierte auch eines der größten Probleme vieler Unternehmen, die in der Ukraine investieren wollen – die Versicherung gegen Kriegsschäden und Zerstörungen. Dagegen kündigte er den Londoner Konferenzrahmen für Kriegsrisikoversicherungen an, der den Weg für risikoärmere Investitionen ebnen soll.
Das Unternehmen Marsh McLennan, das unter anderem Rückversicherungen anbietet und nach eigenen Angaben an dem Programm der britischen Regierung mitgewirkt hat, sagte, dass eine Kriegsrisikoversicherung in einem noch nie dagewesenen Umfang zur Verfügung stehen und von der Regierung abgesichert werden müsse.
Der Krieg Russlands gegen die Ukraine tobt seit fast 16 Monaten. Zahlreiche Wohnhäuser, Krankenhäuser und wichtige Infrastruktureinrichtungen sind zerstört worden. Die Gesamtrechnung dürfte enorm sein: Die Ukraine, die Weltbank, die Europäische Kommission und die Vereinten Nationen schätzten im März die Kosten für das erste Kriegsjahr auf 411 Milliarden Dollar. Sie könnten leicht mehr als eine Billion Dollar erreichen. rtr/lei
Die Luftwaffeninspekteure Deutschlands, Frankreichs und Spanien haben auf der Luftfahrtmesse Le Bourget bei Paris einen Vertrag zur kooperativen Luftkriegsführung unterzeichnet – und damit bestehende Vereinbarungen bekräftigt. Das Future Combat Air System (FCAS) soll demnach bis 2040 in einen Verbund mit bewaffneten und unbewaffneten Drohnen eingebunden werden, der unter dem Namen Next Generation Weapon System (NGWS) firmiert.
Der französische Luftwaffeninspekteur Stéphane Mille sagte gegenüber Table.Media, dass das Papier voriges Jahr konzipiert wurde, zu einer Zeit, “als das Projekt stockte”. Es gehe darum zu zeigen, “dass wir immer noch zusammenarbeiten”.
Die Entwicklung von FCAS hat mehrfach für Unstimmigkeiten zwischen Deutschland und Frankreich gesorgt, weil die beteiligten Unternehmen Airbus und Dassault sich um die Aufgabenverteilung stritten. 2019 schloss sich Spanien dem zunächst bilateralen deutsch-französischen Projekt an.
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kündigte zum Auftakt der Luftfahrmesse Le Bourget am Montag an, dass Belgien die Entwicklung von FCAS fortan als Beobachter begleiten werde. Der französische General Jean-Luc Moritz, der den operativen Teil von FCAS auf französischer Seite leitet, erklärte am Mittwoch, der nun geschlossene Vertrag mache die Anforderungen an das Waffensystem der nächsten Generation NGWS deutlich, ein zentrales Waffensystem zu bieten, das andere Systeme kommandieren, aber auch selbst kämpfen könne. Weiter solle NGWS in der Lage sein, mithilfe von künstlicher Intelligenz Drohnenmanöver zu synchronisieren und Kommunikation zu bieten, die resilient gegen Cyberangriffe ist. Gb

Seine Kollegen und sich selbst sieht Rainer Steffens als “Lobbyisten der besonderen Art”. Er war von 2011 bis 2018 bereits Leiter der Vertretung von Nordrhein-Westfalen (NRW) bei der EU in Brüssel. Seit November 2022 steht er nun zum zweiten Mal für die Interessen und Belange des Bundeslandes ein. Durch die offen zugänglichen Informationen zu Finanzen und Mitarbeitern sehe er in seiner Tätigkeit aber einen klaren Unterschied zum klassischen Lobbyismus, sagt Steffens. Als geborener Niedersachse hat er dennoch durch seine rheinländische Ehefrau und seinen Schwiegervater eine familiäre Beziehung zu NRW. Es freue ihn, das Bundesland mit seinen rund 18 Millionen Einwohnern vertreten zu können, nicht zuletzt da es “die größte Wirtschaftskraft einer Region in Europa” hat.
Das wichtigste Thema in der Arbeit des 62-Jährigen ist aktuell die Transformation der Industriegesellschaft vor dem Hintergrund von Green Deal und Fit für 55. Die Pläne korrespondieren laut Rainer Steffens sehr gut mit den Aktivitäten von EU-Kommission und Ursula von der Leyen. Auch die Geschehnisse rund um Lützerath haben den Leiter der Vertretung NRWs beschäftigt. Er verstehe die Kritik an dem Kohle-Kompromiss. “Es ist nicht das Beste, was man jemals hätte erreichen können, aber das, was politisch für uns möglich war.”
Als Jurastudent habe er selbst gegen Atomkraft demonstriert und sich auch später in seiner Karriere Umweltthemen gewidmet. Nach Tätigkeiten im niedersächsischen Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten hatte Rainer Steffens bis 2005 mehrere Funktionen im Bundesumweltministerium inne und war später der erste Referatsleiter Umwelt in der ständigen Vertretung Deutschlands.
Zwischen der vorherigen und der aktuellen Laufzeit als Leiter der Vertretung arbeitete er als Koordinator im Ausschuss der Regionen in Brüssel. “Das ist aus meiner Sicht das am meisten unterschätzte Organ in Brüssel”, sagt der 62-Jährige. Es setzt sich aus etwa 350 Vertretern europäischer Städte und Regionen zusammen, die sehr gute informelle Kontaktmöglichkeiten zu den Institutionen haben.
Die Begeisterung für Europa und die entsprechende Ausrichtung entwickelte Rainer Steffens bereits am Anfang seiner Karriere. Im Rahmen seines Jurastudiums in Hannover und Berlin absolvierte er Mitte der 80er-Jahre eine Wahlstation beim Europäischen Parlament in Luxemburg. Vor allem der interkulturelle Austausch mit anderen Studenten sei damals der Auslöser für seine Europabegeisterung gewesen, erzählt der 62-Jährige.
Neben vielen anderen Aufgaben richtet die Landesvertretung regelmäßig Veranstaltungen aus. Vor allem bekannt sind sie für die Karneval-Partys. “Das ist natürlich ein Teil des Kulturexports und wir sind stolz darauf, dass wir einmal im Jahr die größte Karnevals-Party westlich von Aachen ausrichten, bei der wir bis zu 800 Gäste begrüßen dürfen.” Rainer Steffens gefällt das bunte Treiben, die volle Hingabe sei aber nicht in seiner DNA verankert. Wobei er aufblühe, sei das Fahrradfahren. Im Keller des 62-Jährigen stehen zurzeit sieben Fahrräder, auf denen er, wenn möglich, jeden Tag zwölf Kilometer zur Arbeit hin und zurück fährt.
Seine Leidenschaft kombiniere er auch gelegentlich mit seinem Beruf: Mit Kollegen aus der Landesvertretung NRW habe er bereits eine einwöchige Radtour durch das Ruhrgebiet und das Rheinland bis nach Aachen organisiert. Ihm sei es wichtig, nicht nur auf dem “Brüsseler Parkett” tätig zu sein, sondern auch “in das Land NRW hineinwirken zu können”. Stationen der Tour waren unter anderem EU-geförderte Projekte, Schulen und Handwerksbetriebe, die sich besonders mit Europa verbunden fühlen, außerdem Gespräche mit Politikern aus den Städten. Für nächstes Jahr habe er schon Pläne, die Tour zu wiederholen. Von Kim Fischer
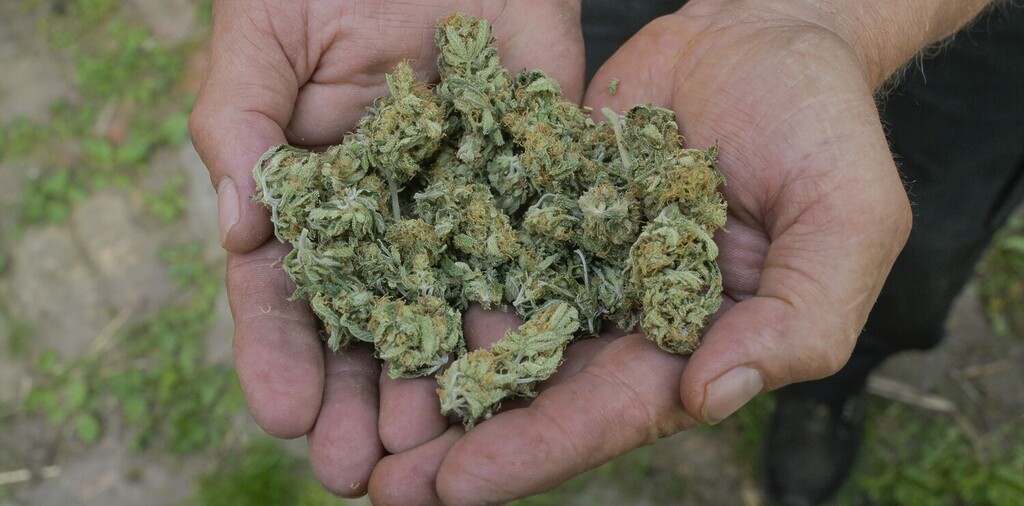
Katargate, der Korruptionsskandal rund um das EU-Parlament, ist noch sieben Monate nach den Razzien für Überraschungen gut. Überraschung Nummer eins: Am Montag stellt sich der Europaabgeordnete Andrea Cozzolino (ehemals S&D), dessen Auslieferung die belgischen Ermittlungsbehörden seit Monaten fordern, überraschend am Flughafen in Zaventem. Dem Napolitaner wird vorgeworfen, Bestechungsgelder von Marokko und Katar angenommen zu haben. Der inzwischen fraktionslose Abgeordnete bestreitet das vehement. Cozzolino war am Dienstag noch vom belgischen Ermittlungsrichter Michel Claise vernommen worden. Claise hat einen Ruf wie Donnerhall in Belgien.
Jetzt kommt Überraschung Nummer zwei: Claise musste nun die Ermittlungen wegen Befangenheit abgeben. Der Sohn des Richters, Nicolas, hat nämlich 2018 ein Unternehmen gegründet, mit Ugo, dem Sohn der sozialistischen EU-Abgeordneten Marie Arena. Der Name von Marie Arena, eine weitere belgische Sozialistin mit italienischen Wurzeln, tauchte in dem Skandal immer wieder auf. Sie leitete den Menschenrechtsausschuss, in dessen Umfeld dubiose Geschichten abliefen. Marie Arena hatte eine Affäre mit dem Hauptverdächtigen, Antonio Panzeri, über dessen NGOs die Schmiergeldzahlungen wohl abgewickelt wurden.
Nett ist auch, womit die beiden Jungs ihr Geld verdient haben: Nicolas und Ugo haben Hanfblüten verkauft. Alles ganz legal natürlich. Vermutlich soll das Zeug nur zu kosmetischen Zwecken benutzt werden. Obwohl der THC-Gehalt so gering ist, fühlt man sich als Beobachter doch ein wenig benebelt. mgr
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat in letzter Zeit vor allem für Zwist auf dem internationalen Parkett oder zumindest nicht für weniger davon gesorgt. Umstrittene Aussagen zu Taiwan, Beharren auf AKWs für Klimaschutz und über Monate eine harte Linie zur Plattformarbeitsrichtlinie. Heute, mit dem Start des zweitägigen “Gipfels für einen neuen globalen Finanzierungspakt” in Paris, könnte es Macron gelingen, sich wieder einmal positiv ins Licht zu rücken.
Bei dem Gipfel soll ein wenig bekannter Teil des Pariser Klimaschutzabkommens mehr Aufmerksamkeit zukommen: die Frage nach der Finanzierung und dem Finanzsystem. Macron will bei dem zweitägigen Treffen die diversen Debatten dazu unter einem Dach zusammenführen. Es geht beispielsweise um Partnerschaften für grünes Wachstum oder die Weiterentwicklung von multilateralen Entwicklungsbanken. Auch private Investoren sollen besser eingebunden werden.
Zumindest angesichts der Liste der Teilnehmer kann Macron in der Mission “Einigen statt Spalten” schon einmal einen Teilerfolg für sich verbuchen: Zahlreiche bedeutende Akteure der Weltbühne haben ihr Kommen angekündigt. Von Bundeskanzler Olaf Scholz, Lula da Silva, Chinas Premier Li Qiang bis hin zu UN-Generalsekretär António Guterres, Weltbankchefin Kristalina Georgiewa und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Wenn dann am Ende noch ein passabler “operativer” Fahrplan mit praktischen Maßnahmen herauskommt, dann wäre noch einiges mehr erreicht. Mehr dazu lesen Sie in unserer Analyse von Claire Stam.


Mit seinem “Gipfel für einen neuen globalen Finanzpakt” will der französische Präsident Emmanuel Macron ab heute der internationalen Klimafinanzierung neuen Schwung, einen neuen Rahmen und neue Geldgeber verschaffen. Das zweitägige Treffen in Paris soll die diversen Debatten über Klimafinanzen unter einem Dach zusammenführen. Es soll private Investoren verstärkt für die Kapitalbedürfnisse der globalen Klimawende in die Pflicht nehmen.
Und es soll allgemein die Aufmerksamkeit auf das bislang oft vernachlässigte dritte Ziel des Pariser Abkommens aus Artikel 2 I c richten: Nämlich neben der Begrenzung der Temperatur und der Anpassung an den Klimawandel die “Finanzflüsse kompatibel zu machen mit einem Pfad Richtung niedriger Emissionen von Treibhausgasen und einer klimafesten Entwicklung.”
Die Organisatoren hoffen auf eine “gemeinsame Diagnose” der Herausforderungen und einer “neuen politischen Vision”, die zu “greifbaren, umsetzbaren” Ergebnissen führen sollen, heißt es aus dem Élysée-Palast. Nicht geplant ist eine Wort für Wort ausgehandelte gemeinsamen Erklärung, sondern ein “operativer” Fahrplan mit praktischen Maßnahmen.
Macron hatte das Ganze auf dem G20-Gipfel im November 2022 angekündigt, nachdem er die “Bridgetown Initiative” von Mia Mottley, der Premierministerin von Barbados, unterstützt hatte. Mottley wird prominenter Gast in Paris sein. Ihre Agenda sieht ein globales Finanzsystem vor, das sich an den Bedürfnissen der am stärksten gefährdeten Länder orientiert: Es soll insgesamt Finanzmittel von 100 Milliarden Dollar mobilisieren, insbesondere aus dem Privatsektor. Diese sollen die Kapitalkosten in den Entwicklungsländern senken, um die Folgen des Klimawandels zu bewältigen. Das gilt zusätzlich zu den 100 Milliarden Dollar, die die Industrieländer ab 2020 dem Globalen Süden versprochen haben und die sie bisher nicht vollständig geliefert haben.
Kurz vor Beginn des Gipfels in Paris haben Staats- und Regierungschefs die Forderung nach einer klimafesten Reform des Finanzsystems unterstützt und nach einem “neuen globalen Konsens” in dieser Frage gedrängt, darunter US-Präsident Joe Biden, Bundeskanzler Olaf Scholz, Brasiliens Präsident Lula da Silva, Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa und die Chefin der EU-Kommission Ursula von der Leyen.
Ohnehin haben die G20 eine Reform der Bretton-Woods-Finanzarchitektur gefordert, die angesichts der Herausforderungen des 21. Jahrhunderts nicht mehr funktionsfähig sei. “Die Klimafrage kollidiert mit der Agenda der Reform der Bretton-Woods-Institutionen“, analysiert Philippe Zaouati, CEO von Mirova, einer auf nachhaltige Investitionen spezialisierten Vermögensverwaltungsgesellschaft.
Der französische Investor ist der Ansicht, dass das gesamte System “überdacht” und an die neuen klimatischen Gegebenheiten “angepasst” werden muss. Und das setzt eine stärkere Beteiligung des privaten Finanzsektors voraus. “Öffentliche Entwicklungshilfe ist gut, aber nicht alles”, betont Zaouati. “Derzeit sind zum Beispiel Pensionsfonds noch viel zu zögerlich, um in südliche Länder zu investieren. Dabei besteht gerade dort ein großer Investitionsbedarf.”
Die bisherigen Debatten haben aus Sicht von Paris ein Problem: Sie finden über zahlreiche Kanäle statt, die nicht unbedingt miteinander übereinstimmen und als entfernt voneinander gelten: beim Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank, bei den UN-Klimaverhandlungen, bei G7 und G20. “Diese internationalen Foren sind derzeit Gegenstand unzusammenhängender Aktionen, was die Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen betrifft. Dieser Gipfel soll einen gemeinsamen Rahmen schaffen“, sagt Laurence Tubiana, Vorsitzende der European Climate Foundation und Architektin des Pariser Abkommens. Sie fordert die Umsetzung des Finanzziels des Pariser Abkommens.
Paris strebt an, die zwei Tage im Palais Brongniart zum Knotenpunkt dieser verschiedenen Verhandlungsräume zu machen. Macron will trotz der Spannungen zwischen China und den USA, dem Krieg in der Ukraine und der tiefen Verärgerung der Länder des Südens erfolgreich sein. Der geopolitische Kontext ist “sehr kompliziert”, bemerkt Bertrand Badré, Direktor des Fonds für verantwortungsbewusste Investitionen Blue Orange Capital und ehemaliger Generaldirektor für Finanzen der Weltbank. “Es gibt immer weniger Lust, sich zu einigen.” Aber “wenn es uns nicht gelingt, den Entwicklungsländern in der Frage der Finanzierung entgegenzukommen, werden sie nicht am Verhandlungstisch sitzen bleiben und mit der Extraktion von Kohle, Öl und Gas beginnen”, befürchtet er.
Es haben sich rund 50 Staats- und Regierungschefs angekündigt. Neben der charismatischen Mia Mottley aus Barbados hat auch der Präsident Brasiliens, Lula da Silva, bereits seine Teilnahme zugesagt. Auch China dürfte mit seinem Premierminister Li Qiang hochrangig vertreten sein. UN-Generalsekretär António Guterres kommt ebenso wie die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, der deutsche Bundeskanzler, Olaf Scholz oder die Präsidenten von Ghana, Nana Akufo-Addo, Senegal, Macky Sall und Kenia, William Ruto. Die USA werden voraussichtlich durch den Klimagesandten John Kerry und Finanzministerin Janet Yellen vertreten sein.
Die wichtigsten internationalen Organisationen, große Stiftungen, der Privatsektor, der akademische Sektor und die Zivilgesellschaft werden ebenfalls anwesend sein. Unter ihnen: der neue Präsident der Weltbank, Ajay Banga, der seit dem 1. Juni im Amt ist und für den dieser Gipfel das erste große internationale Treffen sein wird. Außerdem werden die geschäftsführende Direktorin des IWF, Kristalina Georgieva, und Mafalda Duarte, die sich anschickt, die Leitung des Grünen Klimafonds zu übernehmen, auf dem Gipfel sprechen. Christine Lagarde, die Präsidentin der Europäischen Zentralbank und ehemalige Chefin des IWF, wird ebenfalls vor Ort sein, wie auch Mark Carney, ehemaliger Gouverneur der Bank of England, der die Initiative Gfanz (Glasgow Financial Alliance for Net Zero) ins Leben gerufen hat.
Geplant sind sechs Round Table-Gespräche zu folgenden Themen:

Sie haben gerade Ihr Amt angetreten. Was ist Ihrer Meinung nach in dieser frühen Phase Ihrer Amtszeit das drängendste Thema?
Im Moment ist die ganze Diskussion über De-Risking unser Hauptanliegen. In Europa wird viel darüber geredet, in China auch. Wir sind der Meinung, dass noch einiges getan werden muss, um dieses Konzept mit Inhalt zu füllen. Wir müssen uns genauer ansehen, was es in Europa bedeutet – und zugleich darüber nachdenken, wie es im chinesischen Kontext gesehen wird. Tatsächlich betreibt China seit zehn Jahren De-Risking. Sie nennen es nur anders: “Made in China 2025”, “Dualer Kreislauf” oder “14. Fünfjahresplan”.
Wie kann dann das De-Risking der EU klappen?
Wir müssen gründlich analysieren, was als Risiko und als Schwachstelle wahrnehmbar ist. Wir müssen uns die Handels- und Produktionsströme ansehen, um besser zu verstehen, was De-Risking für das eigentliche Geschäft bedeutet. Das hat Priorität. Das wird aber ein wenig Nachdenken erfordern und kann nicht über Nacht gelingen. Die Wortwahl spielt eine große Rolle. De-Risking bestimmt als Konzept die gesamte Agenda – ebenso wie die Einteilung der EU von 2019, China als “Partner, Konkurrenten und strategischen Rivalen” zu sehen. Wir müssen uns wirklich über das Konzept De-Risking selbst und seine Auswirkungen im Klaren sein.
China ist immer noch ein wichtiger Handelspartner für die meisten Länder in Europa, insbesondere für Deutschland. Eine Diversifizierung wird kompliziert werden. Welche Trends erwarten Sie?
Viele Dinge werden sich nicht wirklich ändern. Was das verarbeitende Gewerbe betrifft, so hat China seinen Anteil am weltweiten Export weiter erhöht. Was wir derzeit sehen, ist, dass die Regierung weiterhin einen Schwerpunkt auf angebotsseitige Unterstützung der Exportproduktion legt. Zum Beispiel durch erleichterten Zugang zu Krediten. China wird auch weiterhin eine recht starke Exportproduktion aufweisen, was zusätzlich durch die Abschwächung des Renminbi gefördert wird, zumindest kurzfristig.
Das klingt für die chinesische Konjunktur erst mal nicht schlecht.
Andererseits kommt der schwache Yuan aber den chinesischen Haushalten nicht gerade zugute, denn er verteuert importierte Waren. Das zeigt, dass die staatliche Unterstützung jetzt eher der Angebotsseite als der Nachfrageseite zugutekommt. Derzeit gibt es nicht viele Maßnahmen, die das Konsumwachstum fördern. Aber genau das würden wir gerne sehen.
Was würde helfen, den Konsum anzukurbeln?
Die Menschen in China müssen das Gefühl haben, dass sich der Immobiliensektor stabilisiert. 70 Prozent des Vermögens der privaten Haushalte sind in Immobilien gebunden, und solange die Menschen nicht wissen, wie es mit den Immobilien weitergeht, werden sie sich in ihrem Konsumverhalten zurückhalten.
Wie sehen Sie die derzeitige wirtschaftliche Lage Chinas im Allgemeinen nach dem Ende von Null-Covid?
Es ist noch zu früh für eine Bewertung. Wir haben gesehen, dass die Dinge im ersten Quartal relativ gut liefen, gefolgt von einer gewissen Abschwächung im zweiten Quartal. Wir sind etwas besorgt, denn wir sehen Schwächen in einigen Sektoren – vor allem bei hochwertigen Industriegütern. Die Dienstleistungen schneiden besser ab. In drei Monaten werden wir vielleicht ein klareres Bild haben.
Wie sehr trifft diese Wachstumsunsicherheit die europäischen Unternehmen?
Meiner Beobachtung nach verlieren die BIP-Zahlen immer mehr an Bedeutung. Man muss sich eher einzelne Sektoren genauer ansehen. Als die Wirtschaft der Volksrepublik zwölf Prozent pro Jahr wuchs, konnte jeder dort wachsen. Jetzt, wo sich das Wachstum abschwächt, ist es nicht mehr universell. Aber in einigen Sektoren gibt es in China immer noch erhebliche Chancen.
Welche Sektoren könnten das sein?
Wir haben bereits in einem unserer Papiere darauf hingewiesen, dass China in den verschiedenen Branchen unterschiedliche Bedeutung haben wird. Es gibt Branchen, in denen China in Zukunft mehr als die Hälfte der weltweiten Nachfrage ausmachen wird. Und es gibt andere, die einfach so kompliziert sind, dass man sich fragen könnte: Ist China wirklich etwas für mich? Wenn Sie also Spezialchemikalien herstellen, dann ist China der richtige Ort für Sie. Wenn Sie aber digitale Plattformen oder digitale Inhalte herstellen, dann könnte China etwas schwieriger sein.
Die Unternehmen beklagen sich über die verschiedenen Sicherheitsgesetze, die ihnen das Leben immer schwerer machen. Gleichzeitig arbeitet Europa an Gesetzen, die Unternehmen zwingen, ihre Wertschöpfungsketten im Ausland zu bewerten und zu kontrollieren. Was bedeutet das alles für etablierte oder auch neue Lieferketten in China? Und wie können sich Unternehmen – insbesondere kleine und mittlere Firmen (KMU) – in diesem komplizierten Umfeld zurechtfinden?
Wenn Sie kein sehr großes Unternehmen sind und den Punkt kommen, an dem Sie zwei getrennte Wertschöpfungsketten aufbauen und betreiben müssen – eine für den Westen und eine für China – könnten die Kosten verschreckend hoch werden. Ich würde lieber in eine Lieferkette investieren, die sehr gut funktioniert, in einem Markt, den ich kenne, als zwei aufzubauen – und die zweite dann in einem Markt zu betreiben, mit dem ich nicht so gut vertraut bin. Das trägt zu der Unsicherheit bei, die viele Unternehmen derzeit empfinden und die sich auch in unserer neuen Umfrage zum Geschäftsklima widerspiegelt.
Hat das konkrete Folgen in den europäischen Unternehmen?
Das beginnt, sich auf Investitionsentscheidungen auszuwirken. Wenn ich nicht mit einem gewissen Maß an Sicherheit vorhersagen kann, wie die Welt in fünf Jahren aussehen wird und ob China dann der richtige Ort für mich ist, werde ich nicht investieren. Ich kenne kein einziges KMU, das sich seit dem Beginn von Covid in China niedergelassen hat. Das hat auch nicht nur mit der Politik zu tun. Viele unserer Unternehmen waren während der Pandemie erschüttert, als sie erkannten, wie anfällig ihre Lieferketten waren und wie abhängig sie von einem einzigen Standort geworden waren.
Was können die Unternehmen in dieser Situation tun?
Die Leute sitzen über ihren Taschenrechnern und versuchen herauszufinden, welche Investitionen sie tätigen müssen – und wie diese Investitionen zu den erwarteten Gewinnen passen, die sie auf dem chinesischen Markt erzielen könnten. Und je mehr die Kosten für eine etwaige Trennung der Lieferkette steigen, desto höher wird die Schwelle, ab der es für Unternehmen interessant wird, sich hier in China niederzulassen.
Wie macht sich das in China bemerkbar?
Das stellt ein Risiko dar und schränkt die Vielfalt an Größe und Art der Unternehmen ein, die ein längerfristiges Interesse an einem Engagement in China haben. Ich denke, das sind genau die Art von Gesprächen, die wir mit der chinesischen Regierung führen müssen: Verordnungen und Beschränkungen haben Konsequenzen im wirklichen Leben und Konsequenzen in Form investierter Euros und US-Dollars. Peking hat noch einiges zu tun, um der internationalen Geschäftswelt zu zeigen, dass China ein effizienter und berechenbarer Ort ist, an dem sich Unternehmen niederlassen können.
Stimmt es, dass die lokalen Regierungen nach wie vor stark bestrebt sind, ausländische Unternehmen anzuziehen – auch wenn die Zentralregierung heutzutage mehr Wert auf Sicherheit und Stabilität als auf die Wirtschaft legt?
Ja, die meisten Provinzen und Gemeinden sind sehr daran interessiert, ausländische Investitionen anzuziehen – vor allem unter den derzeitigen Umständen einer sich abschwächenden Wirtschaft. Ich denke, alles, was die Wirtschaftstätigkeit ankurbelt, ist willkommen. Das stelle ich persönlich fest, wenn ich auf Reisen bin. Es gibt ein großes Interesse daran, mit der ausländischen Geschäftswelt in Kontakt zu treten – und wir wissen das natürlich zu schätzen.
Peking sendet eine nicht ganz so offene Botschaft.
Ehrlich gesagt, waren viele von uns nach dem KPCh-Kongress im Oktober etwas besorgt, weil der Schwerpunkt so sehr auf Sicherheit und Eigenständigkeit lag, was in eine andere Richtung zu gehen schien. Aber dann hatten wir den Nationalen Volkskongress im März, auf dem viel mehr über die unerschütterliche Unterstützung von Reformen und Öffnung gesprochen wurde, was schön zu hören war.
Was denken Sie, in welche Richtung es künftig gehen wird?
Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir nicht wirklich, welche Seite sich durchsetzen wird. Es ist wunderbar, dass die lokalen Regierungen mit uns reden wollen. Wir freuen uns über die Aufmerksamkeit. Aber wird das auch zu Ergebnissen vor Ort führen? Ich denke, das bleibt abzuwarten.
Jens Eskelund lebt seit 25 Jahren in China und ist Hauptvertreter der dänischen Unternehmensgruppe Maersk. Er war bereits zwei Amtszeiten lang Vizepräsident der EU-Kammer – von 2019 bis 2021 und von Oktober 2022 bis Mai 2023 – und war seit der Gründung der Kammer auch aktiv an den Arbeitsgruppen beteiligt. Er war außerdem Vorstandsmitglied und Vorsitzender der dänischen Handelskammer in China.
22.06.2023 – 08:30-09:30 Uhr, online
DGAP, Discussion Morning Briefing on Geopolitical Challenges
The German Council on Foreign Relations (DGAP) looks at the European Commission’s Economic Security Strategy. INFOS & REGISTRATION
23.06.2023 – 08:45-14:30 Uhr, London (UK)/online
GMF, Conference Building A Transparent and Accountable Ukraine: Key Steps to Recovery
The German Marshall Fund (GMF) brings together officials from governments, donor agencies, and civil society to discuss how Ukraine can prepare for a process of recovery and reconstruction that promotes digitalization, strong governance, transparency, and integrity. INFOS & REGISTRATION
23.06.2023 – 09:00-18:00 Uhr, Neapel (Italien)
EC, Conference 1st Conference on Sustainable Banking and Finance CSBF 2023
The European Commission (EC) aims at stimulating the discussion about the bidirectional nature of the relationship between climate change and finance. INFOS & REGISTRATION
23.06.2023 – 09:30-12:30 Uhr, Brüssel (Belgien)/online
SGI Europe, Conference The EU Single Market at 30: What role for SGIs?
SGI Europe reflects the discussion about the bidirectional nature of the relationship between climate change and finance. INFOS & REGISTRATION
24.06.-25.06.2023, Amsterdam (Niederlande)
Steconf, Conference 3rd International Conference on Innovation in Renewable Energy and Power
Steconf addresses global and regional trends, innovative application frameworks, and current research. INFOS & REGISTRATION
26.06.-30.06.2023, Trier
ERA, Seminar Summer Course on European Intellectual Property Law
The Academy of European Law (ERA) provides a thorough introduction to European intellectual property law. INFOS & REGISTRATION
26.06.2023 – 15:00-17:15 Uhr, online
FZE, Konferenz Die Energiewirtschaft und Gaia-X
Das Forum für Zukunftsenergien (FZE) diskutiert das Gaia-X-Projekt im Kontext der Digitalisierung der deutschen Industrie. INFOS & ANMELDUNG
27.06.-01.07.2023, Champaign-Urbana, Illinois (USA)
Aspen Institute, Conference U.S.-German Forum on Future Agriculture
Das Aspen Institute (AI) beleuchtet Lösungsansätze für eine nachhaltige Zukunft der Landwirtschaft und des ländlichen Raums. INFOS & REGISTRATION
27.06.-29.06.2023, Prag (Tschechien)
Conference International Flow Battery Forum 2023
The conference addresses the central role that flow batteries play in the energy storage sector. INFOS & REGISTRATION
27.06.-28.06.2023, München
SZ, Konferenz Nachhaltigkeitsgipfel
Die Süddeutsche Zeitung (SZ) widmet sich der Frage, ob Deutschland den Umbau hin zu einer grünen Wirtschaft schafft. INFOS & ANMELDUNG
27.06.2023 – 10:30-16:45 Uhr, Brüssel (Belgien)/online
Bruegel Future of Work and Inclusive Growth Annual Conference 2023
Bruegel discusses necessary skills demanded by the AI and green sectors, examines the impact of technology adoption on labour markets, and addresses the growing inequality brought on by digitalisation of capital. INFOS & REGISTRATION
27.06.2023 – 14:30-16:30 Uhr, Brüssel (Belgien)/online
ERCST, Discussion EU Climate Policy & Electricity Market
The European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition (ERCST) addresses the interactions between EU climate policy and the electricity market. INFOS & REGISTRATION
27.06.2023 – 16:30-18:30 Uhr, Leipzig
DIHK, Diskussion Aus Alt mach Neu: Wege in die zirkuläre Wertschöpfung in der Automobilindustrie
Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) geht der Frage nach, was regulatorische und gesetzlichen Rahmenbedingungen für eine Circular Economy sind. INFOS & ANMELDUNG
27.06.2023 – 17:30-18:15 Uhr, Berlin
EBD, Diskussion Die türkische Präsidentschaftswahl und die europäisch-türkischen Beziehungen – Ist es Zeit für eine “Zeitenwende”?
Die Europäische Bewegung Deutschland (EBD) beschäftigt sich mit der Bedeutung der türkischen Präsidentschaftswahl für die europäisch-türkischen Beziehungen. INFOS & ANMELDUNG
Die Kommission hofft, lange Vakanzen an der Spitze der Vertretungen in mehreren Mitgliedstaaten zu beenden, indem sie die Posten deutlich attraktiver macht. Nach Information von Table.Media werden die Vertretungen der Kommission in Berlin, Warschau und Budapest aufgewertet. Der Leiter – er oder sie ist der Vertreter der Kommission in dem jeweiligen Mitgliedstaat – bekleidet künftig den Rang eines Direktors.
Direktoren sind in den Besoldungsgruppen AD 13 und 14 eingestuft und verdienen im Grundgehalt zu Beginn ihrer Dienstzeit 14.644,53 Euro monatlich, beziehungsweise 16.569,31 Euro monatlich. Allerdings greift je nach Standort ein Berichtigungskoeffizient (Polen derzeit 70,1; Ungarn derzeit 69,9), wodurch die Grundgehälter dort deutlich niedriger sind.
Jörg Wojahn, der Vertreter der Kommission in Berlin, räumt nach Informationen von Table.Media im Sommer seinen Posten. Hinweise, wonach Martin Selmayr, der Vertreter der Kommission in Österreich und ehemaliger Generalsekretär der Kommission, nach Berlin wechselt, gelten indes als Spekulation.
Mit der Hochstufung des Vertreters in Berlin, Warschau und Budapest ziehen die jeweiligen Vertretungen mit Paris gleich, wo bereits bisher der Leiter im Direktorenrang arbeitet. Wie zu hören ist, gibt es Unmut in Italien und Spanien: Die Regierungen bestehen darauf, dass die Kommission auch die Vertreter in ihren Ländern zu Direktoren macht.
Bislang wurden die Leiter der Vertretungen als Gruppenleiter (head of unit) eingestuft und verdienen im Grundgehalt zu Beginn ihrer Amtszeit in den Besoldungsstufen AD 9 bis AD 12. Das sind in Deutschland etwa zwischen 8.936,26 Euro und 12.943,31 Euro monatlich.
Die Leitung der Regionalvertretung der Kommission in München ist seit September 2020 vakant, das Büro in Bonn wird seit September 2021 kommissarisch aus Berlin geleitet. Um die Posten attraktiver zu machen, hat sich die Kommission entschieden, die Leiter der Regionalbüros künftig als Gruppenleiter einzustufen. Bislang hatten sie keinen ausgewiesenen Rang.
Die Regionalvertretung in Bonn, die demnächst nach Köln umziehen soll, ist zuständig für Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen und das Saarland. In diesen Bundesländern wohnen rund 30 Millionen Bürger. Dies entspricht in etwa der addierten Einwohnerzahl der Mitgliedstaaten Portugal, Schweden und Tschechien. Die Regionalvertretung in München ist zuständig für Baden-Württemberg und Bayern. In diesen Bundesländern wohnen etwa 25 Millionen Menschen. Die betroffenen Landesregierungen hatten wiederholt bei der Kommission gegen die Vakanzen protestiert. Die Vertretungen unterstehen direkt der Kommissionspräsidentin. Die Besetzung der Posten fällt in die Kompetenz Ursula von der Leyen.
Da etwa in München mindestens zwei Bewerbungsrunden, bei denen nur Kommissionsbeamte infrage kamen, ohne Besetzung der Leitungsposition zu Ende gingen, hat die Kommission bei dem gerade laufenden Verfahren auch externe Bewerber zugelassen.
Die Höherstufung der Leiter der Regionalbüros in den Rang von Gruppenleitern stößt auf Kritik: Während Gruppenleiter in der Kommission Personalverantwortung für 15 bis 20 Beamte haben, arbeiten etwa im Regionalbüro in Bonn nur noch insgesamt drei Mitarbeiter. Eine so geringe Zahl von Mitarbeitern passe nicht zu dem Posten eines Gruppenleiters, heißt es in der Behörde. mgr
Die EU macht Ernst damit, die Schlupflöcher in ihrem Sanktionsregime gegenüber Russland zu schließen. Die Botschafter der Mitgliedstaaten haben am Mittwoch dem elften Sanktionspaket zugestimmt. Es sieht erstmals ein Instrument vor, um Unternehmen und Drittstaaten mit Strafmaßnahmen zu belegen, die Umgehungsgeschäfte betreiben oder sich dafür als Plattform anbieten.
Das Sanktionspaket werde Putins Kriegsmaschinerie mit verschärften Ausfuhrbeschränkungen einen weiteren Schlag versetzen und auf Einrichtungen abzielen, die den Kreml unterstützen, begrüßte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Einigung. Das Instrument gegen die Umgehung von Sanktionen werde Russland daran hindern, sanktionierte Güter in die Hände zu bekommen.
Allerdings musste die EU-Kommission ihren ursprünglichen Vorschlag von Ende April mehrfach überarbeiten und das Instrument entschärfen. Dies auf Druck Deutschlands und weiterer Staaten. “Wir müssen verhindern, dass Russland sanktionierte kriegswichtige Güter über Drittstaaten erhält”, heißt es in einer Weisung aus Berlin noch letzte Woche. Die Bekämpfung von Sanktionsumgehung habe zwar höchste Priorität. Gleichzeitig dürften aber Drittstaaten nicht auf die Seite Russlands getrieben werden.
Deutschland zog seinen Prüfvorbehalt erst vor der letzten Runde im AstV zurück. Das Instrument gegen Drittstaaten soll jetzt in einem vorsichtig abgestuften Verfahren und nur in letzter Instanz zum Einsatz kommen. Bevor Strafmaßnahmen gegen Drittstaaten verhängt werden können, muss die EU-Kommission nachweisen, dass alle anderen diplomatischen Bemühungen gescheitert sind. Das elfte Sanktionspaket schaffe “in letzter Instanz, neue außergewöhnliche Maßnahmen”, um den Verkauf, Transfer oder Export von sensiblen dual-use Gütern und Technologie in Drittstaaten einzuschränken, sagten nun Diplomaten. Die EU-Staaten müssten Strafmaßnahmen gegen Drittstaaten jeweils im Konsens zustimmen.
Konkret werden Drittstaaten ins Visier genommen, die über längere Zeit als Schlupflöcher dienen und mit Blick auf Umgehungsgeschäfte als “besonders hohes Risiko” eingeschätzt werden. Gelistet werden sollen nur Firmen und Drittstaaten, wenn es einen deutlichen Bezug zu kriegsrelevanten Gütern aus der EU gibt. Es brauche eine klare Abgrenzung zu extraterritorialen Sanktionen, wie die EU sie sonst ablehne, sagten Deutschland und andere Mitgliedstaaten.
Teil des Pakets ist auch ein Hafenanlaufverbot für Schiffe, die in Ship-to-Ship-Transfers zur Umgehung des Ölimportverbots auf dem Seeweg involviert sind. 71 Personen und 33 Entitäten werden zudem gelistet, weil sie im Verdacht stehen, unter anderem an der Deportation von ukrainischen Kindern nach Russland beteiligt zu sein. Neu können künftig auch Personen und Entitäten mit Strafmaßnahmen wie Einreise- und Kontensperren belegt werden, wenn sie sich an der Umgehung von Sanktionen beteiligen.
Die EU-Kommission wollte eigentlich sieben chinesische Firmen mit Sanktionen belegen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur afp ist jetzt nur die Listung von drei mehrheitlich russisch kontrollierten Firmen mit Sitz in Hongkong vorgesehen.
Die Mitgliedstaaten müssen nun bis Freitag im schriftlichen Verfahren die Einigung im AstV noch formell absegnen. Das elfte Sanktionspaket könnte noch dann noch am selben Tag der Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft treten. sti
Die Ukraine muss weiter auf den Start von Beitrittsgesprächen mit der EU warten. Der EU-Gipfel in der kommenden Woche in Brüssel will das Land zu zusätzlichen Reformen ermuntern, jedoch kein Datum für den Start von Verhandlungen nennen. Dies geht aus einem Entwurf der Schlussfolgerungen für das Gipfeltreffen hervor, der Table.Media vorliegt. Der Europäische Rat erkenne die “substanziellen Bemühungen” der Ukraine an, heißt es in dem Dokument. “Er ermuntert die Ukraine, auf seinem Reformpfad fortzufahren.” Eine Beitrittskonferenz wird jedoch nicht in Aussicht gestellt.
Die Ukraine hatte den Start von Verhandlungen noch in diesem Jahr gefordert. Die EU-Kommission hat dies jedoch von sieben Bedingungen abhängig gemacht. Bisher seien nur zwei der sieben Kriterien erfüllt, hieß es bei einem Treffen der EU-Botschafter am Mittwoch in Brüssel. “Die Haupthürden für die Ukraine sind die Reform des Verfassungsgerichts und der Kampf gegen die Korruption und die Oligarchen“, sagte ein Diplomat. Umgesetzt habe die Ukraine dagegen die Empfehlungen, den politischen Einfluss auf die Medien zu verringern und das Justizsystem zu reformieren.
Die EU-Staaten müssen die Aufnahme von Beitrittsgesprächen einstimmig beschließen. Als Grundlage gilt ein Fortschrittsbericht zu den Kandidatenländern, den die EU-Kommission im Oktober vorlegen will. Erweiterungskommissar Olivér Várhelyi hat gestern nur einen mündlichen Zwischenbericht gegeben.
Vor einem Jahr hatte der EU-Gipfel beschlossen, der Ukraine den Kandidatenstatus zu verleihen. Vor allem Polen und die baltischen Länder fordern seitdem den schnellen Start von Beitrittsverhandlungen. Deutschland steht auf der Bremse – und verweist auf die EU-Kommission. eb
Bei einer Geberkonferenz in London sind mehrere Milliarden an Hilfen für die Ukraine von den Staats- und Regierungschefs zugesagt worden. Londons Premier Rishi Sunak stellte verschiedene Unterstützungsmaßnahmen vor, darunter zusätzliche Garantien in Höhe von drei Milliarden Dollar, um Kredite der Weltbank freizusetzen. Diese beinhalten Zusagen über 20 Millionen Pfund (rund 23 Millionen Euro), um den Zugang zur Multilateralen Investitionsgarantie-Agentur der Weltbank zu verbessern, die politische Risiken für Projekte absichert.
Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, erklärte, die EU werde der Ukraine 50 Milliarden Euro für die Jahre 2024 bis 2027 zur Verfügung stellen, während US-Außenminister Antony Blinken 1,3 Milliarden Dollar an zusätzlicher Hilfe anbot. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock erklärte, Berlin biete für 2023 zusätzliche 381 Millionen Euro an humanitärer Hilfe an.
Der ukrainische Premierminister Denys Schmyhal sagte am Mittwoch, er rechne mit der Zusage von fast sieben Milliarden Dollar an Hilfsgeldern, nachdem er auf einer Londoner Konferenz erklärt hatte, Kiew stehe aufgrund des russischen Krieges vor dem größten Wiederaufbauprojekt in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg.
Sunak adressierte auch eines der größten Probleme vieler Unternehmen, die in der Ukraine investieren wollen – die Versicherung gegen Kriegsschäden und Zerstörungen. Dagegen kündigte er den Londoner Konferenzrahmen für Kriegsrisikoversicherungen an, der den Weg für risikoärmere Investitionen ebnen soll.
Das Unternehmen Marsh McLennan, das unter anderem Rückversicherungen anbietet und nach eigenen Angaben an dem Programm der britischen Regierung mitgewirkt hat, sagte, dass eine Kriegsrisikoversicherung in einem noch nie dagewesenen Umfang zur Verfügung stehen und von der Regierung abgesichert werden müsse.
Der Krieg Russlands gegen die Ukraine tobt seit fast 16 Monaten. Zahlreiche Wohnhäuser, Krankenhäuser und wichtige Infrastruktureinrichtungen sind zerstört worden. Die Gesamtrechnung dürfte enorm sein: Die Ukraine, die Weltbank, die Europäische Kommission und die Vereinten Nationen schätzten im März die Kosten für das erste Kriegsjahr auf 411 Milliarden Dollar. Sie könnten leicht mehr als eine Billion Dollar erreichen. rtr/lei
Die Luftwaffeninspekteure Deutschlands, Frankreichs und Spanien haben auf der Luftfahrtmesse Le Bourget bei Paris einen Vertrag zur kooperativen Luftkriegsführung unterzeichnet – und damit bestehende Vereinbarungen bekräftigt. Das Future Combat Air System (FCAS) soll demnach bis 2040 in einen Verbund mit bewaffneten und unbewaffneten Drohnen eingebunden werden, der unter dem Namen Next Generation Weapon System (NGWS) firmiert.
Der französische Luftwaffeninspekteur Stéphane Mille sagte gegenüber Table.Media, dass das Papier voriges Jahr konzipiert wurde, zu einer Zeit, “als das Projekt stockte”. Es gehe darum zu zeigen, “dass wir immer noch zusammenarbeiten”.
Die Entwicklung von FCAS hat mehrfach für Unstimmigkeiten zwischen Deutschland und Frankreich gesorgt, weil die beteiligten Unternehmen Airbus und Dassault sich um die Aufgabenverteilung stritten. 2019 schloss sich Spanien dem zunächst bilateralen deutsch-französischen Projekt an.
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kündigte zum Auftakt der Luftfahrmesse Le Bourget am Montag an, dass Belgien die Entwicklung von FCAS fortan als Beobachter begleiten werde. Der französische General Jean-Luc Moritz, der den operativen Teil von FCAS auf französischer Seite leitet, erklärte am Mittwoch, der nun geschlossene Vertrag mache die Anforderungen an das Waffensystem der nächsten Generation NGWS deutlich, ein zentrales Waffensystem zu bieten, das andere Systeme kommandieren, aber auch selbst kämpfen könne. Weiter solle NGWS in der Lage sein, mithilfe von künstlicher Intelligenz Drohnenmanöver zu synchronisieren und Kommunikation zu bieten, die resilient gegen Cyberangriffe ist. Gb

Seine Kollegen und sich selbst sieht Rainer Steffens als “Lobbyisten der besonderen Art”. Er war von 2011 bis 2018 bereits Leiter der Vertretung von Nordrhein-Westfalen (NRW) bei der EU in Brüssel. Seit November 2022 steht er nun zum zweiten Mal für die Interessen und Belange des Bundeslandes ein. Durch die offen zugänglichen Informationen zu Finanzen und Mitarbeitern sehe er in seiner Tätigkeit aber einen klaren Unterschied zum klassischen Lobbyismus, sagt Steffens. Als geborener Niedersachse hat er dennoch durch seine rheinländische Ehefrau und seinen Schwiegervater eine familiäre Beziehung zu NRW. Es freue ihn, das Bundesland mit seinen rund 18 Millionen Einwohnern vertreten zu können, nicht zuletzt da es “die größte Wirtschaftskraft einer Region in Europa” hat.
Das wichtigste Thema in der Arbeit des 62-Jährigen ist aktuell die Transformation der Industriegesellschaft vor dem Hintergrund von Green Deal und Fit für 55. Die Pläne korrespondieren laut Rainer Steffens sehr gut mit den Aktivitäten von EU-Kommission und Ursula von der Leyen. Auch die Geschehnisse rund um Lützerath haben den Leiter der Vertretung NRWs beschäftigt. Er verstehe die Kritik an dem Kohle-Kompromiss. “Es ist nicht das Beste, was man jemals hätte erreichen können, aber das, was politisch für uns möglich war.”
Als Jurastudent habe er selbst gegen Atomkraft demonstriert und sich auch später in seiner Karriere Umweltthemen gewidmet. Nach Tätigkeiten im niedersächsischen Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten hatte Rainer Steffens bis 2005 mehrere Funktionen im Bundesumweltministerium inne und war später der erste Referatsleiter Umwelt in der ständigen Vertretung Deutschlands.
Zwischen der vorherigen und der aktuellen Laufzeit als Leiter der Vertretung arbeitete er als Koordinator im Ausschuss der Regionen in Brüssel. “Das ist aus meiner Sicht das am meisten unterschätzte Organ in Brüssel”, sagt der 62-Jährige. Es setzt sich aus etwa 350 Vertretern europäischer Städte und Regionen zusammen, die sehr gute informelle Kontaktmöglichkeiten zu den Institutionen haben.
Die Begeisterung für Europa und die entsprechende Ausrichtung entwickelte Rainer Steffens bereits am Anfang seiner Karriere. Im Rahmen seines Jurastudiums in Hannover und Berlin absolvierte er Mitte der 80er-Jahre eine Wahlstation beim Europäischen Parlament in Luxemburg. Vor allem der interkulturelle Austausch mit anderen Studenten sei damals der Auslöser für seine Europabegeisterung gewesen, erzählt der 62-Jährige.
Neben vielen anderen Aufgaben richtet die Landesvertretung regelmäßig Veranstaltungen aus. Vor allem bekannt sind sie für die Karneval-Partys. “Das ist natürlich ein Teil des Kulturexports und wir sind stolz darauf, dass wir einmal im Jahr die größte Karnevals-Party westlich von Aachen ausrichten, bei der wir bis zu 800 Gäste begrüßen dürfen.” Rainer Steffens gefällt das bunte Treiben, die volle Hingabe sei aber nicht in seiner DNA verankert. Wobei er aufblühe, sei das Fahrradfahren. Im Keller des 62-Jährigen stehen zurzeit sieben Fahrräder, auf denen er, wenn möglich, jeden Tag zwölf Kilometer zur Arbeit hin und zurück fährt.
Seine Leidenschaft kombiniere er auch gelegentlich mit seinem Beruf: Mit Kollegen aus der Landesvertretung NRW habe er bereits eine einwöchige Radtour durch das Ruhrgebiet und das Rheinland bis nach Aachen organisiert. Ihm sei es wichtig, nicht nur auf dem “Brüsseler Parkett” tätig zu sein, sondern auch “in das Land NRW hineinwirken zu können”. Stationen der Tour waren unter anderem EU-geförderte Projekte, Schulen und Handwerksbetriebe, die sich besonders mit Europa verbunden fühlen, außerdem Gespräche mit Politikern aus den Städten. Für nächstes Jahr habe er schon Pläne, die Tour zu wiederholen. Von Kim Fischer
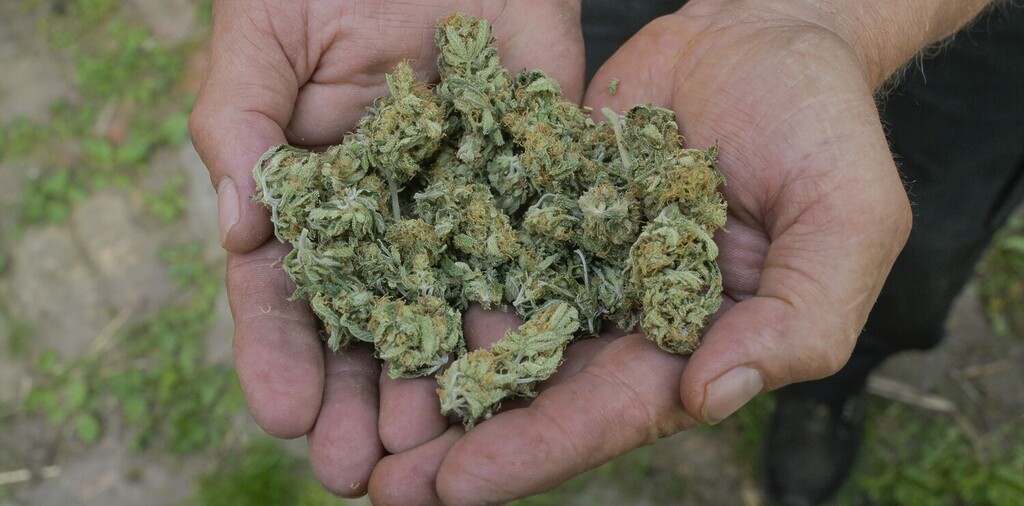
Katargate, der Korruptionsskandal rund um das EU-Parlament, ist noch sieben Monate nach den Razzien für Überraschungen gut. Überraschung Nummer eins: Am Montag stellt sich der Europaabgeordnete Andrea Cozzolino (ehemals S&D), dessen Auslieferung die belgischen Ermittlungsbehörden seit Monaten fordern, überraschend am Flughafen in Zaventem. Dem Napolitaner wird vorgeworfen, Bestechungsgelder von Marokko und Katar angenommen zu haben. Der inzwischen fraktionslose Abgeordnete bestreitet das vehement. Cozzolino war am Dienstag noch vom belgischen Ermittlungsrichter Michel Claise vernommen worden. Claise hat einen Ruf wie Donnerhall in Belgien.
Jetzt kommt Überraschung Nummer zwei: Claise musste nun die Ermittlungen wegen Befangenheit abgeben. Der Sohn des Richters, Nicolas, hat nämlich 2018 ein Unternehmen gegründet, mit Ugo, dem Sohn der sozialistischen EU-Abgeordneten Marie Arena. Der Name von Marie Arena, eine weitere belgische Sozialistin mit italienischen Wurzeln, tauchte in dem Skandal immer wieder auf. Sie leitete den Menschenrechtsausschuss, in dessen Umfeld dubiose Geschichten abliefen. Marie Arena hatte eine Affäre mit dem Hauptverdächtigen, Antonio Panzeri, über dessen NGOs die Schmiergeldzahlungen wohl abgewickelt wurden.
Nett ist auch, womit die beiden Jungs ihr Geld verdient haben: Nicolas und Ugo haben Hanfblüten verkauft. Alles ganz legal natürlich. Vermutlich soll das Zeug nur zu kosmetischen Zwecken benutzt werden. Obwohl der THC-Gehalt so gering ist, fühlt man sich als Beobachter doch ein wenig benebelt. mgr
