das Ende der Legislaturperiode rückt näher und damit steigt bei vielen Dossiers der Druck, doch noch irgendwie eine Einigung hinzubekommen. Till Hoppe hat sich im EU-Parlament umgehört, welche Gesetzesvorhaben Priorität haben. Mehr lesen Sie in den heutigen News.
Auch im Rat der Arbeitsminister (EPSCO) heißt es heute in Sachen Plattformarbeitsrichtlinie: Crunch Time. Nach eineinhalb Jahren der Debatte, vielem Hin und Her und vor allem vielen vergeblichen Versuchen der Einigung, könnte dort heute die Zeit richten, was zuvor nicht möglich erschien: eine Einigung, damit die Trilogverhandlungen starten können.
Nicht nur die Gewerkschaften drängen trotz Vorbehalten zu einem Ja zu dem zuletzt immer wieder aufgeweichten Text. Auch viele der Länder, die den Vorschlag zuletzt abgelehnt haben, weil sie sich für eine möglichst scharfe und umfassende Richtlinie aussprechen, signalisieren, dass sie angesichts der Zeitnot doch ins Lager der Befürworter einscheren könnten. Getreu dem Motto: Eine schwache Regelung, die gegebenenfalls im Trilog nachverhandelt werden kann, ist besser als gar keine.
Denn es gibt noch ein Problem: In Spanien stehen Ende Juli Neuwahlen an. Und dann könnte die konservative PP übernehmen, die weniger Interesse an einer strengen Richtlinie hat als die aktuelle, linksgerichtete Regierung unter Pedro Sánchez. Mehr zu einem neuen linken Parteienbündnis in Spanien lesen Sie übrigens in einer Analyse meiner Kollegin Isabel Cuesta Camacho.
Doch während es im Lager derjenigen, die beim EPSCO möglichst strenge Regeln wollen, doch Signale für ein Einlenken gibt, ist das auf der anderen Seite nicht unbedingt klar. Vor allem Frankreich steht hier im Fokus, weil es eine möglichst weiche Regel möchte und bis zuletzt Kritik an dem immer wieder veränderten Text angemeldet hat.
Einfacher wird die Einigung auch deswegen nicht, weil Deutschland sich sehr sicher enthalten wird. Dabei hatte das größte Land der EU zunächst aktiv an der Richtlinie mitverhandelt und könnte nach Sicht von Beobachtern auch jetzt durch ein aktives Agieren nicht nur für eine Einigung, sondern auch für einen ambitionierteren Text sorgen.
Man sagt gerne: Die Zeit heilt alle Wunden. Aber wird sie in dem Fall auch eine Einigung bringen? Es wird spannend.

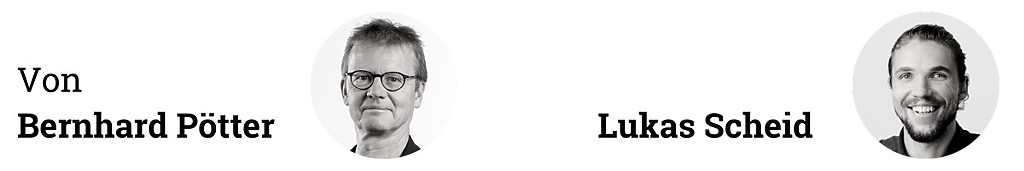
Die Europäische Union hat sich im Grundsatz bei einem der heißen Eisen der nächsten COP28 auf den gleichen Kurs festgelegt wie die COP-Präsidentschaft aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und andere Ölstaaten: die umstrittene CCS-Technik als Schlupfloch beim Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen zu nutzen. Die EU strebt nun auf der COP28 einen Beschluss an, der diese Formulierung erlauben würde. Das wurde am Rande der Bonner Klimakonferenz deutlich. Unabhängig davon bezeichnet eine neue Beurteilung des Thinktank-Projekts “Climate Action Tracker” die EU-Klimapolitik als “ungenügend“.
Nach einem Beschluss des EU-Ministerrats, der bereits im März gefasst wurde, soll es auf dem Weg zur Klimaneutralität nicht nur möglich sein, Emissionen aus Industrieprozessen, sondern auch aus der Energiewirtschaft abzuscheiden und zu speichern. Die Nutzung für den Energiesektor hatten die Europäer bislang abgelehnt und etwa bei der COP27 ein “Herunterfahren der fossilen Energien” ohne die Erwähnung von CCS gefordert. Die europäische Position verlangt jetzt nur noch ein “Energiesystem, frei von unverminderten fossilen Brennstoffen” – (“unabated fossil fuels”).
Diese Entscheidung, die bisher in der Öffentlichkeit kaum bekannt war, ist nicht nur eine Annäherung an öl- und gasproduzierende Länder wie die VAE oder die USA. Er steht auch im Widerspruch zur deutschen Position. Außenministerin Annalena Baerbock hatte auf dem Petersberger Klimadialog ihren Dissens mit dem nächsten COP-Präsidenten Sultan Ahmed Al Jaber zu diesem Punkt deutlich gemacht: “Wir müssen raus aus den fossilen Energien”, sagte sie – während Al Jaber betonte, die Welt müsse sich mit den Realitäten abfinden. “Fossile Brennstoffe werden auch weiterhin eine Rolle spielen“. Ziel solle es sein, “die Emissionen auslaufen zu lassen”.
Auch Staatssekretärin Jennifer Morgan hatte erklärt, sie glaube nicht, “dass CCS uns ans Ziel bringt”. Und im Wirtschafts- und Klimaministerium von Robert Habeck wird an einer deutschen CCS-Management-Strategie gearbeitet, deren klare Vorgabe lautet: CCS nur für Prozessemissionen aus der Industrie – nicht als Ausweg für die fossilen Brennstoffe im Energiebereich.
Diese Möglichkeit lässt die neue EU-Position nun aber offen. Ein “Energiesystem frei von unverminderten fossilen Brennstoffen” schließt die Anwendung der CCS-Technik als Möglichkeit auch in der Stromerzeugung und für die Verbrennung in der Industrie ein. Der Beschluss ist ein wenig konkreter als Al Jabers “Ende der Emissionen“, denn er verweist auf eine IPCC-Definition von “unabated fossil fuels” und auf einen Höhepunkt der Fossilen deutlich vor 2050. Al Jaber wiederum nutzte auf der Konferenz in Bonn bei einer Rede den EU-Begriff eines Energiesystems “free of unabated fossil fuels”.
Der EU-Kommission ist klar, dass der Beschluss den Fossilen selbst in einer klimaneutralen EU ein Existenzrecht als Brennstoffe zuweist. Ohnehin ist geplant, dass auch beim Netto-Null-Ziel der EU noch Emissionen aus Industrie oder Landwirtschaft in der Natur oder durch CCS gespeichert werden. In den Debatten für eine Öffnung zu “unabated fuels” hätten besonders Länder wie Polen oder Dänemark Druck gemacht, heißt es aus Verhandlungskreisen.
Mit dem Kurswechsel der EU wird ein Kompromiss in dieser umstrittenen Frage bei der COP28 wahrscheinlicher. Denn viele andere einflussreiche Staaten, deren Volkswirtschaften noch in großem Maß an fossilen Energien hängen, streben offen oder verdeckt dieses Ziel an: Die Ölstaaten, die USA, aber auch China oder europäische Länder wie Norwegen und Dänemark, die bereits an CCS-Projekten arbeiten.
Für die Wissenschaftler des “Climate Action Tracker” (CAT) ist CCS allerdings eine “gefährliche Ablenkung”. CCS solle nicht zur Verringerung der Emissionen im Stromsektor eingesetzt werden, weil “weitaus billigere erneuerbare Energien zur Verfügung stehen”, sagt Claire Stockwell von der CAT-Projektorganisation Climate Analytics. In ihrem aktuellen Gutachten auf halbem Weg zur COP28 kommt auch die EU nicht gut weg: Die anhaltenden Investitionen in neue fossile Infrastrukturen, insbesondere in LNG-Terminals und Gaspipelines, “untergraben die Dekarbonisierungsbemühungen der EU”, heißt es. Der CAT bewertet die Klimapolitik der EU insgesamt als “unzureichend”, auch weil die EU ihr bei der UN hinterlegtes Klimaziel (NDC) noch nicht wie versprochen angehoben hat.
Allgemein lauten die Hauptargumente der CCS-Kritiker: Die Technik sei teurer als die Erneuerbaren, weltweit nicht in großem Maßstab erprobt und komme für die nötige Halbierung der globalen Emissionen bis 2030 zu spät. Alden Meyer, Klimaexperte beim Thinktank E3G, hofft allerdings darauf, dass in einer möglichen Erklärung der COP28 zum Ausstieg mithilfe von CCS immerhin sektorale Ziele definiert würden: Dann sei der Zusatz “unabated” nicht so problematisch, so Meyer. Denn dann sei klar, dass nur die wenigen schwer zu dekarbonisierenden Sektoren auf Techniken wie CCS zurückgreifen könnten.
Außerdem müsse die EU dann das Potenzial von CCS realistisch einschätzen, so Meyer. “Wenn man anerkennt, dass CCS vielleicht nur fünf Prozent der Emissionen verhindern kann, dann wäre klar, dass der Phase-down zu 95 Prozent fossile Brennstoffe jeglicher Art betreffen würde.” Die VAE jedenfalls, die stark für CCS plädieren, planen laut CAT bis 2030 nur einen Anteil von 2 Prozent ihrer Emissionen auf diese Weise zu speichern.
Meyer fordert deshalb eine Klarstellung der EU, welche Rolle sie CCS für den anvisierten Phase-down zuschreibt. Dafür aber sei erst einmal eine anerkannte Definition nötig, was als “abated fuel” gilt. Vergangene Woche hat die Kommission eine öffentliche Konsultation zu CCS gestartet, um zu prüfen, welche Rolle CCS bei der Dekarbonisierung bis 2030, 2040 und 2050 spielen kann.
Eine Debatte darüber fordern auch Experten der “Stiftung für Wissenschaft und Politik” (SWP). Sie stellen fest, dass in Ländern mit hohen Exporten fossiler Energieträger CCS als Option zur Absicherung fossiler Geschäftsmodelle diskutiert werde, damit der Druck auf die Abkehr von fossilen Energieträgern nachlasse. Sie gehen davon aus, dass die Potenziale der Technik insgesamt begrenzt sind: Bis 2050 könnten in der EU insgesamt 550 Millionen Tonnen CO₂ gespeichert werden. Weltweit geht die internationale Energieagentur (IEA) von etwas mehr als 5 Milliarden Tonnen in 2050 aus.
Im letzten Moment hat sich am Freitagabend das linke Lager in Spanien für die vorgezogenen Wahlen am 23. Juli zusammengeschlossen. Wenige Stunden vor Ablauf der gesetzlichen Frist sprach sich die Parteibasis von Podemos für ein Bündnis mit der noch jungen linken Partei Sumar aus. Insgesamt beteiligen sich nun 16 Gruppierungen, die weiter links zu verorten sind als die regierende Sozialistische Arbeiterpartei PSOE von Ministerpräsident Pedro Sánchez.
Nach der Niederlage der PSOE und der linken Parteien bei den Regionalwahlen am 28. Mai hatte Sánchez zu vorgezogenen Neuwahlen aufgerufen. Eine Koalition von Linken und PSOE ist notwendig, um zu versuchen, die derzeitige Regierung zu retten – im Verein mit Unidas Podemos, dem von Podemos geführten Linksbündnis. Bis zum vergangenen Freitag mussten Bündnisse für die Wahl registriert werden. Bis 19. Juni müssen nun formell die Wahllisten vorliegen.
Jüngsten Umfragen zufolge würde die konservative Volkspartei (PP) die Wahlen mit 145 Sitzen gewinnen, bräuchte aber die rechtsgerichtete Partei Vox (31 Sitze), um zu regieren. Die PSOE käme auf 103 Sitze und Sumar auf 33. Die absolute Mehrheit liegt bei 176 Sitzen.
Sánchez kritisiert PP und Vox als “Trumpisten”. Auf Twitter bezeichnete er in den letzten Wochen gar beide Parteien unter dem Hashtag “VoxPP” als “rechtsextrem”, ohne einen Unterschied zwischen Rechtsaußen und der Volkspartei PP zu machen.
Der amtierende Ministerpräsident forderte PP-Chef Alberto Núñez Feijóo außerdem auf, sechs Fernsehdebatten mit ihm zu führen – eine pro Woche bis zum Wahltag. Von der neuen Linken-Führerin Yolanda Díaz wurde der Vorschlag mit den Worten kritisiert: “Spanien ist mehr als eine Debatte zwischen zwei Männern”. Vox-Chef Santiago Abascal kritisierte seinerseits Sánchez’ Vorschlag als “Überbleibsel des Zweiparteiensystems“, das nicht der aktuellen politischen Realität Spaniens entspreche.
Den konservativ-rechten Parteien steht ein immer noch uneiniges linkes Lager gegenüber. Die bereits an der Regierung beteiligte Sumar von Vizepräsidentin Yolanda Díaz war zur neuen Führerin der Linken aufgestiegen. Im Gegenzug hatte Podemos an politischem Gewicht verloren, was für Spannungen mit Sumar gesorgt hatte. Vor diesem Hintergrund war die Entscheidung der Basis von Podemos mit Spannung erwartet worden.
Im Vorfeld hatte Díaz die Spannungen befeuert. Sie legte ein Veto gegen die Podemos-Politikerin Irene Montero, die derzeitige Gleichstellungsministerin, und andere Parteimitglieder ein, um sie von den Wahllisten auszuschließen.
Für Podemos ist das letzte Wort über das Abkommen deshalb noch nicht gesprochen. Grund für das Veto von Díaz gegen Gleichstellungsministerin Montero war das Scheitern des von ihr geförderten sogenannten “Nur-Ja-ist-Ja”-Gesetzes, was zu Strafminderungen für mehr als 1000 Sexualstraftäter führte.
Podemos-Chefin Ione Belarra erklärte, sie habe eine Einigung mit Sumar erreicht, um nicht außerhalb des Bündnisses zu bleiben. Sie bestehe aber darauf, dass sie weiterhin mit Díaz über die Aufnahme von Montero in die Wahllisten verhandeln werde.
Sollte die ältere Linkspartei Podemos bei den Wahlen allein antreten, könnte es sein, dass sie komplett untergeht. Bereits bei den Regionalwahlen am 28. Mai verschwand sie aus acht Regionalparlamenten, darunter in Madrid und Valencia. Selbst Regierungspartner von Podemos, wie Vizepräsidentin Nadia Calviño, sind der Ansicht, dass die Partei kaum noch als relevante Kraft bezeichnet werden könne.
Die Vorverlegung der Wahlen beginnt bereits, sich auf die kommende Ratspräsidentschaft Spaniens auszuwirken, die ab Juli beginnt. Obwohl einzelne Kabinettsmitglieder bereits dabei sind, in einigen Formationen des Rates einen Ausblick auf die Präsidentschaft zu geben, wird wohl erst die nächste spanische Regierungsspitze das gesamte Programm in der Plenumssitzung des Europäischen Parlaments im September vorstellen.
In Spanien selbst sorgt das Datum der Wahlen für Verwunderung: mitten in den Sommerferien und bei hohen Temperaturen. Nach Angaben des Nationalen Instituts für Statistik könnten mehr als zehn Millionen Spanier am Wahltag nicht an ihrem Wohnort sein.
In einem Jahr wird das Europaparlament neu gewählt, und die heftigen Auseinandersetzungen um das Umweltpaket der EU-Kommission zeigen: Der Wahlkampf hat bereits begonnen. Im Parlament wird nun diskutiert, welche der rund 200 laufenden Gesetzesvorhaben unbedingt noch in dieser Legislaturperiode abgeschlossen werden sollen. Dabei zeichnet sich nach Informationen von Table.Media ab, dass folgende Dossiers Priorität haben dürften:
Die Diskussion in den Gremien wie der Konferenz der Ausschussvorsitzenden ist dem Vernehmen nach aber noch nicht beendet. So könnten während der anstehenden spanischen Ratspräsidentschaft erfahrungsgemäß rund 35 bis 40 Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen werden, heißt es im Parlament. Die darauffolgende belgische Ratspräsidentschaft werde absolute Priorität auf die Finalisierung des Asylpakets legen.
Bei zwei im April vorgestellten Großvorhaben der Kommission, zur Pharmaindustrie und zum Krisenmanagement im Bankensektor, läuft den Abgeordneten die Zeit davon: Das Pharmapaket etwa wird voraussichtlich erst im September in alle 24 EU-Amtssprachen übersetzt sein. Parlamentspräsidentin Roberta Metsola forderte laut Financial Times in einem Brief an Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die Übersetzung zu beschleunigen.
Wie andere unvollendete Dossiers könnten Pharma- und Bankenrettungspaket aber auch in der neuen Legislaturperiode abgeschlossen werden. Anders als im Bundestag gilt auf EU-Ebene nicht das Diskontinuitätsprinzip, wonach alle Gesetzesentwürfe nach einer Wahl neu eingebracht werden müssen. tho
Die EU-Kommission hat dem wirtschaftlich schwer angeschlagenen Tunesien Finanzhilfen in Höhe von bis zu 900 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Angesichts steigender Zahlen von Mittelmeermigranten hofft Brüssel zugleich darauf, gemeinsam mit Tunesien effektiver gegen Schlepper und illegale Überfahrten vorzugehen. Etwa für Such- und Rettungsaktionen und die Rückführungen von Migranten wolle man schon in diesem Jahr gut 100 Millionen Euro zur Verfügung stellen, kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Sonntag in Tunis nach einem Gespräch mit Präsident Kais Saied an. Das entspricht der dreifachen Summe, mit der Brüssel Tunis dabei zuletzt im Durchschnitt jährlich unterstützte.
An dem Treffen nahmen auch Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und der niederländische Regierungschef Mark Rutte teil. Vor allem Meloni drängt seit Langem auf Abkommen mit Tunesien, um die dort ablegenden Migrantenboote auf deren Weg nach Süditalien früh zu stoppen. Die ultrarechte Politikerin sprach von einem “wichtigen ersten Schritt”.
Ob der Deal zustandekommt und mit Tunesien bei den Detailverhandlungen Einigungen erzielt werden, dürfte von einem Entgegenkommen Saieds abhängen. Bereits ein Kredit des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Höhe von 1,9 Milliarden Dollar hängt in der Luft, weil Saied keine verbindliche Zusage zu den dafür verlangten Reformen machen will.
Saied schloss eine Rolle seines Landes als Grenzpolizei für Europa aus. “Wir können keine Rolle erfüllen, (…) in der wir ihre Länder bewachen”, sagte Saied am Samstag nach einem Besuch in der Küstenstadt Sfax, von wo aus Schleuser regelmäßig die teils seeuntauglichen und hoffnungslos überfüllten Boote losschicken. Migranten seien “leider Opfer eines globalen Systems, das sie nicht als Menschen sondern als reine Zahlen behandelt”, sagte Saied. dpa/rtr
Mit neuen Regeln zur Gasbeschaffung will die EU-Kommission die zentrale EU-Energieplattform attraktiver für die Industrie machen. Ab 26. Juni könnten Käufer Gebote bei der zweiten Ausschreibungsrunde für den gemeinsamen Gaseinkauf platzieren, kündigte Kommissionsvize Maroš Šefčovič am Freitag an. Dabei werde der Lieferzeitraum bis März 2025 ausgeweitet, weil energieintensive Industriebetriebe Gas normalerweise über längere Zeiträume beschafften.
“Wichtig ist, dass sich bis zum 26. Juni weitere potenzielle Nutzer – vor allem aus energieintensiven Industrien – bei der Plattform registrieren und diesen neuen Gasmarktplatz nutzen”, fügte Šefčovič hinzu. Für den 20. Juni kündigte der Kommissionsvize außerdem ein Treffen mit internationalen Gaslieferanten an. Er unterstrich außerdem die Ankündigung, dass die Gasplattform als Blaupause für die Beschaffung von Wasserstoff oder kritischen Rohstoffen dienen könne, ohne neue Details zu nennen.
Für Lieferungen aus der ersten Gebotsrunde seien inzwischen erste Verträge unterzeichnet worden, hieß es weiter nach einem Treffen des Lenkungsausschusses der Energieplattform. Bisher seien Käufer und Verkäufer für 10,9 Milliarden Kubikmeter (bcm) Gas zusammengebracht worden, schreibt der Plattformbetreiber Prisma auf seiner Website. Eingegangen seien sogar Gebote für Lieferungen von 18,7 bcm. ber
Mehr als 60 der größten europäischen Unternehmen aus den Bereichen Konsum, Finanzen und Energie, darunter Nestlé, Unilever und Ikea, haben sich für ein Gesetz zur Wiederherstellung der Natur ausgesprochen.
Die Konzerne fordern “die dringende Verabschiedung eines ehrgeizigen und rechtsverbindlichen EU-Naturschutzgesetzes”, um “die Natur nach Europa zurückzubringen”. In einem offenen Brief, der am heutigen Montag veröffentlicht werden soll und Table.Media vorab vorlag, weisen die Konzerne darauf hin, dass “Unternehmen und Finanzinstitutionen von der Natur abhängen”.
Sie fügen hinzu, dass diese eine entscheidende Rolle bei der Erhaltung und Wiederherstellung der Natur und der Wende zu einer “naturfreundlichen Wirtschaft” spielen müssen. Maßnahmen in dem erforderlichen Umfang und Tempo könnten nur durchgeführt werden, wenn sie durch ehrgeizige umweltpolitische Maßnahmen und Vorschriften unterstützt werden, “die unsere Wirtschafts-, Steuer- und Rechtssysteme umgestalten”.
“Wenn die Natur unter Druck steht, stehen auch unsere Nahrungsmittelsysteme unter Druck. Ein Beispiel: Steigende Temperaturen werden die für den Kaffeeanbau geeigneten Flächen bis 2050 um bis zu 50 Prozent reduzieren, wenn wir nicht eingreifen”, sagte Bart Vandewaetere, Vice-President ESG Engagement bei Nestlé Europe.
Die groß angelegte Wiederherstellung von Lebensräumen, ihren Arten und den vielfältigen Ökosystemleistungen, “von denen wir alle profitieren”, werde letztlich dazu beitragen, die Klimakrise zu bewältigen, die langfristige Nahrungsmittel- und Wassersicherheit zu gewährleisten sowie Beschäftigungsmöglichkeiten zu schützen und neue zu schaffen, fügte Vandewaetere hinzu.
Die unterzeichnenden Unternehmen schließen sich nun ähnlichen Aufrufen von Landwirten, Jägern und Wissenschaftlern an, die vor den wirtschaftlichen Folgen warnen, wenn die Europaabgeordneten die vorgeschlagenen Rechtsvorschriften zur Wiederherstellung der Natur nicht verabschieden.
Die Parlamentarier des ENVI-Ausschusses stimmen am 15. Juni über den Gesetzesvorschlag ab. Am 31. Mai zog sich die EVP aus den Verhandlungen über den Text zurück. Die EVP überließ dem Ausschussvorsitzenden Pascal Canfin (Renew), einem Befürworter des Gesetzesvorschlags der Kommission, die Aufgabe, eine Mehrheit für den Text in seiner eigenen Fraktion sowie bei den Grünen, der S&D und den Linken, zu finden. Die Kommission hat mittlerweile angeboten, einige Ziele des Renaturierungsgesetzes zurückzuschrauben, um eine Einigung über die vorgeschlagenen Rechtsvorschriften zu erzielen. cst
Der AI Act ist ein hochpolitisches Dossier. Jetzt stellt sich heraus, dass es auch ein hochemotionales Dossier ist. Vor dem entscheidenden Votum im Plenum des EU-Parlaments sieht es erneut so aus, als könnte der Kompromiss platzen. Die Abstimmung ist für Mittwoch angesetzt.
Der Auslöser ist wieder der Streit über das Verbot der biometrischen Gesichtserkennung in Echtzeit im öffentlichen Raum. Im Kompromisspapier ist der Einsatz dieser Technik verboten. Für den nachträglichen Einsatz gilt ein Richtervorbehalt.
Die EVP lehnt das Verbot ab. Sie möchte, dass diese Technik den Strafverfolgungsbehörden bei vermissten Kindern, schwerer Kriminalität oder Terror in Echtzeit zur Verfügung steht. Bereits beim Votum in den Ausschüssen hat die EVP dieses Verbot separat zur Abstimmung gebracht – erhielt dafür aber keine Mehrheit.
Nun hat die EVP erneut einen Änderungsantrag gestellt und will als Gruppe gegen das Verbot stimmen. Das sei von vorneherein klar gewesen, sagt die EVP. Die anderen Fraktionen sehen das anders und sind verärgert. Einige fühlen sich animiert, Zugeständnisse, die sie während der Verhandlungen machen mussten, wieder zurückzuziehen.
Neben den 771 Änderungen des Kompromisspapiers stehen am Mittwoch noch 36 weitere Änderungsanträge zur Abstimmung. So hat Patrick Breyer (Piratenpartei) ein Verbot automatisierter Verhaltensüberwachung in der Öffentlichkeit beantragt. Zu den deutschen Unterstützern gehören Birgit Sippel und Tiemo Wölken (SPD) sowie Alexandra Geese (Grüne). Birgit Sippel wiederum möchte das Verbot auch im Bereich Asyl, Migration oder Grenzverwaltung durchsetzen und hat ebenfalls einige Unterstützer für ihren Antrag.
Das Problem: Während die EVP und rechte Parteien gegen das Verbot biometrischer Erkennung in Echtzeit sind und Grüne sowie Linke für das Verbot, so gibt es bei den Sozialdemokraten und Liberalen kein so klares Bild. Svenja Hahn (FDP) sagt zwar, “Gesichtserkennung zur Überwachung kennen wir aus China, diese Anwendung von Technologie hat in einer liberalen Demokratie nichts zu suchen”. Doch das sehen nicht alle Liberalen im EU-Parlament so. Es könnte also sein, dass die Situation am Mittwoch eskaliert und der Kompromiss am Ende platzt.
Einer der Schattenberichterstatter sagte daher im Gespräch mit Table.Media, er werde versuchen, am heutigen Montag noch ein Gespräch mit den anderen Berichterstattern zu arrangieren, um die Emotionen wieder in den Griff zu bekommen.
Es gibt allerdings auch Gründe, die dafür sprechen, dass der Kompromisstext eine Mehrheit erzielt. Denn nicht nur haben die Verhandler aller Fraktionen bereits intensiv an dem Text gearbeitet. Sondern viele spüren auch den Zeitdruck, der durch die schnelle Entwicklung der Künstlichen Intelligenz entsteht. Hinzukommt: Die europäischen Gesetzgeber wollen die weltweit ersten sein, die eine Regulierung für KI beschließen.
Die Verhandlungen zum AI Act sind mit der Abstimmung über die Parlamentsposition ja noch nicht beendet. Der Trilog beginnt dann erst. Und es ist unwahrscheinlich, dass das Verbot der biometrischen Gesichtserkennung in Echtzeit den Trilog übersteht. Denn die Mitgliedstaaten sind mehrheitlich dagegen. vis

In Gunther Krichbaums politischer Brust schlagen scheinbar zwei Herzen. Das eine pocht für seine Heimat, die Region Stuttgart und mittlerweile vor allem Pforzheim. Er studierte Rechtswissenschaften an den Universitäten Tübingen und Heidelberg. Aber schon im jungen Alter nahm Krichbaum auch den Weg ins benachbarte Ausland mit Abstechern nach Genf und Lausanne. Das zweite Herz schlägt europäisch.
Über ein Direktmandat im Wahlkreis Pforzheim zog der Volljurist 2002 in den Bundestag ein und übernahm drei Jahre später bereits das Amt des stellvertretenden europapolitischen Sprechers innerhalb der Unionsfraktion. “Die Entscheidung für den Europaausschuss war für mich keine Zufallsentscheidung. Ein älterer Kollege hatte mich gefragt: ‘Was willst du denn im Europaausschuss? Die machen doch die Verfassung.’ Was dann später der Vertrag von Lissabon wurde. ‘Dann ist es doch dort total langweilig.’ Also diese Langeweile kam nie auf, weil die Themen eben auch sehr, sehr vielseitig sind“, sagt Krichbaum.
Bei genauer anatomischer Betrachtung sind es aber wohl doch nicht zwei Herzen, sondern nur eines in der Brust des 59-Jährigen. Sein Engagement für Europa habe nämlich eine Vorgeschichte und diese liegt wiederum in seiner Heimat. “Ich bin aufgewachsen in einem Ort in der Nähe von Stuttgart, in Korntal und in Baden-Württemberg, eben nicht sehr weit weg von der französischen Grenze. Deswegen war das Interesse für Frankreich für mich auch ein relativ frühes, schon durch den Schüleraustausch“, erinnert sich Krichbaum.
Anfangs habe er in Frankreich überhaupt nichts verstanden. Aber das tat seiner Lust an anderen Ländern keinen Abbruch. “Europa hat mich schon immer fasziniert, tatsächlich schon als Jugendlicher. Die vielen verschiedenen Kulturen, Sprachen, die Unterschiedlichkeit unserer einzelnen Länder. Und deswegen hatte ich einfach auch schon privat früher die verschiedenen Länder bereist und bin dem schlicht und ergreifend auch treu geblieben”, ergänzt der CDU-Politiker.
Seine Europaaffinität machte sich ebenso im Bundestag schnell bemerkbar. Bis zum Regierungswechsel 2021 war Krichbaum etwas mehr als 14 Jahre Vorsitzender des Ausschusses für Angelegenheiten der Europäischen Union. Er wurde damit zur festen Größe, wenn es um EU-relevante Sachfragen und auch um deren Vermittlung ging. “Als Ausschussvorsitzender haben Sie eine sehr stark moderierende, koordinierende Rolle, mitunter auch sehr stark repräsentative Rolle”, so Krichbaum.
Darüber hinaus war eine ausgedehnte Reisetätigkeit Teil seines Abgeordnetenlebens – und trotzdem schaffte er es, sein Direktmandat mittlerweile sechsmal zu gewinnen. “Im Wahlkreis muss das akzeptiert sein. Auf der anderen Seite gibt es genügend Möglichkeiten, dass Synergien bei Städtepartnerschaften entstehen oder man auch Kommunen unterstützt, indem europäische Fördergelder an Land gezogen werden. Es geht durchaus, aber es ist erklärungsbedürftig, das ist wahr”, sagt Krichbaum.
Der Europaausschuss gehöre zu einem von fünf Ausschüssen mit einer starken “Außenberührung”, wie es Krichbaum nennt. “Also da muss man mit anderen Worten, seinen Koffer fast so lieben wie seine Frau. Auf jeden Fall ist es so, dass man wissen muss, dass, wenn man sich für einen dieser Ausschüsse entscheidet, tatsächlich auch viel unterwegs ist. Aber die Entschädigung dafür ist: Es ist unglaublich bereichernd”, sagt Krichbaum.
Seit der letzten Bundestagswahl und dem Ausscheiden der Union aus der Bundesregierung ist er nicht mehr Ausschussvorsitzender, dafür aber europapolitischer Sprecher seiner Fraktion. Die Europapolitik an sich lässt Krichbaum nicht los. Angesprochen darauf, wie er über Berlin-Mitte hinaus für ein solches Politikfeld eigentlich Networking betreibt, findet der Pforzheimer eine ansprechende Metapher: “Im Prinzip ist es wie ein Stein, den sie ins Wasser werfen und der dann seine konzentrischen Kreise zieht. Natürlich ist jetzt in meiner Funktion die Aufgabe, dass ich in erster Linie den Kontakt zu den anderen christdemokratischen Parteien halte, im Rahmen der EVP. Ich bin auch Mitglied im Vorstand der EVP.”
Darüber hinaus kommt Krichbaum jedoch über Formate wie interparlamentarische Konferenzen auch mit Kolleginnen und Kollegen anderer Parteien ständig in Kontakt. “Viel entsteht auch durch die Auslandsbesuche, die ich ganz regelmäßig vornehme. Es vergeht keine Woche, in der ich nicht irgendwie im Flieger sitze”, ergänzt der 59-Jährige. Um das auf sich zu nehmen und weiterhin mit Leidenschaft bei der Sache zu sein, muss das Herz schon stark für Europa schlagen. Constanin Eckner
das Ende der Legislaturperiode rückt näher und damit steigt bei vielen Dossiers der Druck, doch noch irgendwie eine Einigung hinzubekommen. Till Hoppe hat sich im EU-Parlament umgehört, welche Gesetzesvorhaben Priorität haben. Mehr lesen Sie in den heutigen News.
Auch im Rat der Arbeitsminister (EPSCO) heißt es heute in Sachen Plattformarbeitsrichtlinie: Crunch Time. Nach eineinhalb Jahren der Debatte, vielem Hin und Her und vor allem vielen vergeblichen Versuchen der Einigung, könnte dort heute die Zeit richten, was zuvor nicht möglich erschien: eine Einigung, damit die Trilogverhandlungen starten können.
Nicht nur die Gewerkschaften drängen trotz Vorbehalten zu einem Ja zu dem zuletzt immer wieder aufgeweichten Text. Auch viele der Länder, die den Vorschlag zuletzt abgelehnt haben, weil sie sich für eine möglichst scharfe und umfassende Richtlinie aussprechen, signalisieren, dass sie angesichts der Zeitnot doch ins Lager der Befürworter einscheren könnten. Getreu dem Motto: Eine schwache Regelung, die gegebenenfalls im Trilog nachverhandelt werden kann, ist besser als gar keine.
Denn es gibt noch ein Problem: In Spanien stehen Ende Juli Neuwahlen an. Und dann könnte die konservative PP übernehmen, die weniger Interesse an einer strengen Richtlinie hat als die aktuelle, linksgerichtete Regierung unter Pedro Sánchez. Mehr zu einem neuen linken Parteienbündnis in Spanien lesen Sie übrigens in einer Analyse meiner Kollegin Isabel Cuesta Camacho.
Doch während es im Lager derjenigen, die beim EPSCO möglichst strenge Regeln wollen, doch Signale für ein Einlenken gibt, ist das auf der anderen Seite nicht unbedingt klar. Vor allem Frankreich steht hier im Fokus, weil es eine möglichst weiche Regel möchte und bis zuletzt Kritik an dem immer wieder veränderten Text angemeldet hat.
Einfacher wird die Einigung auch deswegen nicht, weil Deutschland sich sehr sicher enthalten wird. Dabei hatte das größte Land der EU zunächst aktiv an der Richtlinie mitverhandelt und könnte nach Sicht von Beobachtern auch jetzt durch ein aktives Agieren nicht nur für eine Einigung, sondern auch für einen ambitionierteren Text sorgen.
Man sagt gerne: Die Zeit heilt alle Wunden. Aber wird sie in dem Fall auch eine Einigung bringen? Es wird spannend.

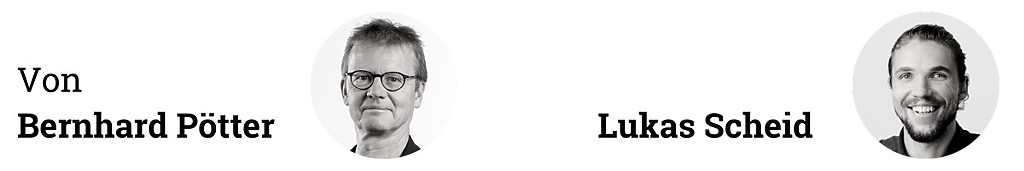
Die Europäische Union hat sich im Grundsatz bei einem der heißen Eisen der nächsten COP28 auf den gleichen Kurs festgelegt wie die COP-Präsidentschaft aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und andere Ölstaaten: die umstrittene CCS-Technik als Schlupfloch beim Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen zu nutzen. Die EU strebt nun auf der COP28 einen Beschluss an, der diese Formulierung erlauben würde. Das wurde am Rande der Bonner Klimakonferenz deutlich. Unabhängig davon bezeichnet eine neue Beurteilung des Thinktank-Projekts “Climate Action Tracker” die EU-Klimapolitik als “ungenügend“.
Nach einem Beschluss des EU-Ministerrats, der bereits im März gefasst wurde, soll es auf dem Weg zur Klimaneutralität nicht nur möglich sein, Emissionen aus Industrieprozessen, sondern auch aus der Energiewirtschaft abzuscheiden und zu speichern. Die Nutzung für den Energiesektor hatten die Europäer bislang abgelehnt und etwa bei der COP27 ein “Herunterfahren der fossilen Energien” ohne die Erwähnung von CCS gefordert. Die europäische Position verlangt jetzt nur noch ein “Energiesystem, frei von unverminderten fossilen Brennstoffen” – (“unabated fossil fuels”).
Diese Entscheidung, die bisher in der Öffentlichkeit kaum bekannt war, ist nicht nur eine Annäherung an öl- und gasproduzierende Länder wie die VAE oder die USA. Er steht auch im Widerspruch zur deutschen Position. Außenministerin Annalena Baerbock hatte auf dem Petersberger Klimadialog ihren Dissens mit dem nächsten COP-Präsidenten Sultan Ahmed Al Jaber zu diesem Punkt deutlich gemacht: “Wir müssen raus aus den fossilen Energien”, sagte sie – während Al Jaber betonte, die Welt müsse sich mit den Realitäten abfinden. “Fossile Brennstoffe werden auch weiterhin eine Rolle spielen“. Ziel solle es sein, “die Emissionen auslaufen zu lassen”.
Auch Staatssekretärin Jennifer Morgan hatte erklärt, sie glaube nicht, “dass CCS uns ans Ziel bringt”. Und im Wirtschafts- und Klimaministerium von Robert Habeck wird an einer deutschen CCS-Management-Strategie gearbeitet, deren klare Vorgabe lautet: CCS nur für Prozessemissionen aus der Industrie – nicht als Ausweg für die fossilen Brennstoffe im Energiebereich.
Diese Möglichkeit lässt die neue EU-Position nun aber offen. Ein “Energiesystem frei von unverminderten fossilen Brennstoffen” schließt die Anwendung der CCS-Technik als Möglichkeit auch in der Stromerzeugung und für die Verbrennung in der Industrie ein. Der Beschluss ist ein wenig konkreter als Al Jabers “Ende der Emissionen“, denn er verweist auf eine IPCC-Definition von “unabated fossil fuels” und auf einen Höhepunkt der Fossilen deutlich vor 2050. Al Jaber wiederum nutzte auf der Konferenz in Bonn bei einer Rede den EU-Begriff eines Energiesystems “free of unabated fossil fuels”.
Der EU-Kommission ist klar, dass der Beschluss den Fossilen selbst in einer klimaneutralen EU ein Existenzrecht als Brennstoffe zuweist. Ohnehin ist geplant, dass auch beim Netto-Null-Ziel der EU noch Emissionen aus Industrie oder Landwirtschaft in der Natur oder durch CCS gespeichert werden. In den Debatten für eine Öffnung zu “unabated fuels” hätten besonders Länder wie Polen oder Dänemark Druck gemacht, heißt es aus Verhandlungskreisen.
Mit dem Kurswechsel der EU wird ein Kompromiss in dieser umstrittenen Frage bei der COP28 wahrscheinlicher. Denn viele andere einflussreiche Staaten, deren Volkswirtschaften noch in großem Maß an fossilen Energien hängen, streben offen oder verdeckt dieses Ziel an: Die Ölstaaten, die USA, aber auch China oder europäische Länder wie Norwegen und Dänemark, die bereits an CCS-Projekten arbeiten.
Für die Wissenschaftler des “Climate Action Tracker” (CAT) ist CCS allerdings eine “gefährliche Ablenkung”. CCS solle nicht zur Verringerung der Emissionen im Stromsektor eingesetzt werden, weil “weitaus billigere erneuerbare Energien zur Verfügung stehen”, sagt Claire Stockwell von der CAT-Projektorganisation Climate Analytics. In ihrem aktuellen Gutachten auf halbem Weg zur COP28 kommt auch die EU nicht gut weg: Die anhaltenden Investitionen in neue fossile Infrastrukturen, insbesondere in LNG-Terminals und Gaspipelines, “untergraben die Dekarbonisierungsbemühungen der EU”, heißt es. Der CAT bewertet die Klimapolitik der EU insgesamt als “unzureichend”, auch weil die EU ihr bei der UN hinterlegtes Klimaziel (NDC) noch nicht wie versprochen angehoben hat.
Allgemein lauten die Hauptargumente der CCS-Kritiker: Die Technik sei teurer als die Erneuerbaren, weltweit nicht in großem Maßstab erprobt und komme für die nötige Halbierung der globalen Emissionen bis 2030 zu spät. Alden Meyer, Klimaexperte beim Thinktank E3G, hofft allerdings darauf, dass in einer möglichen Erklärung der COP28 zum Ausstieg mithilfe von CCS immerhin sektorale Ziele definiert würden: Dann sei der Zusatz “unabated” nicht so problematisch, so Meyer. Denn dann sei klar, dass nur die wenigen schwer zu dekarbonisierenden Sektoren auf Techniken wie CCS zurückgreifen könnten.
Außerdem müsse die EU dann das Potenzial von CCS realistisch einschätzen, so Meyer. “Wenn man anerkennt, dass CCS vielleicht nur fünf Prozent der Emissionen verhindern kann, dann wäre klar, dass der Phase-down zu 95 Prozent fossile Brennstoffe jeglicher Art betreffen würde.” Die VAE jedenfalls, die stark für CCS plädieren, planen laut CAT bis 2030 nur einen Anteil von 2 Prozent ihrer Emissionen auf diese Weise zu speichern.
Meyer fordert deshalb eine Klarstellung der EU, welche Rolle sie CCS für den anvisierten Phase-down zuschreibt. Dafür aber sei erst einmal eine anerkannte Definition nötig, was als “abated fuel” gilt. Vergangene Woche hat die Kommission eine öffentliche Konsultation zu CCS gestartet, um zu prüfen, welche Rolle CCS bei der Dekarbonisierung bis 2030, 2040 und 2050 spielen kann.
Eine Debatte darüber fordern auch Experten der “Stiftung für Wissenschaft und Politik” (SWP). Sie stellen fest, dass in Ländern mit hohen Exporten fossiler Energieträger CCS als Option zur Absicherung fossiler Geschäftsmodelle diskutiert werde, damit der Druck auf die Abkehr von fossilen Energieträgern nachlasse. Sie gehen davon aus, dass die Potenziale der Technik insgesamt begrenzt sind: Bis 2050 könnten in der EU insgesamt 550 Millionen Tonnen CO₂ gespeichert werden. Weltweit geht die internationale Energieagentur (IEA) von etwas mehr als 5 Milliarden Tonnen in 2050 aus.
Im letzten Moment hat sich am Freitagabend das linke Lager in Spanien für die vorgezogenen Wahlen am 23. Juli zusammengeschlossen. Wenige Stunden vor Ablauf der gesetzlichen Frist sprach sich die Parteibasis von Podemos für ein Bündnis mit der noch jungen linken Partei Sumar aus. Insgesamt beteiligen sich nun 16 Gruppierungen, die weiter links zu verorten sind als die regierende Sozialistische Arbeiterpartei PSOE von Ministerpräsident Pedro Sánchez.
Nach der Niederlage der PSOE und der linken Parteien bei den Regionalwahlen am 28. Mai hatte Sánchez zu vorgezogenen Neuwahlen aufgerufen. Eine Koalition von Linken und PSOE ist notwendig, um zu versuchen, die derzeitige Regierung zu retten – im Verein mit Unidas Podemos, dem von Podemos geführten Linksbündnis. Bis zum vergangenen Freitag mussten Bündnisse für die Wahl registriert werden. Bis 19. Juni müssen nun formell die Wahllisten vorliegen.
Jüngsten Umfragen zufolge würde die konservative Volkspartei (PP) die Wahlen mit 145 Sitzen gewinnen, bräuchte aber die rechtsgerichtete Partei Vox (31 Sitze), um zu regieren. Die PSOE käme auf 103 Sitze und Sumar auf 33. Die absolute Mehrheit liegt bei 176 Sitzen.
Sánchez kritisiert PP und Vox als “Trumpisten”. Auf Twitter bezeichnete er in den letzten Wochen gar beide Parteien unter dem Hashtag “VoxPP” als “rechtsextrem”, ohne einen Unterschied zwischen Rechtsaußen und der Volkspartei PP zu machen.
Der amtierende Ministerpräsident forderte PP-Chef Alberto Núñez Feijóo außerdem auf, sechs Fernsehdebatten mit ihm zu führen – eine pro Woche bis zum Wahltag. Von der neuen Linken-Führerin Yolanda Díaz wurde der Vorschlag mit den Worten kritisiert: “Spanien ist mehr als eine Debatte zwischen zwei Männern”. Vox-Chef Santiago Abascal kritisierte seinerseits Sánchez’ Vorschlag als “Überbleibsel des Zweiparteiensystems“, das nicht der aktuellen politischen Realität Spaniens entspreche.
Den konservativ-rechten Parteien steht ein immer noch uneiniges linkes Lager gegenüber. Die bereits an der Regierung beteiligte Sumar von Vizepräsidentin Yolanda Díaz war zur neuen Führerin der Linken aufgestiegen. Im Gegenzug hatte Podemos an politischem Gewicht verloren, was für Spannungen mit Sumar gesorgt hatte. Vor diesem Hintergrund war die Entscheidung der Basis von Podemos mit Spannung erwartet worden.
Im Vorfeld hatte Díaz die Spannungen befeuert. Sie legte ein Veto gegen die Podemos-Politikerin Irene Montero, die derzeitige Gleichstellungsministerin, und andere Parteimitglieder ein, um sie von den Wahllisten auszuschließen.
Für Podemos ist das letzte Wort über das Abkommen deshalb noch nicht gesprochen. Grund für das Veto von Díaz gegen Gleichstellungsministerin Montero war das Scheitern des von ihr geförderten sogenannten “Nur-Ja-ist-Ja”-Gesetzes, was zu Strafminderungen für mehr als 1000 Sexualstraftäter führte.
Podemos-Chefin Ione Belarra erklärte, sie habe eine Einigung mit Sumar erreicht, um nicht außerhalb des Bündnisses zu bleiben. Sie bestehe aber darauf, dass sie weiterhin mit Díaz über die Aufnahme von Montero in die Wahllisten verhandeln werde.
Sollte die ältere Linkspartei Podemos bei den Wahlen allein antreten, könnte es sein, dass sie komplett untergeht. Bereits bei den Regionalwahlen am 28. Mai verschwand sie aus acht Regionalparlamenten, darunter in Madrid und Valencia. Selbst Regierungspartner von Podemos, wie Vizepräsidentin Nadia Calviño, sind der Ansicht, dass die Partei kaum noch als relevante Kraft bezeichnet werden könne.
Die Vorverlegung der Wahlen beginnt bereits, sich auf die kommende Ratspräsidentschaft Spaniens auszuwirken, die ab Juli beginnt. Obwohl einzelne Kabinettsmitglieder bereits dabei sind, in einigen Formationen des Rates einen Ausblick auf die Präsidentschaft zu geben, wird wohl erst die nächste spanische Regierungsspitze das gesamte Programm in der Plenumssitzung des Europäischen Parlaments im September vorstellen.
In Spanien selbst sorgt das Datum der Wahlen für Verwunderung: mitten in den Sommerferien und bei hohen Temperaturen. Nach Angaben des Nationalen Instituts für Statistik könnten mehr als zehn Millionen Spanier am Wahltag nicht an ihrem Wohnort sein.
In einem Jahr wird das Europaparlament neu gewählt, und die heftigen Auseinandersetzungen um das Umweltpaket der EU-Kommission zeigen: Der Wahlkampf hat bereits begonnen. Im Parlament wird nun diskutiert, welche der rund 200 laufenden Gesetzesvorhaben unbedingt noch in dieser Legislaturperiode abgeschlossen werden sollen. Dabei zeichnet sich nach Informationen von Table.Media ab, dass folgende Dossiers Priorität haben dürften:
Die Diskussion in den Gremien wie der Konferenz der Ausschussvorsitzenden ist dem Vernehmen nach aber noch nicht beendet. So könnten während der anstehenden spanischen Ratspräsidentschaft erfahrungsgemäß rund 35 bis 40 Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen werden, heißt es im Parlament. Die darauffolgende belgische Ratspräsidentschaft werde absolute Priorität auf die Finalisierung des Asylpakets legen.
Bei zwei im April vorgestellten Großvorhaben der Kommission, zur Pharmaindustrie und zum Krisenmanagement im Bankensektor, läuft den Abgeordneten die Zeit davon: Das Pharmapaket etwa wird voraussichtlich erst im September in alle 24 EU-Amtssprachen übersetzt sein. Parlamentspräsidentin Roberta Metsola forderte laut Financial Times in einem Brief an Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die Übersetzung zu beschleunigen.
Wie andere unvollendete Dossiers könnten Pharma- und Bankenrettungspaket aber auch in der neuen Legislaturperiode abgeschlossen werden. Anders als im Bundestag gilt auf EU-Ebene nicht das Diskontinuitätsprinzip, wonach alle Gesetzesentwürfe nach einer Wahl neu eingebracht werden müssen. tho
Die EU-Kommission hat dem wirtschaftlich schwer angeschlagenen Tunesien Finanzhilfen in Höhe von bis zu 900 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Angesichts steigender Zahlen von Mittelmeermigranten hofft Brüssel zugleich darauf, gemeinsam mit Tunesien effektiver gegen Schlepper und illegale Überfahrten vorzugehen. Etwa für Such- und Rettungsaktionen und die Rückführungen von Migranten wolle man schon in diesem Jahr gut 100 Millionen Euro zur Verfügung stellen, kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Sonntag in Tunis nach einem Gespräch mit Präsident Kais Saied an. Das entspricht der dreifachen Summe, mit der Brüssel Tunis dabei zuletzt im Durchschnitt jährlich unterstützte.
An dem Treffen nahmen auch Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und der niederländische Regierungschef Mark Rutte teil. Vor allem Meloni drängt seit Langem auf Abkommen mit Tunesien, um die dort ablegenden Migrantenboote auf deren Weg nach Süditalien früh zu stoppen. Die ultrarechte Politikerin sprach von einem “wichtigen ersten Schritt”.
Ob der Deal zustandekommt und mit Tunesien bei den Detailverhandlungen Einigungen erzielt werden, dürfte von einem Entgegenkommen Saieds abhängen. Bereits ein Kredit des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Höhe von 1,9 Milliarden Dollar hängt in der Luft, weil Saied keine verbindliche Zusage zu den dafür verlangten Reformen machen will.
Saied schloss eine Rolle seines Landes als Grenzpolizei für Europa aus. “Wir können keine Rolle erfüllen, (…) in der wir ihre Länder bewachen”, sagte Saied am Samstag nach einem Besuch in der Küstenstadt Sfax, von wo aus Schleuser regelmäßig die teils seeuntauglichen und hoffnungslos überfüllten Boote losschicken. Migranten seien “leider Opfer eines globalen Systems, das sie nicht als Menschen sondern als reine Zahlen behandelt”, sagte Saied. dpa/rtr
Mit neuen Regeln zur Gasbeschaffung will die EU-Kommission die zentrale EU-Energieplattform attraktiver für die Industrie machen. Ab 26. Juni könnten Käufer Gebote bei der zweiten Ausschreibungsrunde für den gemeinsamen Gaseinkauf platzieren, kündigte Kommissionsvize Maroš Šefčovič am Freitag an. Dabei werde der Lieferzeitraum bis März 2025 ausgeweitet, weil energieintensive Industriebetriebe Gas normalerweise über längere Zeiträume beschafften.
“Wichtig ist, dass sich bis zum 26. Juni weitere potenzielle Nutzer – vor allem aus energieintensiven Industrien – bei der Plattform registrieren und diesen neuen Gasmarktplatz nutzen”, fügte Šefčovič hinzu. Für den 20. Juni kündigte der Kommissionsvize außerdem ein Treffen mit internationalen Gaslieferanten an. Er unterstrich außerdem die Ankündigung, dass die Gasplattform als Blaupause für die Beschaffung von Wasserstoff oder kritischen Rohstoffen dienen könne, ohne neue Details zu nennen.
Für Lieferungen aus der ersten Gebotsrunde seien inzwischen erste Verträge unterzeichnet worden, hieß es weiter nach einem Treffen des Lenkungsausschusses der Energieplattform. Bisher seien Käufer und Verkäufer für 10,9 Milliarden Kubikmeter (bcm) Gas zusammengebracht worden, schreibt der Plattformbetreiber Prisma auf seiner Website. Eingegangen seien sogar Gebote für Lieferungen von 18,7 bcm. ber
Mehr als 60 der größten europäischen Unternehmen aus den Bereichen Konsum, Finanzen und Energie, darunter Nestlé, Unilever und Ikea, haben sich für ein Gesetz zur Wiederherstellung der Natur ausgesprochen.
Die Konzerne fordern “die dringende Verabschiedung eines ehrgeizigen und rechtsverbindlichen EU-Naturschutzgesetzes”, um “die Natur nach Europa zurückzubringen”. In einem offenen Brief, der am heutigen Montag veröffentlicht werden soll und Table.Media vorab vorlag, weisen die Konzerne darauf hin, dass “Unternehmen und Finanzinstitutionen von der Natur abhängen”.
Sie fügen hinzu, dass diese eine entscheidende Rolle bei der Erhaltung und Wiederherstellung der Natur und der Wende zu einer “naturfreundlichen Wirtschaft” spielen müssen. Maßnahmen in dem erforderlichen Umfang und Tempo könnten nur durchgeführt werden, wenn sie durch ehrgeizige umweltpolitische Maßnahmen und Vorschriften unterstützt werden, “die unsere Wirtschafts-, Steuer- und Rechtssysteme umgestalten”.
“Wenn die Natur unter Druck steht, stehen auch unsere Nahrungsmittelsysteme unter Druck. Ein Beispiel: Steigende Temperaturen werden die für den Kaffeeanbau geeigneten Flächen bis 2050 um bis zu 50 Prozent reduzieren, wenn wir nicht eingreifen”, sagte Bart Vandewaetere, Vice-President ESG Engagement bei Nestlé Europe.
Die groß angelegte Wiederherstellung von Lebensräumen, ihren Arten und den vielfältigen Ökosystemleistungen, “von denen wir alle profitieren”, werde letztlich dazu beitragen, die Klimakrise zu bewältigen, die langfristige Nahrungsmittel- und Wassersicherheit zu gewährleisten sowie Beschäftigungsmöglichkeiten zu schützen und neue zu schaffen, fügte Vandewaetere hinzu.
Die unterzeichnenden Unternehmen schließen sich nun ähnlichen Aufrufen von Landwirten, Jägern und Wissenschaftlern an, die vor den wirtschaftlichen Folgen warnen, wenn die Europaabgeordneten die vorgeschlagenen Rechtsvorschriften zur Wiederherstellung der Natur nicht verabschieden.
Die Parlamentarier des ENVI-Ausschusses stimmen am 15. Juni über den Gesetzesvorschlag ab. Am 31. Mai zog sich die EVP aus den Verhandlungen über den Text zurück. Die EVP überließ dem Ausschussvorsitzenden Pascal Canfin (Renew), einem Befürworter des Gesetzesvorschlags der Kommission, die Aufgabe, eine Mehrheit für den Text in seiner eigenen Fraktion sowie bei den Grünen, der S&D und den Linken, zu finden. Die Kommission hat mittlerweile angeboten, einige Ziele des Renaturierungsgesetzes zurückzuschrauben, um eine Einigung über die vorgeschlagenen Rechtsvorschriften zu erzielen. cst
Der AI Act ist ein hochpolitisches Dossier. Jetzt stellt sich heraus, dass es auch ein hochemotionales Dossier ist. Vor dem entscheidenden Votum im Plenum des EU-Parlaments sieht es erneut so aus, als könnte der Kompromiss platzen. Die Abstimmung ist für Mittwoch angesetzt.
Der Auslöser ist wieder der Streit über das Verbot der biometrischen Gesichtserkennung in Echtzeit im öffentlichen Raum. Im Kompromisspapier ist der Einsatz dieser Technik verboten. Für den nachträglichen Einsatz gilt ein Richtervorbehalt.
Die EVP lehnt das Verbot ab. Sie möchte, dass diese Technik den Strafverfolgungsbehörden bei vermissten Kindern, schwerer Kriminalität oder Terror in Echtzeit zur Verfügung steht. Bereits beim Votum in den Ausschüssen hat die EVP dieses Verbot separat zur Abstimmung gebracht – erhielt dafür aber keine Mehrheit.
Nun hat die EVP erneut einen Änderungsantrag gestellt und will als Gruppe gegen das Verbot stimmen. Das sei von vorneherein klar gewesen, sagt die EVP. Die anderen Fraktionen sehen das anders und sind verärgert. Einige fühlen sich animiert, Zugeständnisse, die sie während der Verhandlungen machen mussten, wieder zurückzuziehen.
Neben den 771 Änderungen des Kompromisspapiers stehen am Mittwoch noch 36 weitere Änderungsanträge zur Abstimmung. So hat Patrick Breyer (Piratenpartei) ein Verbot automatisierter Verhaltensüberwachung in der Öffentlichkeit beantragt. Zu den deutschen Unterstützern gehören Birgit Sippel und Tiemo Wölken (SPD) sowie Alexandra Geese (Grüne). Birgit Sippel wiederum möchte das Verbot auch im Bereich Asyl, Migration oder Grenzverwaltung durchsetzen und hat ebenfalls einige Unterstützer für ihren Antrag.
Das Problem: Während die EVP und rechte Parteien gegen das Verbot biometrischer Erkennung in Echtzeit sind und Grüne sowie Linke für das Verbot, so gibt es bei den Sozialdemokraten und Liberalen kein so klares Bild. Svenja Hahn (FDP) sagt zwar, “Gesichtserkennung zur Überwachung kennen wir aus China, diese Anwendung von Technologie hat in einer liberalen Demokratie nichts zu suchen”. Doch das sehen nicht alle Liberalen im EU-Parlament so. Es könnte also sein, dass die Situation am Mittwoch eskaliert und der Kompromiss am Ende platzt.
Einer der Schattenberichterstatter sagte daher im Gespräch mit Table.Media, er werde versuchen, am heutigen Montag noch ein Gespräch mit den anderen Berichterstattern zu arrangieren, um die Emotionen wieder in den Griff zu bekommen.
Es gibt allerdings auch Gründe, die dafür sprechen, dass der Kompromisstext eine Mehrheit erzielt. Denn nicht nur haben die Verhandler aller Fraktionen bereits intensiv an dem Text gearbeitet. Sondern viele spüren auch den Zeitdruck, der durch die schnelle Entwicklung der Künstlichen Intelligenz entsteht. Hinzukommt: Die europäischen Gesetzgeber wollen die weltweit ersten sein, die eine Regulierung für KI beschließen.
Die Verhandlungen zum AI Act sind mit der Abstimmung über die Parlamentsposition ja noch nicht beendet. Der Trilog beginnt dann erst. Und es ist unwahrscheinlich, dass das Verbot der biometrischen Gesichtserkennung in Echtzeit den Trilog übersteht. Denn die Mitgliedstaaten sind mehrheitlich dagegen. vis

In Gunther Krichbaums politischer Brust schlagen scheinbar zwei Herzen. Das eine pocht für seine Heimat, die Region Stuttgart und mittlerweile vor allem Pforzheim. Er studierte Rechtswissenschaften an den Universitäten Tübingen und Heidelberg. Aber schon im jungen Alter nahm Krichbaum auch den Weg ins benachbarte Ausland mit Abstechern nach Genf und Lausanne. Das zweite Herz schlägt europäisch.
Über ein Direktmandat im Wahlkreis Pforzheim zog der Volljurist 2002 in den Bundestag ein und übernahm drei Jahre später bereits das Amt des stellvertretenden europapolitischen Sprechers innerhalb der Unionsfraktion. “Die Entscheidung für den Europaausschuss war für mich keine Zufallsentscheidung. Ein älterer Kollege hatte mich gefragt: ‘Was willst du denn im Europaausschuss? Die machen doch die Verfassung.’ Was dann später der Vertrag von Lissabon wurde. ‘Dann ist es doch dort total langweilig.’ Also diese Langeweile kam nie auf, weil die Themen eben auch sehr, sehr vielseitig sind“, sagt Krichbaum.
Bei genauer anatomischer Betrachtung sind es aber wohl doch nicht zwei Herzen, sondern nur eines in der Brust des 59-Jährigen. Sein Engagement für Europa habe nämlich eine Vorgeschichte und diese liegt wiederum in seiner Heimat. “Ich bin aufgewachsen in einem Ort in der Nähe von Stuttgart, in Korntal und in Baden-Württemberg, eben nicht sehr weit weg von der französischen Grenze. Deswegen war das Interesse für Frankreich für mich auch ein relativ frühes, schon durch den Schüleraustausch“, erinnert sich Krichbaum.
Anfangs habe er in Frankreich überhaupt nichts verstanden. Aber das tat seiner Lust an anderen Ländern keinen Abbruch. “Europa hat mich schon immer fasziniert, tatsächlich schon als Jugendlicher. Die vielen verschiedenen Kulturen, Sprachen, die Unterschiedlichkeit unserer einzelnen Länder. Und deswegen hatte ich einfach auch schon privat früher die verschiedenen Länder bereist und bin dem schlicht und ergreifend auch treu geblieben”, ergänzt der CDU-Politiker.
Seine Europaaffinität machte sich ebenso im Bundestag schnell bemerkbar. Bis zum Regierungswechsel 2021 war Krichbaum etwas mehr als 14 Jahre Vorsitzender des Ausschusses für Angelegenheiten der Europäischen Union. Er wurde damit zur festen Größe, wenn es um EU-relevante Sachfragen und auch um deren Vermittlung ging. “Als Ausschussvorsitzender haben Sie eine sehr stark moderierende, koordinierende Rolle, mitunter auch sehr stark repräsentative Rolle”, so Krichbaum.
Darüber hinaus war eine ausgedehnte Reisetätigkeit Teil seines Abgeordnetenlebens – und trotzdem schaffte er es, sein Direktmandat mittlerweile sechsmal zu gewinnen. “Im Wahlkreis muss das akzeptiert sein. Auf der anderen Seite gibt es genügend Möglichkeiten, dass Synergien bei Städtepartnerschaften entstehen oder man auch Kommunen unterstützt, indem europäische Fördergelder an Land gezogen werden. Es geht durchaus, aber es ist erklärungsbedürftig, das ist wahr”, sagt Krichbaum.
Der Europaausschuss gehöre zu einem von fünf Ausschüssen mit einer starken “Außenberührung”, wie es Krichbaum nennt. “Also da muss man mit anderen Worten, seinen Koffer fast so lieben wie seine Frau. Auf jeden Fall ist es so, dass man wissen muss, dass, wenn man sich für einen dieser Ausschüsse entscheidet, tatsächlich auch viel unterwegs ist. Aber die Entschädigung dafür ist: Es ist unglaublich bereichernd”, sagt Krichbaum.
Seit der letzten Bundestagswahl und dem Ausscheiden der Union aus der Bundesregierung ist er nicht mehr Ausschussvorsitzender, dafür aber europapolitischer Sprecher seiner Fraktion. Die Europapolitik an sich lässt Krichbaum nicht los. Angesprochen darauf, wie er über Berlin-Mitte hinaus für ein solches Politikfeld eigentlich Networking betreibt, findet der Pforzheimer eine ansprechende Metapher: “Im Prinzip ist es wie ein Stein, den sie ins Wasser werfen und der dann seine konzentrischen Kreise zieht. Natürlich ist jetzt in meiner Funktion die Aufgabe, dass ich in erster Linie den Kontakt zu den anderen christdemokratischen Parteien halte, im Rahmen der EVP. Ich bin auch Mitglied im Vorstand der EVP.”
Darüber hinaus kommt Krichbaum jedoch über Formate wie interparlamentarische Konferenzen auch mit Kolleginnen und Kollegen anderer Parteien ständig in Kontakt. “Viel entsteht auch durch die Auslandsbesuche, die ich ganz regelmäßig vornehme. Es vergeht keine Woche, in der ich nicht irgendwie im Flieger sitze”, ergänzt der 59-Jährige. Um das auf sich zu nehmen und weiterhin mit Leidenschaft bei der Sache zu sein, muss das Herz schon stark für Europa schlagen. Constanin Eckner
