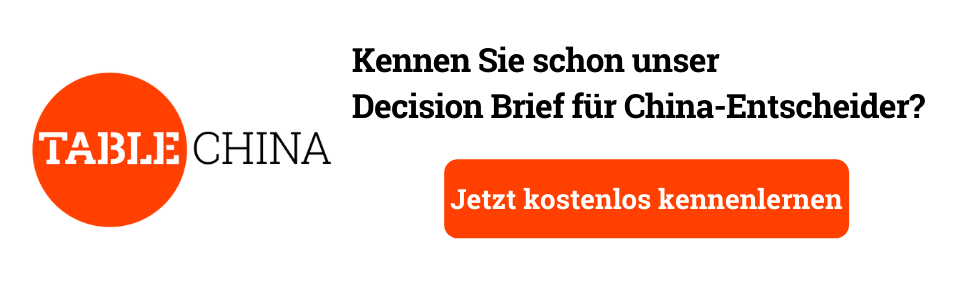russischer Boden ist für zahlreiche europäische Abgeordnete, Personen des öffentlichen Lebens und Journalisten künftig tabu. Das russische Außenministerium hat gestern ein Einreiseverbot für die “oberste Führungsebene der EU sowie für die überwiegende Mehrheit der Mitglieder des Europäischen Parlaments, die eine antirussische Politik unterstützen” verhängt.
Gasrechnungen aus Russland müssen ab heute über die Gazprom-Bank beglichen werden, so will es Präsident Wladimir Putin. Wirklich ändern wird sich aber aus europäischer Sicht nichts, zumindest bleibt Bundeskanzler Olaf Scholz gelassen. Lukas Scheid hat analysiert, über welches Kontenkonstrukt die Zahlungen künftig erfolgen und was hinter Putins Kampf um die Währungshoheit stecken könnte.
Alarm kommt derzeit aus der Medizin und MedTech-Branche. Die Anforderungen in der neuen EU-Medizinprodukteverordnung sind teilweise so hoch, dass es für Hersteller von Medizinprodukten kaum mehr lukrativ ist, bestimmte Produkte weiter am Markt zu halten, geschweige denn Forschung und Entwicklung zu betreiben, schreibt Eugenie Ankowitsch.
Die Gesetzesinitiative der EU-Kommission zur strategischen Gasspeicherung steht in der Kritik. Unter anderem monieren Mitgliedstaaten, die große Speicherkapazitäten füllen müssen, um Länder ohne eigene Speicher mitversorgen zu können, die unzureichende Teilung der Lasten. Mehr dazu lesen Sie in den News.
Neu bei Europe.Table: Claire Stam schreibt in der Kolumne “What’s cooking in Brussels” über das, was in der kommenden Woche in Brüssel auf der europäischen Speisekarte stehen wird. Wohl bekomm’s!

Obwohl Christian Lindner (FDP) eine “Prüfung im Einzelnen” ankündigte, was das per Dekret erlassene russische Zahlungsregime für Gas vorschreibe, scheint man sich keine allzu großen Sorgen zu machen. Eine “Putin’sche Nebelkerze, um Verwirrung zu stiften”, nannte es Jens Südekum, Mitglied des Beratungsgremiums des Bundeswirtschaftsministeriums. Auch aus Berliner Regierungskreisen ist die Einschätzung zu hören, Putins Dekret ändere nichts Wesentliches am Status Quo. Gas dürfte also auch weiterhin gen Europa fließen.
Italiens Ministerpräsident Mario Draghi sagte, er verstehe es als “interne Angelegenheit der Russischen Föderation”. Deutsche Gazprom-Kunden hielten sich am Mittwoch noch mit Reaktionen zurück, was das Dekret bedeute.
Das Dekret sieht vor, dass die Gazprombank praktisch als Vermittlungsinstanz für den Gaseinkauf westlicher Länder agiert. Ein ausländischer Gaskunde wird dabei verpflichtet, Devisen auf ein spezielles sogenanntes K-Konto zu überweisen. Die Gazprombank soll dann im Namen des Kunden Rubel aufkaufen und die russische Währung auf ein anderes K-Konto transferieren. In einem weiteren Schritt sollen die Rubel dann auf ein Konto des Gaslieferanten Gazprom wandern. Die Gazprombank kann solche Konten laut Dekret ohne Anwesenheit eines Vertreters eines ausländischen Gaskäufers eröffnen.
“Wenn solche Zahlungen nicht geleistet werden, betrachten wir dies als Verzug der Käufer mit allen daraus resultierenden Konsequenzen”, verkündete Wladimir Putin am Donnerstag. “Niemand verkauft uns etwas umsonst, und wir werden auch keine Wohltätigkeit tun – das bedeutet, bestehende Verträge werden gestoppt.“
Trotz dieser Androhung eines Gasstopps reagierte Bundeskanzler Olaf Scholz am Donnerstag gelassen und verwies wie auch Mario Draghi und Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire wiederholt auf bestehende Verträge. “Auf alle Fälle gilt für die Unternehmen, dass sie in Euro zahlen wollen, können und werden”, so Scholz. Finanzminister Lindner betonte, man lasse sich nicht erpressen und wolle keinen Beitrag leisten, die russische Kriegskasse zu füllen. Sanktionen gegen die russische Währung blieben bestehen.
“Möglicherweise handelt der Kreml aus der Angst heraus, dass die Gazprom-Bank bald ebenfalls sanktioniert wird, und zwar inmitten eines umfassenderen Bestrebens der Europäischen Union, die Energiebeziehungen mit Russland vollständig zu kappen”, sagte ein Analyst bei Fitch Solutions. Möglich ist das: Wirtschaftsminister Robert Habeck sagte nach einem Treffen mit seinem französischen Amtskollegen Le Maire, man habe sich auch über weitere Sanktionen unterhalten. Details gab er nicht bekannt, außer: “Das letzte Sanktionspaket muss nicht das Letzte sein – sollte nicht das Letzte sein.”
Unterstützung für den Kurs der europäischen Regierungen kommt von der energieintensiven Industrie. “Wir sollten weiter in der Frage Eurozahlung zusammenhalten, die verbleibende Zeit aber nutzen, um uns Gedanken zu machen, wie mit dem Gasbedarf der Industrie umzugehen ist”, sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbands der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft (VIK), Christian Seyfert. Er sprach sich zudem dafür aus, Kohlekraftwerke schon jetzt aus der Reserve holen, um die Gasspeicher zu schonen.
Offen ist, was der Transferierungsprozess von Euro oder Dollar in Rubel für die russische Währung bedeutet. Bislang hat Europa in diesem Jahr täglich 200 bis 800 Millionen Euro für russisches Gas ausgegeben. Eine Umrechnung in Rubel wäre ein enormer Gewinn für den Rubel. Allerdings ist unklar, ob das Prozedere über die K-Konten diesen Effekt erzielt.
Das Bundeswirtschaftsministerium spielt einem Medienbericht zufolge intern derzeit auch eine Verstaatlichung bis hin zu einer Enteignung der deutschen Töchter der russischen Energiekonzerne Gazprom und Rosneft durch. Damit wolle die Bundesregierung im Falle einer Schieflage der Unternehmen einer massiven Beeinträchtigung der Energieversorgung insbesondere in Ostdeutschland vorbeugen, berichtet das “Handelsblatt” unter Berufung auf Regierungsvertreter.
Banken und Geschäftspartner gehen seit Inkrafttreten der Sanktionen gegenüber Russland auf Distanz zu Firmen mit russischen Eigentümern. Die Gefahr eines “technischen Konkurses” sei daher nicht von der Hand zu weisen. Der Hintergrund dürfte aber auch noch ein anderer sein: Die russischen Eigentümer erschwerten den betriebenen Abschied von russischem Öl und Gas, weil eine Rosneft-Raffinerie nicht einfach russisches Öl mit Öl von anderswo ersetzen könnte, heißt es in Berlin.
Kippten die beiden Unternehmen, hätte dies massive Auswirkungen auf die Energieversorgung. Gazprom Germania betreibt große Gasspeicher, Rosneft Deutschland steht für 25 Prozent des deutschen Raffineriegeschäfts. Mit rtr
Rat der EU: Bildung, Jugend, Kultur und Sport
04.04.-05.04.2022
Agenda: Auf der vorläufigen Tagesordnung stehen unter anderem eine Debatte zu den Schlussfolgerungen zur Stärkung des interkulturellen Austauschs durch die Mobilität von Künstler:innen sowie Kulturschaffenden und durch Mehrsprachigkeit im digitalen Zeitalter sowie zum Titel “Aufbau einer europäischen Strategie für das Ökosystem der Kultur- und Kreativwirtschaft”.
Vorläufige Tagesordnung (Französisch)
Treffen der Euro-Gruppe
04.04.2022 15:00 Uhr
Agenda: Die Finanzminister:innen des Euro-Raums kommen zu Beratungen zusammen. Es soll dabei unter anderem um die kurz- und mittelfristigen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine bezogen auf die makroökonomische Lage gehen. Zudem steht das Thema der Abwägung bei der Gestaltung eines digitalen Euro zwischen Datenschutz und anderen politischen Themen auf der Agenda.
Vorläufige Tagesordnung (Englisch)
Plenartagung des EU-Parlaments: Sachstandsbericht IPCC, Emissionshandel
04.04.2022 17:00-22:00 Uhr
Agenda: Auf der vorläufigen Tagesordnung stehen unter anderem Aussprachen zum 6. Sachstandsbericht des Weltklimarats der Vereinten Nationen (IPCC) sowie zum Bericht über die Überarbeitung der Marktstabilitätsreserve für das Emissionshandelssystem der EU.
Vorläufige Tagesordnung
Wöchentliche Kommissionssitzung
05.04.2022
Agenda: Auf der vorläufigen Tagesordnung stehen unter anderem das Emissions- und Schadstoffpaket. Im Anschluss an die Sitzung der Kommission findet voraussichtlich gegen 15:00 Uhr eine Pressekonferenz statt.
Vorläufige Tagesordnung Pressekonferenz Live
Plenartagung des EU-Parlaments: Ukraine, Energieinfrastruktur
05.04.2022 09:00-22:00 Uhr
Agenda: Auf der vorläufigen Tagesordnung stehen unter anderem Aussprachen zum Schwerpunktthema Ukraine sowie zum Bericht über die transeuropäische Energieinfrastruktur.
Vorläufige Tagesordnung
Rat der EU: Wirtschaft und Finanzen
05.04.2022 10:00 Uhr
Agenda: Auf der vorläufigen Tagesordnung stehen unter anderem eine Richtlinie zur Festsetzung einer globalen Mindeststeuer für multinationale Konzerne, wirtschaftliche und finanzielle Aspekte der Ukraine-Krise sowie die Vorbereitung des Treffens der Finanzminister:innen und der Zentralbankpräsident:innen der G20-Staaten.
Vorläufige Tagesordnung (Französisch)
Plenartagung des EU-Parlaments: Europäischer Rat, Daten-Governance-Gesetz
06.04.2022 09:00-22:00 Uhr
Agenda: Auf der vorläufigen Tagesordnung stehen unter anderem Aussprachen zu den Schlussfolgerungen der Tagung des Europäischen Rates vom 24./25.03.2022 sowie zum Bericht über das Daten-Governance-Gesetz.
Vorläufige Tagesordnung
Ratspräsidentschaft: Konferenz zum Thema Energie
07.04.2022
Agenda: Im Rahmen der Konferenz zum Thema Energie kommen hochrangige Expert:innen der EU-Mitgliedstaaten und Vertreter:innen der Europäischen Kommission sowie von europäischen Vereinen und Unternehmen aus dem Energiesektor zusammen. Ziel der Konferenz wird sein, die Diskussionen über energiepolitische Fragen zum “Fit for 55”-Paket voranzutreiben und einen umfassenderen Gedankenaustausch über die marktbezogenen und technologischen Herausforderungen zu ermöglichen.
Infos
Plenartagung des EU-Parlaments: Recht auf Reparatur
07.04.2022 09:00-16:00 Uhr
Agenda: Auf der vorläufigen Tagesordnung stehen unter anderem eine Anfrage zum Recht auf Reparatur.
Vorläufige Tagesordnung
Rat der EU: Landwirtschaft und Fischerei
07.04.2022 11:00 Uhr
Agenda: Auf der vorläufigen Tagesordnung stehen unter anderem ein Anpassungspaket für die Landwirtschaft an die “Fit-for-55″-Ziele, eine Information der Kommission und der Mitgliedstaaten zur Lage auf den Agrarmärkten, insbesondere nach der Invasion in der Ukraine, sowie ein Meinungsaustausch zur Gewährleistung der Ernährungssicherheit und Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Nahrungsmittelsysteme.
Vorläufige Tagesordnung (Französisch)
Die Vereinigung für europäische pädiatrische und kongenitale Kardiologie AEPC (Association for European Paediatric and Congenital Cardiology) habe sie über einen drohenden Mangel an Medizinprodukten für pädiatrische Herzinterventionen informiert, schreibt die niederländische EP-Abgeordnete Kathleen van Brempt (S&D) in ihrer parlamentarischen Anfrage an die Kommission. Dieser Mangel soll eine Folge der EU-Medizinprodukteverordnung (MDR) sein. Ob dieses Problem der Kommission bewusst sei und ob sie plane, die MDR zu überarbeiten, fragt van Brempt.
Laut Matthias Gorenflo, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Kardiologie und Angeborene Herzfehler e.V. (DGPK) zeichnet sich der Mangel nicht nur ab, sondern ist schon jetzt real. Firmenvertreter:innen würden in Gesprächen häufig argumentieren, dass die Kosten und der Aufwand für die Rezertifizierung nach der MDR derart hoch seien, dass man Produkte lieber aus dem Portfolio nehme, berichtet Gorenflo, der als Ärztlicher Direktor an der Klinik für Kinderkardiologie und Angeborene Herzfehler am Universitätsklinikum Heidelberg tätig ist.
Das betrifft seinen Angaben zufolge eine ganze Reihe von Produktgruppen, angefangen mit den Biopsiezangen, über sogenannte Herzsets und transseptale Nadeln bis hin zu lebensrettende Medizinprodukten wie Ballonatrioseptostomie-Katheter. Diesen benutzen Kinderkardiolog:innen, um bei schwerstkranken Neugeborenen die Verbindung zwischen rechter und linker Vorkammer aufzureißen. Dies führe zur Vermischung vom roten und blauen Blut und mache Patient:innen überlebensfähig, erklärt Gorenflo.
Derzeit liefert nur noch ein einziger Hersteller einen solchen Ballonatrioseptostomie-Katheter. Andere hätten entsprechende Produkte bereits vom Markt genommen. “Leider ist das verbliebene Produkt vom Handling her etwas ganz anderes als die Produkte, die wir früher vorzugsweise genutzt haben”, berichtet der Kinderkardiologe. Das verkompliziere die Prozedur und mache sie länger. Letztendlich sei es eine Gefahr für die kleinen Patient:innen. “Ich möchte es mir allerdings nicht einmal vorstellen, dass auch der letzte Hersteller zum Schluss kommt, das Produkt vom Markt zu nehmen”, betont er.
Der DGPK-Präsident glaubt, die EU-Kommission habe unterschätzt, welche Folgen die MDR in der Versorgungsrealität haben wird. Das Ziel muss aus seiner Sicht sein, eine bessere Balance zwischen den berechtigten Forderungen nach Patient:innensicherheit und der Praktikabilität in der Umsetzung durch die Hersteller zu finden.
Seit Langem warnen die Medizinproduktehersteller vor Versorgungsengpässen aufgrund der MDR. Sie gilt seit Mai 2021, wobei das Gesetz den Herstellern eine dreijährige Übergangszeit für die Zertifizierung der Bestandsprodukte einräumt. Die MDR sieht zum Schutz der Patient:innen strengere Regeln für die Produktsicherheit und Transparenz vor. Die Industrie klagt über deutlich gestiegene Kosten, Umsetzungsfragen und erhöhten Zertifizierungsaufwand für das Inverkehrbringen ihrer Produkte (Europe.Table berichtete).
Für Bestands- und Nischenprodukte, zu denen auch Medizinprodukte für kardiologische Interventionen bei Babys und Kindern zählen, fordert der Bundesverband Medizintechnologie (BVMed) rasche Lösungen. Das Problem der Nischenprodukte könne man etwa nach dem Vorbild der USA lösen. Dort gilt eine “Orphan Devices”-Regelung für Medizinprodukte, die in geringer Stückzahl und für sehr spezielle Anwendungen hergestellt werden. Mit den “Orphan-Drug”-Bestimmungen gibt es auch in Europa analoge Ausnahmeregelungen im Arzneimittelbereich.
Nicht nur Nischenprodukte aus dem Bestand laufen Gefahr, vom Markt zu verschwinden, warnt die Branche. Auch Forschung und Entwicklung würden ausgebremst, weil die Zulassungsanforderungen hoch seien und es keine Perspektiven gebe, dass sich die Investition in Innovation irgendwann einmal amortisieren werde. Nicht nur Unternehmen entwickeln innovative Produkte. In Operationssälen und aus dem klinischen Alltag heraus entstehen einige Impulse für Neu- oder Weiterentwicklungen.
So auch bei Oliver Muensterer. Als Leiter der Kinderchirurgischen Klinik und Poliklinik im Dr. von Haunerschen Kinderspital am Universitätsklinikum München behandelt er viele Babys und Kleinkinder mit seltenen Krankheiten oder Fehlbildungen. Die dafür notwendigen Medizinprodukte werden nur in geringen Stückzahlen benötigt. “Leider ist der Off-Label-Use bei Kinderchirurgen praktisch unser Modus vivendi. Wir lehnen uns im Sinne unserer Patienten oft ziemlich weit aus dem Fenster”, berichtete der Kinderchirurg bei einer Veranstaltung.
“Ich selbst arbeite daran, wie man ohne eine Operation eine unterbrochene Speiseröhre mit speziellen Magneten zusammenbringen kann”, so Muensterer. “Ich hatte immer die Hoffnung, solche Ideen auf dem EU-Markt umsetzen zu können”. Derzeit sehe es danach aus, dass er die FDA-Zulassung zuerst bekäme. “Das zeigt, wie schwierig es für Leute wie mich ist, solche Ideen, die Kindern wirklich helfen, auch umzusetzen”, bedauert er. Die MDR hat aus seiner Sicht das Potenzial, Kinder zu Verlierern zu machen. Das sei nicht nur ein wirtschaftliches, politisches und medizinisches, sondern auch ein ethisches Problem.
Aus der Sicht der Industrie ist es ein Problem, dass die MDR keinerlei Ausnahmeregelungen für Produkte vorsieht, die für kleine Patient:innenpopulationen bestimmt sind. Nicht einmal als Begriff gibt es Nischenprodukte in der Systematik der Verordnung. Oft wird in Diskussionen auf die Möglichkeit der Sonderzulassung gemäß Artikel 59 MDR verwiesen. Doch dieser Weg ist für Nischenprodukte nicht tragfähig, sind sich Expert:innen einig.
“Der Gesetzgeber hatte dabei gar nicht die Nischenprodukte vor Augen, sondern Ausnahmefälle”, erläutert Heike Wachenhausen, Rechtsanwältin und Honorarprofessorin an der Technischen Hochschule Lübeck. Deshalb gebe es eben eine zeitliche Befristung. Auch muss der Hersteller in jedem einzelnen Mitgliedstaat eine nationale Genehmigung beantragen. Wachenhausen ist eine der Expert:innen, die die baden-württembergische Landesregierung mit der Erarbeitung von Handlungsempfehlungen beauftragt hat, die aufzeigen, wie die Umsetzung der MDR gelingen kann. Die Empfehlungen wurden inzwischen an die EU-Kommission übergeben (Europe.Table berichtete).
Substanzielle Änderungen an der MDR seien eher nicht zu erwarten, sagte Peter Bischoff-Everding, Rechtsreferent im Referat Medizinprodukte, GD Sante, auf einer Veranstaltung. Die Kommission nehme allerdings die Hinweise, die derzeit überwiegend aus Deutschland kämen, ernst. Die Mitglieder der “Medical Devices Coordination Group” (MDCG) hätten bereits Ende 2021 darüber diskutiert und eine Arbeitsgruppe gegründet. Diese soll zunächst eine detaillierte Problemanalyse erstellen. Dazu gehöre auch eine Definition des Begriffs Nischenprodukte.
In einem nächsten Schritt sollen die Ursachen des Problems klar identifiziert werden, um anschließend gegebenenfalls Maßnahmen auszuarbeiten. Bevor mögliche Lösungen entwickelt werden können, müsse geklärt werden, ob es sich um ein vorübergehendes Problem handelt, das mit dem Übergang von den früheren Medizinprodukterichtlinien zur MDR zusammenhängt, oder um ein strukturelles Langzeitproblem, heißt es auch in der Antwort der Kommission auf die parlamentarische Anfrage von van Brempt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt beabsichtige man jedenfalls nicht, die MDR zu überarbeiten.
Wegen hoher Beschaffungskosten für Gas haben die Mitgliedsstaaten Bedenken gegen die Gesetzesinitiative der EU-Kommission zur strategischen Gasspeicherung. Bei einem Treffen der Ratsarbeitsgruppe Energie am Montag beklagten nach Informationen von Europe.Table aus EU-Kreisen einige Länder mit großen Speicherkapazitäten eine unzureichende finanzielle Lastenteilung, wenn sie für Staaten ohne eigene Speicher Gas bevorraten sollen. Zu dieser Gruppe gehören die Niederlande, Österreich, Ungarn und Lettland.
Eine Staatengruppe mit geringer oder gar keiner Speicherkapazität hat wiederum Bedenken gegen die Vorgabe, 15 Prozent des Jahresverbrauchs in Speichern anderer EU-Staaten bevorraten zu müssen. Zu diesen Ländern zählen unter anderem Belgien, Finnland, Spanien und Griechenland.
Österreich rechnete bei dem Treffen eine Belastung von 15 Milliarden Euro vor, wenn seine Gasspeicher wie von der EU vorgesehen zu 90 Prozent gefüllt werden sollten. Die Kosten müsse letztlich der Steuerzahler tragen. Die vorgesehene Lastenteilung sei ungeeignet, weil es nur um die Mitgliedsstaaten gehe, die über keine eigenen Speicher verfügen.
Ein Beamter der Generaldirektion Energie führte bei dem Treffen aus, dass sich die 15 Prozent Speichermenge von Staaten ohne eigene Gasspeicher nur auf den jährlichen Verbrauch geschützter Gaskunden bezögen. Würden diese Mengen in einem Staat mit Speichern gebucht, könne dieser die für andere Länder vorgehaltenen Mengen von seinem vorgeschriebenen Mindestfüllstand abziehen.
EU-Staaten ohne eigene Gasspeicher sind die Inselstaaten Irland, Malta und Zypern. Außerdem zählen dazu Finnland, Litauen, Estland, Luxemburg, Slowenien und Griechenland.
In der gestrigen Sitzung des Industrieausschusses im EU-Parlament beklagte Christian Ehler (EVP), dass entgegen früheren Entwürfen des Kommissionsvorschlags keine Rolle mehr für die Regulierungsagentur ACER beim Speichermonitoring vorgesehen sei. Außerdem mahnte er eine schnellere Zertifizierung von Speicherbetreibern an. In Bezug auf das Gaspaket drängte Ehler darauf, auch beim Aufbau von Wasserstoff-Infrastruktur bereits die Versorgungssicherheit zu berücksichtigen. ber
Die Europäische Kommission werde alles nötige tun, um die europäische Solarindustrie wieder aufzubauen, sagte EU-Energiekommissarin Kadri Simson am Donnerstag. Gleichzeitig arbeite die EU Pläne aus, um die Abhängigkeit von russischem Gas rasch zu verringern. Dies soll unter anderem mit mehr Tempo beim Ausbau der Erneuerbaren Energien geschehen.
Mit einer gezielten Strategie für die Solarenergie sollen die Genehmigungsverfahren, die die Installation von Solaranlagen bisher verzögert haben, beschleunigt werden, mehr Solarstrom-Abnahmeverträge geschlossen und die Produktionskapazitäten für Solaranlagen in Europa aufgebaut werden, erklärte Kadri Simson auf der Konferenz Solar Power Summit in Brüssel. Simson fügte hinzu, dass dies auch Hilfe bei der Finanzierung von Projekten beinhalten würde.
Die EU hat zwischen 2013 und 2018 Antidumping- und Antisubventionskontrollen für Solarpaneele aus China eingeführt, um die europäischen Hersteller vor einer Flut von billigeren Teilen aus dem weltweit führenden Hersteller von Solarprodukten zu schützen. rtr
Der Streit um die Begrenzung von personalisierter Werbung im Rahmen des Digital Services Act geht in die nächste Runde. Beim vierten Trilog bestätigten die Unterhändler von Europaparlament, Rat und Kommission zwar einen vergangene Woche im Rahmen der Verhandlungen um den Digital Markets Act vereinbarten Bann von personalisierter Werbung für Minderjährige und die Nutzung sensibler Daten etwa über religiöse und sexuelle Orientierungen. Wie die konkrete Ausgestaltung aussehen soll, sei aber weiterhin unklar, hieß es in Verhandlungskreisen.
Die Vertreter des Europaparlaments sollen nun einen eigenen Formulierungsvorschlag erarbeiten. Die französische Ratspräsidentschaft hatte zuvor vorgeschlagen, den sehr großen Online-Plattformen zu untersagen, minderjährigen Nutzern auf persönlichen Informationen basierende Werbung zu präsentieren. Dies gilt aber nur unter der Voraussetzung, dass die Unternehmen Kenntnis von der Minderjährigkeit haben, ohne dafür zusätzliche Daten zu erheben.
Vor allem Sozialdemokraten, Grünen und Linken im Europaparlament geht das nicht weit genug. Sie pochen unter anderem darauf, dass das Verbot für alle Plattformen gilt, nicht nur für die ganz großen. Zudem soll eine spezifische Regelung aufgenommen werden, die Minderjährige vor irreführenden Nutzer-Oberflächen schützt, den sogenannten Dark Patterns. Hier seien sich Rat und Parlament einig, hieß es in den Kreisen. Der nächste Trilog soll Ende April stattfinden, der genaue Termin steht noch nicht fest. tho
EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager will die Rechtsgrundlage für ihre Untersuchungen gegen Marktmachtmissbrauch und Kartellabsprachen überarbeiten. Die Verordnung 1/2003 solle in den kommenden Monaten evaluiert werden, kündigte Vestager gestern auf einer Konferenz an. Es gehe darum, durch Konsultation von Stakeholdern zu überprüfen, was an den seit 2004 geltenden Regeln gut funktioniere “und wo es Spielraum für effizientere und wirksamere Verfahren und Durchsetzungsinstrumente gibt, um sicherzustellen, dass die Verordnung 1 wirklich fit für das digitale Zeitalter ist”.
Die Verordnung 1/2013 ist die Grundlage für Verfahren gegen Unternehmen, die ihre Marktmacht missbrauchen. Die EU-Wettbewerbsbehörde ist auf dieser Basis gegen Unternehmen wie Google, Apple, Amazon, Microsoft und Intel vorgegangen und hat Geldbußen teils in Milliardenhöhe verhängt. Die Untersuchungen zogen sich aber häufig über mehrere Jahre hin. Kritiker bemängelten daher, die Strafen könnten den entstandenen Schaden für den Wettbewerb nicht mehr beheben.
Die Regeln ermöglichten es der EU-Wettbewerbsbehörde auch, gegen Kartelle vorzugehen. Vestager sagte, dass die aktualisierten Regeln darauf abzielen würden, sie operationeller und nützlicher für die Unternehmen zu machen. Die verfahrenstechnischen Änderungen betreffen Auskunftsersuchen an Unternehmen, Razzien, mündliche Anhörungen und die Obergrenze von zehn Prozent für Geldbußen, die bei Verstößen verhängt werden können. tho/rtr
Die russische Invasion in der Ukraine konfrontiert die Europäische Union in einer brutalen, nackten Weise mit der Frage, die sie bisher immer erfolgreich unter dem Deckmantel der Handelsbeziehungen umgangen hat: Wie geht sie mit autoritären Staaten um, die nicht zögern, die Werte, die sie predigt, infrage zu stellen? Welche “lessons learned” kann sie daraus ziehen?
Das EU-China-Gipfeltreffen, das heute beginnt, und die Wahlen in Ungarn, die am 3. April stattfinden, rufen diese Frage auf sehr akute Weise auf der EU politische Tagesordnung. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, und der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, tauschen sich nämlich im Namen der EU vormittags mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang und nachmittags mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping per Videokonferenz aus.
Im Vorfeld des Gipfels haben Stimmen aus der EU und Amerika vor Konsequenzen für Peking gewarnt, falls es den Widerstand gegen die russische Aggression behindert. Peking hat sich aber gegen die westlichen Sanktionen gewehrt und geschworen, die Geschäfte mit Russland wie gewohnt weiterlaufen zu lassen. Am Mittwoch reiste der russische Außenminister Sergej Lawrow nach China und traf sich mit seinem Amtskollegen Wang Yi.
Der Krieg in der Ukraine hat die ohnehin schon frostige Beziehung zwischen der EU und China noch frostiger werden lassen: Die Zwangsmaßnahmen Pekings gegen Litauen sollten ursprünglich angesprochen worden, ein Thema, das die EU bei der Welthandelsorganisation gegen China vorgebracht hatte. Litauen hatte alle Diplomaten aus Peking abgezogen, nachdem China wütend auf die Eröffnung der neuen diplomatischen Vertretung Taiwans in Vilnius reagiert hatte.
Eine weitere Frage war auch das umfassende Investitionsabkommen. Das Abkommen wurde zwar im Dezember 2020 von der EU mit China vereinbart, aber “eingefroren”, nachdem Peking im vergangenen Jahr Sanktionen gegen Mitglieder des Europäischen Parlaments verhängt hatte. Schade nur, dass die großen wirtschaftlichen Interessen, die in den letzten Jahrzehnten aufgebaut wurden, Europa von Peking abhängig gemacht haben. Deshalb werden Ursula von der Leyen und Charles Michel gleichzeitig versuchen, Europas starke Wirtschaftsbeziehungen zu China zu erhalten, und ihn auch dazu drängen, sich dem blutigen Krieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin entgegenzustellen. An dieser Stelle möchte man hier viel Glück wünschen.
Was die Wahlen in Ungarn angeht: Brüssel zeigt sich vor weiteren vier Jahren mit Viktor Orbán resigniert. Der seit 2010 an der Macht befindliche Gründer und Vorsitzende der Fidesz, einer Formation, die zur extremen Rechten übergelaufen ist, steht mit seinen 58 Jahren zwar vor voraussichtlich knappen Wahlen: Zum ersten Mal seit zwölf Jahren hat sich fast die gesamte Opposition hinter einem einzigen, Pro-EU-Kandidaten versammelt, um zu versuchen, ihn zu stürzen. Dennoch stehen die Chancen, dass Viktor Orbán wieder gewählt wird, hoch.
Warum sind die Wahlen in Ungarn für Brüssel wichtig? Ähnlich wie mit China geht es hier schließlich um klingende Münze. Denn Viktor Orbán hat bereits in einem Brief an Brüssel gefordert, dass die Gelder aus dem Konjunkturprogramm, die derzeit wegen seiner Verfehlungen in Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit eingefroren sind, an ihn ausgezahlt werden.
Wie Polen spielt es mit der ukrainischen Flüchtlingskrise, um die europäischen Kreise zu bemitleiden. Doch im Gegensatz zu seinen ultrakonservativen polnischen Verbündeten hat Orbán die Türen für ukrainische Flüchtlinge nur scheinbar geöffnet: Die meisten von ihnen bleiben nicht im Land, da es keine echte Willkommenspolitik gibt.
Nun, der Krieg in der Ukraine bietet die Gelegenheit, die Achse zu schwächen, die er mit Polen gebildet hat, um die EU von innen heraus zu verändern. Orbáns prorussischer Tropismus stößt in Warschau auf wachsendes Unbehagen, wo die ultrakonservative Partei Recht und Gerechtigkeit die Ukraine ohne mit der Wimper zu zucken unterstützt.
Die laufenden Anhörungen zu den Verstößen Polens und Ungarns gegen die EU-Werte stehen übrigens auf der Tagesordnung der Sitzung des EU-Parlaments in der kommenden Woche. Die Abgeordneten werden außerdem über die Reaktion der EU auf die russische Invasion in der Ukraine debattieren, den Aktionsplan der Union zur Stärkung ihrer Sicherheits- und Verteidigungspolitik bis 2030, die Schlussfolgerungen des EU-Gipfels vom 24. und 25. März sowie die Ergebnisse des EU-China-Gipfels bewerten.
Darüber hinaus werden die Europaabgeordneten über die vorgeschlagene Aktualisierung der Regeln zur Finanzierung von Energieprojekten, das “Recht auf Wiedergutmachung” und die Situation der Frauen in Afghanistan abstimmen. Soweit das offizielle Programm. Denn in den Fluren der Institution in der Rue Wiertz bleiben die Diskussionen zwischen den EU-Parlamentariern aller Parteien um die Frage der Taxonomie und das von der Europäischen Kommission angenommene Verfahren, das nach Ansicht der Parlamentarier in die Vorrechte des Parlaments eingreift, weiterhin heiß.
“Wir sprechen mit allen demokratischen Parteien”, bestätigt der deutsche Europaabgeordnete Michael Bloss (Bündnis 90/Die Grünen) gegenüber Table.Media. Und er erinnert dabei daran, was auf dem Spiel steht: die Glaubwürdigkeit eines Finanzinstruments, das einer Energiequelle, die den Hintergrund des Krieges in der Ukraine nährt, den grünen Stempel aufdrückt, und die Frage des Verfahrens, das die Europäische Kommission angewandt hat, um ihr Projekt durch einen delegierten Rechtsakt, der Gas und Atomenergie als “grün” einstuft, zu drängen.
Die Kommission hat den Entwurf des delegierten Rechtsakts am 11. März an das Europäische Parlament weitergeleitet. Die EU-Abgeordneten haben bis zum 11. Juli Zeit, ihn abzulehnen, benötigen dafür aber eine absolute Mehrheit von 353 Stimmen. Bloss schätzt die Zahl der Abgeordneten, die bereit sind, sich zu wehren, auf etwa 250. Die Grüne Europa-Fraktion hat bereits offiziell erklärt, dass sie den delegierten Rechtsakt offiziell ablehnen werden.
Und in einem Brief an die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, und die Kommissarin für Finanzdienstleistungen, Mairead McGuinness, vom 15. März argumentierten mehr als 100 Europaabgeordnete aus allen politischen Lagern (darunter auch Bloss), dass die EU-Exekutive, wenn sie wirklich russisches Gas loswerden wolle, Gas aus der Taxonomie streichen müsse. Und sie forderten, den Entwurf des delegierten Rechtsakts in der vorgelegten Form angesichts der aktuellen geopolitischen Lage zurückzuziehen. Es fehlen noch etwa 100 Abgeordnete, um die Situation umzukehren… der Krieg in der Ukraine könnte noch einige Unentschlossene überzeugen.
russischer Boden ist für zahlreiche europäische Abgeordnete, Personen des öffentlichen Lebens und Journalisten künftig tabu. Das russische Außenministerium hat gestern ein Einreiseverbot für die “oberste Führungsebene der EU sowie für die überwiegende Mehrheit der Mitglieder des Europäischen Parlaments, die eine antirussische Politik unterstützen” verhängt.
Gasrechnungen aus Russland müssen ab heute über die Gazprom-Bank beglichen werden, so will es Präsident Wladimir Putin. Wirklich ändern wird sich aber aus europäischer Sicht nichts, zumindest bleibt Bundeskanzler Olaf Scholz gelassen. Lukas Scheid hat analysiert, über welches Kontenkonstrukt die Zahlungen künftig erfolgen und was hinter Putins Kampf um die Währungshoheit stecken könnte.
Alarm kommt derzeit aus der Medizin und MedTech-Branche. Die Anforderungen in der neuen EU-Medizinprodukteverordnung sind teilweise so hoch, dass es für Hersteller von Medizinprodukten kaum mehr lukrativ ist, bestimmte Produkte weiter am Markt zu halten, geschweige denn Forschung und Entwicklung zu betreiben, schreibt Eugenie Ankowitsch.
Die Gesetzesinitiative der EU-Kommission zur strategischen Gasspeicherung steht in der Kritik. Unter anderem monieren Mitgliedstaaten, die große Speicherkapazitäten füllen müssen, um Länder ohne eigene Speicher mitversorgen zu können, die unzureichende Teilung der Lasten. Mehr dazu lesen Sie in den News.
Neu bei Europe.Table: Claire Stam schreibt in der Kolumne “What’s cooking in Brussels” über das, was in der kommenden Woche in Brüssel auf der europäischen Speisekarte stehen wird. Wohl bekomm’s!

Obwohl Christian Lindner (FDP) eine “Prüfung im Einzelnen” ankündigte, was das per Dekret erlassene russische Zahlungsregime für Gas vorschreibe, scheint man sich keine allzu großen Sorgen zu machen. Eine “Putin’sche Nebelkerze, um Verwirrung zu stiften”, nannte es Jens Südekum, Mitglied des Beratungsgremiums des Bundeswirtschaftsministeriums. Auch aus Berliner Regierungskreisen ist die Einschätzung zu hören, Putins Dekret ändere nichts Wesentliches am Status Quo. Gas dürfte also auch weiterhin gen Europa fließen.
Italiens Ministerpräsident Mario Draghi sagte, er verstehe es als “interne Angelegenheit der Russischen Föderation”. Deutsche Gazprom-Kunden hielten sich am Mittwoch noch mit Reaktionen zurück, was das Dekret bedeute.
Das Dekret sieht vor, dass die Gazprombank praktisch als Vermittlungsinstanz für den Gaseinkauf westlicher Länder agiert. Ein ausländischer Gaskunde wird dabei verpflichtet, Devisen auf ein spezielles sogenanntes K-Konto zu überweisen. Die Gazprombank soll dann im Namen des Kunden Rubel aufkaufen und die russische Währung auf ein anderes K-Konto transferieren. In einem weiteren Schritt sollen die Rubel dann auf ein Konto des Gaslieferanten Gazprom wandern. Die Gazprombank kann solche Konten laut Dekret ohne Anwesenheit eines Vertreters eines ausländischen Gaskäufers eröffnen.
“Wenn solche Zahlungen nicht geleistet werden, betrachten wir dies als Verzug der Käufer mit allen daraus resultierenden Konsequenzen”, verkündete Wladimir Putin am Donnerstag. “Niemand verkauft uns etwas umsonst, und wir werden auch keine Wohltätigkeit tun – das bedeutet, bestehende Verträge werden gestoppt.“
Trotz dieser Androhung eines Gasstopps reagierte Bundeskanzler Olaf Scholz am Donnerstag gelassen und verwies wie auch Mario Draghi und Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire wiederholt auf bestehende Verträge. “Auf alle Fälle gilt für die Unternehmen, dass sie in Euro zahlen wollen, können und werden”, so Scholz. Finanzminister Lindner betonte, man lasse sich nicht erpressen und wolle keinen Beitrag leisten, die russische Kriegskasse zu füllen. Sanktionen gegen die russische Währung blieben bestehen.
“Möglicherweise handelt der Kreml aus der Angst heraus, dass die Gazprom-Bank bald ebenfalls sanktioniert wird, und zwar inmitten eines umfassenderen Bestrebens der Europäischen Union, die Energiebeziehungen mit Russland vollständig zu kappen”, sagte ein Analyst bei Fitch Solutions. Möglich ist das: Wirtschaftsminister Robert Habeck sagte nach einem Treffen mit seinem französischen Amtskollegen Le Maire, man habe sich auch über weitere Sanktionen unterhalten. Details gab er nicht bekannt, außer: “Das letzte Sanktionspaket muss nicht das Letzte sein – sollte nicht das Letzte sein.”
Unterstützung für den Kurs der europäischen Regierungen kommt von der energieintensiven Industrie. “Wir sollten weiter in der Frage Eurozahlung zusammenhalten, die verbleibende Zeit aber nutzen, um uns Gedanken zu machen, wie mit dem Gasbedarf der Industrie umzugehen ist”, sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbands der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft (VIK), Christian Seyfert. Er sprach sich zudem dafür aus, Kohlekraftwerke schon jetzt aus der Reserve holen, um die Gasspeicher zu schonen.
Offen ist, was der Transferierungsprozess von Euro oder Dollar in Rubel für die russische Währung bedeutet. Bislang hat Europa in diesem Jahr täglich 200 bis 800 Millionen Euro für russisches Gas ausgegeben. Eine Umrechnung in Rubel wäre ein enormer Gewinn für den Rubel. Allerdings ist unklar, ob das Prozedere über die K-Konten diesen Effekt erzielt.
Das Bundeswirtschaftsministerium spielt einem Medienbericht zufolge intern derzeit auch eine Verstaatlichung bis hin zu einer Enteignung der deutschen Töchter der russischen Energiekonzerne Gazprom und Rosneft durch. Damit wolle die Bundesregierung im Falle einer Schieflage der Unternehmen einer massiven Beeinträchtigung der Energieversorgung insbesondere in Ostdeutschland vorbeugen, berichtet das “Handelsblatt” unter Berufung auf Regierungsvertreter.
Banken und Geschäftspartner gehen seit Inkrafttreten der Sanktionen gegenüber Russland auf Distanz zu Firmen mit russischen Eigentümern. Die Gefahr eines “technischen Konkurses” sei daher nicht von der Hand zu weisen. Der Hintergrund dürfte aber auch noch ein anderer sein: Die russischen Eigentümer erschwerten den betriebenen Abschied von russischem Öl und Gas, weil eine Rosneft-Raffinerie nicht einfach russisches Öl mit Öl von anderswo ersetzen könnte, heißt es in Berlin.
Kippten die beiden Unternehmen, hätte dies massive Auswirkungen auf die Energieversorgung. Gazprom Germania betreibt große Gasspeicher, Rosneft Deutschland steht für 25 Prozent des deutschen Raffineriegeschäfts. Mit rtr
Rat der EU: Bildung, Jugend, Kultur und Sport
04.04.-05.04.2022
Agenda: Auf der vorläufigen Tagesordnung stehen unter anderem eine Debatte zu den Schlussfolgerungen zur Stärkung des interkulturellen Austauschs durch die Mobilität von Künstler:innen sowie Kulturschaffenden und durch Mehrsprachigkeit im digitalen Zeitalter sowie zum Titel “Aufbau einer europäischen Strategie für das Ökosystem der Kultur- und Kreativwirtschaft”.
Vorläufige Tagesordnung (Französisch)
Treffen der Euro-Gruppe
04.04.2022 15:00 Uhr
Agenda: Die Finanzminister:innen des Euro-Raums kommen zu Beratungen zusammen. Es soll dabei unter anderem um die kurz- und mittelfristigen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine bezogen auf die makroökonomische Lage gehen. Zudem steht das Thema der Abwägung bei der Gestaltung eines digitalen Euro zwischen Datenschutz und anderen politischen Themen auf der Agenda.
Vorläufige Tagesordnung (Englisch)
Plenartagung des EU-Parlaments: Sachstandsbericht IPCC, Emissionshandel
04.04.2022 17:00-22:00 Uhr
Agenda: Auf der vorläufigen Tagesordnung stehen unter anderem Aussprachen zum 6. Sachstandsbericht des Weltklimarats der Vereinten Nationen (IPCC) sowie zum Bericht über die Überarbeitung der Marktstabilitätsreserve für das Emissionshandelssystem der EU.
Vorläufige Tagesordnung
Wöchentliche Kommissionssitzung
05.04.2022
Agenda: Auf der vorläufigen Tagesordnung stehen unter anderem das Emissions- und Schadstoffpaket. Im Anschluss an die Sitzung der Kommission findet voraussichtlich gegen 15:00 Uhr eine Pressekonferenz statt.
Vorläufige Tagesordnung Pressekonferenz Live
Plenartagung des EU-Parlaments: Ukraine, Energieinfrastruktur
05.04.2022 09:00-22:00 Uhr
Agenda: Auf der vorläufigen Tagesordnung stehen unter anderem Aussprachen zum Schwerpunktthema Ukraine sowie zum Bericht über die transeuropäische Energieinfrastruktur.
Vorläufige Tagesordnung
Rat der EU: Wirtschaft und Finanzen
05.04.2022 10:00 Uhr
Agenda: Auf der vorläufigen Tagesordnung stehen unter anderem eine Richtlinie zur Festsetzung einer globalen Mindeststeuer für multinationale Konzerne, wirtschaftliche und finanzielle Aspekte der Ukraine-Krise sowie die Vorbereitung des Treffens der Finanzminister:innen und der Zentralbankpräsident:innen der G20-Staaten.
Vorläufige Tagesordnung (Französisch)
Plenartagung des EU-Parlaments: Europäischer Rat, Daten-Governance-Gesetz
06.04.2022 09:00-22:00 Uhr
Agenda: Auf der vorläufigen Tagesordnung stehen unter anderem Aussprachen zu den Schlussfolgerungen der Tagung des Europäischen Rates vom 24./25.03.2022 sowie zum Bericht über das Daten-Governance-Gesetz.
Vorläufige Tagesordnung
Ratspräsidentschaft: Konferenz zum Thema Energie
07.04.2022
Agenda: Im Rahmen der Konferenz zum Thema Energie kommen hochrangige Expert:innen der EU-Mitgliedstaaten und Vertreter:innen der Europäischen Kommission sowie von europäischen Vereinen und Unternehmen aus dem Energiesektor zusammen. Ziel der Konferenz wird sein, die Diskussionen über energiepolitische Fragen zum “Fit for 55”-Paket voranzutreiben und einen umfassenderen Gedankenaustausch über die marktbezogenen und technologischen Herausforderungen zu ermöglichen.
Infos
Plenartagung des EU-Parlaments: Recht auf Reparatur
07.04.2022 09:00-16:00 Uhr
Agenda: Auf der vorläufigen Tagesordnung stehen unter anderem eine Anfrage zum Recht auf Reparatur.
Vorläufige Tagesordnung
Rat der EU: Landwirtschaft und Fischerei
07.04.2022 11:00 Uhr
Agenda: Auf der vorläufigen Tagesordnung stehen unter anderem ein Anpassungspaket für die Landwirtschaft an die “Fit-for-55″-Ziele, eine Information der Kommission und der Mitgliedstaaten zur Lage auf den Agrarmärkten, insbesondere nach der Invasion in der Ukraine, sowie ein Meinungsaustausch zur Gewährleistung der Ernährungssicherheit und Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Nahrungsmittelsysteme.
Vorläufige Tagesordnung (Französisch)
Die Vereinigung für europäische pädiatrische und kongenitale Kardiologie AEPC (Association for European Paediatric and Congenital Cardiology) habe sie über einen drohenden Mangel an Medizinprodukten für pädiatrische Herzinterventionen informiert, schreibt die niederländische EP-Abgeordnete Kathleen van Brempt (S&D) in ihrer parlamentarischen Anfrage an die Kommission. Dieser Mangel soll eine Folge der EU-Medizinprodukteverordnung (MDR) sein. Ob dieses Problem der Kommission bewusst sei und ob sie plane, die MDR zu überarbeiten, fragt van Brempt.
Laut Matthias Gorenflo, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Kardiologie und Angeborene Herzfehler e.V. (DGPK) zeichnet sich der Mangel nicht nur ab, sondern ist schon jetzt real. Firmenvertreter:innen würden in Gesprächen häufig argumentieren, dass die Kosten und der Aufwand für die Rezertifizierung nach der MDR derart hoch seien, dass man Produkte lieber aus dem Portfolio nehme, berichtet Gorenflo, der als Ärztlicher Direktor an der Klinik für Kinderkardiologie und Angeborene Herzfehler am Universitätsklinikum Heidelberg tätig ist.
Das betrifft seinen Angaben zufolge eine ganze Reihe von Produktgruppen, angefangen mit den Biopsiezangen, über sogenannte Herzsets und transseptale Nadeln bis hin zu lebensrettende Medizinprodukten wie Ballonatrioseptostomie-Katheter. Diesen benutzen Kinderkardiolog:innen, um bei schwerstkranken Neugeborenen die Verbindung zwischen rechter und linker Vorkammer aufzureißen. Dies führe zur Vermischung vom roten und blauen Blut und mache Patient:innen überlebensfähig, erklärt Gorenflo.
Derzeit liefert nur noch ein einziger Hersteller einen solchen Ballonatrioseptostomie-Katheter. Andere hätten entsprechende Produkte bereits vom Markt genommen. “Leider ist das verbliebene Produkt vom Handling her etwas ganz anderes als die Produkte, die wir früher vorzugsweise genutzt haben”, berichtet der Kinderkardiologe. Das verkompliziere die Prozedur und mache sie länger. Letztendlich sei es eine Gefahr für die kleinen Patient:innen. “Ich möchte es mir allerdings nicht einmal vorstellen, dass auch der letzte Hersteller zum Schluss kommt, das Produkt vom Markt zu nehmen”, betont er.
Der DGPK-Präsident glaubt, die EU-Kommission habe unterschätzt, welche Folgen die MDR in der Versorgungsrealität haben wird. Das Ziel muss aus seiner Sicht sein, eine bessere Balance zwischen den berechtigten Forderungen nach Patient:innensicherheit und der Praktikabilität in der Umsetzung durch die Hersteller zu finden.
Seit Langem warnen die Medizinproduktehersteller vor Versorgungsengpässen aufgrund der MDR. Sie gilt seit Mai 2021, wobei das Gesetz den Herstellern eine dreijährige Übergangszeit für die Zertifizierung der Bestandsprodukte einräumt. Die MDR sieht zum Schutz der Patient:innen strengere Regeln für die Produktsicherheit und Transparenz vor. Die Industrie klagt über deutlich gestiegene Kosten, Umsetzungsfragen und erhöhten Zertifizierungsaufwand für das Inverkehrbringen ihrer Produkte (Europe.Table berichtete).
Für Bestands- und Nischenprodukte, zu denen auch Medizinprodukte für kardiologische Interventionen bei Babys und Kindern zählen, fordert der Bundesverband Medizintechnologie (BVMed) rasche Lösungen. Das Problem der Nischenprodukte könne man etwa nach dem Vorbild der USA lösen. Dort gilt eine “Orphan Devices”-Regelung für Medizinprodukte, die in geringer Stückzahl und für sehr spezielle Anwendungen hergestellt werden. Mit den “Orphan-Drug”-Bestimmungen gibt es auch in Europa analoge Ausnahmeregelungen im Arzneimittelbereich.
Nicht nur Nischenprodukte aus dem Bestand laufen Gefahr, vom Markt zu verschwinden, warnt die Branche. Auch Forschung und Entwicklung würden ausgebremst, weil die Zulassungsanforderungen hoch seien und es keine Perspektiven gebe, dass sich die Investition in Innovation irgendwann einmal amortisieren werde. Nicht nur Unternehmen entwickeln innovative Produkte. In Operationssälen und aus dem klinischen Alltag heraus entstehen einige Impulse für Neu- oder Weiterentwicklungen.
So auch bei Oliver Muensterer. Als Leiter der Kinderchirurgischen Klinik und Poliklinik im Dr. von Haunerschen Kinderspital am Universitätsklinikum München behandelt er viele Babys und Kleinkinder mit seltenen Krankheiten oder Fehlbildungen. Die dafür notwendigen Medizinprodukte werden nur in geringen Stückzahlen benötigt. “Leider ist der Off-Label-Use bei Kinderchirurgen praktisch unser Modus vivendi. Wir lehnen uns im Sinne unserer Patienten oft ziemlich weit aus dem Fenster”, berichtete der Kinderchirurg bei einer Veranstaltung.
“Ich selbst arbeite daran, wie man ohne eine Operation eine unterbrochene Speiseröhre mit speziellen Magneten zusammenbringen kann”, so Muensterer. “Ich hatte immer die Hoffnung, solche Ideen auf dem EU-Markt umsetzen zu können”. Derzeit sehe es danach aus, dass er die FDA-Zulassung zuerst bekäme. “Das zeigt, wie schwierig es für Leute wie mich ist, solche Ideen, die Kindern wirklich helfen, auch umzusetzen”, bedauert er. Die MDR hat aus seiner Sicht das Potenzial, Kinder zu Verlierern zu machen. Das sei nicht nur ein wirtschaftliches, politisches und medizinisches, sondern auch ein ethisches Problem.
Aus der Sicht der Industrie ist es ein Problem, dass die MDR keinerlei Ausnahmeregelungen für Produkte vorsieht, die für kleine Patient:innenpopulationen bestimmt sind. Nicht einmal als Begriff gibt es Nischenprodukte in der Systematik der Verordnung. Oft wird in Diskussionen auf die Möglichkeit der Sonderzulassung gemäß Artikel 59 MDR verwiesen. Doch dieser Weg ist für Nischenprodukte nicht tragfähig, sind sich Expert:innen einig.
“Der Gesetzgeber hatte dabei gar nicht die Nischenprodukte vor Augen, sondern Ausnahmefälle”, erläutert Heike Wachenhausen, Rechtsanwältin und Honorarprofessorin an der Technischen Hochschule Lübeck. Deshalb gebe es eben eine zeitliche Befristung. Auch muss der Hersteller in jedem einzelnen Mitgliedstaat eine nationale Genehmigung beantragen. Wachenhausen ist eine der Expert:innen, die die baden-württembergische Landesregierung mit der Erarbeitung von Handlungsempfehlungen beauftragt hat, die aufzeigen, wie die Umsetzung der MDR gelingen kann. Die Empfehlungen wurden inzwischen an die EU-Kommission übergeben (Europe.Table berichtete).
Substanzielle Änderungen an der MDR seien eher nicht zu erwarten, sagte Peter Bischoff-Everding, Rechtsreferent im Referat Medizinprodukte, GD Sante, auf einer Veranstaltung. Die Kommission nehme allerdings die Hinweise, die derzeit überwiegend aus Deutschland kämen, ernst. Die Mitglieder der “Medical Devices Coordination Group” (MDCG) hätten bereits Ende 2021 darüber diskutiert und eine Arbeitsgruppe gegründet. Diese soll zunächst eine detaillierte Problemanalyse erstellen. Dazu gehöre auch eine Definition des Begriffs Nischenprodukte.
In einem nächsten Schritt sollen die Ursachen des Problems klar identifiziert werden, um anschließend gegebenenfalls Maßnahmen auszuarbeiten. Bevor mögliche Lösungen entwickelt werden können, müsse geklärt werden, ob es sich um ein vorübergehendes Problem handelt, das mit dem Übergang von den früheren Medizinprodukterichtlinien zur MDR zusammenhängt, oder um ein strukturelles Langzeitproblem, heißt es auch in der Antwort der Kommission auf die parlamentarische Anfrage von van Brempt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt beabsichtige man jedenfalls nicht, die MDR zu überarbeiten.
Wegen hoher Beschaffungskosten für Gas haben die Mitgliedsstaaten Bedenken gegen die Gesetzesinitiative der EU-Kommission zur strategischen Gasspeicherung. Bei einem Treffen der Ratsarbeitsgruppe Energie am Montag beklagten nach Informationen von Europe.Table aus EU-Kreisen einige Länder mit großen Speicherkapazitäten eine unzureichende finanzielle Lastenteilung, wenn sie für Staaten ohne eigene Speicher Gas bevorraten sollen. Zu dieser Gruppe gehören die Niederlande, Österreich, Ungarn und Lettland.
Eine Staatengruppe mit geringer oder gar keiner Speicherkapazität hat wiederum Bedenken gegen die Vorgabe, 15 Prozent des Jahresverbrauchs in Speichern anderer EU-Staaten bevorraten zu müssen. Zu diesen Ländern zählen unter anderem Belgien, Finnland, Spanien und Griechenland.
Österreich rechnete bei dem Treffen eine Belastung von 15 Milliarden Euro vor, wenn seine Gasspeicher wie von der EU vorgesehen zu 90 Prozent gefüllt werden sollten. Die Kosten müsse letztlich der Steuerzahler tragen. Die vorgesehene Lastenteilung sei ungeeignet, weil es nur um die Mitgliedsstaaten gehe, die über keine eigenen Speicher verfügen.
Ein Beamter der Generaldirektion Energie führte bei dem Treffen aus, dass sich die 15 Prozent Speichermenge von Staaten ohne eigene Gasspeicher nur auf den jährlichen Verbrauch geschützter Gaskunden bezögen. Würden diese Mengen in einem Staat mit Speichern gebucht, könne dieser die für andere Länder vorgehaltenen Mengen von seinem vorgeschriebenen Mindestfüllstand abziehen.
EU-Staaten ohne eigene Gasspeicher sind die Inselstaaten Irland, Malta und Zypern. Außerdem zählen dazu Finnland, Litauen, Estland, Luxemburg, Slowenien und Griechenland.
In der gestrigen Sitzung des Industrieausschusses im EU-Parlament beklagte Christian Ehler (EVP), dass entgegen früheren Entwürfen des Kommissionsvorschlags keine Rolle mehr für die Regulierungsagentur ACER beim Speichermonitoring vorgesehen sei. Außerdem mahnte er eine schnellere Zertifizierung von Speicherbetreibern an. In Bezug auf das Gaspaket drängte Ehler darauf, auch beim Aufbau von Wasserstoff-Infrastruktur bereits die Versorgungssicherheit zu berücksichtigen. ber
Die Europäische Kommission werde alles nötige tun, um die europäische Solarindustrie wieder aufzubauen, sagte EU-Energiekommissarin Kadri Simson am Donnerstag. Gleichzeitig arbeite die EU Pläne aus, um die Abhängigkeit von russischem Gas rasch zu verringern. Dies soll unter anderem mit mehr Tempo beim Ausbau der Erneuerbaren Energien geschehen.
Mit einer gezielten Strategie für die Solarenergie sollen die Genehmigungsverfahren, die die Installation von Solaranlagen bisher verzögert haben, beschleunigt werden, mehr Solarstrom-Abnahmeverträge geschlossen und die Produktionskapazitäten für Solaranlagen in Europa aufgebaut werden, erklärte Kadri Simson auf der Konferenz Solar Power Summit in Brüssel. Simson fügte hinzu, dass dies auch Hilfe bei der Finanzierung von Projekten beinhalten würde.
Die EU hat zwischen 2013 und 2018 Antidumping- und Antisubventionskontrollen für Solarpaneele aus China eingeführt, um die europäischen Hersteller vor einer Flut von billigeren Teilen aus dem weltweit führenden Hersteller von Solarprodukten zu schützen. rtr
Der Streit um die Begrenzung von personalisierter Werbung im Rahmen des Digital Services Act geht in die nächste Runde. Beim vierten Trilog bestätigten die Unterhändler von Europaparlament, Rat und Kommission zwar einen vergangene Woche im Rahmen der Verhandlungen um den Digital Markets Act vereinbarten Bann von personalisierter Werbung für Minderjährige und die Nutzung sensibler Daten etwa über religiöse und sexuelle Orientierungen. Wie die konkrete Ausgestaltung aussehen soll, sei aber weiterhin unklar, hieß es in Verhandlungskreisen.
Die Vertreter des Europaparlaments sollen nun einen eigenen Formulierungsvorschlag erarbeiten. Die französische Ratspräsidentschaft hatte zuvor vorgeschlagen, den sehr großen Online-Plattformen zu untersagen, minderjährigen Nutzern auf persönlichen Informationen basierende Werbung zu präsentieren. Dies gilt aber nur unter der Voraussetzung, dass die Unternehmen Kenntnis von der Minderjährigkeit haben, ohne dafür zusätzliche Daten zu erheben.
Vor allem Sozialdemokraten, Grünen und Linken im Europaparlament geht das nicht weit genug. Sie pochen unter anderem darauf, dass das Verbot für alle Plattformen gilt, nicht nur für die ganz großen. Zudem soll eine spezifische Regelung aufgenommen werden, die Minderjährige vor irreführenden Nutzer-Oberflächen schützt, den sogenannten Dark Patterns. Hier seien sich Rat und Parlament einig, hieß es in den Kreisen. Der nächste Trilog soll Ende April stattfinden, der genaue Termin steht noch nicht fest. tho
EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager will die Rechtsgrundlage für ihre Untersuchungen gegen Marktmachtmissbrauch und Kartellabsprachen überarbeiten. Die Verordnung 1/2003 solle in den kommenden Monaten evaluiert werden, kündigte Vestager gestern auf einer Konferenz an. Es gehe darum, durch Konsultation von Stakeholdern zu überprüfen, was an den seit 2004 geltenden Regeln gut funktioniere “und wo es Spielraum für effizientere und wirksamere Verfahren und Durchsetzungsinstrumente gibt, um sicherzustellen, dass die Verordnung 1 wirklich fit für das digitale Zeitalter ist”.
Die Verordnung 1/2013 ist die Grundlage für Verfahren gegen Unternehmen, die ihre Marktmacht missbrauchen. Die EU-Wettbewerbsbehörde ist auf dieser Basis gegen Unternehmen wie Google, Apple, Amazon, Microsoft und Intel vorgegangen und hat Geldbußen teils in Milliardenhöhe verhängt. Die Untersuchungen zogen sich aber häufig über mehrere Jahre hin. Kritiker bemängelten daher, die Strafen könnten den entstandenen Schaden für den Wettbewerb nicht mehr beheben.
Die Regeln ermöglichten es der EU-Wettbewerbsbehörde auch, gegen Kartelle vorzugehen. Vestager sagte, dass die aktualisierten Regeln darauf abzielen würden, sie operationeller und nützlicher für die Unternehmen zu machen. Die verfahrenstechnischen Änderungen betreffen Auskunftsersuchen an Unternehmen, Razzien, mündliche Anhörungen und die Obergrenze von zehn Prozent für Geldbußen, die bei Verstößen verhängt werden können. tho/rtr
Die russische Invasion in der Ukraine konfrontiert die Europäische Union in einer brutalen, nackten Weise mit der Frage, die sie bisher immer erfolgreich unter dem Deckmantel der Handelsbeziehungen umgangen hat: Wie geht sie mit autoritären Staaten um, die nicht zögern, die Werte, die sie predigt, infrage zu stellen? Welche “lessons learned” kann sie daraus ziehen?
Das EU-China-Gipfeltreffen, das heute beginnt, und die Wahlen in Ungarn, die am 3. April stattfinden, rufen diese Frage auf sehr akute Weise auf der EU politische Tagesordnung. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, und der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, tauschen sich nämlich im Namen der EU vormittags mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang und nachmittags mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping per Videokonferenz aus.
Im Vorfeld des Gipfels haben Stimmen aus der EU und Amerika vor Konsequenzen für Peking gewarnt, falls es den Widerstand gegen die russische Aggression behindert. Peking hat sich aber gegen die westlichen Sanktionen gewehrt und geschworen, die Geschäfte mit Russland wie gewohnt weiterlaufen zu lassen. Am Mittwoch reiste der russische Außenminister Sergej Lawrow nach China und traf sich mit seinem Amtskollegen Wang Yi.
Der Krieg in der Ukraine hat die ohnehin schon frostige Beziehung zwischen der EU und China noch frostiger werden lassen: Die Zwangsmaßnahmen Pekings gegen Litauen sollten ursprünglich angesprochen worden, ein Thema, das die EU bei der Welthandelsorganisation gegen China vorgebracht hatte. Litauen hatte alle Diplomaten aus Peking abgezogen, nachdem China wütend auf die Eröffnung der neuen diplomatischen Vertretung Taiwans in Vilnius reagiert hatte.
Eine weitere Frage war auch das umfassende Investitionsabkommen. Das Abkommen wurde zwar im Dezember 2020 von der EU mit China vereinbart, aber “eingefroren”, nachdem Peking im vergangenen Jahr Sanktionen gegen Mitglieder des Europäischen Parlaments verhängt hatte. Schade nur, dass die großen wirtschaftlichen Interessen, die in den letzten Jahrzehnten aufgebaut wurden, Europa von Peking abhängig gemacht haben. Deshalb werden Ursula von der Leyen und Charles Michel gleichzeitig versuchen, Europas starke Wirtschaftsbeziehungen zu China zu erhalten, und ihn auch dazu drängen, sich dem blutigen Krieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin entgegenzustellen. An dieser Stelle möchte man hier viel Glück wünschen.
Was die Wahlen in Ungarn angeht: Brüssel zeigt sich vor weiteren vier Jahren mit Viktor Orbán resigniert. Der seit 2010 an der Macht befindliche Gründer und Vorsitzende der Fidesz, einer Formation, die zur extremen Rechten übergelaufen ist, steht mit seinen 58 Jahren zwar vor voraussichtlich knappen Wahlen: Zum ersten Mal seit zwölf Jahren hat sich fast die gesamte Opposition hinter einem einzigen, Pro-EU-Kandidaten versammelt, um zu versuchen, ihn zu stürzen. Dennoch stehen die Chancen, dass Viktor Orbán wieder gewählt wird, hoch.
Warum sind die Wahlen in Ungarn für Brüssel wichtig? Ähnlich wie mit China geht es hier schließlich um klingende Münze. Denn Viktor Orbán hat bereits in einem Brief an Brüssel gefordert, dass die Gelder aus dem Konjunkturprogramm, die derzeit wegen seiner Verfehlungen in Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit eingefroren sind, an ihn ausgezahlt werden.
Wie Polen spielt es mit der ukrainischen Flüchtlingskrise, um die europäischen Kreise zu bemitleiden. Doch im Gegensatz zu seinen ultrakonservativen polnischen Verbündeten hat Orbán die Türen für ukrainische Flüchtlinge nur scheinbar geöffnet: Die meisten von ihnen bleiben nicht im Land, da es keine echte Willkommenspolitik gibt.
Nun, der Krieg in der Ukraine bietet die Gelegenheit, die Achse zu schwächen, die er mit Polen gebildet hat, um die EU von innen heraus zu verändern. Orbáns prorussischer Tropismus stößt in Warschau auf wachsendes Unbehagen, wo die ultrakonservative Partei Recht und Gerechtigkeit die Ukraine ohne mit der Wimper zu zucken unterstützt.
Die laufenden Anhörungen zu den Verstößen Polens und Ungarns gegen die EU-Werte stehen übrigens auf der Tagesordnung der Sitzung des EU-Parlaments in der kommenden Woche. Die Abgeordneten werden außerdem über die Reaktion der EU auf die russische Invasion in der Ukraine debattieren, den Aktionsplan der Union zur Stärkung ihrer Sicherheits- und Verteidigungspolitik bis 2030, die Schlussfolgerungen des EU-Gipfels vom 24. und 25. März sowie die Ergebnisse des EU-China-Gipfels bewerten.
Darüber hinaus werden die Europaabgeordneten über die vorgeschlagene Aktualisierung der Regeln zur Finanzierung von Energieprojekten, das “Recht auf Wiedergutmachung” und die Situation der Frauen in Afghanistan abstimmen. Soweit das offizielle Programm. Denn in den Fluren der Institution in der Rue Wiertz bleiben die Diskussionen zwischen den EU-Parlamentariern aller Parteien um die Frage der Taxonomie und das von der Europäischen Kommission angenommene Verfahren, das nach Ansicht der Parlamentarier in die Vorrechte des Parlaments eingreift, weiterhin heiß.
“Wir sprechen mit allen demokratischen Parteien”, bestätigt der deutsche Europaabgeordnete Michael Bloss (Bündnis 90/Die Grünen) gegenüber Table.Media. Und er erinnert dabei daran, was auf dem Spiel steht: die Glaubwürdigkeit eines Finanzinstruments, das einer Energiequelle, die den Hintergrund des Krieges in der Ukraine nährt, den grünen Stempel aufdrückt, und die Frage des Verfahrens, das die Europäische Kommission angewandt hat, um ihr Projekt durch einen delegierten Rechtsakt, der Gas und Atomenergie als “grün” einstuft, zu drängen.
Die Kommission hat den Entwurf des delegierten Rechtsakts am 11. März an das Europäische Parlament weitergeleitet. Die EU-Abgeordneten haben bis zum 11. Juli Zeit, ihn abzulehnen, benötigen dafür aber eine absolute Mehrheit von 353 Stimmen. Bloss schätzt die Zahl der Abgeordneten, die bereit sind, sich zu wehren, auf etwa 250. Die Grüne Europa-Fraktion hat bereits offiziell erklärt, dass sie den delegierten Rechtsakt offiziell ablehnen werden.
Und in einem Brief an die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, und die Kommissarin für Finanzdienstleistungen, Mairead McGuinness, vom 15. März argumentierten mehr als 100 Europaabgeordnete aus allen politischen Lagern (darunter auch Bloss), dass die EU-Exekutive, wenn sie wirklich russisches Gas loswerden wolle, Gas aus der Taxonomie streichen müsse. Und sie forderten, den Entwurf des delegierten Rechtsakts in der vorgelegten Form angesichts der aktuellen geopolitischen Lage zurückzuziehen. Es fehlen noch etwa 100 Abgeordnete, um die Situation umzukehren… der Krieg in der Ukraine könnte noch einige Unentschlossene überzeugen.