wir haben mitgezählt: Sie lesen heute die 500. Ausgabe von Europe.Table. Vor gut zwei Jahren, am Morgen des 3. August 2021, haben wir die erste Ausgabe verschickt. Damals war der Empfängerkreis noch überschaubar. Heute erreichen wir Tausende Leserinnen und Leser, darunter viele Entscheider in Brüssel und Berlin. Einen Namen darf ich verraten: Ursula von der Leyen liest uns auch (ebenso wie ihre engsten Mitarbeiter).
In dieser 500. Ausgabe wechseln wir ausnahmsweise die Perspektive: Wir berichten nicht, wie sonst immer, nüchtern-sachlich über die europäische Politik, sondern streng subjektiv aus unserem journalistischen Alltag. Zum Beispiel über EU-Gipfel, deren Nachrichtenwert sich bisweilen auf die Spiegelfechterei mancher Staats- und Regierungschefs für das heimische Publikum beschränkt. Über Marathon-Triloge und die nächtliche Informationsbeschaffung. Über schwer verständliche Namen für europäische Rechtsakte. Oder über Männer in grauen Anzügen und wen diese eigentlich repräsentieren.
Wir hoffen, dieser “Blick in die Werkstatt” bringt Ihnen ein paar interessante neue Einsichten. Und vielleicht haben Sie ja auch Freude an unserer Playlist, in der wir unseren Soundtrack für Europa zusammengestellt haben.
Ich wünsche Ihnen eine vergnügliche Lektüre und noch weitere schöne Sommertage!


Alle paar Wochen wird die Eingangshalle des Justus-Lipsius-Gebäudes in Brüssel zum Newsroom: Hunderte Journalistinnen und Journalisten beugen sich über ihre Laptops, die Kollegen der TV-Stationen schalten live von den Rängen. Zettel an den eigens aufgereihten Tischen verraten die Herkunft: Asahi Shimbun aus Japan ist mit zwei Reportern vertreten. Al Jazeera ist immer dabei, chinesische Agenturen und Sender ebenso. Im Laufe einer Gipfelnacht bringen Reporter immer wieder Kameras auf Stativen in Stellung. Korrespondenten aus der ganzen Welt machen Aufsager in Sprachen, die nicht zu den Amtssprachen der EU zählen.
Die Welt schaut hin, wenn sich die Mächtigen Europas treffen. Nebenan, im neuen Europa-Gebäude, laufen die Staats- und Regierungschefs auf einem ziemlich langen roten Teppich auf die wartenden Mikrofone und Kameras zu. Dort, beim sogenannten Doorstep, platzieren sie ihre Botschaften. Dort sprechen sie vor Beginn der Sitzungen die Sätze, die dann zu Hause in den Hauptnachrichten laufen.
Der Auflauf ist groß, der Nachrichtenwert der Gipfel aber oft überschaubar. Nur: Wie sage ich es als Berichterstatter meinem Publikum (oder meiner Redaktion)? Die meisten von uns spielen das Spiel lieber mit. Wir machen viel Lärm um wenig und stürzen uns dankbar auf jeden Konflikt, mögen einzelne Regierungschefs diesen auch nur vor dem Spiegel austragen, um das heimische Publikum zu beglücken.
Inzwischen reihen sich reguläre, informelle, Sonder- und internationale Gipfel aneinander wie in einer alpinen Bergkette. Dass es da nicht stets harte Beschlüsse zu berichten gibt, liegt eigentlich auf der Hand. Bevor die EU vor einer Krise in die nächste stolperte, waren die Staats- und Regierungschefs nur viermal im Jahr zusammengekommen. Im Februar und März 2022 trafen sie sich hingegen viermal in sechs Wochen. Olaf Scholz und Kollegen mögen sich gerne häufig austauschen, auch ohne Konkretes zu beschließen. Aber der Newswert sinkt doch.
Der zweite Grund hat einen Namen: Charles Michel. Seit der frühere belgische Premier als Ratspräsident einlädt, verlaufen Vorbereitung und Gipfel oft chaotisch. Beim Europäischen Rat Ende Juni wollte Michel die Chefs ursprünglich über die Reform des Stabilitätspaktes diskutieren lassen – dabei hatten sich noch nicht einmal die Finanzminister über die vielen technischen Details gebeugt. Auf dringenden Rat vieler Regierungszentralen hin ließ er davon wieder ab.
Stattdessen setzte Michel die Themen Ukraine, China, Wettbewerbsfähigkeit und Migration auf die Agenda. Selbst die Teilnehmer wussten aber bis zum Vortag nicht, welche Fragen er wann aufrufen wollte. Würde er einzeln über die China-Politik und die Wettbewerbsfähigkeit der EU diskutieren? Oder beide Themen zusammen? Die Debatte hätte dann eine andere Stoßrichtung, die Chefs bräuchten eine entsprechend andere Vorbereitung durch ihre Sherpas.
Vor allem aber ignorierte Michel die Warnungen unter anderem aus Paris und Berlin, die Migrationsdebatte durch den Gipfel wieder anzuheizen. Die Innenminister hatten erst kurz zuvor einen Kompromiss ausgehandelt, den eine Mehrheit unter Schmerzen mittragen konnte. Warum also Salz in die Wunden streuen beim Gipfel, zumal dort die Schlussfolgerungen nur einstimmig angenommen werden können?
Mateusz Morawiecki und Viktor Orbán ließen sich nicht bitten und machten den Gipfel zum Drama. An der Substanz und am Fortgang des Asylpakets änderte das zwar wenig. Die meisten Journalisten aber hatten ihre Story über diesen ansonsten weitgehend ereignislosen Gipfel. The show must go on.

Statistisch betrachtet sind die meisten Menschen frühmorgens am produktivsten. Natürlich gibt es auch chronotypisch nachtaktive Eulen. Doch deren Anzahl hält sich in Grenzen. So würde man also auch davon ausgehen, dass konzentriertes Arbeiten, Konstruktivität und Kompromissfähigkeit früher am Tag wahrscheinlicher sind. Schlafmangel macht bekanntlich schlechte Laune.
Umso verwunderlicher ist die Terminierung vieler Trilog-Verhandlungen. Oftmals wenn EU-Parlament, Kommission und Rat auf eine Einigung über einen Gesetzesentwurf zusteuern, wird die letzte Verhandlungsrunde auf den späten Abend angesetzt. Das Kalkül: Statt den ganzen Tag ergebnislos durchzuverhandeln, werden die Verhandlerinnen und Verhandler durch die fortgeschrittene Uhrzeit unter Druck gesetzt, einen Kompromiss zu finden. Wer will schon die ganze Nacht in einem stickigen Konferenzraum sitzen, schlechten Filterkaffee trinken und mit den politischen Gegnern diskutieren?
Besonders beliebt ist die Kompromissfindung durch Schlafentzug bei kontroversen Themen. Eine Einigung ist möglich, aber bei Weitem nicht leicht. Parlamentarier und Mitgliedstaaten müssen teils schmerzhafte Zugeständnisse machen. Und der Rat, der für die Terminierung verantwortlich ist, glaubt offenbar, dass das nachts am besten funktioniert.
Zwischen 18 und 20 Uhr geht es dann meist los. Die Verhandlungsteams haben über Tag letzte Vorbereitungen getroffen. Die Ratspräsidentschaft stimmt ein letztes Mal mögliche Kompromisslinien mit den Ständigen Vertretungen der Mitgliedstaaten ab, die Parlamentsberichterstatterinnen loten aus, wo sie hart bleiben wollen und wo sie Spielraum sehen. Nach dem Abendessen wird’s dann ernst. Nur noch die Verhandler und ihre Fachreferenten sind im Raum (und das Sekretariat, das die Verhandlungsergebnisse auf Papier bringt). Niemand weiß, wie lange sie hier sitzen werden. Doch es liegt in ihrer Hand.
Das Fit-for-55-Paket hat den Verhandlerinnen besonders viele Nachtsitzungen beschert. Sei es bei den Regeln für die Ladeinfrastruktur (AFIR), beim CO2-Grenzausgleich (CBAM), bei den CO2-Reduktionsvorgaben für die Mitgliedstaaten (Effort Sharing) oder den Regeln für nachhaltige Schiffskraftstoffe (Fuel-EU Maritime), die Einigung kam immer erst frühmorgens.
Und dann war da noch der Jumbo-Trilog, der die Einigung über die Reform des europäischen Emissionshandels (ETS) brachte – und damit auch über wesentliche Teile des CBAM und des Klimasozialfonds. Ein ganzes Wochenende wurde verhandelt. Sonntagnacht um 2 Uhr knallten dann die Sektkorken. Zuvor wurde sogar ein deutscher Staatssekretär aus dem Bett geklingelt, um die Gegenwehr der Bundesregierung zu beenden.
Dass es auch manchmal schnell gehen kann, zeigt der Trilog zum Data Act. War um 23 Uhr noch keine Einigung in Sicht, war kurz vor Mitternacht plötzlich Feierabend – der Deal war fertig und alle konnten ins Bett gehen. Noch schneller waren sie bei den CO₂-Standards für Pkw – besser bekannt als Verbrenner-Aus. Trotz der Kontroverse um das Thema kam die Einigung (die Bundesverkehrsminister Wissing später nochmals infrage stellte) um 20.45 Uhr.
Ganz anders lief es bei der Überarbeitung der Erneuerbaren-Energien-Richtlinie (RED III). Der Trilog endete nach durchverhandelter Nacht erst nach 7 Uhr morgens, was die Journalisten vor ein Problem stellte. Normalerweise hat man als Berichterstatter die Qual der Wahl: Bleibt man abends lange wach und hofft auf ein frühes Ergebnis, um noch vor dem Schlafen gehen das Ergebnis analysieren zu können, oder steht man früh auf und schreibt noch schnell, bevor die meisten Leserinnen und Leser aufstehen? Im Falle der RED wäre beides überflüssig gewesen. Für Europe.Table war das misslich, da der Newsletter bekanntlich um 6 Uhr erscheint. Somit kam das Ergebnis wenige Stunden zu spät.
Auch für Journalisten sind die nächtlichen Triloge herausfordernd. Im besten Fall hat man einen Kontakt in die Verhandlungskreise und bekommt eine Info, sobald die Einigung erzielt ist. Dann muss man nur noch das exakte Verhandlungsergebnis in Erfahrung bringen, um es analysieren zu können. In manchen Fällen ist man jedoch auch auf Tweets oder Pressemitteilungen der Beteiligten angewiesen.
Nicht nur Triloge können gerne mal die ganze Nacht andauern. Auch so manche Ratssitzung zieht sich gelegentlich bis in die frühen Morgenstunden. Der Umweltrat beispielsweise tagte Ende Juni 2022 bis 2 Uhr morgens. Dabei starten Ratssitzungen bereits morgens und sollen idealerweise am Nachmittag enden. Doch weil sich die Mitgliedstaaten lange nicht über das Verbrenner-Aus einig wurden, ging es mehrfach in die Verlängerung. Kompromissentwürfe zirkulierten durch die Räume und Ministerien in den Hauptstädten, Telefonleitungen zwischen Brüssel und Berlin liefen heiß, bis alle am Ende weitgehend glücklich waren.
Da bei Ratstreffen meist auch Pressekonferenzen nach Abschluss vorgesehen sind und Ministerinnen und Minister bei sogenannten Doorsteps Statements abgeben, traten Frans Timmermans, Robert Habeck und Steffi Lemke noch in der Nacht vor die Presse. Die Journalisten hatten ausgeharrt, manche Pizza bestellt oder zu Hause vor der Live-Übertragung gewartet, bis sich etwas regt.
Und all das nur, um Ihnen, werte Leserinnen und Leser, gleich morgens, wenn der Europe.Table ins Postfach flattert, das Wichtigste aus diesen Verhandlungsnächten zu berichten. Bleiben Sie uns weiter treu und wir schlagen uns auch weiterhin die Nächte für Sie um die Ohren.
Was ist eigentlich LULUCF, CBAM, CSAM, KARL und OLAF? Das Erste, was alle lernen müssen, die sich beruflich mit der Europäischen Union (EU) beschäftigen, ist die überwältigende Flut an Namen und Abkürzungen. Die Kommission (KOM) scheint eine wahre Lust an der Erfindung von Namen und der Schaffung von Abkürzungen für ihre Rechtsakte, Programme und Institutionen zu haben.
Eigentlich helfen uns Namen, uns in der Welt zu orientieren. Doch die Bezeichnungen der EU verstehen meist nur Experten. Sie schließen Menschen eher aus oder schrecken sie ab, als sie für die Themen und die Politik zu gewinnen, die sich dahinter verbergen.
Der Green Deal ist eine Ausnahme. Der einprägsame Name ist Programm. “Darunter kann ich mir etwas vorstellen”, erklärt Manfred Gotta. “Der Name eignet sich auch für Schlagzeilen in den Medien. Er setzt sich besser fest als eine Abkürzung.” Namen sind Gottas Beruf. Seit mehr als 40 Jahren entwickelt er sehr erfolgreich Namen für Produkte und Unternehmen und schafft damit Werte. Bei seinen Kreationen Xetra, Megapearls oder Twingo weiß nahezu jeder Mensch in Europa, was gemeint ist.

Abkürzungen, sagt Gotta, funktionierten dagegen nur, wenn Menschen etwas Emotionales damit verbinden. Wenn es zum Beispiel um das hochemotionale Thema Auto geht, können Leute sich merken, dass ABS ein Bremssystem ist. Aber was sollen Menschen mit LULUCF (Landnutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft) anfangen?
Die Abkürzung KI für das heiß diskutierte Thema Künstliche Intelligenz braucht dagegen keine Erklärung mehr. Sogar Menschen, die die Abkürzung GPT (Generative Pre-trained Transformers) nicht erklären können, reden über ChatGPT.
Bei CSAM etwa ist es anders. Hiermit will die EU gegen “Child Sexual Abuse Materials (CSAM)” vorgehen, um Kinder im Internet besser zu schützen. Was könnte emotionaler sein? Dennoch funktioniert die Abkürzung nicht. Andere nennen das Gesetzesvorhaben Chatkontrolle – und da wissen in Deutschland plötzlich alle, worum es geht – und erinnern die Debatte.
CSAM ist also auch ein Bespiel dafür, dass die Kommission mit der Namensgebung, wenn sie nicht absolut neutral ist, bereits Partei ergreift oder eine Richtung vorgibt. CSAM zeigt ebenso, dass Abkürzungen nicht in allen Sprachen funktionieren. Und schließlich zeigt die Abkürzung auch, wie leicht es ist, Rechtsakte zu verwechseln, wenn etwa einer CSAM und der andere CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, deutsch: CO₂-Grenzausgleichssystem) heißt.
Dabei hat CBAM mit dem Bam am Ende wenigstens einen kraftvollen Klang. “Bam, das sagt mein Enkelkind immer, wenn etwas herunterfällt”, hat Gotta beobachtet. “Ich denke da eher an eine Konfliktsituation als an eine Regulierung zur Verringerung von Emissionen.” Neben dem Green Deal fallen alle Beispiele, die die Redaktion an den Experten sandte, durch.
Fit for 55? “Was soll das denn sein”, fragt Gotta. “Ein Gymnastikstudio oder ein Kaugummi?” Er findet, ein Klimaschutzpaket mit dem Ziel, die Netto-Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2030 um mindestens 55 Prozent zu reduzieren, “das verdient einen richtigen Namen”. Einen Namen der nicht missverstanden werden kann oder gar beleidigend ist und der nicht an den Menschen vorbeiziele.
So einen Namen kann er nicht aus dem Ärmel schütteln. Vorher ist eine gründliche Recherche notwendig. “Professionelles Branding”, sagt Gotta, “setzt sich zusammen aus rationalen und nicht rationalen Werten, die durch den Namen national, europäisch oder international identisch repräsentiert werden.”
REACH zum Beispiel, klingt wie ein Name, ist aber eine Akronym (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Die macht insofern weder als Name noch als Abkürzung für eine europäische Regulierung Sinn, da sie im Englischen keine Assoziation zu einer Chemikalienverordnung hervorruft und in anderen Ländern wieder anders verstanden wird.
Auch die Abkürzung KARL für die Überarbeitung der Richtlinie über die Behandlung von kommunalem Abwasser können sich deutsche Muttersprachler zwar merken. “Die ist aber überflüssig”, meint Gotta. Denn für die breite Öffentlichkeit sei sie eh nicht interessant und wenn doch, ist EU-Abwasserrichtlinie immer noch eindeutiger. Zumal die Richtlinie (RL) im Englischen auch nicht KARL sondern UWTTD heißt. Das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (European Anti-Fraud Office) heißt wiederum OLAF. Das ergibt nur im Französischen Sinn: Office Européen De Lutte Antifraude.
Was aber macht nun einen guten Namen aus – abgesehen davon, dass er international funktionieren muss? Warum funktionieren Namen wie Chiquita oder Twingo? “Keiner der Namen teilt über seine Phonetik, Assoziationen oder inhaltliche Elemente mit, aus welchem Bereich er stammt oder welchen Nutzen er verspricht”, erläutert Gotta. Dennoch repräsentierten die Namen unverwechselbar und überall ein ganz bestimmtes Produkt. “Man muss Unikate schaffen“, sagt Gotta.
Wichtig sei, einen Namen als erstes zu besetzen. “Wir lernen von Kindesbeinen an täglich Namen”, sagt der Werbetexter. Und wie bei einer Visitenkarte, könne man dann unter den Namen seine Funktion in vielen Sprachen übersetzen. “Dann verbinden die Menschen europaweit das Gleiche mit diesem Namen.” Etwa, dass Tabasco eine scharfe Chilisoße ist.
Und schließlich: “Nur die Gesetze, die für die Menschen wirklich wichtig sind, sollten einen Namen bekommen”, rät Gotta der Kommission. “Klangvolle Namen kann man sich besonders gut merken.” Darauf einen Dujardin.
09.08.2023 – 14:00-15:00 Uhr, online
ASEW, Roundtable Erfahrungsaustausch: eQuota
Die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) bietet betroffenen und interessierten Stadtwerken eine Plattform, um sich über das Insolvenzverfahren des THG-Quotenvermittlers eQuota auszutauschen. INFOS & ANMELDUNG
09.08.2023 – 18:00-19:00 Uhr, online
FNF, Podiumsdiskussion Das Aus für das Getreideabkommen? Über die Tragweite und Auswirkungen für die Welt
Die Friedrich-Naumann-Stiftung (FNF) diskutiert mit dem Bundestagsabgeordneten Ulrich Lechte (FDP) und der Wissenschaftlerin Dr. Bettina Rudloff über die Bedeutung des Getreideabkommens zwischen Russland und der Ukraine und die Folgen einer Nichtverlängerung. INFOS & ANMELDUNG
09.08.2023 – 19:00-21:30 Uhr, Düsseldorf
KAS, Roundtable Digitalisierung in der Landesverwaltung Nordrhein-Westfalens
Die Ministerin des Landes Nordrhein-Westfalen Ina Scharrenbach tauscht sich mit der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) über die drängendsten Fragen moderner Verwaltung im steten Spannungsfeld von Bürokratieabbau, Prozessverschlankung und Effizienzgewinnen aus. INFOS & ANMELDUNG
10.08.2023 – 09:00-15:45 Uhr, online
BMI, Seminar Nachhaltige öffentliche Beschaffung
Das Beschaffungsamt des Bundesinnenministeriums (BMI) bietet eine Schulung für Behörden und Einrichtung auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene zu den Grundlagen, rechtlichen Rahmenbedingungen und der Umsetzung von nachhaltiger Beschaffung. INFOS & ANMELDUNG
10.08.2023- 10:00-12:00 Uhr, online
ASEW, Roundtable Erfahrungsaustausch Mini/Balkon-PV
Die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) beleuchtet das Geschäftsmodell von Stecker-Solar-Geräten (Mini-PV) aus Perspektive der Stadtwerke. INFOS & ANMELDUNG
10.08.2023 – 17:00-19:00 Uhr, Donaueschingen
FNF, Seminar Städtebau mal ländlich – Ökologie und Moderne gekonnt verbinden
Im Rahmen einer Stadtführung der Friedrich-Naumann-Stiftung (FNF) soll am Beispiel der Stadt Donaueschingen aufgezeigt werden, wie der Spagat zwischen der Entwicklung eines Konversionsgeländes der Bundeswehr, der Attraktivität eines Tourismus-Hotspots und ökologischen Gesichtspunkten der Donau-Renaturierung gelingen kann. INFOS & ANMELDUNG
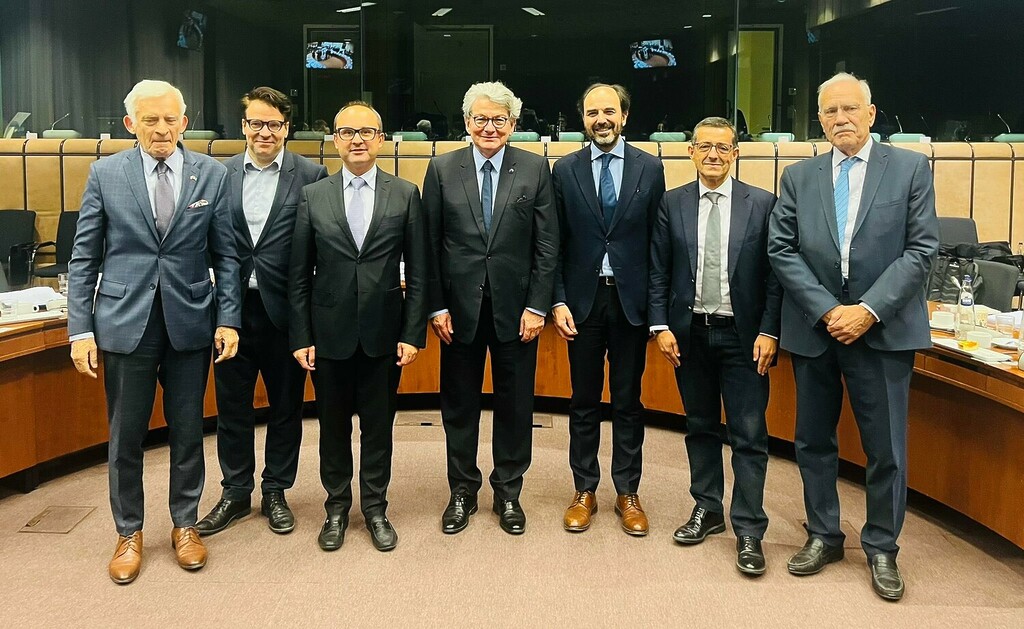
Als ich anfing, für Table.Media über EU-Politik zu schreiben, war ich überrascht. Im Jahr 2022 – Gruppenfotos von Männern in Führungspositionen ernteten längst gewaltige Shitstorms – besuchte ich Veranstaltungen und Podiumsdiskussionen, bei denen ausschließlich Männer auf der Bühne sprachen. Einziges Unterscheidungsmerkmal: ihre verschiedenfarbigen Krawatten.
“Naja, bei den Themen ist das wohl so…”, dachte ich. Rohstoffe, Kreislaufwirtschaft – in der Industrie gibt es einfach nicht so viele Frauen, über die man berichten könnte. Doch weshalb erscheint mir das selbstverständlich? In einer Welt, die sich in allen Lebensbereichen in einem rasanten Wandel befindet, scheinen die Uhren im Spektrum politischer und wirtschaftlicher Kontexte deutlich langsamer zu ticken.
Diesem Eindruck folgend fragte ich bei meinen Kolleginnen und Kollegen nach. Die Mehrheit unserer Redaktionsmitglieder sieht die Perspektiven von Männern tatsächlich häufiger im Europe.Table berücksichtigt als die von Frauen.
Ein Gefühl, das auch der Bilanz entspricht: Zwei Drittel der bisher im Europe.Table porträtierten Personen sind männlich. Vorgestellt werden in dieser Rubrik Menschen, deren Funktion und deren Schaffen für unsere Leserinnen und Leser von Interesse sind. Gewiss könnten darunter mehr Frauen sein.
Dieses Bild spiegelt einen globalen Trend wider: Frauen sind deutlich weniger in den Medien präsent als Männer. Das Global Media Monitoring Project analysiert unter dem Titel “Who makes the News?” regelmäßig Nachrichten aus Print, Radio, Fernsehen, Internet und Twitter. Die jüngste Auswertung der Berichterstattung in Europa aus dem Jahr 2020 ergab: Nur 28 Prozent der zitierten Quellen in klassischen und digitalen Medien waren Frauen. Dabei dienten Frauen am häufigsten als Quellen in Beiträgen über geschlechtsbezogene Themen. Am wenigsten wahrscheinlich waren Zitate von Frauen in Berichten über Politik und Regierungen (22 Prozent). Am ehesten dienten sie dem Zweck, Augenzeugenberichte oder die öffentliche Meinung zu liefern, anstatt als Expertinnen aufzutreten.
Im EU-Kosmos, dem Fokus unserer Berichterstattung, hat sich in den vergangenen Jahren vordergründig einiges gewandelt: Mit Ursula von der Leyen hat erstmals eine Frau den mächtigsten EU-Posten an der Spitze der Kommission inne. Die Kommission selbst ist erstmals paritätisch mit Frauen und Männern besetzt, darunter auch eine Gleichstellungskommissarin, die Malteserin Helena Dalli. Und auch an der Spitze des EU-Parlaments steht mit Roberta Metsola zum ersten Mal eine Frau.
Doch die Zahlen, die sich hinter der Strahlkraft dieser öffentlich sichtbaren Figuren verbergen, sprechen eine andere Sprache: In den EU-Institutionen dominieren weiterhin Männer in Führungspositionen. Im EU-Parlament steht das Geschlechterverhältnis bei 60 zu 40 Prozent.
In den größten Unternehmen innerhalb der EU ist nur ein Drittel der Führungspositionen mit Frauen besetzt. Auch wenn in den meisten Vorständen mittlerweile mindestens eine Frau sitzt, so wird nicht einmal jeder zehnte Vorstand von einer Frau geleitet. In gewisser Weise erscheint es logisch, dass sich dies in der medialen Aufbereitung widerspiegelt.
Was also können wir tun, um unsere Berichterstattung ausgewogener zu gestalten? Natürlich haben wir keinen Einfluss darauf, welche Person ein bestimmtes Amt bekleidet. EU-Kommissare, Europaabgeordnete, Staats- und Regierungschefs, Vorstandsvorsitzende – sie alle sind in ihre Positionen gewählte oder ernannte Mandatsträger, deren Rolle auch aus journalistischer Perspektive durch ihre Qualifikation und nicht durch ihr Geschlecht legitimiert sein sollte.
Im Angesicht des Paritätsanspruchs stellt sich jedoch die Frage, ob die immer noch vorherrschende Mehrheit männlich besetzter Posten auch auf einer tradierten Eignungsbeurteilung basiert, die Männern in bestimmten Themenfeldern per se eine höhere Kompetenz zuweist. Das scheint zudem auch eine für Männer und Frauen unterschiedlich geprägte Berichterstattung zu befördern.
Wenn Politikerinnen es in die Schlagzeilen schaffen, dann oft begleitet von Sexismus und Stereotypen. Die ehemalige finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin etwa ist vor allem durch ihr Tanzvideo interessant für die Medien geworden. Bei einem Treffen Marins mit der damaligen neuseeländischen Premierministerin Jacinda Ardern im vergangenen Jahr fragte ein Journalist während der Pressekonferenz: “Trefft ihr euch einfach, weil ihr euch vom Alter her ähnlich seid und deshalb gemeinsame Interessen habt?”
Journalistinnen und Journalisten sollten sich also auch fragen, ob sie über weibliche Protagonistinnen anders berichten als über männliche. Die Internationale Journalisten-Föderation (IFJ) hat kürzlich ein Toolkit veröffentlicht, um für ebensolche Probleme zu sensibilisieren und eine geschlechtergerechtere Politikberichterstattung zu fördern. “Die Nachrichtenmedien haben noch einen weiten Weg vor sich, um Cis- und Transgender-Frauen in der Führungsetage in einer angemessenen Weise darzustellen, und jede einzelne Anstrengung zählt“, heißt es darin.
Auch in der Auswahl der Expertinnen und Experten für Zitate, Porträts und Interviews haben Journalistinnen und Redakteure die Möglichkeit, auf mehr Ausgewogenheit zu achten. Dafür gibt es Unterstützung: Die LMU München vermittelt über die Datenbank FemConsult etwa Wissenschaftlerinnen in Führungspositionen. In der Datenbank AcademiaNet von der Robert Bosch Stiftung und Spektrum der Wissenschaft sind Tausende Spitzenforscherinnen aus diversen Fachgebieten gelistet.
Geschlechterparität hat eben nicht nur eine numerische Dimension, wie das European Institute for Gender Equality schreibt, sondern auch eine substanzielle: Sie bezieht sich auf den gleichberechtigten Beitrag von Frauen und Männern zu jeder Lebensdimension, privat und öffentlich.
“There is a gender angle to every story”, jede Geschichte hat eine Gender-Dimension, schreibt das Global Media Monitoring Project. Auch die großen, aktuellen Themen: Klimapolitik, Rohstoffversorgung, Sorgfaltspflichten, Digitalisierung. Das UN-Entwicklungsprogramm berichtet etwa: “Durch die Auswirkungen des Klimawandels werden strukturelle Ungleichheiten, etwa die zwischen Frauen und Männern, fortgeschrieben und verstärkt”.
Journalistinnen und Redakteure entscheiden, wessen Perspektiven sie in ihren Beiträgen darstellen, welchen Themen und Menschen sie auf die öffentliche Bühne helfen. Diese “Gatekeeper”-Funktion sowie journalistische Qualitätsstandards fordern auch zu einer Ausgewogenheit männlicher, weiblicher, diverserer Perspektiven auf. Dazu gehört auch eine Verantwortung auf individueller Ebene. Für alle Schreibenden. Und auch für mich.

Es gibt niemanden, der die Ereignisse in der direkt gewählten Volksvertretung der EU-Bürger von den Anfängen bis heute so aufmerksam verfolgt hat wie Bernd Posselt. Er war dabei, als das erste direkt gewählte EU-Parlament am 17.7.1979 in Straßburg zusammengekommen ist. Damals war er 23 Jahre alt und Assistent von Otto von Habsburg, dem langjährigen Europaabgeordneten für die CSU und Sohn des letzten österreichisch-ungarischen Kaisers. Posselt zog selbst 1994 für die CSU ins Europaparlament ein und engagierte sich im Auswärtigen Ausschuss und bei sicherheitspolitischen Themen.
Er gehörte dem Haus 20 Jahre lang als Parlamentarier an. Seitdem er 2014 den Wiedereinzug verpasste, ist er der erste auf der Nachrückerliste der CSU. Vermutlich wird der 68-Jährige, der in Pforzheim geboren wurde und gelernter Journalist ist, auf der Europaliste der CSU im Herbst auch wieder auf dem siebten Platz landen. Mutmaßlich ist das wiederum der erste Nachrückerplatz.
Posselt musste zwar vor bald zehn Jahren seinen Zugangsausweis als Mitglied des Europäischen Parlaments (MEP) abgeben. Doch er war seitdem weiterhin präsent – vor allem in den Straßburger Sitzungswochen. Als Ex-MEP hat er weiter Zutritt zum Hohen Haus. Doch anders als andere Ex-MEPs hat er diesen Zutritt nicht etwa genutzt, um als Lobbyist auf seine ehemaligen Kollegen einzuwirken, sondern weiterhin für politische Arbeit. Posselt berät EVP-Fraktionschef Manfred Weber in der Außenpolitik, schreibt Bücher und beobachtet die Europapolitik. Er ist seit 1998 Chef der überparteilichen Paneuropa Union, deren Ursprünge in die 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts zurückreichen.
Irgendwie hat Posselt nicht aufgehört, Abgeordneter zu sein. Er ist in Straßburg anwesend, präsenter als mancher Abgeordnete, der ein Mandat der Wähler bekommen hat. Er darf nicht abstimmen und sitzt auch nicht unten im Plenum. Aber er ist dabei und dürfte abgesehen von Krankheit seit Juli 1979 so gut wie keine Sitzungswoche in Straßburg verpasst haben. Damals als Posselt den Sitz im Parlament verlor und trotzdem immer noch nach Straßburg fuhr, erschienen darüber Artikel, die spöttische Züge trugen.
“Ich habe das alles gelesen”, berichtet Posselt. Er hält an seiner Mission aber fest, weil er – in seinem Fall ist der Ausdruck wohl treffend – beseelt ist von der europäischen Idee wie kaum ein anderer Politiker. Als 20-Jähriger ist er der CSU beigetreten. Anlass war die Rede von Franz-Josef Strauß mit dem Titel “Europa kann nicht länger warten”. Posselt sagt: “Millionen von Menschen setzen sich ehrenamtlich für Europa ein, warum sollte ich es nicht auch tun?”
Posselt war Assistent, dann wurde er Abgeordneter, inzwischen ist seine Rolle am besten mit Chronist des Europaparlaments an dessen Hauptsitz in Straßburg beschrieben. Es gibt niemanden, der kenntnisreicher über seine Geschichte erzählen kann. Er hat die Rede von Louise Weiss parat, die die Politikerin, Journalistin und Feministin als Alterspräsidentin bei der ersten Sitzung gehalten hat: “Sie hat gefordert, dass wir nicht nur europäische Traktorsitze brauchen, sondern europäische Menschen.”
Posselts Eltern kamen aus dem Sudetenland und der Steiermark. Er hat sich früh für Ost- und Mitteleuropa interessiert und kann stolz darauf sein, dass Putin ihn wegen seines Einsatzes für die Menschenrechte bereits 2015 mit einem Einreiseverbot für Russland belegt hat.
Er ist ein Kenner der Architektur und Baugeschichte der Volksvertretung. So kann er davon berichten, wie am Brüsseler Sitz des Parlaments die Ausschüsse teils in gemieteten Räumlichkeiten tagten. Er beschreibt lebendig die Symbolik, die das legendäre internationale Büro “architecturestudio” im Straßburger Parlamentsgebäude verewigt hat.
Der Bau, der 1999 nach der Wahl bezogen wurde und seinerzeit 275 Millionen Euro kostete, stehe sehr bewusst an dem Ort, wo die elsässische Ill auf den Kanal trifft, der die Marne mit dem Rhein verbindet. “Auf dem Wasserweg sind von hier drei Meere erreichbar”, weiß Posselt. Das viele Glas stehe für die Transparenz der europäischen Demokratie. Der Plenarsaal sei wie ein Amphitheater konstruiert. An etlichen Stellen habe der Besucher Blickkontakt zum Straßburger Münster.
Posselt erzählt auch vom 1. Mai 2004 und der ersten EU-Osterweiterung. Damals kam der ehemalige Solidarność-Führer und spätere Präsident Polens, Lech Wałęsa, für den Festakt nach Straßburg. “Am Haupteingang des Parlaments wurde ein Mast für die polnische Flagge errichtet, der auf der früheren Lenin-Werft in Danzig gefertigt wurde.” Besucher des Parlaments finden bis heute das Symbol der ehemals verbotenen Gewerkschaft, deren Widerstand den Zusammenbruch des Kommunismus eingeleitet hat, auf dem Masten.
Posselt teilt sein Wissen gern. Obwohl er zu den wenigen Menschen gehört, die bis heute kein Mobilfunktelefon benutzen, ist er erstaunlich gut erreichbar. Warum er kein Handy hat? “Ich will kreativ arbeiten, da würde es mich nur stören.” Markus Grabitz

Europa ist mehr als die EU. Viel mehr. Für uns ist Europa auch ein Lebensgefühl. Und wie könnten wir das schöner und gefühlvoller ausdrücken als mit Musik? Darum haben Mitglieder der Europe.Table-Redaktion anlässlich unserer 500. Ausgabe eine Playlist zusammengestellt, mit unserem Soundtrack für Europa.
Wir beginnen, wie könnte es anders sein, mit der “Ode an die Freude“. Dabei haben wir uns für eine Einspielung des London Symphony Orchestra entschieden. Schade, dass die Briten nun keine Freude mehr haben. Ein Kollege gestand sogar, dass ihm gelegentlich die Tränen kommen, wenn er die Europa-Hymne hört. Wer, wird nicht verraten.
Dann haben wir einige Titel unserer Playlist nach ihrem Namen ausgewählt, so wie das zum Beispiel Binnenmarktkommissar Thierry Breton für den Raw Materials Act gemacht hat. Breton ist offenbar überzeugt, europäische Gesetze mit musikalischer Begleitung besser vermitteln zu können. Er hat bereits für verschiedene Rechtsakte Playlisten erstellt. Das hat Leonie Düngefeld inspiriert, Songs auszuwählen mit den folgenden Worten im Titel:
Auch Spanien, das gerade die Ratspräsidentschaft innehat, hat zu Beginn der Amtszeit eine Playlist erstellt, die wir hörenswert finden.
Die übrigen Titel haben wir nach persönlichen Kriterien ausgewählt. Clara Baldus fiel zu Europa und Musik zuerst der Eurovision Song Contest ein. So kommt Loreen mit Euphoria auf unsere Playlist.
Lukas Scheid reist gern durch Europa und über die Musik bekommt er noch einmal einen anderen Zugang zu seinen Reisedestinationen. So hat er Vajze e bukur nga kurbeti von Bledar Alushaj beim Trampen durch Albanien in einem Auto auf Dauerschleife hören müssen. Da Albanien Beitrittskandidat ist, mag der Song als musikalische Kostprobe dienen.
Nordmazedonien bewirbt sich ebenfalls. Bei Stakleni Noze von Funk Shui saß Lukas Scheid im Mavrovo-Nationalpark mit jungen Mazedoniern beim Bier. Sie haben sich gegenseitig ihre Lieblingslieder in Landessprache vorgespielt. Auch Norwegen, die Niederlande, die Schweiz und Schweden haben ihre musikalischen Spuren in seiner persönlichen Playlist hinterlassen. Europe Is Lost von Kae Tempest ist der Rap, den er hörte, als er während des Brexits in UK lebte.
Geradezu paneuropäisch ist der Hintergrund des Norwegers Erlend Øye, der im heimischen Bergen die Band Kings of Convenience gründete, bevor er in Berlin seine zweite Band, Whitest Boy Alive, startete. Mittlerweile ist er nach Sizilien emigriert, wo er sich auf seine Solo-Karriere fokussiert und gemeinsam mit den Sizilianern von La Comitiva Gitarrenpop macht. In diesem Song La Prima Estate geht es um die Freiheit des ersten Sommers nach der Maturità, dem italienischen Abitur. Eine Empfehlung von Leonard Schulz.
Als er in Istanbul lebte, hörte er oft, wie Musiker Rembetiko, den “griechischen Blues” spielten. Die Compilation Songs of Smyrna (dem heutigen Izmir) mit Songs wie Baxe Tsifliki erinnern Leonard Schulz daran, wie eng die Länder kulturell verknüpft sind. Und die Brass-Band Fanfare Ciocărlia aus Rumänien – hier vertreten mit Iag Bari – hat er während des Balkan-Musik-Booms in den 00er-Jahren in Berlin oft gehört.
Denkt Markus Grabitz musikalisch an Europa, fällt ihm das Lied Göttingen der französischen Chansonnière Barbara ein. Es entstand nach einem Konzert, das sie Anfang der 1960er in der ihr bis dahin unbekannten Stadt gegeben hatte und bei dem sie in Kontakt kam mit den Deutschen. Es wurde später zur Hymne der Aussöhnung zwischen den ehemaligen Erbfeinden. Sie singt: “Lasst diese Zeit nie wiederkehren, und nie mehr Hass die Welt zerstören, es wohnen Menschen, die ich liebe, in Göttingen, in Göttingen …” Kanzler Gerhard Schröder hat eine Passage des Liedtextes eingebaut in seine Rede zum 40. Jubiläum der Élysée-Verträge und dafür viel Applaus bekommen. Niemand hat vor oder nach Barbara Göttingen je so charmant ausgesprochen.
Der flämische Rocker und Singersongwriter Arno Hintjens singt in Putain als Refrain: “Putain, putain, c’est vachement bien, nous sommes quand même tous des Européens”. In der deutschen Übersetzung heißt das so viel wie: “Kraftausdruck, Kraftausdruck, es stimmt, wir sind trotz allem alle Europäer.” Er schrieb das Lied von 2003 später um, um gegen den beschlossenen, aber noch nicht vollzogenen Brexit zu protestieren, seitdem hat es auch die Verse: “Bye-bye Brexit, bye-bye Brexit, We’re still gonna eat fish & chips all.”
Auch für Corinna Visser gehören die Freiheit und das grenzenlose Reisen zu den wichtigsten Errungenschaften und den Stärken Europas. Denn sie hat in anderen Teilen der Erde erlebt, was Grenzen anrichten können. Darum wird es gegen Ende der Europe.Table-Playlist noch einmal kitschig mit Wind of Change von den Scorpions, etwas schräg mit Brennerautobahn von Roy Bianco & Die Abbruzanti Boys und kulinarisch mit Carbonara von Spliff.
Dann noch ein Blick zu den Nachbarn: Bei den Spaniern hoch im Kurs steht aktuell der Rapper Quevedo mit Columbia. Die Franzosen stehen auf C’est carré le S von Naps. Italien hört Alfa mit bellissimissima <3. Zum Schluss: Freedom von George Michael. Viel Vergnügen beim Hören. Die Redaktion
wir haben mitgezählt: Sie lesen heute die 500. Ausgabe von Europe.Table. Vor gut zwei Jahren, am Morgen des 3. August 2021, haben wir die erste Ausgabe verschickt. Damals war der Empfängerkreis noch überschaubar. Heute erreichen wir Tausende Leserinnen und Leser, darunter viele Entscheider in Brüssel und Berlin. Einen Namen darf ich verraten: Ursula von der Leyen liest uns auch (ebenso wie ihre engsten Mitarbeiter).
In dieser 500. Ausgabe wechseln wir ausnahmsweise die Perspektive: Wir berichten nicht, wie sonst immer, nüchtern-sachlich über die europäische Politik, sondern streng subjektiv aus unserem journalistischen Alltag. Zum Beispiel über EU-Gipfel, deren Nachrichtenwert sich bisweilen auf die Spiegelfechterei mancher Staats- und Regierungschefs für das heimische Publikum beschränkt. Über Marathon-Triloge und die nächtliche Informationsbeschaffung. Über schwer verständliche Namen für europäische Rechtsakte. Oder über Männer in grauen Anzügen und wen diese eigentlich repräsentieren.
Wir hoffen, dieser “Blick in die Werkstatt” bringt Ihnen ein paar interessante neue Einsichten. Und vielleicht haben Sie ja auch Freude an unserer Playlist, in der wir unseren Soundtrack für Europa zusammengestellt haben.
Ich wünsche Ihnen eine vergnügliche Lektüre und noch weitere schöne Sommertage!


Alle paar Wochen wird die Eingangshalle des Justus-Lipsius-Gebäudes in Brüssel zum Newsroom: Hunderte Journalistinnen und Journalisten beugen sich über ihre Laptops, die Kollegen der TV-Stationen schalten live von den Rängen. Zettel an den eigens aufgereihten Tischen verraten die Herkunft: Asahi Shimbun aus Japan ist mit zwei Reportern vertreten. Al Jazeera ist immer dabei, chinesische Agenturen und Sender ebenso. Im Laufe einer Gipfelnacht bringen Reporter immer wieder Kameras auf Stativen in Stellung. Korrespondenten aus der ganzen Welt machen Aufsager in Sprachen, die nicht zu den Amtssprachen der EU zählen.
Die Welt schaut hin, wenn sich die Mächtigen Europas treffen. Nebenan, im neuen Europa-Gebäude, laufen die Staats- und Regierungschefs auf einem ziemlich langen roten Teppich auf die wartenden Mikrofone und Kameras zu. Dort, beim sogenannten Doorstep, platzieren sie ihre Botschaften. Dort sprechen sie vor Beginn der Sitzungen die Sätze, die dann zu Hause in den Hauptnachrichten laufen.
Der Auflauf ist groß, der Nachrichtenwert der Gipfel aber oft überschaubar. Nur: Wie sage ich es als Berichterstatter meinem Publikum (oder meiner Redaktion)? Die meisten von uns spielen das Spiel lieber mit. Wir machen viel Lärm um wenig und stürzen uns dankbar auf jeden Konflikt, mögen einzelne Regierungschefs diesen auch nur vor dem Spiegel austragen, um das heimische Publikum zu beglücken.
Inzwischen reihen sich reguläre, informelle, Sonder- und internationale Gipfel aneinander wie in einer alpinen Bergkette. Dass es da nicht stets harte Beschlüsse zu berichten gibt, liegt eigentlich auf der Hand. Bevor die EU vor einer Krise in die nächste stolperte, waren die Staats- und Regierungschefs nur viermal im Jahr zusammengekommen. Im Februar und März 2022 trafen sie sich hingegen viermal in sechs Wochen. Olaf Scholz und Kollegen mögen sich gerne häufig austauschen, auch ohne Konkretes zu beschließen. Aber der Newswert sinkt doch.
Der zweite Grund hat einen Namen: Charles Michel. Seit der frühere belgische Premier als Ratspräsident einlädt, verlaufen Vorbereitung und Gipfel oft chaotisch. Beim Europäischen Rat Ende Juni wollte Michel die Chefs ursprünglich über die Reform des Stabilitätspaktes diskutieren lassen – dabei hatten sich noch nicht einmal die Finanzminister über die vielen technischen Details gebeugt. Auf dringenden Rat vieler Regierungszentralen hin ließ er davon wieder ab.
Stattdessen setzte Michel die Themen Ukraine, China, Wettbewerbsfähigkeit und Migration auf die Agenda. Selbst die Teilnehmer wussten aber bis zum Vortag nicht, welche Fragen er wann aufrufen wollte. Würde er einzeln über die China-Politik und die Wettbewerbsfähigkeit der EU diskutieren? Oder beide Themen zusammen? Die Debatte hätte dann eine andere Stoßrichtung, die Chefs bräuchten eine entsprechend andere Vorbereitung durch ihre Sherpas.
Vor allem aber ignorierte Michel die Warnungen unter anderem aus Paris und Berlin, die Migrationsdebatte durch den Gipfel wieder anzuheizen. Die Innenminister hatten erst kurz zuvor einen Kompromiss ausgehandelt, den eine Mehrheit unter Schmerzen mittragen konnte. Warum also Salz in die Wunden streuen beim Gipfel, zumal dort die Schlussfolgerungen nur einstimmig angenommen werden können?
Mateusz Morawiecki und Viktor Orbán ließen sich nicht bitten und machten den Gipfel zum Drama. An der Substanz und am Fortgang des Asylpakets änderte das zwar wenig. Die meisten Journalisten aber hatten ihre Story über diesen ansonsten weitgehend ereignislosen Gipfel. The show must go on.

Statistisch betrachtet sind die meisten Menschen frühmorgens am produktivsten. Natürlich gibt es auch chronotypisch nachtaktive Eulen. Doch deren Anzahl hält sich in Grenzen. So würde man also auch davon ausgehen, dass konzentriertes Arbeiten, Konstruktivität und Kompromissfähigkeit früher am Tag wahrscheinlicher sind. Schlafmangel macht bekanntlich schlechte Laune.
Umso verwunderlicher ist die Terminierung vieler Trilog-Verhandlungen. Oftmals wenn EU-Parlament, Kommission und Rat auf eine Einigung über einen Gesetzesentwurf zusteuern, wird die letzte Verhandlungsrunde auf den späten Abend angesetzt. Das Kalkül: Statt den ganzen Tag ergebnislos durchzuverhandeln, werden die Verhandlerinnen und Verhandler durch die fortgeschrittene Uhrzeit unter Druck gesetzt, einen Kompromiss zu finden. Wer will schon die ganze Nacht in einem stickigen Konferenzraum sitzen, schlechten Filterkaffee trinken und mit den politischen Gegnern diskutieren?
Besonders beliebt ist die Kompromissfindung durch Schlafentzug bei kontroversen Themen. Eine Einigung ist möglich, aber bei Weitem nicht leicht. Parlamentarier und Mitgliedstaaten müssen teils schmerzhafte Zugeständnisse machen. Und der Rat, der für die Terminierung verantwortlich ist, glaubt offenbar, dass das nachts am besten funktioniert.
Zwischen 18 und 20 Uhr geht es dann meist los. Die Verhandlungsteams haben über Tag letzte Vorbereitungen getroffen. Die Ratspräsidentschaft stimmt ein letztes Mal mögliche Kompromisslinien mit den Ständigen Vertretungen der Mitgliedstaaten ab, die Parlamentsberichterstatterinnen loten aus, wo sie hart bleiben wollen und wo sie Spielraum sehen. Nach dem Abendessen wird’s dann ernst. Nur noch die Verhandler und ihre Fachreferenten sind im Raum (und das Sekretariat, das die Verhandlungsergebnisse auf Papier bringt). Niemand weiß, wie lange sie hier sitzen werden. Doch es liegt in ihrer Hand.
Das Fit-for-55-Paket hat den Verhandlerinnen besonders viele Nachtsitzungen beschert. Sei es bei den Regeln für die Ladeinfrastruktur (AFIR), beim CO2-Grenzausgleich (CBAM), bei den CO2-Reduktionsvorgaben für die Mitgliedstaaten (Effort Sharing) oder den Regeln für nachhaltige Schiffskraftstoffe (Fuel-EU Maritime), die Einigung kam immer erst frühmorgens.
Und dann war da noch der Jumbo-Trilog, der die Einigung über die Reform des europäischen Emissionshandels (ETS) brachte – und damit auch über wesentliche Teile des CBAM und des Klimasozialfonds. Ein ganzes Wochenende wurde verhandelt. Sonntagnacht um 2 Uhr knallten dann die Sektkorken. Zuvor wurde sogar ein deutscher Staatssekretär aus dem Bett geklingelt, um die Gegenwehr der Bundesregierung zu beenden.
Dass es auch manchmal schnell gehen kann, zeigt der Trilog zum Data Act. War um 23 Uhr noch keine Einigung in Sicht, war kurz vor Mitternacht plötzlich Feierabend – der Deal war fertig und alle konnten ins Bett gehen. Noch schneller waren sie bei den CO₂-Standards für Pkw – besser bekannt als Verbrenner-Aus. Trotz der Kontroverse um das Thema kam die Einigung (die Bundesverkehrsminister Wissing später nochmals infrage stellte) um 20.45 Uhr.
Ganz anders lief es bei der Überarbeitung der Erneuerbaren-Energien-Richtlinie (RED III). Der Trilog endete nach durchverhandelter Nacht erst nach 7 Uhr morgens, was die Journalisten vor ein Problem stellte. Normalerweise hat man als Berichterstatter die Qual der Wahl: Bleibt man abends lange wach und hofft auf ein frühes Ergebnis, um noch vor dem Schlafen gehen das Ergebnis analysieren zu können, oder steht man früh auf und schreibt noch schnell, bevor die meisten Leserinnen und Leser aufstehen? Im Falle der RED wäre beides überflüssig gewesen. Für Europe.Table war das misslich, da der Newsletter bekanntlich um 6 Uhr erscheint. Somit kam das Ergebnis wenige Stunden zu spät.
Auch für Journalisten sind die nächtlichen Triloge herausfordernd. Im besten Fall hat man einen Kontakt in die Verhandlungskreise und bekommt eine Info, sobald die Einigung erzielt ist. Dann muss man nur noch das exakte Verhandlungsergebnis in Erfahrung bringen, um es analysieren zu können. In manchen Fällen ist man jedoch auch auf Tweets oder Pressemitteilungen der Beteiligten angewiesen.
Nicht nur Triloge können gerne mal die ganze Nacht andauern. Auch so manche Ratssitzung zieht sich gelegentlich bis in die frühen Morgenstunden. Der Umweltrat beispielsweise tagte Ende Juni 2022 bis 2 Uhr morgens. Dabei starten Ratssitzungen bereits morgens und sollen idealerweise am Nachmittag enden. Doch weil sich die Mitgliedstaaten lange nicht über das Verbrenner-Aus einig wurden, ging es mehrfach in die Verlängerung. Kompromissentwürfe zirkulierten durch die Räume und Ministerien in den Hauptstädten, Telefonleitungen zwischen Brüssel und Berlin liefen heiß, bis alle am Ende weitgehend glücklich waren.
Da bei Ratstreffen meist auch Pressekonferenzen nach Abschluss vorgesehen sind und Ministerinnen und Minister bei sogenannten Doorsteps Statements abgeben, traten Frans Timmermans, Robert Habeck und Steffi Lemke noch in der Nacht vor die Presse. Die Journalisten hatten ausgeharrt, manche Pizza bestellt oder zu Hause vor der Live-Übertragung gewartet, bis sich etwas regt.
Und all das nur, um Ihnen, werte Leserinnen und Leser, gleich morgens, wenn der Europe.Table ins Postfach flattert, das Wichtigste aus diesen Verhandlungsnächten zu berichten. Bleiben Sie uns weiter treu und wir schlagen uns auch weiterhin die Nächte für Sie um die Ohren.
Was ist eigentlich LULUCF, CBAM, CSAM, KARL und OLAF? Das Erste, was alle lernen müssen, die sich beruflich mit der Europäischen Union (EU) beschäftigen, ist die überwältigende Flut an Namen und Abkürzungen. Die Kommission (KOM) scheint eine wahre Lust an der Erfindung von Namen und der Schaffung von Abkürzungen für ihre Rechtsakte, Programme und Institutionen zu haben.
Eigentlich helfen uns Namen, uns in der Welt zu orientieren. Doch die Bezeichnungen der EU verstehen meist nur Experten. Sie schließen Menschen eher aus oder schrecken sie ab, als sie für die Themen und die Politik zu gewinnen, die sich dahinter verbergen.
Der Green Deal ist eine Ausnahme. Der einprägsame Name ist Programm. “Darunter kann ich mir etwas vorstellen”, erklärt Manfred Gotta. “Der Name eignet sich auch für Schlagzeilen in den Medien. Er setzt sich besser fest als eine Abkürzung.” Namen sind Gottas Beruf. Seit mehr als 40 Jahren entwickelt er sehr erfolgreich Namen für Produkte und Unternehmen und schafft damit Werte. Bei seinen Kreationen Xetra, Megapearls oder Twingo weiß nahezu jeder Mensch in Europa, was gemeint ist.

Abkürzungen, sagt Gotta, funktionierten dagegen nur, wenn Menschen etwas Emotionales damit verbinden. Wenn es zum Beispiel um das hochemotionale Thema Auto geht, können Leute sich merken, dass ABS ein Bremssystem ist. Aber was sollen Menschen mit LULUCF (Landnutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft) anfangen?
Die Abkürzung KI für das heiß diskutierte Thema Künstliche Intelligenz braucht dagegen keine Erklärung mehr. Sogar Menschen, die die Abkürzung GPT (Generative Pre-trained Transformers) nicht erklären können, reden über ChatGPT.
Bei CSAM etwa ist es anders. Hiermit will die EU gegen “Child Sexual Abuse Materials (CSAM)” vorgehen, um Kinder im Internet besser zu schützen. Was könnte emotionaler sein? Dennoch funktioniert die Abkürzung nicht. Andere nennen das Gesetzesvorhaben Chatkontrolle – und da wissen in Deutschland plötzlich alle, worum es geht – und erinnern die Debatte.
CSAM ist also auch ein Bespiel dafür, dass die Kommission mit der Namensgebung, wenn sie nicht absolut neutral ist, bereits Partei ergreift oder eine Richtung vorgibt. CSAM zeigt ebenso, dass Abkürzungen nicht in allen Sprachen funktionieren. Und schließlich zeigt die Abkürzung auch, wie leicht es ist, Rechtsakte zu verwechseln, wenn etwa einer CSAM und der andere CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, deutsch: CO₂-Grenzausgleichssystem) heißt.
Dabei hat CBAM mit dem Bam am Ende wenigstens einen kraftvollen Klang. “Bam, das sagt mein Enkelkind immer, wenn etwas herunterfällt”, hat Gotta beobachtet. “Ich denke da eher an eine Konfliktsituation als an eine Regulierung zur Verringerung von Emissionen.” Neben dem Green Deal fallen alle Beispiele, die die Redaktion an den Experten sandte, durch.
Fit for 55? “Was soll das denn sein”, fragt Gotta. “Ein Gymnastikstudio oder ein Kaugummi?” Er findet, ein Klimaschutzpaket mit dem Ziel, die Netto-Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2030 um mindestens 55 Prozent zu reduzieren, “das verdient einen richtigen Namen”. Einen Namen der nicht missverstanden werden kann oder gar beleidigend ist und der nicht an den Menschen vorbeiziele.
So einen Namen kann er nicht aus dem Ärmel schütteln. Vorher ist eine gründliche Recherche notwendig. “Professionelles Branding”, sagt Gotta, “setzt sich zusammen aus rationalen und nicht rationalen Werten, die durch den Namen national, europäisch oder international identisch repräsentiert werden.”
REACH zum Beispiel, klingt wie ein Name, ist aber eine Akronym (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Die macht insofern weder als Name noch als Abkürzung für eine europäische Regulierung Sinn, da sie im Englischen keine Assoziation zu einer Chemikalienverordnung hervorruft und in anderen Ländern wieder anders verstanden wird.
Auch die Abkürzung KARL für die Überarbeitung der Richtlinie über die Behandlung von kommunalem Abwasser können sich deutsche Muttersprachler zwar merken. “Die ist aber überflüssig”, meint Gotta. Denn für die breite Öffentlichkeit sei sie eh nicht interessant und wenn doch, ist EU-Abwasserrichtlinie immer noch eindeutiger. Zumal die Richtlinie (RL) im Englischen auch nicht KARL sondern UWTTD heißt. Das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (European Anti-Fraud Office) heißt wiederum OLAF. Das ergibt nur im Französischen Sinn: Office Européen De Lutte Antifraude.
Was aber macht nun einen guten Namen aus – abgesehen davon, dass er international funktionieren muss? Warum funktionieren Namen wie Chiquita oder Twingo? “Keiner der Namen teilt über seine Phonetik, Assoziationen oder inhaltliche Elemente mit, aus welchem Bereich er stammt oder welchen Nutzen er verspricht”, erläutert Gotta. Dennoch repräsentierten die Namen unverwechselbar und überall ein ganz bestimmtes Produkt. “Man muss Unikate schaffen“, sagt Gotta.
Wichtig sei, einen Namen als erstes zu besetzen. “Wir lernen von Kindesbeinen an täglich Namen”, sagt der Werbetexter. Und wie bei einer Visitenkarte, könne man dann unter den Namen seine Funktion in vielen Sprachen übersetzen. “Dann verbinden die Menschen europaweit das Gleiche mit diesem Namen.” Etwa, dass Tabasco eine scharfe Chilisoße ist.
Und schließlich: “Nur die Gesetze, die für die Menschen wirklich wichtig sind, sollten einen Namen bekommen”, rät Gotta der Kommission. “Klangvolle Namen kann man sich besonders gut merken.” Darauf einen Dujardin.
09.08.2023 – 14:00-15:00 Uhr, online
ASEW, Roundtable Erfahrungsaustausch: eQuota
Die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) bietet betroffenen und interessierten Stadtwerken eine Plattform, um sich über das Insolvenzverfahren des THG-Quotenvermittlers eQuota auszutauschen. INFOS & ANMELDUNG
09.08.2023 – 18:00-19:00 Uhr, online
FNF, Podiumsdiskussion Das Aus für das Getreideabkommen? Über die Tragweite und Auswirkungen für die Welt
Die Friedrich-Naumann-Stiftung (FNF) diskutiert mit dem Bundestagsabgeordneten Ulrich Lechte (FDP) und der Wissenschaftlerin Dr. Bettina Rudloff über die Bedeutung des Getreideabkommens zwischen Russland und der Ukraine und die Folgen einer Nichtverlängerung. INFOS & ANMELDUNG
09.08.2023 – 19:00-21:30 Uhr, Düsseldorf
KAS, Roundtable Digitalisierung in der Landesverwaltung Nordrhein-Westfalens
Die Ministerin des Landes Nordrhein-Westfalen Ina Scharrenbach tauscht sich mit der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) über die drängendsten Fragen moderner Verwaltung im steten Spannungsfeld von Bürokratieabbau, Prozessverschlankung und Effizienzgewinnen aus. INFOS & ANMELDUNG
10.08.2023 – 09:00-15:45 Uhr, online
BMI, Seminar Nachhaltige öffentliche Beschaffung
Das Beschaffungsamt des Bundesinnenministeriums (BMI) bietet eine Schulung für Behörden und Einrichtung auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene zu den Grundlagen, rechtlichen Rahmenbedingungen und der Umsetzung von nachhaltiger Beschaffung. INFOS & ANMELDUNG
10.08.2023- 10:00-12:00 Uhr, online
ASEW, Roundtable Erfahrungsaustausch Mini/Balkon-PV
Die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) beleuchtet das Geschäftsmodell von Stecker-Solar-Geräten (Mini-PV) aus Perspektive der Stadtwerke. INFOS & ANMELDUNG
10.08.2023 – 17:00-19:00 Uhr, Donaueschingen
FNF, Seminar Städtebau mal ländlich – Ökologie und Moderne gekonnt verbinden
Im Rahmen einer Stadtführung der Friedrich-Naumann-Stiftung (FNF) soll am Beispiel der Stadt Donaueschingen aufgezeigt werden, wie der Spagat zwischen der Entwicklung eines Konversionsgeländes der Bundeswehr, der Attraktivität eines Tourismus-Hotspots und ökologischen Gesichtspunkten der Donau-Renaturierung gelingen kann. INFOS & ANMELDUNG
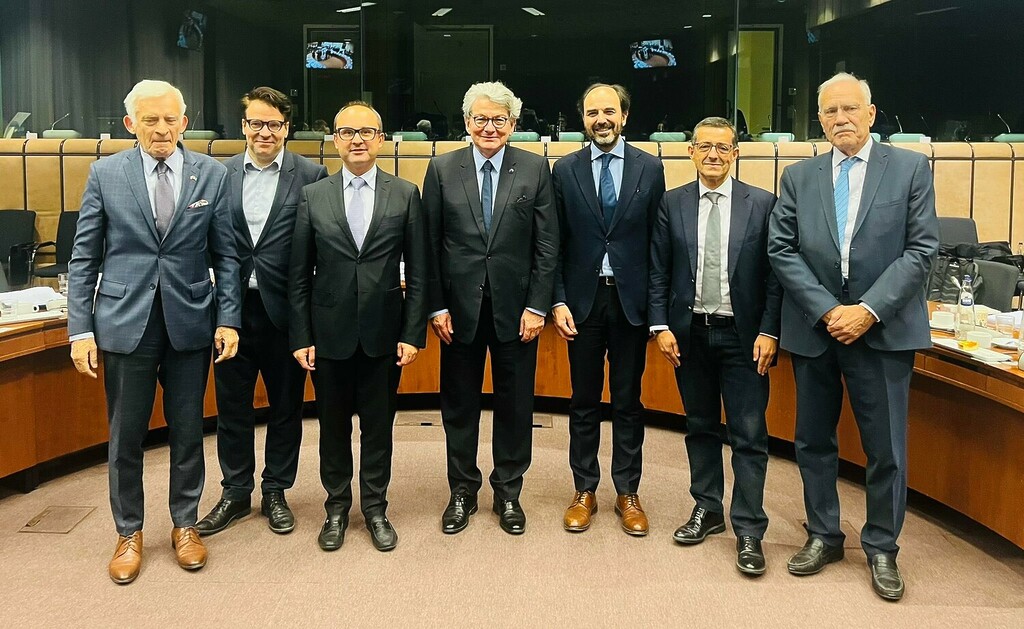
Als ich anfing, für Table.Media über EU-Politik zu schreiben, war ich überrascht. Im Jahr 2022 – Gruppenfotos von Männern in Führungspositionen ernteten längst gewaltige Shitstorms – besuchte ich Veranstaltungen und Podiumsdiskussionen, bei denen ausschließlich Männer auf der Bühne sprachen. Einziges Unterscheidungsmerkmal: ihre verschiedenfarbigen Krawatten.
“Naja, bei den Themen ist das wohl so…”, dachte ich. Rohstoffe, Kreislaufwirtschaft – in der Industrie gibt es einfach nicht so viele Frauen, über die man berichten könnte. Doch weshalb erscheint mir das selbstverständlich? In einer Welt, die sich in allen Lebensbereichen in einem rasanten Wandel befindet, scheinen die Uhren im Spektrum politischer und wirtschaftlicher Kontexte deutlich langsamer zu ticken.
Diesem Eindruck folgend fragte ich bei meinen Kolleginnen und Kollegen nach. Die Mehrheit unserer Redaktionsmitglieder sieht die Perspektiven von Männern tatsächlich häufiger im Europe.Table berücksichtigt als die von Frauen.
Ein Gefühl, das auch der Bilanz entspricht: Zwei Drittel der bisher im Europe.Table porträtierten Personen sind männlich. Vorgestellt werden in dieser Rubrik Menschen, deren Funktion und deren Schaffen für unsere Leserinnen und Leser von Interesse sind. Gewiss könnten darunter mehr Frauen sein.
Dieses Bild spiegelt einen globalen Trend wider: Frauen sind deutlich weniger in den Medien präsent als Männer. Das Global Media Monitoring Project analysiert unter dem Titel “Who makes the News?” regelmäßig Nachrichten aus Print, Radio, Fernsehen, Internet und Twitter. Die jüngste Auswertung der Berichterstattung in Europa aus dem Jahr 2020 ergab: Nur 28 Prozent der zitierten Quellen in klassischen und digitalen Medien waren Frauen. Dabei dienten Frauen am häufigsten als Quellen in Beiträgen über geschlechtsbezogene Themen. Am wenigsten wahrscheinlich waren Zitate von Frauen in Berichten über Politik und Regierungen (22 Prozent). Am ehesten dienten sie dem Zweck, Augenzeugenberichte oder die öffentliche Meinung zu liefern, anstatt als Expertinnen aufzutreten.
Im EU-Kosmos, dem Fokus unserer Berichterstattung, hat sich in den vergangenen Jahren vordergründig einiges gewandelt: Mit Ursula von der Leyen hat erstmals eine Frau den mächtigsten EU-Posten an der Spitze der Kommission inne. Die Kommission selbst ist erstmals paritätisch mit Frauen und Männern besetzt, darunter auch eine Gleichstellungskommissarin, die Malteserin Helena Dalli. Und auch an der Spitze des EU-Parlaments steht mit Roberta Metsola zum ersten Mal eine Frau.
Doch die Zahlen, die sich hinter der Strahlkraft dieser öffentlich sichtbaren Figuren verbergen, sprechen eine andere Sprache: In den EU-Institutionen dominieren weiterhin Männer in Führungspositionen. Im EU-Parlament steht das Geschlechterverhältnis bei 60 zu 40 Prozent.
In den größten Unternehmen innerhalb der EU ist nur ein Drittel der Führungspositionen mit Frauen besetzt. Auch wenn in den meisten Vorständen mittlerweile mindestens eine Frau sitzt, so wird nicht einmal jeder zehnte Vorstand von einer Frau geleitet. In gewisser Weise erscheint es logisch, dass sich dies in der medialen Aufbereitung widerspiegelt.
Was also können wir tun, um unsere Berichterstattung ausgewogener zu gestalten? Natürlich haben wir keinen Einfluss darauf, welche Person ein bestimmtes Amt bekleidet. EU-Kommissare, Europaabgeordnete, Staats- und Regierungschefs, Vorstandsvorsitzende – sie alle sind in ihre Positionen gewählte oder ernannte Mandatsträger, deren Rolle auch aus journalistischer Perspektive durch ihre Qualifikation und nicht durch ihr Geschlecht legitimiert sein sollte.
Im Angesicht des Paritätsanspruchs stellt sich jedoch die Frage, ob die immer noch vorherrschende Mehrheit männlich besetzter Posten auch auf einer tradierten Eignungsbeurteilung basiert, die Männern in bestimmten Themenfeldern per se eine höhere Kompetenz zuweist. Das scheint zudem auch eine für Männer und Frauen unterschiedlich geprägte Berichterstattung zu befördern.
Wenn Politikerinnen es in die Schlagzeilen schaffen, dann oft begleitet von Sexismus und Stereotypen. Die ehemalige finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin etwa ist vor allem durch ihr Tanzvideo interessant für die Medien geworden. Bei einem Treffen Marins mit der damaligen neuseeländischen Premierministerin Jacinda Ardern im vergangenen Jahr fragte ein Journalist während der Pressekonferenz: “Trefft ihr euch einfach, weil ihr euch vom Alter her ähnlich seid und deshalb gemeinsame Interessen habt?”
Journalistinnen und Journalisten sollten sich also auch fragen, ob sie über weibliche Protagonistinnen anders berichten als über männliche. Die Internationale Journalisten-Föderation (IFJ) hat kürzlich ein Toolkit veröffentlicht, um für ebensolche Probleme zu sensibilisieren und eine geschlechtergerechtere Politikberichterstattung zu fördern. “Die Nachrichtenmedien haben noch einen weiten Weg vor sich, um Cis- und Transgender-Frauen in der Führungsetage in einer angemessenen Weise darzustellen, und jede einzelne Anstrengung zählt“, heißt es darin.
Auch in der Auswahl der Expertinnen und Experten für Zitate, Porträts und Interviews haben Journalistinnen und Redakteure die Möglichkeit, auf mehr Ausgewogenheit zu achten. Dafür gibt es Unterstützung: Die LMU München vermittelt über die Datenbank FemConsult etwa Wissenschaftlerinnen in Führungspositionen. In der Datenbank AcademiaNet von der Robert Bosch Stiftung und Spektrum der Wissenschaft sind Tausende Spitzenforscherinnen aus diversen Fachgebieten gelistet.
Geschlechterparität hat eben nicht nur eine numerische Dimension, wie das European Institute for Gender Equality schreibt, sondern auch eine substanzielle: Sie bezieht sich auf den gleichberechtigten Beitrag von Frauen und Männern zu jeder Lebensdimension, privat und öffentlich.
“There is a gender angle to every story”, jede Geschichte hat eine Gender-Dimension, schreibt das Global Media Monitoring Project. Auch die großen, aktuellen Themen: Klimapolitik, Rohstoffversorgung, Sorgfaltspflichten, Digitalisierung. Das UN-Entwicklungsprogramm berichtet etwa: “Durch die Auswirkungen des Klimawandels werden strukturelle Ungleichheiten, etwa die zwischen Frauen und Männern, fortgeschrieben und verstärkt”.
Journalistinnen und Redakteure entscheiden, wessen Perspektiven sie in ihren Beiträgen darstellen, welchen Themen und Menschen sie auf die öffentliche Bühne helfen. Diese “Gatekeeper”-Funktion sowie journalistische Qualitätsstandards fordern auch zu einer Ausgewogenheit männlicher, weiblicher, diverserer Perspektiven auf. Dazu gehört auch eine Verantwortung auf individueller Ebene. Für alle Schreibenden. Und auch für mich.

Es gibt niemanden, der die Ereignisse in der direkt gewählten Volksvertretung der EU-Bürger von den Anfängen bis heute so aufmerksam verfolgt hat wie Bernd Posselt. Er war dabei, als das erste direkt gewählte EU-Parlament am 17.7.1979 in Straßburg zusammengekommen ist. Damals war er 23 Jahre alt und Assistent von Otto von Habsburg, dem langjährigen Europaabgeordneten für die CSU und Sohn des letzten österreichisch-ungarischen Kaisers. Posselt zog selbst 1994 für die CSU ins Europaparlament ein und engagierte sich im Auswärtigen Ausschuss und bei sicherheitspolitischen Themen.
Er gehörte dem Haus 20 Jahre lang als Parlamentarier an. Seitdem er 2014 den Wiedereinzug verpasste, ist er der erste auf der Nachrückerliste der CSU. Vermutlich wird der 68-Jährige, der in Pforzheim geboren wurde und gelernter Journalist ist, auf der Europaliste der CSU im Herbst auch wieder auf dem siebten Platz landen. Mutmaßlich ist das wiederum der erste Nachrückerplatz.
Posselt musste zwar vor bald zehn Jahren seinen Zugangsausweis als Mitglied des Europäischen Parlaments (MEP) abgeben. Doch er war seitdem weiterhin präsent – vor allem in den Straßburger Sitzungswochen. Als Ex-MEP hat er weiter Zutritt zum Hohen Haus. Doch anders als andere Ex-MEPs hat er diesen Zutritt nicht etwa genutzt, um als Lobbyist auf seine ehemaligen Kollegen einzuwirken, sondern weiterhin für politische Arbeit. Posselt berät EVP-Fraktionschef Manfred Weber in der Außenpolitik, schreibt Bücher und beobachtet die Europapolitik. Er ist seit 1998 Chef der überparteilichen Paneuropa Union, deren Ursprünge in die 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts zurückreichen.
Irgendwie hat Posselt nicht aufgehört, Abgeordneter zu sein. Er ist in Straßburg anwesend, präsenter als mancher Abgeordnete, der ein Mandat der Wähler bekommen hat. Er darf nicht abstimmen und sitzt auch nicht unten im Plenum. Aber er ist dabei und dürfte abgesehen von Krankheit seit Juli 1979 so gut wie keine Sitzungswoche in Straßburg verpasst haben. Damals als Posselt den Sitz im Parlament verlor und trotzdem immer noch nach Straßburg fuhr, erschienen darüber Artikel, die spöttische Züge trugen.
“Ich habe das alles gelesen”, berichtet Posselt. Er hält an seiner Mission aber fest, weil er – in seinem Fall ist der Ausdruck wohl treffend – beseelt ist von der europäischen Idee wie kaum ein anderer Politiker. Als 20-Jähriger ist er der CSU beigetreten. Anlass war die Rede von Franz-Josef Strauß mit dem Titel “Europa kann nicht länger warten”. Posselt sagt: “Millionen von Menschen setzen sich ehrenamtlich für Europa ein, warum sollte ich es nicht auch tun?”
Posselt war Assistent, dann wurde er Abgeordneter, inzwischen ist seine Rolle am besten mit Chronist des Europaparlaments an dessen Hauptsitz in Straßburg beschrieben. Es gibt niemanden, der kenntnisreicher über seine Geschichte erzählen kann. Er hat die Rede von Louise Weiss parat, die die Politikerin, Journalistin und Feministin als Alterspräsidentin bei der ersten Sitzung gehalten hat: “Sie hat gefordert, dass wir nicht nur europäische Traktorsitze brauchen, sondern europäische Menschen.”
Posselts Eltern kamen aus dem Sudetenland und der Steiermark. Er hat sich früh für Ost- und Mitteleuropa interessiert und kann stolz darauf sein, dass Putin ihn wegen seines Einsatzes für die Menschenrechte bereits 2015 mit einem Einreiseverbot für Russland belegt hat.
Er ist ein Kenner der Architektur und Baugeschichte der Volksvertretung. So kann er davon berichten, wie am Brüsseler Sitz des Parlaments die Ausschüsse teils in gemieteten Räumlichkeiten tagten. Er beschreibt lebendig die Symbolik, die das legendäre internationale Büro “architecturestudio” im Straßburger Parlamentsgebäude verewigt hat.
Der Bau, der 1999 nach der Wahl bezogen wurde und seinerzeit 275 Millionen Euro kostete, stehe sehr bewusst an dem Ort, wo die elsässische Ill auf den Kanal trifft, der die Marne mit dem Rhein verbindet. “Auf dem Wasserweg sind von hier drei Meere erreichbar”, weiß Posselt. Das viele Glas stehe für die Transparenz der europäischen Demokratie. Der Plenarsaal sei wie ein Amphitheater konstruiert. An etlichen Stellen habe der Besucher Blickkontakt zum Straßburger Münster.
Posselt erzählt auch vom 1. Mai 2004 und der ersten EU-Osterweiterung. Damals kam der ehemalige Solidarność-Führer und spätere Präsident Polens, Lech Wałęsa, für den Festakt nach Straßburg. “Am Haupteingang des Parlaments wurde ein Mast für die polnische Flagge errichtet, der auf der früheren Lenin-Werft in Danzig gefertigt wurde.” Besucher des Parlaments finden bis heute das Symbol der ehemals verbotenen Gewerkschaft, deren Widerstand den Zusammenbruch des Kommunismus eingeleitet hat, auf dem Masten.
Posselt teilt sein Wissen gern. Obwohl er zu den wenigen Menschen gehört, die bis heute kein Mobilfunktelefon benutzen, ist er erstaunlich gut erreichbar. Warum er kein Handy hat? “Ich will kreativ arbeiten, da würde es mich nur stören.” Markus Grabitz

Europa ist mehr als die EU. Viel mehr. Für uns ist Europa auch ein Lebensgefühl. Und wie könnten wir das schöner und gefühlvoller ausdrücken als mit Musik? Darum haben Mitglieder der Europe.Table-Redaktion anlässlich unserer 500. Ausgabe eine Playlist zusammengestellt, mit unserem Soundtrack für Europa.
Wir beginnen, wie könnte es anders sein, mit der “Ode an die Freude“. Dabei haben wir uns für eine Einspielung des London Symphony Orchestra entschieden. Schade, dass die Briten nun keine Freude mehr haben. Ein Kollege gestand sogar, dass ihm gelegentlich die Tränen kommen, wenn er die Europa-Hymne hört. Wer, wird nicht verraten.
Dann haben wir einige Titel unserer Playlist nach ihrem Namen ausgewählt, so wie das zum Beispiel Binnenmarktkommissar Thierry Breton für den Raw Materials Act gemacht hat. Breton ist offenbar überzeugt, europäische Gesetze mit musikalischer Begleitung besser vermitteln zu können. Er hat bereits für verschiedene Rechtsakte Playlisten erstellt. Das hat Leonie Düngefeld inspiriert, Songs auszuwählen mit den folgenden Worten im Titel:
Auch Spanien, das gerade die Ratspräsidentschaft innehat, hat zu Beginn der Amtszeit eine Playlist erstellt, die wir hörenswert finden.
Die übrigen Titel haben wir nach persönlichen Kriterien ausgewählt. Clara Baldus fiel zu Europa und Musik zuerst der Eurovision Song Contest ein. So kommt Loreen mit Euphoria auf unsere Playlist.
Lukas Scheid reist gern durch Europa und über die Musik bekommt er noch einmal einen anderen Zugang zu seinen Reisedestinationen. So hat er Vajze e bukur nga kurbeti von Bledar Alushaj beim Trampen durch Albanien in einem Auto auf Dauerschleife hören müssen. Da Albanien Beitrittskandidat ist, mag der Song als musikalische Kostprobe dienen.
Nordmazedonien bewirbt sich ebenfalls. Bei Stakleni Noze von Funk Shui saß Lukas Scheid im Mavrovo-Nationalpark mit jungen Mazedoniern beim Bier. Sie haben sich gegenseitig ihre Lieblingslieder in Landessprache vorgespielt. Auch Norwegen, die Niederlande, die Schweiz und Schweden haben ihre musikalischen Spuren in seiner persönlichen Playlist hinterlassen. Europe Is Lost von Kae Tempest ist der Rap, den er hörte, als er während des Brexits in UK lebte.
Geradezu paneuropäisch ist der Hintergrund des Norwegers Erlend Øye, der im heimischen Bergen die Band Kings of Convenience gründete, bevor er in Berlin seine zweite Band, Whitest Boy Alive, startete. Mittlerweile ist er nach Sizilien emigriert, wo er sich auf seine Solo-Karriere fokussiert und gemeinsam mit den Sizilianern von La Comitiva Gitarrenpop macht. In diesem Song La Prima Estate geht es um die Freiheit des ersten Sommers nach der Maturità, dem italienischen Abitur. Eine Empfehlung von Leonard Schulz.
Als er in Istanbul lebte, hörte er oft, wie Musiker Rembetiko, den “griechischen Blues” spielten. Die Compilation Songs of Smyrna (dem heutigen Izmir) mit Songs wie Baxe Tsifliki erinnern Leonard Schulz daran, wie eng die Länder kulturell verknüpft sind. Und die Brass-Band Fanfare Ciocărlia aus Rumänien – hier vertreten mit Iag Bari – hat er während des Balkan-Musik-Booms in den 00er-Jahren in Berlin oft gehört.
Denkt Markus Grabitz musikalisch an Europa, fällt ihm das Lied Göttingen der französischen Chansonnière Barbara ein. Es entstand nach einem Konzert, das sie Anfang der 1960er in der ihr bis dahin unbekannten Stadt gegeben hatte und bei dem sie in Kontakt kam mit den Deutschen. Es wurde später zur Hymne der Aussöhnung zwischen den ehemaligen Erbfeinden. Sie singt: “Lasst diese Zeit nie wiederkehren, und nie mehr Hass die Welt zerstören, es wohnen Menschen, die ich liebe, in Göttingen, in Göttingen …” Kanzler Gerhard Schröder hat eine Passage des Liedtextes eingebaut in seine Rede zum 40. Jubiläum der Élysée-Verträge und dafür viel Applaus bekommen. Niemand hat vor oder nach Barbara Göttingen je so charmant ausgesprochen.
Der flämische Rocker und Singersongwriter Arno Hintjens singt in Putain als Refrain: “Putain, putain, c’est vachement bien, nous sommes quand même tous des Européens”. In der deutschen Übersetzung heißt das so viel wie: “Kraftausdruck, Kraftausdruck, es stimmt, wir sind trotz allem alle Europäer.” Er schrieb das Lied von 2003 später um, um gegen den beschlossenen, aber noch nicht vollzogenen Brexit zu protestieren, seitdem hat es auch die Verse: “Bye-bye Brexit, bye-bye Brexit, We’re still gonna eat fish & chips all.”
Auch für Corinna Visser gehören die Freiheit und das grenzenlose Reisen zu den wichtigsten Errungenschaften und den Stärken Europas. Denn sie hat in anderen Teilen der Erde erlebt, was Grenzen anrichten können. Darum wird es gegen Ende der Europe.Table-Playlist noch einmal kitschig mit Wind of Change von den Scorpions, etwas schräg mit Brennerautobahn von Roy Bianco & Die Abbruzanti Boys und kulinarisch mit Carbonara von Spliff.
Dann noch ein Blick zu den Nachbarn: Bei den Spaniern hoch im Kurs steht aktuell der Rapper Quevedo mit Columbia. Die Franzosen stehen auf C’est carré le S von Naps. Italien hört Alfa mit bellissimissima <3. Zum Schluss: Freedom von George Michael. Viel Vergnügen beim Hören. Die Redaktion
