nur elf Tage, dann geht das Gas aus: Im Falle einer Seeblockade wäre das Szenario für Taiwan düster. Denn die Insel ist abhängig von fossilen Brennstoffen, die aus dem Ausland kommen. Mehr als 97 Prozent der benötigten Energie werden importiert.
Sich unabhängig machen durch Erneuerbare Energien könnte eine Lösung sein, die zudem gut fürs Klima wäre. Doch Experten dämpfen diese Hoffnung. Denn allein mit Solar- und Windkraft lässt sich der Energiebedarf von Industrie und Bewohnern nicht decken. Atomkraft wäre eine Option, aber Taiwan steht kurz vor dem Ausstieg, und die Gegnerschaft ist ähnlich vehement wie hierzulande in Deutschland. Maximilian Arnhold zeichnet ein Bild von Abhängigkeiten und Chancen.
Ägypten, Tunesien, Elfenbeinküste, Togo – das Reisejahr begann für Chinas Außenminister traditionell in Afrika. Dieses Jahr standen für Wang Yi Küstenländer des Kontinents im Fokus, die mit ihren großen Häfen eine wichtige Rolle für die Neue Seidenstraße spielen. Aber natürlich hat die Wahl dieser Reiseziele auch vielfältige geopolitische Hintergründe, wie Fabian Peltsch in seiner Analyse darlegt.
Ägypten steht als neues Brics-Mitglied zum zweiten Mal in Folge auf dem Reiseplan, sein Suez-Kanal mit einem Cluster dort angesiedelter chinesischer Unternehmen dürfte es auf Wang Yis Prioritätenliste nach oben befördert haben. In Tunesien wiederum profitiert Peking von Spannungen des Landes mit der EU. Côte d’Ivoire und Togo sind wichtige Tore nach Afrika. Eine anti-westliche-Stimmung herrscht in vielen dieser Länder. Auch das spielt Wang in die Karten.
“Was wissen wir wirklich über die Welt da draußen? Wie weit haben wir uns von ihr entfernt?” Diese Fragen stellte Deng Xiaoping 1978 seinem Politbüro. Wohl wissend, dass nach Maos ideologischer Herrschaft und angesichts der schlechten Wirtschaftslage ein Umbruch hermusste. Um die Partei-Elite zu Reformen zu bewegen, schickte Deng Xiaoping seinen Vizepremier Gu Mu nach Europa. Dieser sollte auskundschaften, wie es um Länder wie Frankreich und Deutschland wirklich stand. Der Realitäts-Check ermöglichte Chinas rasanten Aufstieg. Johnny Erling beschreibt die Geschehnisse und zieht Parallelen zur Gegenwart.
Ich wünsche Ihnen einen guten Start ins Wochenende!


Wang Yi hat seine knapp einwöchige Afrika-Reise beendet. Der chinesische Außenminister besuchte Ägypten, Tunesien, Togo und Côte d’Ivoire. Warum gerade diese Länder auf dem Plan standen, wurde von offizieller Seite wie immer nicht kommentiert. Es gibt jedoch einige Anhaltspunkte, warum nach den Besuchen von Wangs geschasstem Vorgänger Qin Gang in Äthiopien, Gabun, Angola, Benin und Ägypten im vergangenen Jahr nun das frankophone Westafrika und die Mittelmeerküste des Kontinents im Fokus standen.
“Afrika ist der Ort, an dem sich derzeit viele Herausforderungen im Zusammenhang mit der Belt and Road Initiative bündeln, vor allem im Zusammenhang mit Schuldenproblemen”, sagt Lauren Johnston, Associate Professor am Zentrum für Chinastudien der Universität Sydney. Auch deshalb besuchte Wang dieses Mal vor allem Länder, deren Wirtschaft von ihren Häfen stark beeinflusst wird, sagt die Wissenschaftlerin mit einem Schwerpunkt auf China-Afrika-Beziehungen. China gehe es um Fragen der Handelsumlenkung sowie der regionalen Integration und Handelskonnektivität.
Ägypten – das Land, das Asien, Europa und Afrika verbindet – wird für Peking strategisch immer wichtiger. Zum zweiten Mal in Folge stand es auf der Liste der ersten Auslandsreise des Jahres, die den chinesischen Außenminister traditionell nach Afrika führt. Das dürfte zum einen an seinem neuen Status als Brics-Land liegen, zum anderen an seiner Rolle innerhalb der Belt and Road-Initiative: Ägyptens Suezkanal ist ein wichtiger Transitpunkt für Chinas BRI. Hunderte chinesische Unternehmen haben sich in der 455 Quadratkilometer großen Suez Canal Economic Zone angesiedelt.
China ist schon jetzt der größte Handelspartner Ägyptens, wenn auch mit einem Handelsdefizit von 9,6 Milliarden Dollar im Jahr 2022. Chinesische Investitionen stiegen hier zwischen 2017 und 2022 um gigantische 317 Prozent an. Mit einem Volumen von acht Milliarden US-Dollar ist China viertgrößter Gläubiger Ägyptens.
Zum anderen hat das nordafrikanische Land eine besondere Bedeutung bei der Bewältigung aktueller Krisen im Nahen Osten. Bereits im Oktober 2023 lobte Xi Jinping die konstruktive Rolle Ägyptens in der Region. Auch Peking leidet unter den militanten Huthi im Jemen, die wichtige Schifffahrtsrouten zwischen Asien und Europa attackieren. Die chinesische Regierung hat jedoch kein Interesse daran, dass sich die Präsenz westlicher Kriegsschiffe dort weiter erhöht. Es müsse vermieden werden, “Öl ins Feuer der Spannungen am Roten Meer zu gießen”, erklärte Wang vor Journalisten in Kairo.
China positionierte sich in Ägypten außerdem einmal mehr als Sprecher des globalen Südens, indem es sich als Vermittler in der Gaza-Krise anbot. Zusammen mit Ägypten fordere China “einen sofortigen und umfassenden Waffenstillstand sowie ein Ende der Angriffe auf Zivilisten”, sagte Wang in Kairo und rief abermals zur Einberufung einer internationalen Friedenskonferenz auf, bei der ein konkreter Zeit- und Fahrplan für die Umsetzung der Zwei-Staaten-Lösung aufgesetzt werden soll.
Tunesien ist einer der ältesten Partner der Volksrepublik auf dem Kontinent. Zeitgleich mit Wangs Besuch feierten die beiden Länder 60 Jahre diplomatische Beziehungen. Tunesien ist seit 2018 Teil von Pekings Neuer Seidenstraße. Obwohl die wirtschaftlichen Beziehungen zu dem hochverschuldeten Land bislang wenig ausgebaut sind, versucht Peking hier eine Nische zu besetzen, die durch Spannungen zwischen dem frankophonen Land und der EU entstanden ist.
Tunesien ist eines der Haupttransitländer für Flüchtlinge aus Afrika. Das gibt dem Land enorme Verhandlungsmacht gegenüber der EU. Im Winter wies Tunis Hilfszahlungen aus Brüssel, die unter anderem an die Bekämpfung der Migration übers Mittelmeer gekoppelt waren, als “respektlose Gefälligkeiten” zurück. Die ehemalige Kolonialmacht Frankreich investiert jährlich etwa zwei Milliarden US-Dollar in das nordafrikanische Land. Seit dem Ausbruch des Gaza-Konflikts wächst dort jedoch die anti-europäische und vor allem anti-französische Stimmung.
Wang betonte in Tunis, dass China Tunesien bei der Wahrung seiner “souveränen Unabhängigkeit und nationalen Würde nachdrücklich unterstützt”. Tunesiens 2019 gewählter, als autoritär geltender Präsident erklärte laut Berichten chinesischer Staatsmedien, dass Tunesien mithilfe Chinas die “Modernisierung tunesischer Prägung” vorantreiben wolle. Bislang beschränkte sich die chinesische Hilfe auf einige ausgewählte Projekte, etwa den Bau des Melegue-Damms bei El Kef. Ein neues Abkommen mit der chinesischen Agentur für internationale Zusammenarbeit und Entwicklung soll nun weitere Projekte in den Bereichen Gesundheit, erneuerbare Energien und Kommunikationstechnologie in Angriff nehmen.
Auch beim Tourismus wollen die Länder zusammenwachsen. Im Oktober 2023 hatte Tunesien die Visumpflicht für chinesische Touristen aufgehoben. Der Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor des Landes. Er macht rund sieben Prozent des Bruttoinlandsproduktes aus.
Die Elfenbeinküste und Togo sind weitere “Tore nach Afrika”, die China nicht nur offenhalten, sondern kontinuierlich weiter öffnen will. Die Elfenbeinküste ist Sitz der Afrikanischen Entwicklungsbank (AfDB), der bedeutendsten Finanzinstitution Afrikas. Knapp 15 Prozent des Handels der Elfenbeinküste entfällt auf China. Die chinesischen Investitionen beliefen sich bis 2023 auf 7,5 Milliarden Dollar.
So wurde etwa der Ausbau des Hafens von Abidjan zu einer Tiefwasseranlage zu großen Teilen von Chinas Exim-Bank finanziert. Zudem wurde eine Kooperationsvereinbarung mit der chinesischen Hafenbehörde von Guangzhou unterzeichnet. Eine enorme Stärkung der BRI: Angesichts des steigenden Frachtverkehrs in Westafrika können von hier aus auch benachbarte Länder wie Mali, Burkina Faso und Niger, die keinen Zugang zum Meer haben, stärker in den Handel mit China eingebunden werden.
Auch in Togo, einem der ärmsten Länder Afrikas, ist die chinesische Exim-Bank aktiv. 2016 gewährte sie ein Darlehen über 67 Millionen US-Dollar zur Modernisierung und Erweiterung des internationalen Flughafens Gnassingbé Eyadéma in Lomé. Auch rund um den Hafen der Hauptstadt, einer der größten in Westafrika, haben sich chinesische Firmen angesiedelt. Togos Plan, den Bergbausektor bis 2025 zu verdoppeln, zieht weitere chinesische Unternehmen an.
Den Chinesen kommt auch hier zugute, dass in Togo anti-westliche Stimmung herrscht. Viele fühlen sich von den ehemaligen Kolonialmächten ausgebeutet und im Stich gelassen. Dabei hatte die Europäische Union Togo erst im April 2023 in einem Partnerschaftsabkommen 70 Millionen Euro für eine nachhaltige Landwirtschaft und den Aufbau einer sozialen Infrastruktur zugesagt. Chinas Image-Gewinn, nachdem es dem Land Importzölle erließ und 2022 beim Forum für chinesisch-afrikanische Zusammenarbeit (FOCAC) ankündigte, 17 afrikanischen Ländern die Rückzahlung 23 zinsloser Darlehen zu erlassen, war infolge der weniger belasteten Vergangenheit ungleich größer. Das 21. Jahrhundert sei ein Jahrhundert der Wiederbelebung für die Entwicklungsländer, betonte Wang im Gespräch mit Togos Präsident Faure Gnassingbé. China werde Afrika bei der Beschleunigung seiner unabhängigen Entwicklung weiter unterstützen.

Taiwans Energieversorgung hängt fast vollständig von fossilen Brennstoffen ab: mehr als 97 Prozent des Energiebedarfs werden importiert. Und diese Brennstoffe – Kohle, Öl und Gas – muss Taiwan als Inselstaat auf dem Seeweg über die Taiwanstraße einführen. Das verstärkt nach dem Sieg des China-kritischen William Lai von der Demokratischen Fortschrittspartei (DPP) bei den Präsidentschaftswahlen die Sorge vor Reaktionen aus Peking. Denn eine Seeblockade wäre fatal.
Nach Ansicht von Experten ist Taiwan deswegen sehr anfällig für Störungen. Die Energiebehörde, Teil des Wirtschaftsministeriums, hat berechnet, dass die Erdgas-Vorräte derzeit nur für elf Tage und die Kohle-Vorräte für 39 Tage reichen. Genug Öl gäbe es für 146 Tage. Schon die bisherige DPP-Regierung von Präsidentin Tsai Ing-wen wollte daher die grüne Energie deutlich ausbauen, hat aber ihre selbstgesteckten Ziele nicht erreicht. Nun ist Nachfolger Lai gefragt, als Vizepräsident gehört er bereits der vorigen Regierung an.
Taiwans Strom stammt zu mehr als 80 Prozent aus fossilen Brennstoffen. 2022 importierte Taiwan 63,6 Millionen Tonnen Kohle, vor allem aus Australien und Indonesien. Beträchtliche Mengen an Kohle und Gas stammen laut statistischem Jahrbuch zudem aus Russland und damit aus einem Staat, der im Falle einer akuten Krise und möglichen Blockade wohl zu China halten würde.
“Bereits Chinas Marineübungen rund um Taiwan könnten die Versorgungslinien für einen begrenzten Zeitraum beeinträchtigen oder abschneiden”, schreibt Eugene Chausovsky, Analyst vom US-Thinktank New Lines Institute, im Magazin “Foreign Policy”. Selbst eine begrenzte Blockade der Taiwanstraße könnte laut Chausovsky für die Insel verheerend sein.
Der wachsende Energiehunger dürfte die Lage noch verschärfen. Die wichtige Chip-Industrie Taiwans klagt schon jetzt über Netzausfälle. Das größte Halbleiterunternehmen TSMC verschlingt allein mehr als sechs Prozent des Gesamtenergieverbrauchs des Landes.
Fraglich bleibt dennoch, ob Grünstrom allein der Ausweg aus der fossilen Abhängigkeit und ihrem geopolitischen Bedrohungspotenzial sein kann. Der Ausbau von Solar- und Windkraft hinkt den angepeilten Zielen hinterher. Eigentlich sollte der Anteil der Erneuerbaren am Strommix bis 2025 auf 20 Prozent steigen. Einem Bericht des Wirtschaftsministeriums zufolge dürften bis dahin aber nur gut 15 Prozent des Stroms regenerativ erzeugt werden. Ende 2023 waren erst 8,9 Prozent erreicht.
Gründe für die schleppende Energiewende gibt es viele. Gebiete für Windräder oder Solaranlagen sind umkämpft. Mal stehen Bedenken von Fischern, mal die Umweltrisiken von Windanlagen im Meer im Weg. An Land sind es meist Konflikte um Agrarflächen, die den Ausbau der Freiland-Photovoltaik verhindern – zum Beispiel der Gebietsanspruch Indigener, die vor Projektstart nicht gefragt worden waren.
Laut Energieberater Raoul Kubitschek gibt es noch weitere Hürden für eine Trendwende: “Ein zu niedriger Strompreis und schlecht isolierte, stark klimatisierte Wohnungen.” Manch ausländischer Investor sehe zudem die Gefahr einer möglichen chinesischen Attacke.
Kubitschek leitet das Taipeh-Büro von Niras, einer Ingenieursfirma, die ausländischen Energieunternehmen hilft, in Taiwan zu investieren. “100 Prozent Erneuerbare sind unter Taiwans Voraussetzungen nicht realistisch“, sagt er. Taiwan habe zwar an der Taiwanstraße sehr gute Windbedingungen für Offshore-Windanlagen, es seien bereits Genehmigungen über 5,5 Gigawatt Kapazität erteilt. Allein mit On- und Offshore-Wind und Solarkraft sei die Versorgung aber nicht zu machen, sagt Kubitschek. “Es geht darum, eine Grundversorgung herzustellen. Also müssen weiter Gaskraftwerke benutzt werden.”
Die Halbleiterbranche plädiert dafür, auch auf Atomkraft zu setzen. Zwar ist der Ausstieg bis 2025 beschlossene Sache. Kernenergie macht noch 6,3 Prozent der Stromerzeugung aus. Die China-freundlichere Nationalpartei KMT warb im Wahlkampf jedoch für den Bau neuer AKWs, um den Energiebedarf des Landes zu decken.
Die Regierungspartei DPP dagegen erteilt dem eine Absage. Auch Brennstäbe müssten wieder aus dem Ausland importiert werden, heißt es. Für die unabhängige Energieversorgung wäre also nichts gewonnen. Und auch in Taiwan ist die Endlagerfrage ungeklärt. Kubitschek glaubt, dass der Atomausstieg ohnehin nicht mehr rückgängig zu machen sei. Provinzpolitiker würden den Bau neuer AKWs nicht zulassen.
Am Ende bleibt Taiwan nur, doch alle Anstrengungen in Erneuerbare zu investieren. Denn die Wirtschaft gerät auch indirekt zunehmend unter Druck. Zwar ist Taiwan auf Betreiben Chinas nicht Teil internationaler Klimaverträge, weil es von den Vereinten Nationen nicht als eigener Staat anerkannt ist. Doch westliche Unternehmen wollen ihre Lieferketten mit Ökostrom versorgt sehen, das gilt auch für Taiwan. Zum Beispiel fordert Apple seine Zulieferer auf, bis 2030 klimaneutral zu sein. Als wichtiger Chip-Abnehmer erhöhe Apple damit durchaus den Transformationsdruck auf die Industrie, sagt Kubitschek. Hoffnung macht dem Firmenberater, dass die Taiwaner “aus Fehlern lernen”, wie etwa bei vergangenen Ausschreibungen. Im Netzausbau gebe es viel Potenzial, ebenso im Bereich Offshore-Wind.
Die Recherche für diesen Artikel fand im Rahmen einer Pressereise von Journalists.Network e.V. nach Taiwan statt.
23.01.2024, 10:00 Uhr (17:00 Uhr Beijing time)
Deutsch-chinesische Wirtschaftsvereinigung, Webinar: China 2024: Rechtliche Änderungen im Jahr des Drachen Mehr
23.01.2024, 19:30 Uhr
Konfuzius-Institut Trier, Vortrag: Nadine Godehardt: Chinas geopolitischer Code. Warum die Welt chinesischer wird Mehr
24.01.2024, 15:00 Uhr Beijing time
AHK Greater China, Press Conference & Launch Event: Business Confidence Survey Report 2023/24 Mehr
25.01.2024, 09:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)
EU SME Centre, Hybrid Workshop: Unlocking AI Business Opportunities in China: Meet Start-up & SME AI Innovators Mehr
25.01.2024, 09:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)
Dezan Shira & Associates, Webinar: 2024 China Overview: Planning for Compliance and Tax Optimization Mehr
25.01.2024, 11:00 Uhr (18:00 Uhr Beijing time)
Kiel Institute China Initiative, Global China Conversations: Aussichten für die chinesische Wirtschaft: Kurzfristige Herausforderungen oder fundamentale Verlangsamung? Mehr
26.01.2024, 18:00 Uhr (27.01., 01:00 Uhr Beijing time)
Konfuzius-Institut Frankfurt, Vortrag (hybrid): Bernhard Weßling: Mein Sprung ins kalte Wasser – Mit offenen Augen und Ohren in China leben und arbeiten Mehr
30.01.2024, 10:00 Uhr
Mercator Institute for China Studies (MERICS), Workshop: Zwischen Kooperation und Wettbewerb – China und andere asiatisch-pazifische Akteure in Klimaschutz, Neuer Mobilität, Umwelt- und Energietechnologien Mehr
Der chinesische BMW-Partner Brilliance Automotive plant keinen Ausstieg aus dem Gemeinschaftsunternehmen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf ein ihr vorliegendes Dokument. Der Münchner Autobauer hält an dem Joint Venture BMW Brilliance Automotive (BBA) 75 Prozent, der Rest liegt bei Brilliance China Automotive. BMW lehnte eine Stellungnahme ab.
Brilliance China Automotive steckt aktuell in einer Umstrukturierung und benötigt frisches Kapital. Am Montag hatte die Agentur Bloomberg berichtet, dass mehrere chinesische Autobauer in Vorgespräche über den Verkauf der Anteile involviert seien. Eine Entscheidung sei aber noch nicht getroffen.
Nach der Restrukturierung von Brilliance werde Shenyang Automotive – das Investmentvehikel der Stadt Shenyang, Standort des Joint Ventures – indirekt mit rund 30 Prozent dessen größter Anteilseigner, heißt es in dem Reuters vorliegenden Dokument. Weitere knapp zwölf Prozent liegen demnach bei der Provinz Liaoning, der Rest bei Fondsgesellschaften und im Streubesitz. rtr/jul
Wenige Tage nach der Präsidentschaftswahl in Taiwan hat China innerhalb von 24 Stunden 24 Kampfflugzeuge und fünf Marineschiffe in Richtung der Insel geschickt. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Taipeh überquerten elf der Kampfjets die Median-Linie in der Taiwanstraße oder drangen in die südwestliche und nördliche Luftverteidigungszone (ADIZ) Taiwans ein.
Es ist die erste Machtdemonstration dieser Art seit der Wahl. Diese hatte am Wochenende der China-kritische Lai Ching-te von der DPP für sich entschieden hat. Peking sieht Taiwan als Teil Chinas und hatte massiv versucht, im Vorfeld Einfluss auf die Wahl zu nehmen – auch durch militärische Einschüchterungsversuche. rtr
Der taiwanische Halbleiter-Hersteller TSMC hat im Schlussquartal 2023 einen Gewinnrückgang verbucht – allerdings fiel der weniger schlimm aus als befürchtet. Das Unternehmen teilte am Donnerstag mit, der Überschuss sei um 19 Prozent auf umgerechnet 6,9 Milliarden Euro geschrumpft. Analysten hatten nur 6,6 Milliarden Euro Überschuss erwartet. Der Umsatz des wertvollsten asiatischen börsennotierten Unternehmens ging wie erwartet um 1,5 Prozent auf 18 Milliarden Euro zurück.
Für das gerade angelaufene Quartal stellte der Konzern Erlöse von 16,5 bis 17,2 Milliarden Euro in Aussicht. Das wöre ein ordentlicher Zuwachs, denn im Vorjahreszeitraum waren es nur 15,3 Milliarden Euro gewesen. Die operative Gewinnmarge werde mit voraussichtlich 40 bis 42 Prozent auf dem Niveau des abgelaufenen Quartals liegen. Für das Gesamtjahr 2024 könne dank der anhaltenden Nachfrage nach Spezialchips für Künstliche Intelligenz (KI) mit “gesundem” Umsatzwachstum um die 25 Prozent gerechnet werden, teilte TSMC mit. rtr
Die Ukraine versucht, einen direkten Gesprächskanal zwischen Präsident Wolodymyr Selenskyj und Xi Jinping zu organisieren. Das sagte Außenminister Dmytro Kuleba am Donnerstag in einem Interview mit Bloomberg in Davos: “Es gibt Dinge, über die sie reden können”. Dazu gehören vor allem die Pläne Selenskyjs, noch in diesem Jahr eine hochrangig besetzte Friedenskonferenz in der Schweiz abzuhalten. Diese hatte der ukrainische Präsident am Montag bei einem Treffen nahe Bern mit der Schweizer Präsidentin Viola Amherd angekündigt.
Die Anwesenheit Chinas wäre für die Relevanz einer solchen Konferenz durchaus wichtig. China müsse in Gespräche mit Russland zur Beendigung des Krieges einbezogen werden, sagte Selenskyjs Stabschef Andrij Yermak am Wochenende in Davos nach einem Treffen von Sicherheitsbeamten aus mehr als 80 Ländern. Sie hatten mit Vertretern Kiews über Selenskyjs Friedensplan diskutiert. “China spielt eine wichtige Rolle. Wir müssen Wege finden, um mit China zusammenzuarbeiten”, sagte auch der Schweizer Außenminister Ignazio Cassis, der an dem Treffen teilnahm.
China steht allerdings bisher eher am Rande. Die Reise eines Sondergesandten nach Kiew, Moskau und Europa verlief im Sande – auch wegen seiner prorussischen Haltung. Ministerpräsident Li Qiang war zwar zeitgleich mit Selenskyj beim Weltwirtschaftsforum in Davos, kam aber trotz Bemühungen der ukrainischen Seite nicht mit dem Präsidenten zusammen.
Xi und Selenskyj haben seit Beginn der Invasion vor fast zwei Jahren ein einziges Mal miteinander gesprochen, und zwar im April 2023. Xi sagte damals, Gespräche seien “der einzige gangbare Weg aus der Ukraine-Krise”. Das Wort “Krieg” verwendet China aus Loyalität mit Russland nicht. Selenskyjs Friedensplan verlangt einen vollständigen Rückzug der Russen aus den besetzten Gebieten der Ukraine. ck
China hat nach eigenen Angaben ein riesiges Lithiumvorkommen entdeckt. Das berichtete Xinhua am Donnerstag. Nach Angaben des Ministeriums für natürliche Ressourcen seien etwa eine Million Tonnen des Alkalimetalls, das auch als “das neue Öl” oder “weißes Gold” bezeichnet wird, im Kreis Yajiang in der Provinz Sichuan gefunden wurde.
Lithium ist ein Schlüsselmaterial für Technologien zur Erzeugung Erneuerbarer Energien und Bestandteil von Batterien, zum Beispiel für Elektroautos. Die Bekanntmachung fällt in eine Zeit, in der sich der weltweite Wettlauf um die wichtige Ressource massiv verschärft hat. cyb

Chinas Mut zum marktwirtschaftlichen Neustart 1978 war – wie wir inzwischen wissen – auch eine Reaktion auf eine listige Frage, die Reformarchitekt Deng Xiaoping Ende 1978 seinem Politbüro stellte: “Was wissen wir wirklich über die Welt da draußen? Wie weit haben wir uns von ihr entfernt? Was können wir lernen?” 45 Jahre später hält Pekings heutige Führung solche Neugier auf die Außenwelt nicht mehr für opportun. Sie lebt in ihrer Echokammer und verlangt, dass sich alle an China als Großmacht orientieren. Wer an den Reformbeginn 1978 erinnert, wird zensiert.
In jenem Jahr – der Große Vorsitzende Mao war noch keine zwei Jahre tot – musste sich das Politbüro zu einer ungewöhnlichen Marathonsitzung in der Großen Halle des Volkes versammeln. Auch Chinas Marschälle und weitere höchste Parteifunktionäre nahmen teil. Sie sollten sich den Vortrag von Vizepremier Gu Mu 谷牧 anhören, der gerade von einer dreiwöchigen Reise durch fünf Länder Westeuropas zurückgekehrt war. Mit einer Delegation von 25 Regierungsexperten vom Wasserbau bis zur Atomkraft war er losgefahren – alles im Auftrag von Deng Xiaoping, damals bereits der eigentliche Strippenzieher Chinas. Nach seiner Rückkehr berichtete Gu Mu zuerst Deng, wie “geschockt” sie über das waren, was sie sahen. Deng verlangte von ihm, das Gleiche ungeschminkt auch dem Politbüro vorzutragen.
Die denkwürdige Sitzung von Chinas Nomenklatur mit Gu Mu startete um 15:30 Uhr und endete um 23:15 Uhr. Nach den KP-Analen war es das längste und auch eines der folgenschwersten Treffen nach Maos Tod. “Mein Vater redete an diesem 30. Juni 1978 fast acht Stunden lang, antwortete auf Dutzende Fragen”, schrieb Gu Mus Sohn Liu Nianyuan im Oktober 2018 für die KP-Zeitschrift “Bainianzhao”.

Sein Vater war damals 63 Jahre alt, als er mit seiner Delegation vom 12. Mai bis 7. Juni 1978 europäische Länder bereiste, darunter Frankreich, Schweiz, Belgien, Dänemark und die Bundesrepublik Deutschland. Als erste offizielle Staatsdelegation standen ihnen alle Türen offen. Belgiens König empfing sie zur Audienz, Frankreichs Premier holte sie am Flughafen ab, Walter Scheel traf sie. Sie inspizierten 25 Großstädte und mehr als 80 Fabriken, Bergwerke, Häfen, Bauernhöfe, Universitäten und Forschungseinrichtungen. Überall standen Politiker, Konzernchefs und Fachleute bereit, ihre Fragen zu beantworten: Europa war neugierig auf die “neuen” Chinesen nach Mao und diese wollten alles über Europas Gesellschaft und Industrie wissen, über die sie “ideologisch so falsch informiert” waren.
Für Gu Mu war es seine erste Europareise. “Sie brachte mein Weltbild vom Westen ins Wanken”, sagte er später. Was er dem Politbüro in acht Stunden erzählte, “verblüffte” auch Chinas Führer. “Es waren Nachrichten wie von einem anderen Stern”, schrieb Sohn Liu. Der 80-jährige Nie Rongzhen, einer der mächtigen Marschälle Chinas, lud anderntags Gu Mu zur Fortsetzung ein. Er fragte ihn sechs Stunden lang aus. Danach sagte Nie: “Was ihr erfahren habt, das darf bei uns künftig nicht zerredet werden.”
Dengs Kalkül ging auf. Chinas Wirtschaft und Gesellschaft waren nach Maos Herrschaft am Ende. Deng hatte von Anfang an gehofft, dass Gu Mus Berichte wie ein “heilsamer Schock” seine Mitstreiter aufrütteln würden. Ende April, vor Gu Mus Abfahrt, hatte er sich bereits mit ihm und der Delegation getroffen. Deng forderte sie auf, sich intensiv und ohne Scheuklappen mit allen, die sie treffen würden, auszutauschen. Sie sollten Europa intensiv erkunden, gute wie schlechte Erfahrungen beachten und mitkriegen, wie modernisiert Europas Wirtschaft ist, wie sie gemanagt wird und was China von den kapitalistischen Ländern lernen kann. Gus Sohn schrieb, dass Deng zu seinem Vater sagte: “Versucht zu verstehen, was das für eine Welt da draußen ist.”
2004 enthüllte eine von der Partei herausgegebene zweibändige Biografie über Deng Xiaoping seine Treffen mit Gu Mu vor und nach dessen Europareise. Als er zurückkam, forderte ihn Deng auf, vor einer Sondersitzung des Politbüros zu sprechen. Er dürfe dort auch verkünden, dass China bereit sei, vom Westen zu importieren und dafür auch Anleihen aus dem Ausland aufnehmen würde.
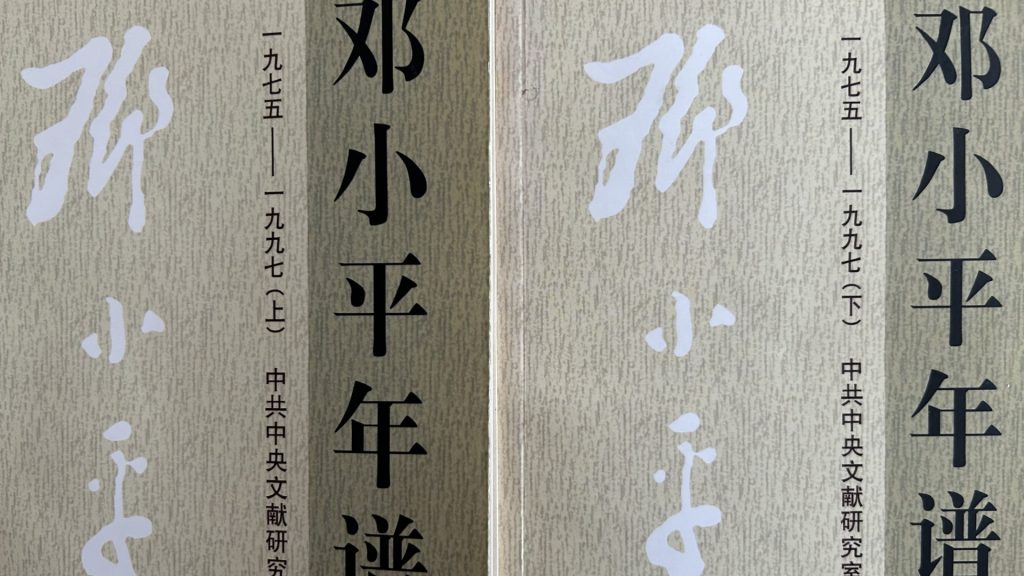
Der renommierte China-Experte und Deng Xiaoping-Biograf Eszra Vogel nannte als erster in seinem Buch “Deng Xiaoping and the Transformation of China” (Harvard 2011) die Europareise Gu Mus einen der “drei Wendepunkte” für Dengs Entschluss und Hinwendung zur radikalen Reform und Öffnung Chinas.
Gu Mu schrieb alle Erfahrungen seiner Delegation in einem 15.000 Schriftzeichen langen Bericht auf und sprach dort Klartext: “Unser derzeitiges wirtschaftliches und technologisches Niveau liegt zwanzig Jahre hinter dem der entwickelten kapitalistischen Länder zurück. Bei der Pro-Kopf-Produktionsleistung ist die Kluft noch größer.”
Das damalige Geheimpapier wurde zu einem der Grundlagendokumente, die auf der Dritten Plenarsitzung der Partei Ende Dezember 1978 verteilt wurden, zu der Deng das Zentralkomitee zusammenrief. Das historische einwöchige Treffen stellte die Weichen für den Beginn der Reform- und Öffnungspolitik. Das ZK einigte sich auch auf die Voraussetzung, dass China die Hindernisse seines ideologisierten Überbaus, Dogmatismus und Bürokratie überwinden müsse, wenn es seine Wirtschaft wieder aufbauen und marktwirtschaftlich erneuern wolle.
Gu Mus Inspektionsbericht (关于访问欧洲五国的情况报告) wurde eine der Vorgaben dafür. Er ist heute noch eine zeitgeschichtliche Fundgrube und wurde erst nach vier Jahrzehnten zugänglich gemacht. Eine amtliche Kantoner Webseite veröffentlichte den Bericht im Juni 2021 als eines von 100 Dokumenten, die in der 100-jährigen Geschichte der Partei (1921-2021) eine besondere Rolle spielten. Ich fand den Link dazu im Netz.
Die legendären Reformbeschlüsse, zu denen sich das Dritte Plenum von 1978 durchrang, wecken heute erneut Hoffnungen auf das noch ausstehende, zeitlich überfällige Dritte Plenum des 20. Parteitags unter Xi Jinpings Herrschaft. Mit der Losung “Die Wahrheit in den Tatsachen suchen” war es Deng Xiaoping 1978 gelungen, über die Schatten des Despoten Mao zu springen. Heute, nach 45 Jahren, erlaubt Xi, der wiederholt von der Überlegenheit des sozialistischen Systems spricht, nicht, daran zu erinnern. Vergangenen Dezember ließ Peking ein anspielungsreiches Editorial der Pekinger Monatszeitschrift Caixin zensieren.
Das Magazin hatte für Chinas erneute Rückbesinnung auf ein “auf der Realität basierendes Denken” plädiert, so wie es Deng auf dem 3. Plenum 1978 durchsetzte. Er “befreite” das Denken, “solche Fragen zu stellen, die zu stellen sich zuvor niemand traute.”
Bewusst auf die heutige Lage anspielend, schrieb Caixin, was passiert, wenn Bürokratismus und Dogmatismus die Politik bestimmen: “Dann traut sich niemand zu sagen, was nicht von oben vorgesagt wird. Zu denken, was nicht in den Dokumenten vorgegeben wird. Etwas zu tun, was die Führer nicht vorab arrangieren.” (上级没有说的,不敢说; 文件没有提的,不敢想; 领导没有安排的,不敢做.)
Gu Mus Rolle ist heute in Vergessenheit geraten. “Wenn wir Deng einen Chefarchitekten für die Reformen und Öffnung nennen, war Gu Mu der Architekt für Chinas erste vier Sonderwirtschaftszonen (SEZ)”, so erinnerte Hongkongs South China Morning Post 2009 an Gu Mu, als er in jenem Jahr starb. Deng hatte ihm die Federführung für die im Juli 1979 erfolgte Gründung der vier SEZ übertragen, darunter auch das berühmte Shenzhen. Heute wird Shenzhen als Verdienst dem Vater von Xi Jinping zugeschrieben.
Gu Mu verhandelte erfolgreich Pekings erste Auslandsanleihe aus Japan und arrangierte mit Deng Chinas Beitritt zur Weltbank 1980. Der frühere Weltbank- Chinachef Pierre Bottelier beschreibt das in seinem im Januar erschienenen Buch “Why and How the People’s Republic of China Entered the World Bank in 1980 and Afterthoughts.”
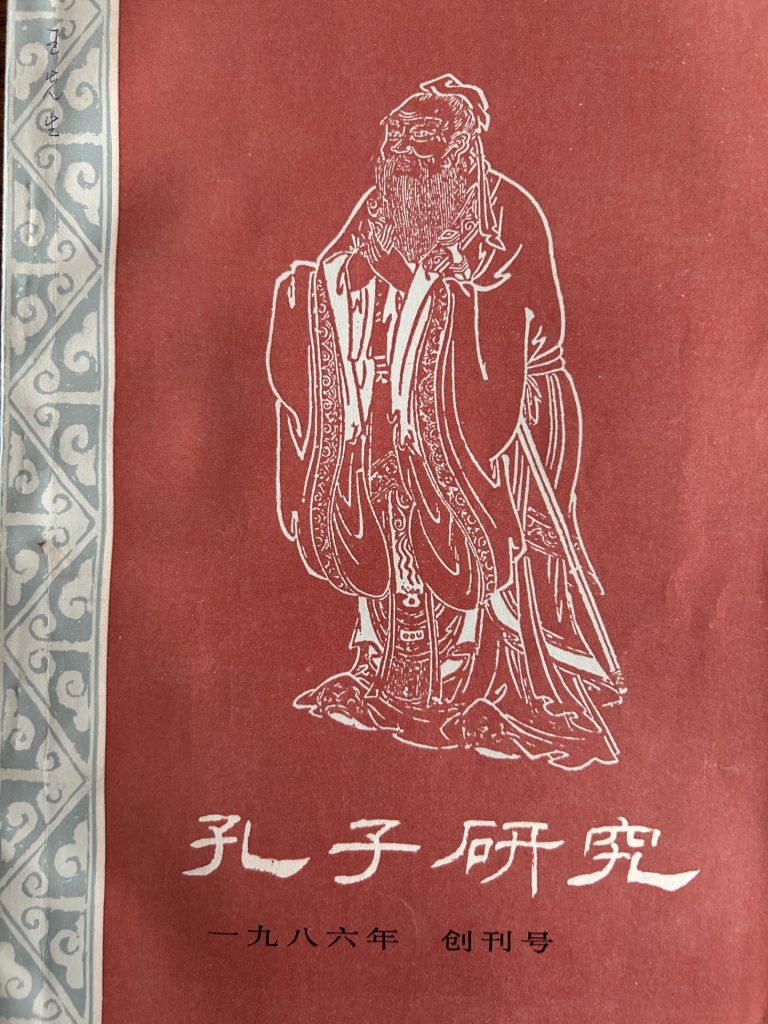
Dengs Motto “Die Wahrheit in den Tatsachen suchen” übernahm Gu Mu auch für andere Bereiche als die Wirtschaft. Gegen innerparteilichen Widerstand setze er sich für die Rehabilitierung von Chinas Nationalheiligen Konfuzius ein, der zu einem China der Reformen gehöre, schrieb er im Geleitwort für die 1986 erschienene erste Ausgabe der Vierteljahres-Zeitschrift “Konfuzius-Forschung”. Danach dauerte es noch acht Jahre, bis im Oktober 1994 in China der Internationale Konfuziusverband gegründet wurde. Gu Mu wurde sein erster Präsident und spricht sich im Grußwort für die Förderung des “kulturellen Pluralismus als notwendigen Trend aus.” Seinen Freund, Singapurs Präsidenten Lee Kuanyew, gewann er als Ehrenvorsitzenden.
Heute betont und interpretiert Peking dagegen etwas ganz Anderes; seine Rückbesinnung auf Tradition, Kultur und auf Konfuzius als Alleinstellungsmerkmale für Xi Jinpings neue China-zentrierte “Initiative für eine globale Zivilisation.” Auch das sind Nachrichten von einem anderen Stern.
Susan Chan ist bei Blackrock zur Leiterin der Asien-Pazifik-Region befördert worden. Chan war zuvor stellvertretende Leiterin der Asien-Pazifik-Region sowie von Greater China. Sie tritt die Nachfolge von Rachel Lord an.
Hua Fan übernimmt die Leitung der China-Sparte von Blackrock, nachdem sie zuletzt als General Managerin des Wealth Management-Joint Ventures zwischen Blackrock und der China Construction Bank tätig war. Beide Ernennungen folgten auf die Beförderung von Hamish MacDonald zum Head of Asia Pacific Real Estate Equity.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

“He Cha – Tee trinken” ist ein chinesischer Euphemismus für eine Vorladung auf die Polizeistation. Das Büro für öffentliche Sicherheit der Stadt Suzhou hat sich den Satz offenbar besonders zu Herzen genommen. Diesen Monat eröffnete es ein eigenes Milchtee-Café in einer Polizeistation. Das Jǐngchá 警茶, ein Wortspiel aus den Schriftzeichen für Polizei und Tee, setzt vor allem auf die Außenwirkung, der Öffentlichkeit ist es bislang nicht zugänglich. Das Konzept scheint trotzdem aufzugehen: Das Merchandise rund um den Shop, vom Becher bis zum Beutel, ist in Chinas Social-Media-Sphäre überall präsent. Die Milchtee-Cops aus Suzhou sind übrigens nicht die einzigen Staatsdiener, die sich der Café-verrückten Mittelschicht des Landes anbiedern. 2022 eröffnete die staatliche Post mehrere Cafés in der Provinz Fujian.
nur elf Tage, dann geht das Gas aus: Im Falle einer Seeblockade wäre das Szenario für Taiwan düster. Denn die Insel ist abhängig von fossilen Brennstoffen, die aus dem Ausland kommen. Mehr als 97 Prozent der benötigten Energie werden importiert.
Sich unabhängig machen durch Erneuerbare Energien könnte eine Lösung sein, die zudem gut fürs Klima wäre. Doch Experten dämpfen diese Hoffnung. Denn allein mit Solar- und Windkraft lässt sich der Energiebedarf von Industrie und Bewohnern nicht decken. Atomkraft wäre eine Option, aber Taiwan steht kurz vor dem Ausstieg, und die Gegnerschaft ist ähnlich vehement wie hierzulande in Deutschland. Maximilian Arnhold zeichnet ein Bild von Abhängigkeiten und Chancen.
Ägypten, Tunesien, Elfenbeinküste, Togo – das Reisejahr begann für Chinas Außenminister traditionell in Afrika. Dieses Jahr standen für Wang Yi Küstenländer des Kontinents im Fokus, die mit ihren großen Häfen eine wichtige Rolle für die Neue Seidenstraße spielen. Aber natürlich hat die Wahl dieser Reiseziele auch vielfältige geopolitische Hintergründe, wie Fabian Peltsch in seiner Analyse darlegt.
Ägypten steht als neues Brics-Mitglied zum zweiten Mal in Folge auf dem Reiseplan, sein Suez-Kanal mit einem Cluster dort angesiedelter chinesischer Unternehmen dürfte es auf Wang Yis Prioritätenliste nach oben befördert haben. In Tunesien wiederum profitiert Peking von Spannungen des Landes mit der EU. Côte d’Ivoire und Togo sind wichtige Tore nach Afrika. Eine anti-westliche-Stimmung herrscht in vielen dieser Länder. Auch das spielt Wang in die Karten.
“Was wissen wir wirklich über die Welt da draußen? Wie weit haben wir uns von ihr entfernt?” Diese Fragen stellte Deng Xiaoping 1978 seinem Politbüro. Wohl wissend, dass nach Maos ideologischer Herrschaft und angesichts der schlechten Wirtschaftslage ein Umbruch hermusste. Um die Partei-Elite zu Reformen zu bewegen, schickte Deng Xiaoping seinen Vizepremier Gu Mu nach Europa. Dieser sollte auskundschaften, wie es um Länder wie Frankreich und Deutschland wirklich stand. Der Realitäts-Check ermöglichte Chinas rasanten Aufstieg. Johnny Erling beschreibt die Geschehnisse und zieht Parallelen zur Gegenwart.
Ich wünsche Ihnen einen guten Start ins Wochenende!


Wang Yi hat seine knapp einwöchige Afrika-Reise beendet. Der chinesische Außenminister besuchte Ägypten, Tunesien, Togo und Côte d’Ivoire. Warum gerade diese Länder auf dem Plan standen, wurde von offizieller Seite wie immer nicht kommentiert. Es gibt jedoch einige Anhaltspunkte, warum nach den Besuchen von Wangs geschasstem Vorgänger Qin Gang in Äthiopien, Gabun, Angola, Benin und Ägypten im vergangenen Jahr nun das frankophone Westafrika und die Mittelmeerküste des Kontinents im Fokus standen.
“Afrika ist der Ort, an dem sich derzeit viele Herausforderungen im Zusammenhang mit der Belt and Road Initiative bündeln, vor allem im Zusammenhang mit Schuldenproblemen”, sagt Lauren Johnston, Associate Professor am Zentrum für Chinastudien der Universität Sydney. Auch deshalb besuchte Wang dieses Mal vor allem Länder, deren Wirtschaft von ihren Häfen stark beeinflusst wird, sagt die Wissenschaftlerin mit einem Schwerpunkt auf China-Afrika-Beziehungen. China gehe es um Fragen der Handelsumlenkung sowie der regionalen Integration und Handelskonnektivität.
Ägypten – das Land, das Asien, Europa und Afrika verbindet – wird für Peking strategisch immer wichtiger. Zum zweiten Mal in Folge stand es auf der Liste der ersten Auslandsreise des Jahres, die den chinesischen Außenminister traditionell nach Afrika führt. Das dürfte zum einen an seinem neuen Status als Brics-Land liegen, zum anderen an seiner Rolle innerhalb der Belt and Road-Initiative: Ägyptens Suezkanal ist ein wichtiger Transitpunkt für Chinas BRI. Hunderte chinesische Unternehmen haben sich in der 455 Quadratkilometer großen Suez Canal Economic Zone angesiedelt.
China ist schon jetzt der größte Handelspartner Ägyptens, wenn auch mit einem Handelsdefizit von 9,6 Milliarden Dollar im Jahr 2022. Chinesische Investitionen stiegen hier zwischen 2017 und 2022 um gigantische 317 Prozent an. Mit einem Volumen von acht Milliarden US-Dollar ist China viertgrößter Gläubiger Ägyptens.
Zum anderen hat das nordafrikanische Land eine besondere Bedeutung bei der Bewältigung aktueller Krisen im Nahen Osten. Bereits im Oktober 2023 lobte Xi Jinping die konstruktive Rolle Ägyptens in der Region. Auch Peking leidet unter den militanten Huthi im Jemen, die wichtige Schifffahrtsrouten zwischen Asien und Europa attackieren. Die chinesische Regierung hat jedoch kein Interesse daran, dass sich die Präsenz westlicher Kriegsschiffe dort weiter erhöht. Es müsse vermieden werden, “Öl ins Feuer der Spannungen am Roten Meer zu gießen”, erklärte Wang vor Journalisten in Kairo.
China positionierte sich in Ägypten außerdem einmal mehr als Sprecher des globalen Südens, indem es sich als Vermittler in der Gaza-Krise anbot. Zusammen mit Ägypten fordere China “einen sofortigen und umfassenden Waffenstillstand sowie ein Ende der Angriffe auf Zivilisten”, sagte Wang in Kairo und rief abermals zur Einberufung einer internationalen Friedenskonferenz auf, bei der ein konkreter Zeit- und Fahrplan für die Umsetzung der Zwei-Staaten-Lösung aufgesetzt werden soll.
Tunesien ist einer der ältesten Partner der Volksrepublik auf dem Kontinent. Zeitgleich mit Wangs Besuch feierten die beiden Länder 60 Jahre diplomatische Beziehungen. Tunesien ist seit 2018 Teil von Pekings Neuer Seidenstraße. Obwohl die wirtschaftlichen Beziehungen zu dem hochverschuldeten Land bislang wenig ausgebaut sind, versucht Peking hier eine Nische zu besetzen, die durch Spannungen zwischen dem frankophonen Land und der EU entstanden ist.
Tunesien ist eines der Haupttransitländer für Flüchtlinge aus Afrika. Das gibt dem Land enorme Verhandlungsmacht gegenüber der EU. Im Winter wies Tunis Hilfszahlungen aus Brüssel, die unter anderem an die Bekämpfung der Migration übers Mittelmeer gekoppelt waren, als “respektlose Gefälligkeiten” zurück. Die ehemalige Kolonialmacht Frankreich investiert jährlich etwa zwei Milliarden US-Dollar in das nordafrikanische Land. Seit dem Ausbruch des Gaza-Konflikts wächst dort jedoch die anti-europäische und vor allem anti-französische Stimmung.
Wang betonte in Tunis, dass China Tunesien bei der Wahrung seiner “souveränen Unabhängigkeit und nationalen Würde nachdrücklich unterstützt”. Tunesiens 2019 gewählter, als autoritär geltender Präsident erklärte laut Berichten chinesischer Staatsmedien, dass Tunesien mithilfe Chinas die “Modernisierung tunesischer Prägung” vorantreiben wolle. Bislang beschränkte sich die chinesische Hilfe auf einige ausgewählte Projekte, etwa den Bau des Melegue-Damms bei El Kef. Ein neues Abkommen mit der chinesischen Agentur für internationale Zusammenarbeit und Entwicklung soll nun weitere Projekte in den Bereichen Gesundheit, erneuerbare Energien und Kommunikationstechnologie in Angriff nehmen.
Auch beim Tourismus wollen die Länder zusammenwachsen. Im Oktober 2023 hatte Tunesien die Visumpflicht für chinesische Touristen aufgehoben. Der Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor des Landes. Er macht rund sieben Prozent des Bruttoinlandsproduktes aus.
Die Elfenbeinküste und Togo sind weitere “Tore nach Afrika”, die China nicht nur offenhalten, sondern kontinuierlich weiter öffnen will. Die Elfenbeinküste ist Sitz der Afrikanischen Entwicklungsbank (AfDB), der bedeutendsten Finanzinstitution Afrikas. Knapp 15 Prozent des Handels der Elfenbeinküste entfällt auf China. Die chinesischen Investitionen beliefen sich bis 2023 auf 7,5 Milliarden Dollar.
So wurde etwa der Ausbau des Hafens von Abidjan zu einer Tiefwasseranlage zu großen Teilen von Chinas Exim-Bank finanziert. Zudem wurde eine Kooperationsvereinbarung mit der chinesischen Hafenbehörde von Guangzhou unterzeichnet. Eine enorme Stärkung der BRI: Angesichts des steigenden Frachtverkehrs in Westafrika können von hier aus auch benachbarte Länder wie Mali, Burkina Faso und Niger, die keinen Zugang zum Meer haben, stärker in den Handel mit China eingebunden werden.
Auch in Togo, einem der ärmsten Länder Afrikas, ist die chinesische Exim-Bank aktiv. 2016 gewährte sie ein Darlehen über 67 Millionen US-Dollar zur Modernisierung und Erweiterung des internationalen Flughafens Gnassingbé Eyadéma in Lomé. Auch rund um den Hafen der Hauptstadt, einer der größten in Westafrika, haben sich chinesische Firmen angesiedelt. Togos Plan, den Bergbausektor bis 2025 zu verdoppeln, zieht weitere chinesische Unternehmen an.
Den Chinesen kommt auch hier zugute, dass in Togo anti-westliche Stimmung herrscht. Viele fühlen sich von den ehemaligen Kolonialmächten ausgebeutet und im Stich gelassen. Dabei hatte die Europäische Union Togo erst im April 2023 in einem Partnerschaftsabkommen 70 Millionen Euro für eine nachhaltige Landwirtschaft und den Aufbau einer sozialen Infrastruktur zugesagt. Chinas Image-Gewinn, nachdem es dem Land Importzölle erließ und 2022 beim Forum für chinesisch-afrikanische Zusammenarbeit (FOCAC) ankündigte, 17 afrikanischen Ländern die Rückzahlung 23 zinsloser Darlehen zu erlassen, war infolge der weniger belasteten Vergangenheit ungleich größer. Das 21. Jahrhundert sei ein Jahrhundert der Wiederbelebung für die Entwicklungsländer, betonte Wang im Gespräch mit Togos Präsident Faure Gnassingbé. China werde Afrika bei der Beschleunigung seiner unabhängigen Entwicklung weiter unterstützen.

Taiwans Energieversorgung hängt fast vollständig von fossilen Brennstoffen ab: mehr als 97 Prozent des Energiebedarfs werden importiert. Und diese Brennstoffe – Kohle, Öl und Gas – muss Taiwan als Inselstaat auf dem Seeweg über die Taiwanstraße einführen. Das verstärkt nach dem Sieg des China-kritischen William Lai von der Demokratischen Fortschrittspartei (DPP) bei den Präsidentschaftswahlen die Sorge vor Reaktionen aus Peking. Denn eine Seeblockade wäre fatal.
Nach Ansicht von Experten ist Taiwan deswegen sehr anfällig für Störungen. Die Energiebehörde, Teil des Wirtschaftsministeriums, hat berechnet, dass die Erdgas-Vorräte derzeit nur für elf Tage und die Kohle-Vorräte für 39 Tage reichen. Genug Öl gäbe es für 146 Tage. Schon die bisherige DPP-Regierung von Präsidentin Tsai Ing-wen wollte daher die grüne Energie deutlich ausbauen, hat aber ihre selbstgesteckten Ziele nicht erreicht. Nun ist Nachfolger Lai gefragt, als Vizepräsident gehört er bereits der vorigen Regierung an.
Taiwans Strom stammt zu mehr als 80 Prozent aus fossilen Brennstoffen. 2022 importierte Taiwan 63,6 Millionen Tonnen Kohle, vor allem aus Australien und Indonesien. Beträchtliche Mengen an Kohle und Gas stammen laut statistischem Jahrbuch zudem aus Russland und damit aus einem Staat, der im Falle einer akuten Krise und möglichen Blockade wohl zu China halten würde.
“Bereits Chinas Marineübungen rund um Taiwan könnten die Versorgungslinien für einen begrenzten Zeitraum beeinträchtigen oder abschneiden”, schreibt Eugene Chausovsky, Analyst vom US-Thinktank New Lines Institute, im Magazin “Foreign Policy”. Selbst eine begrenzte Blockade der Taiwanstraße könnte laut Chausovsky für die Insel verheerend sein.
Der wachsende Energiehunger dürfte die Lage noch verschärfen. Die wichtige Chip-Industrie Taiwans klagt schon jetzt über Netzausfälle. Das größte Halbleiterunternehmen TSMC verschlingt allein mehr als sechs Prozent des Gesamtenergieverbrauchs des Landes.
Fraglich bleibt dennoch, ob Grünstrom allein der Ausweg aus der fossilen Abhängigkeit und ihrem geopolitischen Bedrohungspotenzial sein kann. Der Ausbau von Solar- und Windkraft hinkt den angepeilten Zielen hinterher. Eigentlich sollte der Anteil der Erneuerbaren am Strommix bis 2025 auf 20 Prozent steigen. Einem Bericht des Wirtschaftsministeriums zufolge dürften bis dahin aber nur gut 15 Prozent des Stroms regenerativ erzeugt werden. Ende 2023 waren erst 8,9 Prozent erreicht.
Gründe für die schleppende Energiewende gibt es viele. Gebiete für Windräder oder Solaranlagen sind umkämpft. Mal stehen Bedenken von Fischern, mal die Umweltrisiken von Windanlagen im Meer im Weg. An Land sind es meist Konflikte um Agrarflächen, die den Ausbau der Freiland-Photovoltaik verhindern – zum Beispiel der Gebietsanspruch Indigener, die vor Projektstart nicht gefragt worden waren.
Laut Energieberater Raoul Kubitschek gibt es noch weitere Hürden für eine Trendwende: “Ein zu niedriger Strompreis und schlecht isolierte, stark klimatisierte Wohnungen.” Manch ausländischer Investor sehe zudem die Gefahr einer möglichen chinesischen Attacke.
Kubitschek leitet das Taipeh-Büro von Niras, einer Ingenieursfirma, die ausländischen Energieunternehmen hilft, in Taiwan zu investieren. “100 Prozent Erneuerbare sind unter Taiwans Voraussetzungen nicht realistisch“, sagt er. Taiwan habe zwar an der Taiwanstraße sehr gute Windbedingungen für Offshore-Windanlagen, es seien bereits Genehmigungen über 5,5 Gigawatt Kapazität erteilt. Allein mit On- und Offshore-Wind und Solarkraft sei die Versorgung aber nicht zu machen, sagt Kubitschek. “Es geht darum, eine Grundversorgung herzustellen. Also müssen weiter Gaskraftwerke benutzt werden.”
Die Halbleiterbranche plädiert dafür, auch auf Atomkraft zu setzen. Zwar ist der Ausstieg bis 2025 beschlossene Sache. Kernenergie macht noch 6,3 Prozent der Stromerzeugung aus. Die China-freundlichere Nationalpartei KMT warb im Wahlkampf jedoch für den Bau neuer AKWs, um den Energiebedarf des Landes zu decken.
Die Regierungspartei DPP dagegen erteilt dem eine Absage. Auch Brennstäbe müssten wieder aus dem Ausland importiert werden, heißt es. Für die unabhängige Energieversorgung wäre also nichts gewonnen. Und auch in Taiwan ist die Endlagerfrage ungeklärt. Kubitschek glaubt, dass der Atomausstieg ohnehin nicht mehr rückgängig zu machen sei. Provinzpolitiker würden den Bau neuer AKWs nicht zulassen.
Am Ende bleibt Taiwan nur, doch alle Anstrengungen in Erneuerbare zu investieren. Denn die Wirtschaft gerät auch indirekt zunehmend unter Druck. Zwar ist Taiwan auf Betreiben Chinas nicht Teil internationaler Klimaverträge, weil es von den Vereinten Nationen nicht als eigener Staat anerkannt ist. Doch westliche Unternehmen wollen ihre Lieferketten mit Ökostrom versorgt sehen, das gilt auch für Taiwan. Zum Beispiel fordert Apple seine Zulieferer auf, bis 2030 klimaneutral zu sein. Als wichtiger Chip-Abnehmer erhöhe Apple damit durchaus den Transformationsdruck auf die Industrie, sagt Kubitschek. Hoffnung macht dem Firmenberater, dass die Taiwaner “aus Fehlern lernen”, wie etwa bei vergangenen Ausschreibungen. Im Netzausbau gebe es viel Potenzial, ebenso im Bereich Offshore-Wind.
Die Recherche für diesen Artikel fand im Rahmen einer Pressereise von Journalists.Network e.V. nach Taiwan statt.
23.01.2024, 10:00 Uhr (17:00 Uhr Beijing time)
Deutsch-chinesische Wirtschaftsvereinigung, Webinar: China 2024: Rechtliche Änderungen im Jahr des Drachen Mehr
23.01.2024, 19:30 Uhr
Konfuzius-Institut Trier, Vortrag: Nadine Godehardt: Chinas geopolitischer Code. Warum die Welt chinesischer wird Mehr
24.01.2024, 15:00 Uhr Beijing time
AHK Greater China, Press Conference & Launch Event: Business Confidence Survey Report 2023/24 Mehr
25.01.2024, 09:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)
EU SME Centre, Hybrid Workshop: Unlocking AI Business Opportunities in China: Meet Start-up & SME AI Innovators Mehr
25.01.2024, 09:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)
Dezan Shira & Associates, Webinar: 2024 China Overview: Planning for Compliance and Tax Optimization Mehr
25.01.2024, 11:00 Uhr (18:00 Uhr Beijing time)
Kiel Institute China Initiative, Global China Conversations: Aussichten für die chinesische Wirtschaft: Kurzfristige Herausforderungen oder fundamentale Verlangsamung? Mehr
26.01.2024, 18:00 Uhr (27.01., 01:00 Uhr Beijing time)
Konfuzius-Institut Frankfurt, Vortrag (hybrid): Bernhard Weßling: Mein Sprung ins kalte Wasser – Mit offenen Augen und Ohren in China leben und arbeiten Mehr
30.01.2024, 10:00 Uhr
Mercator Institute for China Studies (MERICS), Workshop: Zwischen Kooperation und Wettbewerb – China und andere asiatisch-pazifische Akteure in Klimaschutz, Neuer Mobilität, Umwelt- und Energietechnologien Mehr
Der chinesische BMW-Partner Brilliance Automotive plant keinen Ausstieg aus dem Gemeinschaftsunternehmen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf ein ihr vorliegendes Dokument. Der Münchner Autobauer hält an dem Joint Venture BMW Brilliance Automotive (BBA) 75 Prozent, der Rest liegt bei Brilliance China Automotive. BMW lehnte eine Stellungnahme ab.
Brilliance China Automotive steckt aktuell in einer Umstrukturierung und benötigt frisches Kapital. Am Montag hatte die Agentur Bloomberg berichtet, dass mehrere chinesische Autobauer in Vorgespräche über den Verkauf der Anteile involviert seien. Eine Entscheidung sei aber noch nicht getroffen.
Nach der Restrukturierung von Brilliance werde Shenyang Automotive – das Investmentvehikel der Stadt Shenyang, Standort des Joint Ventures – indirekt mit rund 30 Prozent dessen größter Anteilseigner, heißt es in dem Reuters vorliegenden Dokument. Weitere knapp zwölf Prozent liegen demnach bei der Provinz Liaoning, der Rest bei Fondsgesellschaften und im Streubesitz. rtr/jul
Wenige Tage nach der Präsidentschaftswahl in Taiwan hat China innerhalb von 24 Stunden 24 Kampfflugzeuge und fünf Marineschiffe in Richtung der Insel geschickt. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Taipeh überquerten elf der Kampfjets die Median-Linie in der Taiwanstraße oder drangen in die südwestliche und nördliche Luftverteidigungszone (ADIZ) Taiwans ein.
Es ist die erste Machtdemonstration dieser Art seit der Wahl. Diese hatte am Wochenende der China-kritische Lai Ching-te von der DPP für sich entschieden hat. Peking sieht Taiwan als Teil Chinas und hatte massiv versucht, im Vorfeld Einfluss auf die Wahl zu nehmen – auch durch militärische Einschüchterungsversuche. rtr
Der taiwanische Halbleiter-Hersteller TSMC hat im Schlussquartal 2023 einen Gewinnrückgang verbucht – allerdings fiel der weniger schlimm aus als befürchtet. Das Unternehmen teilte am Donnerstag mit, der Überschuss sei um 19 Prozent auf umgerechnet 6,9 Milliarden Euro geschrumpft. Analysten hatten nur 6,6 Milliarden Euro Überschuss erwartet. Der Umsatz des wertvollsten asiatischen börsennotierten Unternehmens ging wie erwartet um 1,5 Prozent auf 18 Milliarden Euro zurück.
Für das gerade angelaufene Quartal stellte der Konzern Erlöse von 16,5 bis 17,2 Milliarden Euro in Aussicht. Das wöre ein ordentlicher Zuwachs, denn im Vorjahreszeitraum waren es nur 15,3 Milliarden Euro gewesen. Die operative Gewinnmarge werde mit voraussichtlich 40 bis 42 Prozent auf dem Niveau des abgelaufenen Quartals liegen. Für das Gesamtjahr 2024 könne dank der anhaltenden Nachfrage nach Spezialchips für Künstliche Intelligenz (KI) mit “gesundem” Umsatzwachstum um die 25 Prozent gerechnet werden, teilte TSMC mit. rtr
Die Ukraine versucht, einen direkten Gesprächskanal zwischen Präsident Wolodymyr Selenskyj und Xi Jinping zu organisieren. Das sagte Außenminister Dmytro Kuleba am Donnerstag in einem Interview mit Bloomberg in Davos: “Es gibt Dinge, über die sie reden können”. Dazu gehören vor allem die Pläne Selenskyjs, noch in diesem Jahr eine hochrangig besetzte Friedenskonferenz in der Schweiz abzuhalten. Diese hatte der ukrainische Präsident am Montag bei einem Treffen nahe Bern mit der Schweizer Präsidentin Viola Amherd angekündigt.
Die Anwesenheit Chinas wäre für die Relevanz einer solchen Konferenz durchaus wichtig. China müsse in Gespräche mit Russland zur Beendigung des Krieges einbezogen werden, sagte Selenskyjs Stabschef Andrij Yermak am Wochenende in Davos nach einem Treffen von Sicherheitsbeamten aus mehr als 80 Ländern. Sie hatten mit Vertretern Kiews über Selenskyjs Friedensplan diskutiert. “China spielt eine wichtige Rolle. Wir müssen Wege finden, um mit China zusammenzuarbeiten”, sagte auch der Schweizer Außenminister Ignazio Cassis, der an dem Treffen teilnahm.
China steht allerdings bisher eher am Rande. Die Reise eines Sondergesandten nach Kiew, Moskau und Europa verlief im Sande – auch wegen seiner prorussischen Haltung. Ministerpräsident Li Qiang war zwar zeitgleich mit Selenskyj beim Weltwirtschaftsforum in Davos, kam aber trotz Bemühungen der ukrainischen Seite nicht mit dem Präsidenten zusammen.
Xi und Selenskyj haben seit Beginn der Invasion vor fast zwei Jahren ein einziges Mal miteinander gesprochen, und zwar im April 2023. Xi sagte damals, Gespräche seien “der einzige gangbare Weg aus der Ukraine-Krise”. Das Wort “Krieg” verwendet China aus Loyalität mit Russland nicht. Selenskyjs Friedensplan verlangt einen vollständigen Rückzug der Russen aus den besetzten Gebieten der Ukraine. ck
China hat nach eigenen Angaben ein riesiges Lithiumvorkommen entdeckt. Das berichtete Xinhua am Donnerstag. Nach Angaben des Ministeriums für natürliche Ressourcen seien etwa eine Million Tonnen des Alkalimetalls, das auch als “das neue Öl” oder “weißes Gold” bezeichnet wird, im Kreis Yajiang in der Provinz Sichuan gefunden wurde.
Lithium ist ein Schlüsselmaterial für Technologien zur Erzeugung Erneuerbarer Energien und Bestandteil von Batterien, zum Beispiel für Elektroautos. Die Bekanntmachung fällt in eine Zeit, in der sich der weltweite Wettlauf um die wichtige Ressource massiv verschärft hat. cyb

Chinas Mut zum marktwirtschaftlichen Neustart 1978 war – wie wir inzwischen wissen – auch eine Reaktion auf eine listige Frage, die Reformarchitekt Deng Xiaoping Ende 1978 seinem Politbüro stellte: “Was wissen wir wirklich über die Welt da draußen? Wie weit haben wir uns von ihr entfernt? Was können wir lernen?” 45 Jahre später hält Pekings heutige Führung solche Neugier auf die Außenwelt nicht mehr für opportun. Sie lebt in ihrer Echokammer und verlangt, dass sich alle an China als Großmacht orientieren. Wer an den Reformbeginn 1978 erinnert, wird zensiert.
In jenem Jahr – der Große Vorsitzende Mao war noch keine zwei Jahre tot – musste sich das Politbüro zu einer ungewöhnlichen Marathonsitzung in der Großen Halle des Volkes versammeln. Auch Chinas Marschälle und weitere höchste Parteifunktionäre nahmen teil. Sie sollten sich den Vortrag von Vizepremier Gu Mu 谷牧 anhören, der gerade von einer dreiwöchigen Reise durch fünf Länder Westeuropas zurückgekehrt war. Mit einer Delegation von 25 Regierungsexperten vom Wasserbau bis zur Atomkraft war er losgefahren – alles im Auftrag von Deng Xiaoping, damals bereits der eigentliche Strippenzieher Chinas. Nach seiner Rückkehr berichtete Gu Mu zuerst Deng, wie “geschockt” sie über das waren, was sie sahen. Deng verlangte von ihm, das Gleiche ungeschminkt auch dem Politbüro vorzutragen.
Die denkwürdige Sitzung von Chinas Nomenklatur mit Gu Mu startete um 15:30 Uhr und endete um 23:15 Uhr. Nach den KP-Analen war es das längste und auch eines der folgenschwersten Treffen nach Maos Tod. “Mein Vater redete an diesem 30. Juni 1978 fast acht Stunden lang, antwortete auf Dutzende Fragen”, schrieb Gu Mus Sohn Liu Nianyuan im Oktober 2018 für die KP-Zeitschrift “Bainianzhao”.

Sein Vater war damals 63 Jahre alt, als er mit seiner Delegation vom 12. Mai bis 7. Juni 1978 europäische Länder bereiste, darunter Frankreich, Schweiz, Belgien, Dänemark und die Bundesrepublik Deutschland. Als erste offizielle Staatsdelegation standen ihnen alle Türen offen. Belgiens König empfing sie zur Audienz, Frankreichs Premier holte sie am Flughafen ab, Walter Scheel traf sie. Sie inspizierten 25 Großstädte und mehr als 80 Fabriken, Bergwerke, Häfen, Bauernhöfe, Universitäten und Forschungseinrichtungen. Überall standen Politiker, Konzernchefs und Fachleute bereit, ihre Fragen zu beantworten: Europa war neugierig auf die “neuen” Chinesen nach Mao und diese wollten alles über Europas Gesellschaft und Industrie wissen, über die sie “ideologisch so falsch informiert” waren.
Für Gu Mu war es seine erste Europareise. “Sie brachte mein Weltbild vom Westen ins Wanken”, sagte er später. Was er dem Politbüro in acht Stunden erzählte, “verblüffte” auch Chinas Führer. “Es waren Nachrichten wie von einem anderen Stern”, schrieb Sohn Liu. Der 80-jährige Nie Rongzhen, einer der mächtigen Marschälle Chinas, lud anderntags Gu Mu zur Fortsetzung ein. Er fragte ihn sechs Stunden lang aus. Danach sagte Nie: “Was ihr erfahren habt, das darf bei uns künftig nicht zerredet werden.”
Dengs Kalkül ging auf. Chinas Wirtschaft und Gesellschaft waren nach Maos Herrschaft am Ende. Deng hatte von Anfang an gehofft, dass Gu Mus Berichte wie ein “heilsamer Schock” seine Mitstreiter aufrütteln würden. Ende April, vor Gu Mus Abfahrt, hatte er sich bereits mit ihm und der Delegation getroffen. Deng forderte sie auf, sich intensiv und ohne Scheuklappen mit allen, die sie treffen würden, auszutauschen. Sie sollten Europa intensiv erkunden, gute wie schlechte Erfahrungen beachten und mitkriegen, wie modernisiert Europas Wirtschaft ist, wie sie gemanagt wird und was China von den kapitalistischen Ländern lernen kann. Gus Sohn schrieb, dass Deng zu seinem Vater sagte: “Versucht zu verstehen, was das für eine Welt da draußen ist.”
2004 enthüllte eine von der Partei herausgegebene zweibändige Biografie über Deng Xiaoping seine Treffen mit Gu Mu vor und nach dessen Europareise. Als er zurückkam, forderte ihn Deng auf, vor einer Sondersitzung des Politbüros zu sprechen. Er dürfe dort auch verkünden, dass China bereit sei, vom Westen zu importieren und dafür auch Anleihen aus dem Ausland aufnehmen würde.
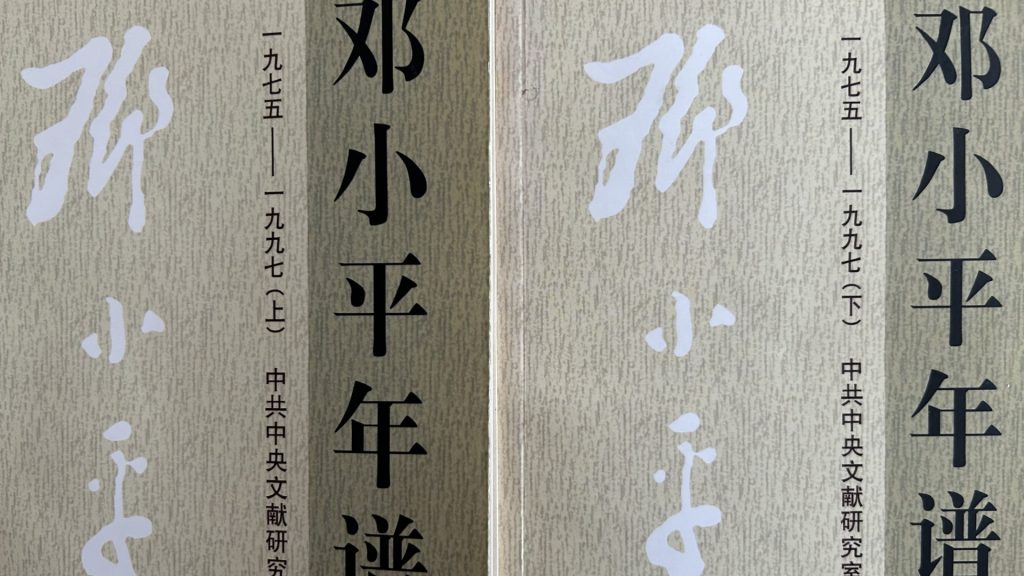
Der renommierte China-Experte und Deng Xiaoping-Biograf Eszra Vogel nannte als erster in seinem Buch “Deng Xiaoping and the Transformation of China” (Harvard 2011) die Europareise Gu Mus einen der “drei Wendepunkte” für Dengs Entschluss und Hinwendung zur radikalen Reform und Öffnung Chinas.
Gu Mu schrieb alle Erfahrungen seiner Delegation in einem 15.000 Schriftzeichen langen Bericht auf und sprach dort Klartext: “Unser derzeitiges wirtschaftliches und technologisches Niveau liegt zwanzig Jahre hinter dem der entwickelten kapitalistischen Länder zurück. Bei der Pro-Kopf-Produktionsleistung ist die Kluft noch größer.”
Das damalige Geheimpapier wurde zu einem der Grundlagendokumente, die auf der Dritten Plenarsitzung der Partei Ende Dezember 1978 verteilt wurden, zu der Deng das Zentralkomitee zusammenrief. Das historische einwöchige Treffen stellte die Weichen für den Beginn der Reform- und Öffnungspolitik. Das ZK einigte sich auch auf die Voraussetzung, dass China die Hindernisse seines ideologisierten Überbaus, Dogmatismus und Bürokratie überwinden müsse, wenn es seine Wirtschaft wieder aufbauen und marktwirtschaftlich erneuern wolle.
Gu Mus Inspektionsbericht (关于访问欧洲五国的情况报告) wurde eine der Vorgaben dafür. Er ist heute noch eine zeitgeschichtliche Fundgrube und wurde erst nach vier Jahrzehnten zugänglich gemacht. Eine amtliche Kantoner Webseite veröffentlichte den Bericht im Juni 2021 als eines von 100 Dokumenten, die in der 100-jährigen Geschichte der Partei (1921-2021) eine besondere Rolle spielten. Ich fand den Link dazu im Netz.
Die legendären Reformbeschlüsse, zu denen sich das Dritte Plenum von 1978 durchrang, wecken heute erneut Hoffnungen auf das noch ausstehende, zeitlich überfällige Dritte Plenum des 20. Parteitags unter Xi Jinpings Herrschaft. Mit der Losung “Die Wahrheit in den Tatsachen suchen” war es Deng Xiaoping 1978 gelungen, über die Schatten des Despoten Mao zu springen. Heute, nach 45 Jahren, erlaubt Xi, der wiederholt von der Überlegenheit des sozialistischen Systems spricht, nicht, daran zu erinnern. Vergangenen Dezember ließ Peking ein anspielungsreiches Editorial der Pekinger Monatszeitschrift Caixin zensieren.
Das Magazin hatte für Chinas erneute Rückbesinnung auf ein “auf der Realität basierendes Denken” plädiert, so wie es Deng auf dem 3. Plenum 1978 durchsetzte. Er “befreite” das Denken, “solche Fragen zu stellen, die zu stellen sich zuvor niemand traute.”
Bewusst auf die heutige Lage anspielend, schrieb Caixin, was passiert, wenn Bürokratismus und Dogmatismus die Politik bestimmen: “Dann traut sich niemand zu sagen, was nicht von oben vorgesagt wird. Zu denken, was nicht in den Dokumenten vorgegeben wird. Etwas zu tun, was die Führer nicht vorab arrangieren.” (上级没有说的,不敢说; 文件没有提的,不敢想; 领导没有安排的,不敢做.)
Gu Mus Rolle ist heute in Vergessenheit geraten. “Wenn wir Deng einen Chefarchitekten für die Reformen und Öffnung nennen, war Gu Mu der Architekt für Chinas erste vier Sonderwirtschaftszonen (SEZ)”, so erinnerte Hongkongs South China Morning Post 2009 an Gu Mu, als er in jenem Jahr starb. Deng hatte ihm die Federführung für die im Juli 1979 erfolgte Gründung der vier SEZ übertragen, darunter auch das berühmte Shenzhen. Heute wird Shenzhen als Verdienst dem Vater von Xi Jinping zugeschrieben.
Gu Mu verhandelte erfolgreich Pekings erste Auslandsanleihe aus Japan und arrangierte mit Deng Chinas Beitritt zur Weltbank 1980. Der frühere Weltbank- Chinachef Pierre Bottelier beschreibt das in seinem im Januar erschienenen Buch “Why and How the People’s Republic of China Entered the World Bank in 1980 and Afterthoughts.”
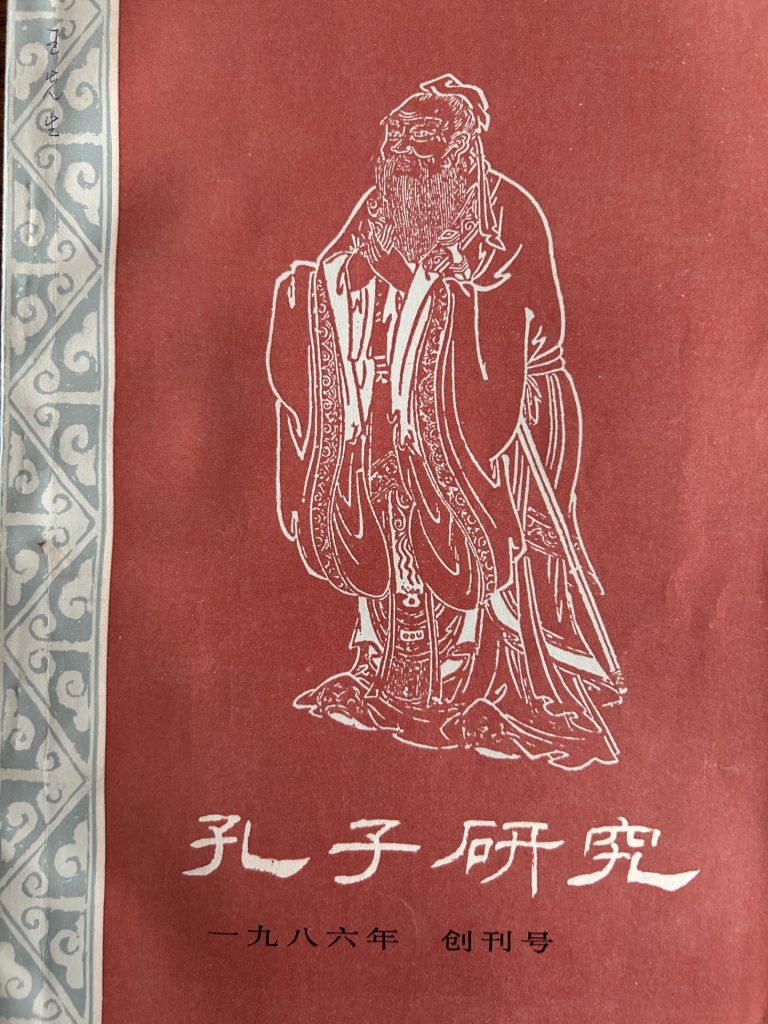
Dengs Motto “Die Wahrheit in den Tatsachen suchen” übernahm Gu Mu auch für andere Bereiche als die Wirtschaft. Gegen innerparteilichen Widerstand setze er sich für die Rehabilitierung von Chinas Nationalheiligen Konfuzius ein, der zu einem China der Reformen gehöre, schrieb er im Geleitwort für die 1986 erschienene erste Ausgabe der Vierteljahres-Zeitschrift “Konfuzius-Forschung”. Danach dauerte es noch acht Jahre, bis im Oktober 1994 in China der Internationale Konfuziusverband gegründet wurde. Gu Mu wurde sein erster Präsident und spricht sich im Grußwort für die Förderung des “kulturellen Pluralismus als notwendigen Trend aus.” Seinen Freund, Singapurs Präsidenten Lee Kuanyew, gewann er als Ehrenvorsitzenden.
Heute betont und interpretiert Peking dagegen etwas ganz Anderes; seine Rückbesinnung auf Tradition, Kultur und auf Konfuzius als Alleinstellungsmerkmale für Xi Jinpings neue China-zentrierte “Initiative für eine globale Zivilisation.” Auch das sind Nachrichten von einem anderen Stern.
Susan Chan ist bei Blackrock zur Leiterin der Asien-Pazifik-Region befördert worden. Chan war zuvor stellvertretende Leiterin der Asien-Pazifik-Region sowie von Greater China. Sie tritt die Nachfolge von Rachel Lord an.
Hua Fan übernimmt die Leitung der China-Sparte von Blackrock, nachdem sie zuletzt als General Managerin des Wealth Management-Joint Ventures zwischen Blackrock und der China Construction Bank tätig war. Beide Ernennungen folgten auf die Beförderung von Hamish MacDonald zum Head of Asia Pacific Real Estate Equity.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

“He Cha – Tee trinken” ist ein chinesischer Euphemismus für eine Vorladung auf die Polizeistation. Das Büro für öffentliche Sicherheit der Stadt Suzhou hat sich den Satz offenbar besonders zu Herzen genommen. Diesen Monat eröffnete es ein eigenes Milchtee-Café in einer Polizeistation. Das Jǐngchá 警茶, ein Wortspiel aus den Schriftzeichen für Polizei und Tee, setzt vor allem auf die Außenwirkung, der Öffentlichkeit ist es bislang nicht zugänglich. Das Konzept scheint trotzdem aufzugehen: Das Merchandise rund um den Shop, vom Becher bis zum Beutel, ist in Chinas Social-Media-Sphäre überall präsent. Die Milchtee-Cops aus Suzhou sind übrigens nicht die einzigen Staatsdiener, die sich der Café-verrückten Mittelschicht des Landes anbiedern. 2022 eröffnete die staatliche Post mehrere Cafés in der Provinz Fujian.