ausgerechnet der gute China-Freund Viktor Orbán lockerte im Frühjahr die Bedingungen für chinesische Investoren, die sich die Aussicht auf eine Aufenthaltsgenehmigung für den Schengen-Raum erkaufen wollen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Denn die EU will die Bedingungen zum Visaerhalt für chinesische Staatsbürger eigentlich erschweren. Orbán konterkariert das.
Aber zur Ehrenrettung des ungarischen Regierungschefs muss man feststellen, dass Ungarn keineswegs der einzige EU-Staat ist, der es chinesischen Staatsbürgern schmackhaft macht, in seinem Hoheitsgebiet zu investieren. Malta, Griechenland oder Portugal tun es ähnlich, schreibt Fabian Peltsch.
Der Ansatz der EU, solche Praktiken stärker zu regulieren, wäre ein Akt der Vernunft. Hat der chinesische Geheimdienst im Fall Jian G. doch bewiesen, dass er europäische Staatsbürgerschaften dazu nutzt, um seinen Spionen eine nahezu feuerfeste Tarnung anzulegen.
Derweil nimmt uns Finn Mayer-Kuckuk heute mit nach Südkorea. Unser China.Table-Ressortleiter begleitet Robert Habeck auf dessen fünftägiger Ostasienreise. In Seoul trifft der deutsche Vizekanzler und Wirtschaftsminister nicht nur Handelsminister Ahn Dukgeun, sondern auch den südkoreanischen Regierungschef Han Duck-soo. Und die Gespräche könnten interessant werden für den deutschen Vizekanzler.
Während Habeck die Abhängigkeiten von China abbauen will, ist Südkorea schon längst dabei, genau dies zu tun. Seit China das Land 2017 mit einem Handelsboykott abstrafte, weil Seoul ein Raketenabwehrsystem der USA auf seinem Terrain zuließ, sind die Südkoreaner alarmiert und verfolgen gezielt eine De-Risking-Strategie, die von China wegführt. Mit einigem Erfolg. Heute ist Südkorea sehr viel autarker vom großen Nachbarn – und damit auch politisch weniger erpressbar. Ein Vorbild für Deutschland und Europa?
Viele Erkenntnisse beim Lesen!


Der erste Stopp der Asienreise von Wirtschaftsminister Robert Habeck ist am Donnerstag die südkoreanische Hauptstadt Seoul. Von dort aus geht es weiter nach China. Die Reihenfolge hat zwar keine tiefere Bedeutung – einem früheren Reiseplan zufolge sollte es erst nach China gehen, dann nach Südkorea. Doch im Licht der deutschen China-Strategie ist Südkorea ein passender Partner, der durchaus besondere Aufmerksamkeit verdient. “Südkorea hat mit ähnlichen Herausforderungen zu kämpfen, sowohl im Bereich der Wirtschaft als auch bei den Sicherheitsrisiken”, sagte Habeck auf dem Flug nach Seoul.
Denn es ist ein erklärtes Ziel der Bundesregierung, die Abhängigkeiten von Lieferanten in China zu verringern. “Südkorea spielt eine Schlüsselrolle in Berlins und Brüssels Indopazifik-Strategien”, sagt Korea-Experte Eric Ballbach von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Es ist in mehrfacher Hinsicht ein besonders wertvoller Partner:
Als Absatzmarkt ist Südkorea zwar auch interessant, aber keine Alternative zu China. Es ist mit 51 Millionen Einwohnern nicht besonders groß. Und Koreaner kaufen gerne koreanische Waren – vor allem Autos von Hyundai.
Beeindruckend sind die Erfolge Südkoreas in der Halbleitertechnik. Deutschland hat diese mit einigen Ausnahmen fast vollständig nach Asien abwandern lassen. Südkorea hat dagegen eine der fortschrittlichsten Chip-Industrien der Welt aufgebaut. Auch wenn der taiwanische Anbieter TSMC der viel zitierte Marktführer ist, macht ihm die Chipsparte von Samsung heftig Konkurrenz. Samsung stellt einen Großteil der Prozessoren für seine fortschrittlichen Handys selbst an Standorten in Südkorea und Texas her. Europa kann vom Niveau der Samsung-Fabriken nur träumen. Dazu kommt, dass Samsung einer der bekanntesten Namen für Handys, Tablets oder Smartwatches ist.
Dabei hat Südkorea im Vergleich zu Deutschland sogar erhebliche Nachteile – Deutschland hat den EU-Binnenmarkt, Südkorea dagegen bloß unfreundliche Nachbarn. Das Land ist weder größer noch reicher als Deutschland. Tatsächlich hatte es einen späten Start als Hochtechnik-Land; erst ab den späten 1980er-Jahren ging das Wirtschaftswunder richtig los. Heute gehört Südkorea zu den Ländern mit den höchsten Ausgaben für neue Technologien. Die Fördertöpfe für Zukunftstechnik wie KI und Quantencomputing sind üppig gefüllt.
Kameras, Handys, Netztechnik – all das glaubte Deutschland nicht profitabel herstellen zu können. Doch auch Samsung baut 5G-Mobilfunknetze, die Deutschland von Huawei gekauft hat, weil es angeblich nicht anders ging.
Der China-Schock kam für Südkorea schon 2017. Das Militär hatte Stellungen für ein Raketenabwehrsystem namens THAAD errichtet. THAAD steht für Terminal High Altitude Area Defense. Offiziell dient die US-Technik der Abwehr eines nordkoreanischen Angriffs. Aus Pekinger Sicht richtet sich das hochmoderne System jedoch gegen China.
Erste Konsequenzen bekam Südkorea schon nach wenigen Tagen zu spüren. Peking heizte über die Staatsmedien den Nationalismus an und die Reaktion der Bürger ließ nicht lange auf sich warten – es gab Krawalle vor Geschäften mit südkoreanischen Marken. Die Tourismusbehörde riet von Reisen nach Südkorea ab und die Zahl der Reisen von China nach Südkorea brach ein. Auch der Einzelhandelskonzern Lotte bekam den Zorn Chinas bereits zu spüren. Lotte-Kaufhäuser im Land mussten plötzlich schließen, weil sie Opfer von Hackerangriffen wurden oder Demonstranten die Zugänge blockiert habe. Ein Neubauprojekt des Unternehmens konnte wegen plötzlicher Brandschutzbedenken der Feuerwehr nicht eröffnen.
Seitdem versucht Südkorea, seine Abhängigkeit von China zu verringern. “Die Strategie war im Grunde eine Strategie des De-Risking, lange, bevor der Begriff von Ursula von der Leyen verwendet wurde”, sagt Ballbach. Bestes Beispiel ist der Einzelhandelskonzern Lotte, dessen Kaufhäuser so unter Beschuss standen. Er zog sich letztlich vom chinesischem Markt zurück. “Damit verlor China eine zentrale Einflussflanke”, sagt Ballbach.
Südkorea hat in der Folgezeit eine Verlagerung der Lieferbeziehungen in befreundete Länder betrieben und handelt mehr mit Südostasien und den USA. Hyundai und Samsung haben mehr in Amerika investiert. Diese Vorbereitungen kamen zu tragen, als 2023 der Handel mit China infolge von US-Sanktionen, denen sich Südkorea anschloss, stark zurückging. Die Folgen gelten jetzt als verkraftbar.
Die Erfolge Südkoreas lassen sich in Deutschland jedoch nur teilweise wiederholen. Die südkoreanische Wirtschaftsstruktur ist anders als die deutsche: Während Deutschland vom Mittelstand geprägt ist, dominieren in Südkorea Großkonzerne, die sogenannten Chaebol. Zulieferern kommt dort weniger die Rolle selbstbewusster, eigenständiger Akteure zu. Sie sind vielmehr Waggons eines Zuges, dessen Lok Großkonzerne wie Samsung, LG oder Hyundai sind. Daher tauchen diese Markennamen auch so oft auf. Die Chaebol arbeiten wiederum eng mit der Regierung zusammen, um die Industriestrategie zu koordinieren.
Dennoch ließe sich etwas übertragen. “Für Deutschland gibt es dennoch viel zu lernen, insbesondere was die gezielte Förderung von Schlüsselsektoren anbelangt”, sagt Ballbach. Die jetzige Industriepolitik Südkoreas konzentriere sich auf die gezielte Förderung der Zukunftstechnologien wie KI, Biomedizin, Halbleiter und E-Mobilität. “Die alten Schlüsselindustrien wie Stahl, Schiffbau und Haushaltsgeräte werden zunehmend den Marktentwicklungen überlassen.”

Die Corona-Pandemie und der harte Lockdown haben viele chinesische Staatsbürger desillusioniert. Die schwächelnde Wirtschaft bereitet ihnen noch immer Sorgen. Viele wollen einen Neuanfang in einem anderen Land oder zumindest einen sicheren Hafen, den man im Notfall ansteuern kann. Eine Möglichkeit bieten “goldene Visa”: Aufenthaltsgenehmigungen durch Investitionen oder Spenden, die nach einer Weile in eine Staatsbürgerschaft münden können.
Die verbreitetste Form, um an ein “goldenes Visum” zu kommen, sind Immobilienkäufe – ein Grund, warum viele europäische Länder in den vergangenen Jahren mit der Praxis gebrochen haben. Durch die Golden-Visa-Programme sind die Immobilienpreise stellenweise regelrecht explodiert. Die Käufer, die sehr oft aus China, aber auch aus Russland stammen, wohnen meist nicht selbst darin, sondern vermieten sie als Ferienwohnungen. Eine derartige Visa-Vergabe erhöhe die “Risiken in Bezug auf Sicherheit, Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Korruption”, erklärte die EU-Kommission schon 2022 und forderte ein EU-weites Verbot. Noch liegt die Vergabe aber weiter im Ermessensspielraum der einzelnen Länder.
Hinzu dürfte inzwischen auch noch die Sorge vor der Einschleusung chinesischer Spione kommen. Im Fall des enttarnten Geheimdienstmitarbeiters Jian G. half eine deutsche Staatsbürgerschaft viele Jahre dabei, die wahre Identität des Spions zu verschleiern. Mit Visa und Staatsbürgerschaften für x-beliebige Investoren gibt die EU dem chinesischen Staat zurzeit noch ein wirkungsvolles Instrument an die Hand, um nachrichtendienstliche Verbindungen zu tarnen.
China hat nach den USA die zweitgrößte Millionärsdichte der Welt. Gleichzeitig verzeichnet das Land die größte Nettoabwanderung von vermögenden Personen. Laut der britischen Migrations-Beratungsfirma Henley & Partners könnten dieses Jahr 15.200 Personen mit einem investierbaren Vermögen von einer Million US-Dollar oder mehr aus China auswandern. 2023 waren es Henley & Partners zufolge 13.800. Viele von Ihnen steuern noch immer Europa an, da sie ihr Vermögen aufgrund strenger Kapitalkontrollen in China nur ungenügend streuen können.
Einmal angekommen, sind sie dank der Reise- und Niederlassungfreizügigkeit des Schengen-Raumes nicht mehr an ein Land gebunden. Auch das Gesundheitssystem in europäischen Ländern ist attraktiv, ebenso die Universitäten für den Nachwuchs, erklären Henley & Partners, die auch ein Büro in Shanghai betreiben.
Längst gibt es weltweit Makler- und Anwaltsfirmen, die sich auf die Immigrations- und Investitionsberatung chinesischer Kunden spezialisiert haben. Nachdem Spanien im April angekündigt hatte, seine Golden-Visa-Programme abzuschaffen, stieg die Nachfrage rapide an. Wie die spanische Tageszeitung El País berichtet, kauften Chinesen mehrere billigere Wohnungen, um die 500.000-Euro-Grenze zu erreichen. Besser Betuchte investierten gleich in Gewerbe- und Luxusimmobilien. Im Artikel wird beispielsweise ein Chalet in Madrid erwähnt, das ein chinesischer Käufer für 975.000 Euro erworben hat.
Nachdem Zypern 2020, Großbritannien 2022 sowie Irland und Portugal 2023 ihre Visaprogramme ganz oder teilweise eingestellt haben, richtet sich der Fokus verstärkt auf weniger wohlhabendere Länder Europas. Malta ist momentan noch der einzige Staat, wo man eine volle Staatsbürgerschaft innerhalb von zwölf Monaten relativ rasch erlangen kann. Dafür liegt die Mindestinvestitionssumme bei 750.000 Euro.
Ein weiteres wichtiges Land für reiche Auswanderer bleibt auch Griechenland. 2023 verdoppelten die Behörden zwar die Mindestinvestitionssumme auf 500.000 Euro. Die fünfjährige Aufenthaltsgenehmigung kann aber immer wieder verlängert werden – vorausgesetzt, die Immobilien werden nicht abgestoßen.
Goldene Visa wurden in Griechenland besonders während der Staatsschuldenkrise 2013 als willkommene Investitionsquelle bewertet. Seitdem vergab das Land mehr als 22.300 Aufenthaltstitel- zwei Drittel davon an chinesische Immobilienkäufer. Es kam aber auch zu Korruptionsfällen, bei denen lokale Bauträger gezielt Immobilien ankauften, um sie mit Aufschlag an chinesische Investitionsmigranten weiterzuverkaufen. Die Mieten und Preise für Eigentumswohnungen zogen derart an, dass bezahlbarer Wohnraum für Durchschnittsverdiener in zentralen Gegenden immer rarer wurde.
Auch auf einigen griechischen Inseln und in anderen touristischen Hotspots stiegen die Preise. Der Athener Küstenvorort Alimos wird von Einheimischen mittlerweile als “Chinatown” bezeichnet. Um die Situation zu entschärfen, will Athen strengere Regeln für Kurzzeitvermietungen erlassen. Auch weitere Anhebungen der Mindestinvestitionssummen sind im Gespräch.
Während Länder wie Griechenland ihre Regeln verschärfen, hat Ungarn vergangenen Monat ein neues Programm aufgelegt, das am 1. Juli in Kraft treten soll. Nicht-EU- und Nicht-EWR-Bürger können demnach eine zehnjährige Aufenthaltsgenehmigung im Austausch gegen den Erwerb von Wohneigentum, einer Investition in lokale Immobilienfonds oder einer Spende an eine Hochschuleinrichtung erlangen. Der Mindestanlagebetrag liegt bei 250.000 Euro.
Chinesische Staatsangehörige waren 2023 bereits die stärksten ausländischen Immobilienkäufer in Ungarn. Sie kauften 647 Immobilien, gefolgt von Russen mit 223.
Um nach Europa zu kommen, kann man aber auch in EU-fernen Drittländern investieren. So können chinesische Staatsbürger etwa für eine Viertelmillion Euro die Staatsbürgerschaft der südpazifischen Inselrepublik Vanatu erwerben. Mit dieser bekommt man automatisch einen visumfreien Zugang zu den Ländern der Schengen-Zone – noch.
Die Europäische Kommission schlug bereits vor zwei Jahren vor, das Abkommen über die Befreiung von der Visumpflicht für Vanuatu auszusetzen. Der zuständige Ausschuss wird sich damit befassen, sobald das neue Parlament und die Ausschüsse konstituiert sind, heißt es auf Anfrage beim EU-Parlament.
In Vanuatu trägt der Verkauf von Staatsbürgerschaften mehr als ein Zehntel zum Bruttoinlandsprodukt bei. Auch die Karibikinsel Dominica erhält mehr Geld aus dem Verkauf der Staatsbürgerschaft für umgerechnet 91.600 Euro pro Person als aus Steuern, wie Bloomberg berichtete. Mit dem dominikanischen Pass kann man momentan immerhin 90 Tage lang ohne Visum in die Europäische Union reisen.
Im Zollstreit zwischen China und der EU fordern chinesische Hersteller Insidern zufolge Strafzölle auf europäische Verbrenner. Bei einem Treffen von Autobauern und Vertretern des Handelsministeriums hätten sich chinesische Hersteller für zusätzliche Abgaben auf größere Fahrzeuge ausgesprochen, berichtete die KP-Zeitung Global Times am Mittwoch. Aus Branchenkreisen hieß es, dabei sei es um Autos mit einem Hubraum von mehr als 2,5 Litern gegangen.
An der Sitzung hätten Vertreter der europäischen Hersteller BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Porsche, Stellantis und Renault sowie der chinesischen Konzerne SAIC, Geely, BYD und Great Wall Motor teilgenommen, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person. Mit Ausnahme von Great Wall hätten sich die chinesischen Autobauer für höhere Zölle ausgesprochen. Die europäischen Hersteller hätten das abgelehnt und für vorsichtige Maßnahmen plädiert.
Ziel des Treffens sei es demnach gewesen, Druck auf die EU-Kommission auszuüben und gegen die europäischen Anti-Dumping-Zölle auf chinesische Autos vorzugehen. Die chinesische Seite habe großes Unverständnis über die Importzölle deutlich gemacht und nach einer kraftvollen Erwiderung gerufen, sagte ein Insider. Alle Teilnehmer des Treffens hätten sich darauf verständigt, dass Handelskonflikte vermieden werden müssten.
Bereits im Mai hatte der Chefexperte von Chinas staatlichem Automobilforschungsinstitut China Automotive Technology & Research Center (CATARC), Liu Bin, in einem Interview mit der Global Times Zölle auf Autos mit mehr als 2,5 Liter Hubraum gefordert. Zahlreiche Premium-Fahrzeuge der Marken Mercedes-Benz, Audi und BMW wären von so einer Regelung betroffen. Denn obwohl die Konzerne Werke in China betreiben, werden hochmotorige Limousinen oder SUVs zumeist nicht in der Volksrepublik produziert, sondern importiert. Allein seit Jahresbeginn wurden nach chinesischen Einfuhrdaten Fahrzeuge mit einem Motor von mehr als 2,5 Litern Hubraum im Wert von 1,1 Milliarden Euro aus Deutschland nach China eingeführt.
Die EU-Kommission hatte Ausgleichszölle auf Elektroauto-Einfuhren aus China von bis zu 38,1 Prozent angekündigt. Sie begründete diesen Schritt mit Wettbewerbsverzerrungen durch hohe staatliche Subventionen in der Volksrepublik. Damit folgt die Union einem ähnlichen Schritt der USA, die ihre Zölle auf chinesische E-Fahrzeuge auf 100 Prozent vervierfacht hatten. Im Zuge des Streits über Strafzölle für E-Autos hatte die Regierung in Peking vor einem neuen Handelskonflikt gewarnt. China werde alle notwendigen Schritte ergreifen, um die EU-Maßnahmen zu kontern. rtr
Der Verband Ecommerce Europe und 16 weitere nationale E-Commerce-Verbände fordern eine faire Wettbewerbssituation und eine effektivere Durchsetzung des EU-Rechts gegenüber nicht in der EU ansässigen Akteuren. In einem offenen Brief verlangen sie, dass “E-Commerce-Akteure, die in der EU tätig sind, aber in Nicht-EU-Ländern ansässig sind, denselben Regeln unterliegen sollten wie Unternehmen mit Sitz in der EU”. Das soll sicherstellen, dass EU-basierte Unternehmen keinen Wettbewerbsnachteil haben.
Hintergrund der Forderungen ist der rapide Erfolg asiatischer E-Commerce-Händler wie Shein und Temu. Diese Unternehmen nutzen erhebliche finanzielle Ressourcen und aggressive Marketingstrategien, um schnell in den europäischen Markt vorzudringen. Zudem profitieren sie nach Angaben der Unterzeichner von staatlichen Subventionen in ihren Heimatländern, was ihre Wettbewerbsfähigkeit weiter stärke. Im Brief kritisieren sie, dass solche Praktiken zu ungleichem Wettbewerb führen und EU-Unternehmen benachteiligen.
Die Verbände weisen darauf hin, dass EU-basierte Unternehmen umfangreichen Gesetzen und hohen Compliance-Kosten unterliegen. Nicht-EU-basierte Akteure hielten diese Regeln oft nicht ein. Nationale Behörden seien häufig unterbesetzt. Zudem erschwere mangelnde Koordination die Durchsetzung der EU-Regeln. Dies verschaffe nicht-EU-Akteuren, die die Regeln ignorierten, einen unfairen Wettbewerbsvorteil. Auch werfen die kommerziellen Praktiken dieser Akteure nach Ansicht der Unterzeichner Fragen zur Einhaltung von Vorschriften in den Bereichen Verbraucherschutz, Produktsicherheit, Datenschutz, Privatsphäre, Umwelt- und Steuerrecht auf.
Daher fordern die Verbände Kommission, Mitgliedstaaten und zuständige Behörden auf, alle notwendigen Mittel bereitzustellen, um die Aktivitäten nicht in der EU ansässiger Akteure genauso gründlich zu kontrollieren und bei Verstößen genauso zu sanktionieren wie EU-basierte Akteure. Dafür sei eine tiefere Zusammenarbeit und Koordination zwischen den EU-Mitgliedstaaten und ihren Behörden notwendig. Diese könne eine konsistente Anwendung der Vorschriften gewährleisten und somit echte Chancengleichheit im EU-Binnenmarkt ermöglichen. vis
Der Internationale Währungsfonds (IWF) und die People’s Bank of China haben die Eröffnung eines neuen IWF-Regionalzentrums in Shanghai bekannt gegeben. Das Zentrum soll laut einem Statement des IWF dazu beitragen, den Dialog mit den Mitgliedsländern und anderen Interessengruppen in der Region zu vertiefen, darunter internationale Finanzinstitutionen, Akademiker, Thinktanks, Organisationen der Zivilgesellschaft und des Privatsektors.
China hält 6,08 Prozent des Stimmrechtsanteils des IWF und liegt damit an dritter Stelle, nach den Vereinigten Staaten (16,5 Prozent) und Japan (6,14 Prozent). China wünscht sich mehr Mitspracherecht im internationalen Finanzsystem, um Chinas wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit gerecht zu werden. Der Anteil des Landes an der globalen Wirtschaftsleistung liegt bei rund 19 Prozent. flee
Ecuador hat die visafreie Einreise für chinesische Staatsbürger ausgesetzt und damit einen zunehmend häufig genutzten Eintrittspunkt in die Migrationsroute Richtung USA geschlossen. Das Außenministerium des südamerikanischen Landes begründete die Entscheidung mit einem Anstieg der illegalen Migrationsströme aus China. In einer Erklärung in den sozialen Medien teilte das Ministerium mit, viele chinesische Reisende hätten zuletzt den erlaubten 90-Tage-Zeitraum überschritten und Ecuador möglicherweise als Ausgangspunkt genutzt, um andere Ziele in der Region zu erreichen.
Das Ministerium erklärte, dass in den letzten Monaten fast die Hälfte der Besucher aus China nicht rechtzeitig über reguläre Routen ausgereist sei. Bereits seit 2022 war die Zahl der chinesischen Bürger, die nach Ecuador einreisen, ohne eine Ausreise zu registrieren, gestiegen. Zwischen 2023 und 2024 reisten 66.189 chinesische Bürger und Bürgerinnen in das Land ein, jedoch nur 34.209 wieder aus. Viele der in Ecuador ankommenden chinesischen Bürger reisen in Richtung der Vereinigten Staaten.
Die Migranten entscheiden sich für die lebensgefährliche Route durch den Darién Gap zwischen Kolumbien und Panama. Die Strecke durch den dichten Regenwald gilt als eine der gefährlichsten Migrationsrouten der Welt. Neben Gefahren aufgrund der schwierigen Vegetation sind die Gruppen regelmäßig den Drogen-Kartellen in der Region ausgesetzt, werden angegriffen, bedroht, erpresst oder verschleppt.
Auf die Frage nach der Aussetzung der Visumpflicht für Ecuador sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Lin Jian, dass China jede Form des Menschenschmuggels entschieden ablehne. Chinas Strafverfolgungsbehörden arbeiten mit den betreffenden Ländern zusammen, um gemeinsam gegen Menschenschmuggel vorzugehen, illegale Einwanderer zu repatriieren und für Ordnung im grenzüberschreitenden Reiseverkehr zu sorgen, sagte Lin. rtr/ari

Robert Habeck landet am Freitag zum ersten Besuch seiner Amtszeit in China. Als Klimaschutzminister ist er dort besonders gefragt. Denn China ist zweifelsohne der Schlüsselakteur für erfolgreichen globalen Klimaschutz – in mehrfacher Hinsicht:
Deshalb ist es höchste Zeit, dass die Bundesregierung den klimapolitischen Beziehungen zu China einen höheren Stellenwert einräumt. Wichtige Grundlagen dafür sind seit Beginn der Legislatur mit der Klimaaußenpolitik-Strategie, der China-Strategie und dem vor einem Jahr zwischen Deutschland und China vereinbarten Transformationsdialog gelegt.
Nun kommt es darauf an, eine realistische und strategische China-Klimapolitik tatsächlich umzusetzen. Leitmotiv dabei sollte “nicht-naive Kooperation” sein. Denn eine erstrebenswerte deutsche China-Klimapolitik umfasst zwar Kooperation in den Bereichen, in denen diese weiterhin sinnvoll und möglich ist – aber auch klar formulierte Erwartungen sowie einen anderen Umgang mit Drittstaaten.
In sechs Bereichen kann Robert Habeck in den nächsten Tagen in Peking Akzente setzen: Erstens sollte er anerkennen, dass wir für die erforderliche Transformation weiter in großem Umfang Importe aus China brauchen werden, aber gleichzeitig erklären, warum Europa seine Lieferketten bei Zukunftstechnologien wie Erneuerbaren Energien oder Elektromobilität diversifizieren will. Das bedeutet auch den Aufbau eigener Fertigungskapazitäten – aber nicht die Schließung des Marktes.
Zweitens sollte er einfordern, dass die ökologischen und sozialen Bedingungen in der Lieferkette – zum Beispiel für Solarzellen – sich verbessern müssen. Weder der Einsatz von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern noch die ausschließliche Nutzung von dreckigem Kohlestrom sind hierbei akzeptabel. Die deutschen und europäischen Lieferkettengesetze sind die besten Instrumente, um tatsächlich Verbesserungen in der Lieferkette zu erreichen, weil sie verbindlich für alle größeren Unternehmen gelten. Mit öffentlichen Überlegungen zum “Aussetzen” des deutschen Gesetzes hat Habeck die Glaubwürdigkeit dieser Position nicht gestärkt. Umso wichtiger, dass er klarstellt, dass verbindliche Sorgfaltspflichten kommen werden und wie China die dafür notwendige Transparenz schaffen kann.
Drittens bleibt der hohe Anteil der Kohleverstromung das größte klimapolitische Problem in China. Hier sollte der Minister einerseits klare Erwartungen formulieren: China muss die eigene Zusage aus 2021, den Zuwachs von Kohlekraftwerken streng zu begrenzen, endlich einhalten, und darüber hinaus im nächsten Fünfjahresplan den Einstieg in den Kohleausstieg schaffen. Andererseits kann Robert Habeck verstärkten Austausch zwischen Fachleuten beider Länder anbieten.
Viertens kann die Zusammenarbeit mit Deutschland dazu beitragen, eine gewisse Akteursvielfalt auch in der chinesischen Klimapolitik zu stärken, über die Zentralregierung hinaus. Im Rahmen des Transformationsdialogs ist beispielsweise eine Zusammenarbeit auch mit Provinzen vorgesehen – ein sinnvoller Ansatz. Zudem sollte die deutsche Seite darauf drängen, dass in den Austausch- und Kooperationsformaten auch Fachleute aus Forschungsinstituten und Zivilgesellschaft aus beiden Ländern eingebunden werden.
Fünftens ist es keine Übertreibung, zu sagen, dass die künftige Erhitzung der Erde maßgeblich vom neuen chinesischen Klimaziel für 2035 abhängt, welches China – so wie alle Länder – spätestens im Februar 2025 bei der UN einreichen muss. Bislang deuten die Zeichen darauf hin, dass China zwar diese Frist einhalten will, aber kein angemessenes ambitioniertes Ziel plant. Dies muss in allen hochrangigen Gesprächen Thema sein – es hilft, wenn der Vizekanzler des größten EU-Mitgliedstaats die Bedeutung dieser Frage unterstreicht. Wirksam wird dies nur dann sein, wenn Habeck auch zusagen kann, dass die EU selbst möglichst früh ein ambitioniertes, am 1,5-Grad-Limit ausgerichtetes Ziel für 2035 und 2040 vorlegen wird.
Sechstens sollte Robert Habeck anbieten, dass China und Deutschland gemeinsam mehr für die Unterstützung anderer Staaten bei der Energiewende tun. Eine beschleunigte globale Energiewende kann ein Ventil für die Handelsspannungen um grüne Technologien sein. Auch wenn die EU den Anteil chinesischer Importe senken möchte, muss das keine sinkende Nachfrage für chinesische Produkte bedeuten, wenn beispielsweise Kohleländer wie Indonesien, Indien oder Südafrika ihre Energiewende beschleunigen und dabei zu großen Teilen auf Technologie aus China zurückgreifen.
Lutz Weischer ist Leiter des Berliner Büros der Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch. Martin Voss ist dort Referent für Klimadiplomatie und Kooperation mit Asien/China.

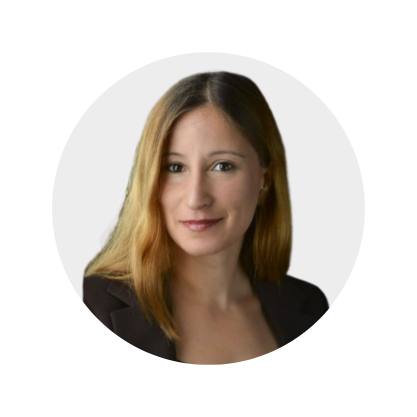
Marina Rudyak – Universität Heidelberg, Sinologin
Marina Rudyak ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sinologie der Universität Heidelberg. Sie ist Dozentin für chinesische Wirtschaftspolitik und internationale Beziehungen und hat zu chinesischer Entwicklungshilfe und Chinas Rolle in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit promoviert. Rudyak war mehrere Jahre lang als wirtschaftspolitische Beraterin für die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) in Peking tätig.

Thomas Heberer – Universität Duisburg-Essen, Professor
Thomas Heberer ist Politik- und Ostasienwissenschaftler. Bis 2013 hatte er den Lehrstuhl Politik Ostasiens an der Universität Duisburg-Essen inne. Dort hält er eine Seniorprofessur für die Politik und die Gesellschaft Chinas. Heberer arbeitete von 1977 bis 1981 als Lektor und Übersetzer am Verlag für Fremdsprachige Literatur in Peking. Gegenwärtig arbeitet Thomas Heberer über Prozesse der Sozialdisziplinierung und Zivilisierung im Modernisierungsprozess Chinas. Zuletzt löste er mit einem Beitrag über die Situation der Uiguren in Xinjiang eine lebhafte Debatte aus.

Sarah Kirchberger – Direktorin des Institut für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel
Sarah Kirchberger ist seit Juli 2023 akademische Direktorin und Abteilungsleiterin für strategische Entwicklung in Asien-Pazifik am Institut für Sicherheitspolitik der Christian-Albrechts-Universität in Kiel. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören der transatlantische Umgang mit Chinas Aufstieg, die Entwicklung der Volksbefreiungsarmee sowie der Taiwan-Konflikt. Sie ist zudem Nonresident Senior Fellow am Scowcroft Center for Strategy and Security, Atlantic Council und Vizepräsidentin des Deutschen Maritimen Instituts (DMI).

Gunter Schubert – Universität Tübingen, Professor
Gunter Schubert führt regelmäßige Feldforschungen in der Volksrepublik China, Taiwan und Hongkong durch und pflegt ein enges Netzwerk mit Wissenschaftlern und akademischen Institutionen in Ostasien. Er hat zahlreiche Publikationen in deutscher, englischer, französischer und chinesischer Sprache in hochrangigen internationalen Fachzeitschriften veröffentlicht. Schubert ist Mitglied des Executive Editorial Board des International Journal of Taiwan Studies, Mitherausgeber von Issues & Studies und sitzt in den Editorial Boards zahlreicher wissenschaftlicher Zeitschriften in den USA, Europa, China und Taiwan.

Kristin Shi-Kupfer – Universität Trier, Professorin
Kristin Shi-Kupfer ist Professorin für Sinologie an der Universität Trier und Senior Associate Fellow bei Merics. Sie ist Expertin für Chinas Digitalpolitik, Ideologie und Medienpolitik sowie Zivilgesellschaft und Menschenrechte. Shi-Kupfer promovierte an der Ruhr-Universität Bochum zum Thema “Emergence and Development of Spiritual-Religious Groups in China after 1978”. Von 2007 bis 2011 war sie als Journalistin in China tätig. Sie berichtete von dort unter anderem für Zeit Online, taz, epd, und Südwest Presse.

Björn Alpermann – Universität Würzburg, Professor
Björn Alpermann ist einer der führenden Xinjiang-Forscher in Deutschland, der mit seiner Arbeit zur Aufdeckung der staatlichen Unterdrückung der Uiguren beiträgt. Er studierte Moderne China-Wissenschaften, Politikwissenschaft und Volkswirtschaftslehre in Köln und Tianjin. Von 1999 bis 2008 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Ostasiatischen Seminar der Universität Köln. 2006 promovierte er im Fach Moderne China-Studien. 2008 bis 2013 war er Juniorprofessor für Contemporary Chinese Studies an der Universität Würzburg und besetzte vertretungsweise den neu eingerichteten Lehrstuhl China Business and Economics.

Markus Taube – Universität Duisburg-Essen, Professor
Markus Taube ist Inhaber des Lehrstuhls für Ostasienwirtschaft und China der Mercator School of Management sowie Direktor der In-East School of Advanced Studies an der Universität Duisburg-Essen. Taube ist außerdem Co-Direktor des Konfuzius-Instituts Metropole Ruhr. Er ist amtierender Präsident der Euro-Asia Management Studies Association (EAMSA) und hält diverse Gastprofessuren in China.

Adrian Zenz – Victims of Communism Memorial Foundation, Senior Fellow and Director China Studies
Adrian Zenz hat mit seiner Forschung weltweit das Bewusstsein für die Einrichtung von Umerziehungslagern durch den chinesischen Staat sowie das staatliche Zwangsarbeitssystem geschaffen. Zenz promovierte in Sozialanthropologie an der Universität von Cambridge. Er führte ethnografische Feldforschung in Westchina in chinesischer Sprache durch und analysiert regelmäßig chinesisches Originalquellenmaterial. Zenz hat für die Regierungen Deutschlands, Frankreichs, des Vereinigten Königreichs, Kanadas und der Vereinigten Staaten als Experte ausgesagt.

Doris Fischer – Universität Würzburg, Professorin
Doris Fischer hat den Lehrstuhl für China Business and Economics an der Universität Würzburg inne. Fischer hat Betriebswirtschaftslehre und Sinologie in Hamburg und Wuhan studiert und in Volkswirtschaftslehre an der Universität Gießen promoviert. Im Mittelpunkt ihrer zahlreichen Forschungsarbeiten zu Wettbewerb, Regulierung sowie Industriepolitik stehen Chinas Wirtschaftspolitik und die damit verbundenen Anreizstrukturen für ökonomische Akteure.

Klaus Mühlhahn – Zeppelin Universität Friedrichshafen, Präsident
Klaus Mühlhahn ist Präsident der Zeppelin Universität und Inhaber des Lehrstuhls für Moderne China-Studien. Mühlhahn gilt als einer der renommiertesten Sinologen in Deutschland. Sein Studium und seine Promotion in Sinologie absolvierte er an der FU Berlin. Seine Forschung führte ihn nach Berkeley, Turku und Indiana, bevor er als Professor für chinesische Geschichte und Kultur an die FU Berlin zurückkehrte. 2020 wurde er dann an die ZU berufen.
Lionel Dumont ist seit Juni Head of Mechanical Design and Simulation / e-powertrain Development bei VW China. Sein Einsatzort ist Tianjin.
Jonathan Chin ist neuer Head of Human Pharmaceuticals China, Hong Kong/Macau and Taiwan bei Boehringer Ingelheim. Chin ist seit 21 Jahren für den deutschen Pharma-Konzern tätig, zuletzt als General Manager Hong Kong and Macau. Er arbeitet in Shanghai.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Ganz in Weiß und gut verhüllt – bei Temperaturen von mehr als 40 Grad versuchen die Menschen in Shenyang sich so gut es geht vor Hitze und Sonnenstrahlen zu schützen. Während hierzulande die Hüllen fallen, setzt diese Frau auf die reflektierende Wirkung der Farbe Weiß. Die Aussichten für die nächsten Tage: Es bleibt brütend heiß.
ausgerechnet der gute China-Freund Viktor Orbán lockerte im Frühjahr die Bedingungen für chinesische Investoren, die sich die Aussicht auf eine Aufenthaltsgenehmigung für den Schengen-Raum erkaufen wollen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Denn die EU will die Bedingungen zum Visaerhalt für chinesische Staatsbürger eigentlich erschweren. Orbán konterkariert das.
Aber zur Ehrenrettung des ungarischen Regierungschefs muss man feststellen, dass Ungarn keineswegs der einzige EU-Staat ist, der es chinesischen Staatsbürgern schmackhaft macht, in seinem Hoheitsgebiet zu investieren. Malta, Griechenland oder Portugal tun es ähnlich, schreibt Fabian Peltsch.
Der Ansatz der EU, solche Praktiken stärker zu regulieren, wäre ein Akt der Vernunft. Hat der chinesische Geheimdienst im Fall Jian G. doch bewiesen, dass er europäische Staatsbürgerschaften dazu nutzt, um seinen Spionen eine nahezu feuerfeste Tarnung anzulegen.
Derweil nimmt uns Finn Mayer-Kuckuk heute mit nach Südkorea. Unser China.Table-Ressortleiter begleitet Robert Habeck auf dessen fünftägiger Ostasienreise. In Seoul trifft der deutsche Vizekanzler und Wirtschaftsminister nicht nur Handelsminister Ahn Dukgeun, sondern auch den südkoreanischen Regierungschef Han Duck-soo. Und die Gespräche könnten interessant werden für den deutschen Vizekanzler.
Während Habeck die Abhängigkeiten von China abbauen will, ist Südkorea schon längst dabei, genau dies zu tun. Seit China das Land 2017 mit einem Handelsboykott abstrafte, weil Seoul ein Raketenabwehrsystem der USA auf seinem Terrain zuließ, sind die Südkoreaner alarmiert und verfolgen gezielt eine De-Risking-Strategie, die von China wegführt. Mit einigem Erfolg. Heute ist Südkorea sehr viel autarker vom großen Nachbarn – und damit auch politisch weniger erpressbar. Ein Vorbild für Deutschland und Europa?
Viele Erkenntnisse beim Lesen!


Der erste Stopp der Asienreise von Wirtschaftsminister Robert Habeck ist am Donnerstag die südkoreanische Hauptstadt Seoul. Von dort aus geht es weiter nach China. Die Reihenfolge hat zwar keine tiefere Bedeutung – einem früheren Reiseplan zufolge sollte es erst nach China gehen, dann nach Südkorea. Doch im Licht der deutschen China-Strategie ist Südkorea ein passender Partner, der durchaus besondere Aufmerksamkeit verdient. “Südkorea hat mit ähnlichen Herausforderungen zu kämpfen, sowohl im Bereich der Wirtschaft als auch bei den Sicherheitsrisiken”, sagte Habeck auf dem Flug nach Seoul.
Denn es ist ein erklärtes Ziel der Bundesregierung, die Abhängigkeiten von Lieferanten in China zu verringern. “Südkorea spielt eine Schlüsselrolle in Berlins und Brüssels Indopazifik-Strategien”, sagt Korea-Experte Eric Ballbach von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Es ist in mehrfacher Hinsicht ein besonders wertvoller Partner:
Als Absatzmarkt ist Südkorea zwar auch interessant, aber keine Alternative zu China. Es ist mit 51 Millionen Einwohnern nicht besonders groß. Und Koreaner kaufen gerne koreanische Waren – vor allem Autos von Hyundai.
Beeindruckend sind die Erfolge Südkoreas in der Halbleitertechnik. Deutschland hat diese mit einigen Ausnahmen fast vollständig nach Asien abwandern lassen. Südkorea hat dagegen eine der fortschrittlichsten Chip-Industrien der Welt aufgebaut. Auch wenn der taiwanische Anbieter TSMC der viel zitierte Marktführer ist, macht ihm die Chipsparte von Samsung heftig Konkurrenz. Samsung stellt einen Großteil der Prozessoren für seine fortschrittlichen Handys selbst an Standorten in Südkorea und Texas her. Europa kann vom Niveau der Samsung-Fabriken nur träumen. Dazu kommt, dass Samsung einer der bekanntesten Namen für Handys, Tablets oder Smartwatches ist.
Dabei hat Südkorea im Vergleich zu Deutschland sogar erhebliche Nachteile – Deutschland hat den EU-Binnenmarkt, Südkorea dagegen bloß unfreundliche Nachbarn. Das Land ist weder größer noch reicher als Deutschland. Tatsächlich hatte es einen späten Start als Hochtechnik-Land; erst ab den späten 1980er-Jahren ging das Wirtschaftswunder richtig los. Heute gehört Südkorea zu den Ländern mit den höchsten Ausgaben für neue Technologien. Die Fördertöpfe für Zukunftstechnik wie KI und Quantencomputing sind üppig gefüllt.
Kameras, Handys, Netztechnik – all das glaubte Deutschland nicht profitabel herstellen zu können. Doch auch Samsung baut 5G-Mobilfunknetze, die Deutschland von Huawei gekauft hat, weil es angeblich nicht anders ging.
Der China-Schock kam für Südkorea schon 2017. Das Militär hatte Stellungen für ein Raketenabwehrsystem namens THAAD errichtet. THAAD steht für Terminal High Altitude Area Defense. Offiziell dient die US-Technik der Abwehr eines nordkoreanischen Angriffs. Aus Pekinger Sicht richtet sich das hochmoderne System jedoch gegen China.
Erste Konsequenzen bekam Südkorea schon nach wenigen Tagen zu spüren. Peking heizte über die Staatsmedien den Nationalismus an und die Reaktion der Bürger ließ nicht lange auf sich warten – es gab Krawalle vor Geschäften mit südkoreanischen Marken. Die Tourismusbehörde riet von Reisen nach Südkorea ab und die Zahl der Reisen von China nach Südkorea brach ein. Auch der Einzelhandelskonzern Lotte bekam den Zorn Chinas bereits zu spüren. Lotte-Kaufhäuser im Land mussten plötzlich schließen, weil sie Opfer von Hackerangriffen wurden oder Demonstranten die Zugänge blockiert habe. Ein Neubauprojekt des Unternehmens konnte wegen plötzlicher Brandschutzbedenken der Feuerwehr nicht eröffnen.
Seitdem versucht Südkorea, seine Abhängigkeit von China zu verringern. “Die Strategie war im Grunde eine Strategie des De-Risking, lange, bevor der Begriff von Ursula von der Leyen verwendet wurde”, sagt Ballbach. Bestes Beispiel ist der Einzelhandelskonzern Lotte, dessen Kaufhäuser so unter Beschuss standen. Er zog sich letztlich vom chinesischem Markt zurück. “Damit verlor China eine zentrale Einflussflanke”, sagt Ballbach.
Südkorea hat in der Folgezeit eine Verlagerung der Lieferbeziehungen in befreundete Länder betrieben und handelt mehr mit Südostasien und den USA. Hyundai und Samsung haben mehr in Amerika investiert. Diese Vorbereitungen kamen zu tragen, als 2023 der Handel mit China infolge von US-Sanktionen, denen sich Südkorea anschloss, stark zurückging. Die Folgen gelten jetzt als verkraftbar.
Die Erfolge Südkoreas lassen sich in Deutschland jedoch nur teilweise wiederholen. Die südkoreanische Wirtschaftsstruktur ist anders als die deutsche: Während Deutschland vom Mittelstand geprägt ist, dominieren in Südkorea Großkonzerne, die sogenannten Chaebol. Zulieferern kommt dort weniger die Rolle selbstbewusster, eigenständiger Akteure zu. Sie sind vielmehr Waggons eines Zuges, dessen Lok Großkonzerne wie Samsung, LG oder Hyundai sind. Daher tauchen diese Markennamen auch so oft auf. Die Chaebol arbeiten wiederum eng mit der Regierung zusammen, um die Industriestrategie zu koordinieren.
Dennoch ließe sich etwas übertragen. “Für Deutschland gibt es dennoch viel zu lernen, insbesondere was die gezielte Förderung von Schlüsselsektoren anbelangt”, sagt Ballbach. Die jetzige Industriepolitik Südkoreas konzentriere sich auf die gezielte Förderung der Zukunftstechnologien wie KI, Biomedizin, Halbleiter und E-Mobilität. “Die alten Schlüsselindustrien wie Stahl, Schiffbau und Haushaltsgeräte werden zunehmend den Marktentwicklungen überlassen.”

Die Corona-Pandemie und der harte Lockdown haben viele chinesische Staatsbürger desillusioniert. Die schwächelnde Wirtschaft bereitet ihnen noch immer Sorgen. Viele wollen einen Neuanfang in einem anderen Land oder zumindest einen sicheren Hafen, den man im Notfall ansteuern kann. Eine Möglichkeit bieten “goldene Visa”: Aufenthaltsgenehmigungen durch Investitionen oder Spenden, die nach einer Weile in eine Staatsbürgerschaft münden können.
Die verbreitetste Form, um an ein “goldenes Visum” zu kommen, sind Immobilienkäufe – ein Grund, warum viele europäische Länder in den vergangenen Jahren mit der Praxis gebrochen haben. Durch die Golden-Visa-Programme sind die Immobilienpreise stellenweise regelrecht explodiert. Die Käufer, die sehr oft aus China, aber auch aus Russland stammen, wohnen meist nicht selbst darin, sondern vermieten sie als Ferienwohnungen. Eine derartige Visa-Vergabe erhöhe die “Risiken in Bezug auf Sicherheit, Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Korruption”, erklärte die EU-Kommission schon 2022 und forderte ein EU-weites Verbot. Noch liegt die Vergabe aber weiter im Ermessensspielraum der einzelnen Länder.
Hinzu dürfte inzwischen auch noch die Sorge vor der Einschleusung chinesischer Spione kommen. Im Fall des enttarnten Geheimdienstmitarbeiters Jian G. half eine deutsche Staatsbürgerschaft viele Jahre dabei, die wahre Identität des Spions zu verschleiern. Mit Visa und Staatsbürgerschaften für x-beliebige Investoren gibt die EU dem chinesischen Staat zurzeit noch ein wirkungsvolles Instrument an die Hand, um nachrichtendienstliche Verbindungen zu tarnen.
China hat nach den USA die zweitgrößte Millionärsdichte der Welt. Gleichzeitig verzeichnet das Land die größte Nettoabwanderung von vermögenden Personen. Laut der britischen Migrations-Beratungsfirma Henley & Partners könnten dieses Jahr 15.200 Personen mit einem investierbaren Vermögen von einer Million US-Dollar oder mehr aus China auswandern. 2023 waren es Henley & Partners zufolge 13.800. Viele von Ihnen steuern noch immer Europa an, da sie ihr Vermögen aufgrund strenger Kapitalkontrollen in China nur ungenügend streuen können.
Einmal angekommen, sind sie dank der Reise- und Niederlassungfreizügigkeit des Schengen-Raumes nicht mehr an ein Land gebunden. Auch das Gesundheitssystem in europäischen Ländern ist attraktiv, ebenso die Universitäten für den Nachwuchs, erklären Henley & Partners, die auch ein Büro in Shanghai betreiben.
Längst gibt es weltweit Makler- und Anwaltsfirmen, die sich auf die Immigrations- und Investitionsberatung chinesischer Kunden spezialisiert haben. Nachdem Spanien im April angekündigt hatte, seine Golden-Visa-Programme abzuschaffen, stieg die Nachfrage rapide an. Wie die spanische Tageszeitung El País berichtet, kauften Chinesen mehrere billigere Wohnungen, um die 500.000-Euro-Grenze zu erreichen. Besser Betuchte investierten gleich in Gewerbe- und Luxusimmobilien. Im Artikel wird beispielsweise ein Chalet in Madrid erwähnt, das ein chinesischer Käufer für 975.000 Euro erworben hat.
Nachdem Zypern 2020, Großbritannien 2022 sowie Irland und Portugal 2023 ihre Visaprogramme ganz oder teilweise eingestellt haben, richtet sich der Fokus verstärkt auf weniger wohlhabendere Länder Europas. Malta ist momentan noch der einzige Staat, wo man eine volle Staatsbürgerschaft innerhalb von zwölf Monaten relativ rasch erlangen kann. Dafür liegt die Mindestinvestitionssumme bei 750.000 Euro.
Ein weiteres wichtiges Land für reiche Auswanderer bleibt auch Griechenland. 2023 verdoppelten die Behörden zwar die Mindestinvestitionssumme auf 500.000 Euro. Die fünfjährige Aufenthaltsgenehmigung kann aber immer wieder verlängert werden – vorausgesetzt, die Immobilien werden nicht abgestoßen.
Goldene Visa wurden in Griechenland besonders während der Staatsschuldenkrise 2013 als willkommene Investitionsquelle bewertet. Seitdem vergab das Land mehr als 22.300 Aufenthaltstitel- zwei Drittel davon an chinesische Immobilienkäufer. Es kam aber auch zu Korruptionsfällen, bei denen lokale Bauträger gezielt Immobilien ankauften, um sie mit Aufschlag an chinesische Investitionsmigranten weiterzuverkaufen. Die Mieten und Preise für Eigentumswohnungen zogen derart an, dass bezahlbarer Wohnraum für Durchschnittsverdiener in zentralen Gegenden immer rarer wurde.
Auch auf einigen griechischen Inseln und in anderen touristischen Hotspots stiegen die Preise. Der Athener Küstenvorort Alimos wird von Einheimischen mittlerweile als “Chinatown” bezeichnet. Um die Situation zu entschärfen, will Athen strengere Regeln für Kurzzeitvermietungen erlassen. Auch weitere Anhebungen der Mindestinvestitionssummen sind im Gespräch.
Während Länder wie Griechenland ihre Regeln verschärfen, hat Ungarn vergangenen Monat ein neues Programm aufgelegt, das am 1. Juli in Kraft treten soll. Nicht-EU- und Nicht-EWR-Bürger können demnach eine zehnjährige Aufenthaltsgenehmigung im Austausch gegen den Erwerb von Wohneigentum, einer Investition in lokale Immobilienfonds oder einer Spende an eine Hochschuleinrichtung erlangen. Der Mindestanlagebetrag liegt bei 250.000 Euro.
Chinesische Staatsangehörige waren 2023 bereits die stärksten ausländischen Immobilienkäufer in Ungarn. Sie kauften 647 Immobilien, gefolgt von Russen mit 223.
Um nach Europa zu kommen, kann man aber auch in EU-fernen Drittländern investieren. So können chinesische Staatsbürger etwa für eine Viertelmillion Euro die Staatsbürgerschaft der südpazifischen Inselrepublik Vanatu erwerben. Mit dieser bekommt man automatisch einen visumfreien Zugang zu den Ländern der Schengen-Zone – noch.
Die Europäische Kommission schlug bereits vor zwei Jahren vor, das Abkommen über die Befreiung von der Visumpflicht für Vanuatu auszusetzen. Der zuständige Ausschuss wird sich damit befassen, sobald das neue Parlament und die Ausschüsse konstituiert sind, heißt es auf Anfrage beim EU-Parlament.
In Vanuatu trägt der Verkauf von Staatsbürgerschaften mehr als ein Zehntel zum Bruttoinlandsprodukt bei. Auch die Karibikinsel Dominica erhält mehr Geld aus dem Verkauf der Staatsbürgerschaft für umgerechnet 91.600 Euro pro Person als aus Steuern, wie Bloomberg berichtete. Mit dem dominikanischen Pass kann man momentan immerhin 90 Tage lang ohne Visum in die Europäische Union reisen.
Im Zollstreit zwischen China und der EU fordern chinesische Hersteller Insidern zufolge Strafzölle auf europäische Verbrenner. Bei einem Treffen von Autobauern und Vertretern des Handelsministeriums hätten sich chinesische Hersteller für zusätzliche Abgaben auf größere Fahrzeuge ausgesprochen, berichtete die KP-Zeitung Global Times am Mittwoch. Aus Branchenkreisen hieß es, dabei sei es um Autos mit einem Hubraum von mehr als 2,5 Litern gegangen.
An der Sitzung hätten Vertreter der europäischen Hersteller BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Porsche, Stellantis und Renault sowie der chinesischen Konzerne SAIC, Geely, BYD und Great Wall Motor teilgenommen, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person. Mit Ausnahme von Great Wall hätten sich die chinesischen Autobauer für höhere Zölle ausgesprochen. Die europäischen Hersteller hätten das abgelehnt und für vorsichtige Maßnahmen plädiert.
Ziel des Treffens sei es demnach gewesen, Druck auf die EU-Kommission auszuüben und gegen die europäischen Anti-Dumping-Zölle auf chinesische Autos vorzugehen. Die chinesische Seite habe großes Unverständnis über die Importzölle deutlich gemacht und nach einer kraftvollen Erwiderung gerufen, sagte ein Insider. Alle Teilnehmer des Treffens hätten sich darauf verständigt, dass Handelskonflikte vermieden werden müssten.
Bereits im Mai hatte der Chefexperte von Chinas staatlichem Automobilforschungsinstitut China Automotive Technology & Research Center (CATARC), Liu Bin, in einem Interview mit der Global Times Zölle auf Autos mit mehr als 2,5 Liter Hubraum gefordert. Zahlreiche Premium-Fahrzeuge der Marken Mercedes-Benz, Audi und BMW wären von so einer Regelung betroffen. Denn obwohl die Konzerne Werke in China betreiben, werden hochmotorige Limousinen oder SUVs zumeist nicht in der Volksrepublik produziert, sondern importiert. Allein seit Jahresbeginn wurden nach chinesischen Einfuhrdaten Fahrzeuge mit einem Motor von mehr als 2,5 Litern Hubraum im Wert von 1,1 Milliarden Euro aus Deutschland nach China eingeführt.
Die EU-Kommission hatte Ausgleichszölle auf Elektroauto-Einfuhren aus China von bis zu 38,1 Prozent angekündigt. Sie begründete diesen Schritt mit Wettbewerbsverzerrungen durch hohe staatliche Subventionen in der Volksrepublik. Damit folgt die Union einem ähnlichen Schritt der USA, die ihre Zölle auf chinesische E-Fahrzeuge auf 100 Prozent vervierfacht hatten. Im Zuge des Streits über Strafzölle für E-Autos hatte die Regierung in Peking vor einem neuen Handelskonflikt gewarnt. China werde alle notwendigen Schritte ergreifen, um die EU-Maßnahmen zu kontern. rtr
Der Verband Ecommerce Europe und 16 weitere nationale E-Commerce-Verbände fordern eine faire Wettbewerbssituation und eine effektivere Durchsetzung des EU-Rechts gegenüber nicht in der EU ansässigen Akteuren. In einem offenen Brief verlangen sie, dass “E-Commerce-Akteure, die in der EU tätig sind, aber in Nicht-EU-Ländern ansässig sind, denselben Regeln unterliegen sollten wie Unternehmen mit Sitz in der EU”. Das soll sicherstellen, dass EU-basierte Unternehmen keinen Wettbewerbsnachteil haben.
Hintergrund der Forderungen ist der rapide Erfolg asiatischer E-Commerce-Händler wie Shein und Temu. Diese Unternehmen nutzen erhebliche finanzielle Ressourcen und aggressive Marketingstrategien, um schnell in den europäischen Markt vorzudringen. Zudem profitieren sie nach Angaben der Unterzeichner von staatlichen Subventionen in ihren Heimatländern, was ihre Wettbewerbsfähigkeit weiter stärke. Im Brief kritisieren sie, dass solche Praktiken zu ungleichem Wettbewerb führen und EU-Unternehmen benachteiligen.
Die Verbände weisen darauf hin, dass EU-basierte Unternehmen umfangreichen Gesetzen und hohen Compliance-Kosten unterliegen. Nicht-EU-basierte Akteure hielten diese Regeln oft nicht ein. Nationale Behörden seien häufig unterbesetzt. Zudem erschwere mangelnde Koordination die Durchsetzung der EU-Regeln. Dies verschaffe nicht-EU-Akteuren, die die Regeln ignorierten, einen unfairen Wettbewerbsvorteil. Auch werfen die kommerziellen Praktiken dieser Akteure nach Ansicht der Unterzeichner Fragen zur Einhaltung von Vorschriften in den Bereichen Verbraucherschutz, Produktsicherheit, Datenschutz, Privatsphäre, Umwelt- und Steuerrecht auf.
Daher fordern die Verbände Kommission, Mitgliedstaaten und zuständige Behörden auf, alle notwendigen Mittel bereitzustellen, um die Aktivitäten nicht in der EU ansässiger Akteure genauso gründlich zu kontrollieren und bei Verstößen genauso zu sanktionieren wie EU-basierte Akteure. Dafür sei eine tiefere Zusammenarbeit und Koordination zwischen den EU-Mitgliedstaaten und ihren Behörden notwendig. Diese könne eine konsistente Anwendung der Vorschriften gewährleisten und somit echte Chancengleichheit im EU-Binnenmarkt ermöglichen. vis
Der Internationale Währungsfonds (IWF) und die People’s Bank of China haben die Eröffnung eines neuen IWF-Regionalzentrums in Shanghai bekannt gegeben. Das Zentrum soll laut einem Statement des IWF dazu beitragen, den Dialog mit den Mitgliedsländern und anderen Interessengruppen in der Region zu vertiefen, darunter internationale Finanzinstitutionen, Akademiker, Thinktanks, Organisationen der Zivilgesellschaft und des Privatsektors.
China hält 6,08 Prozent des Stimmrechtsanteils des IWF und liegt damit an dritter Stelle, nach den Vereinigten Staaten (16,5 Prozent) und Japan (6,14 Prozent). China wünscht sich mehr Mitspracherecht im internationalen Finanzsystem, um Chinas wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit gerecht zu werden. Der Anteil des Landes an der globalen Wirtschaftsleistung liegt bei rund 19 Prozent. flee
Ecuador hat die visafreie Einreise für chinesische Staatsbürger ausgesetzt und damit einen zunehmend häufig genutzten Eintrittspunkt in die Migrationsroute Richtung USA geschlossen. Das Außenministerium des südamerikanischen Landes begründete die Entscheidung mit einem Anstieg der illegalen Migrationsströme aus China. In einer Erklärung in den sozialen Medien teilte das Ministerium mit, viele chinesische Reisende hätten zuletzt den erlaubten 90-Tage-Zeitraum überschritten und Ecuador möglicherweise als Ausgangspunkt genutzt, um andere Ziele in der Region zu erreichen.
Das Ministerium erklärte, dass in den letzten Monaten fast die Hälfte der Besucher aus China nicht rechtzeitig über reguläre Routen ausgereist sei. Bereits seit 2022 war die Zahl der chinesischen Bürger, die nach Ecuador einreisen, ohne eine Ausreise zu registrieren, gestiegen. Zwischen 2023 und 2024 reisten 66.189 chinesische Bürger und Bürgerinnen in das Land ein, jedoch nur 34.209 wieder aus. Viele der in Ecuador ankommenden chinesischen Bürger reisen in Richtung der Vereinigten Staaten.
Die Migranten entscheiden sich für die lebensgefährliche Route durch den Darién Gap zwischen Kolumbien und Panama. Die Strecke durch den dichten Regenwald gilt als eine der gefährlichsten Migrationsrouten der Welt. Neben Gefahren aufgrund der schwierigen Vegetation sind die Gruppen regelmäßig den Drogen-Kartellen in der Region ausgesetzt, werden angegriffen, bedroht, erpresst oder verschleppt.
Auf die Frage nach der Aussetzung der Visumpflicht für Ecuador sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Lin Jian, dass China jede Form des Menschenschmuggels entschieden ablehne. Chinas Strafverfolgungsbehörden arbeiten mit den betreffenden Ländern zusammen, um gemeinsam gegen Menschenschmuggel vorzugehen, illegale Einwanderer zu repatriieren und für Ordnung im grenzüberschreitenden Reiseverkehr zu sorgen, sagte Lin. rtr/ari

Robert Habeck landet am Freitag zum ersten Besuch seiner Amtszeit in China. Als Klimaschutzminister ist er dort besonders gefragt. Denn China ist zweifelsohne der Schlüsselakteur für erfolgreichen globalen Klimaschutz – in mehrfacher Hinsicht:
Deshalb ist es höchste Zeit, dass die Bundesregierung den klimapolitischen Beziehungen zu China einen höheren Stellenwert einräumt. Wichtige Grundlagen dafür sind seit Beginn der Legislatur mit der Klimaaußenpolitik-Strategie, der China-Strategie und dem vor einem Jahr zwischen Deutschland und China vereinbarten Transformationsdialog gelegt.
Nun kommt es darauf an, eine realistische und strategische China-Klimapolitik tatsächlich umzusetzen. Leitmotiv dabei sollte “nicht-naive Kooperation” sein. Denn eine erstrebenswerte deutsche China-Klimapolitik umfasst zwar Kooperation in den Bereichen, in denen diese weiterhin sinnvoll und möglich ist – aber auch klar formulierte Erwartungen sowie einen anderen Umgang mit Drittstaaten.
In sechs Bereichen kann Robert Habeck in den nächsten Tagen in Peking Akzente setzen: Erstens sollte er anerkennen, dass wir für die erforderliche Transformation weiter in großem Umfang Importe aus China brauchen werden, aber gleichzeitig erklären, warum Europa seine Lieferketten bei Zukunftstechnologien wie Erneuerbaren Energien oder Elektromobilität diversifizieren will. Das bedeutet auch den Aufbau eigener Fertigungskapazitäten – aber nicht die Schließung des Marktes.
Zweitens sollte er einfordern, dass die ökologischen und sozialen Bedingungen in der Lieferkette – zum Beispiel für Solarzellen – sich verbessern müssen. Weder der Einsatz von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern noch die ausschließliche Nutzung von dreckigem Kohlestrom sind hierbei akzeptabel. Die deutschen und europäischen Lieferkettengesetze sind die besten Instrumente, um tatsächlich Verbesserungen in der Lieferkette zu erreichen, weil sie verbindlich für alle größeren Unternehmen gelten. Mit öffentlichen Überlegungen zum “Aussetzen” des deutschen Gesetzes hat Habeck die Glaubwürdigkeit dieser Position nicht gestärkt. Umso wichtiger, dass er klarstellt, dass verbindliche Sorgfaltspflichten kommen werden und wie China die dafür notwendige Transparenz schaffen kann.
Drittens bleibt der hohe Anteil der Kohleverstromung das größte klimapolitische Problem in China. Hier sollte der Minister einerseits klare Erwartungen formulieren: China muss die eigene Zusage aus 2021, den Zuwachs von Kohlekraftwerken streng zu begrenzen, endlich einhalten, und darüber hinaus im nächsten Fünfjahresplan den Einstieg in den Kohleausstieg schaffen. Andererseits kann Robert Habeck verstärkten Austausch zwischen Fachleuten beider Länder anbieten.
Viertens kann die Zusammenarbeit mit Deutschland dazu beitragen, eine gewisse Akteursvielfalt auch in der chinesischen Klimapolitik zu stärken, über die Zentralregierung hinaus. Im Rahmen des Transformationsdialogs ist beispielsweise eine Zusammenarbeit auch mit Provinzen vorgesehen – ein sinnvoller Ansatz. Zudem sollte die deutsche Seite darauf drängen, dass in den Austausch- und Kooperationsformaten auch Fachleute aus Forschungsinstituten und Zivilgesellschaft aus beiden Ländern eingebunden werden.
Fünftens ist es keine Übertreibung, zu sagen, dass die künftige Erhitzung der Erde maßgeblich vom neuen chinesischen Klimaziel für 2035 abhängt, welches China – so wie alle Länder – spätestens im Februar 2025 bei der UN einreichen muss. Bislang deuten die Zeichen darauf hin, dass China zwar diese Frist einhalten will, aber kein angemessenes ambitioniertes Ziel plant. Dies muss in allen hochrangigen Gesprächen Thema sein – es hilft, wenn der Vizekanzler des größten EU-Mitgliedstaats die Bedeutung dieser Frage unterstreicht. Wirksam wird dies nur dann sein, wenn Habeck auch zusagen kann, dass die EU selbst möglichst früh ein ambitioniertes, am 1,5-Grad-Limit ausgerichtetes Ziel für 2035 und 2040 vorlegen wird.
Sechstens sollte Robert Habeck anbieten, dass China und Deutschland gemeinsam mehr für die Unterstützung anderer Staaten bei der Energiewende tun. Eine beschleunigte globale Energiewende kann ein Ventil für die Handelsspannungen um grüne Technologien sein. Auch wenn die EU den Anteil chinesischer Importe senken möchte, muss das keine sinkende Nachfrage für chinesische Produkte bedeuten, wenn beispielsweise Kohleländer wie Indonesien, Indien oder Südafrika ihre Energiewende beschleunigen und dabei zu großen Teilen auf Technologie aus China zurückgreifen.
Lutz Weischer ist Leiter des Berliner Büros der Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch. Martin Voss ist dort Referent für Klimadiplomatie und Kooperation mit Asien/China.

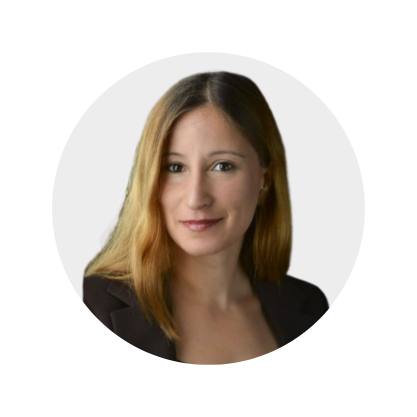
Marina Rudyak – Universität Heidelberg, Sinologin
Marina Rudyak ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sinologie der Universität Heidelberg. Sie ist Dozentin für chinesische Wirtschaftspolitik und internationale Beziehungen und hat zu chinesischer Entwicklungshilfe und Chinas Rolle in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit promoviert. Rudyak war mehrere Jahre lang als wirtschaftspolitische Beraterin für die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) in Peking tätig.

Thomas Heberer – Universität Duisburg-Essen, Professor
Thomas Heberer ist Politik- und Ostasienwissenschaftler. Bis 2013 hatte er den Lehrstuhl Politik Ostasiens an der Universität Duisburg-Essen inne. Dort hält er eine Seniorprofessur für die Politik und die Gesellschaft Chinas. Heberer arbeitete von 1977 bis 1981 als Lektor und Übersetzer am Verlag für Fremdsprachige Literatur in Peking. Gegenwärtig arbeitet Thomas Heberer über Prozesse der Sozialdisziplinierung und Zivilisierung im Modernisierungsprozess Chinas. Zuletzt löste er mit einem Beitrag über die Situation der Uiguren in Xinjiang eine lebhafte Debatte aus.

Sarah Kirchberger – Direktorin des Institut für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel
Sarah Kirchberger ist seit Juli 2023 akademische Direktorin und Abteilungsleiterin für strategische Entwicklung in Asien-Pazifik am Institut für Sicherheitspolitik der Christian-Albrechts-Universität in Kiel. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören der transatlantische Umgang mit Chinas Aufstieg, die Entwicklung der Volksbefreiungsarmee sowie der Taiwan-Konflikt. Sie ist zudem Nonresident Senior Fellow am Scowcroft Center for Strategy and Security, Atlantic Council und Vizepräsidentin des Deutschen Maritimen Instituts (DMI).

Gunter Schubert – Universität Tübingen, Professor
Gunter Schubert führt regelmäßige Feldforschungen in der Volksrepublik China, Taiwan und Hongkong durch und pflegt ein enges Netzwerk mit Wissenschaftlern und akademischen Institutionen in Ostasien. Er hat zahlreiche Publikationen in deutscher, englischer, französischer und chinesischer Sprache in hochrangigen internationalen Fachzeitschriften veröffentlicht. Schubert ist Mitglied des Executive Editorial Board des International Journal of Taiwan Studies, Mitherausgeber von Issues & Studies und sitzt in den Editorial Boards zahlreicher wissenschaftlicher Zeitschriften in den USA, Europa, China und Taiwan.

Kristin Shi-Kupfer – Universität Trier, Professorin
Kristin Shi-Kupfer ist Professorin für Sinologie an der Universität Trier und Senior Associate Fellow bei Merics. Sie ist Expertin für Chinas Digitalpolitik, Ideologie und Medienpolitik sowie Zivilgesellschaft und Menschenrechte. Shi-Kupfer promovierte an der Ruhr-Universität Bochum zum Thema “Emergence and Development of Spiritual-Religious Groups in China after 1978”. Von 2007 bis 2011 war sie als Journalistin in China tätig. Sie berichtete von dort unter anderem für Zeit Online, taz, epd, und Südwest Presse.

Björn Alpermann – Universität Würzburg, Professor
Björn Alpermann ist einer der führenden Xinjiang-Forscher in Deutschland, der mit seiner Arbeit zur Aufdeckung der staatlichen Unterdrückung der Uiguren beiträgt. Er studierte Moderne China-Wissenschaften, Politikwissenschaft und Volkswirtschaftslehre in Köln und Tianjin. Von 1999 bis 2008 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Ostasiatischen Seminar der Universität Köln. 2006 promovierte er im Fach Moderne China-Studien. 2008 bis 2013 war er Juniorprofessor für Contemporary Chinese Studies an der Universität Würzburg und besetzte vertretungsweise den neu eingerichteten Lehrstuhl China Business and Economics.

Markus Taube – Universität Duisburg-Essen, Professor
Markus Taube ist Inhaber des Lehrstuhls für Ostasienwirtschaft und China der Mercator School of Management sowie Direktor der In-East School of Advanced Studies an der Universität Duisburg-Essen. Taube ist außerdem Co-Direktor des Konfuzius-Instituts Metropole Ruhr. Er ist amtierender Präsident der Euro-Asia Management Studies Association (EAMSA) und hält diverse Gastprofessuren in China.

Adrian Zenz – Victims of Communism Memorial Foundation, Senior Fellow and Director China Studies
Adrian Zenz hat mit seiner Forschung weltweit das Bewusstsein für die Einrichtung von Umerziehungslagern durch den chinesischen Staat sowie das staatliche Zwangsarbeitssystem geschaffen. Zenz promovierte in Sozialanthropologie an der Universität von Cambridge. Er führte ethnografische Feldforschung in Westchina in chinesischer Sprache durch und analysiert regelmäßig chinesisches Originalquellenmaterial. Zenz hat für die Regierungen Deutschlands, Frankreichs, des Vereinigten Königreichs, Kanadas und der Vereinigten Staaten als Experte ausgesagt.

Doris Fischer – Universität Würzburg, Professorin
Doris Fischer hat den Lehrstuhl für China Business and Economics an der Universität Würzburg inne. Fischer hat Betriebswirtschaftslehre und Sinologie in Hamburg und Wuhan studiert und in Volkswirtschaftslehre an der Universität Gießen promoviert. Im Mittelpunkt ihrer zahlreichen Forschungsarbeiten zu Wettbewerb, Regulierung sowie Industriepolitik stehen Chinas Wirtschaftspolitik und die damit verbundenen Anreizstrukturen für ökonomische Akteure.

Klaus Mühlhahn – Zeppelin Universität Friedrichshafen, Präsident
Klaus Mühlhahn ist Präsident der Zeppelin Universität und Inhaber des Lehrstuhls für Moderne China-Studien. Mühlhahn gilt als einer der renommiertesten Sinologen in Deutschland. Sein Studium und seine Promotion in Sinologie absolvierte er an der FU Berlin. Seine Forschung führte ihn nach Berkeley, Turku und Indiana, bevor er als Professor für chinesische Geschichte und Kultur an die FU Berlin zurückkehrte. 2020 wurde er dann an die ZU berufen.
Lionel Dumont ist seit Juni Head of Mechanical Design and Simulation / e-powertrain Development bei VW China. Sein Einsatzort ist Tianjin.
Jonathan Chin ist neuer Head of Human Pharmaceuticals China, Hong Kong/Macau and Taiwan bei Boehringer Ingelheim. Chin ist seit 21 Jahren für den deutschen Pharma-Konzern tätig, zuletzt als General Manager Hong Kong and Macau. Er arbeitet in Shanghai.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Ganz in Weiß und gut verhüllt – bei Temperaturen von mehr als 40 Grad versuchen die Menschen in Shenyang sich so gut es geht vor Hitze und Sonnenstrahlen zu schützen. Während hierzulande die Hüllen fallen, setzt diese Frau auf die reflektierende Wirkung der Farbe Weiß. Die Aussichten für die nächsten Tage: Es bleibt brütend heiß.
