US-Außenminister Antony Blinken wird in der kommenden Woche zum zweiten Mal in weniger als einem Jahr China besuchen. Ganz oben auf der Liste der Gesprächspunkte: Russland und die Unterstützung für Moskau aus Peking.
Wie es tatsächlich um das Dreieck aus USA, China und EU steht, ist eines der Hauptthemen unseres Gesprächs mit Gunnar Wiegand. Dieser war mehr als drei Jahrzehnte EU-Diplomat und ist jetzt Visiting Distinguished Fellow im beim German Marshall Fund of the United States (GMF).
Die Position Pekings im Krieg gegen die Ukraine ist Wiegand zufolge von immer größerer Bedeutung für das Verhältnis zwischen China und Europa. “Denn der Krieg Russlands gegen die Ukraine geht weiter, wird intensiver. China ist, ob gewollt oder nicht, inzwischen der wichtigste wirtschaftliche, finanzielle und technologische Stützpfeiler der Kriegswirtschaft Russlands.” Wiegand mahnt ein gemeinsames europäisches Vorgehen an.
Am Donnerstag startet in Peking die Automesse. Inzwischen handelt es sich um die wichtigste Branchenveranstaltung ihrer Art. Unserer besonderer Fokus liebt dabei auf der neuen, starken Konkurrenz, die Deutschland in Fernost erwächst. Den Anfang macht heute eine Analyse zu Xpeng. Der aufstrebende Hersteller will mit einer Modelloffensive durchstarten.
In den kommenden Tagen werden wir Sie weiter mit Auto-Analysen und Interviews versorgen. Wir sind auf der Messe mit zwei Kollegen vertreten.


Wagen wir ein Blick in die Zukunft: Wer wird in neun Monaten Ihrer Einschätzung nach im Weißen Haus sitzen?
Kein Thinktank besitzt die Kapazität des Wahrsagens. Wir blicken auf die demokratischen Prozesse. Wir wissen alle, dass die Situation in den USA offen ist und dass die eine oder andere Kandidatenauswahl vom US-amerikanischen Volk getroffen werden kann. Auch was die Endauswahl angeht, haben wir schon mehrfach gesehen, dass andere Präsidenten als die, die die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhalten hatten, sich im Wahlsystem durchsetzen konnten. Ich denke, wir müssen realistisch sein. Nicht nur hier in Brüssel, sondern in allen Teilen der Welt sollte mit der Möglichkeit gerechnet werden, dass der Herausforderer und frühere Präsident auch wieder US-Präsident werden könnte. Das würde dann natürlich gewisse Auswirkungen haben auf die Politik in Washington, sowohl gegenüber Europa als auch gegenüber China und Russland.
Und wer wird Ihrer Einschätzung nach EU-Kommissionspräsidentin oder -präsident?
Das ist noch schwieriger. Im Unterschied zu den US-Wahlen besteht hier noch weniger Vorhersehbarkeit: Die Spitzenkandidaten sind nicht alle auch Kandidaten für das EU-Parlament. Zudem muss der Vorschlag zunächst vom Europäischen Rat gemacht werden, der dann vom Europäischen Parlament bestätigt werden muss. Aber ich denke, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Kandidat der stärksten Fraktion im Parlament zum Präsidenten der Europäischen Kommission ernannt wird. Wir können davon ausgehen, dass es relativ gute Chancen für die gegenwärtige Amtsinhaberin gibt.
Im Dreieck USA, China, EU – was sind die wichtigsten Punkte für die kommenden Jahre?
Die wichtigste Frage, mit der alle drei zu tun haben werden: Wie richten wir unseren Handel aus? Das war der Knackpunkt zwischen der Regierung unter Donald Trump und China. Die Maßnahmen, die damals getroffen wurden, nämlich die unilaterale Verhängung von erheblichen Zöllen gegen China und auch gegen andere Handelspartner wie Europa sind gegenwärtig suspendiert. Zusätzliche Bedeutung gewinnt das Thema dadurch, dass wir eine ständig wachsende Kapazität der Überproduktion in China haben, nicht nur bei Stahl und Aluminium, sondern insbesondere bei Solaranlagen, elektrischen Autos und Windkraftanlagen. Das wird zu einem großen Teil mit Subventionen erreicht. Diese strukturelle Überproduktion muss irgendwo abgesetzt werden. Hier müssen wir sicherlich zu neuen Politikansätzen kommen, sowohl im Erzeugerland als auch in den Absatzmärkten, um damit so umzugehen, dass es nicht zu einer Deindustrialisierung in unseren Ländern kommt.
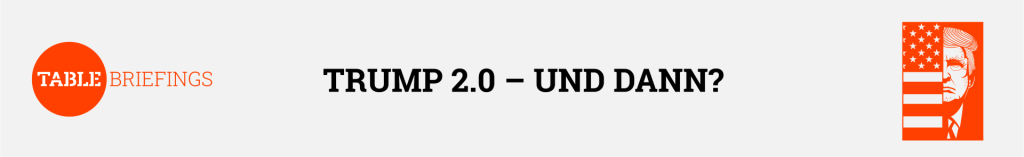
Und neben dem Handel?
Die Frage von Taiwan. Welchen Stellenwert nimmt das Ziel der Vereinigung in der Politikgestaltung in Peking ein? Und wie wird darauf reagiert in Europa und den USA? Wenn die roten Linien eingehalten werden, also keine Mittel der Gewalt eingesetzt werden oder damit gedroht wird, dann wird das auch geachtet werden in Washington und Brüssel. Es muss einen Prozess in gegenseitigem Einvernehmen geben zwischen der Führung in Taiwan und der Führung in China, dessen Ergebnisse demokratisch legitimiert werden müssen. Auch die Themen der wirtschaftlichen Sicherheit bei Spitzentechnologien und möglichen Lizenzierungen von Exporten und Auslandsinvestitionen bleiben wichtig.
Aber von immer größerer Bedeutung für Europas Verhältnis mit China wird die immer engere Verbindung zwischen China und Russland. Denn der Krieg Russlands gegen die Ukraine geht weiter, wird intensiver. China ist, ob gewollt oder nicht, inzwischen der wichtigste wirtschaftliche, finanzielle und technologische Stützpfeiler der Kriegswirtschaft Russlands. Das wird zunehmend zu einem Problem der europäischen Sicherheit.
Was würde ein Präsident Trump für Taiwan bedeuten?
Ich denke, Trump würde die strategische Ambiguität der US-Position in der Unterstützung Taiwans nicht infrage stellen. Er hat das während seiner ersten Präsidentschaft und auch bisher nicht im Wahlkampf getan. Von daher sollte man jetzt nicht zu voreiligen Schlüssen kommen, was Taiwan angeht, auch wenn Trump im handelspolitischen Bereich, sagen wir mal, eine sehr viel robustere Haltung auch gegenüber Taiwan eingenommen hatte.
Sie sind seit knapp einem halben Jahr nicht mehr Teil des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EEAS). Wie sehen Sie die Arbeit jetzt von außen in Bezug auf China?
Die EU verfolgt einen ganzheitlichen Kurs, der zwar manchmal komplex und auch langsamer ist als gewollt, aber der sich insgesamt doch erheblich entwickelt hat, auf einer Basis des Realismus. Nehmen wir China mit seinen Ambitionen und den Kapazitäten, die es aufbaut. Seit 2019 können sich alle EU Mitgliedsstaaten hinter dem Ansatz versammeln, China gleichzeitig als Partner, Wettbewerber und systemischen Rivalen zu sehen. Wir sehen, dass eine ganze Reihe an Verordnungen und Richtlinien seither angenommen worden, mit welchen die normative und wirtschaftliche Kraft Europas besser zum Einsatz gebracht werden kann, angesichts fehlender bilateraler Abkommen mit China. Ich möchte darauf hinweisen, dass diese ganzen Gesetzesvorhaben immer die Zusammenarbeit braucht zwischen Rat und Parlament. Deswegen hat das gedauert.
Was hat sich konkret getan?
Es hat sehr viel mehr Realismus in den Mitgliedstaaten selbst gegeben. Schauen Sie sich an, wie viel Konfuzius-Institute es heute an unseren Universitäten gibt und wie viele es vor einigen Jahren gab. Oder wie viele Mitgliedsstaaten noch bei Chinas Belt and Road Initiative mitmachen. Auch der 17+1 Prozess zwischen den osteuropäischen Ländern und China ist zum Erliegen gekommen. Es hat also auch auf nationaler Ebene ein Umdenken gegeben, und gemeinsames EU-Handeln ist viel wichtiger geworden. Die wichtigste Aufgabe, wo jetzt sehr viel mehr Gemeinsamkeit gefunden werden muss und auch Entscheidungen klar gefällt werden müssen, ist im Bereich der strukturellen Überproduktion in China und wie man damit umgeht. Da ist noch viel zu tun.
Gunnar Wiegand ist Visiting Distinguished Fellow im Indo-Pazifik-Programm des German Marshall Fund of the United States (GMF). Wiegand war von Januar 2016 bis August 2023 Leiter der Asienabteilung des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EEAS). Zuvor war er stellvertretender Leiter für die Abteilung Europa und Zentralasien sowie Direktor der Abteilung für Russland, Östliche Partnerschaft, Zentralasien und OSZE.

In den kommenden drei Jahren möchte Xpeng 30 neue Modelle auf den Markt bringen – nach den üblichen Standards der Fahrzeugindustrie eine hohe Zahl. Das geht aus einem internen Schreiben an die Beschäftigten hervor, über das das Online-Medium CN-EV-Post berichtet. Dazu gehören unter anderem preisgünstigere Modelle unter umgerechnet 20.000 Euro für den globalen Markt. Angesichts eines umkämpften Heimatmarktes muss Xpeng schnell wachsen, um durch Skaleneffekte rentabel zu werden. Doch so einfach ist es nicht mehr. Der chinesische Automarkt leidet unter enormen Überkapazitäten.
Xpeng hat ein durchwachsenes Jahr hinter sich. 2023 hat das Unternehmen 142.000 Autos abgesetzt. Einerseits ist das eine Steigerung um 17 Prozent im Vergleich zu 2022, andererseits verfehlten das Unternehmen das eigene Absatzziel (200.000 Stück) deutlich.
Damit machte die Marke einen Verlust von stattlichen 1,4 Milliarden Euro (zehn Milliarden Yuan). Analysten zeigten sich davon sogar positiv überrascht. Sie hatte ein Minus von 1,5 Milliarden Euro erwartet. Auch 2024 hat nicht wirklich viel sprechend begonnen – nur etwa 22.500 Fahrzeuge hat Xpeng im ersten Quartal ausgeliefert.
Bei Xpeng weiß man um die Situation. Entsprechend martialisch ist auch das interne Schreiben an die Belegschaft formuliert. Man werde in eine “neue Phase des Blutbades” eintreten, zitiert die South China Morning Post aus dem Schreiben. Doch die Konsequenzen daraus sind andere als erwartet. Statt Personal einzusparen, verspricht He Xiaopeng, Gründer und Vorstandsvorsitzender des gleichnamigen Elektroautoherstellers, bis Jahresende 4.000 neue Jobs zu schaffen.
Außerdem möchte die Marke 450 Millionen Euro (3,5 Milliarden Yuan) in die Entwicklung intelligenter Autos investieren – so viel wie noch nie zuvor in der Firmengeschichte. Diese Aufstockung der Investitionen ist dringend notwendig ist. Nio (13, Milliarden Yuan) und Li Auto (10,6 Milliarden Yuan) haben im vergangenen Geschäftsjahr deutlich mehr ausgegeben.
Mit dieser Offensive möchte Xpeng die Früchte ernten, die sie im abgelaufenen Geschäftsjahr gesät haben. Das war nämlich von einigen Umstellungen geprägt. Dazu gehörte unter anderem der Vetrieb, wie Caixin Global berichtet. Xpeng hatte zwei unterschiedliche Vertriebskanäle. Zum einen die eigenen Autohäuser und zum anderen – was erst später dazu kam – der Verkauf über externe Händler. Da beide Sparten innerhalb von Xpeng konkurrierten, nahmen sie sich gegenseitig die Kunden weg. Seit 2023 sind beide Kanäle unter Vizepräsident Wang Tong vereint und unrentable Händler mussten schließen. Aktuell hat Xpeng 254 eigene und 166 externe Händler.
Nicht nur den Vertrieb, auch die Lieferkette hat das Unternehmen aufgeräumt. Dank einer neuen Architektur für ihre Fahrzeuge können 80 Prozent der wichtigen Teile über beinahe alle Modelle hinweg verbaut werden. Das verkürzt auch die Entwicklungszeit für neue Modelle enorm. Ein Vorteil, der in naher Zukunft wichtigen werden soll. So kommt die Zahl von 30 neuen Modellen zustande, die geplant sind.
Darunter finden sich zwei Modelle, die Xpeng unter einer einem neuen Markennamen herausbringen möchte. Der Projektname lautet “Mona”. Die Autos der Marke sollen zwischen 13.000 und 20.000 Euro kosten und damit etwa halb so viel wie die bisherigen Fahrzeuge von Xpeng. Damit greift Xpeng direkt BYD an, die sich auf diese Fahrzeugklasse spezialisiert haben. Der Konzern hat im Jahr 2023 knapp über drei Millionen Elektro- und Plug-in-Fahrzeuge verkauft, die zu großen Teilen unter 20.000 Euro zu haben sind.
Xpeng plant darüber hinaus zwei weitere Modelle, die gemeinsam mit Volkswagen bis zum Jahr 2026 entstehen. Volkswagen setzt auf Xpeng und ist eine Kooperation eingegangen. Der Konzern aus Wolfsburg hat 700 Millionen Euro für einen Anteil von 4,99 Prozent an dem chinesischen Hersteller gezahlt. In einem “Master Agreement” hieß es nun, dass die beiden Unternehmen eine gemeinsame Plattform und Software für E-Autos entwickeln wollen. Durch die gemeinsame Beschaffung von Teilen sollen außerdem die Kosten reduziert werden.
Kernkompetenz von Xpeng sollen über alle Preisklassen hinweg die intelligenten Fahrassistenzsysteme und die dahintersteckende Künstliche Intelligenz sein. Eine Technologie, die allerdings kein Alleinstellungsmerkmal auf dem chinesischen Markt ist. Nicht nur BYD und die anderen Autofirmen, auch Tech-Riesen wie Huawei und Xiaomi mischen mittlerweile auf dem Automarkt mit.
Doch Xpeng ist trotz der Verluste für die Aufholjagd gut gerüstet. Die Umstellungen und Kosteneinsparungen zeigen erste Erfolge, so Brian Gu, der Ehrenvize- und Co-Präsident des Unternehmens. Die Marge sei um zehn Prozent gestiegen und die Barmittel würden mittlerweile fast sechs Milliarden Euro betragen.
Zwischen 2010 und 2014 haben sich chinesische Angreifer immer wieder Zugriff auf die Computer von Volkswagen verschafft und technisches Firmenwissen abgesaugt. Das berichten das ZDF und der Spiegel unter Berufung auf Dokumente über die Abwehr der Cyberattacke. Hinter dem Angriff standen vermutlich staatliche Stellen. Es gebe eine “Spur” in Richtung Volksbefreiungsarmee, sagte einer der Insider. Zudem haben sie zu festen Arbeitszeiten gearbeitet, die auf das Vorgehen von Beamten hindeuten. Es handelte sich seinerzeit um einen der größten Cyberangriffe weltweit.
Bei den Informationen, die die Hacker heruntergeladen haben, handelt es sich beispielsweise um Programmcode für die Getriebesteuerung, aber auch technische Daten aus dem Bereich Elektromobilität oder Brennstoffzellen. In welchen Produkten in China die Kenntnisse eventuell später zum Einsatz kamen, ist nicht bekannt.
Es hat 2015 erheblicher Mühe und einer großen Aktion bedurft, um die Angreifer wieder aus den Systemen auszusperren. Volkswagen hat seitdem seine IT-Sicherheit überarbeitet. Die Enthüllung fällt kurz vor die Pekinger Automesse in ein Klima zunehmender China-Skepsis in Teilen von Regierung, Gesellschaft und Wirtschaft. VW will allerdings mehr denn je in China investieren. Auf mutmaßliche Verbindungen nach China reagierte die chinesische Botschaft in Berlin den Berichten zufolge empört und betonte, dass das Land jede Form von Cyber-Spionage verurteile. fin
Im Kampf gegen die schwächelnde Nachfrage hat der US-Elektroautobauer Tesla erneut seine Preise gesenkt. Damit dreht sich die Rabattspirale immer schneller nach unten. In China sind Tesla-Modelle noch einmal etwa 2.000 Dollar günstiger geworden, wie aus Angaben auf der offiziellen Internetseite des Autobauers am Sonntag hervorging. Bereits am Freitag wurden Preissenkungen in ähnlicher Höhe in den USA bekannt.
Derzeit schwächelt weltweit der Markt für Elektroautos. Tesla war mit einem deutlichen Absatzrückgang in das Jahr gestartet. Es war das erste Mal seit fast vier Jahren, dass das Unternehmen weniger Fahrzeuge verkauft hat als vor Jahresfrist. Der chinesische Anbieter BYD ist Tesla auf den Fersen. Dazu kommt die härtere Konkurrenz durch Branchenneulinge sowie das wachsende Angebot an Elektroautos etablierter Hersteller wie VW. Ein weiterer treibender Faktor für die sinkenden Preise sind Chinas Überkapazitäten. Chinas Autobauer sind nur zu 70 Prozent ausgelastet. rtr
Chinas Führung hat Apple angewiesen, Whatsapp aus dem App Store in der Volksrepublik zu entfernen. Der US-Konzern hat bereits eingewilligt. Man sei gezwungen, die Gesetze der Länder zu befolgen, in denen man aktiv sei, heißt es. Die chinesische Internet-Regulierungsbehörde begründe diese Anordnung mit “Bedenken rund um die nationale Sicherheit”, zitiert das Wall Street Journal den Apple-Konzern. Auch die mit X (ehemals Twitter) konkurrierende App Threads aus dem Facebook-Konzern darf im App Store von Apple in China nicht mehr zum Herunterladen angeboten werden.
Whatsapp ist in China ohnehin schon seit Jahren nur über VPN-Dienste nutzbar, die den Datenverkehr so umleiten, dass er aus einem anderen Land zu kommen scheint. Im Land selbst sind fast alle westlichen Kurznachrichtendienste und soziale Medien blockiert. WhatsApp konnte dennoch bislang aus dem App Store auf die Geräte geladen werden. flee
Das US-Repräsentantenhaus hat der Video-App Tiktok am Samstag ein Ultimatum für die Loslösung von ihrem chinesischen Mutterkonzern Bytedance gestellt. Eine Mehrheit der Parlamentarier beider Parteien stimmte für den Antrag. Wenn die US-Tochter sich nicht von der chinesischen Mutter loslöst, soll Tiktok in den USA aus den App-Stores von Apple und Google verbannt werden. Der Senat muss der Vorlage noch zustimmen, damit sie in Kraft treten kann.
Kritiker von Tiktok werfen der Plattform Nähe zur chinesischen Regierung und etwaige Datenspionage vor. Tiktok weist alle Vorwürfe zurück. Ob die Regierung in Peking einem Verkauf des US-Anteils zustimmen würde, ist unklar. Die App mit 170 Millionen amerikanischen Nutzern ist vor allem bei Jugendlichen beliebt. Der Streit ist im US-Wahlkampf zu einem wichtigen Thema geworden. rtr
Der Boden unter vielen chinesischen Städten sinkt stetig ab. 45 Prozent der städtischen Gebiete des Landes sinken mit einer Geschwindigkeit von mehr als drei Millimetern pro Jahr ab, berichtete die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf eine chinesische Studie, die im Fachmagazin “Science” erschienen ist. Bei 16 Prozent sind es demnach sogar mehr als zehn Millimeter pro Jahr. Ursache der Absenkung ist demnach vor allem Entnahme von Grundwasser aus Gesteinsschichten unterhalb der Städte und das Gewicht von Gebäuden durch den enormen Bauboom im Land.
Zu den von Absenkung stark betroffenen Städten gehören auch die Hauptstadt Peking sowie die Hafenmetropole Shanghai mit ihren jeweils weit über 20 Millionen Einwohnern, so der Bericht. Manche Gebiete von Shanghai haben sich im vergangenen Jahrhundert um bis zu drei Meter abgesenkt, was schon länger bekannt ist.
Ein Team um den Forscher Zurui Ao von der South China Normal University in Foshan hatte für die Studie aber nun Satellitenmessungen aus den Jahren 2015 bis 2022 von 82 chinesischen Großstädten ausgewertet, in denen knapp drei Viertel der urbanen Chinesen leben. Von den Satelliten aus lassen sich mittels Radar Bodenverformungen verfolgen. Von Absenkungen um mehr als drei Millimeter ist demnach knapp ein Drittel (29 Prozent) der Bevölkerung dieser Städte betroffen. Stand 2020 lebten den Forschenden zufolge insgesamt 920 Millionen Chinesen in urbanen Regionen – davon geschätzt etwa 270 Millionen auf sinkendem Boden.
Die Folgen sind bereits zu spüren. Setzungsbedingte Katastrophen haben laut der Studie in China in den vergangenen Jahrzehnten bereits hunderte Tote und Verletzte jährlich sowie immense wirtschaftliche Schäden verursacht. Außerdem steigt in den dicht besiedelten Küstenregionen die Gefahr von Überschwemmungen. Durch die Kombination von Bodenabsenkung und den aus der Klimakrise resultierenden Meeresspiegelanstieg drohten bis 2120 22 bis 26 Prozent der chinesischen Küste unter dem Meeresspiegel liegen. Etwa jeder zehnte Küstenbewohner wäre davon betroffen, so die Studie. Auch drohen Schäden an Gebäuden und Fundamenten, Infrastruktur und Kanalisation.
“Die Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit, die Schutzmaßnahmen zu verstärken und die Grundwasserentnahme streng zu kontrollieren”, heißt es in der Studie. Sie wirbt für ein nachhaltigeres Wassermanagement, wie es etwa in den japanischen Städten Tokio und Osaka bereits erfolgreich praktiziert werde. Das könne die Absenkungsrate auch in China stabilisieren. Bodenabsenkungen infolge menschlicher Aktivitäten gibt es bereits in vielen Teilen der Welt. ck

Nach schweren Regenfällen in der südchinesischen Provinz Guangdong sind bei Erdrutschen mindestens sechs Menschen verletzt und weitere verschüttet worden. Unter Berufung auf die örtlichen Behörden meldete Chinas Staatssender CCTV, dass drei Orte im Becken des Bei-Flusses aufgrund starker Niederschläge Überschwemmungen erleben würden, “wie sie nur einmal in einem Jahrhundert vorkommen”, berichtete die Nachrichtenagentur AFP.
Sintflutartige Regenfälle haben seit Donnerstag in großen Teilen Guangdongs zu einem Anschwellen der Flüsse im Perlflussdelta und somit zu Überschwemmungen in den dortigen Bergregionen geführt. Von CCTV veröffentlichte Aufnahmen zeigten Häuser, die von einer Wand aus braunem Schlamm zerstört wurden. Zunächst gab es keine Berichte über Todesopfer oder darüber, wie viele Menschen von den Erdrutschen verschüttet wurden. Von den Unwettern und Überflutungen sind auch die Megastädte Hongkong, Shenzhen und Guangzhou betroffen.
Das Perlflussdelta ist eine der am dichtesten besiedelten Regionen der Welt. Der nationale Wetterdienst hatte Unwetterwarnungen für Teile Guangdongs ausgegeben und vor heftigen Stürmen in den Küstenregionen gewarnt. CCTV zufolge könnten Hochwasser von bis zu 5,8 Metern über der Warngrenze die Region am Montagmorgen treffen. flee

Der Tag beginnt für Alice Grünfelder jeden Morgen um sieben. Etwas unsanft wird sie zu dieser Stunde aus dem Schlaf geholt von den Glocken der benachbarten Kirche, die ab sieben Uhr morgens jede Viertelstunde läuten. “Mein Tag ist durch sie strukturiert, und bin ich einmal anderswo, lausche ich vergebens nach diesem Zeitmesser, der mich im Alltag doch so nervt.” Es passt zu ihrer Wahlheimat Zürich, dass der Tag genau getaktet ist. Zumindest will es so das Klischee.
Aber mit den Klischees, da war doch was. Man könnte sagen, Grünfelder steht auf keinem guten Fuß mit ihnen - vielmehr verwendet sie einen nicht unerheblichen Teil ihrer Lebenszeit darauf, gegen sie anzugehen. Vor allem gegen solche, mit denen die Europäer China und Asien einordnen.
Grünfelder hat mehrere Jahre in Asien verbracht. Nach ihrem Sinologie-Studium in Berlin war sie als Studienreiseleiterin viel in China unterwegs, vor allem in Tibet und Xinjiang. Mittlerweile hat sie China so oft bereist, dass sie auf die Frage nach der Zahl ihrer Besuche nur mit den Schultern zucken kann. “Ich habe es nicht gezählt.”
Grünfelders China-Faszination hat sie früh mit ihrer literarischen Neigung verknüpft, studierte neben Sinologie auch Neuere Deutsche Literatur und schloss noch vor dem Studium eine Ausbildung zur Buchhändlerin ab. Heute ist sie Lektorin, Literaturvermittlerin, Autorin und Übersetzerin. Sie schreibt über China und andere Länder Asiens, deren Menschen sie auf ihren vielen Reisen tief berührten. Mit ihren Veröffentlichungen versucht sie, den Lesern eine Stimmung des jeweiligen Landes zu vermitteln. “Ich möchte ausdrücken, worum es den Menschen wirklich geht, was sie denken und fühlen.”
Gerade hat sie ihren neuesten Roman fertiggestellt, für den sie nun einen Verlag sucht. Darin geht es um die 140.000 chinesischen Kriegsarbeiter, die während des Ersten Weltkriegs von den Franzosen und Briten rekrutiert worden waren. Grünfelder beschäftigt sich gerne mit jenen Themen, die anderswo kaum besprochen werden. Schon ihr erster Roman “Wüstengängerin”, der 2018 im Verlag Edition 8 erschien, spielt vor dem Hintergrund der Unruhen in Xinjiang und der Unterdrückung der Uiguren – als hierzulande noch kaum jemand darüber sprach.
Auf ihrem Schreibtisch liegen aktuell zwei Bände der taiwanischen Lyrikerin Tsai Wan-Shuen, die noch auf ihre Korrektur warten. Ihr Werk im deutschsprachigen Raum bekannt zu machen, ist so etwas wie eine Herzensangelegenheit. Von dieser Art Projekte hat Grünfelder noch einige im Kopf.
Und ihr derzeit größter Wunsch: ein längerer Aufenthalt in Keelong an der Nordküste Taiwans. “Dort möchte ich die verschiedenen kulturellen und historischen Schichten durchforsten, die mich bei meinem letzten Aufenthalt so fasziniert haben.” Sicher wird sie auch von dieser Reise wieder viele Einblicke mitbringen, die auf die eine oder andere Weise ihren Weg in die deutsche Literaturlandschaft finden werden. Svenja Napp
Howard Tan ist seit Februar Business Development Manager bei Würth in Shanghai. Er war zuvor Market Developer, ebenfalls für Würth.
Benjamin Sim wird zum 1. Juni Leiter der Region Greater China & Singapur bei Julius Bär. Sim kam 2016 zu dem Schweizer Vermögensverwalter und war dort unter anderem stellvertretender Niederlassungsleiter und Chief Operating Officer (COO) in Singapur und COO in Hongkong. Vor seiner Zeit bei Julius Bär arbeitete Sim bei Credit Suisse und HSBC.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Was haben Kaffeefahrten, die Coaching-Szene, Multi-Level-Marketing und Praktikanten-Ausbeutung gemein? Auf all diesen Feldern wird oft büschelweise chinesischer Schnittlauch geerntet! Sie haben richtig gehört, zumindest auf Ihrem chinesischen Ohr.
Schnittlauch ernten, genauer gesagt “Knoblauch-Schnittlauch schneiden”, auf Chinesisch 割韭菜 gē jiǔcài (von 割 gē “schneiden, durchtrennen” und 韭菜 jiǔcài “(chinesischer) Knoblauch-Schnittlauch, Schnittknoblauch”), nennen es die Chinesen nämlich, wenn den einfachen Leuten durch miese Maschen das Geld aus der Tasche gezogen wird.
Früher war das eine Metapher des Börsenjargons. Gemeint war das Schröpfen naiver Neulinge auf dem rutschigen Finanzparkett durch erfahrene Player, die den Aktienanfängern windige Fonds und Finanzprodukte andrehten. Sie warteten manchmal auch einfach, bis die nervösen Newbies ihre Aktienanteile panisch im falschen Moment abstießen, um die Papiere dann für günstiges Geld aufzukaufen – jiucai-Erntezeit für die Wertpapierwölfe eben. Das Abgrasen solcher Profite erschien schnittigen Finanzhaien wohl so easy, wie “schnipp-schnapp” büschelweise Schnittlauchhalme zu ernten. Schnittlauchtriebe sind zudem dafür bekannt, schnell nachzusprießen – genauso wie immer neue Anleger auf dem Börsenbeet nachwachsen, deren Heu sich dann wieder abernten lässt.
Mittlerweile übertragen chinesische Wortakrobaten die schnittige Sprachblüte auf alle erdenklichen Schröpf-Szenarien, in denen das Fußvolk als Goldesel eingespannt wird. Zum Beispiel auf die auch in China blühende Coaching-Branche, in der selbsternannte Gurus der erfolgsdürstenden Mittelschicht mit immer neuen Kursen und Erfolgsversprechen die digitalen Renminbis aus den Rippen leiern. Statt des erhofften Karriere- und Bank-Boosters für die Teilnehmenden schwingen sich die Wundercoaches letztlich einfach nur selbst auf der Einkommensleiter nach oben. Ebenfalls als Schnittlauchschneider verschrien sind in China dreiste Unternehmen, die junge Berufseinsteiger mit miesen Einstiegsgehältern bei hohen Überstundenzahlen abspeisen. Nur um sie dann nach einigen Jahren vor die Tür zu setzen und durch eine neue Generation von Absolventen auszutauschen.
Wer als Langnase erstmals in China ist, droht derweil in eine reale “Jiucai”-Falle zu tappen. Denn in unseren Breiten ist Knoblauch-Schnittlauch (im Fachsprech: allium tuberosum), in der Umgangssprache auch als “Knolau” bekannt, noch immer ein Nischengewächs und wenig verbreitet. Die Lauch-Art mit ihren flachen, dickröhrigen Hälmchen kommt nämlich vor allem in der ostasiatischen Küche zum Einsatz. Seine Ursprünge soll das würzige Gewächs in China haben, wo man es bereits vor rund 3.000 Jahren angebaut haben soll. In Deutschland ist daher auch einfach die Bezeichnung “chinesischer Schnittlauch” gebräuchlich.
Für viele China-Neulinge ist diese jahrtausendealte Zutat dagegen Neuland. Nicht selten verwechseln sie die kräftig grünen Halme im ersten Nahkontakt mit unserem handelsüblichen Schnittlauch (der heißt auf Chinesisch香葱 xiāngcōng) und häufen sich in der Kantine euphorisch Knolau-Rührei, Knolau-Jiaozi und gebratenen Knolau-Tofu auf den Teller. Das böse Erwachen kommt dann im Nachmittagsmeeting, wenn man statt Optimismus und den neuesten Zahlen vor allem eine Knoblauchfahne verbreitet. Denn geschmacklich ähnelt chinesischer Schnittlauch tatsächlich eher dem Knob- als dem Schnittlauch.
Knofi-Note hin oder her: Die TCM feiert das Gewächs fern von Geschmacksfragen für seine heilsame Wirkung, unter anderem bei der Krebsvorbeugung. Ähnlich wie Knoblauch oder Bärlauch enthält die Pflanze den Wirkstoff Allicin, der das menschliche Immunsystem gegen Viren und Bakterien stärkt und ganz nebenbei auch cholesterinsenkend, blutfettausgleichend und entzündungshemmend sein soll. “Jiucai” wirkt zudem verdauungsfördernd und appetitanregend und wird im chinesischen Netz sogar als Anti-Aging-Geheimwaffe und Superfood für einen hellen Teint gepriesen.
Auch in China scheiden sich am “Jiucai” übrigens die Geister. Manche meiden Knolau-Gerichte wie der Teufel das Weihwasser, können dem knoblauchartigen Nachgeschmack, den das Lauchgewächs im Mund zurücklässt, so gar nichts abgewinnen. Hartgesottene dagegen schwören auf die würzigen Halme, verputzen sie als Füllung in Küchlein (韭菜馅饼 jiǔcài-xiànbǐng), motzen damit Glasnudelgerichte (韭菜炒粉丝 jiǔcài chǎofěnsī) und Omelette (韭菜鸡蛋饼 jiǔcài-jīdànbǐng) auf. Echte Jiucai-Junkies ordern das Kraut gar in Reinform, zum Beispiel geröstet (烤韭菜 kǎo jiǔcài) oder gebraten (炒韭菜 chǎo jiǔcài).
Wer es geschmacklich eher kräftig mag (重口味 zhòngkǒuwèi “kräftiger Geschmack”, im übertragenen Sinne auch “ausgefallener” bzw. “härterer Geschmack”), der kommt in der chinesischen Küche ohnehin auf seine Kosten. Das gilt insbesondere für Knoblauch-Fans. Dass man in China keine Vampire kennt, könnte auch damit zusammenhängen, dass man im Reich der Mitte aus der Knoblauchpflanze (大蒜 dàsuàn) kulinarisch alles herausholt, was nur denkbar ist. So wird in manchen Teilen Chinas nicht nur herzhaft in eingelegte, ganze Knoblauchzehen gebissen, als Appetizer oder Snack, zum Beispiel in 糖醋蒜 tángcùsuàn (“süßsauer eingelegter Knoblauch”). Neben der Knolle als Würzallrounder sind auch Knoblauchtriebe in verschiedenen Wachstumsstadien eine beliebte Speise, etwa Jungtriebe, genannt 蒜苗 suànmiáo (das Grüne vom Knoblauch), oder die ausgewachsenen Knoblauchstängel, genannt 蒜苔 suàntái.
Wer selbst schon einschneidende Knoblauch- oder Schnittknoblauch-Erlebnisse hatte und gustatorisch ein gebranntes Kind ist, für den sollten beim Restaurantbesuch die Alarmglocken schellen, wenn die Bedienung bei der Bestellung höflich fragt: 有没有忌口? Yǒu méiyǒu jìkǒu? – “Gibt es Unverträglichkeiten?”. Das ist der richtige Moment, um Extrawünsche wie “ohne Knoblauch” oder “bitte nicht scharf” zu formulieren. Die letzte Ausfahrt quasi, bevor es auf geschmackliche Achterbahnfahrten geht. Wobei sich kulinarische Experimentierfreude in China ja oft auszahlt und ganz neue Areale in Mund- und Magengegend aktiviert.
Verena Menzel betreibt in Peking die Online-Sprachschule New Chinese, wo es jetzt ein ganz neues Kursformat für Einsteiger gibt – für alle, die endlich mit Spaß und Struktur Chinesisch lernen wollen.
US-Außenminister Antony Blinken wird in der kommenden Woche zum zweiten Mal in weniger als einem Jahr China besuchen. Ganz oben auf der Liste der Gesprächspunkte: Russland und die Unterstützung für Moskau aus Peking.
Wie es tatsächlich um das Dreieck aus USA, China und EU steht, ist eines der Hauptthemen unseres Gesprächs mit Gunnar Wiegand. Dieser war mehr als drei Jahrzehnte EU-Diplomat und ist jetzt Visiting Distinguished Fellow im beim German Marshall Fund of the United States (GMF).
Die Position Pekings im Krieg gegen die Ukraine ist Wiegand zufolge von immer größerer Bedeutung für das Verhältnis zwischen China und Europa. “Denn der Krieg Russlands gegen die Ukraine geht weiter, wird intensiver. China ist, ob gewollt oder nicht, inzwischen der wichtigste wirtschaftliche, finanzielle und technologische Stützpfeiler der Kriegswirtschaft Russlands.” Wiegand mahnt ein gemeinsames europäisches Vorgehen an.
Am Donnerstag startet in Peking die Automesse. Inzwischen handelt es sich um die wichtigste Branchenveranstaltung ihrer Art. Unserer besonderer Fokus liebt dabei auf der neuen, starken Konkurrenz, die Deutschland in Fernost erwächst. Den Anfang macht heute eine Analyse zu Xpeng. Der aufstrebende Hersteller will mit einer Modelloffensive durchstarten.
In den kommenden Tagen werden wir Sie weiter mit Auto-Analysen und Interviews versorgen. Wir sind auf der Messe mit zwei Kollegen vertreten.


Wagen wir ein Blick in die Zukunft: Wer wird in neun Monaten Ihrer Einschätzung nach im Weißen Haus sitzen?
Kein Thinktank besitzt die Kapazität des Wahrsagens. Wir blicken auf die demokratischen Prozesse. Wir wissen alle, dass die Situation in den USA offen ist und dass die eine oder andere Kandidatenauswahl vom US-amerikanischen Volk getroffen werden kann. Auch was die Endauswahl angeht, haben wir schon mehrfach gesehen, dass andere Präsidenten als die, die die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhalten hatten, sich im Wahlsystem durchsetzen konnten. Ich denke, wir müssen realistisch sein. Nicht nur hier in Brüssel, sondern in allen Teilen der Welt sollte mit der Möglichkeit gerechnet werden, dass der Herausforderer und frühere Präsident auch wieder US-Präsident werden könnte. Das würde dann natürlich gewisse Auswirkungen haben auf die Politik in Washington, sowohl gegenüber Europa als auch gegenüber China und Russland.
Und wer wird Ihrer Einschätzung nach EU-Kommissionspräsidentin oder -präsident?
Das ist noch schwieriger. Im Unterschied zu den US-Wahlen besteht hier noch weniger Vorhersehbarkeit: Die Spitzenkandidaten sind nicht alle auch Kandidaten für das EU-Parlament. Zudem muss der Vorschlag zunächst vom Europäischen Rat gemacht werden, der dann vom Europäischen Parlament bestätigt werden muss. Aber ich denke, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Kandidat der stärksten Fraktion im Parlament zum Präsidenten der Europäischen Kommission ernannt wird. Wir können davon ausgehen, dass es relativ gute Chancen für die gegenwärtige Amtsinhaberin gibt.
Im Dreieck USA, China, EU – was sind die wichtigsten Punkte für die kommenden Jahre?
Die wichtigste Frage, mit der alle drei zu tun haben werden: Wie richten wir unseren Handel aus? Das war der Knackpunkt zwischen der Regierung unter Donald Trump und China. Die Maßnahmen, die damals getroffen wurden, nämlich die unilaterale Verhängung von erheblichen Zöllen gegen China und auch gegen andere Handelspartner wie Europa sind gegenwärtig suspendiert. Zusätzliche Bedeutung gewinnt das Thema dadurch, dass wir eine ständig wachsende Kapazität der Überproduktion in China haben, nicht nur bei Stahl und Aluminium, sondern insbesondere bei Solaranlagen, elektrischen Autos und Windkraftanlagen. Das wird zu einem großen Teil mit Subventionen erreicht. Diese strukturelle Überproduktion muss irgendwo abgesetzt werden. Hier müssen wir sicherlich zu neuen Politikansätzen kommen, sowohl im Erzeugerland als auch in den Absatzmärkten, um damit so umzugehen, dass es nicht zu einer Deindustrialisierung in unseren Ländern kommt.
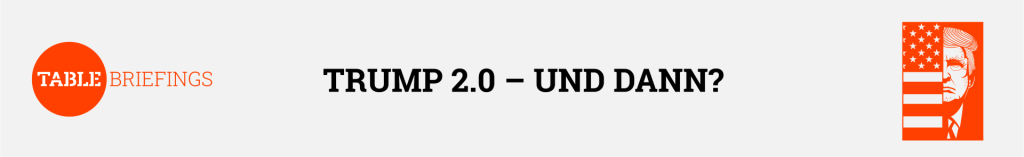
Und neben dem Handel?
Die Frage von Taiwan. Welchen Stellenwert nimmt das Ziel der Vereinigung in der Politikgestaltung in Peking ein? Und wie wird darauf reagiert in Europa und den USA? Wenn die roten Linien eingehalten werden, also keine Mittel der Gewalt eingesetzt werden oder damit gedroht wird, dann wird das auch geachtet werden in Washington und Brüssel. Es muss einen Prozess in gegenseitigem Einvernehmen geben zwischen der Führung in Taiwan und der Führung in China, dessen Ergebnisse demokratisch legitimiert werden müssen. Auch die Themen der wirtschaftlichen Sicherheit bei Spitzentechnologien und möglichen Lizenzierungen von Exporten und Auslandsinvestitionen bleiben wichtig.
Aber von immer größerer Bedeutung für Europas Verhältnis mit China wird die immer engere Verbindung zwischen China und Russland. Denn der Krieg Russlands gegen die Ukraine geht weiter, wird intensiver. China ist, ob gewollt oder nicht, inzwischen der wichtigste wirtschaftliche, finanzielle und technologische Stützpfeiler der Kriegswirtschaft Russlands. Das wird zunehmend zu einem Problem der europäischen Sicherheit.
Was würde ein Präsident Trump für Taiwan bedeuten?
Ich denke, Trump würde die strategische Ambiguität der US-Position in der Unterstützung Taiwans nicht infrage stellen. Er hat das während seiner ersten Präsidentschaft und auch bisher nicht im Wahlkampf getan. Von daher sollte man jetzt nicht zu voreiligen Schlüssen kommen, was Taiwan angeht, auch wenn Trump im handelspolitischen Bereich, sagen wir mal, eine sehr viel robustere Haltung auch gegenüber Taiwan eingenommen hatte.
Sie sind seit knapp einem halben Jahr nicht mehr Teil des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EEAS). Wie sehen Sie die Arbeit jetzt von außen in Bezug auf China?
Die EU verfolgt einen ganzheitlichen Kurs, der zwar manchmal komplex und auch langsamer ist als gewollt, aber der sich insgesamt doch erheblich entwickelt hat, auf einer Basis des Realismus. Nehmen wir China mit seinen Ambitionen und den Kapazitäten, die es aufbaut. Seit 2019 können sich alle EU Mitgliedsstaaten hinter dem Ansatz versammeln, China gleichzeitig als Partner, Wettbewerber und systemischen Rivalen zu sehen. Wir sehen, dass eine ganze Reihe an Verordnungen und Richtlinien seither angenommen worden, mit welchen die normative und wirtschaftliche Kraft Europas besser zum Einsatz gebracht werden kann, angesichts fehlender bilateraler Abkommen mit China. Ich möchte darauf hinweisen, dass diese ganzen Gesetzesvorhaben immer die Zusammenarbeit braucht zwischen Rat und Parlament. Deswegen hat das gedauert.
Was hat sich konkret getan?
Es hat sehr viel mehr Realismus in den Mitgliedstaaten selbst gegeben. Schauen Sie sich an, wie viel Konfuzius-Institute es heute an unseren Universitäten gibt und wie viele es vor einigen Jahren gab. Oder wie viele Mitgliedsstaaten noch bei Chinas Belt and Road Initiative mitmachen. Auch der 17+1 Prozess zwischen den osteuropäischen Ländern und China ist zum Erliegen gekommen. Es hat also auch auf nationaler Ebene ein Umdenken gegeben, und gemeinsames EU-Handeln ist viel wichtiger geworden. Die wichtigste Aufgabe, wo jetzt sehr viel mehr Gemeinsamkeit gefunden werden muss und auch Entscheidungen klar gefällt werden müssen, ist im Bereich der strukturellen Überproduktion in China und wie man damit umgeht. Da ist noch viel zu tun.
Gunnar Wiegand ist Visiting Distinguished Fellow im Indo-Pazifik-Programm des German Marshall Fund of the United States (GMF). Wiegand war von Januar 2016 bis August 2023 Leiter der Asienabteilung des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EEAS). Zuvor war er stellvertretender Leiter für die Abteilung Europa und Zentralasien sowie Direktor der Abteilung für Russland, Östliche Partnerschaft, Zentralasien und OSZE.

In den kommenden drei Jahren möchte Xpeng 30 neue Modelle auf den Markt bringen – nach den üblichen Standards der Fahrzeugindustrie eine hohe Zahl. Das geht aus einem internen Schreiben an die Beschäftigten hervor, über das das Online-Medium CN-EV-Post berichtet. Dazu gehören unter anderem preisgünstigere Modelle unter umgerechnet 20.000 Euro für den globalen Markt. Angesichts eines umkämpften Heimatmarktes muss Xpeng schnell wachsen, um durch Skaleneffekte rentabel zu werden. Doch so einfach ist es nicht mehr. Der chinesische Automarkt leidet unter enormen Überkapazitäten.
Xpeng hat ein durchwachsenes Jahr hinter sich. 2023 hat das Unternehmen 142.000 Autos abgesetzt. Einerseits ist das eine Steigerung um 17 Prozent im Vergleich zu 2022, andererseits verfehlten das Unternehmen das eigene Absatzziel (200.000 Stück) deutlich.
Damit machte die Marke einen Verlust von stattlichen 1,4 Milliarden Euro (zehn Milliarden Yuan). Analysten zeigten sich davon sogar positiv überrascht. Sie hatte ein Minus von 1,5 Milliarden Euro erwartet. Auch 2024 hat nicht wirklich viel sprechend begonnen – nur etwa 22.500 Fahrzeuge hat Xpeng im ersten Quartal ausgeliefert.
Bei Xpeng weiß man um die Situation. Entsprechend martialisch ist auch das interne Schreiben an die Belegschaft formuliert. Man werde in eine “neue Phase des Blutbades” eintreten, zitiert die South China Morning Post aus dem Schreiben. Doch die Konsequenzen daraus sind andere als erwartet. Statt Personal einzusparen, verspricht He Xiaopeng, Gründer und Vorstandsvorsitzender des gleichnamigen Elektroautoherstellers, bis Jahresende 4.000 neue Jobs zu schaffen.
Außerdem möchte die Marke 450 Millionen Euro (3,5 Milliarden Yuan) in die Entwicklung intelligenter Autos investieren – so viel wie noch nie zuvor in der Firmengeschichte. Diese Aufstockung der Investitionen ist dringend notwendig ist. Nio (13, Milliarden Yuan) und Li Auto (10,6 Milliarden Yuan) haben im vergangenen Geschäftsjahr deutlich mehr ausgegeben.
Mit dieser Offensive möchte Xpeng die Früchte ernten, die sie im abgelaufenen Geschäftsjahr gesät haben. Das war nämlich von einigen Umstellungen geprägt. Dazu gehörte unter anderem der Vetrieb, wie Caixin Global berichtet. Xpeng hatte zwei unterschiedliche Vertriebskanäle. Zum einen die eigenen Autohäuser und zum anderen – was erst später dazu kam – der Verkauf über externe Händler. Da beide Sparten innerhalb von Xpeng konkurrierten, nahmen sie sich gegenseitig die Kunden weg. Seit 2023 sind beide Kanäle unter Vizepräsident Wang Tong vereint und unrentable Händler mussten schließen. Aktuell hat Xpeng 254 eigene und 166 externe Händler.
Nicht nur den Vertrieb, auch die Lieferkette hat das Unternehmen aufgeräumt. Dank einer neuen Architektur für ihre Fahrzeuge können 80 Prozent der wichtigen Teile über beinahe alle Modelle hinweg verbaut werden. Das verkürzt auch die Entwicklungszeit für neue Modelle enorm. Ein Vorteil, der in naher Zukunft wichtigen werden soll. So kommt die Zahl von 30 neuen Modellen zustande, die geplant sind.
Darunter finden sich zwei Modelle, die Xpeng unter einer einem neuen Markennamen herausbringen möchte. Der Projektname lautet “Mona”. Die Autos der Marke sollen zwischen 13.000 und 20.000 Euro kosten und damit etwa halb so viel wie die bisherigen Fahrzeuge von Xpeng. Damit greift Xpeng direkt BYD an, die sich auf diese Fahrzeugklasse spezialisiert haben. Der Konzern hat im Jahr 2023 knapp über drei Millionen Elektro- und Plug-in-Fahrzeuge verkauft, die zu großen Teilen unter 20.000 Euro zu haben sind.
Xpeng plant darüber hinaus zwei weitere Modelle, die gemeinsam mit Volkswagen bis zum Jahr 2026 entstehen. Volkswagen setzt auf Xpeng und ist eine Kooperation eingegangen. Der Konzern aus Wolfsburg hat 700 Millionen Euro für einen Anteil von 4,99 Prozent an dem chinesischen Hersteller gezahlt. In einem “Master Agreement” hieß es nun, dass die beiden Unternehmen eine gemeinsame Plattform und Software für E-Autos entwickeln wollen. Durch die gemeinsame Beschaffung von Teilen sollen außerdem die Kosten reduziert werden.
Kernkompetenz von Xpeng sollen über alle Preisklassen hinweg die intelligenten Fahrassistenzsysteme und die dahintersteckende Künstliche Intelligenz sein. Eine Technologie, die allerdings kein Alleinstellungsmerkmal auf dem chinesischen Markt ist. Nicht nur BYD und die anderen Autofirmen, auch Tech-Riesen wie Huawei und Xiaomi mischen mittlerweile auf dem Automarkt mit.
Doch Xpeng ist trotz der Verluste für die Aufholjagd gut gerüstet. Die Umstellungen und Kosteneinsparungen zeigen erste Erfolge, so Brian Gu, der Ehrenvize- und Co-Präsident des Unternehmens. Die Marge sei um zehn Prozent gestiegen und die Barmittel würden mittlerweile fast sechs Milliarden Euro betragen.
Zwischen 2010 und 2014 haben sich chinesische Angreifer immer wieder Zugriff auf die Computer von Volkswagen verschafft und technisches Firmenwissen abgesaugt. Das berichten das ZDF und der Spiegel unter Berufung auf Dokumente über die Abwehr der Cyberattacke. Hinter dem Angriff standen vermutlich staatliche Stellen. Es gebe eine “Spur” in Richtung Volksbefreiungsarmee, sagte einer der Insider. Zudem haben sie zu festen Arbeitszeiten gearbeitet, die auf das Vorgehen von Beamten hindeuten. Es handelte sich seinerzeit um einen der größten Cyberangriffe weltweit.
Bei den Informationen, die die Hacker heruntergeladen haben, handelt es sich beispielsweise um Programmcode für die Getriebesteuerung, aber auch technische Daten aus dem Bereich Elektromobilität oder Brennstoffzellen. In welchen Produkten in China die Kenntnisse eventuell später zum Einsatz kamen, ist nicht bekannt.
Es hat 2015 erheblicher Mühe und einer großen Aktion bedurft, um die Angreifer wieder aus den Systemen auszusperren. Volkswagen hat seitdem seine IT-Sicherheit überarbeitet. Die Enthüllung fällt kurz vor die Pekinger Automesse in ein Klima zunehmender China-Skepsis in Teilen von Regierung, Gesellschaft und Wirtschaft. VW will allerdings mehr denn je in China investieren. Auf mutmaßliche Verbindungen nach China reagierte die chinesische Botschaft in Berlin den Berichten zufolge empört und betonte, dass das Land jede Form von Cyber-Spionage verurteile. fin
Im Kampf gegen die schwächelnde Nachfrage hat der US-Elektroautobauer Tesla erneut seine Preise gesenkt. Damit dreht sich die Rabattspirale immer schneller nach unten. In China sind Tesla-Modelle noch einmal etwa 2.000 Dollar günstiger geworden, wie aus Angaben auf der offiziellen Internetseite des Autobauers am Sonntag hervorging. Bereits am Freitag wurden Preissenkungen in ähnlicher Höhe in den USA bekannt.
Derzeit schwächelt weltweit der Markt für Elektroautos. Tesla war mit einem deutlichen Absatzrückgang in das Jahr gestartet. Es war das erste Mal seit fast vier Jahren, dass das Unternehmen weniger Fahrzeuge verkauft hat als vor Jahresfrist. Der chinesische Anbieter BYD ist Tesla auf den Fersen. Dazu kommt die härtere Konkurrenz durch Branchenneulinge sowie das wachsende Angebot an Elektroautos etablierter Hersteller wie VW. Ein weiterer treibender Faktor für die sinkenden Preise sind Chinas Überkapazitäten. Chinas Autobauer sind nur zu 70 Prozent ausgelastet. rtr
Chinas Führung hat Apple angewiesen, Whatsapp aus dem App Store in der Volksrepublik zu entfernen. Der US-Konzern hat bereits eingewilligt. Man sei gezwungen, die Gesetze der Länder zu befolgen, in denen man aktiv sei, heißt es. Die chinesische Internet-Regulierungsbehörde begründe diese Anordnung mit “Bedenken rund um die nationale Sicherheit”, zitiert das Wall Street Journal den Apple-Konzern. Auch die mit X (ehemals Twitter) konkurrierende App Threads aus dem Facebook-Konzern darf im App Store von Apple in China nicht mehr zum Herunterladen angeboten werden.
Whatsapp ist in China ohnehin schon seit Jahren nur über VPN-Dienste nutzbar, die den Datenverkehr so umleiten, dass er aus einem anderen Land zu kommen scheint. Im Land selbst sind fast alle westlichen Kurznachrichtendienste und soziale Medien blockiert. WhatsApp konnte dennoch bislang aus dem App Store auf die Geräte geladen werden. flee
Das US-Repräsentantenhaus hat der Video-App Tiktok am Samstag ein Ultimatum für die Loslösung von ihrem chinesischen Mutterkonzern Bytedance gestellt. Eine Mehrheit der Parlamentarier beider Parteien stimmte für den Antrag. Wenn die US-Tochter sich nicht von der chinesischen Mutter loslöst, soll Tiktok in den USA aus den App-Stores von Apple und Google verbannt werden. Der Senat muss der Vorlage noch zustimmen, damit sie in Kraft treten kann.
Kritiker von Tiktok werfen der Plattform Nähe zur chinesischen Regierung und etwaige Datenspionage vor. Tiktok weist alle Vorwürfe zurück. Ob die Regierung in Peking einem Verkauf des US-Anteils zustimmen würde, ist unklar. Die App mit 170 Millionen amerikanischen Nutzern ist vor allem bei Jugendlichen beliebt. Der Streit ist im US-Wahlkampf zu einem wichtigen Thema geworden. rtr
Der Boden unter vielen chinesischen Städten sinkt stetig ab. 45 Prozent der städtischen Gebiete des Landes sinken mit einer Geschwindigkeit von mehr als drei Millimetern pro Jahr ab, berichtete die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf eine chinesische Studie, die im Fachmagazin “Science” erschienen ist. Bei 16 Prozent sind es demnach sogar mehr als zehn Millimeter pro Jahr. Ursache der Absenkung ist demnach vor allem Entnahme von Grundwasser aus Gesteinsschichten unterhalb der Städte und das Gewicht von Gebäuden durch den enormen Bauboom im Land.
Zu den von Absenkung stark betroffenen Städten gehören auch die Hauptstadt Peking sowie die Hafenmetropole Shanghai mit ihren jeweils weit über 20 Millionen Einwohnern, so der Bericht. Manche Gebiete von Shanghai haben sich im vergangenen Jahrhundert um bis zu drei Meter abgesenkt, was schon länger bekannt ist.
Ein Team um den Forscher Zurui Ao von der South China Normal University in Foshan hatte für die Studie aber nun Satellitenmessungen aus den Jahren 2015 bis 2022 von 82 chinesischen Großstädten ausgewertet, in denen knapp drei Viertel der urbanen Chinesen leben. Von den Satelliten aus lassen sich mittels Radar Bodenverformungen verfolgen. Von Absenkungen um mehr als drei Millimeter ist demnach knapp ein Drittel (29 Prozent) der Bevölkerung dieser Städte betroffen. Stand 2020 lebten den Forschenden zufolge insgesamt 920 Millionen Chinesen in urbanen Regionen – davon geschätzt etwa 270 Millionen auf sinkendem Boden.
Die Folgen sind bereits zu spüren. Setzungsbedingte Katastrophen haben laut der Studie in China in den vergangenen Jahrzehnten bereits hunderte Tote und Verletzte jährlich sowie immense wirtschaftliche Schäden verursacht. Außerdem steigt in den dicht besiedelten Küstenregionen die Gefahr von Überschwemmungen. Durch die Kombination von Bodenabsenkung und den aus der Klimakrise resultierenden Meeresspiegelanstieg drohten bis 2120 22 bis 26 Prozent der chinesischen Küste unter dem Meeresspiegel liegen. Etwa jeder zehnte Küstenbewohner wäre davon betroffen, so die Studie. Auch drohen Schäden an Gebäuden und Fundamenten, Infrastruktur und Kanalisation.
“Die Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit, die Schutzmaßnahmen zu verstärken und die Grundwasserentnahme streng zu kontrollieren”, heißt es in der Studie. Sie wirbt für ein nachhaltigeres Wassermanagement, wie es etwa in den japanischen Städten Tokio und Osaka bereits erfolgreich praktiziert werde. Das könne die Absenkungsrate auch in China stabilisieren. Bodenabsenkungen infolge menschlicher Aktivitäten gibt es bereits in vielen Teilen der Welt. ck

Nach schweren Regenfällen in der südchinesischen Provinz Guangdong sind bei Erdrutschen mindestens sechs Menschen verletzt und weitere verschüttet worden. Unter Berufung auf die örtlichen Behörden meldete Chinas Staatssender CCTV, dass drei Orte im Becken des Bei-Flusses aufgrund starker Niederschläge Überschwemmungen erleben würden, “wie sie nur einmal in einem Jahrhundert vorkommen”, berichtete die Nachrichtenagentur AFP.
Sintflutartige Regenfälle haben seit Donnerstag in großen Teilen Guangdongs zu einem Anschwellen der Flüsse im Perlflussdelta und somit zu Überschwemmungen in den dortigen Bergregionen geführt. Von CCTV veröffentlichte Aufnahmen zeigten Häuser, die von einer Wand aus braunem Schlamm zerstört wurden. Zunächst gab es keine Berichte über Todesopfer oder darüber, wie viele Menschen von den Erdrutschen verschüttet wurden. Von den Unwettern und Überflutungen sind auch die Megastädte Hongkong, Shenzhen und Guangzhou betroffen.
Das Perlflussdelta ist eine der am dichtesten besiedelten Regionen der Welt. Der nationale Wetterdienst hatte Unwetterwarnungen für Teile Guangdongs ausgegeben und vor heftigen Stürmen in den Küstenregionen gewarnt. CCTV zufolge könnten Hochwasser von bis zu 5,8 Metern über der Warngrenze die Region am Montagmorgen treffen. flee

Der Tag beginnt für Alice Grünfelder jeden Morgen um sieben. Etwas unsanft wird sie zu dieser Stunde aus dem Schlaf geholt von den Glocken der benachbarten Kirche, die ab sieben Uhr morgens jede Viertelstunde läuten. “Mein Tag ist durch sie strukturiert, und bin ich einmal anderswo, lausche ich vergebens nach diesem Zeitmesser, der mich im Alltag doch so nervt.” Es passt zu ihrer Wahlheimat Zürich, dass der Tag genau getaktet ist. Zumindest will es so das Klischee.
Aber mit den Klischees, da war doch was. Man könnte sagen, Grünfelder steht auf keinem guten Fuß mit ihnen - vielmehr verwendet sie einen nicht unerheblichen Teil ihrer Lebenszeit darauf, gegen sie anzugehen. Vor allem gegen solche, mit denen die Europäer China und Asien einordnen.
Grünfelder hat mehrere Jahre in Asien verbracht. Nach ihrem Sinologie-Studium in Berlin war sie als Studienreiseleiterin viel in China unterwegs, vor allem in Tibet und Xinjiang. Mittlerweile hat sie China so oft bereist, dass sie auf die Frage nach der Zahl ihrer Besuche nur mit den Schultern zucken kann. “Ich habe es nicht gezählt.”
Grünfelders China-Faszination hat sie früh mit ihrer literarischen Neigung verknüpft, studierte neben Sinologie auch Neuere Deutsche Literatur und schloss noch vor dem Studium eine Ausbildung zur Buchhändlerin ab. Heute ist sie Lektorin, Literaturvermittlerin, Autorin und Übersetzerin. Sie schreibt über China und andere Länder Asiens, deren Menschen sie auf ihren vielen Reisen tief berührten. Mit ihren Veröffentlichungen versucht sie, den Lesern eine Stimmung des jeweiligen Landes zu vermitteln. “Ich möchte ausdrücken, worum es den Menschen wirklich geht, was sie denken und fühlen.”
Gerade hat sie ihren neuesten Roman fertiggestellt, für den sie nun einen Verlag sucht. Darin geht es um die 140.000 chinesischen Kriegsarbeiter, die während des Ersten Weltkriegs von den Franzosen und Briten rekrutiert worden waren. Grünfelder beschäftigt sich gerne mit jenen Themen, die anderswo kaum besprochen werden. Schon ihr erster Roman “Wüstengängerin”, der 2018 im Verlag Edition 8 erschien, spielt vor dem Hintergrund der Unruhen in Xinjiang und der Unterdrückung der Uiguren – als hierzulande noch kaum jemand darüber sprach.
Auf ihrem Schreibtisch liegen aktuell zwei Bände der taiwanischen Lyrikerin Tsai Wan-Shuen, die noch auf ihre Korrektur warten. Ihr Werk im deutschsprachigen Raum bekannt zu machen, ist so etwas wie eine Herzensangelegenheit. Von dieser Art Projekte hat Grünfelder noch einige im Kopf.
Und ihr derzeit größter Wunsch: ein längerer Aufenthalt in Keelong an der Nordküste Taiwans. “Dort möchte ich die verschiedenen kulturellen und historischen Schichten durchforsten, die mich bei meinem letzten Aufenthalt so fasziniert haben.” Sicher wird sie auch von dieser Reise wieder viele Einblicke mitbringen, die auf die eine oder andere Weise ihren Weg in die deutsche Literaturlandschaft finden werden. Svenja Napp
Howard Tan ist seit Februar Business Development Manager bei Würth in Shanghai. Er war zuvor Market Developer, ebenfalls für Würth.
Benjamin Sim wird zum 1. Juni Leiter der Region Greater China & Singapur bei Julius Bär. Sim kam 2016 zu dem Schweizer Vermögensverwalter und war dort unter anderem stellvertretender Niederlassungsleiter und Chief Operating Officer (COO) in Singapur und COO in Hongkong. Vor seiner Zeit bei Julius Bär arbeitete Sim bei Credit Suisse und HSBC.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Was haben Kaffeefahrten, die Coaching-Szene, Multi-Level-Marketing und Praktikanten-Ausbeutung gemein? Auf all diesen Feldern wird oft büschelweise chinesischer Schnittlauch geerntet! Sie haben richtig gehört, zumindest auf Ihrem chinesischen Ohr.
Schnittlauch ernten, genauer gesagt “Knoblauch-Schnittlauch schneiden”, auf Chinesisch 割韭菜 gē jiǔcài (von 割 gē “schneiden, durchtrennen” und 韭菜 jiǔcài “(chinesischer) Knoblauch-Schnittlauch, Schnittknoblauch”), nennen es die Chinesen nämlich, wenn den einfachen Leuten durch miese Maschen das Geld aus der Tasche gezogen wird.
Früher war das eine Metapher des Börsenjargons. Gemeint war das Schröpfen naiver Neulinge auf dem rutschigen Finanzparkett durch erfahrene Player, die den Aktienanfängern windige Fonds und Finanzprodukte andrehten. Sie warteten manchmal auch einfach, bis die nervösen Newbies ihre Aktienanteile panisch im falschen Moment abstießen, um die Papiere dann für günstiges Geld aufzukaufen – jiucai-Erntezeit für die Wertpapierwölfe eben. Das Abgrasen solcher Profite erschien schnittigen Finanzhaien wohl so easy, wie “schnipp-schnapp” büschelweise Schnittlauchhalme zu ernten. Schnittlauchtriebe sind zudem dafür bekannt, schnell nachzusprießen – genauso wie immer neue Anleger auf dem Börsenbeet nachwachsen, deren Heu sich dann wieder abernten lässt.
Mittlerweile übertragen chinesische Wortakrobaten die schnittige Sprachblüte auf alle erdenklichen Schröpf-Szenarien, in denen das Fußvolk als Goldesel eingespannt wird. Zum Beispiel auf die auch in China blühende Coaching-Branche, in der selbsternannte Gurus der erfolgsdürstenden Mittelschicht mit immer neuen Kursen und Erfolgsversprechen die digitalen Renminbis aus den Rippen leiern. Statt des erhofften Karriere- und Bank-Boosters für die Teilnehmenden schwingen sich die Wundercoaches letztlich einfach nur selbst auf der Einkommensleiter nach oben. Ebenfalls als Schnittlauchschneider verschrien sind in China dreiste Unternehmen, die junge Berufseinsteiger mit miesen Einstiegsgehältern bei hohen Überstundenzahlen abspeisen. Nur um sie dann nach einigen Jahren vor die Tür zu setzen und durch eine neue Generation von Absolventen auszutauschen.
Wer als Langnase erstmals in China ist, droht derweil in eine reale “Jiucai”-Falle zu tappen. Denn in unseren Breiten ist Knoblauch-Schnittlauch (im Fachsprech: allium tuberosum), in der Umgangssprache auch als “Knolau” bekannt, noch immer ein Nischengewächs und wenig verbreitet. Die Lauch-Art mit ihren flachen, dickröhrigen Hälmchen kommt nämlich vor allem in der ostasiatischen Küche zum Einsatz. Seine Ursprünge soll das würzige Gewächs in China haben, wo man es bereits vor rund 3.000 Jahren angebaut haben soll. In Deutschland ist daher auch einfach die Bezeichnung “chinesischer Schnittlauch” gebräuchlich.
Für viele China-Neulinge ist diese jahrtausendealte Zutat dagegen Neuland. Nicht selten verwechseln sie die kräftig grünen Halme im ersten Nahkontakt mit unserem handelsüblichen Schnittlauch (der heißt auf Chinesisch香葱 xiāngcōng) und häufen sich in der Kantine euphorisch Knolau-Rührei, Knolau-Jiaozi und gebratenen Knolau-Tofu auf den Teller. Das böse Erwachen kommt dann im Nachmittagsmeeting, wenn man statt Optimismus und den neuesten Zahlen vor allem eine Knoblauchfahne verbreitet. Denn geschmacklich ähnelt chinesischer Schnittlauch tatsächlich eher dem Knob- als dem Schnittlauch.
Knofi-Note hin oder her: Die TCM feiert das Gewächs fern von Geschmacksfragen für seine heilsame Wirkung, unter anderem bei der Krebsvorbeugung. Ähnlich wie Knoblauch oder Bärlauch enthält die Pflanze den Wirkstoff Allicin, der das menschliche Immunsystem gegen Viren und Bakterien stärkt und ganz nebenbei auch cholesterinsenkend, blutfettausgleichend und entzündungshemmend sein soll. “Jiucai” wirkt zudem verdauungsfördernd und appetitanregend und wird im chinesischen Netz sogar als Anti-Aging-Geheimwaffe und Superfood für einen hellen Teint gepriesen.
Auch in China scheiden sich am “Jiucai” übrigens die Geister. Manche meiden Knolau-Gerichte wie der Teufel das Weihwasser, können dem knoblauchartigen Nachgeschmack, den das Lauchgewächs im Mund zurücklässt, so gar nichts abgewinnen. Hartgesottene dagegen schwören auf die würzigen Halme, verputzen sie als Füllung in Küchlein (韭菜馅饼 jiǔcài-xiànbǐng), motzen damit Glasnudelgerichte (韭菜炒粉丝 jiǔcài chǎofěnsī) und Omelette (韭菜鸡蛋饼 jiǔcài-jīdànbǐng) auf. Echte Jiucai-Junkies ordern das Kraut gar in Reinform, zum Beispiel geröstet (烤韭菜 kǎo jiǔcài) oder gebraten (炒韭菜 chǎo jiǔcài).
Wer es geschmacklich eher kräftig mag (重口味 zhòngkǒuwèi “kräftiger Geschmack”, im übertragenen Sinne auch “ausgefallener” bzw. “härterer Geschmack”), der kommt in der chinesischen Küche ohnehin auf seine Kosten. Das gilt insbesondere für Knoblauch-Fans. Dass man in China keine Vampire kennt, könnte auch damit zusammenhängen, dass man im Reich der Mitte aus der Knoblauchpflanze (大蒜 dàsuàn) kulinarisch alles herausholt, was nur denkbar ist. So wird in manchen Teilen Chinas nicht nur herzhaft in eingelegte, ganze Knoblauchzehen gebissen, als Appetizer oder Snack, zum Beispiel in 糖醋蒜 tángcùsuàn (“süßsauer eingelegter Knoblauch”). Neben der Knolle als Würzallrounder sind auch Knoblauchtriebe in verschiedenen Wachstumsstadien eine beliebte Speise, etwa Jungtriebe, genannt 蒜苗 suànmiáo (das Grüne vom Knoblauch), oder die ausgewachsenen Knoblauchstängel, genannt 蒜苔 suàntái.
Wer selbst schon einschneidende Knoblauch- oder Schnittknoblauch-Erlebnisse hatte und gustatorisch ein gebranntes Kind ist, für den sollten beim Restaurantbesuch die Alarmglocken schellen, wenn die Bedienung bei der Bestellung höflich fragt: 有没有忌口? Yǒu méiyǒu jìkǒu? – “Gibt es Unverträglichkeiten?”. Das ist der richtige Moment, um Extrawünsche wie “ohne Knoblauch” oder “bitte nicht scharf” zu formulieren. Die letzte Ausfahrt quasi, bevor es auf geschmackliche Achterbahnfahrten geht. Wobei sich kulinarische Experimentierfreude in China ja oft auszahlt und ganz neue Areale in Mund- und Magengegend aktiviert.
Verena Menzel betreibt in Peking die Online-Sprachschule New Chinese, wo es jetzt ein ganz neues Kursformat für Einsteiger gibt – für alle, die endlich mit Spaß und Struktur Chinesisch lernen wollen.
