es ist nichts Anrüchiges daran, wenn sich Afrikas Staatschefs für Investitionen aus China interessieren. Auch Deutschland und die EU werben um Investoren aus dem Ausland und zeigen Entgegenkommen, wenn diese angeboten werden. Doch Xi hatte die volle Aufmerksamkeit der Anwesenden in der Großen Halle des Volkes, als er den Teilnehmern des China-Afrika-Gipfels in Peking 45 Milliarden Euro versprach.
Es sei schon auffällig, wie unverblümt sich die Vertreter Afrikas für frische Kredite interessieren, schreibt Andreas Sieren. Doch in Chinas Botschaften verbarg sich auch die Ankündigung eines Kurswechsels: Xi betont vor allem, dort neue Arbeitsplätze zu schaffen. Daran haperte es bisher. China lieferte seine Waren in Afrika ab und nahm Rohstoffe mit, statt neue Fabriken zu bauen. Daran gab es durchaus Kritik in den Empfängerländern. Hier steuert Xi daher nun um.
Die Verhaftung des Künstlers Gao Zhen verdeutlicht den steigenden Druck auf die Kunstfreiheit in China, wie Fabian Peltsch schreibt. Werke, die sozialistische Anführer kritisieren, wie die Skulpturen der Gao-Brüder, sind zunehmend Ziel staatlicher Repressionen. Zwar gab es vorher schon Einschränkungen, doch unter Xi Jinping werden sie wieder viel schlimmer als unter den vorhergegangenen Führungsgenerationen seit Mao.
Auch im Ausland versucht die chinesische Regierung, regimekritische Kunst zu unterdrücken, während Persönlichkeiten wie Gao Zhen oder der in Australien lebende Badiucao weiter Widerstand leisten. Sie lenken damit internationale Aufmerksamkeit auf das Thema Ausdrucksfreiheit in der chinesischen Gesellschaft.


Am Freitag geht in Peking der neunte China-Afrika-Gipfel zu Ende. Das Treffen von Vertretern 53 afrikanischer Staaten mit Xi Jinping und anderen chinesischen Top-Führern gilt als voller Erfolg für China. Xi versprach Investitionen in Höhe von 360 Milliarden Yuan (45 Milliarden Euro) in den kommenden drei Jahren. China werde mindestens eine Million Arbeitsplätze in Afrika schaffen, sagte Xi. Die afrikanisch-chinesischen Beziehungen befänden sich auf einem Höhepunkt.
Mit der Mischung aus Geld und Respekt erwirbt China in Afrika viele Pluspunkte. Gerade jetzt kann Xi viel für seine geopolitischen Ziele bewirken, indem er den Hebel richtig ansetzt: Das Forum on China-Africa Cooperation (Focac) findet vor dem Hintergrund sich wandelnder geopolitischer Verhältnisse statt. Der globale Süden, unter anderem Afrika, will mehr Mitbestimmung in der Welt und wird dabei von China unterstützt.
China selbst verfolgt das Ziel, sich wieder in den Mittelpunkt der Welt zu schieben. Auch in Afrika wird die Zukunft der Welt entschieden mitgestaltet. Paul Frimpong, Direktor des in Ghana ansässigen Africa-China Centre for Policy and Advisory, sagte gegenüber der BBC, dass westliche Mächte – ebenso wie die ölreichen Golfstaaten – versuchen, Chinas Einfluss in Afrika zu erreichen. “Es gibt ein großes Interesse und einen großen Wettbewerb um Afrikas Potenzial.”
China ist zwar schon seit 15 Jahren der größte Handelspartner der Afrikaner. Und auch 2023 wurde beim Handel mit 282 Milliarden US-Dollar wieder ein Allzeithoch erzielt. Aber das tatsächliche Bild ist gemischter. Die Handelsbeziehungen sind von einem schweren Defizit zu Lasten Afrikas geprägt. Afrika wird zudem regelmäßig vorgehalten, nicht mit einer Stimme zu gegenüber China zu sprechen.
Das Gleiche kann man allerdings auch von Europa sagen, wo Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Alleingang und ohne Konsultationen mit EU-Mitgliedsländern versucht hat, den Kurs Brüssels gegenüber China zu bestimmen.
Auch ist die Afrikanische Union (AU), die doppelt so viele Länder wie die EU vertritt, noch mit vielen politischen Entwicklungsprojekten wie etwa dem Aufbau der afrikanischen Freihandelszone beschäftigt. In einem bilateralen Treffen mit Xi bemerkte der Vorsitzende der AU-Kommission, Moussa Faki Mahamat, dass er während seiner achtjährigen Amtszeit das “schnelle Wachstum der Beziehungen zwischen der AU und China miterlebt” habe und dankte China für die “wertvolle Hilfe”. Doch es wurden nicht nur Höflichkeiten ausgetauscht. Die Afrikaner fragen immer unverblümter: “What’s in for us?”
So nutzten afrikanische Staatspräsidenten die Zeit vor dem Gipfel für bilaterale Staatsbesuche mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa traf bereits am Montag mit Xi zusammen. Beide sprachen von einem Treffen mit “großer Bedeutung”, bei dem es um wechselseitige Investitionen zwischen den beiden Volkswirtschaften ging. Schon im Vorfeld hatte Ramaphosa die guten Beziehungen zwischen Südafrika und China gelobt.
Aber Ramaphosa hatte auch eine klare Botschaft dabei: “Als Südafrika möchten wir das Handelsdefizit verringern und die Struktur unseres Handels verbessern”, so der Präsident. “Der Besuch chinesischer Unternehmen im vergangenen Jahr hat uns ermutigt. Wir fordern nachhaltigere Produktion und arbeitsplatzschaffende Investitionen.”
Xi kündigte an, die bilateralen Beziehungen auf die Ebene einer “neuen Ära der umfassenden strategischen Partnerschaft” zu heben. Konkret wies Ramaphosa auf den Energiesektor hin, den das Land am Kap mit erneuerbaren Energien und grünem Wasserstoff revolutionieren und dabei China als Partner gewinnen möchte.
Der Aufruf kommt in derselben Woche, in der Rainer Baake, BMZ-Sonderbeauftragter für die “Just Energy Transition Partnership” (JETP) mit Südafrika sowie die AA-Klimastaatssekretärin Jennifer Morgan sich um eine ähnliche Zusammenarbeit in Pretoria bemühen. Sie hatten allerdings mehr gute Ratschläge als Geld in der Tasche.
Der kenianische Präsident William Ruto traf sich ebenfalls mit Xi. Auch er hob das Potenzial einer Kooperation im Energiebereich hervor: “Unser Kontinent verfügt über 60 Prozent der weltweiten erneuerbaren Energie. Die Kombination unserer erneuerbaren Energieressourcen und erneuerbarer Energietechnologien aus China wird eine Win-Win-Situation sein”, bemerkte Ruto in einem Interview mit der staatsnahen chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua.
Auf seinem langen Wunschzettel hatte er jedoch wichtige Infrastrukturprojekte, die er mit chinesischer Finanzierung weiterbringen möchte, darunter die Verlängerung der Mombasa-Nairobi-Eisenbahnlinie nach Uganda sowie der Rironi-Mau-Summit-Fernstraße, ebenfalls an die ugandische Grenze.
In seinem Treffen mit Xi betonte Félix Tshisekedi, Präsident der Demokratischen Republik Kongo, dass Focac den afrikanischen Ländern “eine wichtige Gelegenheit” biete, “ihre Entwicklungsträume zu verwirklichen”. China sei “verlässlicher und engagierter Partner bei der Entwicklung des afrikanischen Kontinents.” Auch er will am Ende neue Kredite. Ähnlich war es bei den Staats- und Regierungschefs von Äthiopien, Nigeria und Senegal, die mit Xi zusammenkamen.
Die gemeinsame Erklärung, die heute verabschiedet wird, legt die Richtung für die nächsten drei Jahre fest. Denn der Gipfel findet nur alle drei Jahre statt. In den Augen von Cobus van Staden, Mitbegründer des China-Global South Project, gibt sich China Mühe, seinen Status als Entwicklungsland zu betonen und Solidarität mit Afrika und dem Rest des globalen Südens zu signalisieren. “Es vermeidet die Tristheit der anhaltenden Entwicklungshilfe der USA und der EU mit ihren damit verbundenen Konditionalitäten und Predigten”, so van Staden.
Das kommt in Afrika gut an. Doch am Ende zählt nur eines: Wie viel Arbeitsplätze die Chinesen in Afrika schaffen. Und das Spiel kennen die Chinesen genau. Auch sie haben vor drei Jahrzehnten angefangen die westlichen Hersteller zu zwingen immer mehr Produkte für den chinesischen Markt auch in China zu produzieren. Deshalb betonte Xi in seiner Rede auch die konkrete Zahl von einer Million Jobs.
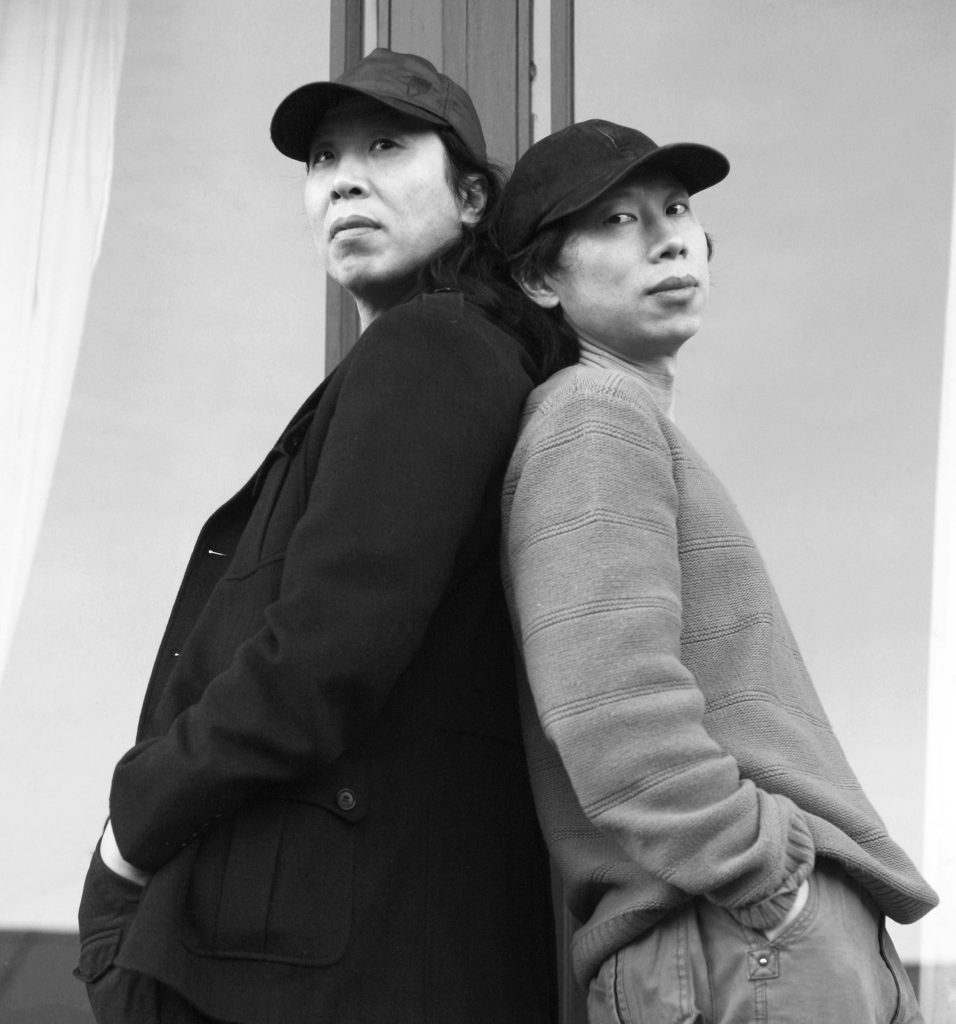
Der Staat schüchtert Chinas Künstler durch eine Reihe Verhaftungen und Drohungen weiter ein. Die Vorgänge zeigen, dass der Führung weniger denn je an den Vorteilen einer freien Gesellschaft gelegen ist. Zugleich treten überwunden geglaubte Maßstäbe für die Bewertung der Kunst wieder in den Vordergrund: Erhalt des Respekts für sozialistische Führungspersonen und soziale Stabilität.
Der bekannte Künstler Gao Zhen 高兟 wurde Ende August in China verhaftet, wie Anfang der Woche bekannt wurde. Gaos Frau, die gerade mit dem gemeinsamen Sohn nach New York ausreisen wollte, wurde am vergangenen Dienstag ebenfalls in China festgenommen. Gao Zhen hält seit 2011 eine Green Card für die USA, sein Sohn wurde dort geboren. In den letzten zwei Jahren pendelte der 68-jährige Künstler oft zwischen China und New York, um im Studio außerhalb Pekings an seinen Skulpturen zu arbeiten. Zuletzt war er im Juni aus den USA für einen Familienbesuch nach China eingereist.
Zusammen mit seinem Bruder Gao Qiang 高强 hatte er unter dem Namen Gao Brothers in der Vergangenheit auch kritische Kunstwerke angefertigt, unter anderem solche mit dem Konterfei Mao Zedongs, die sich mit der Kulturrevolution auseinandersetzen. Eine der beschlagnahmten Riesen-Büsten zeigt den “Großen Steuermann” mit Brüsten und Pinoccio-Nase. Eine Provokation. Andererseits wurde die Skulptur vor mehr als zehn Jahren vollendet und seitdem oftmals ausgestellt. Warum also jetzt die Verhaftung?
Gaos Bruder, der seit vielen Jahren nicht in China war, glaubt, dass Gao Zhen innerhalb eines 2021 ins Strafgesetzbuch aufgenommenen Gesetzes als Exempel statuiert wird. Es ahndet die “Schädigung des Rufs oder der Ehre von Helden und Märtyrern” mit bis zu drei Jahren Gefängnis. “Ich bin der Meinung, dass so eine rückwirkende Bestrafung dem Grundsatz des Rückwirkungsverbots widerspricht, der ein weithin akzeptierter Standard in der modernen Rechtsstaatlichkeit ist”, sagt Gao Qiang gegenüber Table.Briefings. “Darüber hinaus ist es fraglich, ob Mao als Held oder Märtyrer zu bezeichnen ist.”
Gao Qiang hatte seinen Bruder vor der Reise gewarnt. “Unsere Freunde in China haben erzählt, wie sehr die Regierung in den letzten zehn Jahren die Kontrolle über verschiedene Aspekte der Gesellschaft verschärft hat”, sagt Gao Qiang. “Das Umfeld für Künstler ist schwieriger geworden, und es besteht ein größeres Risiko, Werke zu schaffen, die nicht mit den Ansichten der Regierung übereinstimmen.”
Mehrmals hat Staatschef Xi Jinping auch an die Künstler des Landes appelliert, sie sollen Chinas Geschichte gut erzählen. Damit steht Xi in der Tradition Maos, der 1942 bei seiner berühmten “Rede an die Künstler und Schriftsteller” in Yan’an erläuterte, dass jegliche Art von Kunst dazu dienen soll, die Massen zu erziehen. Die Künstler wurden in China seitdem aber nicht immer so gegängelt, im Gegenteil.
Noch in den Nullerjahren waren Werke, die Mao parodierten, auf dem boomenden Kunstmarkt Chinas ein alltäglicher Anblick. In den kommerziellen Galerien der Moganshan Lu 50 in Shanghai oder dem Kunstdistrikt 798 in Peking wurden sie tausendfach reproduziert und nachgeahmt, bis sie zu einem Klischee verkommen waren, das niemanden mehr ernsthaft empörte.
Unter Xi sei die Zensur und Selbstzensur jedoch wieder normal, sagt die junge Shanghaier Videokünstlerin Bing Qing zu Table.Briefings. “Jede Generation hat ihre eigenen politischen Probleme”. Für sie sei vor allem der Zero-Covid-Lockdown in Shanghai ein Trauma gewesen. Wenn man bestimmte Themen vermeidet und sich kommerziellen Möglichkeiten nicht verschließt, bestünden immer noch Freiräume, um von der Kunst gut leben zu können. “Ich würde meine Arbeiten auch als politisch betrachten, aber nicht so wie die westliche Welt politische Kunst in der Regel definiert”, sagt sie. “Es geht mir mehr um die mentalen Komplexitäten des Menschseins, die ja auch politischen Entscheidungen zugrunde liegen.”
Die Gao-Brüder hatten den pragmatischen Umgang mit den roten Linien des Staates ebenfalls praktiziert und zuletzt kaum mehr plakative politische Kunst produziert. Ihr Studio haben sie aus Sicherheitsgründen nicht mehr der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. “Als der Künstler Ai Weiwei vor zehn Jahren inhaftiert wurde, wurden wir nicht festgenommen, obwohl wir aufgrund von Interviews mit westlichen Medien und der Schaffung und Ausstellung sensibler Werke viele Schwierigkeiten hatten”, erinnert er sich. Mittlerweile verschwänden jedoch auch die Grauzonen mehr und mehr. “Eine gesunde Gesellschaft sollte sich in Richtung einer zunehmenden Freiheit des Denkens und Handelns bewegen, nicht in die entgegengesetzte Richtung.“
Selbst im Ausland versucht der chinesische Staat seinen Einfluss auf die Kunstfreiheit auszuüben, erklärt der in Australien lebende Künstler Badiucao. Um seine Ausstellungen in Ländern wie Italien und Polen zu verhindern, haben chinesische Diplomaten immer wieder Druck gemacht und unverhohlen mit ernsten Folgen gedroht, sollten seine regimekritischen Werke doch gezeigt werden. “Heutzutage ist es fast unmöglich, die chinesische Regierung nicht zu beleidigen”, sagt er. “Alles könnte problematisch sein.” Nach der Verhaftung, hat der 38-Jährige ein Poster designt, das Gao Zhens sofortige Freilassung fordert.
Auch Gao Zhens Bruder macht sich große Sorgen. “Gao Zhen ist fast 70 Jahre alt und von Natur aus sensibel und melancholisch, so dass ich mir große Sorgen um seine körperliche und geistige Gesundheit mache. Ich hoffe, dass alle die sofortige Freilassung von Gao Zhen fordern, damit er wieder mit seiner Familie vereint werden und sicher nach New York zurückkehren kann.”
09.09.2024, 16:00 Uhr
China Netzwerk Baden-Württemberg, CNBW Nähkästle mit Corinne Abele (in Berlin): Wie geht es weiter mit Chinas Technologie-Aufholjagd? Anmeldung
09.09.2024, 13:30 Uhr (19:30 Uhr Beijing time)
Fairbanks Center, Livestream auf Youtube: Wan-an Chiang (Bürgermeister von Taipeh) – Global Taipei: Bridging Tradition and Innovation Mehr
11.09.2024, 18:00 Uhr
Konfuzius-Institut der FU Berlin, Vernissage (in Berlin): Entzünden wir Licht am Licht: China in den Augen von Leibniz – Eine Kalligraphie-Ausstellung von Prof. Dr. Chen Hongjie Mehr
11.09.2024, 14:30 Uhr
Deutsch-Chinesische Wirtschaftsvereinigung, Promotionsveranstaltung (in Düsseldorf): Deutsch-Chinesisches Forum für Wirtschafts- und Handelskooperation (China International Supply Chain Expo) Mehr
12.09.2024, 08:30 Uhr (14:30 Uhr Beijing time)
China Netzwerk Baden-Württemberg, Webinar: Key Insights and Practical Strategies for China’s Outbound Data Transfer Mehr
16.09.2024, 18:30 Uhr (17.09., 00:30 Uhr Beijing time)
Konfuzius-Institut Freiburg, Vortrag (hybrid): Chinesisch entschlüsselt: Chinas Sprachkultur im Überblick Mehr
19.09.2024, 15:00 Uhr (21:00 Uhr Beijing time)
IfW Kiel, Global China Conversations #34: Wie wirkt sich die Jugendarbeitslosigkeit in China auf die Entwicklung des Landes und der Welt aus? Mehr
Eines der größten Automobilunternehmen Chinas, Changan Automobile, hat in München eine Niederlassung gegründet. Das teilte das Unternehmen auf Weibo mit. Zu Changan gehören Elektroauto-Marken wie Avatr, Deepal und Nevo. Der Konzern besitzt Joint Ventures mit Ford, Mazda und Suzuki.
Die neue Changan Automobile Deutschland GmbH soll sich neben Sales, Marketing und Service mit Marktforschung und Kunden-Insights, technische Richtlinien und Fahrzeugzulassungen sowie lokaler Produktentwicklung beschäftigen. Ein Designzentrum gibt es in München bereits. Und auch die Designsprache trägt deutsche Züge: Klaus Zyciora, ehemaliger Chefdesigner von Volkswagen, ist seit vergangenem Jahr Global Head of Design.
Den Schritt nach Deutschland bezeichnet Changan selbst als Teil seines “Vast Ocean” Plans, einer globalen Expansionsstrategie. Demnach will Changan bis 2030 in mehr als 90 Prozent der globalen Märkte präsent sein, unter anderem durch 20 lokalisierte Marketingorganisationen mit mehr als 3.000 Ablegern. Seinen ersten Produktionsstandort im Ausland baut Changan aktuell in Thailand, wo ab dem kommenden Jahr Fahrzeuge vom Band rollen sollen. Auch Werke in Südamerika und Europa sind geplant.
Changan besitzt einen lange Firmenhistorie, seit 1959 produziert das Unternehmen mit Hauptsitz in Chongqing, Sichuan, Autos. Changan ist der kleinste der vier großen staatlichen Automobilkonzerne, zu denen auch SAIC Motor, die FAW Group und die Dongfeng Motor Corporation gehören.
Bei den Fahrzeugverkäufen in China ist Changan weit vorne mit dabei. Unter den chinesischen Marken kam der Konzern im ersten Halbjahr 2024 mit einem Verkaufsvolumen von 809.000 Fahrzeugen auf Platz vier hinter BYD, Chery und Geely. Im Ausland verkaufte Changan bis Juli dieses Jahres 228.000 Fahrzeuge, ein Zuwachs von knapp 70 Prozent. Ende des Jahres soll diese Zahl bei 480.000 Fahrzeugen stehen. jul
Für die Kooperation zwischen dem ungarischen Konzern Acemil und dem chinesischen Schienenfahrzeughersteller China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) könnte nun ein eigenes Werk in Ungarn entstehen, um den europäischen Markt zu beliefern. Das berichtete die Branchenplattform Railway Gazette.
Acemil hatte im Mai dieses Jahres einen Kooperationsvertrag CRRC ZELC, einer Tochtergesellschaft des chinesischen Staatskonzerns, unterzeichnet. Die Produktionsanlagen sollen dem Bericht zufolge ab nächstem Jahr betriebsbereit sein. Die beiden Unternehmen möchten auch eine Einrichtung für Trainings sowie Forschung und Entwicklung errichten.
CRRC ZELC stellt in erster Linie Rangier- und Güterzuglokomotiven her. Diese sollen für den europäischen Markt nun auch aus ungarischer Produktion kommen: Die wichtigsten Produkte, die CRRC ZELC für den EU-Markt herstellen möchte, sind laut Bericht Strecken- und Rangierlokomotiven, elektrische Triebzüge und Doppelstockzüge. CRRC ZELC und Acemil gehen demnach davon aus, dass alle vier dieser Produktlinien in Zukunft in Ungarn hergestellt werden könnten.
Mit der Herstellung in der EU gemeinsam mit Acemil kann CRRC ZELC auch größere Ausschreibungen annehmen, ohne Ziel der Foreign Subsidies Regulation zu werden, die Subventionen aus Drittstaaten innerhalb der EU überprüft. In Bulgarien hatte sich eine weitere CRRC-Tochter, CRRC Qingdao Sifang Locomotive, bereits aus einer Ausschreibung zurückgezogen, nachdem die EU-Kommission eine Untersuchung eingeleitet hatte. ari
Die chinesischen Behörden haben fünf aktuelle und ehemalige Mitarbeiter des britisch-schwedischen Pharmaunternehmens AstraZeneca festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, gegen Datenschutzbestimmungen verstoßen und ein nicht zugelassenes Krebsmedikament eingeführt zu haben.
In jüngster Zeit geht die chinesische Regierung verstärkt gegen Medikamentenschmuggel vor. “Wir sind uns bewusst, dass Ermittlungen gegen eine kleine Anzahl unserer Mitarbeiter laufen”, erklärte ein AstraZeneca-Sprecher gegenüber Nachrichtenagenturen, ohne weitere Details preiszugeben. Die Polizei in Shenzhen reagierte zunächst nicht auf Anfragen zu einer Stellungnahme. fin
China will künftig keine Adoptionen chinesischer Kinder über die Landesgrenze hinweg mehr gestatten. Das berichtete die Nachrichtenagentur AP. Einzige Ausnahme bleibe die Adoption durch nahe Verwandte, wie etwa bei der Adoption von Stiefkindern oder Blutsverwandten, erklärte eine Sprecherin des Außenministeriums. Die Entscheidung stehe im Einklang mit internationalen Abkommen. Nähere Gründe dafür nannte sie nicht. Es dürfte aber mit der sinkenden Geburtenrate Chinas und der daraus folgenden Überalterung zusammenhängen.
In den vergangenen Jahrzehnten haben viele internationale Familien Kinder aus China adoptiert und sie in ihre neuen Heimatländer gebracht. Während der Pandemie wurden internationale Adoptionen durch China dann jedoch ausgesetzt. Später durften zumindest Kinder noch ausreisen, die noch vor der Aussetzung im Jahr 2020 eine Reiseerlaubnis erhalten hatten. Zwischen Oktober 2022 und September 2023 erteilten US-Konsulate 16 Visa für Adoptionen aus China – die ersten nach einer zweijährigen Pause. Ob seitdem weitere Visa ausgestellt wurden, ist bislang nicht bekannt. fin
Eine führende Zeitschrift der Kommunistischen Partei Chinas veröffentlichte Anfang dieser Woche Xi Jinpings unverblümte Kommentare zu dem, was er als harten Wettbewerb zwischen der Partei und “verschiedenen Gegnern” um Chinas junge Generation sieht. Zum ersten Schultag am 1. September veröffentlichte die Zeitschrift Qiushi, deren Aufgabe es ist, die Regierungsphilosophie der Partei zu verbreiten, Xis Worte zur Bildung als Leitartikel.
Darin sagte er, die Widersacher hätten “nie aufgehört, die Regierung zu untergraben und zu sabotieren” und “eine Farbrevolution anzuzetteln”. Um dem entgegenzuwirken, sei es oberste Priorität der chinesischen Pädagogen, “Generation um Generation von jungen Menschen heranzuziehen, die die Führung der Partei und das sozialistische System unterstützen”.
Zudem erklärte er in den für ihn typischen betont umgangssprachlichen, aber grammatikalisch unsauberen Sätzen, dass das chinesische Bildungssystem “niemals Menschen mit chinesischem Gesicht, aber [sic] sind keine chinesischen Herzen, ohne Gefühle für China und ohne chinesischen Charakter hervorbringen sollte.” (长着中国脸,不是中国心,没有中国情,缺少中国味.)
Dass Qiushi dieser kämpferischen Äußerungen aufgriff, die Xi im Rahmen einer Konferenz im Jahr 2018 gemacht hatte, lässt darauf schließen, dass seine Position in diesem Punkt unverändert ist, wenn nicht sogar in den folgenden Jahren weiter gefestigt wurde, und er sich nicht scheut, sie erneut offen auszusprechen.
Es lohnt sich ein genauer Blick auf Xis Worte. Jedem, der sich mit der deutschen Geschichte auskennt, könnten sie bekannt vorkommen:
Die ideologische Erziehung in Chinas Schulen und Universitäten lässt sich grob in drei Teile unterteilen. Den ersten Teil bildet der Unterricht zur “Theorie des Marxismus” und die Theorie des “Sozialismus chinesischer Prägung”. Der zweite Teil ist der Geschichtsunterricht. Der dritte Teil setzt sich aus Elementen der ersten beiden Teile zusammen, die in andere Fächer wie etwa Chinesische und internationale Beziehungen einfließen.
Während der Theorieteil fast vollständig gescheitert ist, ist die Geschichtslehre mit ihrer Verherrlichung der Partei und dem Aufbau einer Opfermentalität insgesamt ein Riesenerfolg. Dies half der kommunistischen Partei bei der Legitimierung ihrer Herrschaft.
Der Theorieteil bestand zwischen den 1950er- und 1970er-Jahren aus destillierten Theorien des Marxismus und Leninismus, wie Marx’ Projektion der Entwicklung der menschlichen Gesellschaft von einer primitiven zu einer paradiesischen kommunistischen Gesellschaft; der ausbeuterische Charakter des Kapitalismus, der durch eine proletarische Revolution zum Untergang verurteilt ist; und die Notwendigkeit einer proletarischen Diktatur in der “sozialistischen Phase” der kommunistischen Länder.
Mit der Entwicklung des Weltgeschehens seit den 1980er-Jahren erwiesen sich diese Theorien als zunehmend überholt und wenig glaubwürdig. Ein Teil von ihnen wurde später durch neu erfundene “Theorien” ersetzt, wie etwa die Theorie über des Sozialismus chinesischer Prägung (in der Ära von Deng Xiaoping), die Ideen des Dreifachen Vertretens (Jiang Zemin) und Xi Jinpings Ideen des Sozialismus chinesischer Prägung im neuen Zeitalter.
Bei den Inhalten letzterem handelt es sich aber eher um Erklärungen für politische Maßnahmen als um echte systematische Theorien. In Lehrbüchern abgedruckt, werden sie zu einer Art Flickenteppich aus Kauderwelsch. Trotzdem gehören sie zur Pflichtlektüre an weiterführenden Schulen und Universitäten. Um zu bestehen, müssen Studenten und Schüler in Prüfungen lediglich wiederholen, was in den Lehrbüchern steht.
Wie in allen kommunistischen Ländern üblich, sind auch Chinas Geschichtslehrbücher voller Lügen. Bedauerlicherweise haben Generationen von Schülern und Studenten sie sehr gut verinnerlicht. Manche von ihnen fanden später die Wahrheit heraus, manche aber leben weiter mit einer stark verzerrten Sicht auf die Welt. Die Probleme der Geschichtslehrbücher sind vielfältig. Um einige der größten zu nennen:
Der Erfolg der Geschichtserziehung der Kommunistischen Partei resultiert in einer chronisch nationalistischen Stimmung und Fremdenfeindlichkeit. Durch das Internet kennen viele die Wahrheit und haben begonnen, das Narrativ der Partei zu hinterfragen und die Welt aus anderen Blickwinkeln zu betrachten. Aus diesem Grund wirkte Xi in seiner Rede zur Bildung so defensiv.
Katrina Northrop ist neue China-Korrespondentin der Washington Post. Sie wird von Taipeh aus arbeiten. Northrop schrieb zuvor für The Wire China.
Sally Jensen Cusicahua ist neue Südostasien-Korrespondentin für die Nachrichtenagentur AFP. Sie wird von Bangkok aus arbeiten. Jensen Cusicahua war zuvor für TaiwanPlus in Taipeh im Einsatz.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Ungewollt verwunschen: Diese Fachwerkhäuser in Zhenjiang in der Provinz Jiangsu sind märchenhaft überwuchert und wirken damit unfreiwillig abenteuerlich. Was wie ein perfekter Ausflugsort für Lost-Places-Fans aussieht und eine wahre Freude für Fotografen ist, sollte eigentlich ein Vergnügungspark werden. Als Konkurrenz zum Disneyland in Shanghai sollte der Park namens Evergrande Cultural Tourism City Millionen in die Kassen spülen. Doch bevor es dazu kam, ging dem ehemals zweitgrößten Immobilienkonzern Chinas allerdings das Geld aus. Seit 2021 liegt das Bauprojekt daher brach.
es ist nichts Anrüchiges daran, wenn sich Afrikas Staatschefs für Investitionen aus China interessieren. Auch Deutschland und die EU werben um Investoren aus dem Ausland und zeigen Entgegenkommen, wenn diese angeboten werden. Doch Xi hatte die volle Aufmerksamkeit der Anwesenden in der Großen Halle des Volkes, als er den Teilnehmern des China-Afrika-Gipfels in Peking 45 Milliarden Euro versprach.
Es sei schon auffällig, wie unverblümt sich die Vertreter Afrikas für frische Kredite interessieren, schreibt Andreas Sieren. Doch in Chinas Botschaften verbarg sich auch die Ankündigung eines Kurswechsels: Xi betont vor allem, dort neue Arbeitsplätze zu schaffen. Daran haperte es bisher. China lieferte seine Waren in Afrika ab und nahm Rohstoffe mit, statt neue Fabriken zu bauen. Daran gab es durchaus Kritik in den Empfängerländern. Hier steuert Xi daher nun um.
Die Verhaftung des Künstlers Gao Zhen verdeutlicht den steigenden Druck auf die Kunstfreiheit in China, wie Fabian Peltsch schreibt. Werke, die sozialistische Anführer kritisieren, wie die Skulpturen der Gao-Brüder, sind zunehmend Ziel staatlicher Repressionen. Zwar gab es vorher schon Einschränkungen, doch unter Xi Jinping werden sie wieder viel schlimmer als unter den vorhergegangenen Führungsgenerationen seit Mao.
Auch im Ausland versucht die chinesische Regierung, regimekritische Kunst zu unterdrücken, während Persönlichkeiten wie Gao Zhen oder der in Australien lebende Badiucao weiter Widerstand leisten. Sie lenken damit internationale Aufmerksamkeit auf das Thema Ausdrucksfreiheit in der chinesischen Gesellschaft.


Am Freitag geht in Peking der neunte China-Afrika-Gipfel zu Ende. Das Treffen von Vertretern 53 afrikanischer Staaten mit Xi Jinping und anderen chinesischen Top-Führern gilt als voller Erfolg für China. Xi versprach Investitionen in Höhe von 360 Milliarden Yuan (45 Milliarden Euro) in den kommenden drei Jahren. China werde mindestens eine Million Arbeitsplätze in Afrika schaffen, sagte Xi. Die afrikanisch-chinesischen Beziehungen befänden sich auf einem Höhepunkt.
Mit der Mischung aus Geld und Respekt erwirbt China in Afrika viele Pluspunkte. Gerade jetzt kann Xi viel für seine geopolitischen Ziele bewirken, indem er den Hebel richtig ansetzt: Das Forum on China-Africa Cooperation (Focac) findet vor dem Hintergrund sich wandelnder geopolitischer Verhältnisse statt. Der globale Süden, unter anderem Afrika, will mehr Mitbestimmung in der Welt und wird dabei von China unterstützt.
China selbst verfolgt das Ziel, sich wieder in den Mittelpunkt der Welt zu schieben. Auch in Afrika wird die Zukunft der Welt entschieden mitgestaltet. Paul Frimpong, Direktor des in Ghana ansässigen Africa-China Centre for Policy and Advisory, sagte gegenüber der BBC, dass westliche Mächte – ebenso wie die ölreichen Golfstaaten – versuchen, Chinas Einfluss in Afrika zu erreichen. “Es gibt ein großes Interesse und einen großen Wettbewerb um Afrikas Potenzial.”
China ist zwar schon seit 15 Jahren der größte Handelspartner der Afrikaner. Und auch 2023 wurde beim Handel mit 282 Milliarden US-Dollar wieder ein Allzeithoch erzielt. Aber das tatsächliche Bild ist gemischter. Die Handelsbeziehungen sind von einem schweren Defizit zu Lasten Afrikas geprägt. Afrika wird zudem regelmäßig vorgehalten, nicht mit einer Stimme zu gegenüber China zu sprechen.
Das Gleiche kann man allerdings auch von Europa sagen, wo Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Alleingang und ohne Konsultationen mit EU-Mitgliedsländern versucht hat, den Kurs Brüssels gegenüber China zu bestimmen.
Auch ist die Afrikanische Union (AU), die doppelt so viele Länder wie die EU vertritt, noch mit vielen politischen Entwicklungsprojekten wie etwa dem Aufbau der afrikanischen Freihandelszone beschäftigt. In einem bilateralen Treffen mit Xi bemerkte der Vorsitzende der AU-Kommission, Moussa Faki Mahamat, dass er während seiner achtjährigen Amtszeit das “schnelle Wachstum der Beziehungen zwischen der AU und China miterlebt” habe und dankte China für die “wertvolle Hilfe”. Doch es wurden nicht nur Höflichkeiten ausgetauscht. Die Afrikaner fragen immer unverblümter: “What’s in for us?”
So nutzten afrikanische Staatspräsidenten die Zeit vor dem Gipfel für bilaterale Staatsbesuche mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa traf bereits am Montag mit Xi zusammen. Beide sprachen von einem Treffen mit “großer Bedeutung”, bei dem es um wechselseitige Investitionen zwischen den beiden Volkswirtschaften ging. Schon im Vorfeld hatte Ramaphosa die guten Beziehungen zwischen Südafrika und China gelobt.
Aber Ramaphosa hatte auch eine klare Botschaft dabei: “Als Südafrika möchten wir das Handelsdefizit verringern und die Struktur unseres Handels verbessern”, so der Präsident. “Der Besuch chinesischer Unternehmen im vergangenen Jahr hat uns ermutigt. Wir fordern nachhaltigere Produktion und arbeitsplatzschaffende Investitionen.”
Xi kündigte an, die bilateralen Beziehungen auf die Ebene einer “neuen Ära der umfassenden strategischen Partnerschaft” zu heben. Konkret wies Ramaphosa auf den Energiesektor hin, den das Land am Kap mit erneuerbaren Energien und grünem Wasserstoff revolutionieren und dabei China als Partner gewinnen möchte.
Der Aufruf kommt in derselben Woche, in der Rainer Baake, BMZ-Sonderbeauftragter für die “Just Energy Transition Partnership” (JETP) mit Südafrika sowie die AA-Klimastaatssekretärin Jennifer Morgan sich um eine ähnliche Zusammenarbeit in Pretoria bemühen. Sie hatten allerdings mehr gute Ratschläge als Geld in der Tasche.
Der kenianische Präsident William Ruto traf sich ebenfalls mit Xi. Auch er hob das Potenzial einer Kooperation im Energiebereich hervor: “Unser Kontinent verfügt über 60 Prozent der weltweiten erneuerbaren Energie. Die Kombination unserer erneuerbaren Energieressourcen und erneuerbarer Energietechnologien aus China wird eine Win-Win-Situation sein”, bemerkte Ruto in einem Interview mit der staatsnahen chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua.
Auf seinem langen Wunschzettel hatte er jedoch wichtige Infrastrukturprojekte, die er mit chinesischer Finanzierung weiterbringen möchte, darunter die Verlängerung der Mombasa-Nairobi-Eisenbahnlinie nach Uganda sowie der Rironi-Mau-Summit-Fernstraße, ebenfalls an die ugandische Grenze.
In seinem Treffen mit Xi betonte Félix Tshisekedi, Präsident der Demokratischen Republik Kongo, dass Focac den afrikanischen Ländern “eine wichtige Gelegenheit” biete, “ihre Entwicklungsträume zu verwirklichen”. China sei “verlässlicher und engagierter Partner bei der Entwicklung des afrikanischen Kontinents.” Auch er will am Ende neue Kredite. Ähnlich war es bei den Staats- und Regierungschefs von Äthiopien, Nigeria und Senegal, die mit Xi zusammenkamen.
Die gemeinsame Erklärung, die heute verabschiedet wird, legt die Richtung für die nächsten drei Jahre fest. Denn der Gipfel findet nur alle drei Jahre statt. In den Augen von Cobus van Staden, Mitbegründer des China-Global South Project, gibt sich China Mühe, seinen Status als Entwicklungsland zu betonen und Solidarität mit Afrika und dem Rest des globalen Südens zu signalisieren. “Es vermeidet die Tristheit der anhaltenden Entwicklungshilfe der USA und der EU mit ihren damit verbundenen Konditionalitäten und Predigten”, so van Staden.
Das kommt in Afrika gut an. Doch am Ende zählt nur eines: Wie viel Arbeitsplätze die Chinesen in Afrika schaffen. Und das Spiel kennen die Chinesen genau. Auch sie haben vor drei Jahrzehnten angefangen die westlichen Hersteller zu zwingen immer mehr Produkte für den chinesischen Markt auch in China zu produzieren. Deshalb betonte Xi in seiner Rede auch die konkrete Zahl von einer Million Jobs.
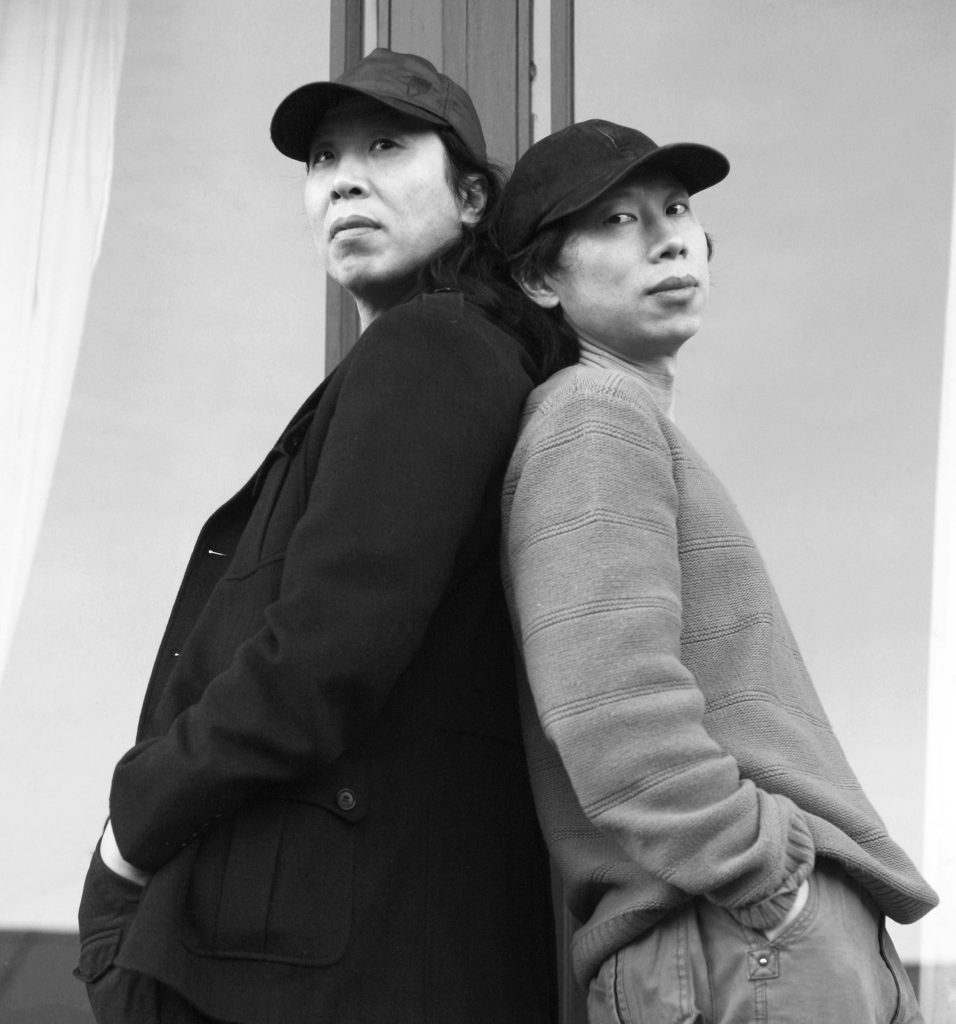
Der Staat schüchtert Chinas Künstler durch eine Reihe Verhaftungen und Drohungen weiter ein. Die Vorgänge zeigen, dass der Führung weniger denn je an den Vorteilen einer freien Gesellschaft gelegen ist. Zugleich treten überwunden geglaubte Maßstäbe für die Bewertung der Kunst wieder in den Vordergrund: Erhalt des Respekts für sozialistische Führungspersonen und soziale Stabilität.
Der bekannte Künstler Gao Zhen 高兟 wurde Ende August in China verhaftet, wie Anfang der Woche bekannt wurde. Gaos Frau, die gerade mit dem gemeinsamen Sohn nach New York ausreisen wollte, wurde am vergangenen Dienstag ebenfalls in China festgenommen. Gao Zhen hält seit 2011 eine Green Card für die USA, sein Sohn wurde dort geboren. In den letzten zwei Jahren pendelte der 68-jährige Künstler oft zwischen China und New York, um im Studio außerhalb Pekings an seinen Skulpturen zu arbeiten. Zuletzt war er im Juni aus den USA für einen Familienbesuch nach China eingereist.
Zusammen mit seinem Bruder Gao Qiang 高强 hatte er unter dem Namen Gao Brothers in der Vergangenheit auch kritische Kunstwerke angefertigt, unter anderem solche mit dem Konterfei Mao Zedongs, die sich mit der Kulturrevolution auseinandersetzen. Eine der beschlagnahmten Riesen-Büsten zeigt den “Großen Steuermann” mit Brüsten und Pinoccio-Nase. Eine Provokation. Andererseits wurde die Skulptur vor mehr als zehn Jahren vollendet und seitdem oftmals ausgestellt. Warum also jetzt die Verhaftung?
Gaos Bruder, der seit vielen Jahren nicht in China war, glaubt, dass Gao Zhen innerhalb eines 2021 ins Strafgesetzbuch aufgenommenen Gesetzes als Exempel statuiert wird. Es ahndet die “Schädigung des Rufs oder der Ehre von Helden und Märtyrern” mit bis zu drei Jahren Gefängnis. “Ich bin der Meinung, dass so eine rückwirkende Bestrafung dem Grundsatz des Rückwirkungsverbots widerspricht, der ein weithin akzeptierter Standard in der modernen Rechtsstaatlichkeit ist”, sagt Gao Qiang gegenüber Table.Briefings. “Darüber hinaus ist es fraglich, ob Mao als Held oder Märtyrer zu bezeichnen ist.”
Gao Qiang hatte seinen Bruder vor der Reise gewarnt. “Unsere Freunde in China haben erzählt, wie sehr die Regierung in den letzten zehn Jahren die Kontrolle über verschiedene Aspekte der Gesellschaft verschärft hat”, sagt Gao Qiang. “Das Umfeld für Künstler ist schwieriger geworden, und es besteht ein größeres Risiko, Werke zu schaffen, die nicht mit den Ansichten der Regierung übereinstimmen.”
Mehrmals hat Staatschef Xi Jinping auch an die Künstler des Landes appelliert, sie sollen Chinas Geschichte gut erzählen. Damit steht Xi in der Tradition Maos, der 1942 bei seiner berühmten “Rede an die Künstler und Schriftsteller” in Yan’an erläuterte, dass jegliche Art von Kunst dazu dienen soll, die Massen zu erziehen. Die Künstler wurden in China seitdem aber nicht immer so gegängelt, im Gegenteil.
Noch in den Nullerjahren waren Werke, die Mao parodierten, auf dem boomenden Kunstmarkt Chinas ein alltäglicher Anblick. In den kommerziellen Galerien der Moganshan Lu 50 in Shanghai oder dem Kunstdistrikt 798 in Peking wurden sie tausendfach reproduziert und nachgeahmt, bis sie zu einem Klischee verkommen waren, das niemanden mehr ernsthaft empörte.
Unter Xi sei die Zensur und Selbstzensur jedoch wieder normal, sagt die junge Shanghaier Videokünstlerin Bing Qing zu Table.Briefings. “Jede Generation hat ihre eigenen politischen Probleme”. Für sie sei vor allem der Zero-Covid-Lockdown in Shanghai ein Trauma gewesen. Wenn man bestimmte Themen vermeidet und sich kommerziellen Möglichkeiten nicht verschließt, bestünden immer noch Freiräume, um von der Kunst gut leben zu können. “Ich würde meine Arbeiten auch als politisch betrachten, aber nicht so wie die westliche Welt politische Kunst in der Regel definiert”, sagt sie. “Es geht mir mehr um die mentalen Komplexitäten des Menschseins, die ja auch politischen Entscheidungen zugrunde liegen.”
Die Gao-Brüder hatten den pragmatischen Umgang mit den roten Linien des Staates ebenfalls praktiziert und zuletzt kaum mehr plakative politische Kunst produziert. Ihr Studio haben sie aus Sicherheitsgründen nicht mehr der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. “Als der Künstler Ai Weiwei vor zehn Jahren inhaftiert wurde, wurden wir nicht festgenommen, obwohl wir aufgrund von Interviews mit westlichen Medien und der Schaffung und Ausstellung sensibler Werke viele Schwierigkeiten hatten”, erinnert er sich. Mittlerweile verschwänden jedoch auch die Grauzonen mehr und mehr. “Eine gesunde Gesellschaft sollte sich in Richtung einer zunehmenden Freiheit des Denkens und Handelns bewegen, nicht in die entgegengesetzte Richtung.“
Selbst im Ausland versucht der chinesische Staat seinen Einfluss auf die Kunstfreiheit auszuüben, erklärt der in Australien lebende Künstler Badiucao. Um seine Ausstellungen in Ländern wie Italien und Polen zu verhindern, haben chinesische Diplomaten immer wieder Druck gemacht und unverhohlen mit ernsten Folgen gedroht, sollten seine regimekritischen Werke doch gezeigt werden. “Heutzutage ist es fast unmöglich, die chinesische Regierung nicht zu beleidigen”, sagt er. “Alles könnte problematisch sein.” Nach der Verhaftung, hat der 38-Jährige ein Poster designt, das Gao Zhens sofortige Freilassung fordert.
Auch Gao Zhens Bruder macht sich große Sorgen. “Gao Zhen ist fast 70 Jahre alt und von Natur aus sensibel und melancholisch, so dass ich mir große Sorgen um seine körperliche und geistige Gesundheit mache. Ich hoffe, dass alle die sofortige Freilassung von Gao Zhen fordern, damit er wieder mit seiner Familie vereint werden und sicher nach New York zurückkehren kann.”
09.09.2024, 16:00 Uhr
China Netzwerk Baden-Württemberg, CNBW Nähkästle mit Corinne Abele (in Berlin): Wie geht es weiter mit Chinas Technologie-Aufholjagd? Anmeldung
09.09.2024, 13:30 Uhr (19:30 Uhr Beijing time)
Fairbanks Center, Livestream auf Youtube: Wan-an Chiang (Bürgermeister von Taipeh) – Global Taipei: Bridging Tradition and Innovation Mehr
11.09.2024, 18:00 Uhr
Konfuzius-Institut der FU Berlin, Vernissage (in Berlin): Entzünden wir Licht am Licht: China in den Augen von Leibniz – Eine Kalligraphie-Ausstellung von Prof. Dr. Chen Hongjie Mehr
11.09.2024, 14:30 Uhr
Deutsch-Chinesische Wirtschaftsvereinigung, Promotionsveranstaltung (in Düsseldorf): Deutsch-Chinesisches Forum für Wirtschafts- und Handelskooperation (China International Supply Chain Expo) Mehr
12.09.2024, 08:30 Uhr (14:30 Uhr Beijing time)
China Netzwerk Baden-Württemberg, Webinar: Key Insights and Practical Strategies for China’s Outbound Data Transfer Mehr
16.09.2024, 18:30 Uhr (17.09., 00:30 Uhr Beijing time)
Konfuzius-Institut Freiburg, Vortrag (hybrid): Chinesisch entschlüsselt: Chinas Sprachkultur im Überblick Mehr
19.09.2024, 15:00 Uhr (21:00 Uhr Beijing time)
IfW Kiel, Global China Conversations #34: Wie wirkt sich die Jugendarbeitslosigkeit in China auf die Entwicklung des Landes und der Welt aus? Mehr
Eines der größten Automobilunternehmen Chinas, Changan Automobile, hat in München eine Niederlassung gegründet. Das teilte das Unternehmen auf Weibo mit. Zu Changan gehören Elektroauto-Marken wie Avatr, Deepal und Nevo. Der Konzern besitzt Joint Ventures mit Ford, Mazda und Suzuki.
Die neue Changan Automobile Deutschland GmbH soll sich neben Sales, Marketing und Service mit Marktforschung und Kunden-Insights, technische Richtlinien und Fahrzeugzulassungen sowie lokaler Produktentwicklung beschäftigen. Ein Designzentrum gibt es in München bereits. Und auch die Designsprache trägt deutsche Züge: Klaus Zyciora, ehemaliger Chefdesigner von Volkswagen, ist seit vergangenem Jahr Global Head of Design.
Den Schritt nach Deutschland bezeichnet Changan selbst als Teil seines “Vast Ocean” Plans, einer globalen Expansionsstrategie. Demnach will Changan bis 2030 in mehr als 90 Prozent der globalen Märkte präsent sein, unter anderem durch 20 lokalisierte Marketingorganisationen mit mehr als 3.000 Ablegern. Seinen ersten Produktionsstandort im Ausland baut Changan aktuell in Thailand, wo ab dem kommenden Jahr Fahrzeuge vom Band rollen sollen. Auch Werke in Südamerika und Europa sind geplant.
Changan besitzt einen lange Firmenhistorie, seit 1959 produziert das Unternehmen mit Hauptsitz in Chongqing, Sichuan, Autos. Changan ist der kleinste der vier großen staatlichen Automobilkonzerne, zu denen auch SAIC Motor, die FAW Group und die Dongfeng Motor Corporation gehören.
Bei den Fahrzeugverkäufen in China ist Changan weit vorne mit dabei. Unter den chinesischen Marken kam der Konzern im ersten Halbjahr 2024 mit einem Verkaufsvolumen von 809.000 Fahrzeugen auf Platz vier hinter BYD, Chery und Geely. Im Ausland verkaufte Changan bis Juli dieses Jahres 228.000 Fahrzeuge, ein Zuwachs von knapp 70 Prozent. Ende des Jahres soll diese Zahl bei 480.000 Fahrzeugen stehen. jul
Für die Kooperation zwischen dem ungarischen Konzern Acemil und dem chinesischen Schienenfahrzeughersteller China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) könnte nun ein eigenes Werk in Ungarn entstehen, um den europäischen Markt zu beliefern. Das berichtete die Branchenplattform Railway Gazette.
Acemil hatte im Mai dieses Jahres einen Kooperationsvertrag CRRC ZELC, einer Tochtergesellschaft des chinesischen Staatskonzerns, unterzeichnet. Die Produktionsanlagen sollen dem Bericht zufolge ab nächstem Jahr betriebsbereit sein. Die beiden Unternehmen möchten auch eine Einrichtung für Trainings sowie Forschung und Entwicklung errichten.
CRRC ZELC stellt in erster Linie Rangier- und Güterzuglokomotiven her. Diese sollen für den europäischen Markt nun auch aus ungarischer Produktion kommen: Die wichtigsten Produkte, die CRRC ZELC für den EU-Markt herstellen möchte, sind laut Bericht Strecken- und Rangierlokomotiven, elektrische Triebzüge und Doppelstockzüge. CRRC ZELC und Acemil gehen demnach davon aus, dass alle vier dieser Produktlinien in Zukunft in Ungarn hergestellt werden könnten.
Mit der Herstellung in der EU gemeinsam mit Acemil kann CRRC ZELC auch größere Ausschreibungen annehmen, ohne Ziel der Foreign Subsidies Regulation zu werden, die Subventionen aus Drittstaaten innerhalb der EU überprüft. In Bulgarien hatte sich eine weitere CRRC-Tochter, CRRC Qingdao Sifang Locomotive, bereits aus einer Ausschreibung zurückgezogen, nachdem die EU-Kommission eine Untersuchung eingeleitet hatte. ari
Die chinesischen Behörden haben fünf aktuelle und ehemalige Mitarbeiter des britisch-schwedischen Pharmaunternehmens AstraZeneca festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, gegen Datenschutzbestimmungen verstoßen und ein nicht zugelassenes Krebsmedikament eingeführt zu haben.
In jüngster Zeit geht die chinesische Regierung verstärkt gegen Medikamentenschmuggel vor. “Wir sind uns bewusst, dass Ermittlungen gegen eine kleine Anzahl unserer Mitarbeiter laufen”, erklärte ein AstraZeneca-Sprecher gegenüber Nachrichtenagenturen, ohne weitere Details preiszugeben. Die Polizei in Shenzhen reagierte zunächst nicht auf Anfragen zu einer Stellungnahme. fin
China will künftig keine Adoptionen chinesischer Kinder über die Landesgrenze hinweg mehr gestatten. Das berichtete die Nachrichtenagentur AP. Einzige Ausnahme bleibe die Adoption durch nahe Verwandte, wie etwa bei der Adoption von Stiefkindern oder Blutsverwandten, erklärte eine Sprecherin des Außenministeriums. Die Entscheidung stehe im Einklang mit internationalen Abkommen. Nähere Gründe dafür nannte sie nicht. Es dürfte aber mit der sinkenden Geburtenrate Chinas und der daraus folgenden Überalterung zusammenhängen.
In den vergangenen Jahrzehnten haben viele internationale Familien Kinder aus China adoptiert und sie in ihre neuen Heimatländer gebracht. Während der Pandemie wurden internationale Adoptionen durch China dann jedoch ausgesetzt. Später durften zumindest Kinder noch ausreisen, die noch vor der Aussetzung im Jahr 2020 eine Reiseerlaubnis erhalten hatten. Zwischen Oktober 2022 und September 2023 erteilten US-Konsulate 16 Visa für Adoptionen aus China – die ersten nach einer zweijährigen Pause. Ob seitdem weitere Visa ausgestellt wurden, ist bislang nicht bekannt. fin
Eine führende Zeitschrift der Kommunistischen Partei Chinas veröffentlichte Anfang dieser Woche Xi Jinpings unverblümte Kommentare zu dem, was er als harten Wettbewerb zwischen der Partei und “verschiedenen Gegnern” um Chinas junge Generation sieht. Zum ersten Schultag am 1. September veröffentlichte die Zeitschrift Qiushi, deren Aufgabe es ist, die Regierungsphilosophie der Partei zu verbreiten, Xis Worte zur Bildung als Leitartikel.
Darin sagte er, die Widersacher hätten “nie aufgehört, die Regierung zu untergraben und zu sabotieren” und “eine Farbrevolution anzuzetteln”. Um dem entgegenzuwirken, sei es oberste Priorität der chinesischen Pädagogen, “Generation um Generation von jungen Menschen heranzuziehen, die die Führung der Partei und das sozialistische System unterstützen”.
Zudem erklärte er in den für ihn typischen betont umgangssprachlichen, aber grammatikalisch unsauberen Sätzen, dass das chinesische Bildungssystem “niemals Menschen mit chinesischem Gesicht, aber [sic] sind keine chinesischen Herzen, ohne Gefühle für China und ohne chinesischen Charakter hervorbringen sollte.” (长着中国脸,不是中国心,没有中国情,缺少中国味.)
Dass Qiushi dieser kämpferischen Äußerungen aufgriff, die Xi im Rahmen einer Konferenz im Jahr 2018 gemacht hatte, lässt darauf schließen, dass seine Position in diesem Punkt unverändert ist, wenn nicht sogar in den folgenden Jahren weiter gefestigt wurde, und er sich nicht scheut, sie erneut offen auszusprechen.
Es lohnt sich ein genauer Blick auf Xis Worte. Jedem, der sich mit der deutschen Geschichte auskennt, könnten sie bekannt vorkommen:
Die ideologische Erziehung in Chinas Schulen und Universitäten lässt sich grob in drei Teile unterteilen. Den ersten Teil bildet der Unterricht zur “Theorie des Marxismus” und die Theorie des “Sozialismus chinesischer Prägung”. Der zweite Teil ist der Geschichtsunterricht. Der dritte Teil setzt sich aus Elementen der ersten beiden Teile zusammen, die in andere Fächer wie etwa Chinesische und internationale Beziehungen einfließen.
Während der Theorieteil fast vollständig gescheitert ist, ist die Geschichtslehre mit ihrer Verherrlichung der Partei und dem Aufbau einer Opfermentalität insgesamt ein Riesenerfolg. Dies half der kommunistischen Partei bei der Legitimierung ihrer Herrschaft.
Der Theorieteil bestand zwischen den 1950er- und 1970er-Jahren aus destillierten Theorien des Marxismus und Leninismus, wie Marx’ Projektion der Entwicklung der menschlichen Gesellschaft von einer primitiven zu einer paradiesischen kommunistischen Gesellschaft; der ausbeuterische Charakter des Kapitalismus, der durch eine proletarische Revolution zum Untergang verurteilt ist; und die Notwendigkeit einer proletarischen Diktatur in der “sozialistischen Phase” der kommunistischen Länder.
Mit der Entwicklung des Weltgeschehens seit den 1980er-Jahren erwiesen sich diese Theorien als zunehmend überholt und wenig glaubwürdig. Ein Teil von ihnen wurde später durch neu erfundene “Theorien” ersetzt, wie etwa die Theorie über des Sozialismus chinesischer Prägung (in der Ära von Deng Xiaoping), die Ideen des Dreifachen Vertretens (Jiang Zemin) und Xi Jinpings Ideen des Sozialismus chinesischer Prägung im neuen Zeitalter.
Bei den Inhalten letzterem handelt es sich aber eher um Erklärungen für politische Maßnahmen als um echte systematische Theorien. In Lehrbüchern abgedruckt, werden sie zu einer Art Flickenteppich aus Kauderwelsch. Trotzdem gehören sie zur Pflichtlektüre an weiterführenden Schulen und Universitäten. Um zu bestehen, müssen Studenten und Schüler in Prüfungen lediglich wiederholen, was in den Lehrbüchern steht.
Wie in allen kommunistischen Ländern üblich, sind auch Chinas Geschichtslehrbücher voller Lügen. Bedauerlicherweise haben Generationen von Schülern und Studenten sie sehr gut verinnerlicht. Manche von ihnen fanden später die Wahrheit heraus, manche aber leben weiter mit einer stark verzerrten Sicht auf die Welt. Die Probleme der Geschichtslehrbücher sind vielfältig. Um einige der größten zu nennen:
Der Erfolg der Geschichtserziehung der Kommunistischen Partei resultiert in einer chronisch nationalistischen Stimmung und Fremdenfeindlichkeit. Durch das Internet kennen viele die Wahrheit und haben begonnen, das Narrativ der Partei zu hinterfragen und die Welt aus anderen Blickwinkeln zu betrachten. Aus diesem Grund wirkte Xi in seiner Rede zur Bildung so defensiv.
Katrina Northrop ist neue China-Korrespondentin der Washington Post. Sie wird von Taipeh aus arbeiten. Northrop schrieb zuvor für The Wire China.
Sally Jensen Cusicahua ist neue Südostasien-Korrespondentin für die Nachrichtenagentur AFP. Sie wird von Bangkok aus arbeiten. Jensen Cusicahua war zuvor für TaiwanPlus in Taipeh im Einsatz.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Ungewollt verwunschen: Diese Fachwerkhäuser in Zhenjiang in der Provinz Jiangsu sind märchenhaft überwuchert und wirken damit unfreiwillig abenteuerlich. Was wie ein perfekter Ausflugsort für Lost-Places-Fans aussieht und eine wahre Freude für Fotografen ist, sollte eigentlich ein Vergnügungspark werden. Als Konkurrenz zum Disneyland in Shanghai sollte der Park namens Evergrande Cultural Tourism City Millionen in die Kassen spülen. Doch bevor es dazu kam, ging dem ehemals zweitgrößten Immobilienkonzern Chinas allerdings das Geld aus. Seit 2021 liegt das Bauprojekt daher brach.
