häufig sprechen Bildungspolitiker, -forscher und -praktiker darüber, wie wichtig die Digitalisierung für das deutsche Bildungssystem ist. Doch wie die digitale Transformation voranschreitet und wie sie das Lehren, Lernen und das Schulsystem als Ganzes verändert oder verändern kann – dazu fehlt bisher der Überblick. Das Forum Bildung Digitalisierung (Forum BD) hat daher ein Forscherteam beauftragt, herausgekommen ist der Navigator BD. Vera Kraft analysiert ihn und hinterfragt, welchen Mehrwert die neu gewonnenen Erkenntnissen haben.
Dass bei der Digitalisierung der Schulen noch einiges zu tun ist, zeigt auch eine Allensbach-Studie, die Holger Schleper beleuchtet. Es zeigt sich darin eine große Unzufriedenheit mit dem deutschen Bildungssystem insgesamt, speziell bei Eltern. Die größte Diskrepanz zwischen Anspruch und Realität sehen die Befragten bei der digitalen Ausstattung der Schulen. Die Länder dürfte das in ihrer Forderung nach dem Digitalpakt II bestätigen. Beunruhigen sollte sie aber, dass nicht mal jeder Zehnte findet, dass die Politik Bildung den Stellenwert einräumt, den sie verdient.
Kritik an der Politik übt auch Dieter Dohmen, Direktor des Forschungsinstituts für Bildungs- und Sozialökonomie. In einem Standpunkt schreibt er, wieso die bisherigen politischen Maßnahmen kaum dazu beitragen, dass mehr junge Menschen eine Lehre beginnen. Schon in der Debatte über die Gründe für Krisensymptome am Ausbildungsmarkt sieht er Leerstellen – und präsentiert eigene Argumente. Da sich die Studien gerade ballen, erwartet Sie morgen Mittag übrigens ausnahmsweise schon das nächste Briefing, Sie dürfen gespannt sein!
Ich hoffe, unser Briefing ist heute für Sie hilfreich!

Zu wenig Tablets hier, zu viel Bildschirmzeit da – bei all den Diskussionen um einzelne Probleme und Fragen geht schnell mal der Blick fürs große Ganze verloren. Das befürchtet jedenfalls das Forum Bildung Digitalisierung (Forum BD). In dessen Auftrag hat daher ein Team renommierter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den Anlauf unternommen, den Stand der digitalen Transformation im Bereich schulischer Bildung systematisch zu erfassen.
Herausgekommen ist der Navigator Bildung Digitalisierung (Navigator BD): Ein 140-seitiges Dokument, das einen umfassenden Überblick über die aktuelle Studien- und Datenlage gibt (zum Download). Der Navigator wird am heutigen Mittwoch veröffentlicht und lag Table.Briefings bereits vorab vor. Er soll als Machbarkeitsstudie für ein Bildungsmonitoring dienen. “Dabei steht im Vordergrund, nicht nur das Was, sondern auch das Wie der digitalen Transformation zu erfassen“, sagt Ralph Müller-Eiselt, geschäftsführender Vorstand des Forum BD zu Table.Briefings.
Angesichts des drastischen Rückgangs von Basiskompetenzen bereits bei Grundschülern reiche es nicht, Probleme an der Oberfläche anzugehen, sagt Uta Hauck-Thum, Professorin für Grundschulpädagogik und -didaktik an der Ludwig-Maximilians-Universität München und Co-Autorin. “Was jetzt nötig ist, sind grundlegende Veränderungen im Bildungssystem.”
Genau dabei soll der Navigator unterstützen. Wie ein Kompass macht er zunächst eine “Standortbestimmung” möglich. Unter Leitung von Birgit Eickelmann, Professorin für Schulpädagogik an der Universität Paderborn, haben Hauck-Thum, Julia Gerick, Professorin für Empirische Bildungsforschung an der Universität Braunschweig und Kai Maaz, Professor für Soziologie mit dem Schwerpunkt Bildungssysteme und Gesellschaft an der Goethe-Universität Frankfurt am Main, vorliegende Studien und Daten aus dem Zeitraum Juli 2021 bis Januar 2024 gesichtet und sortiert und “blinde Flecken” herausgearbeitet.
Die Autoren orientieren sich dabei an drei strategischen Handlungsfeldern:
Diese sind wiederum in 21 Themenfelder wie Infrastruktur, Leadership oder Kreativität aufgeteilt und können als Indikatoren dienen.
Dabei zeigt sich: In den vergangenen Jahren hat viel digitale Entwicklung stattgefunden, es gab diverse Forschungs- und Förderprogramme. Die vorliegenden Studien beschreiben allerdings häufig lediglich den Ist-Zustand. Was die Erkenntnisse für die Schul- und Schulsystementwicklung oder die veränderten Lehr-Lern-Prozesse bedeuten, bleibt meist offen. Dabei bräuchte es genau dieses Steuerungswissen, um digitale Transformationsprozesse besser zu unterstützen, betonen die Autoren.
“Es gibt nicht nur ein Umsetzungsproblem, sondern auch ein erhebliches Erkenntnisproblem“, fasst Müller-Eiselt eine der zentralen Erkenntnisse der Studie zusammen. Wie groß die Wissenslücken sind, unterscheidet sich allerdings stark je nach Themenfeld. Während es beispielsweise viel Forschung zu technischer Ausstattung an Schulen oder Fortbildungen für Lehrkräfte und Schulleitungen gibt, fehlen empirische Erkenntnisse, wie sich Schulkultur mit Blick auf die digitale Transformation verändert beziehungsweise verändern sollte.
Darüber hinaus sind sich die Autoren einig: Um die digitale Transformation im schulischen Bildungsbereich wirksam zu gestalten, müssen sich alle relevanten Akteure auf ein gemeinsames Zielbild einigen. “Den digitalen Wandel einfach nur zu messen, greift am Ende zu kurz”, sagt Müller-Eiselt zu Table.Briefings. Der Navigator BD könne als Grundlage dienen, so eine gemeinsame Vision zu entwickeln. “Er ist ein Vorschlag und als erster Impuls für weitere Diskussionen über ein geteiltes Zielbild zu verstehen.”
Zwei weitere Schlüsse ziehen die Autoren aus ihrem gewonnenen Überblick über den Stand der Digitalisierung im Bildungsbereich:
Für ein solches Bildungsmonitoring müsste das vorhandene Wissen vertieft, sortiert und schließlich erweitert werden. “Die Dynamik der Entwicklungen erfordert es, dass wir nicht wie bisher auf Veränderungen immer nur reagieren”, sagt Studienleiterin Birgit Eickelmann zu Table.Briefings. “Wir müssen strukturell auf allen Ebenen agiler werden und dafür Raum und Möglichkeiten, also auch Kapazitäten, schaffen.”
Eine Konstante steht dabei über allen Transformationsprozessen: “Alle Entwicklungen sind an den Kindern und Jugendlichen und ihren Bedürfnissen sowie an der Zukunft und Stabilität unserer demokratischen Gesellschaft auszurichten”, sagt Eickelmann. Doch es gebe auch andere Orientierungspunkte, etwa, dass Schule ein moderner und attraktiver Arbeitsplatz für alle Lehrkräfte sein soll, an dem sich Innovationen entfalten können.
Eine Navigationshilfe bietet der Navigator BD allemal. Dennoch, das betonen die Autoren auch selbst, ist es nur ein Auftakt. Die Studie zeigt mögliche Perspektiven für die zukünftigen Entwicklungen der digitalen Transformation und wie sich vorhandene Monitoring-Ansätze weiterentwickeln lassen. Hier seien insbesondere schulische Akteure gefordert, sagt Eickelmann. “Bildungsadministration, Schulaufsichten und Schulträger müssen die Konzepte nun ausgestalten und auf die eigenen Arbeitsbereiche übertragen.”
Es wirkt wie ein stabiles Fundament für den Bildungsbereich: Für 84 Prozent der ostdeutschen und 76 Prozent der westdeutschen Bevölkerung ist ein “hervorragendes Bildungssystem” grundlegend für die Zukunft Deutschlands. Einmal zum Vergleich: Für die Stärkung der Bundeswehr liegen die Werte bei 43 Prozent (West) und 28 Prozent (Ost). Die Zahlen entstammen einer repräsentativen Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach aus diesem Juli, die heute Vormittag vorgestellt wird und Table.Briefings vorab vorlag. Auftraggeber der Studie “Der Wert von Bildung” ist die Deutsche Telekom Stiftung.
Je weiter man jedoch in die Zahlen eintaucht, desto deutlicher werden die Risse im Fundament. Lehrkräftemangel, zum Teil mangelnde Digitalisierung der Schulen, zu wenige einheitliche Bildungsstandards, ausbaufähige Berufsorientierung und – vor allem und immer wieder – fehlende Bildungsgerechtigkeit: Die Studie legt mit nüchternen Zahlen die alarmierenden Schwachstellen des Bildungssystems offen. Dass Eltern schulpflichtiger Kinder dabei noch wesentlich kritischer urteilen als die Gesamtbevölkerung, spricht Bände.
Verdichtet lässt sich das in einer Gegenüberstellung von “Ideal und Realität” ablesen, wie es in der Studie heißt. Demnach steht für 91 Prozent der Befragten fest, dass ein gutes Bildungssystem gleiche Bildungschancen für alle Kinder ermöglichen muss. Verwirklicht sehen das gerade einmal 25 Prozent. Es ist mit die größte Diskrepanz, die die Studie aufzeigt (66 Prozentpunkte).
Jacob Chammon, Geschäftsführer der Telekom-Stiftung, kann diesem Befund auch etwas Positives abgewinnen. “Er zeigt, dass die Gesamtbevölkerung erkennt, dass gute Bildung ausschlaggebend für die Zukunft von Kindern und Jugendlichen ist”, sagte er Table.Briefings. Auch vor diesem Hintergrund dürfte sehr viel Augenmerk darauf liegen, wie sich das Startchancen-Programm entwickelt.
Lesen Sie auch: Startchancen – Warum das 20-Milliarden-Euro-Programm viel kleiner ausfällt
Die größte Kluft gibt es laut Studie mit 68 Prozentpunkten im Bereich “gute technische bzw. digitale Ausstattung der Schulen und Universitäten”. 79 Prozent halten sie für unverzichtbar. Doch lediglich elf Prozent finden, dass es diese gute Ausstattung tatsächlich gibt. Was aus Sicht von Jacob Chammon einmal mehr die Notwendigkeit eines Digitalpaktes II zeigt, auf den sich Bund und Länder aktuell nicht einigen können. “Das Urteil ist eindeutig: Es gibt flächendeckend noch keine gute digitale Ausstattung an den Schulen. Es ist Zufall, ob ich an Schule A oder B bin und von einer guten Ausstattung profitieren kann. Das darf nicht sein und damit verbunden ist der klare Auftrag, sich zu einigen.”
Bei der “Ausstattung der Schulen und Universitäten mit Lehr- und Lernmitteln” liegen 65 Prozentpunkte zwischen Ideal (80 Prozent) und Realität (15 Prozent). Exakt diese Lücke tut sich auch auf bei dem Anspruch, “im gesamten Bundesgebiet einheitliche Standards, zum Beispiel bei Abschlussprüfungen” zu haben. Bemerkenswert: Mit fünf Prozent findet sich hier der niedrigste Wert in der “Realitäts-Rangliste”.
Fast drei Viertel der deutschen Bevölkerung – 73 Prozent – sind zudem der Meinung, dass die Schulen besser auf das Berufsleben vorbereiten müssen. Hier fördert der Blick ins Allensbacher Archiv zutage, dass dieser Wert 2012 noch bei 26 Prozent lag – und damit 47 Prozentpunkte niedriger. “Es ist sehr wichtig, dort genau hinzuschauen”, fordert Chammon. Die Verbindung zwischen der Schulzeit und dem Leben nach der Schule sei für viele Eltern von sehr großer Bedeutung. Auch, weil die Zukunft immer ungewisser werde.
Lesen Sie auch: Berlin und MV: Neue Pläne sollen Berufsorientierung stärken
“Schulen müssen sich hier öffnen, um Kindern Zukunftskompetenzen beizubringen.” Verbunden damit sei die Frage, ob die Formate für Berufsorientierung wie zweiwöchige Berufspraktika eigentlich noch die richtigen sind. “Oder müssen wir das viel stärker in den schulischen Alltag integrieren und auch Vorbilder für die Kinder und Jugendlichen schaffen?”, fragt Chammon. “Gerade in der MINT-Bildung ist das von großer Bedeutung.”
Gefragt danach, was an den Schulen in den nächsten fünf bis zehn Jahren vordringlich verbessert werden muss, steht für 84 Prozent der Bevölkerung der Lehrkräftemangel an erster Stelle. Bei den Eltern von Schulkindern liegt der Wert sogar bei 90 Prozent. Knapp drei Viertel (71 Prozent) begrüßen es zudem, wenn Deutschland regelmäßig an internationalen Vergleichsstudien wie PISA teilnimmt. In der Gesamtbevölkerung sind es 67 Prozent. Dass die Studien sich allerdings positiv auf den Unterricht auswirken, bezweifeln insgesamt knapp 60 Prozent der Befragten.
Zweifel und Ernüchterung sind ein hartnäckiger Begleiter des Bildungssystems. Das spiegelt sich auch darin wider, dass lediglich acht Prozent der Befragten angeben, dass Bildung den politischen Stellenwert hat, den sie verdient. Das ist historisch niedrig. Denn das Allensbacher Archiv zeigt, dass der Wert zwar schon seit vielen Jahren gering ist, 2008 aber bei zwölf Prozent lag und 2017 bei 13 Prozent.
Chammon wird hier sehr grundsätzlich: “Wir haben in Deutschland ein sehr verschachteltes Bildungssystem, in dem es sehr schwer ist, Veränderungen hinzubekommen.” Als Stichworte nennt er Föderalismus, innere und äußere Schulangelegenheiten, die riesige Anzahl an Schulträgern und schließlich den Ganztag, der eine weitere Trägerstruktur ins System bringe. “Für Politikerinnen und Politiker macht es das schwer, Dinge durchzusetzen.” An diese großen Reformthemen wirklich heranzugehen, scheue die Politik sich aber.
Lesen Sie auch: Mehr als nur “Hausmeister” – die Rolle der Kommunen
Zugleich zeigt die Studie auch, dass durchaus Bewegung ins Bildungssystem kommen kann. Denn für die Zukunft des Landes am wichtigsten – noch vor dem “hervorragenden Bildungssystem” – halten die Befragten, “dass wir genug qualifizierte Fachkräfte ausbilden” (79 Prozent). 39 Prozent sehen demgegenüber die Notwendigkeit, qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland zu gewinnen.
2017 lag dieser Wert noch bei 25 Prozent. Die anhaltende öffentliche Debatte über dieses Thema zeige hier Wirkung, heißt es in der Studie. “Der Bevölkerung wird zunehmend bewusst, dass der Fachkräftemangel in Zeiten geburtenschwacher Jahrgänge und dem gleichzeitigen altersbedingten Ausscheiden der geburtenstarken Babyboomer-Jahrgänge aus dem Berufsleben nicht allein mit der Ausbildung qualifizierter Fachkräfte aus dem eigenen Land aufgefangen werden kann.”

The same procedure as every year! – wie bei “Dinner for one” verhält es sich seit einigen Jahren immer im August, wenn das neue Ausbildungsjahr beginnt, viele Ausbildungsplätze unbesetzt bleiben und viele junge Menschen keinen Ausbildungsplatz gefunden haben. Zur Frage, warum das so ist, kommen aus Politik, Forschung und Verbänden die immer gleichen Begründungen: Zu viele Abiturienten würden studieren, statt eine Ausbildung zu beginnen. Die Schulabgänger und -abgängerinnen könnten zu wenig und wären nicht ausbildungsfähig. Aufgrund der Demografie gäbe es nicht genug Schulabgänger und das letzte Buzzword lautet “Mismatch”.
Diese Argumente sind jedoch wenig hilfreich. Denn sie sind entweder schlicht falsch oder sie greifen zu kurz. Der Mismatch etwa spielt zwar eine gewisse Rolle, wenn etwa Jugendliche nicht dort wohnen, wo es Ausbildungsplätze gibt, in seiner Bedeutung wird er jedoch deutlich überschätzt. Was sonst tatsächlich zutrifft:
Der Anteil an Abiturienten, die eine Ausbildung aufnehmen, ist seit Anfang der 2000er-Jahre deutlich gestiegen. Mittlerweile beginnt fast die Hälfte eines Abiturientenjahrgangs eine berufliche Ausbildung, jeder dritte eine duale Ausbildung. Die Zahl der Jugendlichen mit Hauptschulabschluss im dualen System war 2021 hingegen um 35.000 niedriger als es dem Rückgang an Hauptschulabsolventen seit 2011 entsprochen hätte. 25.000 Jugendliche mit Realschulabschluss wanderten von der dualen in die schulische Ausbildung, etwas schwächer zeigt sich diese Entwicklung bei anderen Schulabgängern.
Fazit: Der letztlich seit 2007 zu beobachtende starke Rückgang an Azubis im dualen System liegt vor allem daran, dass immer mehr Haupt- und Realschulabsolventen keinen Ausbildungsplatz suchen, finden oder bekommen. Dass sich mehr Abiturienten für eine duale Ausbildung entscheiden, verhinderte einen noch dramatischeren Azubi-Rückgang. Wenn man jetzt jedoch einseitig darauf setzt, noch mehr Abiturienten für die duale Ausbildung zu gewinnen, führt dies unweigerlich dazu, dass der Fachkräftemangel bei Akademikern noch größer wird als er sowieso schon ist. Dabei liegen die größten Potenziale woanders.
Dass auch die Demografie für den Rückgang der Ausbildungsverträge nicht maßgeblich ist, zeigt sich nicht nur daran, dass aktuell mehr als 2,9 Millionen der 20- bis 34-Jährigen ungelernt und weder in Schule noch in Ausbildung sind, sondern noch stärker an den folgenden Zahlen. Der Anstieg (der Ungelernten) geht vor allem auf zwei Entwicklungen zurück:
Es gibt in Deutschland somit ein riesiges Potenzial an jungen Menschen, die für eine qualifizierende Ausbildung gewonnen werden könnten. Diese Gruppe wird zwar in Sonntagsreden erwähnt, spielt aber in der alltäglichen Politik kaum eine Rolle. Stattdessen versuchen Politik und nachgeordnete Behörden wie die Bundesagentur für Arbeit mit großem Aufwand, junge Menschen aus dem Ausland für eine Ausbildung nach Deutschland zu holen. Mit mäßigem Erfolg.
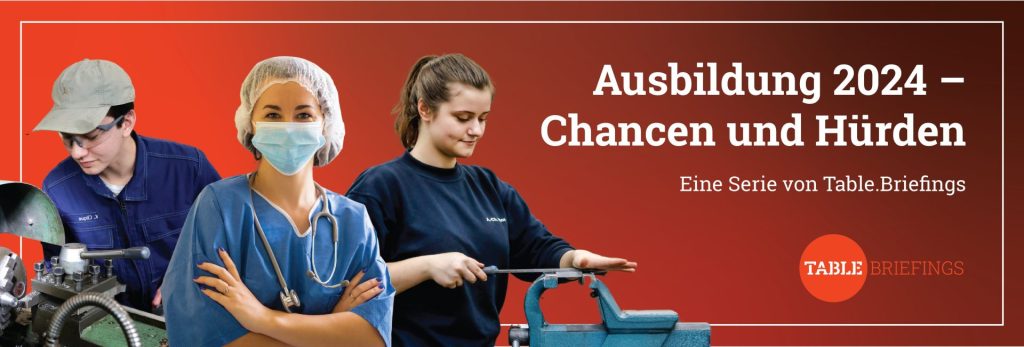
Der geringe Erfolg von Maßnahmen – wie die Stärkung der Berufsorientierung in der Schule, insbesondere am Gymnasium, Berufswahlapps, kleinere Reformen innerhalb der Ausbildung, (noch) mehr Zuständigkeit für die Jugendberufsagenturen und diverse Projektförderrichtlinien – zeigt sich schon daran, dass die Situation sich nur für Abiturienten verbessert hat. Auch die Ausbildungsgarantie wird wenig Wirkung zeigen. Nicht nur, weil sie zu klein angelegt und auf bestimmte Regionen beschränkt ist, sondern weil es kein wirklich auf die Ausbildung von herausfordernden Zielgruppen ausgerichtetes Konzept gibt.
Es braucht eine sorgfältige Analyse, warum viele Jugendliche nicht in Ausbildung finden. Das Gros hat einen niedrigen bis mittleren Schulabschluss, kommt aus benachteiligten Familien, die Mehrheit hat eine Zuwanderungsgeschichte. Folgende Gründe sind in meinen Augen ausschlaggebend:
Gerade kleine und kleinste Unternehmen ziehen sich aus dem Ausbildungsgeschehen. Wer mehrfach keinen Erfolg hatte, einen Ausbildungsplatz zu besetzen – und im Übrigen kaum die Ressourcen hat, um die Kompetenzdefizite leistungsschwächerer Jugendlicher im Ausbildungsalltag aufzufangen – zieht die naheliegenden Konsequenzen und gibt verständlicherweise auf.
Besser wäre es, wenn diese Betriebe ihre Strategie hinterfragen würden, wozu sie gezielte und kompetente Unterstützung benötigen: Wie und wo positioniere ich mich im harten Wettbewerb um Azubis? Welche Kompetenzen brauchen Jugendliche für eine Ausbildung bei uns? Welche Möglichkeiten der flexiblen, bedarfsorientierten “Nachhilfe” gibt es? Kleine und kleinste Unternehmen haben nur wenig Zeit und finanzielle Ressourcen, daher braucht es ein kompetentes und kostengünstiges Angebot mit pro-aktiver Ansprache.
Es steht viel auf dem Spiel: Wenn es uns nicht gelingt, das Ruder zeitnah herumzureißen, wird die duale Ausbildung zum Auslaufmodell – und noch mehr junge Menschen werden keine Ausbildung beginnen und erfolgreich abschließen (können).
Um das Startchancen-Programm administrativ zu begleiten, entstehen in den Bundesländern zahlreiche neue Stellen. Das ergab eine Umfrage von Table.Briefings in den Schulministerien. Vor allem in der Antwort aus Bayern, das von Beginn an mit der Umsetzung des Programms haderte, scheint Kritik durch. Kultusministerin Anna Stolz hatte den Bürokratieaufwand wiederholt beklagt.
Lesen Sie auch: Kultusministerin Stolz – Startchancen-Programm bringt unnötigen bürokratischen Aufwand
Bereits für die Vorbereitung des Startchancen-Programms sei ein deutlicher Zusatzaufwand entstanden, heißt es aus dem bayerischen Kultusministerium. Im Ministerium und nachgeordneten Behörden würden “im Laufe des Schuljahres 2024/2025 4,5 Stellen für Beamte bzw. Arbeitnehmer für die Aufgabe ,Startchancen-Programm’ umpriorisiert”. Das Ministerium betont zudem, dass “in allen beteiligten Behörden sowie den betroffenen Schulaufsichten weitere Personen in nicht unerheblichem Maße parallel zu ihren sonstigen Dienstgeschäften” in das Programm eingebunden seien. Und stellt in Aussicht, dass noch weitere “Stellen umpriorisiert oder neu geschaffen werden”.
In vielen anderen Ländern ist das Bild ähnlich: “Rheinland-Pfalz schafft im Doppelhaushalt 2025/2026 insgesamt 15 neue Stellen für das Startchancen-Programm”, heißt es aus dem Schulministerium. Hinzu kämen fünf weitere Stellen, die durch Neuverteilung von Zuständigkeiten ebenfalls zum Startchancen-Programm zu rechnen sind. Aus Niedersachsen ist zu hören, dass rund zehn zusätzliche Stellen in der Kultusverwaltung entstehen sollen.
Sachsen schreibt von “zusätzlichen acht Stellen, die für die Einstellung von Fachkräften für die multiprofessionellen Teams, Unterstützungsstrukturen für die Verwendung der Chancenbudgets sowie die konzeptionelle Begleitung vorgesehen sind”. Die Bund-Ländervereinbarung sähe dafür vier Prozent der Mittel für die Säulen 2 (Schulbudget) und 3 (Multiprofessionelle Teams) des Programms vor.
In Thüringen, wo an diesem Sonntag die Landtagswahlen anstehen, ist geplant, die Stabstelle Startchancen-Programm im Bildungsministerium “auf bis zu sieben Personen aufwachsen zu lassen”. Das allerdings steht noch unter Haushaltsvorbehalt. Mecklenburg-Vorpommern beabsichtigt derweil, “zur administrativen Abwicklung des Programms zwei drittmittelfinanzierte Stellen einzurichten”.
Schleswig-Holstein, Bremen und Baden-Württemberg betonen, bereits vorhandenes Personal und etablierte Strukturen zur Umsetzung des Startchancen-Programms zu nutzen. In Schleswig-Holstein werden sie um sechs zusätzliche Stellen ergänzt, in Bremen um eine. Baden-Württemberg nennt noch keine Zahlen, plant aber “den Ausbau der personellen Kapazitäten”.
Aus den übrigen Ländern lagen Table.Briefings, teils wegen laufender Etat-Verhandlungen oder noch zu klärender Strukturen, keine Zahlen vor. Allein aus Brandenburg hieß es, dass keine zusätzlichen Stellen entstehen würden. Holger Schleper
Unter SPD-geführten Landesregierungen erhielten Schülerinnen und Schüler seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland durchschnittlich deutlich mehr politische Bildung als unter Unions-Regierungen. Das ist das Ergebnis einer Studie des Leibniz-Institus für Bildungsverläufe (LIfBi), die am Mittwoch veröffentlicht wird und Table.Briefings vorab vorliegt. Darin untersuchten die Forscherinnen und Forscher den Stellenwert von Politikunterricht in Deutschlands Schulen für den Zeitraum von 1949 bis 2019. Für die ostdeutschen Bundesländer sind Daten ab der Wiedervereinigung enthalten.
Insbesondere für die 1970er- bis 1990er-Jahre zeige sich dabei ein klarer politischer Einfluss der Landesregierungen, erklärt Schulforscher Norbert Sendzik, der die Studie gemeinsam mit Marcel Helbig und Ulrike Mehnert durchgeführt hat. “War die SPD an einer Regierung beteiligt, wurde mehr politische Bildung unterrichtet. Regierte die CDU, war weniger politische Bildung vorgesehen”, fasst Mehnert zusammen. So wurde beispielsweise um die Jahrtausendwende das Fach Politik in Nordrhein-Westfalen mit sieben Wochenstunden gelehrt, während es in Bayern und Sachsen nur zwei Wochenstunden waren. Besonders deutlich erkennbar ist die Entwicklung für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die nach der Wiedervereinigung christdemokratisch geprägt waren.
Zugleich betont Sendzik, dass die politische Bildung seit den 2000er-Jahren weniger von der Zusammensetzung der Landesregierung geprägt sei. Dennoch gibt es auch hier bundeslandspezifische Entwicklungen: So wurde in Hessen die Unterrichtszeit seit den 1990er-Jahren bis in die 2010er-Jahre von sieben auf drei Wochenstunden mehr als halbiert, während sie in Schleswig-Holstein im selben Zeitraum von im Schnitt rund einer auf fast fünf Wochenstunden anstieg.
Außerdem vergleicht die Studie die Ausprägung des Politikunterrichts an verschiedenen Schulformen. Diese Untersuchung ergab einen für die Forscher überraschenden Befund: In der Geschichte der Bundesrepublik war an nicht-gymnasialen Schulformen insgesamt mehr Politikunterricht vorgesehen als an Gymnasien. Dieses Ergebnis sei den Forschern zufolge deshalb bemerkenswert, da andere Forschung für die Gegenwart darauf hinweist, dass Gymnasiasten mehr politische Bildung erhalten als Schülerinnen und Schüler anderer Schulformen. max
Hamburg schafft die Abschlussprüfungen für Gymnasiasten in der zehnten Klasse ab dem kommenden Schuljahr ab. “Wir haben in den letzten Jahren ein so enges Netz an Schülerleistungsstudien (KERMIT) über die einzelnen Klassenstufen hinweg geschaffen, dass die individuelle Entwicklung jedes Jugendlichen auch ohne zusätzliche Überprüfungen gut beurteilt werden kann“, erklärte Schulsenatorin Ksenija Bekeris. Bislang müssen die Schülerinnen und Schüler zu Beginn des zweiten Halbjahres der zehnten Klasse in den Fächern Deutsch, Mathematik und einer fortgeführten Fremdsprache eine zentral gestellte Klassenarbeit schreiben und in mindestens zwei dieser Fächer eine mündliche Prüfung ablegen.
Außerdem kündigte Bekeris an, dauerhaft mehr Beratungslehrkräfte in Gymnasien einsetzen zu wollen. Damit setzt sie eine im Nachgang der Corona-Pandemie gestartete und zunächst auf zwei Jahre befristete Initiative fort. Die SPD-Politikerin betonte, dass durch diese Maßnahmen nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern auch Lehrkräfte entlastet würden. Im nächsten Schritt soll nun über Entlastungen für Stadtteilschulen nachgedacht werden.
Mit der Abschaffung der Abschlussprüfungen für Gymnasiasten am Ende der zehnten Klasse folgt Bekeris dem Beispiel Berlins, wo Schulsenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) diesen Schritt bereits zu Beginn des Schuljahres 2023/24 vollzog. Im bundesweiten Vergleich ist es bereits die Regel, dass Schülerinnen und Schüler an Gymnasien mit der Versetzung in die gymnasiale Oberstufe automatisch einen dem Mittleren Schulabschluss (MSA) gleichwertigen Abschluss erhalten. Gesonderte Prüfungen gibt es derzeit lediglich in Brandenburg, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Thüringen. Maximilian Stascheit
Lesen Sie auch: Schulsenatorin Bekeris im Interview: Kita und Schule müssen mehr Daten austauschen
Research.Table: Was die DFG-Präsidentin zur Forschungssicherheit in Deutschland sagt. Um die Balance zwischen Forschungssicherheit und Wissenschaftsfreiheit ging es bei einem transatlantischen Austausch in Washington. Im Interview mit Table.Briefings erläutert DFG-Präsidentin Katja Becker, inwieweit das neue Secure Center der USA ein Vorbild für Deutschland sein kann. Das ganze Gespräch lesen Sie hier.
Research.Table: Industrielle Forschungsgemeinschaften gegen Bevorzugung der HAWs bei der Dati. In einem gemeinsamen Positionspapier reagieren die außeruniversitären Forschungsgemeinschaften auf die Empfehlungen der Dati-Gründungskommission. Unter anderem kritisieren sie, dass mindestens 25 Prozent der Mitglieder des Förderrats aus den Reihen von HAWs berufen werden sollen. Was sie daran stört, lesen Sie hier.
Capital: Dänemark rudert bei der Digitalisierung von Schulen zurück. Dänemark ist ein Vorreiter in der Digitalisierung, doch das Land will die Schüler jetzt wieder analoger lernen lassen. Die PISA-Ergebnisse des Landes haben sich verschlechtert und Studien stellen fest, dass zu viel Bildschirmzeit zu Konzentrationsschwierigkeiten führt. Die digitalen Geräte sollen in der Schule nur noch genutzt werden, wenn es tatsächlich erforderlich ist. Auch vollständig handyfreie Schulen sollen nun eine Option sein. (Warum Dänemark die Digitalisierung in Schulen zurückdreht)
WAZ: Langsamer Start des Startchancen-Programms in Duisburg. Für das Startchancen-Programm in Duisburg liegen noch keine Förderrichtlinien vor. Diese legen fest, wie viele Mittel die Schulen bekommen und wie hoch der Eigenanteil der Träger sein wird. Durch die Mittel des Startchancen-Programms ist es den Schulen nun auch möglich, eine weitere Stelle auszuschreiben. Zur derzeitigen Personalausstattung der Duisburger Schulen liegen keine Zahlen vor. (Neues “Startchancen”-Programm verstolpert Start an Schulen)
Merkur: Bundesagentur für Arbeit sieht gute Chancen auf Ausbildungsplatz für Hauptschüler. Insbesondere in Bereichen mit vielen unbesetzten Stellen – wie in der Gastronomie oder dem Handwerk (speziell dem Metallbau) – seien auch Jugendliche mit Hauptschulabschluss gesucht. Jedoch sind durch spezifische Anforderungen der Betriebe nur 60 Prozent der Ausbildungsplätze durch Hauptschüler besetzbar. (Bundesagentur: Noch Chancen für Hauptschüler auf Lehrstelle)
Le Figaro: Falsche Versprechungen für französischen Sportunterricht. Die Generalsekretärin Coralie Benech von der Nationalen Gewerkschaft für Sportunterricht in Frankreich beklagt mangelnde Investitionen im Sport. Präsident Macron habe Investitionen in den Schulsport versprochen, doch stattdessen fielen in diesem Bereich tausende Stellen weg. Zudem verfügten Sportvereine wie Schulen nicht über ausreichend Ausstattung. (Sport scolaire : «C’est difficile de croire à un héritage après les JO de Paris 2024»)
Dlf: Antidemokratische Tendenzen stellen Lehrkräfte vor Herausforderungen. Bei rechtsextremen Aussagen von Schülern sind die Grenzen zwischen bewusster Provokation, verfestigter Meinung und schlichter Unwissenheit jedoch meist unklar. Ursachen können zudem eigene negative Erfahrungen oder auch das Elternhaus sein. Die Schulleitung kann hier nur bei eindeutigen Straftaten eingreifen. Die Lehrkräfte fühlen sich selbst meist nur unzureichend vorbereitet, um angemessen zu reagieren. (Der Umgang mit Rechtsextremismus in der Schule)
NDR: Umfrage zeigt Gewalt an Schulen. Der Philologenverband Niedersachsen (PHVN) hat Gymnasial- und Gesamtschullehrkräfte zu Gewalt an Schulen befragt und alarmierende Ergebnisse präsentiert. Laut PHVN haben 70 Prozent der Lehrkräfte Erfahrungen mit verbaler Gewalt wie Bedrohungen, Mobbing oder Beschimpfung, 21 Prozent erlebten physische Gewalt (körperliche Übergriffe, Nötigung et cetera). 950 aktive Lehrkräfte hatten im Juni und Juli an der Umfrage teilgenommen. Der Verband fordert das Kultusministerium auf, zu handeln und “konkrete Regelungen zu schaffen, die allen an Schule Beteiligten Sicherheit geben”. (Gewalt an Schulen: Verband fordert Schutz für Lehrkräfte)
30. August 2024, 14 Uhr, online
Webinar Pack your bags, it’s back to school! What’s on the horizon for a new school year?
Vor welchen Herausforderungen steht die Schule? In dieser jährlichen Diskussionsveranstaltung von der OECD geht es um einen Blick in die Zukunft. Zudem wird es einen Ausblick auf die geplanten Veranstaltungen vom Education Directorate geben. INFOS & ANMELDUNG
05. September 2024, 10 bis 20 Uhr, Berlin
Networking Festival der Berliner Wirtschaft – Bildung X Business
Die IHK bietet Berliner Unternehmen die Chance, sich zu vernetzen und über praxiserprobte Bildungsinnovationen auszutauschen. Zu Gast sind unter anderem Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch, Migrations- und Bildungssoziologe Aladin El-Mafaalani und die Botschafterin Marika Linntam vom Pisa-Spitzenreiter Estland. INFOS & ANMELDUNG
05. September 2024, 11 – 12.30 Uhr, online
Präsentation Vorstellung des Navigator Bildung Digitalisierung
Wie weit ist die Digitalisierung an Deutschlands Schulen fortgeschritten? Die Co-Autorinnen Birgit Eickelmann und Uta Hauck-Thum präsentieren die Ergebnisse des Navigator Bildung Digitalisierung. Anschließend diskutieren sie u.a. mit einem Schüler und einem Schulleiter, wie eine Gesamtstrategie
für die digitale Transformation im schulischen Bildungsbereich umgesetzt werden kann. INOFS& ANMELDUNG
10. bis 11. September 2024, Berlin
Workshop Bundeskonferenz Bildungsmanagement 2024
Wie gelingt die vollständige Ganztagsbetreuung ab dem Jahr 2026? Wie können Kommunen Fachkräfte für sich gewinnen und digitale Innovationen in der Bildung nutzen? Das BMBF lädt zu Workshops und Diskussionen zu Themen der kommunalen Bildungslandschaft ein. INOFS& ANMELDUNG
18. bis 20. September 2024
Konferenz Digital, analogue, and hybrid learning spaces: Rethinking dialogue, inquiry, and argumentation?!
In dieser Konferenz der European Association for Research on Learning and Instruction können Forscher und Interessierte in den Austausch über das Feld der Bildungsforschung treten. Das Thema dieser Konferenz ist die Veränderung vom gemeinsamen Austausch durch digitale und analoge Räume. Eine Anmeldung zur Teilnahme ist bis 06.09. möglich. INFOS & ANMELDUNG
häufig sprechen Bildungspolitiker, -forscher und -praktiker darüber, wie wichtig die Digitalisierung für das deutsche Bildungssystem ist. Doch wie die digitale Transformation voranschreitet und wie sie das Lehren, Lernen und das Schulsystem als Ganzes verändert oder verändern kann – dazu fehlt bisher der Überblick. Das Forum Bildung Digitalisierung (Forum BD) hat daher ein Forscherteam beauftragt, herausgekommen ist der Navigator BD. Vera Kraft analysiert ihn und hinterfragt, welchen Mehrwert die neu gewonnenen Erkenntnissen haben.
Dass bei der Digitalisierung der Schulen noch einiges zu tun ist, zeigt auch eine Allensbach-Studie, die Holger Schleper beleuchtet. Es zeigt sich darin eine große Unzufriedenheit mit dem deutschen Bildungssystem insgesamt, speziell bei Eltern. Die größte Diskrepanz zwischen Anspruch und Realität sehen die Befragten bei der digitalen Ausstattung der Schulen. Die Länder dürfte das in ihrer Forderung nach dem Digitalpakt II bestätigen. Beunruhigen sollte sie aber, dass nicht mal jeder Zehnte findet, dass die Politik Bildung den Stellenwert einräumt, den sie verdient.
Kritik an der Politik übt auch Dieter Dohmen, Direktor des Forschungsinstituts für Bildungs- und Sozialökonomie. In einem Standpunkt schreibt er, wieso die bisherigen politischen Maßnahmen kaum dazu beitragen, dass mehr junge Menschen eine Lehre beginnen. Schon in der Debatte über die Gründe für Krisensymptome am Ausbildungsmarkt sieht er Leerstellen – und präsentiert eigene Argumente. Da sich die Studien gerade ballen, erwartet Sie morgen Mittag übrigens ausnahmsweise schon das nächste Briefing, Sie dürfen gespannt sein!
Ich hoffe, unser Briefing ist heute für Sie hilfreich!

Zu wenig Tablets hier, zu viel Bildschirmzeit da – bei all den Diskussionen um einzelne Probleme und Fragen geht schnell mal der Blick fürs große Ganze verloren. Das befürchtet jedenfalls das Forum Bildung Digitalisierung (Forum BD). In dessen Auftrag hat daher ein Team renommierter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den Anlauf unternommen, den Stand der digitalen Transformation im Bereich schulischer Bildung systematisch zu erfassen.
Herausgekommen ist der Navigator Bildung Digitalisierung (Navigator BD): Ein 140-seitiges Dokument, das einen umfassenden Überblick über die aktuelle Studien- und Datenlage gibt (zum Download). Der Navigator wird am heutigen Mittwoch veröffentlicht und lag Table.Briefings bereits vorab vor. Er soll als Machbarkeitsstudie für ein Bildungsmonitoring dienen. “Dabei steht im Vordergrund, nicht nur das Was, sondern auch das Wie der digitalen Transformation zu erfassen“, sagt Ralph Müller-Eiselt, geschäftsführender Vorstand des Forum BD zu Table.Briefings.
Angesichts des drastischen Rückgangs von Basiskompetenzen bereits bei Grundschülern reiche es nicht, Probleme an der Oberfläche anzugehen, sagt Uta Hauck-Thum, Professorin für Grundschulpädagogik und -didaktik an der Ludwig-Maximilians-Universität München und Co-Autorin. “Was jetzt nötig ist, sind grundlegende Veränderungen im Bildungssystem.”
Genau dabei soll der Navigator unterstützen. Wie ein Kompass macht er zunächst eine “Standortbestimmung” möglich. Unter Leitung von Birgit Eickelmann, Professorin für Schulpädagogik an der Universität Paderborn, haben Hauck-Thum, Julia Gerick, Professorin für Empirische Bildungsforschung an der Universität Braunschweig und Kai Maaz, Professor für Soziologie mit dem Schwerpunkt Bildungssysteme und Gesellschaft an der Goethe-Universität Frankfurt am Main, vorliegende Studien und Daten aus dem Zeitraum Juli 2021 bis Januar 2024 gesichtet und sortiert und “blinde Flecken” herausgearbeitet.
Die Autoren orientieren sich dabei an drei strategischen Handlungsfeldern:
Diese sind wiederum in 21 Themenfelder wie Infrastruktur, Leadership oder Kreativität aufgeteilt und können als Indikatoren dienen.
Dabei zeigt sich: In den vergangenen Jahren hat viel digitale Entwicklung stattgefunden, es gab diverse Forschungs- und Förderprogramme. Die vorliegenden Studien beschreiben allerdings häufig lediglich den Ist-Zustand. Was die Erkenntnisse für die Schul- und Schulsystementwicklung oder die veränderten Lehr-Lern-Prozesse bedeuten, bleibt meist offen. Dabei bräuchte es genau dieses Steuerungswissen, um digitale Transformationsprozesse besser zu unterstützen, betonen die Autoren.
“Es gibt nicht nur ein Umsetzungsproblem, sondern auch ein erhebliches Erkenntnisproblem“, fasst Müller-Eiselt eine der zentralen Erkenntnisse der Studie zusammen. Wie groß die Wissenslücken sind, unterscheidet sich allerdings stark je nach Themenfeld. Während es beispielsweise viel Forschung zu technischer Ausstattung an Schulen oder Fortbildungen für Lehrkräfte und Schulleitungen gibt, fehlen empirische Erkenntnisse, wie sich Schulkultur mit Blick auf die digitale Transformation verändert beziehungsweise verändern sollte.
Darüber hinaus sind sich die Autoren einig: Um die digitale Transformation im schulischen Bildungsbereich wirksam zu gestalten, müssen sich alle relevanten Akteure auf ein gemeinsames Zielbild einigen. “Den digitalen Wandel einfach nur zu messen, greift am Ende zu kurz”, sagt Müller-Eiselt zu Table.Briefings. Der Navigator BD könne als Grundlage dienen, so eine gemeinsame Vision zu entwickeln. “Er ist ein Vorschlag und als erster Impuls für weitere Diskussionen über ein geteiltes Zielbild zu verstehen.”
Zwei weitere Schlüsse ziehen die Autoren aus ihrem gewonnenen Überblick über den Stand der Digitalisierung im Bildungsbereich:
Für ein solches Bildungsmonitoring müsste das vorhandene Wissen vertieft, sortiert und schließlich erweitert werden. “Die Dynamik der Entwicklungen erfordert es, dass wir nicht wie bisher auf Veränderungen immer nur reagieren”, sagt Studienleiterin Birgit Eickelmann zu Table.Briefings. “Wir müssen strukturell auf allen Ebenen agiler werden und dafür Raum und Möglichkeiten, also auch Kapazitäten, schaffen.”
Eine Konstante steht dabei über allen Transformationsprozessen: “Alle Entwicklungen sind an den Kindern und Jugendlichen und ihren Bedürfnissen sowie an der Zukunft und Stabilität unserer demokratischen Gesellschaft auszurichten”, sagt Eickelmann. Doch es gebe auch andere Orientierungspunkte, etwa, dass Schule ein moderner und attraktiver Arbeitsplatz für alle Lehrkräfte sein soll, an dem sich Innovationen entfalten können.
Eine Navigationshilfe bietet der Navigator BD allemal. Dennoch, das betonen die Autoren auch selbst, ist es nur ein Auftakt. Die Studie zeigt mögliche Perspektiven für die zukünftigen Entwicklungen der digitalen Transformation und wie sich vorhandene Monitoring-Ansätze weiterentwickeln lassen. Hier seien insbesondere schulische Akteure gefordert, sagt Eickelmann. “Bildungsadministration, Schulaufsichten und Schulträger müssen die Konzepte nun ausgestalten und auf die eigenen Arbeitsbereiche übertragen.”
Es wirkt wie ein stabiles Fundament für den Bildungsbereich: Für 84 Prozent der ostdeutschen und 76 Prozent der westdeutschen Bevölkerung ist ein “hervorragendes Bildungssystem” grundlegend für die Zukunft Deutschlands. Einmal zum Vergleich: Für die Stärkung der Bundeswehr liegen die Werte bei 43 Prozent (West) und 28 Prozent (Ost). Die Zahlen entstammen einer repräsentativen Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach aus diesem Juli, die heute Vormittag vorgestellt wird und Table.Briefings vorab vorlag. Auftraggeber der Studie “Der Wert von Bildung” ist die Deutsche Telekom Stiftung.
Je weiter man jedoch in die Zahlen eintaucht, desto deutlicher werden die Risse im Fundament. Lehrkräftemangel, zum Teil mangelnde Digitalisierung der Schulen, zu wenige einheitliche Bildungsstandards, ausbaufähige Berufsorientierung und – vor allem und immer wieder – fehlende Bildungsgerechtigkeit: Die Studie legt mit nüchternen Zahlen die alarmierenden Schwachstellen des Bildungssystems offen. Dass Eltern schulpflichtiger Kinder dabei noch wesentlich kritischer urteilen als die Gesamtbevölkerung, spricht Bände.
Verdichtet lässt sich das in einer Gegenüberstellung von “Ideal und Realität” ablesen, wie es in der Studie heißt. Demnach steht für 91 Prozent der Befragten fest, dass ein gutes Bildungssystem gleiche Bildungschancen für alle Kinder ermöglichen muss. Verwirklicht sehen das gerade einmal 25 Prozent. Es ist mit die größte Diskrepanz, die die Studie aufzeigt (66 Prozentpunkte).
Jacob Chammon, Geschäftsführer der Telekom-Stiftung, kann diesem Befund auch etwas Positives abgewinnen. “Er zeigt, dass die Gesamtbevölkerung erkennt, dass gute Bildung ausschlaggebend für die Zukunft von Kindern und Jugendlichen ist”, sagte er Table.Briefings. Auch vor diesem Hintergrund dürfte sehr viel Augenmerk darauf liegen, wie sich das Startchancen-Programm entwickelt.
Lesen Sie auch: Startchancen – Warum das 20-Milliarden-Euro-Programm viel kleiner ausfällt
Die größte Kluft gibt es laut Studie mit 68 Prozentpunkten im Bereich “gute technische bzw. digitale Ausstattung der Schulen und Universitäten”. 79 Prozent halten sie für unverzichtbar. Doch lediglich elf Prozent finden, dass es diese gute Ausstattung tatsächlich gibt. Was aus Sicht von Jacob Chammon einmal mehr die Notwendigkeit eines Digitalpaktes II zeigt, auf den sich Bund und Länder aktuell nicht einigen können. “Das Urteil ist eindeutig: Es gibt flächendeckend noch keine gute digitale Ausstattung an den Schulen. Es ist Zufall, ob ich an Schule A oder B bin und von einer guten Ausstattung profitieren kann. Das darf nicht sein und damit verbunden ist der klare Auftrag, sich zu einigen.”
Bei der “Ausstattung der Schulen und Universitäten mit Lehr- und Lernmitteln” liegen 65 Prozentpunkte zwischen Ideal (80 Prozent) und Realität (15 Prozent). Exakt diese Lücke tut sich auch auf bei dem Anspruch, “im gesamten Bundesgebiet einheitliche Standards, zum Beispiel bei Abschlussprüfungen” zu haben. Bemerkenswert: Mit fünf Prozent findet sich hier der niedrigste Wert in der “Realitäts-Rangliste”.
Fast drei Viertel der deutschen Bevölkerung – 73 Prozent – sind zudem der Meinung, dass die Schulen besser auf das Berufsleben vorbereiten müssen. Hier fördert der Blick ins Allensbacher Archiv zutage, dass dieser Wert 2012 noch bei 26 Prozent lag – und damit 47 Prozentpunkte niedriger. “Es ist sehr wichtig, dort genau hinzuschauen”, fordert Chammon. Die Verbindung zwischen der Schulzeit und dem Leben nach der Schule sei für viele Eltern von sehr großer Bedeutung. Auch, weil die Zukunft immer ungewisser werde.
Lesen Sie auch: Berlin und MV: Neue Pläne sollen Berufsorientierung stärken
“Schulen müssen sich hier öffnen, um Kindern Zukunftskompetenzen beizubringen.” Verbunden damit sei die Frage, ob die Formate für Berufsorientierung wie zweiwöchige Berufspraktika eigentlich noch die richtigen sind. “Oder müssen wir das viel stärker in den schulischen Alltag integrieren und auch Vorbilder für die Kinder und Jugendlichen schaffen?”, fragt Chammon. “Gerade in der MINT-Bildung ist das von großer Bedeutung.”
Gefragt danach, was an den Schulen in den nächsten fünf bis zehn Jahren vordringlich verbessert werden muss, steht für 84 Prozent der Bevölkerung der Lehrkräftemangel an erster Stelle. Bei den Eltern von Schulkindern liegt der Wert sogar bei 90 Prozent. Knapp drei Viertel (71 Prozent) begrüßen es zudem, wenn Deutschland regelmäßig an internationalen Vergleichsstudien wie PISA teilnimmt. In der Gesamtbevölkerung sind es 67 Prozent. Dass die Studien sich allerdings positiv auf den Unterricht auswirken, bezweifeln insgesamt knapp 60 Prozent der Befragten.
Zweifel und Ernüchterung sind ein hartnäckiger Begleiter des Bildungssystems. Das spiegelt sich auch darin wider, dass lediglich acht Prozent der Befragten angeben, dass Bildung den politischen Stellenwert hat, den sie verdient. Das ist historisch niedrig. Denn das Allensbacher Archiv zeigt, dass der Wert zwar schon seit vielen Jahren gering ist, 2008 aber bei zwölf Prozent lag und 2017 bei 13 Prozent.
Chammon wird hier sehr grundsätzlich: “Wir haben in Deutschland ein sehr verschachteltes Bildungssystem, in dem es sehr schwer ist, Veränderungen hinzubekommen.” Als Stichworte nennt er Föderalismus, innere und äußere Schulangelegenheiten, die riesige Anzahl an Schulträgern und schließlich den Ganztag, der eine weitere Trägerstruktur ins System bringe. “Für Politikerinnen und Politiker macht es das schwer, Dinge durchzusetzen.” An diese großen Reformthemen wirklich heranzugehen, scheue die Politik sich aber.
Lesen Sie auch: Mehr als nur “Hausmeister” – die Rolle der Kommunen
Zugleich zeigt die Studie auch, dass durchaus Bewegung ins Bildungssystem kommen kann. Denn für die Zukunft des Landes am wichtigsten – noch vor dem “hervorragenden Bildungssystem” – halten die Befragten, “dass wir genug qualifizierte Fachkräfte ausbilden” (79 Prozent). 39 Prozent sehen demgegenüber die Notwendigkeit, qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland zu gewinnen.
2017 lag dieser Wert noch bei 25 Prozent. Die anhaltende öffentliche Debatte über dieses Thema zeige hier Wirkung, heißt es in der Studie. “Der Bevölkerung wird zunehmend bewusst, dass der Fachkräftemangel in Zeiten geburtenschwacher Jahrgänge und dem gleichzeitigen altersbedingten Ausscheiden der geburtenstarken Babyboomer-Jahrgänge aus dem Berufsleben nicht allein mit der Ausbildung qualifizierter Fachkräfte aus dem eigenen Land aufgefangen werden kann.”

The same procedure as every year! – wie bei “Dinner for one” verhält es sich seit einigen Jahren immer im August, wenn das neue Ausbildungsjahr beginnt, viele Ausbildungsplätze unbesetzt bleiben und viele junge Menschen keinen Ausbildungsplatz gefunden haben. Zur Frage, warum das so ist, kommen aus Politik, Forschung und Verbänden die immer gleichen Begründungen: Zu viele Abiturienten würden studieren, statt eine Ausbildung zu beginnen. Die Schulabgänger und -abgängerinnen könnten zu wenig und wären nicht ausbildungsfähig. Aufgrund der Demografie gäbe es nicht genug Schulabgänger und das letzte Buzzword lautet “Mismatch”.
Diese Argumente sind jedoch wenig hilfreich. Denn sie sind entweder schlicht falsch oder sie greifen zu kurz. Der Mismatch etwa spielt zwar eine gewisse Rolle, wenn etwa Jugendliche nicht dort wohnen, wo es Ausbildungsplätze gibt, in seiner Bedeutung wird er jedoch deutlich überschätzt. Was sonst tatsächlich zutrifft:
Der Anteil an Abiturienten, die eine Ausbildung aufnehmen, ist seit Anfang der 2000er-Jahre deutlich gestiegen. Mittlerweile beginnt fast die Hälfte eines Abiturientenjahrgangs eine berufliche Ausbildung, jeder dritte eine duale Ausbildung. Die Zahl der Jugendlichen mit Hauptschulabschluss im dualen System war 2021 hingegen um 35.000 niedriger als es dem Rückgang an Hauptschulabsolventen seit 2011 entsprochen hätte. 25.000 Jugendliche mit Realschulabschluss wanderten von der dualen in die schulische Ausbildung, etwas schwächer zeigt sich diese Entwicklung bei anderen Schulabgängern.
Fazit: Der letztlich seit 2007 zu beobachtende starke Rückgang an Azubis im dualen System liegt vor allem daran, dass immer mehr Haupt- und Realschulabsolventen keinen Ausbildungsplatz suchen, finden oder bekommen. Dass sich mehr Abiturienten für eine duale Ausbildung entscheiden, verhinderte einen noch dramatischeren Azubi-Rückgang. Wenn man jetzt jedoch einseitig darauf setzt, noch mehr Abiturienten für die duale Ausbildung zu gewinnen, führt dies unweigerlich dazu, dass der Fachkräftemangel bei Akademikern noch größer wird als er sowieso schon ist. Dabei liegen die größten Potenziale woanders.
Dass auch die Demografie für den Rückgang der Ausbildungsverträge nicht maßgeblich ist, zeigt sich nicht nur daran, dass aktuell mehr als 2,9 Millionen der 20- bis 34-Jährigen ungelernt und weder in Schule noch in Ausbildung sind, sondern noch stärker an den folgenden Zahlen. Der Anstieg (der Ungelernten) geht vor allem auf zwei Entwicklungen zurück:
Es gibt in Deutschland somit ein riesiges Potenzial an jungen Menschen, die für eine qualifizierende Ausbildung gewonnen werden könnten. Diese Gruppe wird zwar in Sonntagsreden erwähnt, spielt aber in der alltäglichen Politik kaum eine Rolle. Stattdessen versuchen Politik und nachgeordnete Behörden wie die Bundesagentur für Arbeit mit großem Aufwand, junge Menschen aus dem Ausland für eine Ausbildung nach Deutschland zu holen. Mit mäßigem Erfolg.
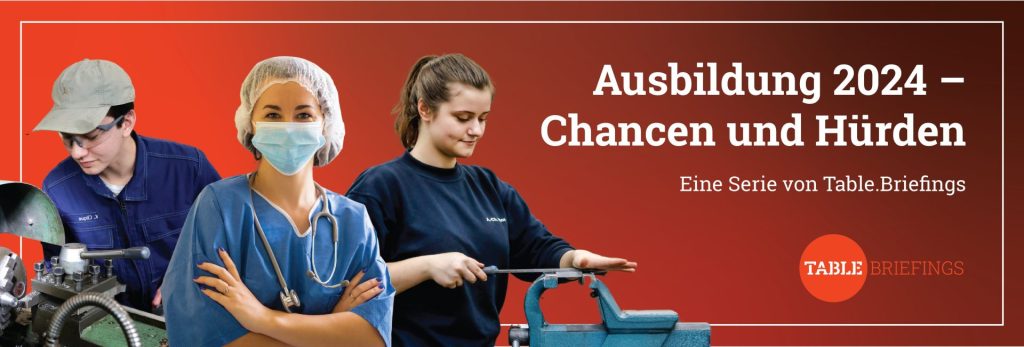
Der geringe Erfolg von Maßnahmen – wie die Stärkung der Berufsorientierung in der Schule, insbesondere am Gymnasium, Berufswahlapps, kleinere Reformen innerhalb der Ausbildung, (noch) mehr Zuständigkeit für die Jugendberufsagenturen und diverse Projektförderrichtlinien – zeigt sich schon daran, dass die Situation sich nur für Abiturienten verbessert hat. Auch die Ausbildungsgarantie wird wenig Wirkung zeigen. Nicht nur, weil sie zu klein angelegt und auf bestimmte Regionen beschränkt ist, sondern weil es kein wirklich auf die Ausbildung von herausfordernden Zielgruppen ausgerichtetes Konzept gibt.
Es braucht eine sorgfältige Analyse, warum viele Jugendliche nicht in Ausbildung finden. Das Gros hat einen niedrigen bis mittleren Schulabschluss, kommt aus benachteiligten Familien, die Mehrheit hat eine Zuwanderungsgeschichte. Folgende Gründe sind in meinen Augen ausschlaggebend:
Gerade kleine und kleinste Unternehmen ziehen sich aus dem Ausbildungsgeschehen. Wer mehrfach keinen Erfolg hatte, einen Ausbildungsplatz zu besetzen – und im Übrigen kaum die Ressourcen hat, um die Kompetenzdefizite leistungsschwächerer Jugendlicher im Ausbildungsalltag aufzufangen – zieht die naheliegenden Konsequenzen und gibt verständlicherweise auf.
Besser wäre es, wenn diese Betriebe ihre Strategie hinterfragen würden, wozu sie gezielte und kompetente Unterstützung benötigen: Wie und wo positioniere ich mich im harten Wettbewerb um Azubis? Welche Kompetenzen brauchen Jugendliche für eine Ausbildung bei uns? Welche Möglichkeiten der flexiblen, bedarfsorientierten “Nachhilfe” gibt es? Kleine und kleinste Unternehmen haben nur wenig Zeit und finanzielle Ressourcen, daher braucht es ein kompetentes und kostengünstiges Angebot mit pro-aktiver Ansprache.
Es steht viel auf dem Spiel: Wenn es uns nicht gelingt, das Ruder zeitnah herumzureißen, wird die duale Ausbildung zum Auslaufmodell – und noch mehr junge Menschen werden keine Ausbildung beginnen und erfolgreich abschließen (können).
Um das Startchancen-Programm administrativ zu begleiten, entstehen in den Bundesländern zahlreiche neue Stellen. Das ergab eine Umfrage von Table.Briefings in den Schulministerien. Vor allem in der Antwort aus Bayern, das von Beginn an mit der Umsetzung des Programms haderte, scheint Kritik durch. Kultusministerin Anna Stolz hatte den Bürokratieaufwand wiederholt beklagt.
Lesen Sie auch: Kultusministerin Stolz – Startchancen-Programm bringt unnötigen bürokratischen Aufwand
Bereits für die Vorbereitung des Startchancen-Programms sei ein deutlicher Zusatzaufwand entstanden, heißt es aus dem bayerischen Kultusministerium. Im Ministerium und nachgeordneten Behörden würden “im Laufe des Schuljahres 2024/2025 4,5 Stellen für Beamte bzw. Arbeitnehmer für die Aufgabe ,Startchancen-Programm’ umpriorisiert”. Das Ministerium betont zudem, dass “in allen beteiligten Behörden sowie den betroffenen Schulaufsichten weitere Personen in nicht unerheblichem Maße parallel zu ihren sonstigen Dienstgeschäften” in das Programm eingebunden seien. Und stellt in Aussicht, dass noch weitere “Stellen umpriorisiert oder neu geschaffen werden”.
In vielen anderen Ländern ist das Bild ähnlich: “Rheinland-Pfalz schafft im Doppelhaushalt 2025/2026 insgesamt 15 neue Stellen für das Startchancen-Programm”, heißt es aus dem Schulministerium. Hinzu kämen fünf weitere Stellen, die durch Neuverteilung von Zuständigkeiten ebenfalls zum Startchancen-Programm zu rechnen sind. Aus Niedersachsen ist zu hören, dass rund zehn zusätzliche Stellen in der Kultusverwaltung entstehen sollen.
Sachsen schreibt von “zusätzlichen acht Stellen, die für die Einstellung von Fachkräften für die multiprofessionellen Teams, Unterstützungsstrukturen für die Verwendung der Chancenbudgets sowie die konzeptionelle Begleitung vorgesehen sind”. Die Bund-Ländervereinbarung sähe dafür vier Prozent der Mittel für die Säulen 2 (Schulbudget) und 3 (Multiprofessionelle Teams) des Programms vor.
In Thüringen, wo an diesem Sonntag die Landtagswahlen anstehen, ist geplant, die Stabstelle Startchancen-Programm im Bildungsministerium “auf bis zu sieben Personen aufwachsen zu lassen”. Das allerdings steht noch unter Haushaltsvorbehalt. Mecklenburg-Vorpommern beabsichtigt derweil, “zur administrativen Abwicklung des Programms zwei drittmittelfinanzierte Stellen einzurichten”.
Schleswig-Holstein, Bremen und Baden-Württemberg betonen, bereits vorhandenes Personal und etablierte Strukturen zur Umsetzung des Startchancen-Programms zu nutzen. In Schleswig-Holstein werden sie um sechs zusätzliche Stellen ergänzt, in Bremen um eine. Baden-Württemberg nennt noch keine Zahlen, plant aber “den Ausbau der personellen Kapazitäten”.
Aus den übrigen Ländern lagen Table.Briefings, teils wegen laufender Etat-Verhandlungen oder noch zu klärender Strukturen, keine Zahlen vor. Allein aus Brandenburg hieß es, dass keine zusätzlichen Stellen entstehen würden. Holger Schleper
Unter SPD-geführten Landesregierungen erhielten Schülerinnen und Schüler seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland durchschnittlich deutlich mehr politische Bildung als unter Unions-Regierungen. Das ist das Ergebnis einer Studie des Leibniz-Institus für Bildungsverläufe (LIfBi), die am Mittwoch veröffentlicht wird und Table.Briefings vorab vorliegt. Darin untersuchten die Forscherinnen und Forscher den Stellenwert von Politikunterricht in Deutschlands Schulen für den Zeitraum von 1949 bis 2019. Für die ostdeutschen Bundesländer sind Daten ab der Wiedervereinigung enthalten.
Insbesondere für die 1970er- bis 1990er-Jahre zeige sich dabei ein klarer politischer Einfluss der Landesregierungen, erklärt Schulforscher Norbert Sendzik, der die Studie gemeinsam mit Marcel Helbig und Ulrike Mehnert durchgeführt hat. “War die SPD an einer Regierung beteiligt, wurde mehr politische Bildung unterrichtet. Regierte die CDU, war weniger politische Bildung vorgesehen”, fasst Mehnert zusammen. So wurde beispielsweise um die Jahrtausendwende das Fach Politik in Nordrhein-Westfalen mit sieben Wochenstunden gelehrt, während es in Bayern und Sachsen nur zwei Wochenstunden waren. Besonders deutlich erkennbar ist die Entwicklung für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die nach der Wiedervereinigung christdemokratisch geprägt waren.
Zugleich betont Sendzik, dass die politische Bildung seit den 2000er-Jahren weniger von der Zusammensetzung der Landesregierung geprägt sei. Dennoch gibt es auch hier bundeslandspezifische Entwicklungen: So wurde in Hessen die Unterrichtszeit seit den 1990er-Jahren bis in die 2010er-Jahre von sieben auf drei Wochenstunden mehr als halbiert, während sie in Schleswig-Holstein im selben Zeitraum von im Schnitt rund einer auf fast fünf Wochenstunden anstieg.
Außerdem vergleicht die Studie die Ausprägung des Politikunterrichts an verschiedenen Schulformen. Diese Untersuchung ergab einen für die Forscher überraschenden Befund: In der Geschichte der Bundesrepublik war an nicht-gymnasialen Schulformen insgesamt mehr Politikunterricht vorgesehen als an Gymnasien. Dieses Ergebnis sei den Forschern zufolge deshalb bemerkenswert, da andere Forschung für die Gegenwart darauf hinweist, dass Gymnasiasten mehr politische Bildung erhalten als Schülerinnen und Schüler anderer Schulformen. max
Hamburg schafft die Abschlussprüfungen für Gymnasiasten in der zehnten Klasse ab dem kommenden Schuljahr ab. “Wir haben in den letzten Jahren ein so enges Netz an Schülerleistungsstudien (KERMIT) über die einzelnen Klassenstufen hinweg geschaffen, dass die individuelle Entwicklung jedes Jugendlichen auch ohne zusätzliche Überprüfungen gut beurteilt werden kann“, erklärte Schulsenatorin Ksenija Bekeris. Bislang müssen die Schülerinnen und Schüler zu Beginn des zweiten Halbjahres der zehnten Klasse in den Fächern Deutsch, Mathematik und einer fortgeführten Fremdsprache eine zentral gestellte Klassenarbeit schreiben und in mindestens zwei dieser Fächer eine mündliche Prüfung ablegen.
Außerdem kündigte Bekeris an, dauerhaft mehr Beratungslehrkräfte in Gymnasien einsetzen zu wollen. Damit setzt sie eine im Nachgang der Corona-Pandemie gestartete und zunächst auf zwei Jahre befristete Initiative fort. Die SPD-Politikerin betonte, dass durch diese Maßnahmen nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern auch Lehrkräfte entlastet würden. Im nächsten Schritt soll nun über Entlastungen für Stadtteilschulen nachgedacht werden.
Mit der Abschaffung der Abschlussprüfungen für Gymnasiasten am Ende der zehnten Klasse folgt Bekeris dem Beispiel Berlins, wo Schulsenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) diesen Schritt bereits zu Beginn des Schuljahres 2023/24 vollzog. Im bundesweiten Vergleich ist es bereits die Regel, dass Schülerinnen und Schüler an Gymnasien mit der Versetzung in die gymnasiale Oberstufe automatisch einen dem Mittleren Schulabschluss (MSA) gleichwertigen Abschluss erhalten. Gesonderte Prüfungen gibt es derzeit lediglich in Brandenburg, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Thüringen. Maximilian Stascheit
Lesen Sie auch: Schulsenatorin Bekeris im Interview: Kita und Schule müssen mehr Daten austauschen
Research.Table: Was die DFG-Präsidentin zur Forschungssicherheit in Deutschland sagt. Um die Balance zwischen Forschungssicherheit und Wissenschaftsfreiheit ging es bei einem transatlantischen Austausch in Washington. Im Interview mit Table.Briefings erläutert DFG-Präsidentin Katja Becker, inwieweit das neue Secure Center der USA ein Vorbild für Deutschland sein kann. Das ganze Gespräch lesen Sie hier.
Research.Table: Industrielle Forschungsgemeinschaften gegen Bevorzugung der HAWs bei der Dati. In einem gemeinsamen Positionspapier reagieren die außeruniversitären Forschungsgemeinschaften auf die Empfehlungen der Dati-Gründungskommission. Unter anderem kritisieren sie, dass mindestens 25 Prozent der Mitglieder des Förderrats aus den Reihen von HAWs berufen werden sollen. Was sie daran stört, lesen Sie hier.
Capital: Dänemark rudert bei der Digitalisierung von Schulen zurück. Dänemark ist ein Vorreiter in der Digitalisierung, doch das Land will die Schüler jetzt wieder analoger lernen lassen. Die PISA-Ergebnisse des Landes haben sich verschlechtert und Studien stellen fest, dass zu viel Bildschirmzeit zu Konzentrationsschwierigkeiten führt. Die digitalen Geräte sollen in der Schule nur noch genutzt werden, wenn es tatsächlich erforderlich ist. Auch vollständig handyfreie Schulen sollen nun eine Option sein. (Warum Dänemark die Digitalisierung in Schulen zurückdreht)
WAZ: Langsamer Start des Startchancen-Programms in Duisburg. Für das Startchancen-Programm in Duisburg liegen noch keine Förderrichtlinien vor. Diese legen fest, wie viele Mittel die Schulen bekommen und wie hoch der Eigenanteil der Träger sein wird. Durch die Mittel des Startchancen-Programms ist es den Schulen nun auch möglich, eine weitere Stelle auszuschreiben. Zur derzeitigen Personalausstattung der Duisburger Schulen liegen keine Zahlen vor. (Neues “Startchancen”-Programm verstolpert Start an Schulen)
Merkur: Bundesagentur für Arbeit sieht gute Chancen auf Ausbildungsplatz für Hauptschüler. Insbesondere in Bereichen mit vielen unbesetzten Stellen – wie in der Gastronomie oder dem Handwerk (speziell dem Metallbau) – seien auch Jugendliche mit Hauptschulabschluss gesucht. Jedoch sind durch spezifische Anforderungen der Betriebe nur 60 Prozent der Ausbildungsplätze durch Hauptschüler besetzbar. (Bundesagentur: Noch Chancen für Hauptschüler auf Lehrstelle)
Le Figaro: Falsche Versprechungen für französischen Sportunterricht. Die Generalsekretärin Coralie Benech von der Nationalen Gewerkschaft für Sportunterricht in Frankreich beklagt mangelnde Investitionen im Sport. Präsident Macron habe Investitionen in den Schulsport versprochen, doch stattdessen fielen in diesem Bereich tausende Stellen weg. Zudem verfügten Sportvereine wie Schulen nicht über ausreichend Ausstattung. (Sport scolaire : «C’est difficile de croire à un héritage après les JO de Paris 2024»)
Dlf: Antidemokratische Tendenzen stellen Lehrkräfte vor Herausforderungen. Bei rechtsextremen Aussagen von Schülern sind die Grenzen zwischen bewusster Provokation, verfestigter Meinung und schlichter Unwissenheit jedoch meist unklar. Ursachen können zudem eigene negative Erfahrungen oder auch das Elternhaus sein. Die Schulleitung kann hier nur bei eindeutigen Straftaten eingreifen. Die Lehrkräfte fühlen sich selbst meist nur unzureichend vorbereitet, um angemessen zu reagieren. (Der Umgang mit Rechtsextremismus in der Schule)
NDR: Umfrage zeigt Gewalt an Schulen. Der Philologenverband Niedersachsen (PHVN) hat Gymnasial- und Gesamtschullehrkräfte zu Gewalt an Schulen befragt und alarmierende Ergebnisse präsentiert. Laut PHVN haben 70 Prozent der Lehrkräfte Erfahrungen mit verbaler Gewalt wie Bedrohungen, Mobbing oder Beschimpfung, 21 Prozent erlebten physische Gewalt (körperliche Übergriffe, Nötigung et cetera). 950 aktive Lehrkräfte hatten im Juni und Juli an der Umfrage teilgenommen. Der Verband fordert das Kultusministerium auf, zu handeln und “konkrete Regelungen zu schaffen, die allen an Schule Beteiligten Sicherheit geben”. (Gewalt an Schulen: Verband fordert Schutz für Lehrkräfte)
30. August 2024, 14 Uhr, online
Webinar Pack your bags, it’s back to school! What’s on the horizon for a new school year?
Vor welchen Herausforderungen steht die Schule? In dieser jährlichen Diskussionsveranstaltung von der OECD geht es um einen Blick in die Zukunft. Zudem wird es einen Ausblick auf die geplanten Veranstaltungen vom Education Directorate geben. INFOS & ANMELDUNG
05. September 2024, 10 bis 20 Uhr, Berlin
Networking Festival der Berliner Wirtschaft – Bildung X Business
Die IHK bietet Berliner Unternehmen die Chance, sich zu vernetzen und über praxiserprobte Bildungsinnovationen auszutauschen. Zu Gast sind unter anderem Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch, Migrations- und Bildungssoziologe Aladin El-Mafaalani und die Botschafterin Marika Linntam vom Pisa-Spitzenreiter Estland. INFOS & ANMELDUNG
05. September 2024, 11 – 12.30 Uhr, online
Präsentation Vorstellung des Navigator Bildung Digitalisierung
Wie weit ist die Digitalisierung an Deutschlands Schulen fortgeschritten? Die Co-Autorinnen Birgit Eickelmann und Uta Hauck-Thum präsentieren die Ergebnisse des Navigator Bildung Digitalisierung. Anschließend diskutieren sie u.a. mit einem Schüler und einem Schulleiter, wie eine Gesamtstrategie
für die digitale Transformation im schulischen Bildungsbereich umgesetzt werden kann. INOFS& ANMELDUNG
10. bis 11. September 2024, Berlin
Workshop Bundeskonferenz Bildungsmanagement 2024
Wie gelingt die vollständige Ganztagsbetreuung ab dem Jahr 2026? Wie können Kommunen Fachkräfte für sich gewinnen und digitale Innovationen in der Bildung nutzen? Das BMBF lädt zu Workshops und Diskussionen zu Themen der kommunalen Bildungslandschaft ein. INOFS& ANMELDUNG
18. bis 20. September 2024
Konferenz Digital, analogue, and hybrid learning spaces: Rethinking dialogue, inquiry, and argumentation?!
In dieser Konferenz der European Association for Research on Learning and Instruction können Forscher und Interessierte in den Austausch über das Feld der Bildungsforschung treten. Das Thema dieser Konferenz ist die Veränderung vom gemeinsamen Austausch durch digitale und analoge Räume. Eine Anmeldung zur Teilnahme ist bis 06.09. möglich. INFOS & ANMELDUNG
