
wir begrüßen Sie zum Berlin.Table, dem Late-Night-Memo für die Hauptstadt.
Die Wahl in Berlin wirkt nach. Auch weil das Ergebnis großes Potenzial hat, die Stadt und die Menschen zu spalten. Zwischen links und rechts und zwischen Peripherie und Zentrum. Einer, der im Zuspitzen und Spalten seit vielen Jahren besonders wirkungsvoll ist, heißt Wolfgang Kubicki. Seine Äußerungen vom Wahlabend, gerichtet gegen die Grünen und transportiert vom Spiegel, haben auch Tage später noch das Zeug dazu, die Stimmung in der Ampel zu vergiften. Wir schauen heute auf die Parteien, ihre Abwägungen und deren mögliche Folgen für die Bundesparteien.
Außerdem berichten wir über das neue Anti-Extremisten-Gesetz der Bundesregierung, schildern die besondere Rolle des Nicht-Krawallpolitikers und CDU-Klimaexperten Andreas Jung und werfen einen Blick auf eine besondere Niederlage der SPD in ihrer Hochburg Mainz.
Viel Vergnügen bei der Lektüre. An dieser Stelle versorgen wir Sie jeden Sonntag-, Dienstag- und Donnerstagabend mit Informationen und Analysen aus der Hauptstadt.
Heute haben Okan Bellikli, Stefan Braun, Enno Eidens, Horand Knaup, Malte Kreutzfeldt, Vera Weidenbach, Britta Weppner und Thomas Wiegold mitgewirkt. Wir danken für Ihr Interesse.
Berlin: Die Optionen und ihre Folgen. Nach der Wahl in Berlin warten alle auf das, was nun kommt. Die Frage, ob es mit Rot-Grün-Rot oder doch einem Bündnis unter Führung der CDU weitergeht, hat große Konsequenzen auch für die Bundesparteien. Machtpolitisch, aber auch beim Blick auf das, was daraus für künftige Wahlen abgeleitet werden könnte. Erste Reflexe könnten auf längere Sicht deshalb die falschen sein.
Für die SPD ist Mehrheit erst mal Mehrheit. Für die SPD in der Stadt wie im Bund steht an erster Stelle der Machterhalt. Dazu gehört der Verweis, dass demokratische Mehrheit demokratische Mehrheit ist. Daran wollen sie nicht rütteln lassen und erinnern gerne an die CDU, die 2001 in Hamburg mit Ronald Schill koalierte, um die deutlich stärkere SPD von der Macht fernzuhalten.
Trotzdem bleibt ein ungutes Gefühl, auch bei Sozialdemokraten. Wer sich am Sonntagabend die ersten Reaktionen ansah, konnte sehen, dass Co-Parteichef Lars Klingbeil wie Franziska Giffey auch eine andere Lesart des Ergebnisses für legitim halten: dass das Votum eine schwere, eine bittere Niederlage gewesen ist. Historisch schlecht, in keinem Wahlkreis bei der Zweitstimme eine Mehrheit; das klingt nach Misstrauensvotum. Auch wenn Giffey und Klingbeil nun auf Rot-Grün-Rot setzen – sie wissen um die Malaise. Und sie ahnen, dass ein Ignorieren des Wählervotums der SPD noch schaden kann. Zum Beispiel bei den nächsten Wahlen in Bremen, Bayern und Hessen.
Die Grünen genießen einen kurzen Glücksmoment. Die Grünen schnupperten am Sonntagabend an der Chance, zum ersten Mal das Rote Rathaus zu besetzen. Das fühlte sich gut an, für die Grünen im Land wie im Bund. Aber es hat verdeckt, was nun bevorsteht. Die Partei hat drei Möglichkeiten: Weiter mit einer geschwächten Franziska Giffey; mühsame Gespräche mit der CDU oder ein noch nicht ganz ausgeschlossener Absturz in die Opposition.
Jetzt droht ihnen eine schwere Abwägung. Denn keine der Optionen ist schön. Und Bettina Jarasch weiß das. Sie kam nicht als linke Vorkämpferin, sondern als kompromissbereite Pragmatikerin nach Berlin. Mit der Grünen-Spitze im Bund muss sie nun abwägen zwischen dem einfachsten Weg (Fortsetzung) oder dem mühsamen Weg des Neuanfangs. Dabei ahnen alle in der Führung: Ein Augen-Zu-und-Durch passt nicht wirklich zum vorgelebten Verantwortungsbewusstsein der Grünen in der Ampel.
Die CDU ist erst mal erleichtert. Bei den Christdemokraten ist die Lage vergleichsweise einfach. Sie reklamieren den Sieg für sich und werden laut schimpfen, sollten sie außen vor bleiben. Vor allem aber herrscht große Erleichterung. Mitten hinein in den heiklen Konflikt mit Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen kann die Parteiführung um Friedrich Merz einen kurzen Moment in der Sonne genießen.
Das Einfache kann aber schnell vorbei sein. Ein Blick in die weitere Zukunft zeigt Merz und dem Wahlsieger Kai Wegner, dass das Leben schwer bleibt. Kommt die Chance auf ein Bündnis mit SPD oder Grünen, dann werden erhebliche Kompromisse nötig werden. Kompromisse, über die sich Wegner und Merz im Stillen vermutlich schon den Kopf zerbrechen. Kommt diese Chance nicht, dann kann die CDU versuchen, SPD, Grüne und Linke bei den nächsten Landtagswahlen dafür zu geißeln. Eines aber wissen sie nicht: Ob die Wähler sich dann noch für die CDU oder womöglich gleich für die AfD entscheiden.
Das Endergebnis lässt noch auf sich warten. Wie sich am Dienstag herausstellte, sind in Berlin-Lichtenberg 466 Stimmen noch nicht ausgezählt. Beim 105-Stimmen-Vorsprung der SPD vor den Grünen lässt das noch einiges offen. Das amtliche Endergebnis wird für den 27. Februar erwartet. Es bleibt noch Zeit, alles abzuwägen.
SZ: Jürgen Habermas zum Krieg und zum Bemühen um Frieden. Wenn es andere partout nicht tun, dann macht es Jürgen Habermas: Überlegen, wie man aus dem Kreislauf des Krieges herauskommt, ohne sich an die Seite einer Sahra Wagenknecht zu stellen. Er scheut sich nicht, gegen die Mehrheit der Meinungen anzuschreiben, möchte den “vorbeugenden Charakter von rechtzeitigen Verhandlungen” hervorheben. Nichts an alledem ist einfach. Aber das Denken in diese Richtung ist es wert und wichtig. (“Ein Plädoyer für Verhandlungen”, Seite 10)
Die Private Krankenversicherung als Wirtschaftsfaktor: Die PKV ist nicht nur eine wichtige Stütze des Gesundheitssystems in Deutschland. Sie trägt auch wesentlich zur ökonomischen Bedeutung der Gesundheitsbranche bei. Wie groß der “ökonomische Fußabdruck” der PKV ausfällt, zeigen regelmäßige Studien des Wirtschaftsforschungsinstitut WifOR. (Mehr)
Handelsblatt: Der Wohnungsmangel wird immer schlimmer. In zwei Jahren könnten in Deutschland 700.000 Wohnungen fehlen, schreiben Silke Kersting und Julian Trauthig und berufen sich dabei auf das Frühjahrsgutachten der Immobilienweisen. Die Gründe: Hohe Zuwanderung, sinkende Investitionen, steigende Kosten, Personalmangel und staatliche Regulierung. Gebaut werde kaum noch. Auch problematisch: Die Mieten in westdeutschen Städten stiegen 2022 mit 5,2 Prozent schneller als in den Vorjahren. (“Hohe Nachfrage, sinkende Neubauzahlen”), Seite 1/8)
FAZ: Kritik an Plan zur Aufzeichnung von Prozessen. Der Richterbund lehnt das Vorhaben der Bundesregierung ab, Strafverfahren in Zukunft in Bild und Ton aufnehmen zu lassen. Er befürchtet laut Helene Bubrowski die Verletzung von Persönlichkeitsrechten und eine Mehrbelastung der Justiz. In vielen anderen europäischen Ländern allerdings ist die audiovisuelle Dokumentation der Hauptverhandlung in solchen Prozessen Standard, so die Autorin. (“Kritik an Buschmanns Plänen”, Seite 4)
Nicht überlesen!
SZ: Stadtrand gegen Zentrum – Die neue Landkarte von Berlin. Berlin ist gespalten, aber nicht mehr zwischen Ost und West, sondern zwischen Peripherie und Zentrum. Gustav Seibt analysiert die Folgen – und wenn er recht hat, dann wird das nichts mehr mit einem Gemeinschaftsgefühl in der Hauptstadt. (“Halt den Rand”, 13. Februar 2023)
Financial Times: Wenn der Staat sich zu sehr auf Berater verlässt. Die Wirtschaftswissenschaftlerin Mariana Mazzucato hat ein neues Buch geschrieben, das im April auch auf Deutsch erscheint. “Wie die Beratungsbranche unsere Unternehmen schwächt, den Staat unterwandert und die Wirtschaft vereinnahmt”, lautet der Untertitel. Ihre Thesen erläutert sie in der FT. (“Mariana Mazzucato: ‘The McKinseys and the Deloittes have no expertise in the areas that they’re advising in'”, 13. Februar 2023)
Zwischen Ausbildung und Studium – können neue Modelle aus der Berufsbildung den Fachkräftemangel eindämmen? Über diese und andere Fragen spricht Bildung.Table-Redakteurin Anna Parrisius am 23. Februar mit Prof. Dr. Insa Sjurts (BHH) und Prof. Bernd Fitzenberger (IAB). (Hier anmelden)
Beamte: BMI will Extremisten schneller rauswerfen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will Disziplinarverfahren gegen Beamte des Bundes beschleunigen. Ein entsprechender Gesetzentwurf soll an diesem Mittwoch das Kabinett passieren. Derzeit dauern Verfahren im Schnitt rund vier Jahre. Dies sei bei Verfassungsfeinden im Staatsdienst “nicht hinzunehmen, auch weil die Beamten während des gesamten Disziplinarverfahrens weiterhin einen beträchtlichen Teil ihrer Bezüge erhalten”, heißt es in dem Entwurf.
Bisher waren Verwaltungsgerichte für eine Disziplinarklage zuständig. Das Gericht musste von der Disziplinarbehörde angerufen werden. Betroffene konnten gegen einen Entscheid beim Oberverwaltungsgericht Berufung einlegen. Künftig soll eine Disziplinarbehörde per Verfügung alle Maßnahmen- etwa eine Zurückstufung, Entfernung aus dem Beamtenverhältnis und Aberkennung des Ruhegehalts – aussprechen können. Das Verwaltungsgericht soll auch künftig eine “gerichtliche Vollkontrolle der Disziplinarverfügung” gewährleisten; es wird aber nur noch tätig, wenn Betroffene die Entscheidung der Behörde anfechten. Auch die bisher geltende Bezahlung der Bezüge bis zum Abschluss des Verfahrens soll entfallen; wird die Entlassung aus dem Beamtenverhältnis vom Gericht bestätigt, müssen die seit der ersten Entscheidung bezahlten Bezüge zurückerstattet werden.
Volksverhetzung gilt künftig als schweres Dienstvergehen. Wenn ein Beamter wegen Volksverhetzung zu einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten verurteilt wird, verliert er künftig – auch ohne Disziplinarverfahren – die Beamtenrechte. Bei den meisten anderen Straftatbeständen gilt das erst bei einem Strafmaß von zwölf Monaten oder mehr. Zur Einordnung: 2021 wurden innerhalb der Bundesverwaltung 373 Disziplinarmaßnahmen verhängt, überwiegend jedoch ohne Zurückstufung oder Rauswurf aus dem Beamtenverhältnis.
Massive Kritik kommt von Verdi und DGB. Die Einführung einer Disziplinarverfügung für sämtliche Disziplinarmaßnahmen genüge “nicht den Anforderungen an ein förmliches, unparteiliches und die Fairness sicherndes Verfahren”, sagt Verdi-Gewerkschaftssekretär Christian Hoffmeister. Grundlegende Prinzipien des Beamtentums würden geschwächt. Auch die als gebundene Entscheidung ausgestaltete Enthebung der Beamten aus dem Dienst und die zwingende Kürzung der Bezüge fällt bei der Gewerkschaft durch. Es sei nicht vertretbar, Beamte einer Situation auszusetzen, “in der sie durch eine bloße behördliche Entscheidung ihrer grundlegenden Rechte beraubt werden”. Sollte das Kabinett die Vorlage durchwinken, dürften auf die Innenpolitiker insbesondere der Ampel-Fraktionen noch einige klärende Gespräche zukommen.
Pistorius verschiebt sein Vorhaben. Das Verteidigungsministerium, das ursprünglich gemeinsam mit dem BMI einen Gesetzentwurf gegen Extremisten einbringen wollte, hat seine Pläne dagegen verschoben. Die offizielle Begründung: die Abstimmung mit den anderen Ressorts fehle noch. Das ist zwar richtig, der Grund dafür ist allerdings banal: Im Bendlerblock war der Entwurf schon fertig, es fehlte nur noch die Unterschrift von Ministerin Christine Lambrecht – die dann aber zurücktrat. Nachfolger Boris Pistorius hat das Vorhaben jetzt auf seinem Arbeitsstapel.
SPD: OB-Desaster in Mainz. Während die Sozialdemokraten am Sonntagabend in Berlin zitterten, versteckten sie sich bei der OB-Wahl in der Landeshauptstadt Mainz. Die Devise der ebenso entsetzten wie sprachlosen Parteiführung: “Heute keine Kommentare!” Auf desaströse 13,3 Prozent und Rang vier hatte es ihre Kandidatin gebracht, schaffte es nicht einmal in die Stichwahl. Und das nach 73 Jahren ununterbrochener SPD-Regierung im Rathaus. Gewinner war mit 40,2 Prozent der außerhalb der Stadt unbekannte parteilose Nino Haase, ein 39-jähriger Unternehmer.
Der Kandidat der Grünen landete mit 21,5 Prozent auf Rang zwei. Chancen in der Stichwahl räumt ihm kaum jemand ein. “Auch Dreyers Niederlage” titelte die Allgemeine Zeitung aus Mainz. Weil die Ministerpräsidentin sich bei der Berufung des neuen Innenministers Michael Ebling – zuvor OB in Mainz – in keinster Weise um die Nachfolgefrage gekümmert hatte. Ähnlich verheerend, mit 13,5 Prozent, schnitt allerdings auch die CDU-Kandidatin ab. Noch nie wurden die etablierten Parteien in einer deutschen Großstadt derart abgewatscht. Mehr dazu lesen Sie hier.
SZ: Kiew erhält Munition aus Deutschland
Tagesspiegel: Trotz mangelnder Ladesäulen: Europa verbietet ab 2035 neue Autos mit Verbrennermotor
Welt: Verbrenner-Aus beschlossen: Was jetzt auf Verbraucher zukommt
Handelsblatt: Turbo für die Energiewende
Sächsische Zeitung: Bund soll Kosten für Asyl-Unterkünfte übernehmen
Zeit Online: Gauri Lankesh und die vielköpfige Hydra
Spiegel: Hetze gegen Reporterinnen: “Wir stechen dich ab und dann vergraben wir dich”
RND: “Die Geschichte stimmt nicht”: das Leck in der Nord-Stream-Story
T-Online: Bayern-Legende Bixente Lizarazu “Neuers Verletzung ist schrecklich”
Business Insider: 2022 gab es in Deutschland 642.000 neue Jobs: Knapp 70 Prozent wurden durch Zugewanderte besetzt
SZ: Sekt und Marmelade gestohlen: Einbrecher entschuldigen sich
Spiegel: Nato bestätigt Offensive auf Bachmut, russische Militärflugzeuge offenbar nahe Polen abgefangen
Welt: Großeinsatz bei Dresden-Gedenken – Polizei setzt Pfefferspray ein
FAZ: Paris droht Berlin mit Pipeline-Blockade
NZZ: “Antakya wird nie mehr sein, wie es einst war”
Jahrestag: Cafe Moskau wird Cafe Kyiv. Der bevorstehende Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine am 24. Februar wird an vielen Orten die unterschiedlichsten Formen des Gedenkens und Diskutierens auslösen – bei den Vereinten Nationen, in Brüssel und den europäischen Hauptstädten. Für Berlin hat die Konrad-Adenauer-Stiftung etwas Besonderes organisiert: Sie wird zusammen mit unterschiedlichen Organisationen das Berliner Cafe Moskau am 27. Februar in ein Cafe Kyiv verwandeln.
EU-Kommission, Bosch-Stiftung, Aspen-Institut, Zentrum Liberale Moderne: Es werden viele dabei sein. Geplant sind unter anderem Lesungen, eine Modeschau, sowie ukrainische Speisen und Getränke. Die Inhalte werden von den Beteiligten bestimmt und sollen Raum für politische Debatten geben. Die temporäre Umwandlung beginnt am 24. Februar. Weil das Gebäude an der Karl-Marx-Allee unter Denkmalschutz steht, darf die Neugestaltung maximal vier Tage so bleiben. Am Jahrestag soll auch dort die Solidaritätsdemonstration für die Ukraine starten.

CDU-Politiker Jung: Wichtig und leise. Der 47-jährige Klima- und Energieexperte Andreas Jung gehört als Parteivize eigentlich zum engsten Machtzirkel der Christdemokraten. Trotzdem ist er außerhalb von Partei und Fraktion kaum bekannt. Dabei könnte er der CDU ein neues Gesicht geben. Es fehlt ihm bislang aber eine in der Politik wichtige Eigenschaft: Er polarisiert nicht. Und poltern tut er erst recht nicht. Das macht es für ihn schwer, neben seinem populären Parteikollegen Jens Spahn Statur und Einfluss zu bekommen.
Profil gewinnen könnte Jung im Fall Hans-Georg Maaßen. An der Entscheidung für das Parteiausschlussverfahren war er als stellvertretender Vorsitzender direkt beteiligt und begründet seither die Entscheidung fachkundig und entschieden. Jung und Maaßen verkörpern zwei absolut gegensätzliche Politiker-Typen. Jung ist selbst Jurist und kann die Äußerungen des ehemaligen Verfassungsschutzchefs parieren. Außerdem dürfte es ihm leichter fallen als Friedrich Merz, glaubwürdig für eine CDU zu stehen, in der Maaßen keinen Platz mehr hat. Das ganze Porträt lesen Sie hier.
Europe.Table: Auch Busse müssen emissionsfrei werden. Alle neuen Stadtbusse in der EU dürfen ab 2030 kein CO₂ mehr ausstoßen. Das sieht der Vorschlag der Kommission für die CO₂-Flottengrenzwerte von schweren Nutzfahrzeugen vor, der am Dienstag offiziell vorgestellt wurde. Allerdings können die Mitgliedstaaten Ausnahmen von der Pflicht zur Anschaffung von Nullemissions-Bussen beantragen, wenn bergiges Gelände und schwierige Wetterbedingungen dies erforderlich machen. Mehr
Security.Table: Neue Chefin fürs BSI. Im Sommer übernimmt die IT-Expertin Claudia Plattner die Leitung der wichtigsten deutschen Cybersicherheitsbehörde – des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Plattner steht vor enormen Aufgaben und vielen politischen Fallstricken. Falk Steiner stellt die Frau vor, die für digitale Sicherheit des Landes eine große Rolle spielen wird. Mehr
Bildung.Table: SPD-Fraktionsvize will Bildungsmilliarde verdoppeln. Die SPD drängt ihren liberalen Koalitionspartner zu höheren Ausgaben für Bildung. Eine Milliarde Euro vom Bund für das Startchancen-Programm? “Wir brauchen eher das Doppelte”, sagt Fraktionsvize Sönke Rix im Interview. Das Rennen um die Haushalts-Milliarden ist eröffnet. Mehr
ESG.Table: Wie nachhaltig ist die Aktienrente? Bei der von der Bundesregierung geplanten Aktienrente ist noch offen, ob sie auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen wird. Eine klare Ausschlussstrategie für nicht-nachhaltiges Wirtschaften wäre ökonomisch klug und notwendig, sagt Kristina Jeromin vom Sustainable-Finance-Beirat der Bundesregierung. Allerdings ist der Beirat bislang noch nicht an der Planung beteiligt gewesen, was die Mitglieder kritisieren. Mehr
Informationen am Morgen (Deutschlandfunk)
ca. 6:50 Uhr: Bruno Lezzi, Militärhistoriker: Schweizer Neutralität noch zeitgemäß?
ca. 7:14 Uhr: Frank Schäffler, MdB (FDP): Serie von Niederlagen – Wie weiter bei der FDP?
ca. 8:10 Uhr: Marcel Fratzscher, DIW: Wie die Rente stabilisieren?
ARD-Morgenmagazin (Das Erste)
6:05/7:05/8:35 Uhr: Silvana Ahmad, Studentin: Finanzielle Sorgen bei Studierenden
6:35/7:35 Uhr: Stefan Arne Bremkens, Oberstleutnant bei der Luftwaffe: Unbekannte Objekte über den USA
8:10 Uhr: Bettina Stark-Watzinger, Bundesbildungsministerin: Verzögerte Hilfen für Studierende und Fachschüler
Mittwoch, 15. Februar
Viktor Richter, Deutscher Botschafter in Armenien, 65
Thomas Bareiß, MdB (CDU) und Mitglied des Bundesvorstands, 48
Sabine Sütterlin-Waack, Ministerin für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport in Schleswig-Holstein, 65
Donnerstag, 16. Februar
Bodo Ramelow, Ministerpräsident von Thüringen, 67
Steffen Bilger, MdB (CDU) und Mitglied des Bundesvorstands, 44
Robert Farle, MdB (fraktionslos), 73
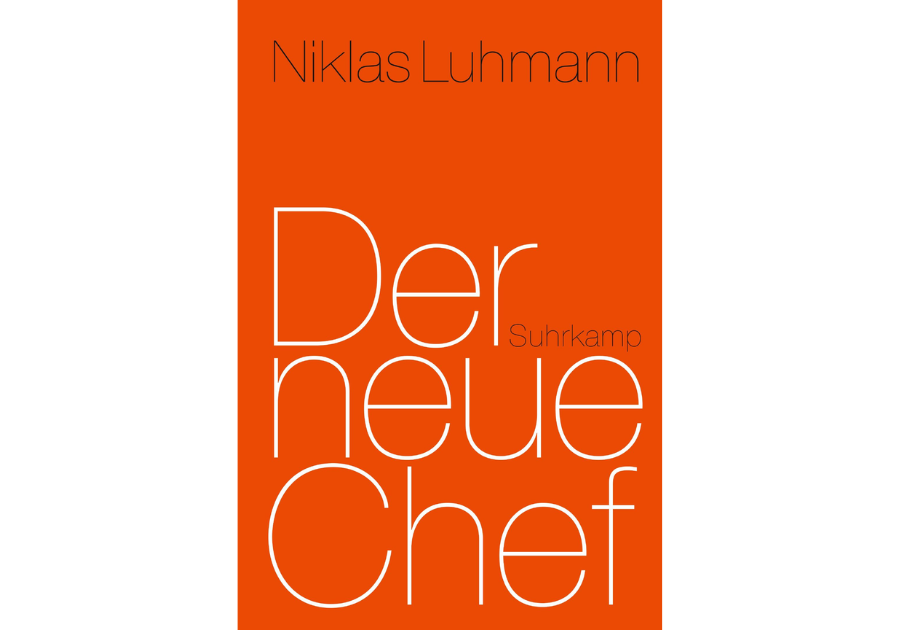
Unser Tipp führt Sie heute ins Büro vom Chef – bitte nicht wegklicken. Sie haben gerade einen neuen Chef bekommen oder sind selbst “Der neue Chef” geworden? Etwa in einem höchstverwalteten Ministerium oder einem lockeren Start-up, bei dem jegliche Struktur fehlt? Niklas Luhmann weiß, was Ihnen nun bevorsteht. Überwältigend präzise und vorsichtig unterhaltsam beschreibt der große Systemtheoretiker die komplexen Beziehungen zwischen dem vorgesetzten Neuling und seinem neuen Team, das bereits über eine Vielfalt an formalen und informalen Rollen und Gruppendynamiken verfügt. “Der neue Chef” klärt auf über die komplexen sozialen und organisatorischen Verhältnisse, die ein Führungswechsel mit sich bringt. Sei es im Verteidigungsministerium oder bei einer Kreuzberger Neugründung.
Buch: Der neue Chef | Autor: Niklas Luhmann | Herausgeber: Jürgen Knaube
Das war’s für heute. Das nächste Late-Night-Memo erhalten Sie am Donnerstagabend.
Good night and good luck!
Der Berlin.Table ist das Late-Night-Memo für die Table.Media-Community.
PS: Wenn Ihnen der Berlin.Table gefällt, empfehlen Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail weitergeleitet wurde: Hier können Sie sich für das Late-Night-Memo kostenlos anmelden.
