der Countdown läuft: KLWG und Agrarpaket hätten eigentlich vor der Sommerpause beschlossen werden sollen. Bislang kann die Ampel-Koalition aber keinen Erfolg verkünden. “Ich würde mal die These wagen, dass wir uns zu sehr mit uns selbst beschäftigen. Und zu wenig damit, dass wir gemeinsam Ergebnisse erzielen”, sagte Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) während des deutschen Ernährungstages am vergangenen Mittwoch zu Table.Briefings.
Aufgegeben hat der Grünen-Politiker beim Kinderlebensmittel-Werbegesetz (KLWG) trotzdem nicht. “Die FDP sagt ja nicht, dass sie grundsätzlich gegen eine Beschränkung von an Kinder gerichtete Werbung für ungesunde Lebensmittel ist.” Der Vorwurf sei lediglich, dass sein Entwurf über die Koalitionsvereinbarung hinausgehe. Er selbst teile diese Einschätzung der FDP allerdings nicht und verhandele deshalb weiter. Er sei der Meinung, dass sich am Ende alle Parteien mit einem Ergebnis profilieren könnten: SPD und Grüne durch Einhaltung ihrer Wahlversprechen. Die FDP mit Durchsetzung einer “schlanken” Koalitionsvereinbarung.
Zähe Verhandlungen zieht weiterhin das Agrarpaket nach sich. “Die Tarifglättung für die Land- und Forstwirtschaft soll aber unabhängig davon kommen und befindet sich auf guten Weg zum Bundestagsbeschluss”, sagt FDP-Finanzpolitiker Christoph Meyer zu Table.Briefings. Die Ampel-Koalition hatte sich ursprünglich darauf verständigt, das Agrarpaket vor der Sommerpause zu verabschieden. Die letzte Möglichkeit dazu wäre Anfang Juli.
Wir wünschen Ihnen eine erkenntnisreiche Lektüre!

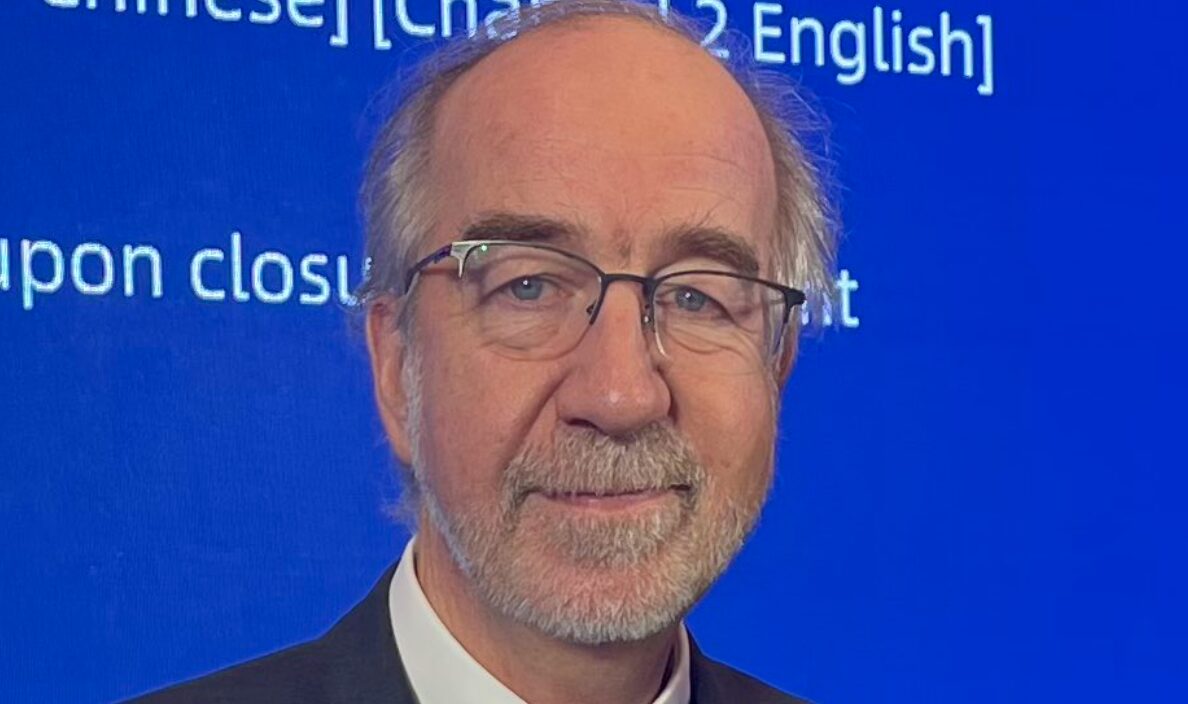
Herr Clarke, warum hat Peking speziell die Schweinefleischindustrie ins Visier genommen? Welche Strategie steckt dahinter?
Peking will ein klares Signal, eine Warnung, senden, dass China Antidumpingzölle auf Schweinefleisch erheben wird, wenn die EU nicht über die Zölle auf Elektrofahrzeuge verhandelt. China hat sich für Schweinefleisch entschieden, weil es der größte landwirtschaftliche Exportartikel der EU nach China ist. Auch wenn die Landwirtschaft nur einen sehr kleinen Teil der Exporte der EU nach China ausmacht, ist sie in der EU politisch sehr sichtbar und lenkt daher die Aufmerksamkeit auf das Problem. Zuvor hatte Peking auch gedroht, möglicherweise Milchprodukte, Wein und sogar Airbus ins Visier zu nehmen.
Warum hat China das nun erstmal nicht gemacht?
Ich bin ehrlicherweise überrascht, dass China nicht Wein ins Visier genommen hat. Denn ein Großteil des Weins kommt aus Frankreich. Und Frankreich stand hinter der Untersuchung mit den Elektrofahrzeugen und hat sie vorangetrieben. Aber vielleicht war der Sektor zu offensichtlich, und es läuft bereits eine Untersuchung zu hauptsächlich französischen Spirituosen. Was Milchprodukte betrifft, exportiert die EU nicht so viel nach China. Sie exportiert allerdings Säuglingsnahrung wie Milchpulver, das die Chinesen wirklich brauchen. Schweinefleisch ist also eine recht praktische Überlegung. Wir sprechen von Exporten im Wert von drei Milliarden Euro. Das wird die Welt nicht verändern und meiner Meinung nach steuert das auch nicht auf einen Handelskrieg hin. China hat sich entschieden, diesen Sektor zu untersuchen, weil das zwar Schaden verursachen und drei oder vier Mitgliedstaaten auf die Elektroauto-Angelegenheit aufmerksam machen, aber keine massiven Schäden, oder zu einem Handelskrieg führen kann. Der Sektor wurde also sehr sorgfältig gewählt.
Halten Sie das für eine gute Strategie der chinesischen Seite?
Ich habe dazu gemischte Gefühle. Ich denke, es ist eine gute Strategie, wenn das Signal lautet: “Wir wollen verhandeln”, was meiner Meinung nach die Absicht ist. Es geht nicht um Rache.
Und wird das funktionieren?
Vielleicht. Die davon betroffenen Länder wären Spanien, die Niederlande und Dänemark als die drei großen Schweinefleisch-Exporteure. Keiner von ihnen scheint besonders starke Eigeninteressen in der Elektroauto-Frage zu haben. Wenn ihre Schweinefleischexporte ins Visier geraten, könnten sie geneigt sein, der Kommission zu sagen, sie solle bitte über Elektroautos verhandeln, aber das wird keine dramatischen Auswirkungen auf den Fall haben. Das Land, das am meisten auf Zölle auf Elektrofahrzeuge gedrängt hat, ist Frankreich. Wenn Peking Vergeltung üben oder bei künftigen Verhandlungen den größtmöglichen Einfluss ausüben will, wäre es besser gewesen, Produkte aus Frankreich oder Deutschland ins Visier zu nehmen, die in der EU im Grunde die Entscheidungen treffen. In dieser Hinsicht ist es also keine brillante Strategie.
Peking schafft sich damit also eher selbst Probleme?
Ich sehe zwei Punkte: Erstens ist es auf lange Sicht nicht sehr klug, Zölle auf Lebensmittel zu erheben. Aus Sicht der Lebensmittelsicherheit ist es ein ziemlich gefährlicher Ansatz, die eigenen Versorgungsquellen zu reduzieren. Zweitens: Diese von China eingeleitete Antidumpinguntersuchung wurde eindeutig aus politischen Gründen durchgeführt. Es gibt kein glaubwürdiges Dumping bei Schweinefleisch, das nach China geht. Das untergräbt die Glaubwürdigkeit Chinas, wenn es zugleich vorgibt, sich dem Multilateralismus verpflichtet zu fühlen und die WTO-Regeln gewissenhaft zu befolgen. Die Tatsache, dass China diese Untersuchung aus politischen Gründen einleitet, untergräbt seine Darstellung vollständig. Es schaden sich langfristig selbst, auch seinem Ruf.
Sie haben gesagt, dass der Schweinefleischsektor sorgfältig ausgewählt wurde, um Verhandlungen anzustoßen, anstatt zu eskalieren. Beide Seiten haben sich am Samstag darauf geeinigt, Verhandlungen über die E-Fahrzeuge aufzunehmen. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass dieser Konflikt durch die Verhandlungen gelöst wird?
Die EU-Verordnung und -Politik in Bezug auf Antisubventionen bieten einen gewissen Verhandlungsspielraum. Wenn die chinesischen Unternehmen bei der Untersuchung kooperieren, kann das zu einem deutlich niedrigeren Antisubventionszoll führen. Und wenn die chinesische Regierung kooperiert und erklärt, was die Subventionen sind und was nicht, wäre das ebenfalls hilfreich.
Die EU kann sich auch dafür entscheiden, das breitere öffentliche Interesse zu berücksichtigen – die EU-Handelsschutzgesetzgebung enthält einen Test auf öffentliches Interesse. Liegt es in unserem Interesse als europäische Gesellschaft oder Wirtschaft, eine Steuer auf chinesische Elektrofahrzeuge zu erheben – ja oder nein? Und wenn die Kommission und die Mitgliedstaaten am Ende des Tages entscheiden, dass wir erschwingliche chinesische grüne Technologie brauchen, um das Netto-Null-Ziel und die grüne Transformation zu unterstützen, können sie beschließen, diese Importe nicht so hoch zu besteuern. Es gibt also erheblichen Verhandlungsspielraum. Ich glaube nicht, dass wir uns wegen Schweinefleisch im Wert von drei Milliarden Euro in einem Handelskrieg befinden. Jedenfalls handelt es sich derzeit nur um eine Untersuchung durch China und noch nicht um die Verhängung von Zöllen.
Wie wahrscheinlich ist es, dass auf die Untersuchung tatsächlich Maßnahmen wie Zölle auf Schweinefleisch folgen?
Das wird von den Gesprächen zum Thema Elektrofahrzeuge abhängen. Wenn es keinen Verhandlungsspielraum mit China gibt oder wenn die chinesischen Unternehmen bei der EU-Untersuchung nicht kooperieren, dann bin ich ziemlich sicher, dass die Chinesen Zölle auf Schweinefleisch erheben werden. Peking hat eine sehr vage Behauptung aufgestellt – für die es bisher keine Beweise gibt -, dass es in Europa illegale Subventionen für den Schweinefleischsektor gibt. Die Chinesen könnten also ebenfalls versuchen, Ausgleichszölle auf die Subventionen zu erheben. Ich bin sicher, dass sie das tun werden, wenn sie mit dem Ergebnis bei den Elektrofahrzeugen nicht zufrieden sind. Und sei es nur, weil sie sonst ihr Gesicht verlieren würden.
Welche Auswirkungen hätten die Schweinefleischzölle auf den EU-Markt? Und welche auf China? Sie haben bereits erwähnt, dass es dort schwierig ist, einige landwirtschaftliche Lebensmittel zu beschaffen.
Kurz- bis mittelfristig wird es Auswirkungen auf den chinesischen Markt haben, weil China diese Produkte braucht. Viele der europäischen Exporte, Dinge wie Köpfe, Füße und Hufe, werden in Europa nicht verwendet, aber die Chinesen kaufen sie. Das bedeutet auch, dass man, um diese Produkte anzubeiten, ein ganzes Schwein produzieren muss. Und China hat möglicherweise nicht die Verbraucherkapazität, um das gesamte Fleisch aufzunehmen, wenn es im Inland produziert wird.
Es bedeutet auch, dass es in Europa vorübergehend Überkapazitäten geben wird, wenn der chinesische Markt für europäische Exporte geschlossen ist. Aber die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass die Schweinefleischindustrie durchaus in der Lage ist, ihren Handel umzulenken und ihre Märkte zu diversifizieren. Das war die Erfahrung der letzten Jahre, beispielsweise nachdem Deutschland aufgrund der Afrikanischen Schweinepest in Deutschland vom chinesischen Markt ausgeschlossen war. Nach ein paar Monaten konnte es das Schweinefleisch tatsächlich an neue Bestimmungsorte liefern.
Könnte die EU bei der Welthandelsorganisation Berufung einlegen? Die WTO wirkt derzeit ein wenig zahnlos.
Wenn die EU feststellt, dass Chinas Antidumpingmaßnahmen mit Chinas WTO-Verpflichtungen unvereinbar sind, könnte die EU China natürlich vor die WTO bringen. Die EU wird darüber anhand einer Reihe von Kriterien entscheiden. Erstens: Geht es um viel Geld? Zweitens: Gibt es ein systemisches Problem, das wir lösen müssen? Und drittens: Werden wir den Fall wahrscheinlich gewinnen? Wenn die EU davon überzeugt ist, dass sie den Fall gewinnen kann, und wenn es sich entweder um einen systemischen Fall handelt, oder wenn er erhebliche kommerzielle Auswirkungen hat, könnte sie durchaus das Streitschlichtungssystem der WTO nutzen. Aber dieses funktioniert sehr langsam. Zwischen der Einleitung eines Verfahrens und seinem Abschluss vergehen ein paar Jahre. In der Zwischenzeit bleiben die Zölle in Kraft. Das ist nicht die ideale Lösung. In solchen Situationen kommt es häufig vor, dass ein WTO-Mitglied mit einer Streitschlichtungsvereinbarung droht und Konsultationen mit dem anderen Land aufnimmt. Dadurch kann man sehen, ob ein Kompromiss gefunden werden kann, der die Notwendigkeit, den ganzen Weg zu gehen und ein Verfahren einzuleiten, überflüssig macht. Und in dieser Situation wäre es wahrscheinlich im Interesse Chinas, wenn seine Antidumpinggesetzgebung nicht systematisch als mit den WTO-Regeln unvereinbar eingestuft würde.
John Clarke war bis Oktober 2023 Direktor für internationale Beziehungen in der Generaldirektion für Landwirtschaft der Europäischen Kommission. Zuvor war er Leiter der EU-Delegation bei der WTO und den Vereinten Nationen in Genf. 1993 kam er als Unterhändler für Handel zur Europäischen Kommission.
Nach dem Eklat zwischen ÖVP und Grünen, den beiden Koalitionspartnern in Österreich, um das “Ja” zum Renaturierungsgesetz in Brüssel, haben die Konservativen rechtliche Schritte angekündigt. Ziel ist es, die Zustimmung der EU im Ministerrat rückgängig zu machen und die zuständige Ministerin Lenore Gewessler einzuschüchtern. Die grüne Umweltministerin hatte gegen den Willen ihres Regierungspartners sowie im Widerspruch zu einem Beschluss der österreichischen Bundesländer dem Gesetzgebungsverfahren am Montag zugestimmt.
Das sind die Schritte, die gegen Gewessler geplant sind:
Experten sind zurückhaltend, ob die ÖVP-Strategie aufgehen könnte. Man betrete hier “juristisches Neuland”, sagt Walter Obwexer, Experte für Europäisches Verfassungsrecht an der Universität Innsbruck. Zur Nichtigkeitsklage gebe es unterschiedliche Ansichten unter Juristen. Mit einer Entscheidung sei frühestens in eineinhalb Jahren zu rechnen. Von einem Amtsmissbrauch sei nicht auszugehen, erklärt Robert Kert, Jurist an der Wirtschaftsuniversität Wien. Die Grünen sehen den rechtlichen Schritten gelassen entgegen. Sie verweisen darauf, dass die ÖVP selbst im Laufe der Koalition immer wieder politische Alleingänge hingelegt habe.
Nehammer will nun nur noch “notwendige und wichtige Maßnahmen” umsetzen, sagte er zur Austria Presse Agentur (APA). Nachdem die ÖVP bereits einige eigene Termine abgesagt hatte, hielt sie den Ministerrat diese Woche nicht in Präsenz, sondern im Umlaufverfahren ab. Am 21. Juni boykottierten zudem alle fünf von der ÖVP gestellten Energielandesräte ein Treffen mit Leonore Gewessler. Ihnen missfällt der Alleingang der Umweltministerin, es fehle das Vertrauen.
Nach dem Coup der Grünen-Ministerin hatte die ÖVP vor Wut geschäumt. Am Abend des Tages war Nehammer vor die Kameras getreten: Gewessler habe “rechtswidrig” gehandelt und einen “mehr als schweren Vertrauensbruch” begangen. Rechtsgutachten des Verfassungsdienstes im Bundeskanzleramt und des ÖVP-geführten Landwirtschaftsministeriums würden dies belegen.
Gewessler wiederum stützt sich auf vier private Rechtsgutachten (siehe hier, hier, hier und hier). Diese bescheinigen ihr mehr oder weniger freies Stimmrecht. So sei etwa die einheitlich ablehnende Stellungnahme der Bundesländer nicht mehr gültig, da sich diese auf eine veraltete Version des Gesetzes beziehe. Zudem habe mittlerweile das SPÖ-regierte Bundesland Wien die Zustimmung zum Gesetz beschlossen. Auch das SPÖ-regierte Kärnten hat diesen Schritt vor. Naturschutz ist in Österreich zwar Ländersache. Gewessler kann aber laut Verfassung aus “zwingenden integrations- und außenpolitischen Gründen” von einer einheitlichen Stellungnahme der Bundesländer abweichen.
Dem Getöse zum Trotz will die Koalition weitermachen. Neuwahlen werde es keine geben, erklären ÖVP und Grüne. Am 29. September wird in Österreich ohnehin gewählt. Die ÖVP liegt in Umfragen hinter der rechtspopulistischen FPÖ und gleichauf mit der SPÖ bei rund 22 Prozent. Ihre Chancen, auch wieder den nächsten Kanzler zu stellen, sind also begrenzt. Zudem stehen für die ÖVP in den nächsten Wochen wichtige Gesetze zur Abstimmung – etwa zur Asylberatung, zur Handysicherstellung und im Justizbereich. Die Verabschiedung will man nicht gefährden. Auch die Grünen würden bei Neuwahlen an Macht einbüßen.
Die Vertrauenskrise in Österreich sitzt tief. Misstrauen zu säen sei politische Strategie geworden, werfen Kritiker den konservativen und rechten Parteien vor. Seit Monaten verbreiteten EVP und ÖVP Falschinformationen zum Renaturierungsgesetz, wie etwa 6.000 Forschende in einem Offenen Brief bemängelten. Einige der Vorwürfe:
Auch zu anderen Themen verbreitet die ÖVP Desinformation, frisierte Umfragen, und erstellte Rechnungen, die sich später als nicht seriös erwiesen. “Flooding the zone with shit” nennt sich diese PR-Strategie. So wird Desinformation salonfähig. Die ÖVP erzielt kurzfristige Erfolge, schadet aber langfristig der Demokratie. Laut Vertrauensindex der APA gibt es nur vier Bundespolitiker, denen die Bürger mehr Vertrauen attestieren als Misstrauen. Gewessler und Nehammer schneiden besonders schlecht ab.
Auch das Vertrauen von Jugendlichen in die Politik sinkt, die Wissenschaftsskepsis ist weiter stark ausgeprägt. 38 Prozent der Befragten verlassen sich lieber auf ihren gesunden Menschenverstand, nur 58 Prozent vertrauen der Ökologie- und Klimaforschung, zeigt das Wissenschaftsbarometer der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Von dieser Skepsis lebt die FPÖ, die seit mehr als einem Jahr alle Umfragen anführt.
Wenige Tage, bevor Ungarn den Vorsitz im EU-Ministerrat übernimmt, will die scheidende belgische Ratspräsidentschaft zur Deregulierung neuer Gentechniken (NGT) noch einen letzten Einigungsversuch unternehmen. Am Mittwoch wollen die Belgier den EU-Botschaftern einen Kompromissvorschlag vorlegen, ist aus Diplomatenkreisen zu hören. Demnach reichte die Zeit nicht, um das Thema schon am Montag auf die Agenda des EU-Agrarrats zu setzen. Es ist die letzte reguläre Sitzung der zuständigen Botschafter vor dem Ende der Präsidentschaft.
Bei dem jüngsten Entwurf, der Table.Briefings vorliegt, handelt es sich um eine abgewandelte Version des Kompromisses von Ende Mai, mit dem die Belgier keinen Durchbruch erzielt hatten. Statt, wie damals vorgesehen, den NGT-1-Status einer Pflanze an den Verzicht auf jegliche Patente hierauf zu knüpfen, sollen die jeweiligen Unternehmen jetzt nur noch auf Produktpatente verzichten. Verfahrenspatente, mit denen zum Beispiel die gentechnischen Methoden zur Herstellung einer Pflanze geschützt werden, wären weiter möglich. Zudem soll die Verzichtserklärung nur verlangt werden, wenn eine Pflanze vermarktet wird, und nicht, solange sie zu Forschungszwecken angebaut wird. Gleichzeitig soll die Europäische Kommission aufgefordert werden, einen Leitfaden zu Patenten und geistigem Eigentum vorzulegen.
Mehrere mit der Angelegenheit vertraute Quellen schätzen die Erfolgsaussichten des Einigungsversuchs als eher gering ein. Als entscheidender Faktor gilt weiterhin eine Zustimmung Polens. Das Land hat öffentlich signalisiert, die Zeit bis Mittwoch sei zu knapp, um den neuen Vorschlag zu prüfen.
Schwenkt Warschau nicht um, müssten die Belgier mehrere kleinere Länder überzeugen, um die nötige Mehrheit zu erreichen. Das gilt aber als schwierig, ohne dabei wiederum bisherige Befürworter zu verprellen. Gelingt am Mittwoch keine Einigung, könnte sich das Dossier deutlich verzögern. Die ungarische Ratspräsidentschaft hat sich in ihrem Arbeitsprogramm zwar vorgenommen, hieran weiterzuarbeiten. Weil Ungarn der Deregulierung neuer Gentechniken jedoch selbst kritisch gegenüber steht, wird erwartet, dass das Land das Thema mit weniger Elan vorantreibt, als die Belgier und zuvor die Spanier. jd
Bei ihrem letzten EU-Agrarministertreffen am Montag hat die belgische Ratspräsidentschaft den Zwischenstand der Gespräche zu mehreren Gesetzesvorschlägen vorgestellt. Dem aktuellen Verhandlungsstand nach schlagen die Minister bei der EU-Saatgutverordnung einen entgegengesetzten Kurs zum Europäischen Parlament ein. Sie wollen Ausnahmen im Vergleich zum ursprünglichen Kommissionsvorschlag einschränken. So sollen Ausnahmen für sogenannte Erhaltungssorten auf alte Sorten beschränkt werden, um Schlupflöcher für Neuzüchtungen zu vermeiden. Auch für den Austausch kleiner Mengen an Saatgut zwischen Landwirten wollen die Minister Ausnahmeregelungen enger fassen.
Damit ginge der Rat auf Züchterverbände zu, die vor phytosanitären Risiken warnen, wenn bestimmtes Saatgut und Pflanzenmaterial von Kontrollen und Anforderungen ausgenommen wird. Das Parlament hatte in seiner Verhandlungsposition im April dagegen gefordert, die Ausnahmen auszuweiten. Letzteres unterstützen Kleinbauern- und Bio-Verbände.
Bis der Ministerrat tatsächlich seine Position zu dem Vorschlag annimmt, könnte es aber noch dauern. Wegen der Komplexität des Dossiers – immerhin zehn verschiedene bestehende Rechtsakte werden darin zusammengefasst und reformiert – strebt auch Ungarn, das von Juli bis Dezember die Ratspräsidentschaft übernimmt, während seiner Amtszeit noch keine Einigung an.
Kaum vorangekommen ist die belgische Präsidentschaft derweil beim Vorschlag zum Tierschutz bei Lebendtransporten, den die Europäische Kommission Anfang Dezember zusammen mit einem Gesetz zum Schutz von Hunden und Katzen vorgelegt hatte. Die belgische Präsidentschaft entschied sich, vorrangig die Arbeit am recht unstrittigen Haustierthema voranzutreiben. Zum Vorschlag zu Tiertransporten, der als deutlich kontroverser gilt, ist demnach noch nicht einmal die erste Prüfung durch die zuständige Arbeitsgruppe abgeschlossen. Auch hier sieht die ungarische Präsidentschaft keine Einigung vor.
Bei ihrem Treffen wollten die EU-Agrarminister auch eine Erklärung zur Zukunft der europäischen Landwirtschaft verabschieden. Darin steht, Umwelt- und Klimaschutz vor allem durch Anreize voranzutreiben. Obwohl der Text kaum ins Detail geht, konnte er nicht einstimmig verabschiedet werden. Widerstand kam aus Rumänien und der Slowakei. Streitpunkt war eine Formulierung zur externen Konvergenz. Dieser Mechanismus dient dazu, die Höhe der Direktzahlungen in verschiedenen EU-Ländern stetig anzugleichen. jd
In der Studie “The Grounds for sharing. A Study of Value Distribtion in the coffee industry” untersuchte das unabhängige Bureau d’Analyse Sociétale d’Internet Collectif (BASIC) erstmals, wie sich entlang der Kaffee-Wertschöpfungskette die Kosten, Steuern und Nettogewinnspannen von Landwirten bis zu Einzelhändlern verteilen. Die Autoren analysierten vier der sechs größten Erzeugerländer (Brasilien, Kolumbien, Äthiopien und Vietnam) sowie als Absatzmarkt Deutschland, den größten Kaffeemarkt Europas. Beauftragt wurde die Studie vom Branchenverband Global Coffee Platform (GCP), der Nachhaltigkeitsinitiative IDH und der NGO Solidaridad.
Die Autoren stellten öffentlich zugängliche Daten zusammen und ergänzten diese mit Befragungen und Konsultationen. Ihre zentralen Ergebnisse:
Auf den ersten Blick erscheint der anteilige Nettoprofit der Kaffeebauern überraschend hoch. Das liegt allerdings daran, dass deren Kosten unzureichend erfasst sind. Denn die Mitarbeit von Familienmitgliedern werde “weder bezahlt” noch einberechnet, heißt es in der Studie. Deswegen “erscheinen die Gewinnmargen der Kleinbäuerinnen vermeintlich höher”. Damit werde das Problem verschleiert, denn der Großteil der Kosten der Kleinbauern entfällt auf die unbezahlte Familienarbeit.
Die Studie erfasst 41 Kaffeeprodukte mit einem Umsatz von drei Milliarden Euro, darunter gemahlenen Kaffee, ganze Bohnen, Softpads und Kapseln. Auch unterschiedliche Anbauweisen – konventionell und zertifiziert nach Kriterien der Rainforest Alliance und Fairtrade – wurden berücksichtigt.
Weltweit bauen 12,5 Millionen Bauern Kaffee an, davon bewirtschaften 70 Prozent Flächen von weniger als fünf Hektar, womit sie als Kleinbauern gelten. Die derzeitige Verteilung der Wertschöpfung mache die Kaffeeproduktion für die meisten Kaffeebauern “wirtschaftlich unrentabel“, sagt die Geschäftsführerin der Global Coffee Platform, Annette Pensel. Diese Ungleichverteilung “lähmt das Bestreben der Kaffeeindustrie”, nachhaltig zu werden. Wer als Bauer für zertifizierte Lieferketten arbeitet, erzielt ein höheres Einkommen als in nicht zertifizierten Lieferketten.
Viele importierende Unternehmen bekennen sich dazu, die Einkommen von Kleinbauern zu erhöhen, etwa Tchibo durch den Ausbau der nachhaltigen Kaffeebeschaffung. Solche Bemühungen seien wichtig, heißt es in der Studie. Allerdings müsse die Wertschöpfung selbst gerechter verteilt werden, indem der Sektor sich zu entsprechenden Beschaffungspraktiken verpflichte. Tessa Meulensteen, Direktorin Agri-Commidities von IDH, schlägt Partnerschaften vor, um “die Schaffung und den Transfer von Werten zu entwickeln und umzusetzen”. Das dürfte Unternehmen auch bei der Einhaltung der Sorgfaltspflichten helfen, die von Lieferkettengesetzen vorgeschrieben werden. cd
Das Qualitätsmanagement-Tool “Unser Schulessen”, das Mittagessen in Kita und Schule gesünder gestalten soll, wird vom Nationalen Qualitätszentrum für Ernährung in Kita und Schule (NQZ) nun bundesweit ausgebaut. Auf der digitalen Arbeitsplattform können Bildungseinrichtungen ihre aktuellen Speisepläne eintragen und auswerten lassen. Die Kriterien dazu wurden aus dem “DGE-Qualitätsstandard für die Verpflegung in Schulen” abgeleitet. Das Tool bietet allen Nutzern – von der Schulleitung bis zu den Schülerinnen und Schülern – einen Überblick über die aktuelle Qualität. Erprobt wurde die Plattform bereits in Brandenburg und Rheinland-Pfalz.
“Jedes Kind in Deutschland muss die Chance haben, gesund aufzuwachsen“, sagt Cem Özdemir, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, anlässlich des Ausbaus der Plattform. Wichtig sei, dass das Essen den Kindern schmecke. “Das Qualitätsmanagement-Tool ,Unser Schulessen’ rückt ihre Bedürfnisse in den Fokus und lässt sie ihre Schulverpflegung aktiv mitgestalten”, so Özdemir.
Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft stellt eine Finanzierung des Angebots auf maximal drei Jahre in Aussicht, sagt Wiebke Kottenkamp, Leiterin des NQZ, zu Table.Briefings. “Der Auftrag ist zunächst für zwei Jahre geschlossen und kann bei Bedarf um ein weiteres Jahr verlängert werden. Insgesamt stehen dafür bis zu 850.000 Euro zur Verfügung.”
Schulen können sich bei dem Tool kostenlos anmelden und auch Partner wie Caterer zur Nutzung einladen. Auf der Plattform lassen sich dann Stammdaten der Schule wie die Schülerzahl und der Essenspreis speichern und je nach Bedarf anpassen. Zudem bietet das Tool, die Möglichkeit, Umfragen zu erstellen, und macht Vorschläge, wie das Essen nachhaltiger und gesünder gestaltet werden kann. Außerdem gibt es Hintergrundinfos und Materialien, um Ernährung im Unterricht oder Ganztag zu thematisieren. vkr
25.06.2024 – 19.00 – 20.30 Uhr / Berlin
Veranstaltung NABUsalon “125 Jahre NABU”
Der NABU ist Deutschlands ältester und größter Umweltverband mit über 940.000 Mitgliedern. Er setzt sich aktiv für den Naturschutz ein und engagiert sich für Artenvielfalt, Lebensraumschutz und eine nachhaltige Zukunft. Bundesumweltministerin Steffi Lemke hält beim NABUsalon “125 Jahre NABU: Naturschutz verbindet – ohne Grenzen!” eine Rede. INFO
25.06.2024 / Oslo
Forum Oslo Tropical Forest Forum
Das Oslo Tropical Forest Forum ist eine globale Konferenz, die Ministerinnen und Minister, politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, multilaterale Institutionen, zivilgesellschaftliche Organisationen, indigene Völker und den Privatsektor zusammenbringt, um Maßnahmen zum Schutz der tropischen Wälder voranzutreiben. Bundesumweltministerin Steffi Lemke nimmt an dem Tropical Forest Forums und Trandheim Ministerial Dialouges teil. INFO
26.06.2024 / Berlin
Table.Media Sommerfest
26.06. – 27.06.2024 / Messe Cottbus
DBV Veranstaltung Deutscher Bauerntag 2024
Auf dem Deutschen Bauerntag 2024 wird darüber diskutiert, wie sich die Landwirtschaft von heute mit viel Innovation und Unternehmergeist weiterentwickeln kann und welche Lösungen es für die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit der Branche gibt. PROGRAMM
30.06.2024 – 09.00 – 18.00 Uhr / Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf
100 Jahre Demeter 100 Jahre biodynamisch
Schon vor 100 Jahren wurde der Grundstein der biodynamischen Landwirtschaft gelegt. Seither setzen Demeter-Mitglieder immer wieder wichtige Impulse für eine Landwirtschaft im Einklang mit der Natur und den Ökolandbau insgesamt. Sie haben nachhaltige Lösungen für die großen Herausforderungen unserer Zeit entwickelt wie die Klimakatastrophe und das Artensterben: regionale, bäuerliche Landwirtschaft, Klimaschutz und -anpassung, eine unabhängige Züchtung, der Schutz des Bodens als einer unserer wichtigsten Ressourcen und der Verzicht auf Gentechnik. INFO
03.07.2024 / Berlin
Sitzungswoche Bundestag Kabinettsitzung
Auf der Tagesordnung steht die Beratung über den Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2024 Tagesordnung
10.07.2024 11.00 – 12.00 Uhr/ online
Diskussion digital talk: Regional is(s)t besser?
Viele Verbraucher wünschen sich mehr Heimat auf dem Teller. Doch wie können Gastro-Profis von der Sehnsucht der Gäste nach Produkten vom Bauernhof um die Ecke profitieren? Und wie definiert man “Aus der Region”? Welche Bezugsquellen gibt es für regionales Gemüse, Fleisch oder Obst? Und ist das Schnitzel von Bauer Heinz tatsächlich nachhaltiger? INFO & ANMELDUNG
10.07.2024 / Grub, Bayern
Seminar 1. Süddeutsches Agri-PV-Forum
Das 1. Süddeutsche Agri-PV-Forum 2024 findet als Kooperationsveranstaltung von LandSchafftEnergie+ am Technologie- und Förderzentrum und den Bayerischen Staatsgütern am Standort Grub statt. Informieren, vernetzen, besichtigen – bei der Veranstaltung in Grub werden aktuelle Entwicklungen, rechtliche Aspekte und Praxisbeispiele im Bereich Agri-Photovoltaik (Agri-PV) vorgestellt. Anmeldung bis 03.07.2024 INFO & ANMELDUNG
Financial Times: Deforestation: US urges EU to delay deforestation law
Die US-Handels- und Landwirtschaftsminister Gina Raimondo und Thomas Vilsack sowie die Handelsbeauftragte Katherine Tai haben die EU aufgefordert, das Inkrafttreten der Verordnung zu entwaldungsfreien Lieferketten zu verschieben. Das geplante Importverbot von Produkten wie Kakao, Holz und Sanitärartikeln, die zur Abholzung beitragen, würde US-amerikanischen Produzenten schaden und sie vor “kritische Herausforderungen” stellen. In den USA sind vor allem die Holz-, Papier- und Zellstoffindustrie betroffen. Auch innerhalb der EU mehrten sich zuletzt die Forderungen, das Inkrafttreten der neuen Regeln aufzuschieben. Zum Artikel
AGRA Europe: Niederländische BBB wird Teil der EVP
Die niederländische Bauer-Bürger-Bewegung (BBB), die als EU-skeptisch gilt, wird sich der Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP) anschließen. Ihre beiden Abgeordneten, Sander Schmit und Jessika van Leeuwen, werden aber voraussichtlich keinen Platz im Landwirtschaftsausschuss erhalten. Gerüchte um eine mögliche Zusammenlegung des Landwirtschafts- und Fischereiausschusses sind derzeit noch nicht bestätigt. Die Fraktionsbildung im Europaparlament schreitet voran, wobei die EVP die größte Fraktion bleibt, gefolgt von den Sozialdemokraten (S&D) und den EU-skeptischen Europäischen Konservativen (EKR). Die rechtspopulistische Fraktion Identität und Demokratie (ID) liegt erstmals vor den Grünen/EFA. Zum Artikel
Euronews: Commission reintroduces tariffs on Ukraine’s oat and eggs, eyeing sugar next
Die EU hat Zölle auf ukrainischen Hafer und Eier wiedereingeführt, nachdem die Importe beider Produkte die zuletzt festgelegten Schwellenwerte überschritten hatten. Die seit dem 6. Juni geltende vorübergehende Zollliberalisierung für die Ukraine beinhaltet einen automatischen Schutzmechanismus, bei dem Zölle wieder greifen, wenn Importe für eine Reihe “sensibler” Produktgruppen bestimmte Mengen überschreiten. Auch für Zucker könnte der Mechanismus bald greifen. Daten der Europäischen Kommission zufolge überschreiten die Importe bereits den Schwellenwert. Der europäische Lebensmittel- und Getränkesektor ist jedoch besorgt über mögliche Engpässe, sollten Zölle auf Zucker anfallen, da die Ukraine 65 Prozent ihres Zuckers in die EU exportiert. Zum Artikel
Politico: EU approved Slovak law to kill bears in return for nature vote, minister claims
Der slowakische Vizepremier Tomáš Taraba hat nach eigener Darstellung seine entscheidende Stimme für das EU-Naturwiederherstellungsgesetz als Teil eines Kuhhandels mit der Europäischen Kommission abgegeben. Diese habe ihm im Gegenzug zugesagt, ein slowakisches Gesetz über Notfallgenehmigungen zur Tötung von Bären nicht zu stoppen. Tatsächlich hatte EU-Umweltkommissar Virginijus Sinkevičius in einem Schreiben wenige Tage vor der Abstimmung zum Renaturierungsgesetz seine vorläufige Unterstützung für das slowakische Bärengesetz angedeutet. Einen Zusammenhang streitet die Europäische Kommission ab. Umweltschützer und Rechtsexperten sehen in dem slowakischen Gesetz einen möglichen Verstoß gegen EU-Regeln zum Wildtierschutz. Zum Artikel
der Countdown läuft: KLWG und Agrarpaket hätten eigentlich vor der Sommerpause beschlossen werden sollen. Bislang kann die Ampel-Koalition aber keinen Erfolg verkünden. “Ich würde mal die These wagen, dass wir uns zu sehr mit uns selbst beschäftigen. Und zu wenig damit, dass wir gemeinsam Ergebnisse erzielen”, sagte Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) während des deutschen Ernährungstages am vergangenen Mittwoch zu Table.Briefings.
Aufgegeben hat der Grünen-Politiker beim Kinderlebensmittel-Werbegesetz (KLWG) trotzdem nicht. “Die FDP sagt ja nicht, dass sie grundsätzlich gegen eine Beschränkung von an Kinder gerichtete Werbung für ungesunde Lebensmittel ist.” Der Vorwurf sei lediglich, dass sein Entwurf über die Koalitionsvereinbarung hinausgehe. Er selbst teile diese Einschätzung der FDP allerdings nicht und verhandele deshalb weiter. Er sei der Meinung, dass sich am Ende alle Parteien mit einem Ergebnis profilieren könnten: SPD und Grüne durch Einhaltung ihrer Wahlversprechen. Die FDP mit Durchsetzung einer “schlanken” Koalitionsvereinbarung.
Zähe Verhandlungen zieht weiterhin das Agrarpaket nach sich. “Die Tarifglättung für die Land- und Forstwirtschaft soll aber unabhängig davon kommen und befindet sich auf guten Weg zum Bundestagsbeschluss”, sagt FDP-Finanzpolitiker Christoph Meyer zu Table.Briefings. Die Ampel-Koalition hatte sich ursprünglich darauf verständigt, das Agrarpaket vor der Sommerpause zu verabschieden. Die letzte Möglichkeit dazu wäre Anfang Juli.
Wir wünschen Ihnen eine erkenntnisreiche Lektüre!

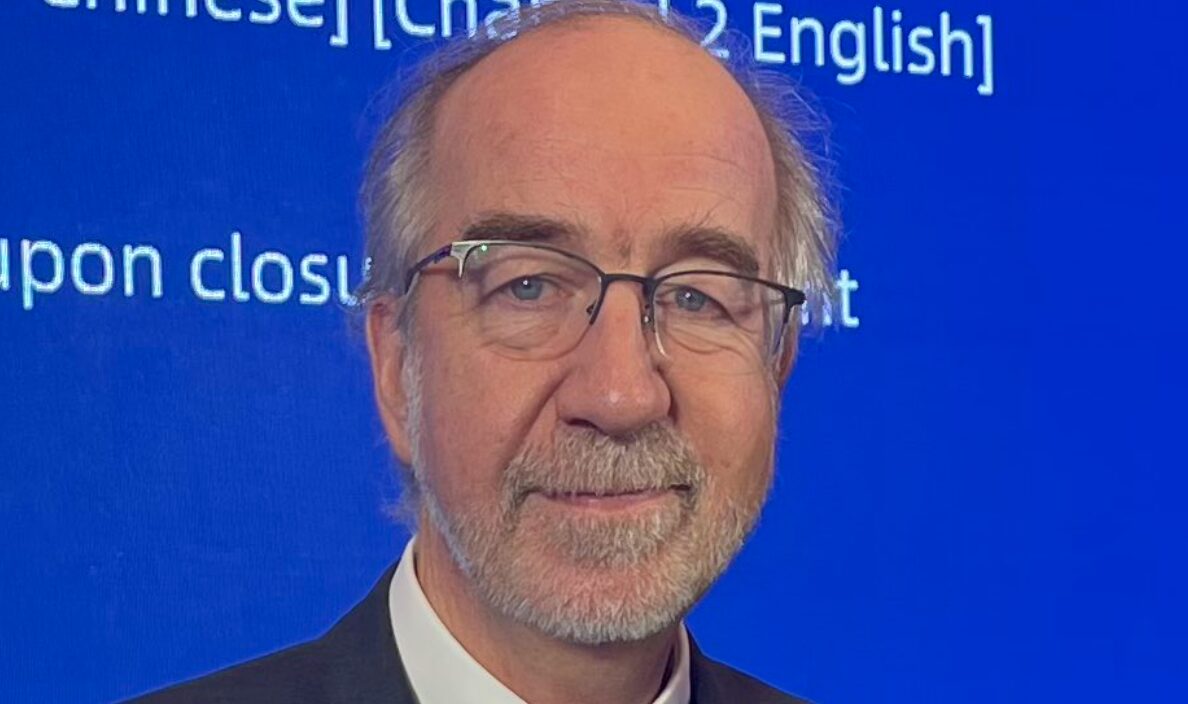
Herr Clarke, warum hat Peking speziell die Schweinefleischindustrie ins Visier genommen? Welche Strategie steckt dahinter?
Peking will ein klares Signal, eine Warnung, senden, dass China Antidumpingzölle auf Schweinefleisch erheben wird, wenn die EU nicht über die Zölle auf Elektrofahrzeuge verhandelt. China hat sich für Schweinefleisch entschieden, weil es der größte landwirtschaftliche Exportartikel der EU nach China ist. Auch wenn die Landwirtschaft nur einen sehr kleinen Teil der Exporte der EU nach China ausmacht, ist sie in der EU politisch sehr sichtbar und lenkt daher die Aufmerksamkeit auf das Problem. Zuvor hatte Peking auch gedroht, möglicherweise Milchprodukte, Wein und sogar Airbus ins Visier zu nehmen.
Warum hat China das nun erstmal nicht gemacht?
Ich bin ehrlicherweise überrascht, dass China nicht Wein ins Visier genommen hat. Denn ein Großteil des Weins kommt aus Frankreich. Und Frankreich stand hinter der Untersuchung mit den Elektrofahrzeugen und hat sie vorangetrieben. Aber vielleicht war der Sektor zu offensichtlich, und es läuft bereits eine Untersuchung zu hauptsächlich französischen Spirituosen. Was Milchprodukte betrifft, exportiert die EU nicht so viel nach China. Sie exportiert allerdings Säuglingsnahrung wie Milchpulver, das die Chinesen wirklich brauchen. Schweinefleisch ist also eine recht praktische Überlegung. Wir sprechen von Exporten im Wert von drei Milliarden Euro. Das wird die Welt nicht verändern und meiner Meinung nach steuert das auch nicht auf einen Handelskrieg hin. China hat sich entschieden, diesen Sektor zu untersuchen, weil das zwar Schaden verursachen und drei oder vier Mitgliedstaaten auf die Elektroauto-Angelegenheit aufmerksam machen, aber keine massiven Schäden, oder zu einem Handelskrieg führen kann. Der Sektor wurde also sehr sorgfältig gewählt.
Halten Sie das für eine gute Strategie der chinesischen Seite?
Ich habe dazu gemischte Gefühle. Ich denke, es ist eine gute Strategie, wenn das Signal lautet: “Wir wollen verhandeln”, was meiner Meinung nach die Absicht ist. Es geht nicht um Rache.
Und wird das funktionieren?
Vielleicht. Die davon betroffenen Länder wären Spanien, die Niederlande und Dänemark als die drei großen Schweinefleisch-Exporteure. Keiner von ihnen scheint besonders starke Eigeninteressen in der Elektroauto-Frage zu haben. Wenn ihre Schweinefleischexporte ins Visier geraten, könnten sie geneigt sein, der Kommission zu sagen, sie solle bitte über Elektroautos verhandeln, aber das wird keine dramatischen Auswirkungen auf den Fall haben. Das Land, das am meisten auf Zölle auf Elektrofahrzeuge gedrängt hat, ist Frankreich. Wenn Peking Vergeltung üben oder bei künftigen Verhandlungen den größtmöglichen Einfluss ausüben will, wäre es besser gewesen, Produkte aus Frankreich oder Deutschland ins Visier zu nehmen, die in der EU im Grunde die Entscheidungen treffen. In dieser Hinsicht ist es also keine brillante Strategie.
Peking schafft sich damit also eher selbst Probleme?
Ich sehe zwei Punkte: Erstens ist es auf lange Sicht nicht sehr klug, Zölle auf Lebensmittel zu erheben. Aus Sicht der Lebensmittelsicherheit ist es ein ziemlich gefährlicher Ansatz, die eigenen Versorgungsquellen zu reduzieren. Zweitens: Diese von China eingeleitete Antidumpinguntersuchung wurde eindeutig aus politischen Gründen durchgeführt. Es gibt kein glaubwürdiges Dumping bei Schweinefleisch, das nach China geht. Das untergräbt die Glaubwürdigkeit Chinas, wenn es zugleich vorgibt, sich dem Multilateralismus verpflichtet zu fühlen und die WTO-Regeln gewissenhaft zu befolgen. Die Tatsache, dass China diese Untersuchung aus politischen Gründen einleitet, untergräbt seine Darstellung vollständig. Es schaden sich langfristig selbst, auch seinem Ruf.
Sie haben gesagt, dass der Schweinefleischsektor sorgfältig ausgewählt wurde, um Verhandlungen anzustoßen, anstatt zu eskalieren. Beide Seiten haben sich am Samstag darauf geeinigt, Verhandlungen über die E-Fahrzeuge aufzunehmen. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass dieser Konflikt durch die Verhandlungen gelöst wird?
Die EU-Verordnung und -Politik in Bezug auf Antisubventionen bieten einen gewissen Verhandlungsspielraum. Wenn die chinesischen Unternehmen bei der Untersuchung kooperieren, kann das zu einem deutlich niedrigeren Antisubventionszoll führen. Und wenn die chinesische Regierung kooperiert und erklärt, was die Subventionen sind und was nicht, wäre das ebenfalls hilfreich.
Die EU kann sich auch dafür entscheiden, das breitere öffentliche Interesse zu berücksichtigen – die EU-Handelsschutzgesetzgebung enthält einen Test auf öffentliches Interesse. Liegt es in unserem Interesse als europäische Gesellschaft oder Wirtschaft, eine Steuer auf chinesische Elektrofahrzeuge zu erheben – ja oder nein? Und wenn die Kommission und die Mitgliedstaaten am Ende des Tages entscheiden, dass wir erschwingliche chinesische grüne Technologie brauchen, um das Netto-Null-Ziel und die grüne Transformation zu unterstützen, können sie beschließen, diese Importe nicht so hoch zu besteuern. Es gibt also erheblichen Verhandlungsspielraum. Ich glaube nicht, dass wir uns wegen Schweinefleisch im Wert von drei Milliarden Euro in einem Handelskrieg befinden. Jedenfalls handelt es sich derzeit nur um eine Untersuchung durch China und noch nicht um die Verhängung von Zöllen.
Wie wahrscheinlich ist es, dass auf die Untersuchung tatsächlich Maßnahmen wie Zölle auf Schweinefleisch folgen?
Das wird von den Gesprächen zum Thema Elektrofahrzeuge abhängen. Wenn es keinen Verhandlungsspielraum mit China gibt oder wenn die chinesischen Unternehmen bei der EU-Untersuchung nicht kooperieren, dann bin ich ziemlich sicher, dass die Chinesen Zölle auf Schweinefleisch erheben werden. Peking hat eine sehr vage Behauptung aufgestellt – für die es bisher keine Beweise gibt -, dass es in Europa illegale Subventionen für den Schweinefleischsektor gibt. Die Chinesen könnten also ebenfalls versuchen, Ausgleichszölle auf die Subventionen zu erheben. Ich bin sicher, dass sie das tun werden, wenn sie mit dem Ergebnis bei den Elektrofahrzeugen nicht zufrieden sind. Und sei es nur, weil sie sonst ihr Gesicht verlieren würden.
Welche Auswirkungen hätten die Schweinefleischzölle auf den EU-Markt? Und welche auf China? Sie haben bereits erwähnt, dass es dort schwierig ist, einige landwirtschaftliche Lebensmittel zu beschaffen.
Kurz- bis mittelfristig wird es Auswirkungen auf den chinesischen Markt haben, weil China diese Produkte braucht. Viele der europäischen Exporte, Dinge wie Köpfe, Füße und Hufe, werden in Europa nicht verwendet, aber die Chinesen kaufen sie. Das bedeutet auch, dass man, um diese Produkte anzubeiten, ein ganzes Schwein produzieren muss. Und China hat möglicherweise nicht die Verbraucherkapazität, um das gesamte Fleisch aufzunehmen, wenn es im Inland produziert wird.
Es bedeutet auch, dass es in Europa vorübergehend Überkapazitäten geben wird, wenn der chinesische Markt für europäische Exporte geschlossen ist. Aber die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass die Schweinefleischindustrie durchaus in der Lage ist, ihren Handel umzulenken und ihre Märkte zu diversifizieren. Das war die Erfahrung der letzten Jahre, beispielsweise nachdem Deutschland aufgrund der Afrikanischen Schweinepest in Deutschland vom chinesischen Markt ausgeschlossen war. Nach ein paar Monaten konnte es das Schweinefleisch tatsächlich an neue Bestimmungsorte liefern.
Könnte die EU bei der Welthandelsorganisation Berufung einlegen? Die WTO wirkt derzeit ein wenig zahnlos.
Wenn die EU feststellt, dass Chinas Antidumpingmaßnahmen mit Chinas WTO-Verpflichtungen unvereinbar sind, könnte die EU China natürlich vor die WTO bringen. Die EU wird darüber anhand einer Reihe von Kriterien entscheiden. Erstens: Geht es um viel Geld? Zweitens: Gibt es ein systemisches Problem, das wir lösen müssen? Und drittens: Werden wir den Fall wahrscheinlich gewinnen? Wenn die EU davon überzeugt ist, dass sie den Fall gewinnen kann, und wenn es sich entweder um einen systemischen Fall handelt, oder wenn er erhebliche kommerzielle Auswirkungen hat, könnte sie durchaus das Streitschlichtungssystem der WTO nutzen. Aber dieses funktioniert sehr langsam. Zwischen der Einleitung eines Verfahrens und seinem Abschluss vergehen ein paar Jahre. In der Zwischenzeit bleiben die Zölle in Kraft. Das ist nicht die ideale Lösung. In solchen Situationen kommt es häufig vor, dass ein WTO-Mitglied mit einer Streitschlichtungsvereinbarung droht und Konsultationen mit dem anderen Land aufnimmt. Dadurch kann man sehen, ob ein Kompromiss gefunden werden kann, der die Notwendigkeit, den ganzen Weg zu gehen und ein Verfahren einzuleiten, überflüssig macht. Und in dieser Situation wäre es wahrscheinlich im Interesse Chinas, wenn seine Antidumpinggesetzgebung nicht systematisch als mit den WTO-Regeln unvereinbar eingestuft würde.
John Clarke war bis Oktober 2023 Direktor für internationale Beziehungen in der Generaldirektion für Landwirtschaft der Europäischen Kommission. Zuvor war er Leiter der EU-Delegation bei der WTO und den Vereinten Nationen in Genf. 1993 kam er als Unterhändler für Handel zur Europäischen Kommission.
Nach dem Eklat zwischen ÖVP und Grünen, den beiden Koalitionspartnern in Österreich, um das “Ja” zum Renaturierungsgesetz in Brüssel, haben die Konservativen rechtliche Schritte angekündigt. Ziel ist es, die Zustimmung der EU im Ministerrat rückgängig zu machen und die zuständige Ministerin Lenore Gewessler einzuschüchtern. Die grüne Umweltministerin hatte gegen den Willen ihres Regierungspartners sowie im Widerspruch zu einem Beschluss der österreichischen Bundesländer dem Gesetzgebungsverfahren am Montag zugestimmt.
Das sind die Schritte, die gegen Gewessler geplant sind:
Experten sind zurückhaltend, ob die ÖVP-Strategie aufgehen könnte. Man betrete hier “juristisches Neuland”, sagt Walter Obwexer, Experte für Europäisches Verfassungsrecht an der Universität Innsbruck. Zur Nichtigkeitsklage gebe es unterschiedliche Ansichten unter Juristen. Mit einer Entscheidung sei frühestens in eineinhalb Jahren zu rechnen. Von einem Amtsmissbrauch sei nicht auszugehen, erklärt Robert Kert, Jurist an der Wirtschaftsuniversität Wien. Die Grünen sehen den rechtlichen Schritten gelassen entgegen. Sie verweisen darauf, dass die ÖVP selbst im Laufe der Koalition immer wieder politische Alleingänge hingelegt habe.
Nehammer will nun nur noch “notwendige und wichtige Maßnahmen” umsetzen, sagte er zur Austria Presse Agentur (APA). Nachdem die ÖVP bereits einige eigene Termine abgesagt hatte, hielt sie den Ministerrat diese Woche nicht in Präsenz, sondern im Umlaufverfahren ab. Am 21. Juni boykottierten zudem alle fünf von der ÖVP gestellten Energielandesräte ein Treffen mit Leonore Gewessler. Ihnen missfällt der Alleingang der Umweltministerin, es fehle das Vertrauen.
Nach dem Coup der Grünen-Ministerin hatte die ÖVP vor Wut geschäumt. Am Abend des Tages war Nehammer vor die Kameras getreten: Gewessler habe “rechtswidrig” gehandelt und einen “mehr als schweren Vertrauensbruch” begangen. Rechtsgutachten des Verfassungsdienstes im Bundeskanzleramt und des ÖVP-geführten Landwirtschaftsministeriums würden dies belegen.
Gewessler wiederum stützt sich auf vier private Rechtsgutachten (siehe hier, hier, hier und hier). Diese bescheinigen ihr mehr oder weniger freies Stimmrecht. So sei etwa die einheitlich ablehnende Stellungnahme der Bundesländer nicht mehr gültig, da sich diese auf eine veraltete Version des Gesetzes beziehe. Zudem habe mittlerweile das SPÖ-regierte Bundesland Wien die Zustimmung zum Gesetz beschlossen. Auch das SPÖ-regierte Kärnten hat diesen Schritt vor. Naturschutz ist in Österreich zwar Ländersache. Gewessler kann aber laut Verfassung aus “zwingenden integrations- und außenpolitischen Gründen” von einer einheitlichen Stellungnahme der Bundesländer abweichen.
Dem Getöse zum Trotz will die Koalition weitermachen. Neuwahlen werde es keine geben, erklären ÖVP und Grüne. Am 29. September wird in Österreich ohnehin gewählt. Die ÖVP liegt in Umfragen hinter der rechtspopulistischen FPÖ und gleichauf mit der SPÖ bei rund 22 Prozent. Ihre Chancen, auch wieder den nächsten Kanzler zu stellen, sind also begrenzt. Zudem stehen für die ÖVP in den nächsten Wochen wichtige Gesetze zur Abstimmung – etwa zur Asylberatung, zur Handysicherstellung und im Justizbereich. Die Verabschiedung will man nicht gefährden. Auch die Grünen würden bei Neuwahlen an Macht einbüßen.
Die Vertrauenskrise in Österreich sitzt tief. Misstrauen zu säen sei politische Strategie geworden, werfen Kritiker den konservativen und rechten Parteien vor. Seit Monaten verbreiteten EVP und ÖVP Falschinformationen zum Renaturierungsgesetz, wie etwa 6.000 Forschende in einem Offenen Brief bemängelten. Einige der Vorwürfe:
Auch zu anderen Themen verbreitet die ÖVP Desinformation, frisierte Umfragen, und erstellte Rechnungen, die sich später als nicht seriös erwiesen. “Flooding the zone with shit” nennt sich diese PR-Strategie. So wird Desinformation salonfähig. Die ÖVP erzielt kurzfristige Erfolge, schadet aber langfristig der Demokratie. Laut Vertrauensindex der APA gibt es nur vier Bundespolitiker, denen die Bürger mehr Vertrauen attestieren als Misstrauen. Gewessler und Nehammer schneiden besonders schlecht ab.
Auch das Vertrauen von Jugendlichen in die Politik sinkt, die Wissenschaftsskepsis ist weiter stark ausgeprägt. 38 Prozent der Befragten verlassen sich lieber auf ihren gesunden Menschenverstand, nur 58 Prozent vertrauen der Ökologie- und Klimaforschung, zeigt das Wissenschaftsbarometer der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Von dieser Skepsis lebt die FPÖ, die seit mehr als einem Jahr alle Umfragen anführt.
Wenige Tage, bevor Ungarn den Vorsitz im EU-Ministerrat übernimmt, will die scheidende belgische Ratspräsidentschaft zur Deregulierung neuer Gentechniken (NGT) noch einen letzten Einigungsversuch unternehmen. Am Mittwoch wollen die Belgier den EU-Botschaftern einen Kompromissvorschlag vorlegen, ist aus Diplomatenkreisen zu hören. Demnach reichte die Zeit nicht, um das Thema schon am Montag auf die Agenda des EU-Agrarrats zu setzen. Es ist die letzte reguläre Sitzung der zuständigen Botschafter vor dem Ende der Präsidentschaft.
Bei dem jüngsten Entwurf, der Table.Briefings vorliegt, handelt es sich um eine abgewandelte Version des Kompromisses von Ende Mai, mit dem die Belgier keinen Durchbruch erzielt hatten. Statt, wie damals vorgesehen, den NGT-1-Status einer Pflanze an den Verzicht auf jegliche Patente hierauf zu knüpfen, sollen die jeweiligen Unternehmen jetzt nur noch auf Produktpatente verzichten. Verfahrenspatente, mit denen zum Beispiel die gentechnischen Methoden zur Herstellung einer Pflanze geschützt werden, wären weiter möglich. Zudem soll die Verzichtserklärung nur verlangt werden, wenn eine Pflanze vermarktet wird, und nicht, solange sie zu Forschungszwecken angebaut wird. Gleichzeitig soll die Europäische Kommission aufgefordert werden, einen Leitfaden zu Patenten und geistigem Eigentum vorzulegen.
Mehrere mit der Angelegenheit vertraute Quellen schätzen die Erfolgsaussichten des Einigungsversuchs als eher gering ein. Als entscheidender Faktor gilt weiterhin eine Zustimmung Polens. Das Land hat öffentlich signalisiert, die Zeit bis Mittwoch sei zu knapp, um den neuen Vorschlag zu prüfen.
Schwenkt Warschau nicht um, müssten die Belgier mehrere kleinere Länder überzeugen, um die nötige Mehrheit zu erreichen. Das gilt aber als schwierig, ohne dabei wiederum bisherige Befürworter zu verprellen. Gelingt am Mittwoch keine Einigung, könnte sich das Dossier deutlich verzögern. Die ungarische Ratspräsidentschaft hat sich in ihrem Arbeitsprogramm zwar vorgenommen, hieran weiterzuarbeiten. Weil Ungarn der Deregulierung neuer Gentechniken jedoch selbst kritisch gegenüber steht, wird erwartet, dass das Land das Thema mit weniger Elan vorantreibt, als die Belgier und zuvor die Spanier. jd
Bei ihrem letzten EU-Agrarministertreffen am Montag hat die belgische Ratspräsidentschaft den Zwischenstand der Gespräche zu mehreren Gesetzesvorschlägen vorgestellt. Dem aktuellen Verhandlungsstand nach schlagen die Minister bei der EU-Saatgutverordnung einen entgegengesetzten Kurs zum Europäischen Parlament ein. Sie wollen Ausnahmen im Vergleich zum ursprünglichen Kommissionsvorschlag einschränken. So sollen Ausnahmen für sogenannte Erhaltungssorten auf alte Sorten beschränkt werden, um Schlupflöcher für Neuzüchtungen zu vermeiden. Auch für den Austausch kleiner Mengen an Saatgut zwischen Landwirten wollen die Minister Ausnahmeregelungen enger fassen.
Damit ginge der Rat auf Züchterverbände zu, die vor phytosanitären Risiken warnen, wenn bestimmtes Saatgut und Pflanzenmaterial von Kontrollen und Anforderungen ausgenommen wird. Das Parlament hatte in seiner Verhandlungsposition im April dagegen gefordert, die Ausnahmen auszuweiten. Letzteres unterstützen Kleinbauern- und Bio-Verbände.
Bis der Ministerrat tatsächlich seine Position zu dem Vorschlag annimmt, könnte es aber noch dauern. Wegen der Komplexität des Dossiers – immerhin zehn verschiedene bestehende Rechtsakte werden darin zusammengefasst und reformiert – strebt auch Ungarn, das von Juli bis Dezember die Ratspräsidentschaft übernimmt, während seiner Amtszeit noch keine Einigung an.
Kaum vorangekommen ist die belgische Präsidentschaft derweil beim Vorschlag zum Tierschutz bei Lebendtransporten, den die Europäische Kommission Anfang Dezember zusammen mit einem Gesetz zum Schutz von Hunden und Katzen vorgelegt hatte. Die belgische Präsidentschaft entschied sich, vorrangig die Arbeit am recht unstrittigen Haustierthema voranzutreiben. Zum Vorschlag zu Tiertransporten, der als deutlich kontroverser gilt, ist demnach noch nicht einmal die erste Prüfung durch die zuständige Arbeitsgruppe abgeschlossen. Auch hier sieht die ungarische Präsidentschaft keine Einigung vor.
Bei ihrem Treffen wollten die EU-Agrarminister auch eine Erklärung zur Zukunft der europäischen Landwirtschaft verabschieden. Darin steht, Umwelt- und Klimaschutz vor allem durch Anreize voranzutreiben. Obwohl der Text kaum ins Detail geht, konnte er nicht einstimmig verabschiedet werden. Widerstand kam aus Rumänien und der Slowakei. Streitpunkt war eine Formulierung zur externen Konvergenz. Dieser Mechanismus dient dazu, die Höhe der Direktzahlungen in verschiedenen EU-Ländern stetig anzugleichen. jd
In der Studie “The Grounds for sharing. A Study of Value Distribtion in the coffee industry” untersuchte das unabhängige Bureau d’Analyse Sociétale d’Internet Collectif (BASIC) erstmals, wie sich entlang der Kaffee-Wertschöpfungskette die Kosten, Steuern und Nettogewinnspannen von Landwirten bis zu Einzelhändlern verteilen. Die Autoren analysierten vier der sechs größten Erzeugerländer (Brasilien, Kolumbien, Äthiopien und Vietnam) sowie als Absatzmarkt Deutschland, den größten Kaffeemarkt Europas. Beauftragt wurde die Studie vom Branchenverband Global Coffee Platform (GCP), der Nachhaltigkeitsinitiative IDH und der NGO Solidaridad.
Die Autoren stellten öffentlich zugängliche Daten zusammen und ergänzten diese mit Befragungen und Konsultationen. Ihre zentralen Ergebnisse:
Auf den ersten Blick erscheint der anteilige Nettoprofit der Kaffeebauern überraschend hoch. Das liegt allerdings daran, dass deren Kosten unzureichend erfasst sind. Denn die Mitarbeit von Familienmitgliedern werde “weder bezahlt” noch einberechnet, heißt es in der Studie. Deswegen “erscheinen die Gewinnmargen der Kleinbäuerinnen vermeintlich höher”. Damit werde das Problem verschleiert, denn der Großteil der Kosten der Kleinbauern entfällt auf die unbezahlte Familienarbeit.
Die Studie erfasst 41 Kaffeeprodukte mit einem Umsatz von drei Milliarden Euro, darunter gemahlenen Kaffee, ganze Bohnen, Softpads und Kapseln. Auch unterschiedliche Anbauweisen – konventionell und zertifiziert nach Kriterien der Rainforest Alliance und Fairtrade – wurden berücksichtigt.
Weltweit bauen 12,5 Millionen Bauern Kaffee an, davon bewirtschaften 70 Prozent Flächen von weniger als fünf Hektar, womit sie als Kleinbauern gelten. Die derzeitige Verteilung der Wertschöpfung mache die Kaffeeproduktion für die meisten Kaffeebauern “wirtschaftlich unrentabel“, sagt die Geschäftsführerin der Global Coffee Platform, Annette Pensel. Diese Ungleichverteilung “lähmt das Bestreben der Kaffeeindustrie”, nachhaltig zu werden. Wer als Bauer für zertifizierte Lieferketten arbeitet, erzielt ein höheres Einkommen als in nicht zertifizierten Lieferketten.
Viele importierende Unternehmen bekennen sich dazu, die Einkommen von Kleinbauern zu erhöhen, etwa Tchibo durch den Ausbau der nachhaltigen Kaffeebeschaffung. Solche Bemühungen seien wichtig, heißt es in der Studie. Allerdings müsse die Wertschöpfung selbst gerechter verteilt werden, indem der Sektor sich zu entsprechenden Beschaffungspraktiken verpflichte. Tessa Meulensteen, Direktorin Agri-Commidities von IDH, schlägt Partnerschaften vor, um “die Schaffung und den Transfer von Werten zu entwickeln und umzusetzen”. Das dürfte Unternehmen auch bei der Einhaltung der Sorgfaltspflichten helfen, die von Lieferkettengesetzen vorgeschrieben werden. cd
Das Qualitätsmanagement-Tool “Unser Schulessen”, das Mittagessen in Kita und Schule gesünder gestalten soll, wird vom Nationalen Qualitätszentrum für Ernährung in Kita und Schule (NQZ) nun bundesweit ausgebaut. Auf der digitalen Arbeitsplattform können Bildungseinrichtungen ihre aktuellen Speisepläne eintragen und auswerten lassen. Die Kriterien dazu wurden aus dem “DGE-Qualitätsstandard für die Verpflegung in Schulen” abgeleitet. Das Tool bietet allen Nutzern – von der Schulleitung bis zu den Schülerinnen und Schülern – einen Überblick über die aktuelle Qualität. Erprobt wurde die Plattform bereits in Brandenburg und Rheinland-Pfalz.
“Jedes Kind in Deutschland muss die Chance haben, gesund aufzuwachsen“, sagt Cem Özdemir, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, anlässlich des Ausbaus der Plattform. Wichtig sei, dass das Essen den Kindern schmecke. “Das Qualitätsmanagement-Tool ,Unser Schulessen’ rückt ihre Bedürfnisse in den Fokus und lässt sie ihre Schulverpflegung aktiv mitgestalten”, so Özdemir.
Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft stellt eine Finanzierung des Angebots auf maximal drei Jahre in Aussicht, sagt Wiebke Kottenkamp, Leiterin des NQZ, zu Table.Briefings. “Der Auftrag ist zunächst für zwei Jahre geschlossen und kann bei Bedarf um ein weiteres Jahr verlängert werden. Insgesamt stehen dafür bis zu 850.000 Euro zur Verfügung.”
Schulen können sich bei dem Tool kostenlos anmelden und auch Partner wie Caterer zur Nutzung einladen. Auf der Plattform lassen sich dann Stammdaten der Schule wie die Schülerzahl und der Essenspreis speichern und je nach Bedarf anpassen. Zudem bietet das Tool, die Möglichkeit, Umfragen zu erstellen, und macht Vorschläge, wie das Essen nachhaltiger und gesünder gestaltet werden kann. Außerdem gibt es Hintergrundinfos und Materialien, um Ernährung im Unterricht oder Ganztag zu thematisieren. vkr
25.06.2024 – 19.00 – 20.30 Uhr / Berlin
Veranstaltung NABUsalon “125 Jahre NABU”
Der NABU ist Deutschlands ältester und größter Umweltverband mit über 940.000 Mitgliedern. Er setzt sich aktiv für den Naturschutz ein und engagiert sich für Artenvielfalt, Lebensraumschutz und eine nachhaltige Zukunft. Bundesumweltministerin Steffi Lemke hält beim NABUsalon “125 Jahre NABU: Naturschutz verbindet – ohne Grenzen!” eine Rede. INFO
25.06.2024 / Oslo
Forum Oslo Tropical Forest Forum
Das Oslo Tropical Forest Forum ist eine globale Konferenz, die Ministerinnen und Minister, politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, multilaterale Institutionen, zivilgesellschaftliche Organisationen, indigene Völker und den Privatsektor zusammenbringt, um Maßnahmen zum Schutz der tropischen Wälder voranzutreiben. Bundesumweltministerin Steffi Lemke nimmt an dem Tropical Forest Forums und Trandheim Ministerial Dialouges teil. INFO
26.06.2024 / Berlin
Table.Media Sommerfest
26.06. – 27.06.2024 / Messe Cottbus
DBV Veranstaltung Deutscher Bauerntag 2024
Auf dem Deutschen Bauerntag 2024 wird darüber diskutiert, wie sich die Landwirtschaft von heute mit viel Innovation und Unternehmergeist weiterentwickeln kann und welche Lösungen es für die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit der Branche gibt. PROGRAMM
30.06.2024 – 09.00 – 18.00 Uhr / Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf
100 Jahre Demeter 100 Jahre biodynamisch
Schon vor 100 Jahren wurde der Grundstein der biodynamischen Landwirtschaft gelegt. Seither setzen Demeter-Mitglieder immer wieder wichtige Impulse für eine Landwirtschaft im Einklang mit der Natur und den Ökolandbau insgesamt. Sie haben nachhaltige Lösungen für die großen Herausforderungen unserer Zeit entwickelt wie die Klimakatastrophe und das Artensterben: regionale, bäuerliche Landwirtschaft, Klimaschutz und -anpassung, eine unabhängige Züchtung, der Schutz des Bodens als einer unserer wichtigsten Ressourcen und der Verzicht auf Gentechnik. INFO
03.07.2024 / Berlin
Sitzungswoche Bundestag Kabinettsitzung
Auf der Tagesordnung steht die Beratung über den Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2024 Tagesordnung
10.07.2024 11.00 – 12.00 Uhr/ online
Diskussion digital talk: Regional is(s)t besser?
Viele Verbraucher wünschen sich mehr Heimat auf dem Teller. Doch wie können Gastro-Profis von der Sehnsucht der Gäste nach Produkten vom Bauernhof um die Ecke profitieren? Und wie definiert man “Aus der Region”? Welche Bezugsquellen gibt es für regionales Gemüse, Fleisch oder Obst? Und ist das Schnitzel von Bauer Heinz tatsächlich nachhaltiger? INFO & ANMELDUNG
10.07.2024 / Grub, Bayern
Seminar 1. Süddeutsches Agri-PV-Forum
Das 1. Süddeutsche Agri-PV-Forum 2024 findet als Kooperationsveranstaltung von LandSchafftEnergie+ am Technologie- und Förderzentrum und den Bayerischen Staatsgütern am Standort Grub statt. Informieren, vernetzen, besichtigen – bei der Veranstaltung in Grub werden aktuelle Entwicklungen, rechtliche Aspekte und Praxisbeispiele im Bereich Agri-Photovoltaik (Agri-PV) vorgestellt. Anmeldung bis 03.07.2024 INFO & ANMELDUNG
Financial Times: Deforestation: US urges EU to delay deforestation law
Die US-Handels- und Landwirtschaftsminister Gina Raimondo und Thomas Vilsack sowie die Handelsbeauftragte Katherine Tai haben die EU aufgefordert, das Inkrafttreten der Verordnung zu entwaldungsfreien Lieferketten zu verschieben. Das geplante Importverbot von Produkten wie Kakao, Holz und Sanitärartikeln, die zur Abholzung beitragen, würde US-amerikanischen Produzenten schaden und sie vor “kritische Herausforderungen” stellen. In den USA sind vor allem die Holz-, Papier- und Zellstoffindustrie betroffen. Auch innerhalb der EU mehrten sich zuletzt die Forderungen, das Inkrafttreten der neuen Regeln aufzuschieben. Zum Artikel
AGRA Europe: Niederländische BBB wird Teil der EVP
Die niederländische Bauer-Bürger-Bewegung (BBB), die als EU-skeptisch gilt, wird sich der Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP) anschließen. Ihre beiden Abgeordneten, Sander Schmit und Jessika van Leeuwen, werden aber voraussichtlich keinen Platz im Landwirtschaftsausschuss erhalten. Gerüchte um eine mögliche Zusammenlegung des Landwirtschafts- und Fischereiausschusses sind derzeit noch nicht bestätigt. Die Fraktionsbildung im Europaparlament schreitet voran, wobei die EVP die größte Fraktion bleibt, gefolgt von den Sozialdemokraten (S&D) und den EU-skeptischen Europäischen Konservativen (EKR). Die rechtspopulistische Fraktion Identität und Demokratie (ID) liegt erstmals vor den Grünen/EFA. Zum Artikel
Euronews: Commission reintroduces tariffs on Ukraine’s oat and eggs, eyeing sugar next
Die EU hat Zölle auf ukrainischen Hafer und Eier wiedereingeführt, nachdem die Importe beider Produkte die zuletzt festgelegten Schwellenwerte überschritten hatten. Die seit dem 6. Juni geltende vorübergehende Zollliberalisierung für die Ukraine beinhaltet einen automatischen Schutzmechanismus, bei dem Zölle wieder greifen, wenn Importe für eine Reihe “sensibler” Produktgruppen bestimmte Mengen überschreiten. Auch für Zucker könnte der Mechanismus bald greifen. Daten der Europäischen Kommission zufolge überschreiten die Importe bereits den Schwellenwert. Der europäische Lebensmittel- und Getränkesektor ist jedoch besorgt über mögliche Engpässe, sollten Zölle auf Zucker anfallen, da die Ukraine 65 Prozent ihres Zuckers in die EU exportiert. Zum Artikel
Politico: EU approved Slovak law to kill bears in return for nature vote, minister claims
Der slowakische Vizepremier Tomáš Taraba hat nach eigener Darstellung seine entscheidende Stimme für das EU-Naturwiederherstellungsgesetz als Teil eines Kuhhandels mit der Europäischen Kommission abgegeben. Diese habe ihm im Gegenzug zugesagt, ein slowakisches Gesetz über Notfallgenehmigungen zur Tötung von Bären nicht zu stoppen. Tatsächlich hatte EU-Umweltkommissar Virginijus Sinkevičius in einem Schreiben wenige Tage vor der Abstimmung zum Renaturierungsgesetz seine vorläufige Unterstützung für das slowakische Bärengesetz angedeutet. Einen Zusammenhang streitet die Europäische Kommission ab. Umweltschützer und Rechtsexperten sehen in dem slowakischen Gesetz einen möglichen Verstoß gegen EU-Regeln zum Wildtierschutz. Zum Artikel
