auch an diesem Wochenende sind in Deutschland Hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen. Die Berichte über konkrete Vertreibungspläne von Millionen Menschen, geschmiedet auf einem geheimen Treffen zahlreicher AfD-Funktionäre in Potsdam, erschüttern die Gesellschaft nachhaltig, so auch die Wissenschaft.
Doch wie sollte und muss sich Wissenschaft einbringen? Etwa in die Debatte um ein AfD-Verbot? Oder unter dem Hashtag #lautewissenschaft? Was ist erlaubt? Schließlich gilt doch grundsätzlich das Neutralitätsgebot.
Es sei wichtig, sich in dieser Situation, die auch die Wissenschaftsfreiheit bedroht, zu Wort zu melden, sagte am Wochenende HRK-Präsident Walter Rosenthal im Gespräch mit dem Deutschlandfunk. Bei politischen Äußerungen müsse natürlich immer abgewogen werden: Handele es sich um etwas allgemeinpolitisches oder um etwas, das die Hochschulen auch in ihrem Kern betreffe? Dies sei im Augenblick der Fall. Daher habe die HRK sich auf klar gegen rechts positioniert.
Und dieses Mal bleibt es auch nicht bei Veröffentlichungen von Statements. In den Büros und Fluren der Hochschulen wird diskutiert, was wäre, wenn in Thüringen, Brandenburg oder Sachsen die AfD die Wahlen gewinnt?
Anja Steinbeck, Rektorin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, rief persönlich über die Plattform X zur Teilnahme an der lokalen Demonstration auf. “Jede Zeit hat ihre Aufgabe, und durch die Lösung derselben rückt die Menschheit weiter”, schreibt sie in ihrem Post auf X. Es wird in diesen Tagen noch vieles zu klären sein. Etwa an welchen Leitlinien sich einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Hochschulen und Forschungseinrichtungen orientieren können, wenn sie sich klar gegen rechts positionieren wollen. Aber die Statements und Proteste machen Mut.
Damit enthält die breite Bewegung im Land auch einen Arbeitsauftrag, nicht nur an die Politik, an uns Medien, sondern weiterhin auch an die Wissenschaft. Lange Zeit hat man auf den Schutz einer starken Demokratie vertraut, die Aussagen der AfD mit einem Kopfschütteln abgetan. Dringend muss sich auch die Wissenschaft fragen, was sie als Teil einer demokratischen Gesellschaft beitragen will, um Rassismus und Autoritarismus zurückzudrängen.
Nachdenkliche Grüße,


Bei der Vorstellung der aktuellen Empfehlungen des Wissenschaftsrats wird dessen Vorsitzender, Wolfgang Wick, in seinem Eingangsstatement deutlich: Die aktuellen rassistischen, antisemitischen und antidemokratischen Tendenzen bedrohten Weltoffenheit und Internationalität, die nicht nur für die Wissenschaft zentral seien. Der Wissenschaftsrat, “setzt sich für eine offene und vielfältige Gesellschaft ein, die das Fundament für eine freie und leistungsfähige Wissenschaft ist”.
Für beide Themen der Pressekonferenz am gestrigen Montag spielt das Thema vor allem im Hinblick auf internationale Studierende eine Rolle. Sowohl für die Entwicklung der Hochschulen im Land Brandenburg, das den Wissenschaftsrat um Empfehlungen gebeten hatte, als auch für die Zukunft der Hochschulen vor dem Hintergrund stagnierender Studierendenzahlen haben diese eine besondere Bedeutung. Bislang halten junge Menschen aus anderen Ländern in vielen Städten und Regionen die Studierendenzahl noch einigermaßen konstant.
Mittel- und langfristig wird der demografische Wandel die Hochschulen erreichen – allerdings in unterschiedlichem Maße. Während einige Standorte in attraktiven (Groß-)städten kaum einen Einbruch spüren werden, müssten sich Einrichtungen im ländlichen Raum gezielt vorbereiten. Es brauche ein attraktives Portfolio und gute Bedingungen, um im Wettbewerb um Studierende und Nachwuchswissenschaftler mithalten zu können.
Insgesamt sollten Hochschulen stagnierende oder gar sinkende Studierendenzahlen für eine Steigerung der Qualität nutzen, schreibt Wolfgang Wick in seinem jährlichen Bericht zu aktuellen Tendenzen im Wissenschaftssystem. “Die Hochschulen bekommen die Chance, Fehlentwicklungen der Wachstumsperiode zu korrigieren, die Qualität der Lehre zu verbessern, den Anteil erfolgreicher Abschlüsse zu steigern und die Digitalisierung voranzutreiben.”
Sinkende Studierendenzahlen sind allerdings nicht nur eine Chance zur Konsolidierung – manche Standorte werden dadurch auch in ihrer Existenz bedroht. Die Politik müsse der “Versuchung kurzsichtiger Einsparungen widerstehen”, meint Wick weiter. Es gehe eher darum, nicht ausgelastete Studienangebote in Abstimmung mit Hochschulen in der jeweiligen Region abzubauen, zusammenzulegen oder durch attraktivere Angebote zu ersetzen.
Wie man dem demografischen Wandel begegnen kann, machen die privaten Hochschulen vor: Diese erschließen neue Zielgruppen durch Studienformate, die Berufstätigen, Eltern und beruflich Ausgebildeten ein Studium ermöglichen. Das bestätigt auch Marc Hüsch vom Centrum für Hochschulentwicklung (CHE): Private Hochschulen seien oft flexibler und reagierten schneller auf sich verändernde Bedarfe. Auch bei der Internationalisierung und bei der Kommunikation nach außen könnten hier die staatlichen Hochschulen etwas lernen.
Neben den sinkenden Studierendenzahlen müssen sich in Brandenburg die vorwiegend kleinen Hochschulen im Land die Frage stellen, wie sie die kritische Forschermasse erhalten, um in den einzelnen Bereichen gute Wissenschaft betreiben zu können. Der Wissenschaftsrat attestiert immerhin in den gestern vorgelegten Empfehlungen der brandenburgischen Hochschullandschaft “keinen grundlegenden Änderungsbedarf”, wie es die Vorsitzende der Arbeitsgruppe, Sabine Maasen, formulierte.
Eine Mischung aus Profilierung, Vernetzung, strategischer Entwicklung, Kommunikation und Innovation in Studium und Lehre ist in den Empfehlungen des 350 Seiten starken Papiers enthalten. Die Hochschulen in Brandenburg sollen:
Für das Ministerium in Potsdam formulierte der Wissenschaftsrat folgende Empfehlungen:
Brandenburgs Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) hob “gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse in Potsdam” die Bedeutung einer guten Willkommenskultur für ausländische Studierende hervor. Man habe nach Berlin den zweithöchsten Anteil bei internationalen Studierenden. Es gelte jetzt, diese öfter zu einem erfolgreichen Abschluss und dann in den Arbeitsmarkt zu bringen.
Matthias Barth, Präsident der Hochschule Eberswalde, unterstrich im Gespräch mit Table.Media, dass sich die Finanzierungsstruktur ändern sollte. Die aktuelle Leistungsindikatorik werde durch die sogenannte “Dämpfung” am Ende konterkariert, die letztlich die Zuwendungen wieder nivelliere. So belohne man gerade forschungsstarke Hochschulen mit hohem Drittmittelanteil nicht.
Weitere Empfehlungen betrafen insbesondere die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg (BTU). Im vergangenen Jahr wurde bereits klar, dass die Medizin eine eigene Universität in der Lausitz bekommen soll und nicht als medizinische Fakultät an die BTU angegliedert wird. Bereits vor den Empfehlungen zu deren Ausgestaltung, die im Frühjahr anstehen, machte der WR deutlich, dass er eine enge Kooperation der beiden Universitäten erwartet. Gleichzeitig empfiehlt er, die hochschulübergreifende Fakultät für Gesundheitswissenschaften aufzulösen.
Mit Blick auf die Entwicklung der BTU seit der Fusion zwischen TU Cottbus und der Hochschule Lausitz formulierte der WR klare Kritik an Forschungsleistung und der Entwicklung der Studierendenzahlen. Die BTU müsse sich zu einer reinen Universität weiterentwickeln.
Diese Empfehlung begrüßt BTU-Präsidentin Gesine Grande ausdrücklich. Derzeit seien gerade mit Blick auf die Forschung die Potenziale der ehemaligen FH-Kolleginnen und -Kollegen kaum nutzbar. Diese hätten immer noch 18 Semesterwochenstunden Lehre zu leisten. Daher arbeite man intensiv mit dem Ministerium daran, diese Zweiteilung im Kollegium zu beenden. Gerade angesichts des Strukturwandels und der Ansiedlung vieler außeruniversitärer Forschungsinstitute brauche es eine “Forschung auf Augenhöhe” an der BTU. Bei den Studierendenzahlen scheine jedoch die Trendwende bereits geschafft. Und mit rund 40 Prozent internationalen Studierenden sei man hier sogar Vorreiter, betont Grande.
Im Herbst soll es losgehen. Dann will die German University of Digital Science damit beginnen, die ersten Fachleute für den digitalen Wandel auszubilden – weltweit und in englischer Sprache. Hinter dem Konzept dieser neuen, vollständig digital arbeitenden Universität in Potsdam stehen Mike Friedrichsen und Christoph Meinel. Friedrichsen ist noch bis Februar Professor für Wirtschaftsinformatik und digitale Medien an der Stuttgarter Hochschule der Medien, Meinel ist der frühere Direktor des Potsdamer Hasso-Plattner-Instituts (HPI).
Die beiden haben den Zulassungsantrag für die private Hochschule bei der Landesregierung Brandenburg eingereicht, derzeit prüft das Wissenschaftsministerium das Konzept. Die beiden Universitätsgründer erwarten, dass sich der Wissenschaftsrat im Frühjahr mit dem Projekt befassen wird.
Die Gründer wollen mit der vollständig digitalisierten Uni den weltweiten IT-Fachkräftemangel aktiv bekämpfen. Alle administrativen Prozesse sind digitalisiert, es gibt kein Papier im bereits existierenden Headquarter CloudHouse in Potsdam. Von dort werden die digitalen Angebote der Universität verbreitet. In einem virtuellen Raum, im Metaverse, soll die Uni sichtbar sein. Dort kann man sich treffen, austauschen.
Auch eine Lernplattform wird geschaffen, auf der das gesamte Online-Angebot hinterlegt sein soll. Jeder Studierende kann dann Tag für Tag entscheiden, ob er die virtuelle Uni betreten oder einfach für sich selbst ein Modul auf der Lernplattform bearbeiten will.
“Das Revolutionäre an unserem Modell ist: Wir können weltweit Programme anbieten und mit renommierten Professoren zusammenarbeiten, die nicht für den Job umziehen müssen”, sagt Friedrichsen. Insgesamt sollen 20 Professoren in den nächsten drei Jahren berufen werden. Außerdem wolle man eng mit regionalen und internationalen Unternehmen kooperieren, “die den Transformationsnutzen erkennen und Fachkräftebedarf haben”. Sie könnten auf diesem Weg internationale Talente in spezialisierten Bereichen gewinnen.
Ein Konzept mit Zukunft? Ulrich Müller vom Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) sieht die Gründung der German Digital University positiv. “Eine Online-Hochschule reagiert auf den Bedarf nach zeitlich und räumlich flexiblen digitalen Angeboten für berufsbegleitendes Studium und lebenslanges Lernen. Sie greift also relevanten Bedarf auf”, sagt Müller. Die Hochschulwelt in Deutschland sei im Umbruch. Und die Hochschulen müssten angemessen auf veränderte Rahmenbedingungen und Erwartungshorizonte reagieren.
Eine reine Online-Hochschule sei eine denkbare und sinnvolle Option eines Hochschulprofils. Sie existiere auch schon in Deutschland, etwa in Teilen in der privaten Fachhochschule IU mit Sitz in Erfurt oder der Tomorrow University in Frankfurt am Main. Die Tomorrow University ist die erste virtuelle Universität, die eine Zulassung in Deutschland erreicht hat. Bis heute betreut die Universität nach eigenen Angaben rund 400 Lernende für Bachelor- und Masterstudiengänge. Die Studierenden können auf eine eigene App, einen virtuellen Online-Campus und Slack zugreifen.
International sei die Hochschulwelt noch bunter als in Deutschland, sagt Ulrich Müller. Die bekannteste vollständig digitalisierte Universität existiert etwa in den USA: die 2012 gegründete Minerva University mit Sitz in San Francisco. Die Studierenden nehmen an Kursen online teil, es gibt eine enge Zusammenarbeit mit Unternehmen. Im Gegensatz zur German Digital University ziehen die Studierenden der Minerva University allerdings alle vier Monate in eine andere Stadt.
“Ja, es gibt einige wenige Beispiele. Aber dass der gesamte Administrationsbereich, der Lehrbereich, die Organisation der Mitarbeiter digital organisiert ist, das habe ich noch nirgends gesehen”, sagt Friedrichsen. “Wir sind mit diesem Konzept der vollständig digitalisierten Uni, die auch im Metaverse auftritt, Vorreiter in Europa.”
Die German University of Digital Science plant im Herbst den Start mit drei Master of Science-Programmen und einem Master of Business Administration-Programm. Die Zielgruppen sind Studierende aus dem globalen Süden, aus Regionen ohne Präsenz-Studienmöglichkeiten und Berufstätige im Bereich KI. Pro Studienjahr zahlen Studierende 7.500 Euro – für jedes Programm. Auch Stipendien sind geplant.
“In der Aufbauphase haben wir unsere Universität vor allem aus eigenen Mitteln finanziert”, sagt Friedrichsen. Außerdem haben die Gründer eine Verbrauchsstiftung gegründet, die als Finanzierungsquelle für die sogenannte German UDS GmbH, ihrer gemeinnützigen Trägergesellschaft, dient. Die Stiftung hält 51 Prozent der Anteile, um Gemeinnützigkeit und Unabhängigkeit zu gewährleisten. Die restlichen 49 Prozent der Anteile möchten Meinel und Friedrichsen an Unternehmen verkaufen, um die Universität zu finanzieren. Namhafte Unternehmen, wie die Telekom und die PSD-Bank Berlin-Brandenburg, seien bereits Unterstützer.
Die erfolgreiche Umsetzung ihres Modells könnte eine Inspiration für etablierte Hochschulen sein, davon ist Friedrichsen überzeugt: “In fünf bis zehn Jahren wird vieles von dem, was wir jetzt gerade etablieren, vollkommen normal in der Hochschullandschaft sein.”
15.-17. Februar 2024, Denver und online
Tagung AAAS Annual Meeting – Toward Science Without Walls Mehr
26./27. Februar 2024, jeweils von 09.30 bis 13.00 Uhr, online
Online-Forum (€) CHE Online-Forum zu Folgen sinkender Erstsemesterzahlen Mehr
8. März 2024, 10:00 Uhr, Frankfurt am Main und online
Diskussion Wissenschaftsjahr Freiheit: Diskussion u.a. mit Bettina Stark-Watzinger, Alena Buyx und Antje Boetius Mehr
Diese Terminankündigung hat so manchen in der Community stutzig gemacht: Am Freitagabend verleiht das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit dem langjährigen Präsidenten des Deutschen Hochschulverbands, Bernhard Kempen, den Preis für Wissenschaftsfreiheit.
Das ist bemerkenswert, weil die Veranstaltung des kritisch beobachteten Netzwerks nicht irgendwo stattfindet, sondern im Einsteinsaal der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (BBAW). Auf der Plattform X wurde gefragt, ob man genauer hingeschaut habe, wer da demnächst zu Gast sei und ob es sich um eine bewusste Entscheidung handele. Keine zwei Stunden später erklärte BBAW-Präsident Christoph Markschies, dass es sich um eine Fremdveranstaltung handele. “Das Veranstaltungszentrum der BBAW, ein Eigenbetrieb der Akademie, vermietet Räume für Veranstaltungen”, schrieb er am Sonntag auf X. “Hätte das Veranstaltungszentrum die Miet-Anfrage für die Veranstaltung abgelehnt, hätte es damit das Narrativ bestätigt, dass bestimmte Positionen hierzulande ,gecancelt’ werden.”
Angesprochen auf seine Einschätzung des Netzwerks verweist Markschies auf die BBAW-Arbeitsgruppe “Wandel der Universitäten und ihres gesellschaftlichen Umfelds: Folgen für die Wissenschaftsfreiheit?”. Deren soziologische und rechtswissenschaftliche Analysen der Beobachtung der Wissenschaftsfreiheit in unserem Lande erschienen ihm “präziser und umfassender angelegt” als das, was er vom Netzwerk kenne, sagte er auf Anfrage.
Das Netzwerk für Wissenschaftsfreiheit ist eigenen Angaben zufolge ein “Zusammenschluss von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich für ein freiheitliches Wissenschaftsklima einsetzen”. Es wurde im Jahr 2020 gegründet und hat inzwischen mehr als 700 Mitglieder, denen es zum Beispiel darum geht, “die Freiheit von Forschung und Lehre gegen ideologisch motivierte Einschränkungen zu verteidigen”.
In den von dem Netzwerk herausgegebenen Stellungnahmen und offenen Briefen findet sich zum Beispiel die Forderung “Gendersprache darf niemandem aufgezwungen werden”. Oder die Kritik am Beck-Verlag an deren Entscheidung, die Zusammenarbeit mit Hans-Georg Maaßen zu beenden und “damit erneut vor einer gegen den Verlag gerichteten Kampagne in die Knie zu gehen”. Besorgt äußerte es sich jüngst auch “über die Absage von Veranstaltungen und Vorträgen im Zusammenhang mit dem Gaza-Konflikt und Israel in den vergangenen Wochen”.
In der Liste der Mitglieder finden sich einige bekannte Namen. Aktuell bedeutsam: Auch der Rechtswissenschaftler Ulrich Vosgerau gehört dem Netzwerk Wissenschaftsfreiheit an. Er hatte an dem Geheimtreffen von Rechten und Rechtsextremen am Lehnitzsee bei Potsdam teilgenommen. Vosgerau ist CDU-Mitglied und Privatdozent an der Universität Köln. Sein aktueller Status dort ist jedoch ungeklärt, teilte die Uni mit: “Seit 2015 ist er nicht mehr an der Universität zu Köln beschäftigt, seit 2018 lehrt er zudem nicht mehr an der Fakultät. Ob die Voraussetzungen für den Status ,Privatdozent’ noch gegeben sind, wird die Universität zu Köln prüfen.”
Über die Motive des Rechtswissenschaftlers Bernhard Kempen, sich von dem Netzwerk ehren zu lassen, lässt sich nur spekulieren. Kempen ist Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Köln und war von 2004 bis 2023 Präsident des Deutschen Hochschulverbands (DHV).
Der DHV äußert sich nicht zu dem Preis, betont auf Anfrage von Table.Media jedoch, dass “das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit einen Konformitätsdruck in der Debattenkultur an Universitäten bemängelt und damit ein Unbehagen bestätigt, das der DHV unter der Ägide von Bernhard Kempen bundesweit als einer der ersten artikuliert hat”. Insofern sehe der DHV “im Netzwerk einen willkommenen Mitstreiter, der gemeinsam für eine von Sachargumenten und gegenseitigem Respekt geprägte Debattenkultur an den Universitäten eintritt und wirbt”. abg
Gemeinsame Patente zwischen europäischen und chinesischen Unternehmen entstanden in den vergangenen Jahren vor allem in den Bereichen Telekommunikation, Informationstechnologie und Elektronik. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie des EU-Projektes Reconnect China, das ermitteln soll, auf welchen Feldern eine Zusammenarbeit der Europäischen Union mit China “wünschenswert, möglich oder unmöglich ist”. “Bei den Ländern ist Deutschland der größte Patentpartner für China in Europa, gefolgt von Finnland, Schweden und Frankreich”, sagt Mitautor Philipp Brugner zu Table.Media. “Das zeigt sich auch in der Herkunft der Firmen, die involviert sind.” Nokia aus Finnland führe das Feld an, gefolgt von Ericsson, einer Nokia-Tochter, Siemens, ABB, Bosch und L’Oréal.
Dass die Co-Patente vor allem aus Großunternehmen stammen, zeige, “dass die gemeinsame Patentierung zwischen der EU27/AC und China in erster Linie ein kommerzielles Unterfangen ist, das von der Telekommunikations-/Elektronikbranche und industriellen Schwergewichten aus Deutschland und Frankreich dominiert wird“, heißt es in der Studie. Eine bemerkenswerte Ausnahme sei das französische, vom Staat unterstützte Forschungsinstitut Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) mit 67 Co-Patentanmeldungen mit chinesischen Institutionen in der Patentdatenbank PATSTAT.
Auf der chinesischen Seite sieht es anders aus. “Mehrere der aktivsten Bewerber sind chinesische Ableger der oben genannten europäischen Unternehmen“, schreiben die Autoren. So melde Nokia Finnland gemeinsam mit eigenen China-Töchtern Co-Patente an. Auch die Shanghai-Tochter des US-Unternehmens NAVTEQ sei aktiv. Aber auch “echte” chinesische Unternehmen wie Huawei, Lenovo, TCL oder Geely seien stark bei Co-Patenten vertreten: “Hervorzuheben ist, dass auch alle Top-15-Anmelder aus China große Unternehmen sind.” Auch in China seien Telekommunikations- und Elektroniksektor am stärksten vertreten.
Generell gelte der Zugang zu Innovationen durch Patente als sogenannte “secondary innovation”, bei der “Technologien nicht importiert werden, um zu kopieren – sondern um zu verstehen und durch einen oder mehrere eigene Entwicklungsschritte grundsätzlich zu verbessern”, erklärt Brugner. Ein Beispiel, wie China das genutzt habe, seien grüne Technologien, bei denen China anfangs auf ausländische Produkte und Anlagen gesetzt habe, etwa bei Windanlagen oder Photovoltaik. “Heute ist China nicht nur Hauptproduzent, sondern auch unter den stärksten Innovatoren bei den grünen Technologien, was wir aus dem Anteil an international registrierten Patenten zu diesen Technologien ablesen konnten.”
Bis 2018 war die Zahl der angemeldeten Co-Patente stetig angestiegen. Wegen der fehlenden Daten bricht sie danach ein. Die Autoren gehen aber davon aus, “dass die Anzahl der gemeinsam angemeldeten Patente 2021 und 2022 weiter gestiegen ist”, wie Brugner sagt. Das Interesse Chinas an Europa sei groß. “Ich glaube, dass wir den gleichen Trend sehen können wie bei gemeinsamen Publikationen: Die Zusammenarbeit mit China in Bezug auf künstliche Intelligenz und digitale Technologien wird immer wichtiger“, meint Mitautor Gábor Szüdi. “Und bei den Co-Patenten sehen wir vor allem wirklich den Fokus auf die ganz konkrete Angewandte Wissenschaft.” China sei an Kooperation in diesem Feld sehr interessiert.
Nach Angaben der Autoren war die Motivation der Studie nicht, den an Co-Patenten mit China arbeitenden Firmen Empfehlungen zu geben; ihre vorrangige Zielgruppe sei die wissenschaftliche Community. Sie sehen die in ihrer Studie generierten Daten und Erkenntnisse als potenziell wichtige Grundlage für weiterführende Analysen von Wissenschaft und Wirtschaft. Oberziel ist eine höhere China-Kompetenz Europas, auch in Spezialgebieten. Wie dringend dieses Ziel ist, verdeutlichte gerade erst ein vom Deutschen Akademischen Austauschdienst DAAD herausgegebenes Papier. Christiane Kühl
Der von der Bundesregierung angekündigte Entwurf für ein Medizinforschungsgesetz (MFG) – der Table.Media vorliegt – ist am Montag von BMG und BMUV an die betreffenden Verbände verschickt worden. Diese haben bis zum 22. Februar Zeit, zu dem Referentenentwurf Stellung zu nehmen. Am 20. Februar gibt es zudem eine mündliche Anhörung. Zentrales Anliegen des Papiers ist, die Vorschriften für klinische Prüfungen zu vereinfachen.
Der Entwurf entspricht den Vorschlägen, die Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach bereits im Dezember im Zuge der Vorstellung der Pharmastrategie benannt hatte. Demzufolge will die Bundesregierung eine “Bundes-Ethik-Kommission” einrichten, um den Start von Forschungsvorhaben zu beschleunigen. Klinische Studien zu neuen Arzneimitteln, die erstmals am Menschen geprüft werden, und sogenannte Gen- und Zelltherapeutika sollen ab 2025 von dieser Kommission geprüft werden. Bislang sind bis zu 49 Ethik-Kommissionen in den Bundesländern dafür zuständig. Diese sollen zukünftig spezielle Aufgaben übernehmen.
Zudem sollen das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) und das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) sich bei der Zulassung von Arzneimitteln besser koordinieren. Das PEI ist unter anderem für Impfstoffe und Gentherapien zuständig, das BfArM für herkömmliche Arzneimittel. Dem Entwurf zufolge sollen auch die Strahlenschutzvorschriften für die klinische Forschung vereinfacht werden. Sogenannte Anzeige- und Genehmigungsverfahren für die “Anwendungen radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung am Menschen zum Zweck der medizinischen Forschung” sollen mit den Genehmigungen klinischer Prüfungen von Arzneimitteln oder Medizinprodukten verknüpft werden.
Auch will die Ampel-Koalition den Pharmaunternehmen den Marktzugang für neue Therapien erleichtern. Die Unternehmen sollen deswegen künftig für Arzneimittel mit neuen Wirkstoffen vertrauliche Erstattungsbeträge mit den Krankenkassen vereinbaren dürfen. Die Vertraulichkeit soll bis zum Ende des Patentschutzes gelten. Bislang sind die zwischen den Unternehmen und den Kassen vereinbarten Erstattungsbeträge für patentgeschützte Arzneimittel öffentlich. Dies schränke Verhandlungsspielräume ein, heißt es in dem Entwurf.
Für den Verband der forschenden Pharmaunternehmen (vfa) greift der Entwurf, trotz vieler Zugeständnisse an die Unternehmen, noch zu kurz. Der vfa-Präsident Han Steutel begrüßte am Montag in einer Mitteilung zwar grundsätzlich, dass die Bundesregierung den sinkenden Studienzahlen im Pharmabereich entgegensteuert. Dafür seien schnellere Entscheidungswege und landesweit konsistente ethische und datenschutzrechtliche Anforderungen nötig. Der Referentenentwurf springe aber “noch zu kurz, um Deutschland wieder in die internationale Spitzengruppe zurückzubringen.” Der vfa kritisierte konkret, dass Deutschland weiter auf eine zusätzliche Strahlenschutz-Behörde setzt und Mustervertragsklauseln nicht verbindlich mache.
Zu letzterem Punkt wurde bereits im Dezember auch von Seiten der medizinischen Hochschulforschung Kritik laut. Frank Wissing, Generalsekretär des Medizinischen Fakultätentags (MFT), sprach sich damals im Gespräch mit Table.Media zudem gegen die Schaffung einer zentralisierten Bundes-Ethik-Kommission aus. “Noch eine weitere Institution aufzubauen, ist aus unserer Sicht mit Blick auf die dringend erforderliche Harmonisierung nicht zielführend. Vielmehr sollte der Arbeitskreis der Ethikkommissionen durch die Einführung einer verbindlichen Mehrheitsregelung arbeits- und entschlussfähiger gemacht werden.” Zudem warnte Wissing davor, das BfArM einseitig zu stärken. Eine einzelne Megabehörde allein sei keine Lösung. tg mit rtr
Die im Jahr 2011 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) eingerichtete Förderlinie “Forschung zu sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in pädagogischen Kontexten” wird Ende 2024 abgeschlossen. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion hervor.
In einem offenen Brief hatten Universitäts- und Hochschulprofessoren im Oktober 2023 die Weiterführung und den Ausbau dieses Forschungsbereichs gefordert. Nun steht fest: Das BMBF plant keine vierte Förderrunde. Aufgrund des erreichten Forschungsstands seien keine weiteren Fördermaßnahmen vorgesehen.
In dem Förderschwerpunkt seien insgesamt 45 Forschungs- und Entwicklungsprojekte, fünf Juniorprofessuren und zwei Nachwuchsforschungsgruppen mit einem Gesamtvolumen von 32 Millionen Euro gefördert worden. Damit habe das BMBF einen wichtigen Beitrag geleistet, um wissenschaftlich fundierte Präventions- und Interventionsmaßnahmen entwickeln zu können. abg
Fatma Deniz wird Vizepräsidentin der TU Berlin (TUB) mit dem Ressortzuschnitt Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Christian Schröder wurde als TUB-Vizepräsident für Studium und Lehre, Lehrkräftebildung und Weiterbildung für eine zweite Amtszeit bestätigt. Deniz leitet das Fachgebiet Sprache und Kommunikation in Biologischen und Künstlichen Systemen.
Gerd Leuchs, Direktor Emeritus am Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts in Erlangen, wurde von den Mitgliedern der Gesellschaft für Optik und Photonik Optica für 2024 zum Präsidenten gewählt.
Katharina Lorenz wird Präsidentin der Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU). Die Archäologin und bisherige Erste Vizepräsidentin wird die erste Frau an der Spitze der JLU. Sie leitet die Universität seit Oktober 2023 in Vertretung für den bisherigen Präsidenten Joybrato Mukherjee, der als Rektor an die Universität zu Köln wechselte.
Sebastian Schröer-Werner wurde für weitere fünf Jahre als Rektor der Evangelischen Hochschule Berlin gewählt.
Stefan Schwartze, bisher administrativer Vorstand des Deutschen GeoForschungsZentrums GFZ, ist am 23. Januar 2024 zum “Vizepräsidenten Finanzen, Personal und Infrastruktur” des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) gewählt worden.
Wolfgang Wick bleibt Vorsitzender des Wissenschaftsrats. Er wurde bei der Wintersitzung für ein weiteres Jahr im Amt bestätigt. An der Spitze der Wissenschaftlichen Kommission gibt es dagegen eine Veränderung: Julia Arlinghaus wurde zur neuen Vorsitzenden gewählt und löst damit Heike Solga ab, die nach sechs Jahren aus dem Wissenschaftsrat ausscheidet.
Ab dem 1. Februar 2024 neu vom Bundespräsidenten in den Wissenschaftsrat berufen wurden: Liane G. Benning (FU Berlin), Folkmar Bornemann (TU München), Petra Dersch (Universität Münster), Frank Kalter (Universität Mannheim), Gabriele Metzler (HU Berlin), Friederike Pannewick (Philipps-Universität Marburg), Klement Tockner (Senckenberg Gesellschaft Frankfurt), Eva-Lotta Brakemeier (Universität Greifswald)
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!
Europe.Table. AI Act auf der Kippe: Länder befürchten Wettbewerbsnachteil für aufstrebende KI-Unternehmen in Europa. Der Kompromiss war hart erarbeitet. Dass Deutschland und Frankreich nun zum AI Act nicht klar Position beziehen, sorgt für Kritik. Viele Stimmen aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft sind überzeugt, dass es besser wäre, ein Gesetz mit Schwächen zu haben als gar kein Gesetz. Mehr
ESG.Table. Wissenschaft: Kritik am EU-Lieferkettengesetz basiert auf falschem Verständnis der Auswirkungen. Das EU-Lieferkettengesetz könnte scheitern, wenn sich Deutschland wegen der ablehnenden Haltung der FDP im Rat enthalten sollte. Wissenschaftler halten der FDP und Wirtschaftsverbänden ein falsches Verständnis von den Auswirkungen der geplanten Richtlinie vor. Mehr
Solarwatt aus Dresden kapituliert vor chinesischer Konkurrenz. Nach dem Rückzug von Meyer Burger fürchtet nun auch der Dresdner Modulproduzent Solarwatt eine Einstellung seiner Produktion und ruft nach politischer Unterstützung – gegen die Flut günstiger Solarmodule aus China. Mehr
China.Table. “Wir bauen zu zögerlich China-Expertise auf”. Als frisch berufener Professor an der Goethe-Universität in Frankfurt will Philipp Böing China-Forschung aus der Wirtschaftswissenschaft heraus betreiben. Warum das dringend nötig ist, erläutert er im Gespräch mit Marcel Grzanna. Mehr
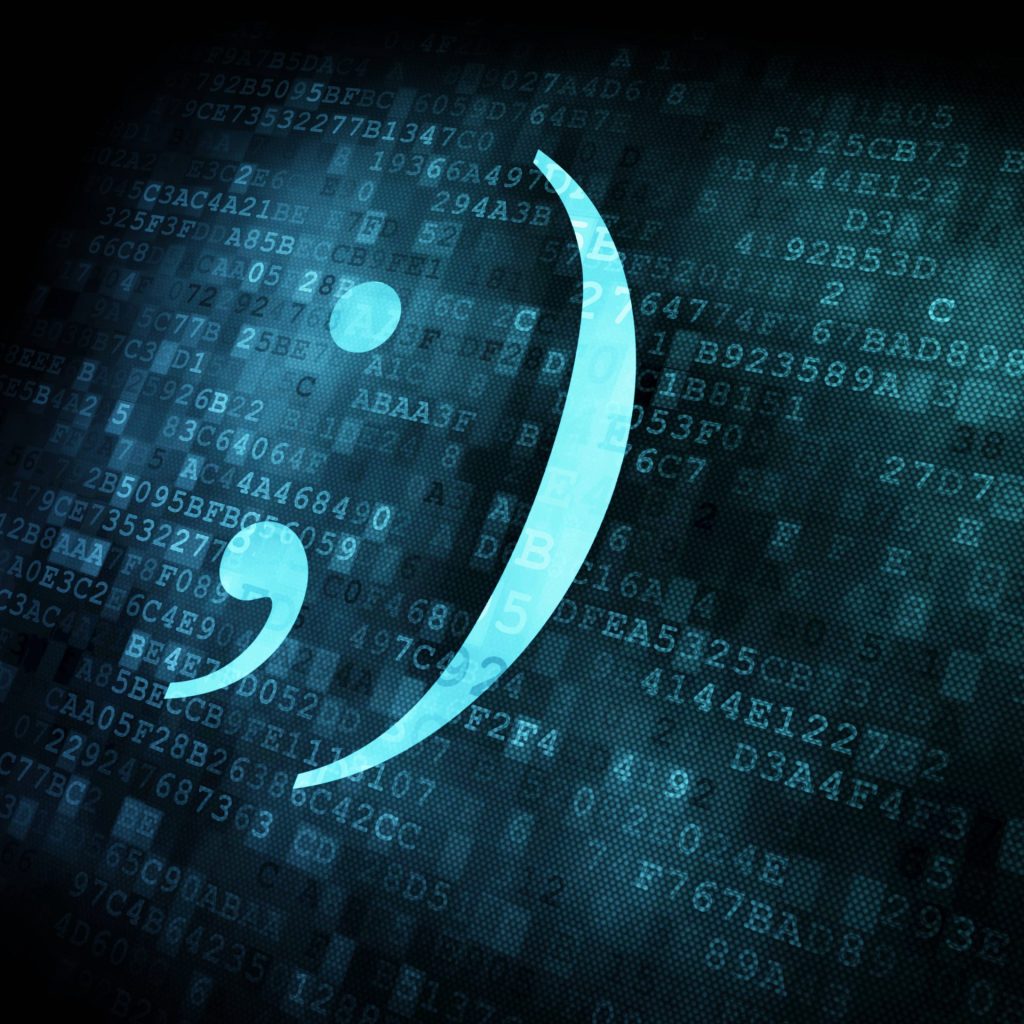
Die Überschriften in wissenschaftlichen Fachzeitschriften sind für gewöhnlich so korrekt formuliert, dass schon beim Lesen der ein bis zwei Zeilen jeder aussteigt, der sich nicht wie verrückt für das jeweilige Thema beziehungsweise Fachgebiet interessiert. Meistens machen das die Mediateams der Journale wieder wett, indem sie die Titel der Pressemitteilungen zu den jeweiligen Studien etwas knackiger formulieren.
Ein Beispiel aus dem Nature-Magazin: Aus der jüngst erschienenen Studie “A dedicated hypothalamic oxytocin circuit controls aversive social learning” wurde für die mediale Aufmerksamkeit “Brain mechanism teaches mice to avoid bullies” gemacht. Das ist doch viel hübscher.
Manche Studientitel sind aber schon im Original gut. Ein Beispiel: “Fantastic yeasts and where to find them: the discovery of a predominantly clonal Cryptococcus deneoformans population in Saudi Arabian soils” überschrieb ein kanadisches Team vor einigen Jahren seine im Journal FEMS Microbiology Ecology erschienene Arbeit über hefeähnliche Pilze, die es in Bodenproben in Saudi-Arabien gefunden hat.
Das ist nicht zu toppen, oder? Der US-amerikanische Meeresschutzbiologe David Shiffman hatte sich das mit den fantastic yeasts gemerkt und kürzlich auf Bluesky andere Wissenschaftler aufgerufen, ihre Lieblingsüberschriften aus wissenschaftlichen Fachjournalen zu nennen. Es kam ein bisschen was zusammen. Etwa: “Identifying species from pieces of feces” (Conservation Genetics, 2004), “2D or not 2D”: Shape-programming polymer sheets” (Progress in Polymer Science, 2016) oder “The Moon is Acquitted of Murder in Cleveland” (Skeptical Inquirer, 1985). Manche humorigen Überschriften werden jedoch auch abgelehnt. David Shiffman selbst bedauert beispielsweise bis heute, dass er mit “Sharks, lies and videotape” nicht durchkam. Anne Brüning
auch an diesem Wochenende sind in Deutschland Hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen. Die Berichte über konkrete Vertreibungspläne von Millionen Menschen, geschmiedet auf einem geheimen Treffen zahlreicher AfD-Funktionäre in Potsdam, erschüttern die Gesellschaft nachhaltig, so auch die Wissenschaft.
Doch wie sollte und muss sich Wissenschaft einbringen? Etwa in die Debatte um ein AfD-Verbot? Oder unter dem Hashtag #lautewissenschaft? Was ist erlaubt? Schließlich gilt doch grundsätzlich das Neutralitätsgebot.
Es sei wichtig, sich in dieser Situation, die auch die Wissenschaftsfreiheit bedroht, zu Wort zu melden, sagte am Wochenende HRK-Präsident Walter Rosenthal im Gespräch mit dem Deutschlandfunk. Bei politischen Äußerungen müsse natürlich immer abgewogen werden: Handele es sich um etwas allgemeinpolitisches oder um etwas, das die Hochschulen auch in ihrem Kern betreffe? Dies sei im Augenblick der Fall. Daher habe die HRK sich auf klar gegen rechts positioniert.
Und dieses Mal bleibt es auch nicht bei Veröffentlichungen von Statements. In den Büros und Fluren der Hochschulen wird diskutiert, was wäre, wenn in Thüringen, Brandenburg oder Sachsen die AfD die Wahlen gewinnt?
Anja Steinbeck, Rektorin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, rief persönlich über die Plattform X zur Teilnahme an der lokalen Demonstration auf. “Jede Zeit hat ihre Aufgabe, und durch die Lösung derselben rückt die Menschheit weiter”, schreibt sie in ihrem Post auf X. Es wird in diesen Tagen noch vieles zu klären sein. Etwa an welchen Leitlinien sich einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Hochschulen und Forschungseinrichtungen orientieren können, wenn sie sich klar gegen rechts positionieren wollen. Aber die Statements und Proteste machen Mut.
Damit enthält die breite Bewegung im Land auch einen Arbeitsauftrag, nicht nur an die Politik, an uns Medien, sondern weiterhin auch an die Wissenschaft. Lange Zeit hat man auf den Schutz einer starken Demokratie vertraut, die Aussagen der AfD mit einem Kopfschütteln abgetan. Dringend muss sich auch die Wissenschaft fragen, was sie als Teil einer demokratischen Gesellschaft beitragen will, um Rassismus und Autoritarismus zurückzudrängen.
Nachdenkliche Grüße,


Bei der Vorstellung der aktuellen Empfehlungen des Wissenschaftsrats wird dessen Vorsitzender, Wolfgang Wick, in seinem Eingangsstatement deutlich: Die aktuellen rassistischen, antisemitischen und antidemokratischen Tendenzen bedrohten Weltoffenheit und Internationalität, die nicht nur für die Wissenschaft zentral seien. Der Wissenschaftsrat, “setzt sich für eine offene und vielfältige Gesellschaft ein, die das Fundament für eine freie und leistungsfähige Wissenschaft ist”.
Für beide Themen der Pressekonferenz am gestrigen Montag spielt das Thema vor allem im Hinblick auf internationale Studierende eine Rolle. Sowohl für die Entwicklung der Hochschulen im Land Brandenburg, das den Wissenschaftsrat um Empfehlungen gebeten hatte, als auch für die Zukunft der Hochschulen vor dem Hintergrund stagnierender Studierendenzahlen haben diese eine besondere Bedeutung. Bislang halten junge Menschen aus anderen Ländern in vielen Städten und Regionen die Studierendenzahl noch einigermaßen konstant.
Mittel- und langfristig wird der demografische Wandel die Hochschulen erreichen – allerdings in unterschiedlichem Maße. Während einige Standorte in attraktiven (Groß-)städten kaum einen Einbruch spüren werden, müssten sich Einrichtungen im ländlichen Raum gezielt vorbereiten. Es brauche ein attraktives Portfolio und gute Bedingungen, um im Wettbewerb um Studierende und Nachwuchswissenschaftler mithalten zu können.
Insgesamt sollten Hochschulen stagnierende oder gar sinkende Studierendenzahlen für eine Steigerung der Qualität nutzen, schreibt Wolfgang Wick in seinem jährlichen Bericht zu aktuellen Tendenzen im Wissenschaftssystem. “Die Hochschulen bekommen die Chance, Fehlentwicklungen der Wachstumsperiode zu korrigieren, die Qualität der Lehre zu verbessern, den Anteil erfolgreicher Abschlüsse zu steigern und die Digitalisierung voranzutreiben.”
Sinkende Studierendenzahlen sind allerdings nicht nur eine Chance zur Konsolidierung – manche Standorte werden dadurch auch in ihrer Existenz bedroht. Die Politik müsse der “Versuchung kurzsichtiger Einsparungen widerstehen”, meint Wick weiter. Es gehe eher darum, nicht ausgelastete Studienangebote in Abstimmung mit Hochschulen in der jeweiligen Region abzubauen, zusammenzulegen oder durch attraktivere Angebote zu ersetzen.
Wie man dem demografischen Wandel begegnen kann, machen die privaten Hochschulen vor: Diese erschließen neue Zielgruppen durch Studienformate, die Berufstätigen, Eltern und beruflich Ausgebildeten ein Studium ermöglichen. Das bestätigt auch Marc Hüsch vom Centrum für Hochschulentwicklung (CHE): Private Hochschulen seien oft flexibler und reagierten schneller auf sich verändernde Bedarfe. Auch bei der Internationalisierung und bei der Kommunikation nach außen könnten hier die staatlichen Hochschulen etwas lernen.
Neben den sinkenden Studierendenzahlen müssen sich in Brandenburg die vorwiegend kleinen Hochschulen im Land die Frage stellen, wie sie die kritische Forschermasse erhalten, um in den einzelnen Bereichen gute Wissenschaft betreiben zu können. Der Wissenschaftsrat attestiert immerhin in den gestern vorgelegten Empfehlungen der brandenburgischen Hochschullandschaft “keinen grundlegenden Änderungsbedarf”, wie es die Vorsitzende der Arbeitsgruppe, Sabine Maasen, formulierte.
Eine Mischung aus Profilierung, Vernetzung, strategischer Entwicklung, Kommunikation und Innovation in Studium und Lehre ist in den Empfehlungen des 350 Seiten starken Papiers enthalten. Die Hochschulen in Brandenburg sollen:
Für das Ministerium in Potsdam formulierte der Wissenschaftsrat folgende Empfehlungen:
Brandenburgs Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) hob “gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse in Potsdam” die Bedeutung einer guten Willkommenskultur für ausländische Studierende hervor. Man habe nach Berlin den zweithöchsten Anteil bei internationalen Studierenden. Es gelte jetzt, diese öfter zu einem erfolgreichen Abschluss und dann in den Arbeitsmarkt zu bringen.
Matthias Barth, Präsident der Hochschule Eberswalde, unterstrich im Gespräch mit Table.Media, dass sich die Finanzierungsstruktur ändern sollte. Die aktuelle Leistungsindikatorik werde durch die sogenannte “Dämpfung” am Ende konterkariert, die letztlich die Zuwendungen wieder nivelliere. So belohne man gerade forschungsstarke Hochschulen mit hohem Drittmittelanteil nicht.
Weitere Empfehlungen betrafen insbesondere die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg (BTU). Im vergangenen Jahr wurde bereits klar, dass die Medizin eine eigene Universität in der Lausitz bekommen soll und nicht als medizinische Fakultät an die BTU angegliedert wird. Bereits vor den Empfehlungen zu deren Ausgestaltung, die im Frühjahr anstehen, machte der WR deutlich, dass er eine enge Kooperation der beiden Universitäten erwartet. Gleichzeitig empfiehlt er, die hochschulübergreifende Fakultät für Gesundheitswissenschaften aufzulösen.
Mit Blick auf die Entwicklung der BTU seit der Fusion zwischen TU Cottbus und der Hochschule Lausitz formulierte der WR klare Kritik an Forschungsleistung und der Entwicklung der Studierendenzahlen. Die BTU müsse sich zu einer reinen Universität weiterentwickeln.
Diese Empfehlung begrüßt BTU-Präsidentin Gesine Grande ausdrücklich. Derzeit seien gerade mit Blick auf die Forschung die Potenziale der ehemaligen FH-Kolleginnen und -Kollegen kaum nutzbar. Diese hätten immer noch 18 Semesterwochenstunden Lehre zu leisten. Daher arbeite man intensiv mit dem Ministerium daran, diese Zweiteilung im Kollegium zu beenden. Gerade angesichts des Strukturwandels und der Ansiedlung vieler außeruniversitärer Forschungsinstitute brauche es eine “Forschung auf Augenhöhe” an der BTU. Bei den Studierendenzahlen scheine jedoch die Trendwende bereits geschafft. Und mit rund 40 Prozent internationalen Studierenden sei man hier sogar Vorreiter, betont Grande.
Im Herbst soll es losgehen. Dann will die German University of Digital Science damit beginnen, die ersten Fachleute für den digitalen Wandel auszubilden – weltweit und in englischer Sprache. Hinter dem Konzept dieser neuen, vollständig digital arbeitenden Universität in Potsdam stehen Mike Friedrichsen und Christoph Meinel. Friedrichsen ist noch bis Februar Professor für Wirtschaftsinformatik und digitale Medien an der Stuttgarter Hochschule der Medien, Meinel ist der frühere Direktor des Potsdamer Hasso-Plattner-Instituts (HPI).
Die beiden haben den Zulassungsantrag für die private Hochschule bei der Landesregierung Brandenburg eingereicht, derzeit prüft das Wissenschaftsministerium das Konzept. Die beiden Universitätsgründer erwarten, dass sich der Wissenschaftsrat im Frühjahr mit dem Projekt befassen wird.
Die Gründer wollen mit der vollständig digitalisierten Uni den weltweiten IT-Fachkräftemangel aktiv bekämpfen. Alle administrativen Prozesse sind digitalisiert, es gibt kein Papier im bereits existierenden Headquarter CloudHouse in Potsdam. Von dort werden die digitalen Angebote der Universität verbreitet. In einem virtuellen Raum, im Metaverse, soll die Uni sichtbar sein. Dort kann man sich treffen, austauschen.
Auch eine Lernplattform wird geschaffen, auf der das gesamte Online-Angebot hinterlegt sein soll. Jeder Studierende kann dann Tag für Tag entscheiden, ob er die virtuelle Uni betreten oder einfach für sich selbst ein Modul auf der Lernplattform bearbeiten will.
“Das Revolutionäre an unserem Modell ist: Wir können weltweit Programme anbieten und mit renommierten Professoren zusammenarbeiten, die nicht für den Job umziehen müssen”, sagt Friedrichsen. Insgesamt sollen 20 Professoren in den nächsten drei Jahren berufen werden. Außerdem wolle man eng mit regionalen und internationalen Unternehmen kooperieren, “die den Transformationsnutzen erkennen und Fachkräftebedarf haben”. Sie könnten auf diesem Weg internationale Talente in spezialisierten Bereichen gewinnen.
Ein Konzept mit Zukunft? Ulrich Müller vom Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) sieht die Gründung der German Digital University positiv. “Eine Online-Hochschule reagiert auf den Bedarf nach zeitlich und räumlich flexiblen digitalen Angeboten für berufsbegleitendes Studium und lebenslanges Lernen. Sie greift also relevanten Bedarf auf”, sagt Müller. Die Hochschulwelt in Deutschland sei im Umbruch. Und die Hochschulen müssten angemessen auf veränderte Rahmenbedingungen und Erwartungshorizonte reagieren.
Eine reine Online-Hochschule sei eine denkbare und sinnvolle Option eines Hochschulprofils. Sie existiere auch schon in Deutschland, etwa in Teilen in der privaten Fachhochschule IU mit Sitz in Erfurt oder der Tomorrow University in Frankfurt am Main. Die Tomorrow University ist die erste virtuelle Universität, die eine Zulassung in Deutschland erreicht hat. Bis heute betreut die Universität nach eigenen Angaben rund 400 Lernende für Bachelor- und Masterstudiengänge. Die Studierenden können auf eine eigene App, einen virtuellen Online-Campus und Slack zugreifen.
International sei die Hochschulwelt noch bunter als in Deutschland, sagt Ulrich Müller. Die bekannteste vollständig digitalisierte Universität existiert etwa in den USA: die 2012 gegründete Minerva University mit Sitz in San Francisco. Die Studierenden nehmen an Kursen online teil, es gibt eine enge Zusammenarbeit mit Unternehmen. Im Gegensatz zur German Digital University ziehen die Studierenden der Minerva University allerdings alle vier Monate in eine andere Stadt.
“Ja, es gibt einige wenige Beispiele. Aber dass der gesamte Administrationsbereich, der Lehrbereich, die Organisation der Mitarbeiter digital organisiert ist, das habe ich noch nirgends gesehen”, sagt Friedrichsen. “Wir sind mit diesem Konzept der vollständig digitalisierten Uni, die auch im Metaverse auftritt, Vorreiter in Europa.”
Die German University of Digital Science plant im Herbst den Start mit drei Master of Science-Programmen und einem Master of Business Administration-Programm. Die Zielgruppen sind Studierende aus dem globalen Süden, aus Regionen ohne Präsenz-Studienmöglichkeiten und Berufstätige im Bereich KI. Pro Studienjahr zahlen Studierende 7.500 Euro – für jedes Programm. Auch Stipendien sind geplant.
“In der Aufbauphase haben wir unsere Universität vor allem aus eigenen Mitteln finanziert”, sagt Friedrichsen. Außerdem haben die Gründer eine Verbrauchsstiftung gegründet, die als Finanzierungsquelle für die sogenannte German UDS GmbH, ihrer gemeinnützigen Trägergesellschaft, dient. Die Stiftung hält 51 Prozent der Anteile, um Gemeinnützigkeit und Unabhängigkeit zu gewährleisten. Die restlichen 49 Prozent der Anteile möchten Meinel und Friedrichsen an Unternehmen verkaufen, um die Universität zu finanzieren. Namhafte Unternehmen, wie die Telekom und die PSD-Bank Berlin-Brandenburg, seien bereits Unterstützer.
Die erfolgreiche Umsetzung ihres Modells könnte eine Inspiration für etablierte Hochschulen sein, davon ist Friedrichsen überzeugt: “In fünf bis zehn Jahren wird vieles von dem, was wir jetzt gerade etablieren, vollkommen normal in der Hochschullandschaft sein.”
15.-17. Februar 2024, Denver und online
Tagung AAAS Annual Meeting – Toward Science Without Walls Mehr
26./27. Februar 2024, jeweils von 09.30 bis 13.00 Uhr, online
Online-Forum (€) CHE Online-Forum zu Folgen sinkender Erstsemesterzahlen Mehr
8. März 2024, 10:00 Uhr, Frankfurt am Main und online
Diskussion Wissenschaftsjahr Freiheit: Diskussion u.a. mit Bettina Stark-Watzinger, Alena Buyx und Antje Boetius Mehr
Diese Terminankündigung hat so manchen in der Community stutzig gemacht: Am Freitagabend verleiht das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit dem langjährigen Präsidenten des Deutschen Hochschulverbands, Bernhard Kempen, den Preis für Wissenschaftsfreiheit.
Das ist bemerkenswert, weil die Veranstaltung des kritisch beobachteten Netzwerks nicht irgendwo stattfindet, sondern im Einsteinsaal der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (BBAW). Auf der Plattform X wurde gefragt, ob man genauer hingeschaut habe, wer da demnächst zu Gast sei und ob es sich um eine bewusste Entscheidung handele. Keine zwei Stunden später erklärte BBAW-Präsident Christoph Markschies, dass es sich um eine Fremdveranstaltung handele. “Das Veranstaltungszentrum der BBAW, ein Eigenbetrieb der Akademie, vermietet Räume für Veranstaltungen”, schrieb er am Sonntag auf X. “Hätte das Veranstaltungszentrum die Miet-Anfrage für die Veranstaltung abgelehnt, hätte es damit das Narrativ bestätigt, dass bestimmte Positionen hierzulande ,gecancelt’ werden.”
Angesprochen auf seine Einschätzung des Netzwerks verweist Markschies auf die BBAW-Arbeitsgruppe “Wandel der Universitäten und ihres gesellschaftlichen Umfelds: Folgen für die Wissenschaftsfreiheit?”. Deren soziologische und rechtswissenschaftliche Analysen der Beobachtung der Wissenschaftsfreiheit in unserem Lande erschienen ihm “präziser und umfassender angelegt” als das, was er vom Netzwerk kenne, sagte er auf Anfrage.
Das Netzwerk für Wissenschaftsfreiheit ist eigenen Angaben zufolge ein “Zusammenschluss von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich für ein freiheitliches Wissenschaftsklima einsetzen”. Es wurde im Jahr 2020 gegründet und hat inzwischen mehr als 700 Mitglieder, denen es zum Beispiel darum geht, “die Freiheit von Forschung und Lehre gegen ideologisch motivierte Einschränkungen zu verteidigen”.
In den von dem Netzwerk herausgegebenen Stellungnahmen und offenen Briefen findet sich zum Beispiel die Forderung “Gendersprache darf niemandem aufgezwungen werden”. Oder die Kritik am Beck-Verlag an deren Entscheidung, die Zusammenarbeit mit Hans-Georg Maaßen zu beenden und “damit erneut vor einer gegen den Verlag gerichteten Kampagne in die Knie zu gehen”. Besorgt äußerte es sich jüngst auch “über die Absage von Veranstaltungen und Vorträgen im Zusammenhang mit dem Gaza-Konflikt und Israel in den vergangenen Wochen”.
In der Liste der Mitglieder finden sich einige bekannte Namen. Aktuell bedeutsam: Auch der Rechtswissenschaftler Ulrich Vosgerau gehört dem Netzwerk Wissenschaftsfreiheit an. Er hatte an dem Geheimtreffen von Rechten und Rechtsextremen am Lehnitzsee bei Potsdam teilgenommen. Vosgerau ist CDU-Mitglied und Privatdozent an der Universität Köln. Sein aktueller Status dort ist jedoch ungeklärt, teilte die Uni mit: “Seit 2015 ist er nicht mehr an der Universität zu Köln beschäftigt, seit 2018 lehrt er zudem nicht mehr an der Fakultät. Ob die Voraussetzungen für den Status ,Privatdozent’ noch gegeben sind, wird die Universität zu Köln prüfen.”
Über die Motive des Rechtswissenschaftlers Bernhard Kempen, sich von dem Netzwerk ehren zu lassen, lässt sich nur spekulieren. Kempen ist Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Köln und war von 2004 bis 2023 Präsident des Deutschen Hochschulverbands (DHV).
Der DHV äußert sich nicht zu dem Preis, betont auf Anfrage von Table.Media jedoch, dass “das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit einen Konformitätsdruck in der Debattenkultur an Universitäten bemängelt und damit ein Unbehagen bestätigt, das der DHV unter der Ägide von Bernhard Kempen bundesweit als einer der ersten artikuliert hat”. Insofern sehe der DHV “im Netzwerk einen willkommenen Mitstreiter, der gemeinsam für eine von Sachargumenten und gegenseitigem Respekt geprägte Debattenkultur an den Universitäten eintritt und wirbt”. abg
Gemeinsame Patente zwischen europäischen und chinesischen Unternehmen entstanden in den vergangenen Jahren vor allem in den Bereichen Telekommunikation, Informationstechnologie und Elektronik. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie des EU-Projektes Reconnect China, das ermitteln soll, auf welchen Feldern eine Zusammenarbeit der Europäischen Union mit China “wünschenswert, möglich oder unmöglich ist”. “Bei den Ländern ist Deutschland der größte Patentpartner für China in Europa, gefolgt von Finnland, Schweden und Frankreich”, sagt Mitautor Philipp Brugner zu Table.Media. “Das zeigt sich auch in der Herkunft der Firmen, die involviert sind.” Nokia aus Finnland führe das Feld an, gefolgt von Ericsson, einer Nokia-Tochter, Siemens, ABB, Bosch und L’Oréal.
Dass die Co-Patente vor allem aus Großunternehmen stammen, zeige, “dass die gemeinsame Patentierung zwischen der EU27/AC und China in erster Linie ein kommerzielles Unterfangen ist, das von der Telekommunikations-/Elektronikbranche und industriellen Schwergewichten aus Deutschland und Frankreich dominiert wird“, heißt es in der Studie. Eine bemerkenswerte Ausnahme sei das französische, vom Staat unterstützte Forschungsinstitut Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) mit 67 Co-Patentanmeldungen mit chinesischen Institutionen in der Patentdatenbank PATSTAT.
Auf der chinesischen Seite sieht es anders aus. “Mehrere der aktivsten Bewerber sind chinesische Ableger der oben genannten europäischen Unternehmen“, schreiben die Autoren. So melde Nokia Finnland gemeinsam mit eigenen China-Töchtern Co-Patente an. Auch die Shanghai-Tochter des US-Unternehmens NAVTEQ sei aktiv. Aber auch “echte” chinesische Unternehmen wie Huawei, Lenovo, TCL oder Geely seien stark bei Co-Patenten vertreten: “Hervorzuheben ist, dass auch alle Top-15-Anmelder aus China große Unternehmen sind.” Auch in China seien Telekommunikations- und Elektroniksektor am stärksten vertreten.
Generell gelte der Zugang zu Innovationen durch Patente als sogenannte “secondary innovation”, bei der “Technologien nicht importiert werden, um zu kopieren – sondern um zu verstehen und durch einen oder mehrere eigene Entwicklungsschritte grundsätzlich zu verbessern”, erklärt Brugner. Ein Beispiel, wie China das genutzt habe, seien grüne Technologien, bei denen China anfangs auf ausländische Produkte und Anlagen gesetzt habe, etwa bei Windanlagen oder Photovoltaik. “Heute ist China nicht nur Hauptproduzent, sondern auch unter den stärksten Innovatoren bei den grünen Technologien, was wir aus dem Anteil an international registrierten Patenten zu diesen Technologien ablesen konnten.”
Bis 2018 war die Zahl der angemeldeten Co-Patente stetig angestiegen. Wegen der fehlenden Daten bricht sie danach ein. Die Autoren gehen aber davon aus, “dass die Anzahl der gemeinsam angemeldeten Patente 2021 und 2022 weiter gestiegen ist”, wie Brugner sagt. Das Interesse Chinas an Europa sei groß. “Ich glaube, dass wir den gleichen Trend sehen können wie bei gemeinsamen Publikationen: Die Zusammenarbeit mit China in Bezug auf künstliche Intelligenz und digitale Technologien wird immer wichtiger“, meint Mitautor Gábor Szüdi. “Und bei den Co-Patenten sehen wir vor allem wirklich den Fokus auf die ganz konkrete Angewandte Wissenschaft.” China sei an Kooperation in diesem Feld sehr interessiert.
Nach Angaben der Autoren war die Motivation der Studie nicht, den an Co-Patenten mit China arbeitenden Firmen Empfehlungen zu geben; ihre vorrangige Zielgruppe sei die wissenschaftliche Community. Sie sehen die in ihrer Studie generierten Daten und Erkenntnisse als potenziell wichtige Grundlage für weiterführende Analysen von Wissenschaft und Wirtschaft. Oberziel ist eine höhere China-Kompetenz Europas, auch in Spezialgebieten. Wie dringend dieses Ziel ist, verdeutlichte gerade erst ein vom Deutschen Akademischen Austauschdienst DAAD herausgegebenes Papier. Christiane Kühl
Der von der Bundesregierung angekündigte Entwurf für ein Medizinforschungsgesetz (MFG) – der Table.Media vorliegt – ist am Montag von BMG und BMUV an die betreffenden Verbände verschickt worden. Diese haben bis zum 22. Februar Zeit, zu dem Referentenentwurf Stellung zu nehmen. Am 20. Februar gibt es zudem eine mündliche Anhörung. Zentrales Anliegen des Papiers ist, die Vorschriften für klinische Prüfungen zu vereinfachen.
Der Entwurf entspricht den Vorschlägen, die Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach bereits im Dezember im Zuge der Vorstellung der Pharmastrategie benannt hatte. Demzufolge will die Bundesregierung eine “Bundes-Ethik-Kommission” einrichten, um den Start von Forschungsvorhaben zu beschleunigen. Klinische Studien zu neuen Arzneimitteln, die erstmals am Menschen geprüft werden, und sogenannte Gen- und Zelltherapeutika sollen ab 2025 von dieser Kommission geprüft werden. Bislang sind bis zu 49 Ethik-Kommissionen in den Bundesländern dafür zuständig. Diese sollen zukünftig spezielle Aufgaben übernehmen.
Zudem sollen das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) und das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) sich bei der Zulassung von Arzneimitteln besser koordinieren. Das PEI ist unter anderem für Impfstoffe und Gentherapien zuständig, das BfArM für herkömmliche Arzneimittel. Dem Entwurf zufolge sollen auch die Strahlenschutzvorschriften für die klinische Forschung vereinfacht werden. Sogenannte Anzeige- und Genehmigungsverfahren für die “Anwendungen radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung am Menschen zum Zweck der medizinischen Forschung” sollen mit den Genehmigungen klinischer Prüfungen von Arzneimitteln oder Medizinprodukten verknüpft werden.
Auch will die Ampel-Koalition den Pharmaunternehmen den Marktzugang für neue Therapien erleichtern. Die Unternehmen sollen deswegen künftig für Arzneimittel mit neuen Wirkstoffen vertrauliche Erstattungsbeträge mit den Krankenkassen vereinbaren dürfen. Die Vertraulichkeit soll bis zum Ende des Patentschutzes gelten. Bislang sind die zwischen den Unternehmen und den Kassen vereinbarten Erstattungsbeträge für patentgeschützte Arzneimittel öffentlich. Dies schränke Verhandlungsspielräume ein, heißt es in dem Entwurf.
Für den Verband der forschenden Pharmaunternehmen (vfa) greift der Entwurf, trotz vieler Zugeständnisse an die Unternehmen, noch zu kurz. Der vfa-Präsident Han Steutel begrüßte am Montag in einer Mitteilung zwar grundsätzlich, dass die Bundesregierung den sinkenden Studienzahlen im Pharmabereich entgegensteuert. Dafür seien schnellere Entscheidungswege und landesweit konsistente ethische und datenschutzrechtliche Anforderungen nötig. Der Referentenentwurf springe aber “noch zu kurz, um Deutschland wieder in die internationale Spitzengruppe zurückzubringen.” Der vfa kritisierte konkret, dass Deutschland weiter auf eine zusätzliche Strahlenschutz-Behörde setzt und Mustervertragsklauseln nicht verbindlich mache.
Zu letzterem Punkt wurde bereits im Dezember auch von Seiten der medizinischen Hochschulforschung Kritik laut. Frank Wissing, Generalsekretär des Medizinischen Fakultätentags (MFT), sprach sich damals im Gespräch mit Table.Media zudem gegen die Schaffung einer zentralisierten Bundes-Ethik-Kommission aus. “Noch eine weitere Institution aufzubauen, ist aus unserer Sicht mit Blick auf die dringend erforderliche Harmonisierung nicht zielführend. Vielmehr sollte der Arbeitskreis der Ethikkommissionen durch die Einführung einer verbindlichen Mehrheitsregelung arbeits- und entschlussfähiger gemacht werden.” Zudem warnte Wissing davor, das BfArM einseitig zu stärken. Eine einzelne Megabehörde allein sei keine Lösung. tg mit rtr
Die im Jahr 2011 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) eingerichtete Förderlinie “Forschung zu sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in pädagogischen Kontexten” wird Ende 2024 abgeschlossen. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion hervor.
In einem offenen Brief hatten Universitäts- und Hochschulprofessoren im Oktober 2023 die Weiterführung und den Ausbau dieses Forschungsbereichs gefordert. Nun steht fest: Das BMBF plant keine vierte Förderrunde. Aufgrund des erreichten Forschungsstands seien keine weiteren Fördermaßnahmen vorgesehen.
In dem Förderschwerpunkt seien insgesamt 45 Forschungs- und Entwicklungsprojekte, fünf Juniorprofessuren und zwei Nachwuchsforschungsgruppen mit einem Gesamtvolumen von 32 Millionen Euro gefördert worden. Damit habe das BMBF einen wichtigen Beitrag geleistet, um wissenschaftlich fundierte Präventions- und Interventionsmaßnahmen entwickeln zu können. abg
Fatma Deniz wird Vizepräsidentin der TU Berlin (TUB) mit dem Ressortzuschnitt Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Christian Schröder wurde als TUB-Vizepräsident für Studium und Lehre, Lehrkräftebildung und Weiterbildung für eine zweite Amtszeit bestätigt. Deniz leitet das Fachgebiet Sprache und Kommunikation in Biologischen und Künstlichen Systemen.
Gerd Leuchs, Direktor Emeritus am Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts in Erlangen, wurde von den Mitgliedern der Gesellschaft für Optik und Photonik Optica für 2024 zum Präsidenten gewählt.
Katharina Lorenz wird Präsidentin der Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU). Die Archäologin und bisherige Erste Vizepräsidentin wird die erste Frau an der Spitze der JLU. Sie leitet die Universität seit Oktober 2023 in Vertretung für den bisherigen Präsidenten Joybrato Mukherjee, der als Rektor an die Universität zu Köln wechselte.
Sebastian Schröer-Werner wurde für weitere fünf Jahre als Rektor der Evangelischen Hochschule Berlin gewählt.
Stefan Schwartze, bisher administrativer Vorstand des Deutschen GeoForschungsZentrums GFZ, ist am 23. Januar 2024 zum “Vizepräsidenten Finanzen, Personal und Infrastruktur” des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) gewählt worden.
Wolfgang Wick bleibt Vorsitzender des Wissenschaftsrats. Er wurde bei der Wintersitzung für ein weiteres Jahr im Amt bestätigt. An der Spitze der Wissenschaftlichen Kommission gibt es dagegen eine Veränderung: Julia Arlinghaus wurde zur neuen Vorsitzenden gewählt und löst damit Heike Solga ab, die nach sechs Jahren aus dem Wissenschaftsrat ausscheidet.
Ab dem 1. Februar 2024 neu vom Bundespräsidenten in den Wissenschaftsrat berufen wurden: Liane G. Benning (FU Berlin), Folkmar Bornemann (TU München), Petra Dersch (Universität Münster), Frank Kalter (Universität Mannheim), Gabriele Metzler (HU Berlin), Friederike Pannewick (Philipps-Universität Marburg), Klement Tockner (Senckenberg Gesellschaft Frankfurt), Eva-Lotta Brakemeier (Universität Greifswald)
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!
Europe.Table. AI Act auf der Kippe: Länder befürchten Wettbewerbsnachteil für aufstrebende KI-Unternehmen in Europa. Der Kompromiss war hart erarbeitet. Dass Deutschland und Frankreich nun zum AI Act nicht klar Position beziehen, sorgt für Kritik. Viele Stimmen aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft sind überzeugt, dass es besser wäre, ein Gesetz mit Schwächen zu haben als gar kein Gesetz. Mehr
ESG.Table. Wissenschaft: Kritik am EU-Lieferkettengesetz basiert auf falschem Verständnis der Auswirkungen. Das EU-Lieferkettengesetz könnte scheitern, wenn sich Deutschland wegen der ablehnenden Haltung der FDP im Rat enthalten sollte. Wissenschaftler halten der FDP und Wirtschaftsverbänden ein falsches Verständnis von den Auswirkungen der geplanten Richtlinie vor. Mehr
Solarwatt aus Dresden kapituliert vor chinesischer Konkurrenz. Nach dem Rückzug von Meyer Burger fürchtet nun auch der Dresdner Modulproduzent Solarwatt eine Einstellung seiner Produktion und ruft nach politischer Unterstützung – gegen die Flut günstiger Solarmodule aus China. Mehr
China.Table. “Wir bauen zu zögerlich China-Expertise auf”. Als frisch berufener Professor an der Goethe-Universität in Frankfurt will Philipp Böing China-Forschung aus der Wirtschaftswissenschaft heraus betreiben. Warum das dringend nötig ist, erläutert er im Gespräch mit Marcel Grzanna. Mehr
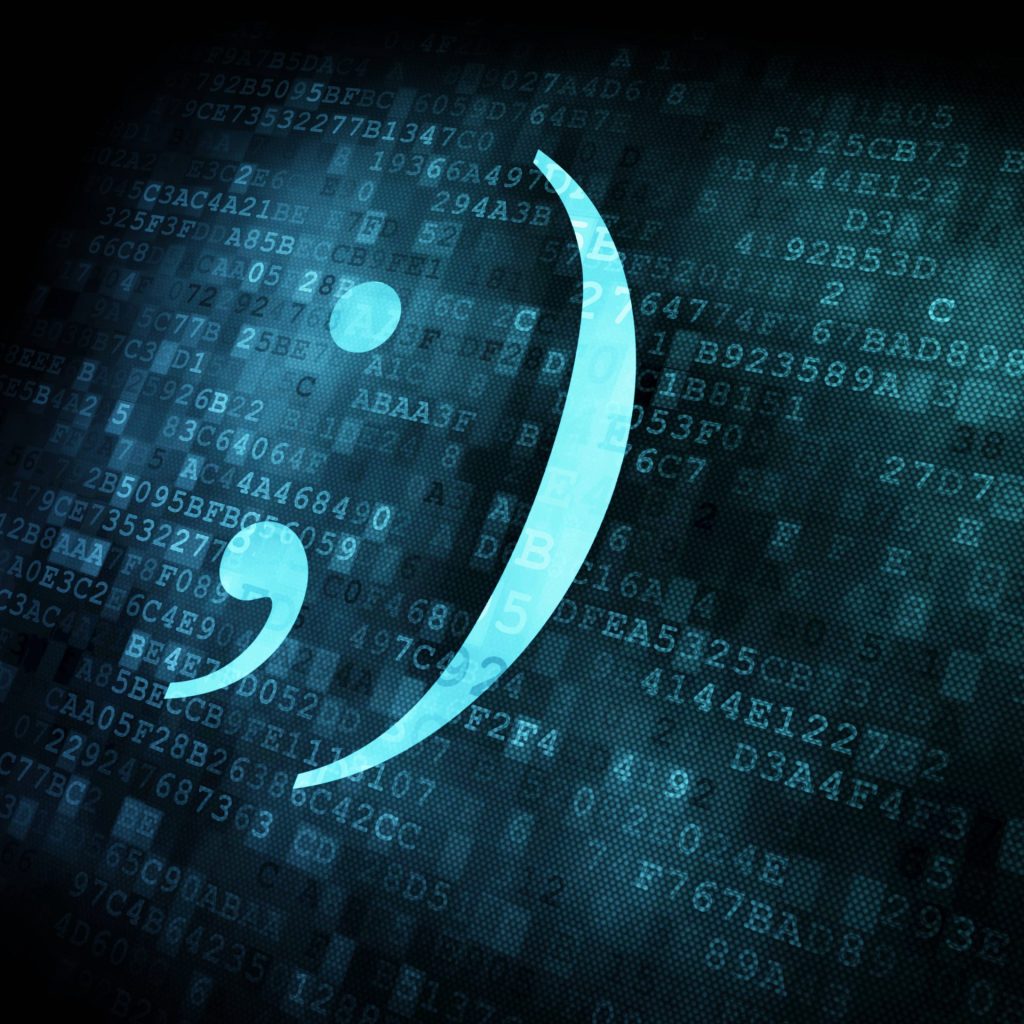
Die Überschriften in wissenschaftlichen Fachzeitschriften sind für gewöhnlich so korrekt formuliert, dass schon beim Lesen der ein bis zwei Zeilen jeder aussteigt, der sich nicht wie verrückt für das jeweilige Thema beziehungsweise Fachgebiet interessiert. Meistens machen das die Mediateams der Journale wieder wett, indem sie die Titel der Pressemitteilungen zu den jeweiligen Studien etwas knackiger formulieren.
Ein Beispiel aus dem Nature-Magazin: Aus der jüngst erschienenen Studie “A dedicated hypothalamic oxytocin circuit controls aversive social learning” wurde für die mediale Aufmerksamkeit “Brain mechanism teaches mice to avoid bullies” gemacht. Das ist doch viel hübscher.
Manche Studientitel sind aber schon im Original gut. Ein Beispiel: “Fantastic yeasts and where to find them: the discovery of a predominantly clonal Cryptococcus deneoformans population in Saudi Arabian soils” überschrieb ein kanadisches Team vor einigen Jahren seine im Journal FEMS Microbiology Ecology erschienene Arbeit über hefeähnliche Pilze, die es in Bodenproben in Saudi-Arabien gefunden hat.
Das ist nicht zu toppen, oder? Der US-amerikanische Meeresschutzbiologe David Shiffman hatte sich das mit den fantastic yeasts gemerkt und kürzlich auf Bluesky andere Wissenschaftler aufgerufen, ihre Lieblingsüberschriften aus wissenschaftlichen Fachjournalen zu nennen. Es kam ein bisschen was zusammen. Etwa: “Identifying species from pieces of feces” (Conservation Genetics, 2004), “2D or not 2D”: Shape-programming polymer sheets” (Progress in Polymer Science, 2016) oder “The Moon is Acquitted of Murder in Cleveland” (Skeptical Inquirer, 1985). Manche humorigen Überschriften werden jedoch auch abgelehnt. David Shiffman selbst bedauert beispielsweise bis heute, dass er mit “Sharks, lies and videotape” nicht durchkam. Anne Brüning
