Corona, Klimakrise, Artensterben – Politiker stehen in diesen Zeiten vor folgenreichen Entscheidungen. Kein Wunder, dass sie wissenschaftliche Beratung zunehmend nachfragen und schätzen. In unserer Serie “Politikberatung, quo vadis?” erfahren Sie im heutigen dritten Teil, welche Erwartungen es vonseiten der Politik gibt. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas hat sich zudem auch Gedanken über die eigene Zunft gemacht. Politikberatung sei nur dann wirklich gut, wenn ihr Beitrag an der Entscheidungsfindung transparent nachvollzogen werden kann, mahnt sie.
Ob die Bundesregierung bei ihren Entscheidungen für die Nationale Wasserstoffstrategie von der Wissenschaft gut beraten wurde, wird sich zeigen. Immerhin hat sie sich gestern auf einen Plan geeinigt. Was die Strategie allgemein für den Forschungsbereich vorsieht, haben wir Ihnen bereits am Dienstag verraten. Bis zum Ende des Jahres will die Ampel noch eine “Importstrategie” zur Ergänzung auflegen. In Sachen Wasserstoff sind etliche Kooperationen mit sonnen- und windreichen Ländern vorgesehen, um den hohen Importbedarf zu stillen. Lucia Weiß gibt beispielhaft Einblicke in eine geplante Kooperation mit Mauretanien. Wie die Wasserstoffwirtschaft zur Entwicklung in Partnerländern beitragen soll, berichtet Nico Beckert im Climate Table.
Falls Sie in diesen Tagen noch nicht im Sommerurlaub sind, sondern noch mitten in Ihrer 40-Stunden-und-mehr-Woche, tröstet Sie vielleicht der Ausblick, den KI-Forscher Aljoscha Burchardt im Interview mit Lilo Berg gibt: Im Jahr 2040 werden wir dank Künstlicher Intelligenz nur noch fünf Stunden pro Woche arbeiten, sagt er. Die restliche Zeit stehe dann zur Verfügung, um sich um Kinder, alte Menschen und eigene Interessen zu kümmern. Ob Lesen dann noch dazu gehört?
Für heute wünschen wir Ihnen auf alle Fälle gute Lektüre!
Wenn Ihnen der Research.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail weitergeleitet wurde: Hier können Sie sich für den Research.Table kostenlos anmelden.


In der Politik gilt es, Entscheidungen unter Unsicherheit zu treffen. Dabei spielen nicht nur die wissenschaftlichen Fakten eine Rolle, sondern zum Beispiel auch Wertvorstellungen. Das ist den Polit-Praktikern klar, wie die Gesamtschau der Statements von Bärbel Bas (SPD), Annette Schavan (CDU), Kai Gehring (Grüne) und Clemens Hoch (SPD) für Table.Media zeigt. Die Antworten machen zugleich deutlich: Angesichts multipler Krisen hat Rat aus der Wissenschaft zunehmendes Gewicht.
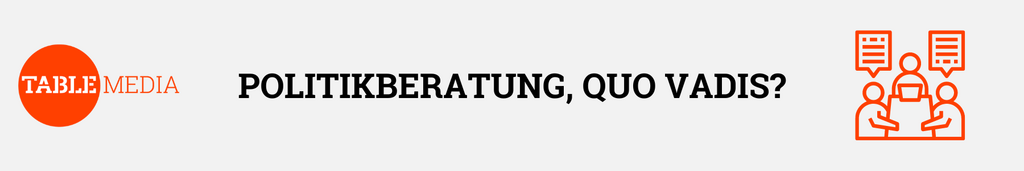
“Die Corona-Pandemie oder der Klimawandel haben verdeutlicht, wie wichtig für die Politik der Wissenstransfer und die Entscheidungsunterstützung auf Basis des aktuellen Forschungsstandes ist”, sagt Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD). Sie verweist auch auf ihre Zeit als stellvertretende Fraktionsvorsitzende für Gesundheit, Bildung & Forschung und Petitionen.
Aus ihrer Sicht muss eine gute wissenschaftliche Politikberatung:
Bas betont: “Politikberatung ist nur dann wirklich gut, wenn ihr Beitrag an der Entscheidungsfindung transparent nachvollzogen werden kann. Die Politik muss transparent deutlich machen, worauf ihre Entscheidungen beruhen.”
Von 2005 bis 2013 war Annette Schavan (CDU) Bundesministerin für Bildung und Forschung, dann trat sie wegen der Aberkennung ihres Doktorgrads zurück. In ihre Amtszeit fiel die Entscheidung, die Leopoldina 2008 zur Nationalen Akademie der Wissenschaften zu machen. Die Rolle solcher Institutionen schätzt sie nach wie vor: “Die Nationalen Akademien sind heute der Schlüssel für den Dialog zwischen Politik und Wissenschaft zu den zahlreichen global bedeutsamen politischen Fragen”, sagt sie.
Politikberatung werde von vielen Einrichtungen angeboten, sagt Schavan. “Die Versuchung ist, sich an solche Experten zu wenden, die die eigene Position stärken und dafür Argumente liefern.“
Gute Politikberatung, die den Anspruch hat, wissenschaftsbasiert zu sein, sollte ihrer Ansicht nach:
“Wirksame Zukunftsgestaltung gelingt nur mit einer evidenz- und faktenbasierten Politik”, sagt Kai Gehring (Grüne), Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. Angesichts der derzeitigen multiplen Krisen und Unsicherheiten sei die Politik wie nie zuvor auf sehr gute und verlässliche wissenschaftliche Politikberatung angewiesen. “Wissenschaft ist der Kompass, der uns durch die aktuellen Krisen navigieren kann”, sagt Gehring.
Aus seiner Sicht sollte gute wissenschaftliche Politikberatung:
Als gelungenes Beispiel nennt Gehring den Corona-Expertenrat, der zwischen Dezember 2021 und April 2023 regelmäßig tagte. “Es sollte darüber nachgedacht werden, ähnliche interdisziplinäre Gremien bestehend aus herausragenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu den großen Herausforderungen unserer Zeit einzusetzen, vor allem zur Klimakatastrophe und ihren Konsequenzen.”
Doch er nimmt auch die Politik in die Pflicht: Auf Seiten der Entscheiderinnen und Entscheider brauche es ein Grundwissen über die Funktions- und Arbeitsweisen der Wissenschaft. “Diese Wissenschaftskompetenz sollte stärker verbreitet und gefördert werden.” Und er betont die Bedeutung von Wissenschaftskommunikation: “Evidenzbasierte Politik kann nur erfolgreich sein, wenn Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft miteinander im Dialog stehen.”
Clemens Hoch (SPD), Minister für Wissenschaft und Gesundheit in Rheinland-Pfalz, betont, aktuelle und künftige Herausforderungen wie der Klimawandel, eine alternde Gesellschaft oder das Aufkommen neuer Technologien im Bereich KI seien so komplex, dass wissenschaftliche Expertise unerlässlich sei. “Bei all diesen Themen ist es wichtig, dass Politik und Wissenschaft in einem ständigen Austausch bleiben und ihre unterschiedlichen Logiken, disziplinären Perspektiven und Einsichten insbesondere in Krisenzeiten miteinander vereinbaren. Ich denke, nur dann kann man den zu lösenden Problemen, Veränderungsprozessen und den Menschen gerecht werden”, sagt Hoch.
Zu einer guten und vor allem hilfreichen Politikberatung gehört für ihn:
An den unterschiedlichen Formen – zum einen in fest institutionalisierten Gremien, zum anderen in mehr oder weniger informelle Beratungen – möchte Hoch festhalten. “Dieses bereits etablierte Vorgehen halte ich für außerordentlich wichtig, um verantwortungsbewusst gesamtgesellschaftliche Entscheidungen treffen zu können. Denn am Ende des Tages gilt: Die Wissenschaft liefert die Grundlagen, aber die Politik muss entscheiden.”
In Teil 4 lesen Sie über die Erfahrungen und Vorschläge von Wissenschaftlern. Die Serie “Politikberatung, quo vadis?” finden Sie gesammelt hier.
Vor Ort in Mauretanien ist noch nichts zu sehen von grünem Wasserstoff, denn bisher gibt es nur eine Absichtserklärung zwischen dem Konsortium mit deutscher Beteiligung und der mauretanischen Regierung für das 34 Milliarden US-Dollar schwere Projekt. 2028 soll es losgehen für den deutschen Projektentwickler Conjuncta in Mauretanien: mit einer 400-Megawatt-Anlage für die Produktion von grünem Wasserstoff, nordöstlich von der Hauptstadt Nouakchott.
Das Hamburger Unternehmen hat sich dazu mit dem Gemeinschaftsunternehmen Infinity Power zusammengetan. Dahinter stehen der ägyptische Grünstromerzeuger Infinity aus Ägypten und ein Staatsunternehmen für erneuerbare Energien, Masdar, aus dem Golfemirat Abu Dhabi. Den klimafreundlichen Strom für die Elektrolyse sollen Windräder und Photovoltaikanlagen in Mauretanien liefern, der Energie-Export soll über einen Hafen abgewickelt werden. Genauso wie in zahlreichen anderen internationalen Projekten, in denen Deutschland mitmischt.
“Die Technologien für die Erzeugung von grünem Wasserstoff sind da”, sagt die Ingenieurin Sylvia Schattauer, seit 2022 kommissarische Leiterin des Fraunhofer-Instituts für Windenergiesysteme. Aber: “Jetzt geht es um das Hochskalieren. Die Systeme und Komponenten sind bisher manufakturgefertigt und sollen nun in großen Stückzahlen in Serie industriell hergestellt werden.”
Schattauer vergleicht das mit dem Übergang von einem individuell zusammengeschraubten Liebhaber-Auto zur Serienproduktion. “Es geht um Optimierung. Das ist keine Fragestellung der Grundlagenforschung, sondern eine Ingenieursaufgabe.” Die Idee des Konsortiums mit deutscher Beteiligung ist denn auch, in Mauretanien zunächst mehrere kleine Anlagen modular zusammenzuschließen, um 2028 auf die angepeilten 400 Megawatt Elektrolysekapazität zu kommen.
Für die anwendungsnahe Forschung geht es laut Schattauer, die Umwelttechnik und Regenerative Energien in Berlin studierte und an der Universität Potsdam in Experimentalphysik promoviert wurde, unter anderem um den Bereich Offshore: also die Produktion von Windenergie auf dem offenen Meer, gekoppelt mit der Produktion von Wasserstoff. “Die Windräder müssen harschen Bedingungen standhalten, das Meerwasser muss vor Ort entsalzt werden und die Elektrolyseure müssen ebenfalls unter harschen Bedingungen betrieben werden. Die Technik mag es nicht, immer im Grenzbereich gefahren zu werden.”
“Mauretanien ist weltweit einer der besten Wasserstoff-Standorte”, sagt Stefan Liebing, Geschäftsführer von Conjuncta. Es gebe rund um die Uhr günstigen Strom – tagsüber aus Sonne und nachts aus Wind. Außerdem sei durch die Lage am Atlantik der Zugang zu Wasser gegeben und Hafeninfrastruktur vorhanden. Diese Voraussetzungen entscheiden laut Liebing über die Wirtschaftlichkeit eines Projektes. Nordafrika soll laut der neuen nationalen Wasserstoffstrategie als Teil eines Schwerpunktkorridors für den Import von Wasserstoff nach Europa angebunden werden.
Laut Conjuncta werden langfristig bis zu 10 Gigawatt Elektrolysekapazität angepeilt. Zum Vergleich: Im Industrieland Deutschland soll laut Koalitionsvertrag bis 2030 ebenfalls auf 10 Gigawatt ausgebaut werden. Was das deutsche Projekt angeht, laufen Liebing zufolge derzeit zwei Schritte parallel. Die mauretanische Regierung, die noch mit drei weiteren internationalen Konsortien Memoranda of Understanding unterzeichnet hat, prüfe die rechtlichen und infrastrukturellen Voraussetzungen.
Conjuncta führe eine eigene Machbarkeitsstudie zu Finanzierung, Technik, Standorten und Verbindungsinfrastruktur durch. Fläche für den Aufbau von Anlagen für Wind- und Sonnenstrom gibt es jedenfalls reichlich in Mauretanien: Das Land hat etwas mehr als eine Million Quadratkilometer und ist damit etwa dreimal so groß wie Deutschland. Und das bei rund einem Zwanzigstel der deutschen Bevölkerungsgröße, 4,2 Millionen Einwohner hat Mauretanien.
“Wir glauben, dass es nicht nur unser Land verändern wird, sondern dass wir damit auch zum weltweiten Paradigmenwechsel in Sachen Energie etwas beitragen können”, gibt sich der mauretanische Energieminister Nani Ould Chrougha selbstbewusst. Das Bewusstsein für das nötige Umsteuern in der Energiepolitik sei in Mauretanien stark vorhanden: Sein Land spüre den Klimawandel stärker als der globale Norden, etwa durch die Veränderungen der Regenzeit.
Energieminister Chrougha, der erst im Juli das Amt vom jetzigen Wirtschaftsminister Abdessalam Ould Mohamed Saleh übernommen hat, gibt sich realistisch, aber optimistisch: “Es stimmt, dass wir keine Gelder vor Ort haben und keine Technologien, aber wir bieten großes Potenzial.” Die Pläne des deutschen Konsortiums, bis 2028 400 Megawatt Elektrolyse-Kapazität in Mauretanien aufzubauen, findet Fraunhofer-Forscherin Schattauer durchaus realistisch, sofern keine bürokratischen Hürden den Prozess verlangsamen.
Aber eine Sache dürfe man langfristig nicht vergessen, so die Energieexpertin: “Für die Produktion von grünem Wasserstoff bedarf es eines funktionierenden Stromnetzes. Wenn keiner diese Investition tätigt, kann das nicht funktionieren.” Aus politischer Perspektive liegt hier die Win-win-Situation für Mauretanien, eines der ärmsten Länder der Welt, das auf einen Entwicklungssprung hofft.

Was erforschen Sie im Zusammenhang mit KI?
Was mich derzeit viel beschäftigt, ist ein Projekt, das wir zusammen mit der Charité sowie Ethikern und Soziologen durchführen. Es geht um ein KI-System für Ärzte, das sie bei Entscheidungen in Diagnose und Therapie unterstützen soll. In Zusammenarbeit mit dem interdisziplinären Forscherteam versuche ich herauszufinden, wie wir das System gestalten sollten, damit es wirklich hilfreich ist. Die ärztliche Autonomie und die Kommunikationsstrukturen im Klinikalltag müssen zum Beispiel gewahrt bleiben.
In einzelnen Bereichen kann die KI durchaus besser als Ärzte sein, wie wir in einer kleinen, retrospektiven Studie gesehen haben. Unser System konnte anhand historischer Daten sehr gut vorhersagen, welche Patienten nach einer Nierenoperation Folgeerscheinungen wie einen Harnwegsinfekt oder sogar eine Abstoßungsreaktion erleiden werden und welche nicht. Selbst erfahrene Ärzte waren da im Hintertreffen.
Allerdings wurden nur einige Ärzte zusammen mit dem experimentellen System besser. Fazit: Wenn die Motivation stimmt, das Vorgehen genau überlegt ist und es eine gute Schulung gibt, kann die Medizin enorm von KI profitieren. Ärzten einfach ein technisches System überzustülpen, wird nicht funktionieren. Sie müssen es von vornherein mitgestalten. Das gilt im Grunde für alle Lebensbereiche, und wir sollten unverzüglich anfangen, die KI unseren Bedürfnissen anzupassen.

Was sind die größten Chancen von KI?
In vielen Bereichen haben wir die Digitalisierung in Deutschland verschlafen – denken wir nur an die Gesundheitsämter und ihre Faxgeräte in der Pandemie. KI gibt uns jetzt eine zweite Chance, die wir beherzt ergreifen sollten, um uns die Arbeit in vielen Gebieten zu erleichtern. Ein Beispiel ist das Bürgeramt, das über Wohngeldanträge zu entscheiden hat. Nehmen wir einmal an, zwei Drittel der Anträge entsprechen praktisch identischen Anträgen, die in der Vergangenheit entweder bewilligt oder abgelehnt wurden.
Nach diesem Muster lassen sie sich von einem KI-Programm effizient bearbeiten. Das gibt den Mitarbeitern mehr Zeit für die komplexen Fälle und insgesamt sind sie viel schneller fertig mit der Arbeit. KI kann uns auch helfen, den demografischen Wandel zu bestehen. Die Babyboomer gehen jetzt scharenweise in Rente und mit ihnen droht ein großer Wissensschatz verloren zu gehen. Dem sollten wir entgegenwirken und das Knowhow über grundlegende Abläufe in vielen Branchen umfassend digitalisieren. Damit lassen sich KI-Systeme trainieren, um später Lücken im Arbeitsmarkt zu schließen. Viel Zeit haben wir dafür nicht mehr, aber wir können es schaffen.
Ist die KI-Entwicklung überhaupt kontrollierbar? Und wie sollte sie reguliert werden?
Selbstverständlich können wir die Entwicklung steuern. Aber wir wollen ja nicht die Technologie als solche regulieren, sondern deren Nutzung. Den Hammer verbieten wir ja auch nicht. Als Werkzeug ist er sehr nützlich, strafbar ist sein Gebrauch als Tötungsinstrument. Dass wir für die KI einen rechtlichen Rahmen brauchen, steht außer Frage. Er sollte Grundlegendes regulieren und darf keinesfalls die praktische Anwendung ersticken. Das wäre etwa der Fall, wenn die Nutzung von ChatGPT für den Kundendialog kleiner und mittlerer Unternehmen als Hochrisikoanwendung eingestuft wird. So etwas zieht einen Rattenschwanz an Haftungsfragen nach sich.
Lasst uns um Gotteswillen nicht alle Probleme im Vorhinein ausdenken, sondern das Wesentliche regeln und schnell eingreifen, wenn es Probleme gibt. Viele Lebensbereiche sind ohnehin stark reguliert, denken wir an das Gesundheitswesen oder den Bausektor. Zusätzliche Vorschriften lähmen den Innovationselan, daran sollten wir auch beim aktuell diskutierten EU AI Act denken. Andererseits eröffnet eine umsichtige KI-Politik Europa gerade im Bildungssektor, in der Medizin, bei der Bewältigung des Klimawandels und in der Industrie große Chancen.
Welche negativen Auswirkungen künstlicher Intelligenz sind zu befürchten?
In den Händen böser Menschen ist KI natürlich eine Gefahr. Ausgefuchste Waffen, Kraftwerkshavarien, üble Fake News, Börsenchaos, kollabierende Märkte – all das sind reale Risiken. Aber solche Probleme gibt es auch heute schon und wir sind bisher meistens damit fertig geworden. Für deutlich übertrieben halte ich die Befürchtung, dass wir durch die Nutzung von KI unweigerlich verblöden. Der Mensch lernt gern und ist gern kreativ, das wird sich so schnell nicht ändern. Überhaupt sollten wir sehr vorsichtig bei Endzeitphantasien durch KI sein. Sie hindern uns nur, uns ernsthaft mit dieser wichtigen Zukunftstechnologie zu befassen.
Wo wird KI in 20 Jahren selbstverständlich sein?
Im Jahr 2040 wird KI allgegenwärtig sein und alle betreffen. Wir werden nicht mehr groß darüber reden. Heute diskutieren wir über die Vier-Tage-Woche, dann haben wir dank KI die Fünf-Stunden-Woche. Für unseren Lebensunterhalt arbeiten wir meinetwegen von 8 Uhr morgens bis 9 Uhr, die restliche Zeit kümmern wir uns um Kinder, alte Menschen und eigene Interessen. Stumpfsinnige, sich ständig wiederholende Arbeitsroutinen wird es nicht mehr geben. Sprachbarrieren sind verschwunden, das Energieproblem ist gelöst. Für Steuerberater und Anlageberater wird es eng, denn KI kann das oft besser. Dennoch wird nicht alles digitalisiert sein, analoge Lösungen wird es weiterhin geben – und hoffentlich auch noch meine geliebte Schallplattensammlung. Überhaupt sollten wir uns fragen, was wir von der KI wollen und sie entsprechend gestalten. Den Technikern sollten wir das keinesfalls allein überlassen.
Zur Person: Aljoscha Burchardt ist Principal Researcher und stellvertretender Standortsprecher am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Berlin. Als Experte für Sprachtechnologie und Künstliche Intelligenz hat der Computerlinguist das MQM-Framework zur Bewertung von Übersetzungsqualität mitgestaltet. Burchardt ist Senior Research Fellow des Weizenbaum-Instituts für die vernetzte Gesellschaft und war Mitglied der Enquete-Kommission “Künstliche Intelligenz” des Deutschen Bundestags.
Die Texte der Table.Media-Serie “Der globale Wettlauf um Künstliche Intelligenz” finden Sie hier.
Neu: Agrifood.Table Professional Briefing – jetzt kostenlos anmelden. Wie unsere Lebensgrundlagen geschaffen, gesichert und reguliert werden. Für die entscheidenden Köpfe in Landwirtschaft und Ernährung in Politik und Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft, Verbänden und NGO. Von Table.Media. (Anmelden)
6. September 2023, Allianz Forum, Pariser Platz 6, Berlin
Preisverleihung Unipreneurs: Die besten Professorinnen und Professoren für Startups Mehr
11.-13. September 2023, Osnabrück
18. Jahrestagung der Gesellschaft für Hochschulforschung Das Zusammenspiel von Hochschulforschung und Hochschulentwicklung: Empirie, Transfer und Wirkungen Mehr
20.-22. September 2023, Hyperion Hotel, Leipzig
Konferenz SEMANTiCS und Language Intelligence 2023 Mehr
27.-29. September 2023, Freie Universität Berlin
Gemeinsame Konferenz der Berliner Hochschulen Open-Access-Tage 2023 “Visionen gestalten” Mehr
Nach Informationen der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) erwägen weitere deutsche Universitäten, chinesische Nachwuchswissenschaftler mit einem CSC-Stipendium künftig nicht mehr zuzulassen. “Es gibt derzeit an weiteren Hochschulen konkrete Überlegungen, CSC-Stipendiat:innen zumindest in bestimmten Fachgebieten auszuschließen”, sagte HRK-Pressesprecher Christoph Hilgert Table.Media auf Nachfrage. Derzeit sei ein Diskussions- und Sensibilisierungsprozess im Gange, den die HRK im Rahmen ihrer Austauschformate zu Fragen der akademischen Zusammenarbeit aktiv unterstütze.
Die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) hatte als erste deutsche Hochschule eine Kooperation mit ausgewählten chinesischen Doktoranden beendet. Nach Recherchen von “Correctiv” und “University World News” (UWN) lässt die Unileitung seit Anfang Juni keine neuen Stipendiaten über das Chinese Scholarship Council (CSC) mehr zu. Das bestätigte eine Sprecherin der FAU Table.Media. Auch in weiteren europäischen Ländern haben Universitäten die Kooperation ausgesetzt.
Zu den Beweggründen teilte man mit, dass die Unileitung bei einer Prüfung des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) einmal mehr dafür sensibilisiert worden sei, “dass wir als FAU die Rahmenbedingungen schaffen müssen, um mit den Anforderungen des BAFA in Einklang zu sein”. In der Konsequenz werden nun nur noch Stipendiaten zugelassen, die “eine Co-Finanzierung über Institutionen mit Reputation und Verankerung im demokratischen System” vorweisen können. Auch an der FAU rechnet man fest damit, dass weitere Hochschulen diese Schritte gehen werden.
Eine Co-Finanzierung für chinesische Studierende bietet etwa der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD). Der DAAD vergibt im 2013 gestarteten Programm “Sino-German Postdoc Scholarship” gemeinsam mit dem CSC deutschlandweit rund 40 bis 50 Stipendien für chinesische Nachwuchswissenschaftler pro Jahr. Diese wären auch an der FAU von dem Ausschluss ausgenommen, bestätigte dort eine Sprecherin. Zahlen zu den reinen CSC-Stipendiaten, die sich derzeit in Deutschland aufhalten, werden nicht zentral erhoben.
“Bei der grundsätzlich partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit dem CSC haben in der Vergangenheit bereits Aushandlungsprozesse stattgefunden, um den Vorstellungen des DAAD für eine Auswahl von Stipendiatinnen und Stipendiaten angemessen Geltung zu verschaffen”, sagte ein Sprecher des DAAD Table.Media. Einer dieser “Aushandlungsprozesse” ist etwa die Absage des DAAD an die Forderung des CSC gewesen, die Auswahlsitzungen mit den chinesischen Bewerbern und Bewerberinnen durchgehend zu filmen.
Seitdem fänden die Auswahlsitzungen für das Programm konsekutiv statt, teilte der DAAD mit: “Zunächst trifft der CSC seine Auswahl, anschließend der DAAD. Förderungen können nur ausgesprochen werden, wenn beide Voten für Kandidaten übereinstimmen.” Zentrales Entscheidungskriterium sei dabei die akademische Qualifikation. Da das Auswahlverfahren so allerdings mit großem Aufwand verbunden sei, kann sich der DAAD eine Ausweitung des Programms derzeit nicht vorstellen.
Zugleich berate der DAAD die deutschen Hochschulen aber zur Betreuung von CSC-Geförderten sowie zur Zusammenarbeit mit Hochschulen in China generell, sagte der Sprecher. Hier spielt das DAAD-Kompetenzzentrum Internationale Wissenschaftskooperationen (KIWi) eine wichtige Rolle. “Der DAAD baut derzeit die Beratungsmöglichkeiten im KIWi aus und erhielt dazu im April zusätzliche Mittel vom Bundesministerium für Bildung und Forschung”, sagte ein DAAD-Sprecher. Man reagiere damit auf den gestiegenen Beratungsbedarf der deutschen Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen in Zeiten zunehmender Unsicherheit in der internationalen Wissenschaftskooperation. tg
Ein Dozent der Berliner Humboldt-Universität (HU) darf Gespräche mit Studierenden nur noch online und im Beisein der Frauenbeauftragten der betroffenen Fakultät führen. Die Regelung wurde wegen Vorwürfen der sexualisierten Gewalt und des Machtmissbrauchs bereits Mitte Mai getroffen. In einem offenen Brief auf der linken Plattform Indymedia haben Unbekannte dem Dozenten Mitte Juli nun auch körperliche sexualisierte Gewalt vorgeworfen. In dem Schreiben heißt es, der Beschuldigte missbrauche “seine Machtposition als Dozent und Vorgesetzter seit mehr als 20 Jahren”. Außerdem habe er sich in Vorlesungen “transfeindlich und rassistisch” geäußert.
Der Universitätsleitung waren in diesem Jahr bereits mutmaßliche verbale sexualisierte Übergriffe angezeigt worden. Die jetzt vorgebrachten Vorwürfe würden weiterhin intensiv geprüft und alle rechtlich möglichen Schritte eingeleitet, um erneute Übergriffe zu verhindern, teilte die Uni mit.
In einer am Dienstag veröffentlichten Stellungnahme ruft das Leitungsteam um Präsidentin Julia von Blumenthal Betroffene dazu auf, bisher unbekannte Sachverhalte zu melden. “Die Humboldt-Universität verurteilt Machtmissbrauch und sexualisierte Übergriffe und ahndet solche Verhaltensweisen”, heißt es. Betroffene Personen würden von der zentralen wie den dezentralen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragen umfassend beraten und bei einem Beschwerdeverfahren begleitet.
Die Studienvertretung der HU hatte am Montag mitgeteilt, seit April in Form einer Arbeitsgemeinschaft an der Aufarbeitung der Vorwürfe beteiligt zu sein. Das neu eingeführte Sechs-Augen-Prinzip wird ihrer Einschätzung nach “weder ausreichend” noch “ausnahmslos” eingehalten. Die zuständigen Stellen müssten sich deutlicher auf die Seite von Betroffenen stellen.
Ein Fall von Fehlverhalten und Belästigung beschäftigt derzeit auch die Ludwig-Maximilians-Universität München. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtete, hat die Landesanwaltschaft ein Disziplinarverfahren gegen einen Chemie-Professor eingeleitet. Dabei geht es um diskriminierendes Fehlverhalten und Belästigungen.
Mit dem Thema Machtmissbrauch befassen sich Universitäten und Forschungseinrichtungen zunehmend auch auf struktureller Ebene. Im Frühjahr rief eine Initiative mit der Wuppertaler Erklärung zu besserer Governance in der Wissenschaft auf. Ende Juni veröffentlichte die Deutsche Gesellschaft für Psychologie einen Bericht zum Thema und mahnte systemische Veränderungen an. abg/dpa
Sifted – Leading European fusion startup offered term sheet to build its tech in US. Wie das Branchenportal “Sifted” meldet, hat das deutsche Laserfusion-Start-up Marvel Fusion ein Vertragsangebot von einem US-Unternehmen vorliegen. Demnach soll in diesem “Term Sheet” eine Finanzierung angeboten werden, wenn Marvel Fusion sich verpflichtet, seinen Demonstrator in den USA zu bauen. Das US-Unternehmen will unerkannt bleiben und Marvel Fusion will sich nicht äußern. Die Infos stammen vom VC-Investor Earlybird, der die letzte Finanzierungsrunde von Marvel Fusion angeführt hat und jetzt dafür wirbt, eine respektable Finanzierung in Europa zu stemmen, bevor das Start-up in die USA abwandert. Mehr
Tagesspiegel – Die Chancen für Frauen an Unis steigen. Bei gleicher Leistung haben Frauen an deutschen Universitäten mindestens dieselbe Chance wie Männer, auf eine Lebenszeit-Professur berufen zu werden – teils sogar bessere. Das legen zwei neue Studien aus dem Saarland und Berlin nahe. Von Gleichberechtigung ist man trotzdem noch ein Stück entfernt, weil Frauen in früheren Karrierephasen oft Nachteile haben. Die Stichworte sind Betreuungsnachteil und Leaky Pipeline. Aber auch dieser Gender-Gap beginnt sich zu schließen. Mehr
FAZ – Mit der Muttersprache Englisch ist man klar im Vorteil. Wer nicht richtig gut Englisch kann, ist massiv im Nachteil, gerade zu Beginn einer Forscherkarriere. In PLoS Biology hat eine internationale Forschergruppe um Tatsuya Amanao von der University of Queensland im australischen Brisbane diese schon länger plausible Hypothese nun quantifiziert. Ulf von Rauchhaupt überlegt in seinem Kommentar, ob es nicht praktikabler sei, zum Latein zurückzukehren, das Niemandes Muttersprache sei. Wem auch das utopisch erscheine, müsse einfach zugeben: nicht jedem Mangel an Gerechtigkeit ist abzuhelfen. Mehr
ZDF – Tatort Uni. #MeToo und Machtmissbrauch an Hochschulen. Erniedrigungen, Mobbing, sexualisierte Übergriffe – im Wissenschaftsbetrieb häufen sich Berichte über den Machtmissbrauch. In der Sendung des ZDF berichten Nachwuchswissenschaftler über ihre Erfahrungen. Mehr
Laborjournal – Über Exzellenz, Geld & Wissenschaft. Gerald Schweiger aus Graz beklagt eine fehlende, klare Definition von Exzellenz. Gleichzeitig seien Peer-Review und Panel-Entscheidungen fehleranfällig. Schweiger stellt die Frage, ob hoher Wettbewerb und niedrige Erfolgsraten innovationshemmend wirken. Mehr
Christian Brei wurde im Juni vom Senat der Leuphana Universität Lüneburg zum hauptberuflichen Vizepräsidenten wiedergewählt. Der Stiftungsrat der Leuphana hat die Wahl jetzt bestätigt.
Beate Sieger-Hanus wurde zur Rektorin der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Stuttgart gewählt. Sie folgt auf Joachim Weber, der in den Ruhestand geht. Sieger-Hanus ist seit 2003 Professorin an der DHBW. Sie leitete den Studiengang BWL-Dienstleistungsmanagement und war Studiendekanin des Studienzentrums Dienstleistungsmanagement der Fakultät Wirtschaft.
Petra Justenhoven, Sprecherin der Geschäftsführung von PricewaterhouseCoopers (PwC) Deutschland sowie Chairwoman und Senior Partnerin von PwC Europe, ist neues Mitglied des Verwaltungsrates des RWI – Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung.
Mackenzie W. Mathis und Alexander Mathis sind die diesjährigen Gewinner des Eric Kandel Young Neuroscientists Prize der gemeinnützigen Hertie-Stiftung und der Federation of European Neuroscience Societies (FENS). Die mit 100.000 Euro dotierte Auszeichnung wird alle zwei Jahre an herausragende junge Wissenschaftler in der Hirnforschung verliehen. Mackenzie W. Mathis und Alexander Mathis sind Assistenzprofessoren am Brain Mind Institute, School of Life Sciences, der École Polytechnique Fédérale de Lausanne.
Hans Joachim Schellnhuber wird ab Dezember Generaldirektor des International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) in Laxenburg bei Wien. Schellnhuber war Gründer und bis 2018 Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK). Er folgt auf den Südafrikaner Albert van Jaarsveld, der das Institut seit 2018 geleitet hat.
Jim Skea ist neuer Vorsitzender des Weltklimarats (IPCC). Der britische Professor für nachhaltige Energie am Imperial College in London ist bei der IPCC-Sitzung in Nairobi gewählt worden.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an research@table.media! Gründer und bis 2018 Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) i
Bildung.Table. Duale Lehramts-Studiengänge auf dem Vormarsch. Immer mehr Bundesländer reformieren ihre Lehramtsstudiengänge hin zum dualen Modell. Table.Media gibt einen Überblick über den Stand der Umsetzung. Der variiert zwischen Nordsee und Alpen stark. Mehr
Bildung.Table. Eine deutsche Schule vergibt das ukrainische Abitur. Die Münchner Schlau-Schule für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge war lange der Underdog unter Bayerns Schulen. Jetzt ist sie selbst für Kanada Vorbild. Jugendliche können dort ukrainisches Abitur machen und lernen Deutsch – am Ende sollen sie an ukrainischen und deutschen Hochschulen studieren können. Mehr
Agrar.Table. Renaturierung: Die entscheidende Rolle der Moore. Das EU-Parlament hat einen Artikel zur Wiedervernässung trockengelegter Moore kurz vor der Abstimmung aus dem Renaturierungsgesetz gestrichen. Dabei können Vorgaben hierzu entscheidend sein, um die CO₂-Minderungsziele zu erreichen. In Deutschland ist die Wiederherstellung von Mooren umstritten. Mehr
Agrar.Table. Glyphosat-Abstimmung im Oktober. Die Abstimmung über eine Verlängerung des umstrittenen Herbizids um 15 Jahre soll im Oktober stattfinden. Vorgehensweise ist die Komitologie-Prozedur: Die Kommission stellt einen Entscheid vor, der zuständige Komitologie-Ausschuss des Rats stimmt darüber ab. Beim nächsten Treffen am 15. September will die Kommission ihren Entscheid zum Glyphosat vorstellen. Danach trifft sich das Komitee wieder am 12. und 13. Oktober und wird über die Verlängerung abstimmen. Mehr
Ich bin es müde, mir von Politikern wie Journalisten anhören zu müssen, dass Effizienzsteigerungen oder Kürzungen von Bildungs- und Forschungsbudgets Tabu sind. Dass Kürzungen beim Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM), bei Inno-KOMM oder dem BAföG Wehklagen hervorrufen und die Zuse-Gemeinschaft gar 22 Prozent mehr fordert, gehört zum Standard-Repertoire der gemeinhin als Beutegemeinschaften bekannten Forschungsorganisationen.
Doch auch Politik und Journalismus leugnen, dass Schrumpfung und Wachstum etwas ganz Natürliches sind. Früh wurde mir beigebracht, dass Ökonomie – Betriebswirtschaft wie Volkswirtschaft – wie ein mathematischer Bruch funktioniert: im Zähler das Wachstum durch Investition in die Erneuerung des Kapitalstocks, durch Renditen auf Invest in Humankapital, durch Return on Invest von Investitionen in Zukunftstechnologien und potenzielle Innovationen.
Im Nenner dagegen geht es um Fortschritt bei Rationalisierung, Reorganisation von Alt zu Neu, Kostensenkung, Prozessoptimierung, summa summarum um Effizienz, Produktivität und entsprechende Einsparungen. Das Gleiche gilt gleichermaßen für Familienhaushalte wie für den Bundeshaushalt.
Wer jahrelang nur die Balance im mathematischen Bruch hält, stagniert. Wer im Wesentlichen auf Effizienz setzt, ohne Wachstum zu erzielen, erlebt, wie es ‘on the long tail’ immer schwerer wird, die Margen zu squeezen. Wer – wie im Forschungs- und Bildungshaushalt – ohne entsprechenden Output oder ohne Effizienzsteigerung investiert, schrumpft oder verschuldet sich (mit entsprechenden Folgen in Hochzins-Zeiten). Erst recht, wenn destruktive Einschläge wie der Krieg in der Ukraine neue Prioritäten notwendig machen.
Dies hatte schon die Große Koalition nicht im Visier. Weder wurden die Experten-Empfehlungen zur gescheiterten Familienpolitik, noch zur ruinösen Verteidigungspolitik aufgegriffen. Der desolate Zustand ist unübersehbar. In der Bildungs- und Forschungspolitik erst recht. So wurden die milliardenschweren Aufholprogramme für Schüler nach Corona ohne Erfolgskontrolle blind über die Republik verstreut.
Der Digitalpakt 1.0 hat keinerlei Verpflichtung, Erfolg zu belegen. Zudem wurde der über 120 Milliarden Euro schwere Pakt für Forschung und Innovation von 2021 bis 2030 ohne jegliche Output-Erwartungen, geschweige denn Verpflichtungen geschlossen. Den gleichen Fehler wiederholte der Haushaltsausschuss des Bundestags, als er den Hochschulpakt dynamisierte, ohne ihn beispielsweise an die drastische Reduktion von Studienabbruchs-Zahlen zu knüpfen.
Da mutet die Aussage des bildungspolitischen Sprechers der CDU, Thomas Jarzombek hoch befremdlich an. Er beklagt: “Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger wird die erste ihrer Zunft seit einem Jahrzehnt sein, die ein Minus in ihrem Ministerium verantworten muss. Und zwar ein Minus von über einer Milliarde Euro”. Hat doch 16 Jahre christdemokratische Bildungs- und Forschungspolitik Geld in den Zähler reingepumpt, nicht nur ohne Erzeugung von Wachstum, ja sogar mit Verschlechterung der Bildungs- und Innovationsrenditen.
Gleichzeitig wurde nichts, aber auch nichts zur Effizienzsteigerung im Nenner gemacht. Förderlinien wurden fast unsterblich. Strategische Prioritäten gab es nicht oder wurden politisch manipuliert wie bei der Forschungsfabrik Batterie. Praktisch wurde nur in gesteigertem Input, nicht in Outcome oder Impact gedacht. “Mehr bringt Mehr” ist eine der schlechtesten Maximen, der die Politik folgen kann. Leider fallen auch einige Medien und Wissenschaftsjournalisten auf diesen Unsinn rein. Ein Pflichtfach Ökonomie hätte ihnen allen nicht nur gutgetan, sondern wäre Voraussetzung für die Ausübung ihres Jobs in Politik wie Journalismus gewesen.
Ich selbst habe dramatische Effizienzprogramme und Sparkurse bei Lufthansa, Continental und Telekom nicht nur miterlebt, sondern mitgestaltet. Die meisten waren überfällig, weil zuvor eine Phase der Arroganz den Kunden gegenüber, der Blindheit gegenüber Umweltsignalen und eine Ignoranz gegenüber Wettbewerbern vorausging. Meist waren sie hoch erfolgreich und heilsam, weil sie nicht nur das System, sondern auch das Mindset reinigten.
Deswegen habe ich nichts gegen Sparen. Ganz im Gegenteil: Ich würde dabei noch strategischer und härter vorgehen. Denn auch Effizienz-Management ist eine Kunst.
Verringerung der Ressourcen zwingt zur Prioritätensetzung. In opulenten Zeiten wird die Gießkanne ausgegossen. Magere Zeiten zwingen zur Devise: Fokus, Fokus, Fokus. Das gibt es die Gelegenheit, alte Zöpfe abzuschneiden und neues zuzulassen – eben strategisch zu priorisieren. Was heißt das praktisch für die Bildung- und Forschungspolitik?
Corona, Klimakrise, Artensterben – Politiker stehen in diesen Zeiten vor folgenreichen Entscheidungen. Kein Wunder, dass sie wissenschaftliche Beratung zunehmend nachfragen und schätzen. In unserer Serie “Politikberatung, quo vadis?” erfahren Sie im heutigen dritten Teil, welche Erwartungen es vonseiten der Politik gibt. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas hat sich zudem auch Gedanken über die eigene Zunft gemacht. Politikberatung sei nur dann wirklich gut, wenn ihr Beitrag an der Entscheidungsfindung transparent nachvollzogen werden kann, mahnt sie.
Ob die Bundesregierung bei ihren Entscheidungen für die Nationale Wasserstoffstrategie von der Wissenschaft gut beraten wurde, wird sich zeigen. Immerhin hat sie sich gestern auf einen Plan geeinigt. Was die Strategie allgemein für den Forschungsbereich vorsieht, haben wir Ihnen bereits am Dienstag verraten. Bis zum Ende des Jahres will die Ampel noch eine “Importstrategie” zur Ergänzung auflegen. In Sachen Wasserstoff sind etliche Kooperationen mit sonnen- und windreichen Ländern vorgesehen, um den hohen Importbedarf zu stillen. Lucia Weiß gibt beispielhaft Einblicke in eine geplante Kooperation mit Mauretanien. Wie die Wasserstoffwirtschaft zur Entwicklung in Partnerländern beitragen soll, berichtet Nico Beckert im Climate Table.
Falls Sie in diesen Tagen noch nicht im Sommerurlaub sind, sondern noch mitten in Ihrer 40-Stunden-und-mehr-Woche, tröstet Sie vielleicht der Ausblick, den KI-Forscher Aljoscha Burchardt im Interview mit Lilo Berg gibt: Im Jahr 2040 werden wir dank Künstlicher Intelligenz nur noch fünf Stunden pro Woche arbeiten, sagt er. Die restliche Zeit stehe dann zur Verfügung, um sich um Kinder, alte Menschen und eigene Interessen zu kümmern. Ob Lesen dann noch dazu gehört?
Für heute wünschen wir Ihnen auf alle Fälle gute Lektüre!
Wenn Ihnen der Research.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail weitergeleitet wurde: Hier können Sie sich für den Research.Table kostenlos anmelden.


In der Politik gilt es, Entscheidungen unter Unsicherheit zu treffen. Dabei spielen nicht nur die wissenschaftlichen Fakten eine Rolle, sondern zum Beispiel auch Wertvorstellungen. Das ist den Polit-Praktikern klar, wie die Gesamtschau der Statements von Bärbel Bas (SPD), Annette Schavan (CDU), Kai Gehring (Grüne) und Clemens Hoch (SPD) für Table.Media zeigt. Die Antworten machen zugleich deutlich: Angesichts multipler Krisen hat Rat aus der Wissenschaft zunehmendes Gewicht.
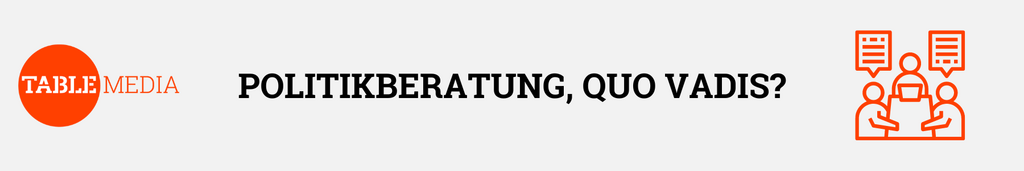
“Die Corona-Pandemie oder der Klimawandel haben verdeutlicht, wie wichtig für die Politik der Wissenstransfer und die Entscheidungsunterstützung auf Basis des aktuellen Forschungsstandes ist”, sagt Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD). Sie verweist auch auf ihre Zeit als stellvertretende Fraktionsvorsitzende für Gesundheit, Bildung & Forschung und Petitionen.
Aus ihrer Sicht muss eine gute wissenschaftliche Politikberatung:
Bas betont: “Politikberatung ist nur dann wirklich gut, wenn ihr Beitrag an der Entscheidungsfindung transparent nachvollzogen werden kann. Die Politik muss transparent deutlich machen, worauf ihre Entscheidungen beruhen.”
Von 2005 bis 2013 war Annette Schavan (CDU) Bundesministerin für Bildung und Forschung, dann trat sie wegen der Aberkennung ihres Doktorgrads zurück. In ihre Amtszeit fiel die Entscheidung, die Leopoldina 2008 zur Nationalen Akademie der Wissenschaften zu machen. Die Rolle solcher Institutionen schätzt sie nach wie vor: “Die Nationalen Akademien sind heute der Schlüssel für den Dialog zwischen Politik und Wissenschaft zu den zahlreichen global bedeutsamen politischen Fragen”, sagt sie.
Politikberatung werde von vielen Einrichtungen angeboten, sagt Schavan. “Die Versuchung ist, sich an solche Experten zu wenden, die die eigene Position stärken und dafür Argumente liefern.“
Gute Politikberatung, die den Anspruch hat, wissenschaftsbasiert zu sein, sollte ihrer Ansicht nach:
“Wirksame Zukunftsgestaltung gelingt nur mit einer evidenz- und faktenbasierten Politik”, sagt Kai Gehring (Grüne), Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. Angesichts der derzeitigen multiplen Krisen und Unsicherheiten sei die Politik wie nie zuvor auf sehr gute und verlässliche wissenschaftliche Politikberatung angewiesen. “Wissenschaft ist der Kompass, der uns durch die aktuellen Krisen navigieren kann”, sagt Gehring.
Aus seiner Sicht sollte gute wissenschaftliche Politikberatung:
Als gelungenes Beispiel nennt Gehring den Corona-Expertenrat, der zwischen Dezember 2021 und April 2023 regelmäßig tagte. “Es sollte darüber nachgedacht werden, ähnliche interdisziplinäre Gremien bestehend aus herausragenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu den großen Herausforderungen unserer Zeit einzusetzen, vor allem zur Klimakatastrophe und ihren Konsequenzen.”
Doch er nimmt auch die Politik in die Pflicht: Auf Seiten der Entscheiderinnen und Entscheider brauche es ein Grundwissen über die Funktions- und Arbeitsweisen der Wissenschaft. “Diese Wissenschaftskompetenz sollte stärker verbreitet und gefördert werden.” Und er betont die Bedeutung von Wissenschaftskommunikation: “Evidenzbasierte Politik kann nur erfolgreich sein, wenn Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft miteinander im Dialog stehen.”
Clemens Hoch (SPD), Minister für Wissenschaft und Gesundheit in Rheinland-Pfalz, betont, aktuelle und künftige Herausforderungen wie der Klimawandel, eine alternde Gesellschaft oder das Aufkommen neuer Technologien im Bereich KI seien so komplex, dass wissenschaftliche Expertise unerlässlich sei. “Bei all diesen Themen ist es wichtig, dass Politik und Wissenschaft in einem ständigen Austausch bleiben und ihre unterschiedlichen Logiken, disziplinären Perspektiven und Einsichten insbesondere in Krisenzeiten miteinander vereinbaren. Ich denke, nur dann kann man den zu lösenden Problemen, Veränderungsprozessen und den Menschen gerecht werden”, sagt Hoch.
Zu einer guten und vor allem hilfreichen Politikberatung gehört für ihn:
An den unterschiedlichen Formen – zum einen in fest institutionalisierten Gremien, zum anderen in mehr oder weniger informelle Beratungen – möchte Hoch festhalten. “Dieses bereits etablierte Vorgehen halte ich für außerordentlich wichtig, um verantwortungsbewusst gesamtgesellschaftliche Entscheidungen treffen zu können. Denn am Ende des Tages gilt: Die Wissenschaft liefert die Grundlagen, aber die Politik muss entscheiden.”
In Teil 4 lesen Sie über die Erfahrungen und Vorschläge von Wissenschaftlern. Die Serie “Politikberatung, quo vadis?” finden Sie gesammelt hier.
Vor Ort in Mauretanien ist noch nichts zu sehen von grünem Wasserstoff, denn bisher gibt es nur eine Absichtserklärung zwischen dem Konsortium mit deutscher Beteiligung und der mauretanischen Regierung für das 34 Milliarden US-Dollar schwere Projekt. 2028 soll es losgehen für den deutschen Projektentwickler Conjuncta in Mauretanien: mit einer 400-Megawatt-Anlage für die Produktion von grünem Wasserstoff, nordöstlich von der Hauptstadt Nouakchott.
Das Hamburger Unternehmen hat sich dazu mit dem Gemeinschaftsunternehmen Infinity Power zusammengetan. Dahinter stehen der ägyptische Grünstromerzeuger Infinity aus Ägypten und ein Staatsunternehmen für erneuerbare Energien, Masdar, aus dem Golfemirat Abu Dhabi. Den klimafreundlichen Strom für die Elektrolyse sollen Windräder und Photovoltaikanlagen in Mauretanien liefern, der Energie-Export soll über einen Hafen abgewickelt werden. Genauso wie in zahlreichen anderen internationalen Projekten, in denen Deutschland mitmischt.
“Die Technologien für die Erzeugung von grünem Wasserstoff sind da”, sagt die Ingenieurin Sylvia Schattauer, seit 2022 kommissarische Leiterin des Fraunhofer-Instituts für Windenergiesysteme. Aber: “Jetzt geht es um das Hochskalieren. Die Systeme und Komponenten sind bisher manufakturgefertigt und sollen nun in großen Stückzahlen in Serie industriell hergestellt werden.”
Schattauer vergleicht das mit dem Übergang von einem individuell zusammengeschraubten Liebhaber-Auto zur Serienproduktion. “Es geht um Optimierung. Das ist keine Fragestellung der Grundlagenforschung, sondern eine Ingenieursaufgabe.” Die Idee des Konsortiums mit deutscher Beteiligung ist denn auch, in Mauretanien zunächst mehrere kleine Anlagen modular zusammenzuschließen, um 2028 auf die angepeilten 400 Megawatt Elektrolysekapazität zu kommen.
Für die anwendungsnahe Forschung geht es laut Schattauer, die Umwelttechnik und Regenerative Energien in Berlin studierte und an der Universität Potsdam in Experimentalphysik promoviert wurde, unter anderem um den Bereich Offshore: also die Produktion von Windenergie auf dem offenen Meer, gekoppelt mit der Produktion von Wasserstoff. “Die Windräder müssen harschen Bedingungen standhalten, das Meerwasser muss vor Ort entsalzt werden und die Elektrolyseure müssen ebenfalls unter harschen Bedingungen betrieben werden. Die Technik mag es nicht, immer im Grenzbereich gefahren zu werden.”
“Mauretanien ist weltweit einer der besten Wasserstoff-Standorte”, sagt Stefan Liebing, Geschäftsführer von Conjuncta. Es gebe rund um die Uhr günstigen Strom – tagsüber aus Sonne und nachts aus Wind. Außerdem sei durch die Lage am Atlantik der Zugang zu Wasser gegeben und Hafeninfrastruktur vorhanden. Diese Voraussetzungen entscheiden laut Liebing über die Wirtschaftlichkeit eines Projektes. Nordafrika soll laut der neuen nationalen Wasserstoffstrategie als Teil eines Schwerpunktkorridors für den Import von Wasserstoff nach Europa angebunden werden.
Laut Conjuncta werden langfristig bis zu 10 Gigawatt Elektrolysekapazität angepeilt. Zum Vergleich: Im Industrieland Deutschland soll laut Koalitionsvertrag bis 2030 ebenfalls auf 10 Gigawatt ausgebaut werden. Was das deutsche Projekt angeht, laufen Liebing zufolge derzeit zwei Schritte parallel. Die mauretanische Regierung, die noch mit drei weiteren internationalen Konsortien Memoranda of Understanding unterzeichnet hat, prüfe die rechtlichen und infrastrukturellen Voraussetzungen.
Conjuncta führe eine eigene Machbarkeitsstudie zu Finanzierung, Technik, Standorten und Verbindungsinfrastruktur durch. Fläche für den Aufbau von Anlagen für Wind- und Sonnenstrom gibt es jedenfalls reichlich in Mauretanien: Das Land hat etwas mehr als eine Million Quadratkilometer und ist damit etwa dreimal so groß wie Deutschland. Und das bei rund einem Zwanzigstel der deutschen Bevölkerungsgröße, 4,2 Millionen Einwohner hat Mauretanien.
“Wir glauben, dass es nicht nur unser Land verändern wird, sondern dass wir damit auch zum weltweiten Paradigmenwechsel in Sachen Energie etwas beitragen können”, gibt sich der mauretanische Energieminister Nani Ould Chrougha selbstbewusst. Das Bewusstsein für das nötige Umsteuern in der Energiepolitik sei in Mauretanien stark vorhanden: Sein Land spüre den Klimawandel stärker als der globale Norden, etwa durch die Veränderungen der Regenzeit.
Energieminister Chrougha, der erst im Juli das Amt vom jetzigen Wirtschaftsminister Abdessalam Ould Mohamed Saleh übernommen hat, gibt sich realistisch, aber optimistisch: “Es stimmt, dass wir keine Gelder vor Ort haben und keine Technologien, aber wir bieten großes Potenzial.” Die Pläne des deutschen Konsortiums, bis 2028 400 Megawatt Elektrolyse-Kapazität in Mauretanien aufzubauen, findet Fraunhofer-Forscherin Schattauer durchaus realistisch, sofern keine bürokratischen Hürden den Prozess verlangsamen.
Aber eine Sache dürfe man langfristig nicht vergessen, so die Energieexpertin: “Für die Produktion von grünem Wasserstoff bedarf es eines funktionierenden Stromnetzes. Wenn keiner diese Investition tätigt, kann das nicht funktionieren.” Aus politischer Perspektive liegt hier die Win-win-Situation für Mauretanien, eines der ärmsten Länder der Welt, das auf einen Entwicklungssprung hofft.

Was erforschen Sie im Zusammenhang mit KI?
Was mich derzeit viel beschäftigt, ist ein Projekt, das wir zusammen mit der Charité sowie Ethikern und Soziologen durchführen. Es geht um ein KI-System für Ärzte, das sie bei Entscheidungen in Diagnose und Therapie unterstützen soll. In Zusammenarbeit mit dem interdisziplinären Forscherteam versuche ich herauszufinden, wie wir das System gestalten sollten, damit es wirklich hilfreich ist. Die ärztliche Autonomie und die Kommunikationsstrukturen im Klinikalltag müssen zum Beispiel gewahrt bleiben.
In einzelnen Bereichen kann die KI durchaus besser als Ärzte sein, wie wir in einer kleinen, retrospektiven Studie gesehen haben. Unser System konnte anhand historischer Daten sehr gut vorhersagen, welche Patienten nach einer Nierenoperation Folgeerscheinungen wie einen Harnwegsinfekt oder sogar eine Abstoßungsreaktion erleiden werden und welche nicht. Selbst erfahrene Ärzte waren da im Hintertreffen.
Allerdings wurden nur einige Ärzte zusammen mit dem experimentellen System besser. Fazit: Wenn die Motivation stimmt, das Vorgehen genau überlegt ist und es eine gute Schulung gibt, kann die Medizin enorm von KI profitieren. Ärzten einfach ein technisches System überzustülpen, wird nicht funktionieren. Sie müssen es von vornherein mitgestalten. Das gilt im Grunde für alle Lebensbereiche, und wir sollten unverzüglich anfangen, die KI unseren Bedürfnissen anzupassen.

Was sind die größten Chancen von KI?
In vielen Bereichen haben wir die Digitalisierung in Deutschland verschlafen – denken wir nur an die Gesundheitsämter und ihre Faxgeräte in der Pandemie. KI gibt uns jetzt eine zweite Chance, die wir beherzt ergreifen sollten, um uns die Arbeit in vielen Gebieten zu erleichtern. Ein Beispiel ist das Bürgeramt, das über Wohngeldanträge zu entscheiden hat. Nehmen wir einmal an, zwei Drittel der Anträge entsprechen praktisch identischen Anträgen, die in der Vergangenheit entweder bewilligt oder abgelehnt wurden.
Nach diesem Muster lassen sie sich von einem KI-Programm effizient bearbeiten. Das gibt den Mitarbeitern mehr Zeit für die komplexen Fälle und insgesamt sind sie viel schneller fertig mit der Arbeit. KI kann uns auch helfen, den demografischen Wandel zu bestehen. Die Babyboomer gehen jetzt scharenweise in Rente und mit ihnen droht ein großer Wissensschatz verloren zu gehen. Dem sollten wir entgegenwirken und das Knowhow über grundlegende Abläufe in vielen Branchen umfassend digitalisieren. Damit lassen sich KI-Systeme trainieren, um später Lücken im Arbeitsmarkt zu schließen. Viel Zeit haben wir dafür nicht mehr, aber wir können es schaffen.
Ist die KI-Entwicklung überhaupt kontrollierbar? Und wie sollte sie reguliert werden?
Selbstverständlich können wir die Entwicklung steuern. Aber wir wollen ja nicht die Technologie als solche regulieren, sondern deren Nutzung. Den Hammer verbieten wir ja auch nicht. Als Werkzeug ist er sehr nützlich, strafbar ist sein Gebrauch als Tötungsinstrument. Dass wir für die KI einen rechtlichen Rahmen brauchen, steht außer Frage. Er sollte Grundlegendes regulieren und darf keinesfalls die praktische Anwendung ersticken. Das wäre etwa der Fall, wenn die Nutzung von ChatGPT für den Kundendialog kleiner und mittlerer Unternehmen als Hochrisikoanwendung eingestuft wird. So etwas zieht einen Rattenschwanz an Haftungsfragen nach sich.
Lasst uns um Gotteswillen nicht alle Probleme im Vorhinein ausdenken, sondern das Wesentliche regeln und schnell eingreifen, wenn es Probleme gibt. Viele Lebensbereiche sind ohnehin stark reguliert, denken wir an das Gesundheitswesen oder den Bausektor. Zusätzliche Vorschriften lähmen den Innovationselan, daran sollten wir auch beim aktuell diskutierten EU AI Act denken. Andererseits eröffnet eine umsichtige KI-Politik Europa gerade im Bildungssektor, in der Medizin, bei der Bewältigung des Klimawandels und in der Industrie große Chancen.
Welche negativen Auswirkungen künstlicher Intelligenz sind zu befürchten?
In den Händen böser Menschen ist KI natürlich eine Gefahr. Ausgefuchste Waffen, Kraftwerkshavarien, üble Fake News, Börsenchaos, kollabierende Märkte – all das sind reale Risiken. Aber solche Probleme gibt es auch heute schon und wir sind bisher meistens damit fertig geworden. Für deutlich übertrieben halte ich die Befürchtung, dass wir durch die Nutzung von KI unweigerlich verblöden. Der Mensch lernt gern und ist gern kreativ, das wird sich so schnell nicht ändern. Überhaupt sollten wir sehr vorsichtig bei Endzeitphantasien durch KI sein. Sie hindern uns nur, uns ernsthaft mit dieser wichtigen Zukunftstechnologie zu befassen.
Wo wird KI in 20 Jahren selbstverständlich sein?
Im Jahr 2040 wird KI allgegenwärtig sein und alle betreffen. Wir werden nicht mehr groß darüber reden. Heute diskutieren wir über die Vier-Tage-Woche, dann haben wir dank KI die Fünf-Stunden-Woche. Für unseren Lebensunterhalt arbeiten wir meinetwegen von 8 Uhr morgens bis 9 Uhr, die restliche Zeit kümmern wir uns um Kinder, alte Menschen und eigene Interessen. Stumpfsinnige, sich ständig wiederholende Arbeitsroutinen wird es nicht mehr geben. Sprachbarrieren sind verschwunden, das Energieproblem ist gelöst. Für Steuerberater und Anlageberater wird es eng, denn KI kann das oft besser. Dennoch wird nicht alles digitalisiert sein, analoge Lösungen wird es weiterhin geben – und hoffentlich auch noch meine geliebte Schallplattensammlung. Überhaupt sollten wir uns fragen, was wir von der KI wollen und sie entsprechend gestalten. Den Technikern sollten wir das keinesfalls allein überlassen.
Zur Person: Aljoscha Burchardt ist Principal Researcher und stellvertretender Standortsprecher am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Berlin. Als Experte für Sprachtechnologie und Künstliche Intelligenz hat der Computerlinguist das MQM-Framework zur Bewertung von Übersetzungsqualität mitgestaltet. Burchardt ist Senior Research Fellow des Weizenbaum-Instituts für die vernetzte Gesellschaft und war Mitglied der Enquete-Kommission “Künstliche Intelligenz” des Deutschen Bundestags.
Die Texte der Table.Media-Serie “Der globale Wettlauf um Künstliche Intelligenz” finden Sie hier.
Neu: Agrifood.Table Professional Briefing – jetzt kostenlos anmelden. Wie unsere Lebensgrundlagen geschaffen, gesichert und reguliert werden. Für die entscheidenden Köpfe in Landwirtschaft und Ernährung in Politik und Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft, Verbänden und NGO. Von Table.Media. (Anmelden)
6. September 2023, Allianz Forum, Pariser Platz 6, Berlin
Preisverleihung Unipreneurs: Die besten Professorinnen und Professoren für Startups Mehr
11.-13. September 2023, Osnabrück
18. Jahrestagung der Gesellschaft für Hochschulforschung Das Zusammenspiel von Hochschulforschung und Hochschulentwicklung: Empirie, Transfer und Wirkungen Mehr
20.-22. September 2023, Hyperion Hotel, Leipzig
Konferenz SEMANTiCS und Language Intelligence 2023 Mehr
27.-29. September 2023, Freie Universität Berlin
Gemeinsame Konferenz der Berliner Hochschulen Open-Access-Tage 2023 “Visionen gestalten” Mehr
Nach Informationen der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) erwägen weitere deutsche Universitäten, chinesische Nachwuchswissenschaftler mit einem CSC-Stipendium künftig nicht mehr zuzulassen. “Es gibt derzeit an weiteren Hochschulen konkrete Überlegungen, CSC-Stipendiat:innen zumindest in bestimmten Fachgebieten auszuschließen”, sagte HRK-Pressesprecher Christoph Hilgert Table.Media auf Nachfrage. Derzeit sei ein Diskussions- und Sensibilisierungsprozess im Gange, den die HRK im Rahmen ihrer Austauschformate zu Fragen der akademischen Zusammenarbeit aktiv unterstütze.
Die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) hatte als erste deutsche Hochschule eine Kooperation mit ausgewählten chinesischen Doktoranden beendet. Nach Recherchen von “Correctiv” und “University World News” (UWN) lässt die Unileitung seit Anfang Juni keine neuen Stipendiaten über das Chinese Scholarship Council (CSC) mehr zu. Das bestätigte eine Sprecherin der FAU Table.Media. Auch in weiteren europäischen Ländern haben Universitäten die Kooperation ausgesetzt.
Zu den Beweggründen teilte man mit, dass die Unileitung bei einer Prüfung des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) einmal mehr dafür sensibilisiert worden sei, “dass wir als FAU die Rahmenbedingungen schaffen müssen, um mit den Anforderungen des BAFA in Einklang zu sein”. In der Konsequenz werden nun nur noch Stipendiaten zugelassen, die “eine Co-Finanzierung über Institutionen mit Reputation und Verankerung im demokratischen System” vorweisen können. Auch an der FAU rechnet man fest damit, dass weitere Hochschulen diese Schritte gehen werden.
Eine Co-Finanzierung für chinesische Studierende bietet etwa der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD). Der DAAD vergibt im 2013 gestarteten Programm “Sino-German Postdoc Scholarship” gemeinsam mit dem CSC deutschlandweit rund 40 bis 50 Stipendien für chinesische Nachwuchswissenschaftler pro Jahr. Diese wären auch an der FAU von dem Ausschluss ausgenommen, bestätigte dort eine Sprecherin. Zahlen zu den reinen CSC-Stipendiaten, die sich derzeit in Deutschland aufhalten, werden nicht zentral erhoben.
“Bei der grundsätzlich partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit dem CSC haben in der Vergangenheit bereits Aushandlungsprozesse stattgefunden, um den Vorstellungen des DAAD für eine Auswahl von Stipendiatinnen und Stipendiaten angemessen Geltung zu verschaffen”, sagte ein Sprecher des DAAD Table.Media. Einer dieser “Aushandlungsprozesse” ist etwa die Absage des DAAD an die Forderung des CSC gewesen, die Auswahlsitzungen mit den chinesischen Bewerbern und Bewerberinnen durchgehend zu filmen.
Seitdem fänden die Auswahlsitzungen für das Programm konsekutiv statt, teilte der DAAD mit: “Zunächst trifft der CSC seine Auswahl, anschließend der DAAD. Förderungen können nur ausgesprochen werden, wenn beide Voten für Kandidaten übereinstimmen.” Zentrales Entscheidungskriterium sei dabei die akademische Qualifikation. Da das Auswahlverfahren so allerdings mit großem Aufwand verbunden sei, kann sich der DAAD eine Ausweitung des Programms derzeit nicht vorstellen.
Zugleich berate der DAAD die deutschen Hochschulen aber zur Betreuung von CSC-Geförderten sowie zur Zusammenarbeit mit Hochschulen in China generell, sagte der Sprecher. Hier spielt das DAAD-Kompetenzzentrum Internationale Wissenschaftskooperationen (KIWi) eine wichtige Rolle. “Der DAAD baut derzeit die Beratungsmöglichkeiten im KIWi aus und erhielt dazu im April zusätzliche Mittel vom Bundesministerium für Bildung und Forschung”, sagte ein DAAD-Sprecher. Man reagiere damit auf den gestiegenen Beratungsbedarf der deutschen Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen in Zeiten zunehmender Unsicherheit in der internationalen Wissenschaftskooperation. tg
Ein Dozent der Berliner Humboldt-Universität (HU) darf Gespräche mit Studierenden nur noch online und im Beisein der Frauenbeauftragten der betroffenen Fakultät führen. Die Regelung wurde wegen Vorwürfen der sexualisierten Gewalt und des Machtmissbrauchs bereits Mitte Mai getroffen. In einem offenen Brief auf der linken Plattform Indymedia haben Unbekannte dem Dozenten Mitte Juli nun auch körperliche sexualisierte Gewalt vorgeworfen. In dem Schreiben heißt es, der Beschuldigte missbrauche “seine Machtposition als Dozent und Vorgesetzter seit mehr als 20 Jahren”. Außerdem habe er sich in Vorlesungen “transfeindlich und rassistisch” geäußert.
Der Universitätsleitung waren in diesem Jahr bereits mutmaßliche verbale sexualisierte Übergriffe angezeigt worden. Die jetzt vorgebrachten Vorwürfe würden weiterhin intensiv geprüft und alle rechtlich möglichen Schritte eingeleitet, um erneute Übergriffe zu verhindern, teilte die Uni mit.
In einer am Dienstag veröffentlichten Stellungnahme ruft das Leitungsteam um Präsidentin Julia von Blumenthal Betroffene dazu auf, bisher unbekannte Sachverhalte zu melden. “Die Humboldt-Universität verurteilt Machtmissbrauch und sexualisierte Übergriffe und ahndet solche Verhaltensweisen”, heißt es. Betroffene Personen würden von der zentralen wie den dezentralen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragen umfassend beraten und bei einem Beschwerdeverfahren begleitet.
Die Studienvertretung der HU hatte am Montag mitgeteilt, seit April in Form einer Arbeitsgemeinschaft an der Aufarbeitung der Vorwürfe beteiligt zu sein. Das neu eingeführte Sechs-Augen-Prinzip wird ihrer Einschätzung nach “weder ausreichend” noch “ausnahmslos” eingehalten. Die zuständigen Stellen müssten sich deutlicher auf die Seite von Betroffenen stellen.
Ein Fall von Fehlverhalten und Belästigung beschäftigt derzeit auch die Ludwig-Maximilians-Universität München. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtete, hat die Landesanwaltschaft ein Disziplinarverfahren gegen einen Chemie-Professor eingeleitet. Dabei geht es um diskriminierendes Fehlverhalten und Belästigungen.
Mit dem Thema Machtmissbrauch befassen sich Universitäten und Forschungseinrichtungen zunehmend auch auf struktureller Ebene. Im Frühjahr rief eine Initiative mit der Wuppertaler Erklärung zu besserer Governance in der Wissenschaft auf. Ende Juni veröffentlichte die Deutsche Gesellschaft für Psychologie einen Bericht zum Thema und mahnte systemische Veränderungen an. abg/dpa
Sifted – Leading European fusion startup offered term sheet to build its tech in US. Wie das Branchenportal “Sifted” meldet, hat das deutsche Laserfusion-Start-up Marvel Fusion ein Vertragsangebot von einem US-Unternehmen vorliegen. Demnach soll in diesem “Term Sheet” eine Finanzierung angeboten werden, wenn Marvel Fusion sich verpflichtet, seinen Demonstrator in den USA zu bauen. Das US-Unternehmen will unerkannt bleiben und Marvel Fusion will sich nicht äußern. Die Infos stammen vom VC-Investor Earlybird, der die letzte Finanzierungsrunde von Marvel Fusion angeführt hat und jetzt dafür wirbt, eine respektable Finanzierung in Europa zu stemmen, bevor das Start-up in die USA abwandert. Mehr
Tagesspiegel – Die Chancen für Frauen an Unis steigen. Bei gleicher Leistung haben Frauen an deutschen Universitäten mindestens dieselbe Chance wie Männer, auf eine Lebenszeit-Professur berufen zu werden – teils sogar bessere. Das legen zwei neue Studien aus dem Saarland und Berlin nahe. Von Gleichberechtigung ist man trotzdem noch ein Stück entfernt, weil Frauen in früheren Karrierephasen oft Nachteile haben. Die Stichworte sind Betreuungsnachteil und Leaky Pipeline. Aber auch dieser Gender-Gap beginnt sich zu schließen. Mehr
FAZ – Mit der Muttersprache Englisch ist man klar im Vorteil. Wer nicht richtig gut Englisch kann, ist massiv im Nachteil, gerade zu Beginn einer Forscherkarriere. In PLoS Biology hat eine internationale Forschergruppe um Tatsuya Amanao von der University of Queensland im australischen Brisbane diese schon länger plausible Hypothese nun quantifiziert. Ulf von Rauchhaupt überlegt in seinem Kommentar, ob es nicht praktikabler sei, zum Latein zurückzukehren, das Niemandes Muttersprache sei. Wem auch das utopisch erscheine, müsse einfach zugeben: nicht jedem Mangel an Gerechtigkeit ist abzuhelfen. Mehr
ZDF – Tatort Uni. #MeToo und Machtmissbrauch an Hochschulen. Erniedrigungen, Mobbing, sexualisierte Übergriffe – im Wissenschaftsbetrieb häufen sich Berichte über den Machtmissbrauch. In der Sendung des ZDF berichten Nachwuchswissenschaftler über ihre Erfahrungen. Mehr
Laborjournal – Über Exzellenz, Geld & Wissenschaft. Gerald Schweiger aus Graz beklagt eine fehlende, klare Definition von Exzellenz. Gleichzeitig seien Peer-Review und Panel-Entscheidungen fehleranfällig. Schweiger stellt die Frage, ob hoher Wettbewerb und niedrige Erfolgsraten innovationshemmend wirken. Mehr
Christian Brei wurde im Juni vom Senat der Leuphana Universität Lüneburg zum hauptberuflichen Vizepräsidenten wiedergewählt. Der Stiftungsrat der Leuphana hat die Wahl jetzt bestätigt.
Beate Sieger-Hanus wurde zur Rektorin der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Stuttgart gewählt. Sie folgt auf Joachim Weber, der in den Ruhestand geht. Sieger-Hanus ist seit 2003 Professorin an der DHBW. Sie leitete den Studiengang BWL-Dienstleistungsmanagement und war Studiendekanin des Studienzentrums Dienstleistungsmanagement der Fakultät Wirtschaft.
Petra Justenhoven, Sprecherin der Geschäftsführung von PricewaterhouseCoopers (PwC) Deutschland sowie Chairwoman und Senior Partnerin von PwC Europe, ist neues Mitglied des Verwaltungsrates des RWI – Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung.
Mackenzie W. Mathis und Alexander Mathis sind die diesjährigen Gewinner des Eric Kandel Young Neuroscientists Prize der gemeinnützigen Hertie-Stiftung und der Federation of European Neuroscience Societies (FENS). Die mit 100.000 Euro dotierte Auszeichnung wird alle zwei Jahre an herausragende junge Wissenschaftler in der Hirnforschung verliehen. Mackenzie W. Mathis und Alexander Mathis sind Assistenzprofessoren am Brain Mind Institute, School of Life Sciences, der École Polytechnique Fédérale de Lausanne.
Hans Joachim Schellnhuber wird ab Dezember Generaldirektor des International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) in Laxenburg bei Wien. Schellnhuber war Gründer und bis 2018 Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK). Er folgt auf den Südafrikaner Albert van Jaarsveld, der das Institut seit 2018 geleitet hat.
Jim Skea ist neuer Vorsitzender des Weltklimarats (IPCC). Der britische Professor für nachhaltige Energie am Imperial College in London ist bei der IPCC-Sitzung in Nairobi gewählt worden.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an research@table.media! Gründer und bis 2018 Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) i
Bildung.Table. Duale Lehramts-Studiengänge auf dem Vormarsch. Immer mehr Bundesländer reformieren ihre Lehramtsstudiengänge hin zum dualen Modell. Table.Media gibt einen Überblick über den Stand der Umsetzung. Der variiert zwischen Nordsee und Alpen stark. Mehr
Bildung.Table. Eine deutsche Schule vergibt das ukrainische Abitur. Die Münchner Schlau-Schule für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge war lange der Underdog unter Bayerns Schulen. Jetzt ist sie selbst für Kanada Vorbild. Jugendliche können dort ukrainisches Abitur machen und lernen Deutsch – am Ende sollen sie an ukrainischen und deutschen Hochschulen studieren können. Mehr
Agrar.Table. Renaturierung: Die entscheidende Rolle der Moore. Das EU-Parlament hat einen Artikel zur Wiedervernässung trockengelegter Moore kurz vor der Abstimmung aus dem Renaturierungsgesetz gestrichen. Dabei können Vorgaben hierzu entscheidend sein, um die CO₂-Minderungsziele zu erreichen. In Deutschland ist die Wiederherstellung von Mooren umstritten. Mehr
Agrar.Table. Glyphosat-Abstimmung im Oktober. Die Abstimmung über eine Verlängerung des umstrittenen Herbizids um 15 Jahre soll im Oktober stattfinden. Vorgehensweise ist die Komitologie-Prozedur: Die Kommission stellt einen Entscheid vor, der zuständige Komitologie-Ausschuss des Rats stimmt darüber ab. Beim nächsten Treffen am 15. September will die Kommission ihren Entscheid zum Glyphosat vorstellen. Danach trifft sich das Komitee wieder am 12. und 13. Oktober und wird über die Verlängerung abstimmen. Mehr
Ich bin es müde, mir von Politikern wie Journalisten anhören zu müssen, dass Effizienzsteigerungen oder Kürzungen von Bildungs- und Forschungsbudgets Tabu sind. Dass Kürzungen beim Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM), bei Inno-KOMM oder dem BAföG Wehklagen hervorrufen und die Zuse-Gemeinschaft gar 22 Prozent mehr fordert, gehört zum Standard-Repertoire der gemeinhin als Beutegemeinschaften bekannten Forschungsorganisationen.
Doch auch Politik und Journalismus leugnen, dass Schrumpfung und Wachstum etwas ganz Natürliches sind. Früh wurde mir beigebracht, dass Ökonomie – Betriebswirtschaft wie Volkswirtschaft – wie ein mathematischer Bruch funktioniert: im Zähler das Wachstum durch Investition in die Erneuerung des Kapitalstocks, durch Renditen auf Invest in Humankapital, durch Return on Invest von Investitionen in Zukunftstechnologien und potenzielle Innovationen.
Im Nenner dagegen geht es um Fortschritt bei Rationalisierung, Reorganisation von Alt zu Neu, Kostensenkung, Prozessoptimierung, summa summarum um Effizienz, Produktivität und entsprechende Einsparungen. Das Gleiche gilt gleichermaßen für Familienhaushalte wie für den Bundeshaushalt.
Wer jahrelang nur die Balance im mathematischen Bruch hält, stagniert. Wer im Wesentlichen auf Effizienz setzt, ohne Wachstum zu erzielen, erlebt, wie es ‘on the long tail’ immer schwerer wird, die Margen zu squeezen. Wer – wie im Forschungs- und Bildungshaushalt – ohne entsprechenden Output oder ohne Effizienzsteigerung investiert, schrumpft oder verschuldet sich (mit entsprechenden Folgen in Hochzins-Zeiten). Erst recht, wenn destruktive Einschläge wie der Krieg in der Ukraine neue Prioritäten notwendig machen.
Dies hatte schon die Große Koalition nicht im Visier. Weder wurden die Experten-Empfehlungen zur gescheiterten Familienpolitik, noch zur ruinösen Verteidigungspolitik aufgegriffen. Der desolate Zustand ist unübersehbar. In der Bildungs- und Forschungspolitik erst recht. So wurden die milliardenschweren Aufholprogramme für Schüler nach Corona ohne Erfolgskontrolle blind über die Republik verstreut.
Der Digitalpakt 1.0 hat keinerlei Verpflichtung, Erfolg zu belegen. Zudem wurde der über 120 Milliarden Euro schwere Pakt für Forschung und Innovation von 2021 bis 2030 ohne jegliche Output-Erwartungen, geschweige denn Verpflichtungen geschlossen. Den gleichen Fehler wiederholte der Haushaltsausschuss des Bundestags, als er den Hochschulpakt dynamisierte, ohne ihn beispielsweise an die drastische Reduktion von Studienabbruchs-Zahlen zu knüpfen.
Da mutet die Aussage des bildungspolitischen Sprechers der CDU, Thomas Jarzombek hoch befremdlich an. Er beklagt: “Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger wird die erste ihrer Zunft seit einem Jahrzehnt sein, die ein Minus in ihrem Ministerium verantworten muss. Und zwar ein Minus von über einer Milliarde Euro”. Hat doch 16 Jahre christdemokratische Bildungs- und Forschungspolitik Geld in den Zähler reingepumpt, nicht nur ohne Erzeugung von Wachstum, ja sogar mit Verschlechterung der Bildungs- und Innovationsrenditen.
Gleichzeitig wurde nichts, aber auch nichts zur Effizienzsteigerung im Nenner gemacht. Förderlinien wurden fast unsterblich. Strategische Prioritäten gab es nicht oder wurden politisch manipuliert wie bei der Forschungsfabrik Batterie. Praktisch wurde nur in gesteigertem Input, nicht in Outcome oder Impact gedacht. “Mehr bringt Mehr” ist eine der schlechtesten Maximen, der die Politik folgen kann. Leider fallen auch einige Medien und Wissenschaftsjournalisten auf diesen Unsinn rein. Ein Pflichtfach Ökonomie hätte ihnen allen nicht nur gutgetan, sondern wäre Voraussetzung für die Ausübung ihres Jobs in Politik wie Journalismus gewesen.
Ich selbst habe dramatische Effizienzprogramme und Sparkurse bei Lufthansa, Continental und Telekom nicht nur miterlebt, sondern mitgestaltet. Die meisten waren überfällig, weil zuvor eine Phase der Arroganz den Kunden gegenüber, der Blindheit gegenüber Umweltsignalen und eine Ignoranz gegenüber Wettbewerbern vorausging. Meist waren sie hoch erfolgreich und heilsam, weil sie nicht nur das System, sondern auch das Mindset reinigten.
Deswegen habe ich nichts gegen Sparen. Ganz im Gegenteil: Ich würde dabei noch strategischer und härter vorgehen. Denn auch Effizienz-Management ist eine Kunst.
Verringerung der Ressourcen zwingt zur Prioritätensetzung. In opulenten Zeiten wird die Gießkanne ausgegossen. Magere Zeiten zwingen zur Devise: Fokus, Fokus, Fokus. Das gibt es die Gelegenheit, alte Zöpfe abzuschneiden und neues zuzulassen – eben strategisch zu priorisieren. Was heißt das praktisch für die Bildung- und Forschungspolitik?
