ob Bettina Stark-Watzinger gehofft hat, dass nach der Rückkehr aus ihrem Urlaub der Ärger mit der Fördermittel-Affäre vergessen ist? Spätestens seit gestern Abend weiß sie, dass sie die Kritik an den Vorgängen im BMBF weiter begleiten wird. Kai Gehring, Vorsitzender des Forschungsausschusses, hat der schriftlichen Bitte der CDU-Politiker Thomas Jarzombek und Stephan Albani entsprochen und eine weitere Sondersitzung mit der Ministerin für den 10. September einberufen. Sie ist gebeten, auch die von ihr entlassene Sabine Döring und Abteilungsleiter Jochen Zachgo mitzubringen. Dies aber liegt in ihrer Entscheidung, sagt Gehring.
Unternehmen in den USA sind kommerziell die größten Profiteure der Förderung des Europäischen Forschungsrats (ERC). Dies hat eine Studie des italienischen Icrios Instituts ergeben. Demnach patentieren US-amerikanische Start-ups und Konzerne weit mehr Produkte, die auf vom ERC finanzierten, wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren, als europäische Unternehmen.
Das war so aber nicht gedacht: Der ERC mit seinem Budget von 16 Milliarden Euro für den Zeitraum von 2021 bis 2027 soll eigentlich eine starke wissenschaftliche Basis bilden, die sich auf Quantität und Qualität der Innovationen auswirkt, die die europäische Wissenschaft und Wirtschaft hervorbringen. Die alte und neue Kommissionspräsidentin, Ursula von der Leyen, hatte bei ihrem jüngsten Antritt noch versprochen, den ERC “auszubauen”. Doch es bleibt bislang offenbar dabei, dass Europa über Exzellenz in der Grundlagenforschung nicht herauskommt, berichtet unser Kollege David Mattews vom europäischen News-Portal ScienceBusiness.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommertag,


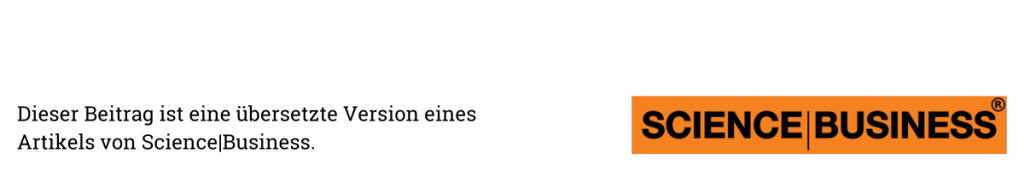
Einer neuen Studie zufolge sind Unternehmen in den USA kommerziell die größten Profiteure der Förderung des Europäischen Forschungsrats (ERC). US-amerikanische Start-ups und Konzerne patentieren weit mehr Produkte, die auf vom ERC finanzierten, wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren, als europäische Unternehmen oder Universitäten.
Die Studie der Wissenschaftler um Jay Prakash Nagar wurde am Icrios durchgeführt, einem Zentrum für Innovationsforschung an der Mailänder Bocconi-Universität. Die Ergebnisse bestätigen, nach Angaben des ERC, die eigenen internen Untersuchungen des Forschungsrats. Sie seien der jüngste Beleg dafür, dass Europa gute Grundlagenforschung bislang nicht effizient genug in echte Innovationen umsetzt.
“In absoluten Zahlen […] sind US-Organisationen, insbesondere US-Unternehmen, immer noch führend, wenn es darum geht, den größten Nutzen aus der ERC-Wissenschaft zu ziehen”, so das Fazit der in der Zeitschrift Research Policy veröffentlichten Studie. Der 2007 gegründete ERC verfügt über ein Budget von 16 Milliarden Euro für den Zeitraum von 2021 bis 2027 und soll Akademikern einige der weltweit großzügigsten und unbürokratischsten Zuschüsse für Forschung gewähren.
Finanziert wird vor allem Grundlagenforschung, der wirtschaftliche Nutzen steht nicht im Fokus der Förderung. Europäische Politiker hoffen jedoch, dass sich eine starke wissenschaftliche Basis auch auf Quantität und Qualität der Innovationen auswirkt, die die europäische Wissenschaft und Wirtschaft hervorbringen. Die alte und neue Kommissionspräsidentin, Ursula von der Leyen, hatte bei ihrem Antritt versprochen, den ERC “auszubauen”.
Doch die Studie mit dem Titel “ERC science and invention: Does ERC break free from the EU-Paradox?” deutet darauf hin, dass es europäischen Unternehmen und Universitäten nicht gelingt, aus den ERC-Durchbrüchen in den Labors Kapital zu schlagen. Untersucht wurden fast 10.000 Innovationen, die sowohl in den USA als auch beim Europäischen Patentamt patentiert wurden – und daher wahrscheinlich von größtem wirtschaftlichem Wert sind – und sich auf ERC-Forschung bezogen.
US-Unternehmen waren für 26 Prozent dieser Patente verantwortlich, verglichen mit etwa 16 Prozent von EU-Unternehmen. EU-Universitäten meldeten 16 Prozent an, US-Universitäten nur knapp 15 Prozent. Hinzu kommt, dass 37 Prozent der US-Unternehmen, die Patente anmeldeten, Start-ups waren. In der EU lag dieser Anteil bei nur 21 Prozent. “Aus meiner Sicht ist die größte Erkenntnis, wie viele Start-ups – verglichen mit der EU – zur Innovationsstärke der USA beitragen”, sagte Co-Autor Jay Prakash Nagar, Forscher an der Duke University im US-amerikanischen Durham.
Die Ergebnisse bestätigen, dass die vom ERC finanzierte Forschung nach wie vor unter dem seit langem beobachteten “europäischen Paradoxon” leidet: Die Grundlagenforschung ist hervorragend, aber die Ergebnisse werden kaum in die sogenannten “real world innovations” umgesetzt, beschreiben es Nagar und seine Mitautoren in ihrer Studie.
Der ERC vergibt Gelder an Wissenschaftler, unabhängig davon, woher sie kommen, aber die Geförderten müssen in der Regel mindestens die Hälfte ihrer Zeit in Europa verbringen. Das soll dazu führen, dass das Know-how vor allem in europäische Unternehmen und Universitäten fließt. Allerdings haben ERC-Stipendiaten aus den USA, selbst wenn sie in Europa ansässig sind, in der Regel weiter eine Verbindung zu den USA. Unter anderem durch Doktoranden, die dorthin ziehen, spekulierte Nagar. Die Ergebnisse flössen jedenfalls schnell über den Atlantik.
Der ERC bestreitet Nagars Ergebnisse nicht – tatsächlich trafen sich ERC-Experten im vergangenen Jahr mit einem seiner Co-Autoren zu einem Gespräch über die Studie, und ein Sprecher sagte auf Anfrage von ScienceBusiness, die Ergebnisse seien “überhaupt nicht überraschend”. Die eigene interne Analyse des Rates hat ebenfalls ergeben, dass US-Unternehmen führend sind, wenn es darum geht, Nutzen aus der ERC-finanzierten Forschung zu ziehen.
Bereits im vergangenen Jahr hatte der ERC eine eigene große Studie über Patente im ERC-Kontext erstellt, und “die von den Experten gesammelten Daten bestätigen die Ergebnisse, auch wenn sie in dem veröffentlichten Bericht selbst nicht ausgewiesen wurden”, sagte der ERC-Sprecher. Jüngste Daten, einschließlich der EU-eigenen Berichte über die Leistung der Bereiche Wissenschaft, Forschung und Innovation würden zeigen, dass die Innovationsleistung in der EU hinter der globalen Konkurrenz zurückbleibt.
Für die forschungspolitische Debatte in der EU kommen die Ergebnisse möglicherweise zum richtigen Zeitpunkt. Sie könnten in die Diskussion über die Forschungs- und Innovationsprogramme der EU einfließen. Es wird erwartet, dass das nächste Forschungsrahmenprogramm der EU, das FP10, einen größeren Schwerpunkt auf die wirtschaftliche Verwertung legt, wenn es 2028 beginnt.
Handlungsbedarf ist vorhanden, da die europäischen Volkswirtschaften stagnieren und der Kontinent global gesehen hinter die technologische Spitze zurückfällt. Die Staats- und Regierungschefs der EU versuchen deshalb auch, die Idee der Kapitalmarktunion wiederzubeleben, einen bislang unvollendeten Vorstoß zur Beseitigung von Investitionshemmnissen und zur Stimulierung eines Risikokapitalmarktes nach US-amerikanischem Vorbild. Auch für diese Debatte könnten die Forschungsergebnisse aus Italien neues Futter liefern. David Matthews
Dieser Beitrag ist eine übersetzte Version eines Artikels von Science|Business . Mit einem Redaktionsteam, das in Brüssel und in der gesamten EU arbeitet, ist Science|Business Europas wichtigste englischsprachige Quelle für fundierte Berichterstattung über Forschungs- und Innovationspolitik.
Die CDU sieht in der Fördermittel-Affäre zu viele unbeantwortete Fragen durch Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger und ihr Ministerium: In einer neuerlichen Sondersitzung des Bundesforschungsausschusses am 10. September soll die FDP-Politikerin erneut zur Fördergeld-Affäre aussagen – ebenfalls erscheinen sollen die von ihr entlassene Staatssekretärin Sabine Döring und der zuletzt in den Blick geratenen Abteilungsleiter 4 (Hochschule), Jochen Zachgo.
Das geht aus einem Brief hervor, den die CDU-Politiker Stephan Albani und Thomas Jarzombek an Kai Gehring, den Vorsitzenden des Bundesforschungsausschusses, geschrieben haben. Sie haben Gehring gebeten, ein weiteres Sondertreffen zu ermöglichen.
Gehring hat der Bitte stattgegeben, wie er gegenüber Table.Briefings erklärt. “Die Entscheidung über die Teilnahme weiterer Personen obliegt der BMBF-Leitung”. Auch über die Modalitäten der Sitzung, wie die Anzahl der Fragerunden, müssen sich wie üblich die Fraktionen verständigen, erklärt Gehring. Da ein Aktenvorlagerecht ausschließlich Untersuchungsausschüssen vorbehalten ist, müsse sich die Union mit dem Anliegen nach Akteneinsicht direkt an das Ministerium wenden.
Man sei dankbar, dass die Bundesministerin am 26. Juni “in den Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung zitiert werden konnte” und es eine erste Aussprache zu den “im Raume stehenden schwerwiegenden Vorwürfen” gab, hatten die CDU-Politiker in ihrem Brief an Gehring geschrieben, allerdings seien “bedauerliche Weise noch zahlreiche Fragen offengeblieben.”
Nach Wahrnehmung der CDU bestehe eine mehrheitliche interfraktionelle Einigkeit darüber, dass eine “lückenlose Sachverhaltsaufklärung die Voraussetzung dafür ist, verloren gegangenes Vertrauen in das BMBF zurückgewinnen zu können.”
Seit dem 26. Juni 2024 sind laut den CDU-Politikern “weitere erhebliche Zweifel an der Richtigkeit der Darstellung” von Bundesministerin Stark-Watzinger entstanden. Dazu zählt die CDU:
Durch das Verhalten der Ministerin in den vergangenen Wochen sei aus einer “anfänglichen Affäre im Bereich der Wissenschaftsfreiheit” eine Affäre auf mehreren Ebenen geworden.
Die CDU zählt hierzu eine Affäre:
Mit Befremden entgegengenommen hätte die Union die Entscheidung von Bettina Stark-Watzinger vom 18. Juli 2024, der entlassenen Staatssekretärin Sabine Döring auch gegenüber “der größten Oppositionsfraktion im Deutschen Bundestag eine persönliche Stellungnahme zu untersagen.”
Und zuletzt: Die Antworten des BMBF auf die Kleine Anfrage der CDU/CSU-Bundestagsfraktion “100 Fragen zur Sachverhaltsaufklärung von Bundesministerin Bettina Stark-Watzinger zur sog. Fördermittel-Affäre” hätten kaum Aufklärung, dafür aber neue Fragen aufgeworfen. So waren frühere Aussagen der Forschungsministerin dahingehend korrigiert worden, etwa zu den Arbeitsabläufen im Ministerium. Und: Ursprünglicher Initiator der Listen, in denen kritische Forscherinnen und Forscher aufgeführt wurden, die vom BMBF direkt gefördert werden, soll demnach der Leiter der Abteilung 4, Jochen Zachgo, gewesen sein.
Aus dem BMBF gab es bislang noch keine Reaktion auf Brief und Einladung. Die Sondersitzung am 10. September soll um 8 Uhr beginnen.

Herr Reinhardt, gibt es aus Perspektive der Wissenschaftsforschung empirische Belege dafür, dass geisteswissenschaftliche Anträge im Begutachtungsprozess von Drittmittelanträgen strukturell benachteiligt sind?
Die Diskussion gibt es mindestens seit dem Beginn der Exzellenzinitiative. Damals hatte sich unter anderem der Politikwissenschaftler Michael Zürn zu Wort gemeldet und über Unterschiede in den Begutachtungskulturen geschrieben. Sowohl Christiane Wiesenfeldt als auch Zürn beschreiben das Phänomen, dass die Geisteswissenschaftler sehr differenziert begutachten. Dies führe in den sehr kompetitiven Begutachtungsverfahren der Exzellenzinitiative – die verschiedene Bereiche miteinander vergleichen und konkurrieren lassen – zu Nachteilen. Die Naturwissenschaften dagegen würden “bedingungslos”, so hatte es Michael Zürn damals beschrieben, wohlwollend argumentieren und sozusagen in ein Schwarz-Weiß-Schema verfallen, weil sie genau wissen, dass nur die Bestnoten durchkommen. Meines Wissens ist das nie systematisch erhoben worden. Bisher stützt sich dieser Eindruck eher auf anekdotische Evidenz.
Solange eine derartige Analyse noch aussteht: Gibt es schlüssige Indizien dafür, das etwas an der These dran ist?
Die Geisteswissenschaften sind ein sehr heterogenes Gebiet. Die Geistes- aber im weitgehenden Maße auch die Sozialwissenschaften sind dadurch gekennzeichnet, dass sie unterschiedliche Zugänge und Methodenbereiche aber auch Theorienbündel und Paradigmen nebeneinander gelten lassen. Dass also unterschiedliche Schulen, wenn Sie so wollen, miteinander konkurrieren und gegeneinander antreten. Das ist in den Natur- und Technikwissenschaften, wenn überhaupt nur temporär der Fall. Da löst ein Paradigma das andere ab, zumindest als das dominante. Natürlich gibt es auch dort Minderheitenmeinungen und Debatten. Aber man hat meist ein Fundament, auf dem mehr oder weniger alle stehen. Allein diese Struktur lässt es plausibel erscheinen, dass Forschende in den Geisteswissenschaften debattierfreudiger sein müssen.
Geisteswissenschaftler sind also von Natur aus kritischere Geister?
Gutachter, die ihre Kollegen bewerten sollen, teilen möglicherweise nicht einmal dieselben Prämissen mit ihnen. Das ist aber auch nur ein Aspekt, ein anderer ist die Quantifizierbarkeit der Begutachtungskriterien. Stefan Hornbostel, ehemaliger Leiter des Instituts für Forschungsinformation und Qualitätssicherung, hat vor etwa zehn oder 15 Jahren in Studien gezeigt, dass die Gutachter für die Exzellenzinitiative bei Geistes- und Naturwissenschaftlern unterschiedliche Kriterien anlegen. Während bei den Geisteswissenschaftlern zum Beispiel in die Publikationsliste der Antragssteller geschaut und deren Arbeiten gelesen wurden, wurde in den Technikwissenschaften eher auf den quantifizierbaren Zitationsindex geschaut. Das führt dazu, dass Geisteswissenschaftler sich eher in das Thema und auch die Kritik an Forschungsansätzen einlesen. Das ist meines Erachtens die qualifiziertere Betrachtung. Wenn es aber um Vergleiche und Noten geht, kann das potenziell ein Nachteil sein.
Die Philosophin Amrei Bahr führt noch einen weiteren Aspekt auf: In den Geisteswissenschaften komme es “prozessual häufig zu einer Gleichzeitigkeit des inhaltlich Ungleichzeitigen”, die sich dem Raster der Drittmittelvergabe aus ‘Work packages’, ‘Milestones’ und ‘deliverables’ entzieht.
Ich würde ihr zustimmen, dass die Projektifizierung, also eine stark strukturierte Art und Weise, auf Ergebnisse zuzusteuern, stärker in den Natur- und Technikwissenschaften ausgeprägt ist. Sie sind durch ihre Forschungspraxis dazu gezwungen, Arbeitspakete zu definieren. Wenn ich zum Beispiel ein Labor betreibe, muss ich das de facto tun. Natürlich müssen auch Geisteswissenschaftler strukturiert vorgehen und können definieren, was sie tun – etwa Quellenlektüre oder Archivrecherche. Aber natürlich ist die Vorhersage und die Planung, wie ich schlussendlich zu Ergebnissen komme, nicht immer so einfach möglich und sinnvoll.
Reicht es aus, wenn die Geisteswissenschaftler die Kunst des Lobens erlernen, wie Frau Wiesenfeldt in ihrem Essay fordert? Oder muss sich nicht eher der Begutachtungsprozess grundlegend ändern?
Ich würde etwas Drittes vorschlagen. Und zwar, dass wir Förderlinien schaffen oder ausbauen, die für die Geistes- und Teile der Sozialwissenschaften angemessener sind und ihnen auf den Leib geschneidert werden. Leibniz-Preisträger Ulrich Herbert hat schon vor einigen Jahren kritisiert, dass die Exzellenzcluster zu groß und zu arbeitsteilig sind, als dass sie dem Gros der Geistes- und Sozialwissenschaften passen. Es wäre also besser, statt die Geisteswissenschaften ins Korsett pressen zu wollen, vielleicht andere Formen, wie die Forschungsgruppen oder hochrangig positionierte Einzelförderungen auszubauen. Beispielhaft genannt seien hier das Koselleck- oder das Heisenberg-Programm der DFG. Was wir sehen, ist ja, dass ein erheblicher Teil der Fördermittel in Sonderforschungsbereiche und andere Verbundprogramme geht. Die Geisteswissenschaften müssten aber kleinteiliger gefördert werden.
Sind Förderentscheidungen nicht auch politischen Prioritäten und einem Zeitgeist unterworfen?
Zu bestimmten Zeiten haben sich bestimmte Bereiche abgehängt gefühlt. Den Chemikern ist es zum Beispiel in den Sechzigerjahren so gegangen, weil sie viel kleinteiliger organisiert waren als die Physiker mit ihrer Großforschung und der entsprechenden Infrastruktur. Das ist also kein Sachverhalt, wo die Linie immer nur zwischen Geistes- und Naturwissenschaften verläuft. Aber ich glaube tatsächlich, wenn man sich anschaut, in welchem Maße Geisteswissenschaften gefördert werden, durch die DFG, die Max-Planck-Gesellschaft und andere, dass sie strukturell im Nachteil sind. Das ist mindestens seit dem Kalten Krieg so. Das mag auch wirtschaftspolitische Gründe haben, weil man von den Natur- und Technikwissenschaften mehr erwartet. Es muss aber kein Automatismus sein.
Was sind bereits erkennbare oder absehbare Folgen der Benachteiligung?
Eine Folge ist, dass die hermeneutischen, interpretierenden Wissenschaften unterrepräsentiert sind. Man kann das am Beispiel der Klimaforschung herleiten. In diesem Bereich ist wissenschaftlich eindeutig zu belegen, dass der entscheidende Faktor menschliches Verhalten ist, also zum Beispiel der Verkehr und die Art wie wir heizen. Wichtige Fragen sind also, wie wir unsere Gesellschaft organisieren und wie verschiedene Sphären des Systems darauf reagieren. Nun ist aber die Herangehensweise der meisten Forscher eine quantifizierende oder besser: eine datafizierende, also eine auf empirisch erhobenen Daten beruhende Wissenschaft, die dann in Modelle und Simulationen gegossen wird. Das hilft nicht dabei, das Phänomen der Klimawandel-Leugnung besser zu verstehen oder diesem im Idealfall sogar begegnen zu können. Dafür brauchen wir die Geisteswissenschaften.
12./13. September 2024, FU Berlin
Jahrestagung des Netzwerks Wissenschaftsmanagement Für Freiheit in Krisenzeiten. Perspektiven aus dem Wissenschaftsmanagement Mehr
19. September 2024, ab 11 Uhr, Körber-Stiftung, Hamburg
Hamburg Science Summit 2024 “Europe’s Path Towards Tech Sovereignty” Mehr
24. September 2024, 10:30 bis 16:15 Uhr, Haus der Commerzbank, Pariser Platz 1, 10117 Berlin
Forum Hochschulräte Starke Marken, klarer Kern: Strategische Schwerpunktsetzung und Markenbildung bei Hochschulen Mehr
25. September 2024, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU)
Jahreskolloquium des Bayerischen Wissenschaftsforums Transformationskompetenz in Wissenschaft und Hochschule Mehr
26. September 2024, 12:00 bis 13:00 Uhr, Webinar
CHE talk feat. DAAD KIWi Connect Transfer und Internationalisierung – Warum ist es sinnvoll, beides gemeinsam zu denken und was braucht es hierzu? Mehr
26./27. September 2024, Leopoldina, Jägerberg 1, 06108 Halle (Saale) und Online
Jahresversammlung 2024 der Leopoldina Ursprung und Beginn des Lebens Mehr
3. /4. Oktober 2024, Universität Helsinki, Finnland
2024 EUA FUNDING FORUM Sense & sustainability: future paths for university finances Mehr
23. bis 25. Oktober 2024 am ETH AI Center in Zürich, Schweiz
Jahrestagung der Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft (GMW) und CampusSource Agilität und KI in Hochschulen Mehr
Eine wissenschaftliche Zwischenbegutachtung von sechs Forschungshubs der Alexander von Humboldt-Stiftung (AvHS) in Afrika fällt positiv aus und empfiehlt die Fortsetzung der Förderung bis 2026. Das Fraunhofer-Institut für System und Innovationsforschung (ISI) hatte die Forschungszentren in Benin, Kamerun, der Republik Kongo, Nigeria und Simbabwe analysiert. Die Hubs hätten es trotz schwieriger Ausgangslage und in einzelnen Fällen auch äußerst prekärer Bedingungen geschafft, Forschungszentren aufzubauen, die national und international wissenschaftlich stark vernetzt sind, eine hohe Sichtbarkeit aufweisen und eine wichtige Plattform insbesondere für Nachwuchswissenschaftler*innen bilden, heißt es in dem Gutachten. Eine Anschlussfinanzierung ist aufgrund der aktuellen Haushaltslage höchstwahrscheinlich nicht gegeben, erklärt eine Sprecherin der AvHS gegenüber Table.Briefings.
Die Hubs sind beauftragt, Forschungsergebnisse zur Bewältigung von Pandemien und Strategien zur Erhöhung der Resilienz afrikanischer Gesellschaften für künftige Krisensituationen entstehen zu lassen. Geleitet werden die Hubs von Wissenschaftlern aus dem afrikanischen Humboldt-Netzwerk.
Aktiv wurden die Forscher etwa in der Bekämpfung der neuen Variante des Mpox-Virus (früher “Affenpocken”), die sich aktuell ausbreitet. So hat ein Forschungshub in Nigeria durch seine große Probensammlung aus Wildtieren Zugang zum natürlichen Wirt des Virus, was seit 2022 für weitergehende Analysen zu Mpox genutzt wird. In der Republik Kongo hat der Forschungshub seinen Arbeitsschwerpunkt von COVID-19 auf andere Infektionskrankheiten wie Mpox oder Malaria verlagert.
Das attestieren die Gutachter den sechs Hubs:
Zu den Herausforderungen für die Hubs zählten schwierige sozio-ökonomische und sicherheitspolitische Ausgangslagen, häufige Stromausfälle oder Verzögerungen und Probleme bei der Beantragung von Einreisevisa für Deutschland, berichten die Gutachter.
Die Forschungshub-Leitungen reagierten kreativ auf solche Hindernisse. Sie initiierten zum Beispiel neue Kooperationen zu anderen afrikanischen Forschungsinstitutionen, stärkten Kompetenzen zur eigenverantwortlichen Mittelverwaltung oder beschafften Solaranlagen.
Die Hubs erhalten aktuell eine Förderung von bis zu 750.000 Euro über einen Zeitraum von maximal fünf Jahren. Fünf der sechs Forschungshubs werden durch das Auswärtige Amt gefördert, eines durch die Bayer Foundation.
Da das Auswärtige Amt seine Ausgaben von 2025 an kürzen muss, kann derzeit keine neue Ausschreibung von Humboldt-Forschungshubs in Aussicht gestellt werden, berichtet eine Sprecherin der Stiftung. Die allgemein schwierige Haushaltslage des Bundes verschlechtere außerdem auch die Chancen auf die Finanzierung der Forschungshubs durch andere Ministerien. nik

Die US-amerikanische National Science Foundation (NSF) hat Fördergelder in Höhe von 67 Millionen US-Dollar für die Einrichtung eines Zentrums für Forschungssicherheit vergeben. Entstehen soll das sogenannte “Safeguarding the Entire Community of the US Research Ecosystem”-Center (Secure Center). Dafür erhält ein Verbund unter Leitung des Sicherheitsforschers Mark Haselkorn an der University of Washington 50 Millionen US-Dollar und weitere 17 Millionen US-Dollar gehen an einen Verbund, dem die Texas A&M University vorsteht.
Das neue Secure Center, das in Seattle angesiedelt sein wird, soll eine Art One-Stop-Shop für US-amerikanische Forschungsorganisationen und kleine Unternehmen sein, die Beratung zum Thema Sicherheit suchen. Seine Schaffung wurde vom Kongress im Chips & Science Act aus dem Jahr 2022 angeordnet, als Teil der wachsenden Bemühungen der USA, die unbefugte Weitergabe sensibler Forschungsergebnisse an andere Länder – insbesondere China – zu verhindern.
“Die NSF ist einer prinzipientreuen internationalen Zusammenarbeit verpflichtet. Gleichzeitig müssen wir uns mit Bedrohungen für die Forschungstätigkeit auseinandersetzen”, sagte NSF-Direktor Sethuraman Panchanathan anlässlich der Fördermittel-Entscheidung. “Mit dem Secure Center bringen wir die Forschungsgemeinschaft zusammen, um Risiken zu identifizieren, Informationen auszutauschen und nationales Fachwissen zur Forschungssicherheit zu nutzen. So sollen Lösungen entwickelt werden, die wichtige Forschungsarbeiten an Einrichtungen im ganzen Land schützen.”
Das Secure Center soll teilweise von der Regierung und durch Nutzungsgebühren finanziert werden, um der US-amerikanischen akademischen Gemeinschaft ein Mitspracherecht bei seiner Arbeitsweise zu geben. Geheime Informationen über Sicherheitsbedrohungen bleiben in den Händen der Regierungsbeamten, die das Projekt überwachen. Das Zentrum werde jedoch Informationen bereitstellen, die nicht klassifiziert sind. Zum Beispiel über “unsachgemäße oder illegale Bemühungen ausländischer Unternehmen, Forschungsergebnisse zu erhalten”, hieß es in der Ausschreibung der NSF im letzten Jahr. Es wird außerdem “zeitnahe Berichte” über Risiken, Sicherheitsschulungen für Lehrkräfte und Mitarbeiter sowie “Analysen von Risikomustern und zur Identifizierung böswilliger Akteure” bereitstellen.
Die Anschubfinanzierung, die für fünf Jahre ausgelegt ist, ist der nächste Schritt zum Ausbau der universitären Sicherheitssysteme, der unter der Trump-Administration begonnen und von Präsident Biden fortgesetzt wurde. Gleichzeitig drängen die USA ihre Verbündeten, ihre eigene Forschungssicherheit strikter zu gestalten – was beispielsweise dazu führte, dass Kanada eine schwarze Liste chinesischer Forschungsorganisationen veröffentlichte und die Europäische Kommission ein Sicherheits-“Toolkit” für Universitäten entwickelte.
Im Gespräch mit Table.Briefings hatte Rebecca Keiser, Chief of Research Security Strategy and Policy, auch Erwartungen an Deutschland formuliert: “Es gibt Wissenschaftler aus kritischen Ländern und Institutionen, die zu uns kommen oder mit uns Forschung betreiben. Und gerade China macht ja auch öffentlich deutlich, was es von diesen erwartet. Das schauen wir uns jetzt kritischer an. In dieser Hinsicht müssen wir auch mit Deutschland zusammenarbeiten“, sagte Keiser im Interview. Vor allem in Europa wächst bei vielen Wissenschaftlern die Sorge, dass diese Maßnahmen die friedliche, grenzüberschreitende wissenschaftliche Zusammenarbeit erschweren könnten. tg mit ScienceBusiness
Die Zeit (online): “Der Astronator”. Sollte Kamala Harris die Wahl zur US-Präsidentin gewinnen, könnte erstmals ein Raumfahrer ins Weiße Haus einziehen. Stefan Schmitt berichtet für “Die Zeit” über Mark Kelly, der in den USA neben einem Dutzend anderer Namen als Harris’ Running Mate, also Anwärter auf die Vizepräsidentschaft, gehandelt wird. Für den Marineflieger, Golfkriegsveteranen und Nasa-Astronauten könnten demnach zum einen sein außerordentlicher Lebensweg sprechen sowie “zweitens jene Bedeutung, die dem Weltall während der nächsten Präsidentschaft zukommen dürfte”. Aktuell ist Kelly, dessen zweite Ehefrau, eine ehemalige Kongressabgeordnete, bei einem politischen Attentat 2011 schwer verletzt wurde, Senator in Arizona. Es ist einer der wichtigsten Swing States bei der kommenden Wahl. Mehr
Wiarda Blog: “Ohne Kulturwandel wird es nicht gehen”. Der Wissenschaftsrat (WR) diskutiert aktuell darüber, wie die Wettbewerbsfähigkeit der Wissenschaft als Arbeitsmarkt deutlich erhöht werden kann. Als einen Baustein in diesem Prozess nennt der Vorsitzende des Gremiums, Wolfgang Wick, neue Personalstrukturen jenseits der Professur. “Die leistungsfähige Wissenschaft, die wir gerade jetzt so dringend brauchen, bekommen wir nur, wenn sie eine attraktive Wissenschaft für kluge Menschen ist”, sagt der Professor für Neurologie im Interview. Dafür brauche es unter anderem mehr unbefristete Stellen, die weisungsgebunden sind, gleichzeitig aber große Durchlässigkeit garantieren, um nicht “die 1970er und 1980er Jahre mit den akademischen Räten wiederzubeleben”. Mehr
Hannah Klauber, Ökonomin an der Technischen Universität Berlin, der Berufsbildungswissenschaftler Stefan Nagel von der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Universität Hannover und die Systembiologin Lena Cords von der Universität Zürich, bekommen den diesjährigen Deutschen Studienpreis. Die Körber-Stiftung würdigt mit dem Preis exzellente Dissertation mit besonders hoher gesellschaftlicher Relevanz. Klauber wird im Bereich Sozialwissenschaften für ihre Forschung zum Zusammenhang von Luftqualität und der Gesundheit von Kindern ausgezeichnet. Nagel entwickelte ein Modell zur Verankerung und Förderung von Nachhaltigkeit in Berufsbildung und Facharbeit. Cords wurde in der Sektion Natur- und Technikwissenschaften für ihre Arbeit zum Thema “Wenn das Bindegewebe Krebs bekämpft” gewürdigt. Die Preise sind mit jeweils 25.000 Euro dotiert.
Gustavo Politis, Forscher am Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) und Professor an der Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, wird mit dem Forschungspreis der Alexander-von-Humboldt-Stiftung ausgezeichnet. Vorgeschlagen worden war der argentinische Archäologe von der Universität Bonn. Dort wird er im kommenden Jahr gemeinsam mit Carla Jaimes Betancourt von der Abteilung für Altamerikanistik und Ethnologie über die südliche Expansion der Arawak forschen.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an research@table.media!
Bildung.Table. Digitalpakt: Was Stark-Watzinger der KMK geantwortet hat. Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat KMK-Präsidentin Christine Streichert-Clivot Antworten auf ihre Fragen zur Finanzierung des Digitalpakts geschickt. Darin erklärt die FDP-Ministerin ihre Haushaltspläne – und setzt die Länder unter Druck. Mehr
China.Table. Pistorius im Indopazifik: Wie Deutschland seine geopolitische Rolle sucht. Verteidigungsminister Pistorius reist in den Indopazifik. Seine erste Station ist Hawaii. Dort will er militärisch ein Zeichen setzen. Heikler wird die Weiterfahrt der deutschen Kriegsschiffe. China ist schon jetzt erbost. Mehr
Europe.Table. AI Act: Wie Entwickler den Verhaltenskodex für Allzweck-KI gestalten sollen. Jetzt tritt der AI Act in Kraft. Parallel startet die EU-Kommission zwei Prozesse, die die Umsetzung begleiten. Sie ruft Entwickler zur Mitarbeit am Verhaltenskodex für Allzweck-KI-Modelle auf und initiiert ein Interessenbekundungsverfahren. Mehr
Climate.Table. Klimaschutzverträge: Zweite Runde läuft an. Die Bundesregierung hat das Vorverfahren für die zweite Gebotsrunde der sogenannten Klimaschutzverträge am Montag gestartet. In dieser Runde liegt ein Fokus auf CCUS-Technologien. Mehr
ESG.Table. Solarenergie: Gefährdet die Wachstumsinitiative den weiteren Ausbau? Der Anteil von Photovoltaik am deutschen Strommix steigt kontinuierlich. Doch nun will die Bundesregierung die Förderung grundlegend ändern. Experten und Verbände halten das für ein falsches Signal. Mehr
Berlin.Table. Talk of the Town. Urteil zum Wahlrecht: Warum sich die Ampel als Gewinner sieht. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat die Wahlrechts-Reform der Ampel bestätigt – mit Ausnahme der Mandatsklausel. Das soll die kleinen Parteien stärken. Doch vor allem für die CSU bringt es Nachteile. Mehr
In der ansonsten innovationsarmen Förderlandschaft der Republik scheinen nur zwei Lichtblicke übrig geblieben zu sein: Zum einen die BMBF-gesteuerte Deutsche Agentur für Transfer und Innovation (Dati), der ich an dieser Stelle schon das Sterbeglöckchen geläutet habe, und zum anderen die BMWK-gesteuerten Startup-Factories, ursprünglich circa zehn, inzwischen wegen der Haushaltslage eher noch fünf bis zehn. Ich selbst habe auf drei in dem letzten Jahr dieser Legislatur (2025) gewettet.
Beides sind Vorhaben, die zentral wären für die Revitalisierung unserer Innovationsökosysteme. Aber ob die Ampel-Regierung hier wirklich noch Zeichen setzen will und kann, bezweifle ich. Die Dati ist zur Unkenntlichkeit verstümmelt, die Startup-Factories laufen Gefahr, in einem Einheitsbrei vermanscht zu werden.
Eine nach der Bundestagswahl neu gewählte Regierung wird hier wohl handeln müssen, bevor diese schüchternen Ansätze vollends den Bach runtergehen. Vor den Ideen grüner Politiker und Politikerinnen aus dem BMWK sei aber gewarnt.
Diese, allen voran Anna Christmann, Startup-Beauftragte des BMWK, wollen ohne Beachtung spezifischer Ursprünge anderswo Vorhandenes nach Deutschland importieren. So wie sie für die Dati nur die schwedische Innovationsagentur Vinnova kopieren wollen, so wollen sie die UnternehmerTUM an der TU München einfältig vervielfältigen. Deshalb ist es mir ein Bedürfnis - so wie bei der Dati - auch bei Startup-Factories sowohl Konzeption wie Umsetzung zu analysieren und Empfehlungen abzugeben.
The Financial Times, Statista und Sifted veröffentlichten jüngst ein Ranking von Europas Top 125 Inkubatoren und Accelerators. Unter den Nationen ist nicht überraschend Großbritannien Spitzenreiter mit 24 gelisteten Hubs, gefolgt von Deutschland (16) und Spanien (15).
Interessant für meine Betrachtung sind die Spitzenreiter unter den Hubs, da sie alle drei jeweils eine unterschiedliche Historie, Organisationsdesigns und Stakeholder-Konstrukte besitzen. Sicher ein Beleg dafür, nicht einfach irgendein Vorzeigemodell zu replizieren, sondern jeweils eine Vielzahl, eine Varietät an Designs zu ermöglichen. Wir werden Startup-Factories scheitern oder mit mittelmäßiger Performance sehen. Da wäre es tödlich, wenn alle das gleiche Muster hätten.
Die Nummer 1, die UnternehmerTUM, 2002 als gemeinnützige GmbH unter Regie der Unternehmerin und BMW-Erbin Susanne Kladden in enger Zusammenarbeit mit der TU München gegründet, ist heute ein An-Institut der TUM in fester personeller Verflechtung von CEO des Hubs und Vice President der TUM. Die meisten europäischen Startup-Hubs sind auf diese oder ähnliche Art und Weise mit ihren Mutterhochschulen verzahnt, falls sie nicht schon institutioneller Bestandteil der Hochschule sind.
Diese Konstellation ist häufig verbunden mit der Kritik, dass die Vertragsverhandlungen zu Ausgründungen viel zu langwierig und zu machtassymetrisch zulasten der Spin Offs sind, der IP-Transfer sei zu komplex und der geforderte Equity-Anteil der Hochschulen viel zu hoch.
Das zweitplatzierte französische-belgische Hub Hexa betrachtet sich als universtäts-unabhängiges Startup-Studio, welches kein Allrounder ist, sondern sich auf vier Verticals spezialisiert hat. Es kreiert oft sogar die Geschäftsmodelle, stellt kompletten operationellen Support für zwölf bis 18 Monate sicher - von der Übernahme aller Kosten über die Vergütung der Gründer bis zur Sicherstellung der ersten Wagniskapital-Runde. Quasi ein Rundum-Service, den sich Hexa mit hohen 30%-Equity vergüten lässt.
Das drittplatzierte Hub SETsquared (Southern England Technology Triangle) ist ein ungewöhnliches, kollaboratives Joint Venture von sechs nicht zu weit voneinander entfernten britischen Forschungsuniversitäten, die seit der Gründung im Jahr 2002 mehr als 5.000 Unternehmer/-innen unterstützt haben, welche anschließend mehr als 4,4 Milliarden Pfund an Fundraising erzielt haben .
In Summe also drei ganz unterschiedliche Modelle. Viele Wege führen nach Rom. Deswegen sind Kopien des Silicon Valley in Europa so schwer tauglich, wie die UnternehmerTUM aus München für andere deutsche Universitäten als Prototyp schwer tauglich ist.
Best Practice führt oft zu strategischer Isomorphie, zu Gleichförmigkeit. Michael Porter von der Harvard Business School , ein weltweit anerkannter Experte für Strategie und Wettbewerbsfähigkeit, formuliert schlicht: “Eine Strategie, die zu einem klaren Wettbewerbsvorteil führt, besteht darin, anders zu sein”. Übersetzt auf die Innovationsintensität von Startup-Ökosystemen heißt das: “Lasst viele Blumen blühen”.
Daher meine Empfehlung für ein ‘Innovating Innovation’: Radikale Varietät bei Gutachtern wie bei Konzepten:
Unabhängige externe Akteure wie beispielsweise Profis der US-amerikanischen National Science Foundation oder Persönlichkeiten wie der Unternehmer Xavier Niel, Gründer der Station F, sind in die Gestaltung von Rahmenbedingungen für Startup-Factories , deren Strategie oder Policies einzubeziehen. An dieser Stelle denke ich auch an Roxanna Varza, heutige Chefin der Station F in Paris (selbst der Incubateur der französischen Spitzenuniverstät HEC ist eingebetteter Teil dieses weltweit größten Startup-Campus) oder Ökosystem-Experten des Yaba Districts in Lagos (Nigeria) mit dem Spitznamen ‘Silicon Lagoon’. Sie alle sind nicht durch deutsche Strukturen und Sichtweisen geprägt oder eingeengt.
Schon der Begriff Factory erinnert gefährlich an die isomorphen Strukturen der deutscher Industriefabriken.
Dass ich Copy Cats ablehne, hat zudem damit zu tun, dass sich in meinen Gesprächen mit etlichen Meinungsmultiplikatoren der 26 Bündnisse, die sich in einer ersten Auswahlphase für den Wettbewerb beworben hatten (darunter auch etliche der 15, die jetzt in die engere Wahl gekommen sind), Unmut über die prägende Rolle der UnternehmerTUM breitgemacht hat. Wie so oft im deutschen Wissenschafts- und Innovationssystem, wird das aber nur hinter vorgehaltener Hand geäußert.
Wie divers die ausgewählten 15 Universitäten beziehungsweise Bündnisse jetzt schon sind, steht in den Sternen. Wenn dann im ersten Quartal 2025 die Gewinner gekürt werden, wird man zudem sehen, ob meine Empfehlung einer diversen Jury und entsprechender variantenreicher Konzepte umgesetzt wurde. Ich sorge mich sehr, dass auch die Startup-Factories ähnlich wie die Deutsche Agentur für Transfer und Innovation inhaltlich-strategisch, strukturell und von den Ressourcen her Rohrkrepierer werden könnten.
ob Bettina Stark-Watzinger gehofft hat, dass nach der Rückkehr aus ihrem Urlaub der Ärger mit der Fördermittel-Affäre vergessen ist? Spätestens seit gestern Abend weiß sie, dass sie die Kritik an den Vorgängen im BMBF weiter begleiten wird. Kai Gehring, Vorsitzender des Forschungsausschusses, hat der schriftlichen Bitte der CDU-Politiker Thomas Jarzombek und Stephan Albani entsprochen und eine weitere Sondersitzung mit der Ministerin für den 10. September einberufen. Sie ist gebeten, auch die von ihr entlassene Sabine Döring und Abteilungsleiter Jochen Zachgo mitzubringen. Dies aber liegt in ihrer Entscheidung, sagt Gehring.
Unternehmen in den USA sind kommerziell die größten Profiteure der Förderung des Europäischen Forschungsrats (ERC). Dies hat eine Studie des italienischen Icrios Instituts ergeben. Demnach patentieren US-amerikanische Start-ups und Konzerne weit mehr Produkte, die auf vom ERC finanzierten, wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren, als europäische Unternehmen.
Das war so aber nicht gedacht: Der ERC mit seinem Budget von 16 Milliarden Euro für den Zeitraum von 2021 bis 2027 soll eigentlich eine starke wissenschaftliche Basis bilden, die sich auf Quantität und Qualität der Innovationen auswirkt, die die europäische Wissenschaft und Wirtschaft hervorbringen. Die alte und neue Kommissionspräsidentin, Ursula von der Leyen, hatte bei ihrem jüngsten Antritt noch versprochen, den ERC “auszubauen”. Doch es bleibt bislang offenbar dabei, dass Europa über Exzellenz in der Grundlagenforschung nicht herauskommt, berichtet unser Kollege David Mattews vom europäischen News-Portal ScienceBusiness.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommertag,


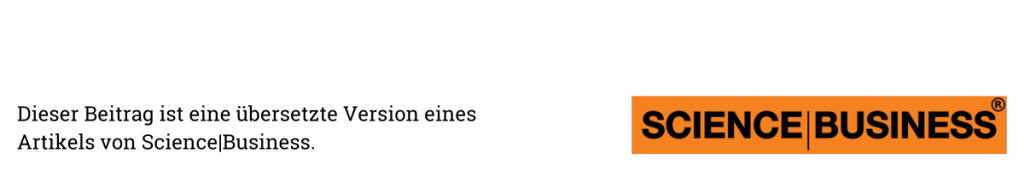
Einer neuen Studie zufolge sind Unternehmen in den USA kommerziell die größten Profiteure der Förderung des Europäischen Forschungsrats (ERC). US-amerikanische Start-ups und Konzerne patentieren weit mehr Produkte, die auf vom ERC finanzierten, wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren, als europäische Unternehmen oder Universitäten.
Die Studie der Wissenschaftler um Jay Prakash Nagar wurde am Icrios durchgeführt, einem Zentrum für Innovationsforschung an der Mailänder Bocconi-Universität. Die Ergebnisse bestätigen, nach Angaben des ERC, die eigenen internen Untersuchungen des Forschungsrats. Sie seien der jüngste Beleg dafür, dass Europa gute Grundlagenforschung bislang nicht effizient genug in echte Innovationen umsetzt.
“In absoluten Zahlen […] sind US-Organisationen, insbesondere US-Unternehmen, immer noch führend, wenn es darum geht, den größten Nutzen aus der ERC-Wissenschaft zu ziehen”, so das Fazit der in der Zeitschrift Research Policy veröffentlichten Studie. Der 2007 gegründete ERC verfügt über ein Budget von 16 Milliarden Euro für den Zeitraum von 2021 bis 2027 und soll Akademikern einige der weltweit großzügigsten und unbürokratischsten Zuschüsse für Forschung gewähren.
Finanziert wird vor allem Grundlagenforschung, der wirtschaftliche Nutzen steht nicht im Fokus der Förderung. Europäische Politiker hoffen jedoch, dass sich eine starke wissenschaftliche Basis auch auf Quantität und Qualität der Innovationen auswirkt, die die europäische Wissenschaft und Wirtschaft hervorbringen. Die alte und neue Kommissionspräsidentin, Ursula von der Leyen, hatte bei ihrem Antritt versprochen, den ERC “auszubauen”.
Doch die Studie mit dem Titel “ERC science and invention: Does ERC break free from the EU-Paradox?” deutet darauf hin, dass es europäischen Unternehmen und Universitäten nicht gelingt, aus den ERC-Durchbrüchen in den Labors Kapital zu schlagen. Untersucht wurden fast 10.000 Innovationen, die sowohl in den USA als auch beim Europäischen Patentamt patentiert wurden – und daher wahrscheinlich von größtem wirtschaftlichem Wert sind – und sich auf ERC-Forschung bezogen.
US-Unternehmen waren für 26 Prozent dieser Patente verantwortlich, verglichen mit etwa 16 Prozent von EU-Unternehmen. EU-Universitäten meldeten 16 Prozent an, US-Universitäten nur knapp 15 Prozent. Hinzu kommt, dass 37 Prozent der US-Unternehmen, die Patente anmeldeten, Start-ups waren. In der EU lag dieser Anteil bei nur 21 Prozent. “Aus meiner Sicht ist die größte Erkenntnis, wie viele Start-ups – verglichen mit der EU – zur Innovationsstärke der USA beitragen”, sagte Co-Autor Jay Prakash Nagar, Forscher an der Duke University im US-amerikanischen Durham.
Die Ergebnisse bestätigen, dass die vom ERC finanzierte Forschung nach wie vor unter dem seit langem beobachteten “europäischen Paradoxon” leidet: Die Grundlagenforschung ist hervorragend, aber die Ergebnisse werden kaum in die sogenannten “real world innovations” umgesetzt, beschreiben es Nagar und seine Mitautoren in ihrer Studie.
Der ERC vergibt Gelder an Wissenschaftler, unabhängig davon, woher sie kommen, aber die Geförderten müssen in der Regel mindestens die Hälfte ihrer Zeit in Europa verbringen. Das soll dazu führen, dass das Know-how vor allem in europäische Unternehmen und Universitäten fließt. Allerdings haben ERC-Stipendiaten aus den USA, selbst wenn sie in Europa ansässig sind, in der Regel weiter eine Verbindung zu den USA. Unter anderem durch Doktoranden, die dorthin ziehen, spekulierte Nagar. Die Ergebnisse flössen jedenfalls schnell über den Atlantik.
Der ERC bestreitet Nagars Ergebnisse nicht – tatsächlich trafen sich ERC-Experten im vergangenen Jahr mit einem seiner Co-Autoren zu einem Gespräch über die Studie, und ein Sprecher sagte auf Anfrage von ScienceBusiness, die Ergebnisse seien “überhaupt nicht überraschend”. Die eigene interne Analyse des Rates hat ebenfalls ergeben, dass US-Unternehmen führend sind, wenn es darum geht, Nutzen aus der ERC-finanzierten Forschung zu ziehen.
Bereits im vergangenen Jahr hatte der ERC eine eigene große Studie über Patente im ERC-Kontext erstellt, und “die von den Experten gesammelten Daten bestätigen die Ergebnisse, auch wenn sie in dem veröffentlichten Bericht selbst nicht ausgewiesen wurden”, sagte der ERC-Sprecher. Jüngste Daten, einschließlich der EU-eigenen Berichte über die Leistung der Bereiche Wissenschaft, Forschung und Innovation würden zeigen, dass die Innovationsleistung in der EU hinter der globalen Konkurrenz zurückbleibt.
Für die forschungspolitische Debatte in der EU kommen die Ergebnisse möglicherweise zum richtigen Zeitpunkt. Sie könnten in die Diskussion über die Forschungs- und Innovationsprogramme der EU einfließen. Es wird erwartet, dass das nächste Forschungsrahmenprogramm der EU, das FP10, einen größeren Schwerpunkt auf die wirtschaftliche Verwertung legt, wenn es 2028 beginnt.
Handlungsbedarf ist vorhanden, da die europäischen Volkswirtschaften stagnieren und der Kontinent global gesehen hinter die technologische Spitze zurückfällt. Die Staats- und Regierungschefs der EU versuchen deshalb auch, die Idee der Kapitalmarktunion wiederzubeleben, einen bislang unvollendeten Vorstoß zur Beseitigung von Investitionshemmnissen und zur Stimulierung eines Risikokapitalmarktes nach US-amerikanischem Vorbild. Auch für diese Debatte könnten die Forschungsergebnisse aus Italien neues Futter liefern. David Matthews
Dieser Beitrag ist eine übersetzte Version eines Artikels von Science|Business . Mit einem Redaktionsteam, das in Brüssel und in der gesamten EU arbeitet, ist Science|Business Europas wichtigste englischsprachige Quelle für fundierte Berichterstattung über Forschungs- und Innovationspolitik.
Die CDU sieht in der Fördermittel-Affäre zu viele unbeantwortete Fragen durch Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger und ihr Ministerium: In einer neuerlichen Sondersitzung des Bundesforschungsausschusses am 10. September soll die FDP-Politikerin erneut zur Fördergeld-Affäre aussagen – ebenfalls erscheinen sollen die von ihr entlassene Staatssekretärin Sabine Döring und der zuletzt in den Blick geratenen Abteilungsleiter 4 (Hochschule), Jochen Zachgo.
Das geht aus einem Brief hervor, den die CDU-Politiker Stephan Albani und Thomas Jarzombek an Kai Gehring, den Vorsitzenden des Bundesforschungsausschusses, geschrieben haben. Sie haben Gehring gebeten, ein weiteres Sondertreffen zu ermöglichen.
Gehring hat der Bitte stattgegeben, wie er gegenüber Table.Briefings erklärt. “Die Entscheidung über die Teilnahme weiterer Personen obliegt der BMBF-Leitung”. Auch über die Modalitäten der Sitzung, wie die Anzahl der Fragerunden, müssen sich wie üblich die Fraktionen verständigen, erklärt Gehring. Da ein Aktenvorlagerecht ausschließlich Untersuchungsausschüssen vorbehalten ist, müsse sich die Union mit dem Anliegen nach Akteneinsicht direkt an das Ministerium wenden.
Man sei dankbar, dass die Bundesministerin am 26. Juni “in den Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung zitiert werden konnte” und es eine erste Aussprache zu den “im Raume stehenden schwerwiegenden Vorwürfen” gab, hatten die CDU-Politiker in ihrem Brief an Gehring geschrieben, allerdings seien “bedauerliche Weise noch zahlreiche Fragen offengeblieben.”
Nach Wahrnehmung der CDU bestehe eine mehrheitliche interfraktionelle Einigkeit darüber, dass eine “lückenlose Sachverhaltsaufklärung die Voraussetzung dafür ist, verloren gegangenes Vertrauen in das BMBF zurückgewinnen zu können.”
Seit dem 26. Juni 2024 sind laut den CDU-Politikern “weitere erhebliche Zweifel an der Richtigkeit der Darstellung” von Bundesministerin Stark-Watzinger entstanden. Dazu zählt die CDU:
Durch das Verhalten der Ministerin in den vergangenen Wochen sei aus einer “anfänglichen Affäre im Bereich der Wissenschaftsfreiheit” eine Affäre auf mehreren Ebenen geworden.
Die CDU zählt hierzu eine Affäre:
Mit Befremden entgegengenommen hätte die Union die Entscheidung von Bettina Stark-Watzinger vom 18. Juli 2024, der entlassenen Staatssekretärin Sabine Döring auch gegenüber “der größten Oppositionsfraktion im Deutschen Bundestag eine persönliche Stellungnahme zu untersagen.”
Und zuletzt: Die Antworten des BMBF auf die Kleine Anfrage der CDU/CSU-Bundestagsfraktion “100 Fragen zur Sachverhaltsaufklärung von Bundesministerin Bettina Stark-Watzinger zur sog. Fördermittel-Affäre” hätten kaum Aufklärung, dafür aber neue Fragen aufgeworfen. So waren frühere Aussagen der Forschungsministerin dahingehend korrigiert worden, etwa zu den Arbeitsabläufen im Ministerium. Und: Ursprünglicher Initiator der Listen, in denen kritische Forscherinnen und Forscher aufgeführt wurden, die vom BMBF direkt gefördert werden, soll demnach der Leiter der Abteilung 4, Jochen Zachgo, gewesen sein.
Aus dem BMBF gab es bislang noch keine Reaktion auf Brief und Einladung. Die Sondersitzung am 10. September soll um 8 Uhr beginnen.

Herr Reinhardt, gibt es aus Perspektive der Wissenschaftsforschung empirische Belege dafür, dass geisteswissenschaftliche Anträge im Begutachtungsprozess von Drittmittelanträgen strukturell benachteiligt sind?
Die Diskussion gibt es mindestens seit dem Beginn der Exzellenzinitiative. Damals hatte sich unter anderem der Politikwissenschaftler Michael Zürn zu Wort gemeldet und über Unterschiede in den Begutachtungskulturen geschrieben. Sowohl Christiane Wiesenfeldt als auch Zürn beschreiben das Phänomen, dass die Geisteswissenschaftler sehr differenziert begutachten. Dies führe in den sehr kompetitiven Begutachtungsverfahren der Exzellenzinitiative – die verschiedene Bereiche miteinander vergleichen und konkurrieren lassen – zu Nachteilen. Die Naturwissenschaften dagegen würden “bedingungslos”, so hatte es Michael Zürn damals beschrieben, wohlwollend argumentieren und sozusagen in ein Schwarz-Weiß-Schema verfallen, weil sie genau wissen, dass nur die Bestnoten durchkommen. Meines Wissens ist das nie systematisch erhoben worden. Bisher stützt sich dieser Eindruck eher auf anekdotische Evidenz.
Solange eine derartige Analyse noch aussteht: Gibt es schlüssige Indizien dafür, das etwas an der These dran ist?
Die Geisteswissenschaften sind ein sehr heterogenes Gebiet. Die Geistes- aber im weitgehenden Maße auch die Sozialwissenschaften sind dadurch gekennzeichnet, dass sie unterschiedliche Zugänge und Methodenbereiche aber auch Theorienbündel und Paradigmen nebeneinander gelten lassen. Dass also unterschiedliche Schulen, wenn Sie so wollen, miteinander konkurrieren und gegeneinander antreten. Das ist in den Natur- und Technikwissenschaften, wenn überhaupt nur temporär der Fall. Da löst ein Paradigma das andere ab, zumindest als das dominante. Natürlich gibt es auch dort Minderheitenmeinungen und Debatten. Aber man hat meist ein Fundament, auf dem mehr oder weniger alle stehen. Allein diese Struktur lässt es plausibel erscheinen, dass Forschende in den Geisteswissenschaften debattierfreudiger sein müssen.
Geisteswissenschaftler sind also von Natur aus kritischere Geister?
Gutachter, die ihre Kollegen bewerten sollen, teilen möglicherweise nicht einmal dieselben Prämissen mit ihnen. Das ist aber auch nur ein Aspekt, ein anderer ist die Quantifizierbarkeit der Begutachtungskriterien. Stefan Hornbostel, ehemaliger Leiter des Instituts für Forschungsinformation und Qualitätssicherung, hat vor etwa zehn oder 15 Jahren in Studien gezeigt, dass die Gutachter für die Exzellenzinitiative bei Geistes- und Naturwissenschaftlern unterschiedliche Kriterien anlegen. Während bei den Geisteswissenschaftlern zum Beispiel in die Publikationsliste der Antragssteller geschaut und deren Arbeiten gelesen wurden, wurde in den Technikwissenschaften eher auf den quantifizierbaren Zitationsindex geschaut. Das führt dazu, dass Geisteswissenschaftler sich eher in das Thema und auch die Kritik an Forschungsansätzen einlesen. Das ist meines Erachtens die qualifiziertere Betrachtung. Wenn es aber um Vergleiche und Noten geht, kann das potenziell ein Nachteil sein.
Die Philosophin Amrei Bahr führt noch einen weiteren Aspekt auf: In den Geisteswissenschaften komme es “prozessual häufig zu einer Gleichzeitigkeit des inhaltlich Ungleichzeitigen”, die sich dem Raster der Drittmittelvergabe aus ‘Work packages’, ‘Milestones’ und ‘deliverables’ entzieht.
Ich würde ihr zustimmen, dass die Projektifizierung, also eine stark strukturierte Art und Weise, auf Ergebnisse zuzusteuern, stärker in den Natur- und Technikwissenschaften ausgeprägt ist. Sie sind durch ihre Forschungspraxis dazu gezwungen, Arbeitspakete zu definieren. Wenn ich zum Beispiel ein Labor betreibe, muss ich das de facto tun. Natürlich müssen auch Geisteswissenschaftler strukturiert vorgehen und können definieren, was sie tun – etwa Quellenlektüre oder Archivrecherche. Aber natürlich ist die Vorhersage und die Planung, wie ich schlussendlich zu Ergebnissen komme, nicht immer so einfach möglich und sinnvoll.
Reicht es aus, wenn die Geisteswissenschaftler die Kunst des Lobens erlernen, wie Frau Wiesenfeldt in ihrem Essay fordert? Oder muss sich nicht eher der Begutachtungsprozess grundlegend ändern?
Ich würde etwas Drittes vorschlagen. Und zwar, dass wir Förderlinien schaffen oder ausbauen, die für die Geistes- und Teile der Sozialwissenschaften angemessener sind und ihnen auf den Leib geschneidert werden. Leibniz-Preisträger Ulrich Herbert hat schon vor einigen Jahren kritisiert, dass die Exzellenzcluster zu groß und zu arbeitsteilig sind, als dass sie dem Gros der Geistes- und Sozialwissenschaften passen. Es wäre also besser, statt die Geisteswissenschaften ins Korsett pressen zu wollen, vielleicht andere Formen, wie die Forschungsgruppen oder hochrangig positionierte Einzelförderungen auszubauen. Beispielhaft genannt seien hier das Koselleck- oder das Heisenberg-Programm der DFG. Was wir sehen, ist ja, dass ein erheblicher Teil der Fördermittel in Sonderforschungsbereiche und andere Verbundprogramme geht. Die Geisteswissenschaften müssten aber kleinteiliger gefördert werden.
Sind Förderentscheidungen nicht auch politischen Prioritäten und einem Zeitgeist unterworfen?
Zu bestimmten Zeiten haben sich bestimmte Bereiche abgehängt gefühlt. Den Chemikern ist es zum Beispiel in den Sechzigerjahren so gegangen, weil sie viel kleinteiliger organisiert waren als die Physiker mit ihrer Großforschung und der entsprechenden Infrastruktur. Das ist also kein Sachverhalt, wo die Linie immer nur zwischen Geistes- und Naturwissenschaften verläuft. Aber ich glaube tatsächlich, wenn man sich anschaut, in welchem Maße Geisteswissenschaften gefördert werden, durch die DFG, die Max-Planck-Gesellschaft und andere, dass sie strukturell im Nachteil sind. Das ist mindestens seit dem Kalten Krieg so. Das mag auch wirtschaftspolitische Gründe haben, weil man von den Natur- und Technikwissenschaften mehr erwartet. Es muss aber kein Automatismus sein.
Was sind bereits erkennbare oder absehbare Folgen der Benachteiligung?
Eine Folge ist, dass die hermeneutischen, interpretierenden Wissenschaften unterrepräsentiert sind. Man kann das am Beispiel der Klimaforschung herleiten. In diesem Bereich ist wissenschaftlich eindeutig zu belegen, dass der entscheidende Faktor menschliches Verhalten ist, also zum Beispiel der Verkehr und die Art wie wir heizen. Wichtige Fragen sind also, wie wir unsere Gesellschaft organisieren und wie verschiedene Sphären des Systems darauf reagieren. Nun ist aber die Herangehensweise der meisten Forscher eine quantifizierende oder besser: eine datafizierende, also eine auf empirisch erhobenen Daten beruhende Wissenschaft, die dann in Modelle und Simulationen gegossen wird. Das hilft nicht dabei, das Phänomen der Klimawandel-Leugnung besser zu verstehen oder diesem im Idealfall sogar begegnen zu können. Dafür brauchen wir die Geisteswissenschaften.
12./13. September 2024, FU Berlin
Jahrestagung des Netzwerks Wissenschaftsmanagement Für Freiheit in Krisenzeiten. Perspektiven aus dem Wissenschaftsmanagement Mehr
19. September 2024, ab 11 Uhr, Körber-Stiftung, Hamburg
Hamburg Science Summit 2024 “Europe’s Path Towards Tech Sovereignty” Mehr
24. September 2024, 10:30 bis 16:15 Uhr, Haus der Commerzbank, Pariser Platz 1, 10117 Berlin
Forum Hochschulräte Starke Marken, klarer Kern: Strategische Schwerpunktsetzung und Markenbildung bei Hochschulen Mehr
25. September 2024, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU)
Jahreskolloquium des Bayerischen Wissenschaftsforums Transformationskompetenz in Wissenschaft und Hochschule Mehr
26. September 2024, 12:00 bis 13:00 Uhr, Webinar
CHE talk feat. DAAD KIWi Connect Transfer und Internationalisierung – Warum ist es sinnvoll, beides gemeinsam zu denken und was braucht es hierzu? Mehr
26./27. September 2024, Leopoldina, Jägerberg 1, 06108 Halle (Saale) und Online
Jahresversammlung 2024 der Leopoldina Ursprung und Beginn des Lebens Mehr
3. /4. Oktober 2024, Universität Helsinki, Finnland
2024 EUA FUNDING FORUM Sense & sustainability: future paths for university finances Mehr
23. bis 25. Oktober 2024 am ETH AI Center in Zürich, Schweiz
Jahrestagung der Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft (GMW) und CampusSource Agilität und KI in Hochschulen Mehr
Eine wissenschaftliche Zwischenbegutachtung von sechs Forschungshubs der Alexander von Humboldt-Stiftung (AvHS) in Afrika fällt positiv aus und empfiehlt die Fortsetzung der Förderung bis 2026. Das Fraunhofer-Institut für System und Innovationsforschung (ISI) hatte die Forschungszentren in Benin, Kamerun, der Republik Kongo, Nigeria und Simbabwe analysiert. Die Hubs hätten es trotz schwieriger Ausgangslage und in einzelnen Fällen auch äußerst prekärer Bedingungen geschafft, Forschungszentren aufzubauen, die national und international wissenschaftlich stark vernetzt sind, eine hohe Sichtbarkeit aufweisen und eine wichtige Plattform insbesondere für Nachwuchswissenschaftler*innen bilden, heißt es in dem Gutachten. Eine Anschlussfinanzierung ist aufgrund der aktuellen Haushaltslage höchstwahrscheinlich nicht gegeben, erklärt eine Sprecherin der AvHS gegenüber Table.Briefings.
Die Hubs sind beauftragt, Forschungsergebnisse zur Bewältigung von Pandemien und Strategien zur Erhöhung der Resilienz afrikanischer Gesellschaften für künftige Krisensituationen entstehen zu lassen. Geleitet werden die Hubs von Wissenschaftlern aus dem afrikanischen Humboldt-Netzwerk.
Aktiv wurden die Forscher etwa in der Bekämpfung der neuen Variante des Mpox-Virus (früher “Affenpocken”), die sich aktuell ausbreitet. So hat ein Forschungshub in Nigeria durch seine große Probensammlung aus Wildtieren Zugang zum natürlichen Wirt des Virus, was seit 2022 für weitergehende Analysen zu Mpox genutzt wird. In der Republik Kongo hat der Forschungshub seinen Arbeitsschwerpunkt von COVID-19 auf andere Infektionskrankheiten wie Mpox oder Malaria verlagert.
Das attestieren die Gutachter den sechs Hubs:
Zu den Herausforderungen für die Hubs zählten schwierige sozio-ökonomische und sicherheitspolitische Ausgangslagen, häufige Stromausfälle oder Verzögerungen und Probleme bei der Beantragung von Einreisevisa für Deutschland, berichten die Gutachter.
Die Forschungshub-Leitungen reagierten kreativ auf solche Hindernisse. Sie initiierten zum Beispiel neue Kooperationen zu anderen afrikanischen Forschungsinstitutionen, stärkten Kompetenzen zur eigenverantwortlichen Mittelverwaltung oder beschafften Solaranlagen.
Die Hubs erhalten aktuell eine Förderung von bis zu 750.000 Euro über einen Zeitraum von maximal fünf Jahren. Fünf der sechs Forschungshubs werden durch das Auswärtige Amt gefördert, eines durch die Bayer Foundation.
Da das Auswärtige Amt seine Ausgaben von 2025 an kürzen muss, kann derzeit keine neue Ausschreibung von Humboldt-Forschungshubs in Aussicht gestellt werden, berichtet eine Sprecherin der Stiftung. Die allgemein schwierige Haushaltslage des Bundes verschlechtere außerdem auch die Chancen auf die Finanzierung der Forschungshubs durch andere Ministerien. nik

Die US-amerikanische National Science Foundation (NSF) hat Fördergelder in Höhe von 67 Millionen US-Dollar für die Einrichtung eines Zentrums für Forschungssicherheit vergeben. Entstehen soll das sogenannte “Safeguarding the Entire Community of the US Research Ecosystem”-Center (Secure Center). Dafür erhält ein Verbund unter Leitung des Sicherheitsforschers Mark Haselkorn an der University of Washington 50 Millionen US-Dollar und weitere 17 Millionen US-Dollar gehen an einen Verbund, dem die Texas A&M University vorsteht.
Das neue Secure Center, das in Seattle angesiedelt sein wird, soll eine Art One-Stop-Shop für US-amerikanische Forschungsorganisationen und kleine Unternehmen sein, die Beratung zum Thema Sicherheit suchen. Seine Schaffung wurde vom Kongress im Chips & Science Act aus dem Jahr 2022 angeordnet, als Teil der wachsenden Bemühungen der USA, die unbefugte Weitergabe sensibler Forschungsergebnisse an andere Länder – insbesondere China – zu verhindern.
“Die NSF ist einer prinzipientreuen internationalen Zusammenarbeit verpflichtet. Gleichzeitig müssen wir uns mit Bedrohungen für die Forschungstätigkeit auseinandersetzen”, sagte NSF-Direktor Sethuraman Panchanathan anlässlich der Fördermittel-Entscheidung. “Mit dem Secure Center bringen wir die Forschungsgemeinschaft zusammen, um Risiken zu identifizieren, Informationen auszutauschen und nationales Fachwissen zur Forschungssicherheit zu nutzen. So sollen Lösungen entwickelt werden, die wichtige Forschungsarbeiten an Einrichtungen im ganzen Land schützen.”
Das Secure Center soll teilweise von der Regierung und durch Nutzungsgebühren finanziert werden, um der US-amerikanischen akademischen Gemeinschaft ein Mitspracherecht bei seiner Arbeitsweise zu geben. Geheime Informationen über Sicherheitsbedrohungen bleiben in den Händen der Regierungsbeamten, die das Projekt überwachen. Das Zentrum werde jedoch Informationen bereitstellen, die nicht klassifiziert sind. Zum Beispiel über “unsachgemäße oder illegale Bemühungen ausländischer Unternehmen, Forschungsergebnisse zu erhalten”, hieß es in der Ausschreibung der NSF im letzten Jahr. Es wird außerdem “zeitnahe Berichte” über Risiken, Sicherheitsschulungen für Lehrkräfte und Mitarbeiter sowie “Analysen von Risikomustern und zur Identifizierung böswilliger Akteure” bereitstellen.
Die Anschubfinanzierung, die für fünf Jahre ausgelegt ist, ist der nächste Schritt zum Ausbau der universitären Sicherheitssysteme, der unter der Trump-Administration begonnen und von Präsident Biden fortgesetzt wurde. Gleichzeitig drängen die USA ihre Verbündeten, ihre eigene Forschungssicherheit strikter zu gestalten – was beispielsweise dazu führte, dass Kanada eine schwarze Liste chinesischer Forschungsorganisationen veröffentlichte und die Europäische Kommission ein Sicherheits-“Toolkit” für Universitäten entwickelte.
Im Gespräch mit Table.Briefings hatte Rebecca Keiser, Chief of Research Security Strategy and Policy, auch Erwartungen an Deutschland formuliert: “Es gibt Wissenschaftler aus kritischen Ländern und Institutionen, die zu uns kommen oder mit uns Forschung betreiben. Und gerade China macht ja auch öffentlich deutlich, was es von diesen erwartet. Das schauen wir uns jetzt kritischer an. In dieser Hinsicht müssen wir auch mit Deutschland zusammenarbeiten“, sagte Keiser im Interview. Vor allem in Europa wächst bei vielen Wissenschaftlern die Sorge, dass diese Maßnahmen die friedliche, grenzüberschreitende wissenschaftliche Zusammenarbeit erschweren könnten. tg mit ScienceBusiness
Die Zeit (online): “Der Astronator”. Sollte Kamala Harris die Wahl zur US-Präsidentin gewinnen, könnte erstmals ein Raumfahrer ins Weiße Haus einziehen. Stefan Schmitt berichtet für “Die Zeit” über Mark Kelly, der in den USA neben einem Dutzend anderer Namen als Harris’ Running Mate, also Anwärter auf die Vizepräsidentschaft, gehandelt wird. Für den Marineflieger, Golfkriegsveteranen und Nasa-Astronauten könnten demnach zum einen sein außerordentlicher Lebensweg sprechen sowie “zweitens jene Bedeutung, die dem Weltall während der nächsten Präsidentschaft zukommen dürfte”. Aktuell ist Kelly, dessen zweite Ehefrau, eine ehemalige Kongressabgeordnete, bei einem politischen Attentat 2011 schwer verletzt wurde, Senator in Arizona. Es ist einer der wichtigsten Swing States bei der kommenden Wahl. Mehr
Wiarda Blog: “Ohne Kulturwandel wird es nicht gehen”. Der Wissenschaftsrat (WR) diskutiert aktuell darüber, wie die Wettbewerbsfähigkeit der Wissenschaft als Arbeitsmarkt deutlich erhöht werden kann. Als einen Baustein in diesem Prozess nennt der Vorsitzende des Gremiums, Wolfgang Wick, neue Personalstrukturen jenseits der Professur. “Die leistungsfähige Wissenschaft, die wir gerade jetzt so dringend brauchen, bekommen wir nur, wenn sie eine attraktive Wissenschaft für kluge Menschen ist”, sagt der Professor für Neurologie im Interview. Dafür brauche es unter anderem mehr unbefristete Stellen, die weisungsgebunden sind, gleichzeitig aber große Durchlässigkeit garantieren, um nicht “die 1970er und 1980er Jahre mit den akademischen Räten wiederzubeleben”. Mehr
Hannah Klauber, Ökonomin an der Technischen Universität Berlin, der Berufsbildungswissenschaftler Stefan Nagel von der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Universität Hannover und die Systembiologin Lena Cords von der Universität Zürich, bekommen den diesjährigen Deutschen Studienpreis. Die Körber-Stiftung würdigt mit dem Preis exzellente Dissertation mit besonders hoher gesellschaftlicher Relevanz. Klauber wird im Bereich Sozialwissenschaften für ihre Forschung zum Zusammenhang von Luftqualität und der Gesundheit von Kindern ausgezeichnet. Nagel entwickelte ein Modell zur Verankerung und Förderung von Nachhaltigkeit in Berufsbildung und Facharbeit. Cords wurde in der Sektion Natur- und Technikwissenschaften für ihre Arbeit zum Thema “Wenn das Bindegewebe Krebs bekämpft” gewürdigt. Die Preise sind mit jeweils 25.000 Euro dotiert.
Gustavo Politis, Forscher am Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) und Professor an der Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, wird mit dem Forschungspreis der Alexander-von-Humboldt-Stiftung ausgezeichnet. Vorgeschlagen worden war der argentinische Archäologe von der Universität Bonn. Dort wird er im kommenden Jahr gemeinsam mit Carla Jaimes Betancourt von der Abteilung für Altamerikanistik und Ethnologie über die südliche Expansion der Arawak forschen.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an research@table.media!
Bildung.Table. Digitalpakt: Was Stark-Watzinger der KMK geantwortet hat. Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat KMK-Präsidentin Christine Streichert-Clivot Antworten auf ihre Fragen zur Finanzierung des Digitalpakts geschickt. Darin erklärt die FDP-Ministerin ihre Haushaltspläne – und setzt die Länder unter Druck. Mehr
China.Table. Pistorius im Indopazifik: Wie Deutschland seine geopolitische Rolle sucht. Verteidigungsminister Pistorius reist in den Indopazifik. Seine erste Station ist Hawaii. Dort will er militärisch ein Zeichen setzen. Heikler wird die Weiterfahrt der deutschen Kriegsschiffe. China ist schon jetzt erbost. Mehr
Europe.Table. AI Act: Wie Entwickler den Verhaltenskodex für Allzweck-KI gestalten sollen. Jetzt tritt der AI Act in Kraft. Parallel startet die EU-Kommission zwei Prozesse, die die Umsetzung begleiten. Sie ruft Entwickler zur Mitarbeit am Verhaltenskodex für Allzweck-KI-Modelle auf und initiiert ein Interessenbekundungsverfahren. Mehr
Climate.Table. Klimaschutzverträge: Zweite Runde läuft an. Die Bundesregierung hat das Vorverfahren für die zweite Gebotsrunde der sogenannten Klimaschutzverträge am Montag gestartet. In dieser Runde liegt ein Fokus auf CCUS-Technologien. Mehr
ESG.Table. Solarenergie: Gefährdet die Wachstumsinitiative den weiteren Ausbau? Der Anteil von Photovoltaik am deutschen Strommix steigt kontinuierlich. Doch nun will die Bundesregierung die Förderung grundlegend ändern. Experten und Verbände halten das für ein falsches Signal. Mehr
Berlin.Table. Talk of the Town. Urteil zum Wahlrecht: Warum sich die Ampel als Gewinner sieht. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat die Wahlrechts-Reform der Ampel bestätigt – mit Ausnahme der Mandatsklausel. Das soll die kleinen Parteien stärken. Doch vor allem für die CSU bringt es Nachteile. Mehr
In der ansonsten innovationsarmen Förderlandschaft der Republik scheinen nur zwei Lichtblicke übrig geblieben zu sein: Zum einen die BMBF-gesteuerte Deutsche Agentur für Transfer und Innovation (Dati), der ich an dieser Stelle schon das Sterbeglöckchen geläutet habe, und zum anderen die BMWK-gesteuerten Startup-Factories, ursprünglich circa zehn, inzwischen wegen der Haushaltslage eher noch fünf bis zehn. Ich selbst habe auf drei in dem letzten Jahr dieser Legislatur (2025) gewettet.
Beides sind Vorhaben, die zentral wären für die Revitalisierung unserer Innovationsökosysteme. Aber ob die Ampel-Regierung hier wirklich noch Zeichen setzen will und kann, bezweifle ich. Die Dati ist zur Unkenntlichkeit verstümmelt, die Startup-Factories laufen Gefahr, in einem Einheitsbrei vermanscht zu werden.
Eine nach der Bundestagswahl neu gewählte Regierung wird hier wohl handeln müssen, bevor diese schüchternen Ansätze vollends den Bach runtergehen. Vor den Ideen grüner Politiker und Politikerinnen aus dem BMWK sei aber gewarnt.
Diese, allen voran Anna Christmann, Startup-Beauftragte des BMWK, wollen ohne Beachtung spezifischer Ursprünge anderswo Vorhandenes nach Deutschland importieren. So wie sie für die Dati nur die schwedische Innovationsagentur Vinnova kopieren wollen, so wollen sie die UnternehmerTUM an der TU München einfältig vervielfältigen. Deshalb ist es mir ein Bedürfnis - so wie bei der Dati - auch bei Startup-Factories sowohl Konzeption wie Umsetzung zu analysieren und Empfehlungen abzugeben.
The Financial Times, Statista und Sifted veröffentlichten jüngst ein Ranking von Europas Top 125 Inkubatoren und Accelerators. Unter den Nationen ist nicht überraschend Großbritannien Spitzenreiter mit 24 gelisteten Hubs, gefolgt von Deutschland (16) und Spanien (15).
Interessant für meine Betrachtung sind die Spitzenreiter unter den Hubs, da sie alle drei jeweils eine unterschiedliche Historie, Organisationsdesigns und Stakeholder-Konstrukte besitzen. Sicher ein Beleg dafür, nicht einfach irgendein Vorzeigemodell zu replizieren, sondern jeweils eine Vielzahl, eine Varietät an Designs zu ermöglichen. Wir werden Startup-Factories scheitern oder mit mittelmäßiger Performance sehen. Da wäre es tödlich, wenn alle das gleiche Muster hätten.
Die Nummer 1, die UnternehmerTUM, 2002 als gemeinnützige GmbH unter Regie der Unternehmerin und BMW-Erbin Susanne Kladden in enger Zusammenarbeit mit der TU München gegründet, ist heute ein An-Institut der TUM in fester personeller Verflechtung von CEO des Hubs und Vice President der TUM. Die meisten europäischen Startup-Hubs sind auf diese oder ähnliche Art und Weise mit ihren Mutterhochschulen verzahnt, falls sie nicht schon institutioneller Bestandteil der Hochschule sind.
Diese Konstellation ist häufig verbunden mit der Kritik, dass die Vertragsverhandlungen zu Ausgründungen viel zu langwierig und zu machtassymetrisch zulasten der Spin Offs sind, der IP-Transfer sei zu komplex und der geforderte Equity-Anteil der Hochschulen viel zu hoch.
Das zweitplatzierte französische-belgische Hub Hexa betrachtet sich als universtäts-unabhängiges Startup-Studio, welches kein Allrounder ist, sondern sich auf vier Verticals spezialisiert hat. Es kreiert oft sogar die Geschäftsmodelle, stellt kompletten operationellen Support für zwölf bis 18 Monate sicher - von der Übernahme aller Kosten über die Vergütung der Gründer bis zur Sicherstellung der ersten Wagniskapital-Runde. Quasi ein Rundum-Service, den sich Hexa mit hohen 30%-Equity vergüten lässt.
Das drittplatzierte Hub SETsquared (Southern England Technology Triangle) ist ein ungewöhnliches, kollaboratives Joint Venture von sechs nicht zu weit voneinander entfernten britischen Forschungsuniversitäten, die seit der Gründung im Jahr 2002 mehr als 5.000 Unternehmer/-innen unterstützt haben, welche anschließend mehr als 4,4 Milliarden Pfund an Fundraising erzielt haben .
In Summe also drei ganz unterschiedliche Modelle. Viele Wege führen nach Rom. Deswegen sind Kopien des Silicon Valley in Europa so schwer tauglich, wie die UnternehmerTUM aus München für andere deutsche Universitäten als Prototyp schwer tauglich ist.
Best Practice führt oft zu strategischer Isomorphie, zu Gleichförmigkeit. Michael Porter von der Harvard Business School , ein weltweit anerkannter Experte für Strategie und Wettbewerbsfähigkeit, formuliert schlicht: “Eine Strategie, die zu einem klaren Wettbewerbsvorteil führt, besteht darin, anders zu sein”. Übersetzt auf die Innovationsintensität von Startup-Ökosystemen heißt das: “Lasst viele Blumen blühen”.
Daher meine Empfehlung für ein ‘Innovating Innovation’: Radikale Varietät bei Gutachtern wie bei Konzepten:
Unabhängige externe Akteure wie beispielsweise Profis der US-amerikanischen National Science Foundation oder Persönlichkeiten wie der Unternehmer Xavier Niel, Gründer der Station F, sind in die Gestaltung von Rahmenbedingungen für Startup-Factories , deren Strategie oder Policies einzubeziehen. An dieser Stelle denke ich auch an Roxanna Varza, heutige Chefin der Station F in Paris (selbst der Incubateur der französischen Spitzenuniverstät HEC ist eingebetteter Teil dieses weltweit größten Startup-Campus) oder Ökosystem-Experten des Yaba Districts in Lagos (Nigeria) mit dem Spitznamen ‘Silicon Lagoon’. Sie alle sind nicht durch deutsche Strukturen und Sichtweisen geprägt oder eingeengt.
Schon der Begriff Factory erinnert gefährlich an die isomorphen Strukturen der deutscher Industriefabriken.
Dass ich Copy Cats ablehne, hat zudem damit zu tun, dass sich in meinen Gesprächen mit etlichen Meinungsmultiplikatoren der 26 Bündnisse, die sich in einer ersten Auswahlphase für den Wettbewerb beworben hatten (darunter auch etliche der 15, die jetzt in die engere Wahl gekommen sind), Unmut über die prägende Rolle der UnternehmerTUM breitgemacht hat. Wie so oft im deutschen Wissenschafts- und Innovationssystem, wird das aber nur hinter vorgehaltener Hand geäußert.
Wie divers die ausgewählten 15 Universitäten beziehungsweise Bündnisse jetzt schon sind, steht in den Sternen. Wenn dann im ersten Quartal 2025 die Gewinner gekürt werden, wird man zudem sehen, ob meine Empfehlung einer diversen Jury und entsprechender variantenreicher Konzepte umgesetzt wurde. Ich sorge mich sehr, dass auch die Startup-Factories ähnlich wie die Deutsche Agentur für Transfer und Innovation inhaltlich-strategisch, strukturell und von den Ressourcen her Rohrkrepierer werden könnten.
