gegenüber der Bundesregierung und dem federführenden BMBF forderten die Projektträger im vergangenen Herbst weitreichende Reformen – und mehr Freiheiten, wie sie eben auch die Sprind habe. Für eine zeitgemäße Innovationsförderung und effizienteren Transfer brauche es nun mal schlankere und agilere Auswahlverfahren, eine vereinfachte Rechts- und Fachaufsicht und eine flexiblere Finanzierung über die Jahresgrenzen hinweg. Mein Kollege Tim Gabel wollte wissen: Was ist aus den Forderungen und Plänen geworden?
Nach dem Projektträger-Tag in Berlin, bei dem auch die auftraggebenden Ministerien zu Gast waren, sprach er mit Sascha Hermann, Geschäftsführer des Projektträgers VDI TZ, Klaus Uckel, Geschäftsleiter beim DLR-Projektträger (DLR-PT) und Jörn Sonnenburg, Stellvertretender Geschäftsleiter des DLR-PT. Forschungspolitiker Holger Becker, Berichterstatter für die SPD, zeigt sich ernüchtert. Noch im September 2023 hatte er das Ziel formuliert, sehr bald mit einem Roadmap-Prozess zur Reformierung der Projektförderung zu starten. Jetzt übt er deutliche Kritik an BMBF und BMWK.
Ungewohnt deutlich wurde am Montag auch der Grünen-Politiker Kai Gehring. Nachdem FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai am Sonntagabend seinem Parteichef Christian Lindner zur Seite gesprungen war, der von der Bundesregierung einen “Herbst der Entscheidungen” gefordert hatte, erklärte Gehring auf LinkedIn, er “empfehle dringend, dass gelb-geführte Häuser einen Beitrag dazu leisten”. Die FDP müsse dringend “Ministerin Stark-Watzinger zur beherzten Sacharbeit für unser Bildungs- und Forschungssystem zurückbewegen”. Seit Wochen sei das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) wegen der Fördergeldaffäre wie gelähmt, so der Vorsitzende des Forschungsausschusses weiter. Was Bettina Stark-Watzinger wohl dazu denkt? Am Donnerstag ist die “Fördermittel-Affäre” erneut Thema im Bundestag, die CDU-Fraktion hatte eine Große Anfrage dazu gestellt.
Die Situation um den Göttinger Universitätspräsidenten Metin Tolan spitzt sich zu, berichtet meine Kollege Markus Weisskopf. In einer Stellungnahme macht der Senat klar, dass der Präsident eigentlich nur noch eine Möglichkeit hat, seine Abwahl zu vermeiden – in dem er zuvor selbst seinen Rückzug erklärt. Doch es finden sich auch noch Unterstützer des umstrittenen Präsidenten.
Kommen Sie gut in den Tag,


Im Herbst 2023 hatten die Projektträger (PT) in ihrem Positionspapier “Administrative Fesseln der Innovationsförderung abstreifen: SPRIND-Freiheitsgesetz breiter denken” klare Forderungen an ihre Auftraggeber, die Bundesregierung und das federführende BMBF formuliert. Der Tenor: für eine zeitgemäße Innovationsförderung und effizienteren Transfer brauche es – wie bei der Sprind – schlanke und agile Auswahlverfahren, eine vereinfachte Rechts- und Fachaufsicht und eine flexiblere Finanzierung über die Jahresgrenzen hinweg.
Man sei es leid, immer als Verursacher von Bürokratie dargestellt zu werden, nur weil die administrativen Beschränkungen noch aus dem letzten Jahrhundert stammten, gaben die Verantwortlichen damals im Gespräch mit Table.Briefings zu Protokoll. Neidisch blickte man auf das Freiheitsgesetz, mit dem die Bundesregierung kurz zuvor ihrer Agentur für Sprunginnovationen die Fesseln gelöst hatte und verwies darauf, dass der Hebel durch Flexibilisierungen bei den Projektträgern wesentlich größer sei.
Die Reaktionen aus der Koalition und seitens des BMBF waren verhalten. Man verwies auf die Neu- und Andersartigkeit der Sprind und auf graduelle Reformen, etwa die Digitalisierung der Antragsverfahren. SPD-Berichterstatter Holger Becker formulierte das Ziel, noch im Jahr 2024 mit einem Roadmap-Prozess zur Reformierung der Projektförderung zu starten. Becker damals: “Wir sollten noch in dieser Legislatur das Rüstzeug herstellen, um in den Jahren danach mit der konkreten Umsetzung beginnen zu können.”
Spätestens seit dem Projektträger-Tag, der Mitte September in Berlin stattfand, und bei dem auch die auftraggebenden Ministerien zu Gast waren, lässt sich vorausschauen: Den großen Wurf wird es in dieser Legislaturperiode nicht mehr geben. So sieht es inzwischen auch Becker: “Leider sind hier keine substanziellen Weiterentwicklungen feststellbar. Seitens des BMBF habe ich dazu in den letzten Monaten keine neuen Vorschläge gesehen“, sagt der SPD-Politiker. Es fehle ihm sowohl vom BMBF als auch vom BMWK die Bereitschaft, über grundlegende Änderungen im System nachzudenken – die im Idealfall auch finanzielle Mittel freisetzen würden.
Klare Bekenntnisse gab es beim Jahrestreffen der PT im Virchowklinikum der Charité von den Ministerien lediglich zu Bürokratieabbau, Verschlankung und Beschleunigung der Antragsprozesse. Die Ministeriumsvertreter hätten sich auch Hinweise und Anregungen zur Gesetzgebung von Seiten des PT-Netzwerks (PT-Netz) ausdrücklich gewünscht – letztlich werde das Positionspapier damit implizit begrüßt, gibt sich Sascha Hermann, Geschäftsführer des Projektträgers VDI TZ im Gespräch mit Table.Briefings optimistisch.
Von den Auftraggebern sei dafür geworben worden, Mut zu haben, um Änderungen von Regelwerken und Gesetzen mitzudenken. “Diese Einladung zum vertieften Dialog nehmen wir gerne an”, sagt Klaus Uckel, Geschäftsleiter beim DLR Projektträger (DLR-PT). Explizite Bezüge zu den Positionspapieren der PT habe es zwar nicht gegeben, es sei aber der Eindruck entstanden, dass “unsere Gedanken und Vorschläge sehr wohl bei den Auftraggebern präsent sind“.
“Gehört haben wir auch den Wunsch ,arbeitet mit den Agenturen zusammen‘”. Man sei im Sinne der “Förderung aus einem Guss” dazu gerne bereit. “Noch leichter wäre die Zusammenarbeit allerdings, wenn wir im Interesse des Innovationssystems die gleichen Freiheiten eingeräumt bekämen wie Sprind und Dati”, ergänzt Jörn Sonnenburg, Stellvertretender Geschäftsleiter des DLR-PT.
Uwe Cantner, Vorsitzender der EFI-Kommission, schaltete sich auf dem PT-Tag mit einem Video-Impuls zu. Im Gespräch mit Table.Briefings gibt er zu bedenken, welche weitreichenden Konsequenzen eine großangelegte Reform der Projektträger nach sich ziehen würde. “Die Projektträger stellen sich immer so etwas wie die schwedische Innovationsagentur Vinnova für sich vor.” Diese agiere in vielen Bereich sehr selbstständig und setze selbst Politikmaßnahmen und -programme auf.
Wer Freiheiten wie die Sprind möchte, brauche unternehmerische Zuschnitte, die die PT bislang nicht hätten, da sie Verwalter zugewiesener Budgets seien. In der Schweiz, wo die Innosuisse auch für die Strategie der Innovationsförderung zuständig sei, sei das dazugehörige Ministerium – bezüglich der Beamtenzahl – sehr klein. “Wenn man den PT eine unternehmerische Rolle zubilligt, braucht man Beschäftigte mit Unternehmergeist und aus meiner Sicht auch sehr viel weniger PT”, sagt Cantner. Das zöge erhebliche Veränderungen nach sich und sei ein “schwieriges Unterfangen”.
Cantner fokussierte sich bei seinem Vortrag auf dem PT-Tag auf graduelle Änderungen des Aufgabenspektrums und der Arbeitsweise von PT. In seinem Impuls ging er passend zum Motto “Aus Ideen werden Innovationen” auf die deutsche Transferproblematik ein. Hier brauche es bereits bei der Initialisierung von Projekten und Konsortien ein gutes Verständnis und belastbare Netzwerke für das spätere Geschäftsmodell.
“An dieser Stelle sind die Aufgaben der PT in den Beauftragungen aus unserer Sicht aktuell noch zu eng gefasst”, sagt Jörn Sonnenburg. Man kenne die Verwertungspotenziale der Projekte und Akteure, die sich als Transferpartner anbieten. “Für diese können wir Brücken bauen, um sich zum richtigen Zeitpunkt für den nächsten Schritt in Richtung Verwertung mit dem richtigen Akteur zu vernetzen oder auch um ein anschlussfähiges Förder- oder Finanzierungsprogramm zu identifizieren. Man muss uns nur beauftragen.” Oft bestünden große Kulturunterschiede zwischen Hochschulen, Instituten und Unternehmen, was Mindset, Ziele, Inhalte, Verwertung und Sprache angehe: “Die PT sind oft die einzigen Übersetzer und Multiplikatoren”, meint Sascha Hermann.
Die zweite Botschaft, die vom Jahrestreffen ausging: “Wir werden digitaler und dadurch effizienter.” Mit dem Wegfall der grundsätzlichen Schriftformerfordernis im vergangenen Jahr und der schrittweisen Einführung der E-Akte habe man wichtige Schritte zum übergeordneten Ziel gemacht, ein rein digitales Antragsverfahren ohne Medienbrüche durchführen und anbieten zu können. Jetzt seien die digitale Vergabe des Förderbescheids und die Entwicklung eines zentralen Förderportals von Bund, Ländern und Kommunen die nächsten Schritte, heißt es von Seiten der PT.
Gegenüber neuen Innovationsagenturen wie der Sprind oder der Cyberagentur – künftig auch einer Dati – gibt man sich selbstbewusst und kooperationsbereit. “Ein Teil der von Projektträgern umgesetzten Projektförderung hat enge Bezüge, etwa zu den Sprind-Challenges. Der von Projektträgern umgesetzte Spitzencluster-Wettbewerb wird als Blaupause für den Aufbau regionaler Innovationsökosysteme durch die Dati herangezogen. Daher sehen wir viel Potenzial in einer engen Zusammenarbeit zwischen den Projektträgern und den Agenturen, vor allem, um aufgrund der jeweiligen speziellen Aufgaben das Transferpotenzial aus den Ergebnissen der Projektförderung wirksam zu heben”, sagt Klaus Uckel.
Von ihrer eigentlichen Aufgabe, über Unternehmensgründungen Sprunginnovationen herbeizuführen, sei die Sprind noch “weit entfernt”. Man sei deshalb auch gespannt auf die Ergebnisse der anstehenden Sprind-Evaluation. Sascha Hermann vom VDI TZ bedauert allerdings, wenn Aufträge für PT nicht öffentlich zugänglich seien oder ausgeschrieben werden. So wie bei der aktuellen Beauftragung der Sprind durch das BMDV. Holger Becker rät bei diesem Punkt zu etwas mehr Geduld. Die Sprind diene sinnvollerweise als Experimentierfeld, um bestimmte Dinge in Finanzierung und Management auszuprobieren. “Ich gehe auch davon aus, dass die Sprind etwas unbürokratischer und schneller agiert als der durchschnittliche PT. Im Idealfall lerne man neue Verfahren kennen, die dann auch die PT übernehmen könnten.

Die Situation rund um den Göttinger Universitätspräsidenten Metin Tolan spitzt sich zu. Bereits in den vergangenen Wochen berichteten verschiedene Medien über eine im Raum stehende Abwahl Tolans. Ende August sprach der Senat von einer tiefen Vertrauens- und Führungskrise in der Universität. Eine Wiederwahl Tolans im Jahr 2026 werde es nicht geben, hieß es zu diesem Zeitpunkt.
Nun, eine Woche vor der Sondersitzung des Senats am 2. Oktober, hat sich der Ton nochmals verschärft. In einer aktuellen Version der “Stellungnahme der Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder des Senats” mit Stand vom 21. September schreiben die Senatoren, dass ein frühzeitiger einvernehmlicher Übergang präferiert, aber nicht möglich war. Im Schreiben, das Table.Briefings vorliegt, heißt es: “In den Gesprächen mit dem Präsidenten Metin Tolan konnte zu unserem großen Bedauern kein alternativer Weg für einen konstruktiven Führungswechsel zum Wohle der Universität gefunden werden.”
Man appelliere weiterhin an Tolan, sich “dieser Option nicht zu verschließen. Ansonsten verbleibe dem Senat nur das Instrument der Abwahl nach § 40 NHG, um einen Führungswechsel in die Wege zu leiten”. Für die Abwahl müsste eine Mehrheit von mindestens zehn Senatoren “aufgrund ihrer Einschätzung der Situation und Abwägung aller Argumente und Sichtweisen” zur Entscheidung kommen, dass eine Fortführung in der aktuellen Form nicht sinnvoll sei. Einer solchen Entscheidung möchte der Senat eine Vertrauensfrage vorschalten.
Diese Formulierungen und die Tatsache, dass elf von dreizehn Senatoren die Stellungnahme unterstützen, zeigen, dass Tolan aus Sicht des Senats entweder selbst das Feld räumen muss oder nächste Woche durch den Senat abgewählt wird.
Der Senat scheint nun auch gewillt, im Zweifel einen Konflikt mit dem Stiftungsrat (entspricht in Göttingen dem Hochschulrat) sowie dem niedersächsischen Wissenschaftsminister Falko Mohrs auszutragen. Mohrs hatte Tolan noch vor kurzem sein Vertrauen ausgesprochen. Und auch der Stiftungsrat unter dem Vorsitz von Peter Strohschneider hatte keine Zustimmung zur Abwahl Tolans signalisiert. Allerdings kann der Senat in letzter Konsequenz den Stiftungsrat überstimmen.
Hintergrund der Krise an der Georg-August-Universität Göttingen sind laut der Stellungnahme des Senats schlechte Leistungsindikatoren sowie eine Verschlechterung der internen Organisation. Zu dem ersten Punkt führen die Autoren insbesondere das schlechte Abschneiden bei der Exzellenzstrategie an. Von fünf in der aktuellen Runde eingereichten Exzellenzclustern überstand kein einziges die erste Auswahlstufe. Damit hat die Universität auch keine Möglichkeit, im Rennen um die Exzellenzunis mitzuspielen – eigentlich der Anspruch in Göttingen.
Aber auch der Verlust von ERC-Grants wird dem aktuellen Präsidenten zur Last gelegt. Ebenso das schlechte Abschneiden bei den niedersächsischen Wissenschaftsräumen und den Niedersachsen-Professuren.
Im Bereich der internen Organisation bemängeln die Senatoren vor allem die mangelnde “zukunftsfähige Gesamtstrategie” der Universität. Daneben werden Mikromanagement, eine unzureichende Finanzsanierung und ein geringer Fortschritt bei der Verwaltungsoptimierung benannt. Dazu herrsche ein “zunehmendes Klima der Einschüchterung von Mitarbeitenden auf allen Ebenen, da Kritik persönlich nachgetragen wird”. Man bemängelt den “Verlust einer offenen Fehlerkultur und konstruktiver Kritik “.
Die Senatoren wollen dem Dialog mit den Dekanen entnommen haben, dass man “in der Problemanalyse weitgehend übereinstimmt und in Teilen ebenfalls geringes Vertrauen besteht, dass der Präsident für eine konkurrenzfähige Zukunft der Universität steht und diese erfolgreich aus der Krise führt”.
Gleichzeitig forderten jedoch sieben der 13 Dekane nach Tolan-kritischen Äußerungen der ehemaligen Senatssprecherin Margarete Boos einen “respektvollen Umgang” und eine faire Debatte. Zudem distanzierten sie sich “von diesen Vorwürfen sowohl in Bezug auf den Stil als auch den Inhalt“. Ob der Senat in seiner Stellungnahme also auch für eine Mehrheit der Dekane spricht, bleibt unklar. Und auch Teile der Professorenschaft stellen sich gegen eine direkte Abwahl Tolans.
Die Autoren der Stellungnahme kommen dennoch zu dem Schluss, dass die verbleibende Amtszeit des Präsidenten zu lang sei, um die anstehenden wichtigen Aufgaben ungelöst zu lassen. “Das Risiko ist zu groß, dass die Universität in 2,5 Jahren noch schlechter dasteht, interne Gräben vertieft werden und noch mehr Personal resigniert die Universität verlässt.”
Daraus ergibt sich für den Senat die oben benannte Vorgehensweise. In der nächsten Woche wird sich zeigen, ob Tolan von sich aus seinen Posten räumt. Oder ob es dann zu einer Abwahl auf der Sondersitzung am 2. Oktober kommt.
24. September 2024, 10:30 bis 16:15 Uhr, Haus der Commerzbank, Pariser Platz 1, 10117 Berlin
Forum Hochschulräte Starke Marken, klarer Kern: Strategische Schwerpunktsetzung und Markenbildung bei Hochschulen Mehr
25. September 2024, 8:00 bis 9:15 Uhr im BASECAMP, Mittelstraße 51-53, 10117 Berlin
Frühstücks-Austausch: Gipfel für Forschung und Innovation Follow-up Innovationen in Europa – Katalysatoren, Kompetenzen und Kooperationen am Beispiel von KI: Gespräch über Umsetzungsschritte für mehr Geschwindigkeit bei Innovation und Forschung Zur Anmeldung
25. September 2024, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU)
Jahreskolloquium des Bayerischen Wissenschaftsforums Transformationskompetenz in Wissenschaft und Hochschule Mehr
26. September 2024, 12:00 bis 13:00 Uhr, Webinar
CHE talk feat. DAAD KIWi Connect Transfer und Internationalisierung – Warum ist es sinnvoll, beides gemeinsam zu denken und was braucht es hierzu? Mehr
26./27. September 2024, Leopoldina, Jägerberg 1, 06108 Halle (Saale) und Online
Jahresversammlung 2024 der Leopoldina Ursprung und Beginn des Lebens Mehr
1. Oktober 2024, 19 Uhr, Bricks Club Berlin
Gesprächsreihe der Wübben Stiftung Wissenschaft in Kooperation mit der Jungen Akademie Christopher Degelmann: Fake News und Fleischkonsum in der Antike Mehr
3. /4. Oktober 2024, Universität Helsinki, Finnland
2024 EUA FUNDING FORUM Sense & sustainability: future paths for university finances Mehr
8. /9. Oktober 2024 an der TU Berlin
bundesweite Tagung zu Machtmissbrauch an Hochschulen “Our UNIverse: Empowered to speak up” Mehr
10. Oktober 2024 an der TUM School of Management, München
Konferenz AI@WORK – How AI is changing leadership, work and collaboration Mehr
11. Oktober 2024 an der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste, Düsseldorf
DHV-Symposium 2024 “Die ‘Große Transformation’ – ein Jahrhundertprojekt zwischen Realität und Utopie” Mehr
23. bis 25. Oktober 2024 am ETH AI Center in Zürich, Schweiz
Jahrestagung der Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft (GMW) und CampusSource Agilität und KI in Hochschulen Mehr
4. November 2024, 17 Uhr, Allgemeiner Fakultätentag e.V., Karlsruhe
Online-Podiumsdiskussion “Denken, Sprechen, Schreiben. Wie wichtig ist die Sprachkompetenz für das wissenschaftliche Arbeiten?” Mehr
7.-9. November 2024, Berlin
Konferenz Falling Walls Science Summit 2024 Mehr
Seit vergangener Woche ist bekannt: Der US-Konzern Intel verschiebt den geplanten Bau einer Chip-Fabrik in Magdeburg. Damit liegt nun eine Investition von insgesamt 30 Milliarden Euro auf Eis, ebenso die Entstehung von 3.000 Arbeitsplätzen.
Was der Bund mit den vorerst nicht benötigten zehn Milliarden Euro Zuschuss zu dem Prestigeprojekt anfangen wird, ist noch nicht geklärt. Hochschulen und Wissenschaft in Sachsen-Anhalt tangiert der Streit darüber nicht. Sie setzen weiterhin auf Halbleiter (siehe dazu auch unser Länder-Kompass Sachsen-Anhalt hier). Denn die Bundesmittel waren vornehmlich für den Bau und die Einrichtung der Chip-Fabrik vorgesehen. Wissenschaftliche Projekte waren mit diesen Mitteln nicht geplant.
Es gebe das schöne Sprichwort “aufgeschoben ist nicht aufgehoben”, sagt Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) auf Anfrage von Table.Briefings. “Ich bleibe zuversichtlich, dass Intel seine Fabrik in Magdeburg bauen wird – wenn auch mit zeitlicher Verzögerung.” Für die Universitäten und Hochschulen des Landes gebe es überhaupt keinen Grund, das Thema Halbleiter wie eine heiße Kartoffel fallen zu lassen.
“Halbleitern gehört die Zukunft, deshalb ist es richtig, Studiengänge und Forschungsvorhaben in diesem Zukunftsfeld anzubieten”, sagt Willingmann. Die Universitäten und Hochschulen des Landes würden daher ihre Studiengänge und Forschungskooperationen konsequent fortsetzen. “Absolventen in diesem Bereich werden in den kommenden Jahren beste Berufsperspektiven haben – nicht nur, aber hoffentlich auch bei Intel in Magdeburg.”
Auch ohne den kurzfristigen Bau der Chipfabrik sei eine Erweiterung der wissenschaftlichen Kompetenzen im Halbleiterbereich weiter notwendig, betont das Wissenschaftsministerium. Es gehe darum, unabhängiger von Playern etwa aus Fernost zu werden. abg
Wer erhält in diesem Jahr die Nobelpreise für Medizin, Physik, Chemie und Wirtschaft? Am 7./8./9. und 14. Oktober werden die Gewinner bekanntgegeben. Fürs qualifizierte Mitorakeln wird für gewöhnlich die Liste der besonders häufig zitierten Forschenden zu Rate gezogen, die das Unternehmen Clarivate alljährlich im Frühherbst veröffentlicht. Für das Jahr 2024 wurden jetzt 22 Citation Laureates bekanntgegeben. Das sind die wichtigsten Köpfe und Erkenntnisse:
Clarivate brüstet sich damit, seit 2002 bereits 75 Nobelpreisträger identifiziert zu haben – oft mehrere Jahre, bevor sie gekürt wurden. Der Citation Award wird seinem Ruf als Indikatorpreis demnach gerecht. Allerdings muss man auch vorherige “Jahrgänge” durchforsten, um für das aktuelle Jahr richtig zu liegen. Benjamin List, Chemienobelpreisträger 2021, war zum Beispiel bereits 2009 Citation Laureate.
Für die Citation Awards werden die Daten des Web of Science Citation Index analysiert. Aus den mehr als 61 Millionen Artikeln, die seit 1970 im Web of Science indexiert wurden, wurden nur etwa 9.000 (0,01 Prozent) 2.000-mal oder häufiger zitiert. Diese quantitative Analyse wird durch eine qualitative flankiert. Sie berücksichtigt prestigeträchtige Auszeichnungen wie die Lasker-Preise in der Biomedizin. abg

Die Forschungs- und Innovationsminister der G20-Staaten trafen sich in der vergangenen Woche in Brasilien. Für Deutschland reiste Staatssekretär Jens Brandenburg nach Manaus an. Das Hauptthema des Ministertreffens war die internationale Zusammenarbeit in Wissenschaft und Innovation für eine nachhaltige Entwicklung, insbesondere unter dem Aspekt von “Open Innovation”.
Themen des diesjährigen G20-Wissenschaftstreffens waren:
Die Minister betonten, dass Forschung und Innovation eine Schlüsselrolle bei der Bekämpfung des Biodiversitätsverlustes, der Umweltverschmutzung und der Gesundheitsförderung spielen.
Abschließend wurde das “Manaus-Paket” verabschiedet, das verschiedene Maßnahmen und Partnerschaften umfasst, darunter die G20-Strategie für offene Innovation und Empfehlungen zur Inklusion in Wissenschaft und Technologie. Das nächste Treffen soll 2025 unter südafrikanischem Vorsitz stattfinden. mw
Die durchschnittlichen Wohnkosten für Studierende sind gegenüber dem Vorjahr kaum gestiegen (plus drei Prozent / 17 Euro). Sie bleiben aber auf einem sehr hohen Niveau von jetzt durchschnittlich 489 Euro. Das ergibt eine Auswertung des Moses Mendelssohn Instituts (MMI) in Kooperation mit WG-Gesucht.de, die das Institut regelmäßig durchführt. Im Wintersemester 2013/14 lagen die Wohnkosten im Durchschnitt noch bei 324 Euro.
Die Analyse bezieht alle 88 Hochschulstandorte in Deutschland mit mindestens 5.000 Studierenden (ohne Fern- und Verwaltungshochschulen) ein. Sie untersucht dabei unbefristete Angebote für Zimmer in Wohngemeinschaften mit zwei bis drei Personen. In diesen Städten sind 91 Prozent der rund 2,7 Millionen Studierenden eingeschrieben.
“Nach dem Auslaufen der Covid-19-Pandemie und dem Angriff Russlands auf die Ukraine sind die Wohnkosten extrem gestiegen”, sagte der Geschäftsführende Direktor des Instituts und Projektleiter Stefan Brauckmann. Die Wohnkosten lagen in diesem Zeitraum deutlich oberhalb der allgemeinen Teuerungsrate. “Jetzt können wir eine Erholungsphase erkennen.” Angespannt bleibt die Lage trotzdem, insbesondere in nachgefragten Hochschulstädten.
In 37 der untersuchten Standorte, in denen etwa die Hälfte der Studierenden eingeschrieben ist, lassen sich kaum WG-Zimmer finden, die nicht über der Wohnkostenpauschale nach Bafög liegen. Die Pauschale wurde zu Beginn des Wintersemesters von 360 auf 380 Euro erhöht. In Berlin liegt der Durchschnittspreis für das Wintersemester bei 650 Euro, in München bei 790 Euro, in Köln bei 600 Euro und in Hamburg bei 620 Euro. Drei Viertel der Studierenden sind in einer Stadt eingeschrieben, in der der Durchschnittspreis für ein WG-Zimmer über der Wohnkostenpauschale von 380 Euro liegt.
Damit es künftig mehr bezahlbaren Wohnraum für Studierende und Azubis gibt, hält Stefan Brackmann öffentliche Förderprogramme für preis- und belegungsgebundenen Wohnraum für zwingend notwendig. Die Wohnkostenpauschalen sollten zudem an den Studienort angepasst werden. Er sagte: “An vielen Standorten wird deutlich, dass selbst gemeinnützige Träger, wie die Studierendenwerke, in den mit öffentlicher Förderung errichteten Neubauwohnheimen nur schwer Endkundenpreise anbieten können, die innerhalb der neuen Bafög-Wohnkostenpauschale liegen.” Durch verschiedene Maßnahmen müssten die Baukosten dringend gesenkt werden. Anna Parrisius
Welt: Wo Deutschland international an der Spitze steht. Es steht wirtschaftlich nicht gut um Deutschland, und auch bei einigen Technologien hängt das Land hinterher. Trotzdem sollte man nicht aus den Augen verlieren, dass es auch Branchen gibt, in denen Deutschland weltweit führt. Im Maschinenbau, aber auch bei Biopharma, stehen Unternehmen aus Deutschland zum Teil an der Weltspitze. (“Deutschland weltweit führend – Die vergessene Stärke des Standorts D”)
Schwäbische Zeitung: Nischenfächer gehören zu Volluniversitäten dazu. Der Rechnungshof Baden-Württemberg hat im Sommer das Land aufgefordert, auch im Wissenschaftsbereich genau hinzuschauen, für welche Fächer Geld ausgegeben wird. Gemeint waren damit Nischenfächer, die nicht viele Studenten anziehen. Die Universität Tübingen reagierte nun auf den Rechnungshof und stellte klar, dass auch Fächer wie Ägyptologie für eine Volluniversität, in der interdisziplinär gearbeitet wird, wichtig sind. (“Nischenfächer: Forscher kontern Rechnungshof-Kritik”)
DLF: Forschung an seltenen Krankheiten in Gefahr. Die Forschung zu seltenen Erkrankungen könnte unter Kürzungen im Bundeshaushalt leiden. Dies könnte Patientenregister und klinische Netzwerke gefährden, die Voraussetzung für die Entwicklung von Therapien sind. Von den seltenen Krankheiten sind in Deutschland mit bis zu vier Millionen Menschen nicht wenige betroffen. (“Forschung an seltenen Erkrankungen fürchtet Förderstopp”)
Heise: Starlink-Satelliten bedrohen die Forschung. Allein 6.400 Satelliten hat Starlink in die Umlaufbahn geschossen, und SpaceX ist nur eines von vielen Unternehmen, die im Satellitengeschäft aktiv sind. Bis 2030 könnten 100.000 Satelliten die Erde umkreisen. Vor allem die starke Kommunikationssignale sendenden Starlink-Satelliten wirken sich schon heute auf die Forschung mit Radioteleskopen aus. (“Wissenschaftler: Neue Starlink-Satelliten bedrohen astronomische Forschung”)
Vox: Das Problem der Wissenschaft mit ihrem Kurzzeitgedächtnis. Vor allem junge Wissenschaftler verlassen immer schneller ihre Projektgruppen. Die von ihnen geleistete Arbeit kann dabei in Vergessenheit geraten. Eine langfristigere Finanzierung, die Wissenschaftler auch an ihren Einrichtungen hält, könnte Abhilfe schaffen. (“Science has a short-term memory problem”)
Nature: Die USA und China wollen weiterhin wissenschaftlich kooperieren. Seit 1979 kooperieren die USA und China im wissenschaftlichen Bereich. Allerdings hat sich das Verhältnis zwischen den beiden Staaten in den vergangenen Jahren stark verschlechtert. Die Zusammenarbeit könnte nun fortgesetzt werden, allerdings vor allem in den Bereichen Klimawandel, öffentliche Gesundheit und Nahrungsmittelsicherheit. (“US and China inch towards renewing science-cooperation pact – despite tensions”)
Süddeutsche Zeitung: Forschung mit Datenspende unterstützen. Durch die Nutzung von Apps und Wearables sammeln Menschen mehr Daten über sich selbst als je zuvor. Dies kann ihnen nicht nur persönlich helfen, sondern auch der Forschung von großem Nutzen sein. Während der Corona-Pandemie haben Datenspenden wertvolle Erkenntnisse geliefert. Jetzt unterstützen sie Wissenschaftler dabei, die Schlafgewohnheiten besser zu verstehen. (“Wie Daten von Fitnesstrackern und anderen Wearables die Forschung voranbringen können”)

Hochschule war vor allem im wissenschaftlichen Bereich traditionell schon immer ein Ort größerer Freiheit bezüglich der Wahl von Arbeitszeit und -ort. In jüngerer Vergangenheit ist diese Freiheit auch auf den Verwaltungsbereich ausgeweitet worden. Im Zuge der Corona-Pandemie erlassene Regelungen zum mobilen Arbeiten wurden vielerorts in feste Dienstvereinbarungen überführt. Parallel dazu hielten neue Arbeitsweisen Einzug an den Hochschulen.
Die räumliche Distanz erforderte eine veränderte Art von Arbeit, aber auch von Führung, vielfach angelehnt an die Ideen der New Work und damit einhergehend mit mehr Eigenverantwortung und größeren Entscheidungsspielräumen für Beschäftigte.
Auch der Fachkräftemangel und der Kampf um Talente setzt den Hochschulen in ihrer Funktion als Arbeitgeber zu. Sie stehen einerseits in Konkurrenz untereinander, sehen sich aber auch im Wettbewerb mit der Wirtschaft, die häufig mit besseren Gehältern und besserer Arbeitsausstattung locken kann. Denn die Spielräume in der Entlohnung Beschäftigter sind an den Hochschulen durch die Tarifbindung eng gesteckt, die Ressourcen zur Gestaltung im baulichen Bereich sind limitiert.
Zusätzlich sind Entscheidungswege an Hochschulen andere. Wo das Prinzip der Freiheit von Forschung und Lehre gilt, sind Top-Down-Maßnahmen, wie sie in vielen Wirtschaftsunternehmen angewendet werden, angesichts anderer Machtverhältnisse nur schwerlich umsetzbar. Fläche ist nach wie vor vielfach Bestandteil von Berufungsverhandlungen, nach dem Grundsatz “je mehr (Repräsentations-)Fläche, desto mehr Prestige”.
Die aus der Klima- und Energiekrise abgeleiteten Handlungsnotwendigkeiten üben zusätzlich Druck auf die Hochschulen aus. Dies betrifft auch den Umgang mit Flächen und Räumen, gehen diese doch einher mit Flächenverbrauch und massiven CO2-Emissionen in Erstellung und Bewirtschaftung.
Bund und Länder sind in diesem Punkt in jüngerer Zeit aktiv geworden und haben Vorgaben zur effizienten Raumnutzung erlassen, die in vielen Bundesländern auch die Hochschulen betreffen (wenn hier vorerst auch nur im Neubau). Weil sich Homeoffice etabliert hat, wird in diesem Zusammenhang eine Reduzierung von Büroarbeitsplätzen in öffentlichen Gebäuden, und damit auch in Hochschulen, angestrebt.
Die Bundesländer setzen diese Einsparbemühungen derzeit unterschiedlich um. An den Hochschulen ist bisher im Wesentlichen die Hochschulverwaltung betroffen. Die Quote der Beschäftigten, für die vor Ort ein Arbeitsplatz vorgehalten werden soll, schwankt zwischen 70 und 90 Prozent. Dies führt in der Konsequenz zur Notwendigkeit einer Einführung von Desk-Sharing, da nicht mehr für alle beschäftigten Personen zeitgleich Plätze zur Verfügung stehen.
Hier ist gutes Change-Management gefragt, denn der persönliche Arbeitsplatz ist für viele Beschäftigte identitätsstiftend und in den meisten Fällen war bisher eine dauerhafte Belegung trotz Homeoffice weiterhin möglich. Dabei bewegt man sich im Bürobereich nach wie vor überwiegend in tradierten Raumstrukturen. Klassische Einzel-, Doppel- oder Mehrpersonenbüros werden in der Regel ergänzt durch Besprechungsräume und Teeküchen. Dies entspricht dem Bild eines Büros mit überwiegend Vollzeit anwesend Beschäftigten
Vernetzung und informelle Gespräche finden in diesem Setting bei zufälligen Begegnungen auf den Fluren, an der Kaffeemaschine oder beim gemeinsamen Mittagessen statt. Wenn viele Beschäftigte nur zeitweise und anlassbezogen vor Ort sind, sind solche tradierten Raumstrukturen aber nicht mehr sinnvoll.
Einem Vernetzungsgedanken stehen sie sogar diametral entgegen. Auch die Art und Weise, wie gearbeitet wird, beeinflusst den Raumbedarf. Die Anteile an Kommunikation, Kollaboration und Stillarbeit variieren im Verlauf der individuellen Tätigkeit, wie auch zwischen den verschiedenen Positionen.
Entsprechend liegt es nahe, räumliche Angebote zu schaffen, die den Bedarfen der Beschäftigten in besserer Art und Weise und in unterschiedlichen Phasen eines Arbeitsprozesses entsprechen und ihre Arbeit bestmöglich unterstützen. Dies erfordert ein Überdenken und Anpassen der tradierten Raumstrukturen, um förderlichere Büroarbeitsumgebungen einhergehend mit Flächenoptimierung realisieren zu können.
Auf diese Aspekte ist dabei zu achten:
Die Vorgaben der Länder zur Flächensuffizienz, die Veränderungen und Anpassungen notwendig machen, stellen eine günstige Gelegenheit dar, bisherige Strukturen und Raumnutzungskonzepte zu reflektieren und nach realisierbaren Verbesserungen zu suchen. Im Idealfall erreichen Hochschulen so eine höhere Zufriedenheit der Mitarbeitenden mit ihrer Büroarbeitsumgebung und stellen ihren Flächenbestand zeitgleich attraktiv, zukunftsfähig und nachhaltig auf.
Inka Wertz ist Hochschulplanerin und Projektleiterin am HIS-Institut für Hochschulentwicklung e.V. in Hannover. Im Fokus ihrer Arbeit steht die Anpassung hochschulischer Flächen an die Anforderungen neuen Lehrens, Lernens und Arbeitens. Darum geht es auch in der Online-Veranstaltung “Home. Office. Hochschulbau. Herausforderungen und Chancen” am 30. Oktober.
Der Standpunkt ist Teil einer Table.Briefings-Serie zum Thema Hochschulbau. Um veränderte Raumkonzepte ging es auch in Teil 4 hier. Eine Übersicht über alle bisherigen Beiträge finden Sie hier.
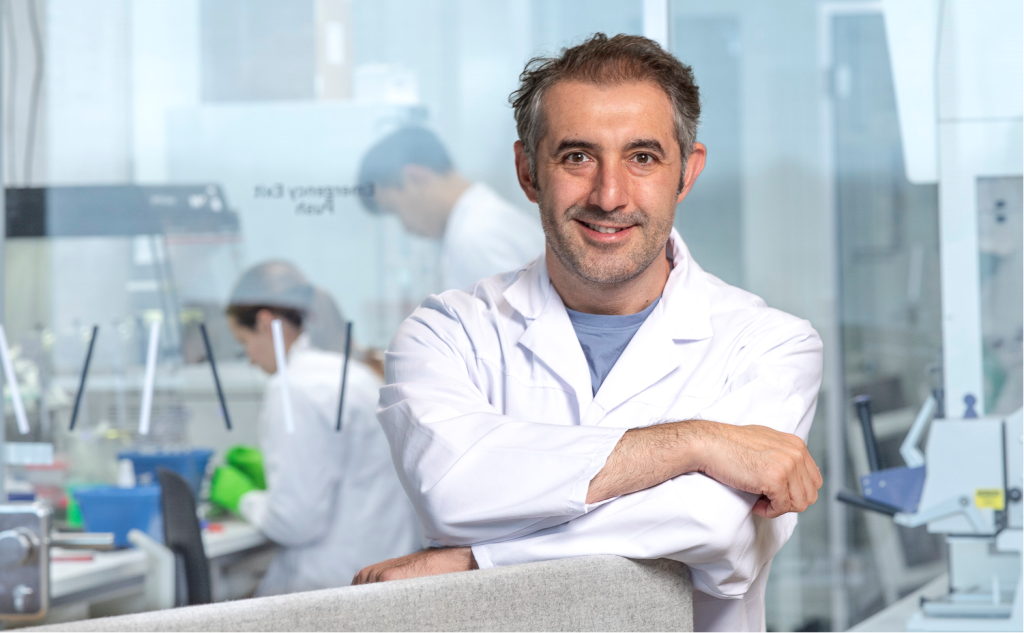
Tierversuche sind die Achillesferse der Wissenschaft: Sie sind gesellschaftlich hoch umstritten, langwierig und teuer. Weltweit suchen Forschende deshalb fieberhaft nach Alternativen – so wie Ali Maximilian Ertürk vom Helmholtz-Zentrum München. Seine Lösungsidee hat Pioniercharakter – und führt ihn im November zum Falling Walls Science Summit in Berlin. Denn er gehört zu den Finalisten des Breakthrough of the Year-Award in der Kategorie Life Sciences.
Um das bahnbrechende Potenzial zu erfassen, ist es vielleicht am einfachsten, sich einen Science-Fiction-Film vorzustellen: Die Technologie dort ist so weit ausgereift, dass ganze Organismen mitsamt ihren biologischen Prozessen und Krankheitsverläufen in virtuellen Umgebungen simuliert werden können. Geforscht wird also etwa nicht direkt an einem Lebewesen, sondern an einer digitalen Simulation, die zuvor mit hochauflösenden Bilddaten erstellt wurde. Auf ihren Screens sehen Forschende, wie und wo sich Krankheiten im Detail auswirken und wie potent neue Arzneimittel sind.

Genau das in der realen Welt irgendwann möglich zu machen, ist Ertürks Ziel. Erreicht er es, könnten nicht nur sehr viele Tierversuche vollständig ersetzt werden. Wissenschaftliche Entdeckungen würden erheblich beschleunigt und die Medikamentenentwicklung revolutioniert. Wie wirken sich Erkrankungen des Gehirns auf das Nervensystem aus? Welche Folgen hat das Rauchen für den ganzen Körper, nicht nur auf die Lunge?
Bei der Suche nach Antworten ist Ertürk mit seinem Team bereits entscheidende Schritte vorangekommen. Ganze Mäusekörper und menschliche Organe können sie im Labor transparent machen und in einer völlig neuen Detailgenauigkeit scannen. Als ihnen das zum ersten Mal gelang, sei das “aufregend” gewesen, sagt Ertürk rückblickend.
So lapidar das auch klingt, die Fachwelt horchte auf. “Einige Forscher bezeichnen seine Pläne als “weit hergeholt”, andere verwenden weniger freundliche Beschreibungen”, schrieb Nature vor einigen Jahren. Er selbst bezeichnete sich damals als “Träumer”. Doch auch das trifft es vielleicht nicht ganz. Der Neurowissenschaftler und Biotechnologe ist eher ein Grenzgänger zwischen wissenschaftlichen Disziplinen, zwischen Forschung, Innovation, Wirtschaft und – ja: Kunst.
1980 in der Türkei geboren und aufgewachsen, studierte Ertürk an der Bilkent University in Ankara. In ein Flugzeug stieg er erstmals als Student. Ein Sommerpraktikum in den USA war der Grund für die erste Fernreise. Ihr sollten viele folgen. Nach der Promotion am Max-Planck-Institut für Neurobiologie in München arbeitete Ertürk als Postdoc im US-amerikanischen Biotech-Unternehmen Genentech in San Francisco.
2019 kehrte er nach Deutschland zurück, wurde Direktor des Instituts für Tissue Engineering and Regenerative Medicine (ITERM) am Münchner Helmholtz-Zentrum und Professor der Ludwig-Maximilians-Universität. Ein Jahr später erhielt er den renommierten ERC Consolidator Grant des europäischen Forschungsrats ERC. Insgesamt 22,5 Millionen Euro an Fördermitteln akquirierte der Wissenschaftler nach eigenen Angaben in den vergangenen sieben Jahren. Er hielt mehr als 100 Vorträge und gründete zwei Firmen: Deep Piction und 1×1 Biotech GmbH.
All das hört sich nach jemandem an, der für Forschung und Entwicklung lebt. Aber Ali Maximilian Ertürk ist, wie gesagt, auch noch Künstler. Seine fotografischen Arbeiten wurden mittlerweile in drei Ausstellungen gezeigt und haben eine Fangemeinde von rund 37.000 Menschen.
Gute Mentoren, freundschaftliche Beziehungen im Team, Kommunikationsstärke, Mut und der Ehrgeiz, sich selbst immer weiter zu verbessern, sind für Ertürk die Faktoren, die für Karrieren in der Wissenschaft entscheidend sind. Und Spaß. Denn: “In der Wissenschaft geht es nicht nur um das Ziel, sondern auch um den spannenden Weg der Entdeckung”, erklärte Ertürk im Falling-Walls-Interview. Christine Prußky
Beim Falling Walls Science Summit 2024, der vom 7. bis 9. November in Berlin stattfindet, ist Ali Maximilian Ertürk unter den Finalisten für den Breakthrough of the Year in der Kategorie Life Sciences. Weitere Porträts der Table.Briefings-Serie “Breakthrough-Minds” finden Sie hier.
Jutta Allmendinger, Professorin an der Humboldt Universität und der Freien Universität Berlin, und Alena Buyx, Professorin für Ethik in der Medizin und Gesundheitstechnologien an der Technischen Universität München, sollen in den Wissenschaftsrat berufen werden. Das haben die Chefinnen und Chefs der Staats- und Senatskanzleien der Länder empfohlen.
Eva-Lotta Brakemeier, Professorin für Klinische Psychologie und Psychotherapie an der Universität Greifswald und Direktorin des Zentrums für Psychologische Psychotherapie (ZPP), ist neue Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Psychologie. Sie tritt die Nachfolge von Stefan Schulz-Hardt an. Seit Anfang 2024 gehört Brakemeier dem Wissenschaftsrat an.
Erin Schuman, US-amerikanische Hirnforscherin, ist mit dem Körber-Preis für die Europäische Wissenschaft ausgezeichnet worden. Die Wegbereiterin der Neurobiologie bekam die mit einer Million Euro dotierte Auszeichnung für die Entdeckung der lokalen Proteinsynthese im Gehirn. Dieser Mechanismus ist die Grundlage für das Lernen und Erinnern. Schuman ist seit 2009 Direktorin am Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt am Main. Neben ihrer Forschung engagiert sie sich für die Erhöhung des Frauenanteils in der Wissenschaft.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an research@table.media!
China.Table. Autonomes Fahren: Welche Technik die USA aus China verbieten wollen. Die USA befürchten, dass autonome Fahrzeuge Daten über US-amerikanische Fahrer und die Infrastruktur des Landes erheben und an China weiterleiten. Das US-Handelsministerium steht kurz davor, einen Vorschlag für neue Regulierungen vorzulegen. Mehr
Europe.Table. Glasfaser: EIB fördert Ausbau in ländlichen Regionen Deutschlands. Die Deutsche Glasfaser erhält ein Darlehen von 350 Millionen Euro von der Europäischen Investment Bank zum Breitbandausbau in ländlichen Gebieten Deutschlands. Aktuell verfügen nur rund 35 Prozent der Haushalte in Deutschland über Glasfaseranschlüsse. Mehr
Security.Table. Konrad-Adenauer-Stiftung “pausiert” langjährige Kooperation mit palästinensischem Umfrageinstitut. Nach Manipulationsvorwürfen von Seiten des israelischen Militärs hat die Konrad-Adenauer-Stiftung die Kooperation mit dem Palästinensischen Zentrum für Politik- und Umfrageforschung (PCPSR) “pausiert”. Die vierte Umfrage zur politischen Haltung und sozialen Situation der Menschen in den palästinensischen Gebieten seit dem 7. Oktober ist dennoch erschienen. Mehr
Europe.Table. Meta kritisiert unklare Gesetzeslage für KI in Europa. In Europa seien klare Regeln für den Umgang mit KI nötig, fordert der Konzern Meta. Bislang bestehe eine große Unsicherheit. Das könne dazu führen, dass Meta nicht alle Produkte in Europa anbietet. Mehr
Berlin.Table. US-Wahlen: Wie Kamala Harris die Frauen für sich gewinnt. Bei den US-Wahlen zeichnet sich ein massiver Gender-Gap ab. Gerade in den Swing States will eine deutliche Mehrheit der Frauen Kamala Harris ihre Stimme geben. Sie hat das Recht auf Abtreibung zum zentralen Bestandteil ihrer Kampagne gemacht und so Donald Trump in die Defensive gedrängt. Mehr

Über das, was Redakteure am Sonntagnachmittag machen, berichten wir im Research.Table normalerweise nicht. Doch da sich der aktuelle Ausflug unter den Titel Scienceseeing stellen lässt und das Ziel auch nicht jede Woche zu erreichen ist, wollen wir einmal eine Ausnahme machen. Es ging nämlich hoch hinaus, sogar bis ins All. Also nicht wortwörtlich, aber schon sehr nah dran. Im Steven F. Udvar-Hazy Center in der Nähe des internationalen Flughafens Dulles – der US-Hauptstadt Washington DC – kann man nämlich so nah an etwas herankommen, das schon einmal im Weltraum war, wie sonst wohl nur selten.
In dem Ausstellungshangar, der zum National Air and Space Museum gehört, steht unter anderem das Space Shuttle “Discovery”. Und zwar nicht irgendeine Nachbildung, sondern exakt das Space Shuttle, das das Teleskop Hubble 1990 in den Weltraum transportiert hat. Man erkennt es besonders gut an den thermischen Kacheln an der Unterseite. Die sind nämlich beim Wiedereintritt in die Atmosphäre ganz schön ramponiert worden. Da fühlt man sich nicht nur angesichts der Maßstäbe dieser Raumfahrt-Legende plötzlich ganz klein am Boden der Smithsonian Institution.
Aber es wären nicht die USA, wenn das hier der einzige Moment wäre, wo man mit offenem Mund in einem Museum steht. Eine Halle weiter – zunächst neben einer Original-Concorde nicht weiter auffällig – ein silbrig glänzendes Exemplar des US-Weltkriegbombers B 29. Natürlich auch: ein Original. Und zwar jenes, mit dem am 6. August 1945 die Atombombe über Hiroshima abgeworfen wurde. Schluck. Der Museumsführer versucht sich an einer kleinen Anekdote: Flugzeug-Kapitän Colonel Paul W. Tibbets, jr. habe vor dem Abflug geahnt, dass die Maschine im Museum landet und daher den Namen seiner Mutter außen ans Cockpit schreiben lassen. Der Schriftzug ist heute noch gut erkennbar: Enola Gay. Drama können die Amerikaner. Tim Gabel
gegenüber der Bundesregierung und dem federführenden BMBF forderten die Projektträger im vergangenen Herbst weitreichende Reformen – und mehr Freiheiten, wie sie eben auch die Sprind habe. Für eine zeitgemäße Innovationsförderung und effizienteren Transfer brauche es nun mal schlankere und agilere Auswahlverfahren, eine vereinfachte Rechts- und Fachaufsicht und eine flexiblere Finanzierung über die Jahresgrenzen hinweg. Mein Kollege Tim Gabel wollte wissen: Was ist aus den Forderungen und Plänen geworden?
Nach dem Projektträger-Tag in Berlin, bei dem auch die auftraggebenden Ministerien zu Gast waren, sprach er mit Sascha Hermann, Geschäftsführer des Projektträgers VDI TZ, Klaus Uckel, Geschäftsleiter beim DLR-Projektträger (DLR-PT) und Jörn Sonnenburg, Stellvertretender Geschäftsleiter des DLR-PT. Forschungspolitiker Holger Becker, Berichterstatter für die SPD, zeigt sich ernüchtert. Noch im September 2023 hatte er das Ziel formuliert, sehr bald mit einem Roadmap-Prozess zur Reformierung der Projektförderung zu starten. Jetzt übt er deutliche Kritik an BMBF und BMWK.
Ungewohnt deutlich wurde am Montag auch der Grünen-Politiker Kai Gehring. Nachdem FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai am Sonntagabend seinem Parteichef Christian Lindner zur Seite gesprungen war, der von der Bundesregierung einen “Herbst der Entscheidungen” gefordert hatte, erklärte Gehring auf LinkedIn, er “empfehle dringend, dass gelb-geführte Häuser einen Beitrag dazu leisten”. Die FDP müsse dringend “Ministerin Stark-Watzinger zur beherzten Sacharbeit für unser Bildungs- und Forschungssystem zurückbewegen”. Seit Wochen sei das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) wegen der Fördergeldaffäre wie gelähmt, so der Vorsitzende des Forschungsausschusses weiter. Was Bettina Stark-Watzinger wohl dazu denkt? Am Donnerstag ist die “Fördermittel-Affäre” erneut Thema im Bundestag, die CDU-Fraktion hatte eine Große Anfrage dazu gestellt.
Die Situation um den Göttinger Universitätspräsidenten Metin Tolan spitzt sich zu, berichtet meine Kollege Markus Weisskopf. In einer Stellungnahme macht der Senat klar, dass der Präsident eigentlich nur noch eine Möglichkeit hat, seine Abwahl zu vermeiden – in dem er zuvor selbst seinen Rückzug erklärt. Doch es finden sich auch noch Unterstützer des umstrittenen Präsidenten.
Kommen Sie gut in den Tag,


Im Herbst 2023 hatten die Projektträger (PT) in ihrem Positionspapier “Administrative Fesseln der Innovationsförderung abstreifen: SPRIND-Freiheitsgesetz breiter denken” klare Forderungen an ihre Auftraggeber, die Bundesregierung und das federführende BMBF formuliert. Der Tenor: für eine zeitgemäße Innovationsförderung und effizienteren Transfer brauche es – wie bei der Sprind – schlanke und agile Auswahlverfahren, eine vereinfachte Rechts- und Fachaufsicht und eine flexiblere Finanzierung über die Jahresgrenzen hinweg.
Man sei es leid, immer als Verursacher von Bürokratie dargestellt zu werden, nur weil die administrativen Beschränkungen noch aus dem letzten Jahrhundert stammten, gaben die Verantwortlichen damals im Gespräch mit Table.Briefings zu Protokoll. Neidisch blickte man auf das Freiheitsgesetz, mit dem die Bundesregierung kurz zuvor ihrer Agentur für Sprunginnovationen die Fesseln gelöst hatte und verwies darauf, dass der Hebel durch Flexibilisierungen bei den Projektträgern wesentlich größer sei.
Die Reaktionen aus der Koalition und seitens des BMBF waren verhalten. Man verwies auf die Neu- und Andersartigkeit der Sprind und auf graduelle Reformen, etwa die Digitalisierung der Antragsverfahren. SPD-Berichterstatter Holger Becker formulierte das Ziel, noch im Jahr 2024 mit einem Roadmap-Prozess zur Reformierung der Projektförderung zu starten. Becker damals: “Wir sollten noch in dieser Legislatur das Rüstzeug herstellen, um in den Jahren danach mit der konkreten Umsetzung beginnen zu können.”
Spätestens seit dem Projektträger-Tag, der Mitte September in Berlin stattfand, und bei dem auch die auftraggebenden Ministerien zu Gast waren, lässt sich vorausschauen: Den großen Wurf wird es in dieser Legislaturperiode nicht mehr geben. So sieht es inzwischen auch Becker: “Leider sind hier keine substanziellen Weiterentwicklungen feststellbar. Seitens des BMBF habe ich dazu in den letzten Monaten keine neuen Vorschläge gesehen“, sagt der SPD-Politiker. Es fehle ihm sowohl vom BMBF als auch vom BMWK die Bereitschaft, über grundlegende Änderungen im System nachzudenken – die im Idealfall auch finanzielle Mittel freisetzen würden.
Klare Bekenntnisse gab es beim Jahrestreffen der PT im Virchowklinikum der Charité von den Ministerien lediglich zu Bürokratieabbau, Verschlankung und Beschleunigung der Antragsprozesse. Die Ministeriumsvertreter hätten sich auch Hinweise und Anregungen zur Gesetzgebung von Seiten des PT-Netzwerks (PT-Netz) ausdrücklich gewünscht – letztlich werde das Positionspapier damit implizit begrüßt, gibt sich Sascha Hermann, Geschäftsführer des Projektträgers VDI TZ im Gespräch mit Table.Briefings optimistisch.
Von den Auftraggebern sei dafür geworben worden, Mut zu haben, um Änderungen von Regelwerken und Gesetzen mitzudenken. “Diese Einladung zum vertieften Dialog nehmen wir gerne an”, sagt Klaus Uckel, Geschäftsleiter beim DLR Projektträger (DLR-PT). Explizite Bezüge zu den Positionspapieren der PT habe es zwar nicht gegeben, es sei aber der Eindruck entstanden, dass “unsere Gedanken und Vorschläge sehr wohl bei den Auftraggebern präsent sind“.
“Gehört haben wir auch den Wunsch ,arbeitet mit den Agenturen zusammen‘”. Man sei im Sinne der “Förderung aus einem Guss” dazu gerne bereit. “Noch leichter wäre die Zusammenarbeit allerdings, wenn wir im Interesse des Innovationssystems die gleichen Freiheiten eingeräumt bekämen wie Sprind und Dati”, ergänzt Jörn Sonnenburg, Stellvertretender Geschäftsleiter des DLR-PT.
Uwe Cantner, Vorsitzender der EFI-Kommission, schaltete sich auf dem PT-Tag mit einem Video-Impuls zu. Im Gespräch mit Table.Briefings gibt er zu bedenken, welche weitreichenden Konsequenzen eine großangelegte Reform der Projektträger nach sich ziehen würde. “Die Projektträger stellen sich immer so etwas wie die schwedische Innovationsagentur Vinnova für sich vor.” Diese agiere in vielen Bereich sehr selbstständig und setze selbst Politikmaßnahmen und -programme auf.
Wer Freiheiten wie die Sprind möchte, brauche unternehmerische Zuschnitte, die die PT bislang nicht hätten, da sie Verwalter zugewiesener Budgets seien. In der Schweiz, wo die Innosuisse auch für die Strategie der Innovationsförderung zuständig sei, sei das dazugehörige Ministerium – bezüglich der Beamtenzahl – sehr klein. “Wenn man den PT eine unternehmerische Rolle zubilligt, braucht man Beschäftigte mit Unternehmergeist und aus meiner Sicht auch sehr viel weniger PT”, sagt Cantner. Das zöge erhebliche Veränderungen nach sich und sei ein “schwieriges Unterfangen”.
Cantner fokussierte sich bei seinem Vortrag auf dem PT-Tag auf graduelle Änderungen des Aufgabenspektrums und der Arbeitsweise von PT. In seinem Impuls ging er passend zum Motto “Aus Ideen werden Innovationen” auf die deutsche Transferproblematik ein. Hier brauche es bereits bei der Initialisierung von Projekten und Konsortien ein gutes Verständnis und belastbare Netzwerke für das spätere Geschäftsmodell.
“An dieser Stelle sind die Aufgaben der PT in den Beauftragungen aus unserer Sicht aktuell noch zu eng gefasst”, sagt Jörn Sonnenburg. Man kenne die Verwertungspotenziale der Projekte und Akteure, die sich als Transferpartner anbieten. “Für diese können wir Brücken bauen, um sich zum richtigen Zeitpunkt für den nächsten Schritt in Richtung Verwertung mit dem richtigen Akteur zu vernetzen oder auch um ein anschlussfähiges Förder- oder Finanzierungsprogramm zu identifizieren. Man muss uns nur beauftragen.” Oft bestünden große Kulturunterschiede zwischen Hochschulen, Instituten und Unternehmen, was Mindset, Ziele, Inhalte, Verwertung und Sprache angehe: “Die PT sind oft die einzigen Übersetzer und Multiplikatoren”, meint Sascha Hermann.
Die zweite Botschaft, die vom Jahrestreffen ausging: “Wir werden digitaler und dadurch effizienter.” Mit dem Wegfall der grundsätzlichen Schriftformerfordernis im vergangenen Jahr und der schrittweisen Einführung der E-Akte habe man wichtige Schritte zum übergeordneten Ziel gemacht, ein rein digitales Antragsverfahren ohne Medienbrüche durchführen und anbieten zu können. Jetzt seien die digitale Vergabe des Förderbescheids und die Entwicklung eines zentralen Förderportals von Bund, Ländern und Kommunen die nächsten Schritte, heißt es von Seiten der PT.
Gegenüber neuen Innovationsagenturen wie der Sprind oder der Cyberagentur – künftig auch einer Dati – gibt man sich selbstbewusst und kooperationsbereit. “Ein Teil der von Projektträgern umgesetzten Projektförderung hat enge Bezüge, etwa zu den Sprind-Challenges. Der von Projektträgern umgesetzte Spitzencluster-Wettbewerb wird als Blaupause für den Aufbau regionaler Innovationsökosysteme durch die Dati herangezogen. Daher sehen wir viel Potenzial in einer engen Zusammenarbeit zwischen den Projektträgern und den Agenturen, vor allem, um aufgrund der jeweiligen speziellen Aufgaben das Transferpotenzial aus den Ergebnissen der Projektförderung wirksam zu heben”, sagt Klaus Uckel.
Von ihrer eigentlichen Aufgabe, über Unternehmensgründungen Sprunginnovationen herbeizuführen, sei die Sprind noch “weit entfernt”. Man sei deshalb auch gespannt auf die Ergebnisse der anstehenden Sprind-Evaluation. Sascha Hermann vom VDI TZ bedauert allerdings, wenn Aufträge für PT nicht öffentlich zugänglich seien oder ausgeschrieben werden. So wie bei der aktuellen Beauftragung der Sprind durch das BMDV. Holger Becker rät bei diesem Punkt zu etwas mehr Geduld. Die Sprind diene sinnvollerweise als Experimentierfeld, um bestimmte Dinge in Finanzierung und Management auszuprobieren. “Ich gehe auch davon aus, dass die Sprind etwas unbürokratischer und schneller agiert als der durchschnittliche PT. Im Idealfall lerne man neue Verfahren kennen, die dann auch die PT übernehmen könnten.

Die Situation rund um den Göttinger Universitätspräsidenten Metin Tolan spitzt sich zu. Bereits in den vergangenen Wochen berichteten verschiedene Medien über eine im Raum stehende Abwahl Tolans. Ende August sprach der Senat von einer tiefen Vertrauens- und Führungskrise in der Universität. Eine Wiederwahl Tolans im Jahr 2026 werde es nicht geben, hieß es zu diesem Zeitpunkt.
Nun, eine Woche vor der Sondersitzung des Senats am 2. Oktober, hat sich der Ton nochmals verschärft. In einer aktuellen Version der “Stellungnahme der Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder des Senats” mit Stand vom 21. September schreiben die Senatoren, dass ein frühzeitiger einvernehmlicher Übergang präferiert, aber nicht möglich war. Im Schreiben, das Table.Briefings vorliegt, heißt es: “In den Gesprächen mit dem Präsidenten Metin Tolan konnte zu unserem großen Bedauern kein alternativer Weg für einen konstruktiven Führungswechsel zum Wohle der Universität gefunden werden.”
Man appelliere weiterhin an Tolan, sich “dieser Option nicht zu verschließen. Ansonsten verbleibe dem Senat nur das Instrument der Abwahl nach § 40 NHG, um einen Führungswechsel in die Wege zu leiten”. Für die Abwahl müsste eine Mehrheit von mindestens zehn Senatoren “aufgrund ihrer Einschätzung der Situation und Abwägung aller Argumente und Sichtweisen” zur Entscheidung kommen, dass eine Fortführung in der aktuellen Form nicht sinnvoll sei. Einer solchen Entscheidung möchte der Senat eine Vertrauensfrage vorschalten.
Diese Formulierungen und die Tatsache, dass elf von dreizehn Senatoren die Stellungnahme unterstützen, zeigen, dass Tolan aus Sicht des Senats entweder selbst das Feld räumen muss oder nächste Woche durch den Senat abgewählt wird.
Der Senat scheint nun auch gewillt, im Zweifel einen Konflikt mit dem Stiftungsrat (entspricht in Göttingen dem Hochschulrat) sowie dem niedersächsischen Wissenschaftsminister Falko Mohrs auszutragen. Mohrs hatte Tolan noch vor kurzem sein Vertrauen ausgesprochen. Und auch der Stiftungsrat unter dem Vorsitz von Peter Strohschneider hatte keine Zustimmung zur Abwahl Tolans signalisiert. Allerdings kann der Senat in letzter Konsequenz den Stiftungsrat überstimmen.
Hintergrund der Krise an der Georg-August-Universität Göttingen sind laut der Stellungnahme des Senats schlechte Leistungsindikatoren sowie eine Verschlechterung der internen Organisation. Zu dem ersten Punkt führen die Autoren insbesondere das schlechte Abschneiden bei der Exzellenzstrategie an. Von fünf in der aktuellen Runde eingereichten Exzellenzclustern überstand kein einziges die erste Auswahlstufe. Damit hat die Universität auch keine Möglichkeit, im Rennen um die Exzellenzunis mitzuspielen – eigentlich der Anspruch in Göttingen.
Aber auch der Verlust von ERC-Grants wird dem aktuellen Präsidenten zur Last gelegt. Ebenso das schlechte Abschneiden bei den niedersächsischen Wissenschaftsräumen und den Niedersachsen-Professuren.
Im Bereich der internen Organisation bemängeln die Senatoren vor allem die mangelnde “zukunftsfähige Gesamtstrategie” der Universität. Daneben werden Mikromanagement, eine unzureichende Finanzsanierung und ein geringer Fortschritt bei der Verwaltungsoptimierung benannt. Dazu herrsche ein “zunehmendes Klima der Einschüchterung von Mitarbeitenden auf allen Ebenen, da Kritik persönlich nachgetragen wird”. Man bemängelt den “Verlust einer offenen Fehlerkultur und konstruktiver Kritik “.
Die Senatoren wollen dem Dialog mit den Dekanen entnommen haben, dass man “in der Problemanalyse weitgehend übereinstimmt und in Teilen ebenfalls geringes Vertrauen besteht, dass der Präsident für eine konkurrenzfähige Zukunft der Universität steht und diese erfolgreich aus der Krise führt”.
Gleichzeitig forderten jedoch sieben der 13 Dekane nach Tolan-kritischen Äußerungen der ehemaligen Senatssprecherin Margarete Boos einen “respektvollen Umgang” und eine faire Debatte. Zudem distanzierten sie sich “von diesen Vorwürfen sowohl in Bezug auf den Stil als auch den Inhalt“. Ob der Senat in seiner Stellungnahme also auch für eine Mehrheit der Dekane spricht, bleibt unklar. Und auch Teile der Professorenschaft stellen sich gegen eine direkte Abwahl Tolans.
Die Autoren der Stellungnahme kommen dennoch zu dem Schluss, dass die verbleibende Amtszeit des Präsidenten zu lang sei, um die anstehenden wichtigen Aufgaben ungelöst zu lassen. “Das Risiko ist zu groß, dass die Universität in 2,5 Jahren noch schlechter dasteht, interne Gräben vertieft werden und noch mehr Personal resigniert die Universität verlässt.”
Daraus ergibt sich für den Senat die oben benannte Vorgehensweise. In der nächsten Woche wird sich zeigen, ob Tolan von sich aus seinen Posten räumt. Oder ob es dann zu einer Abwahl auf der Sondersitzung am 2. Oktober kommt.
24. September 2024, 10:30 bis 16:15 Uhr, Haus der Commerzbank, Pariser Platz 1, 10117 Berlin
Forum Hochschulräte Starke Marken, klarer Kern: Strategische Schwerpunktsetzung und Markenbildung bei Hochschulen Mehr
25. September 2024, 8:00 bis 9:15 Uhr im BASECAMP, Mittelstraße 51-53, 10117 Berlin
Frühstücks-Austausch: Gipfel für Forschung und Innovation Follow-up Innovationen in Europa – Katalysatoren, Kompetenzen und Kooperationen am Beispiel von KI: Gespräch über Umsetzungsschritte für mehr Geschwindigkeit bei Innovation und Forschung Zur Anmeldung
25. September 2024, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU)
Jahreskolloquium des Bayerischen Wissenschaftsforums Transformationskompetenz in Wissenschaft und Hochschule Mehr
26. September 2024, 12:00 bis 13:00 Uhr, Webinar
CHE talk feat. DAAD KIWi Connect Transfer und Internationalisierung – Warum ist es sinnvoll, beides gemeinsam zu denken und was braucht es hierzu? Mehr
26./27. September 2024, Leopoldina, Jägerberg 1, 06108 Halle (Saale) und Online
Jahresversammlung 2024 der Leopoldina Ursprung und Beginn des Lebens Mehr
1. Oktober 2024, 19 Uhr, Bricks Club Berlin
Gesprächsreihe der Wübben Stiftung Wissenschaft in Kooperation mit der Jungen Akademie Christopher Degelmann: Fake News und Fleischkonsum in der Antike Mehr
3. /4. Oktober 2024, Universität Helsinki, Finnland
2024 EUA FUNDING FORUM Sense & sustainability: future paths for university finances Mehr
8. /9. Oktober 2024 an der TU Berlin
bundesweite Tagung zu Machtmissbrauch an Hochschulen “Our UNIverse: Empowered to speak up” Mehr
10. Oktober 2024 an der TUM School of Management, München
Konferenz AI@WORK – How AI is changing leadership, work and collaboration Mehr
11. Oktober 2024 an der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste, Düsseldorf
DHV-Symposium 2024 “Die ‘Große Transformation’ – ein Jahrhundertprojekt zwischen Realität und Utopie” Mehr
23. bis 25. Oktober 2024 am ETH AI Center in Zürich, Schweiz
Jahrestagung der Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft (GMW) und CampusSource Agilität und KI in Hochschulen Mehr
4. November 2024, 17 Uhr, Allgemeiner Fakultätentag e.V., Karlsruhe
Online-Podiumsdiskussion “Denken, Sprechen, Schreiben. Wie wichtig ist die Sprachkompetenz für das wissenschaftliche Arbeiten?” Mehr
7.-9. November 2024, Berlin
Konferenz Falling Walls Science Summit 2024 Mehr
Seit vergangener Woche ist bekannt: Der US-Konzern Intel verschiebt den geplanten Bau einer Chip-Fabrik in Magdeburg. Damit liegt nun eine Investition von insgesamt 30 Milliarden Euro auf Eis, ebenso die Entstehung von 3.000 Arbeitsplätzen.
Was der Bund mit den vorerst nicht benötigten zehn Milliarden Euro Zuschuss zu dem Prestigeprojekt anfangen wird, ist noch nicht geklärt. Hochschulen und Wissenschaft in Sachsen-Anhalt tangiert der Streit darüber nicht. Sie setzen weiterhin auf Halbleiter (siehe dazu auch unser Länder-Kompass Sachsen-Anhalt hier). Denn die Bundesmittel waren vornehmlich für den Bau und die Einrichtung der Chip-Fabrik vorgesehen. Wissenschaftliche Projekte waren mit diesen Mitteln nicht geplant.
Es gebe das schöne Sprichwort “aufgeschoben ist nicht aufgehoben”, sagt Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) auf Anfrage von Table.Briefings. “Ich bleibe zuversichtlich, dass Intel seine Fabrik in Magdeburg bauen wird – wenn auch mit zeitlicher Verzögerung.” Für die Universitäten und Hochschulen des Landes gebe es überhaupt keinen Grund, das Thema Halbleiter wie eine heiße Kartoffel fallen zu lassen.
“Halbleitern gehört die Zukunft, deshalb ist es richtig, Studiengänge und Forschungsvorhaben in diesem Zukunftsfeld anzubieten”, sagt Willingmann. Die Universitäten und Hochschulen des Landes würden daher ihre Studiengänge und Forschungskooperationen konsequent fortsetzen. “Absolventen in diesem Bereich werden in den kommenden Jahren beste Berufsperspektiven haben – nicht nur, aber hoffentlich auch bei Intel in Magdeburg.”
Auch ohne den kurzfristigen Bau der Chipfabrik sei eine Erweiterung der wissenschaftlichen Kompetenzen im Halbleiterbereich weiter notwendig, betont das Wissenschaftsministerium. Es gehe darum, unabhängiger von Playern etwa aus Fernost zu werden. abg
Wer erhält in diesem Jahr die Nobelpreise für Medizin, Physik, Chemie und Wirtschaft? Am 7./8./9. und 14. Oktober werden die Gewinner bekanntgegeben. Fürs qualifizierte Mitorakeln wird für gewöhnlich die Liste der besonders häufig zitierten Forschenden zu Rate gezogen, die das Unternehmen Clarivate alljährlich im Frühherbst veröffentlicht. Für das Jahr 2024 wurden jetzt 22 Citation Laureates bekanntgegeben. Das sind die wichtigsten Köpfe und Erkenntnisse:
Clarivate brüstet sich damit, seit 2002 bereits 75 Nobelpreisträger identifiziert zu haben – oft mehrere Jahre, bevor sie gekürt wurden. Der Citation Award wird seinem Ruf als Indikatorpreis demnach gerecht. Allerdings muss man auch vorherige “Jahrgänge” durchforsten, um für das aktuelle Jahr richtig zu liegen. Benjamin List, Chemienobelpreisträger 2021, war zum Beispiel bereits 2009 Citation Laureate.
Für die Citation Awards werden die Daten des Web of Science Citation Index analysiert. Aus den mehr als 61 Millionen Artikeln, die seit 1970 im Web of Science indexiert wurden, wurden nur etwa 9.000 (0,01 Prozent) 2.000-mal oder häufiger zitiert. Diese quantitative Analyse wird durch eine qualitative flankiert. Sie berücksichtigt prestigeträchtige Auszeichnungen wie die Lasker-Preise in der Biomedizin. abg

Die Forschungs- und Innovationsminister der G20-Staaten trafen sich in der vergangenen Woche in Brasilien. Für Deutschland reiste Staatssekretär Jens Brandenburg nach Manaus an. Das Hauptthema des Ministertreffens war die internationale Zusammenarbeit in Wissenschaft und Innovation für eine nachhaltige Entwicklung, insbesondere unter dem Aspekt von “Open Innovation”.
Themen des diesjährigen G20-Wissenschaftstreffens waren:
Die Minister betonten, dass Forschung und Innovation eine Schlüsselrolle bei der Bekämpfung des Biodiversitätsverlustes, der Umweltverschmutzung und der Gesundheitsförderung spielen.
Abschließend wurde das “Manaus-Paket” verabschiedet, das verschiedene Maßnahmen und Partnerschaften umfasst, darunter die G20-Strategie für offene Innovation und Empfehlungen zur Inklusion in Wissenschaft und Technologie. Das nächste Treffen soll 2025 unter südafrikanischem Vorsitz stattfinden. mw
Die durchschnittlichen Wohnkosten für Studierende sind gegenüber dem Vorjahr kaum gestiegen (plus drei Prozent / 17 Euro). Sie bleiben aber auf einem sehr hohen Niveau von jetzt durchschnittlich 489 Euro. Das ergibt eine Auswertung des Moses Mendelssohn Instituts (MMI) in Kooperation mit WG-Gesucht.de, die das Institut regelmäßig durchführt. Im Wintersemester 2013/14 lagen die Wohnkosten im Durchschnitt noch bei 324 Euro.
Die Analyse bezieht alle 88 Hochschulstandorte in Deutschland mit mindestens 5.000 Studierenden (ohne Fern- und Verwaltungshochschulen) ein. Sie untersucht dabei unbefristete Angebote für Zimmer in Wohngemeinschaften mit zwei bis drei Personen. In diesen Städten sind 91 Prozent der rund 2,7 Millionen Studierenden eingeschrieben.
“Nach dem Auslaufen der Covid-19-Pandemie und dem Angriff Russlands auf die Ukraine sind die Wohnkosten extrem gestiegen”, sagte der Geschäftsführende Direktor des Instituts und Projektleiter Stefan Brauckmann. Die Wohnkosten lagen in diesem Zeitraum deutlich oberhalb der allgemeinen Teuerungsrate. “Jetzt können wir eine Erholungsphase erkennen.” Angespannt bleibt die Lage trotzdem, insbesondere in nachgefragten Hochschulstädten.
In 37 der untersuchten Standorte, in denen etwa die Hälfte der Studierenden eingeschrieben ist, lassen sich kaum WG-Zimmer finden, die nicht über der Wohnkostenpauschale nach Bafög liegen. Die Pauschale wurde zu Beginn des Wintersemesters von 360 auf 380 Euro erhöht. In Berlin liegt der Durchschnittspreis für das Wintersemester bei 650 Euro, in München bei 790 Euro, in Köln bei 600 Euro und in Hamburg bei 620 Euro. Drei Viertel der Studierenden sind in einer Stadt eingeschrieben, in der der Durchschnittspreis für ein WG-Zimmer über der Wohnkostenpauschale von 380 Euro liegt.
Damit es künftig mehr bezahlbaren Wohnraum für Studierende und Azubis gibt, hält Stefan Brackmann öffentliche Förderprogramme für preis- und belegungsgebundenen Wohnraum für zwingend notwendig. Die Wohnkostenpauschalen sollten zudem an den Studienort angepasst werden. Er sagte: “An vielen Standorten wird deutlich, dass selbst gemeinnützige Träger, wie die Studierendenwerke, in den mit öffentlicher Förderung errichteten Neubauwohnheimen nur schwer Endkundenpreise anbieten können, die innerhalb der neuen Bafög-Wohnkostenpauschale liegen.” Durch verschiedene Maßnahmen müssten die Baukosten dringend gesenkt werden. Anna Parrisius
Welt: Wo Deutschland international an der Spitze steht. Es steht wirtschaftlich nicht gut um Deutschland, und auch bei einigen Technologien hängt das Land hinterher. Trotzdem sollte man nicht aus den Augen verlieren, dass es auch Branchen gibt, in denen Deutschland weltweit führt. Im Maschinenbau, aber auch bei Biopharma, stehen Unternehmen aus Deutschland zum Teil an der Weltspitze. (“Deutschland weltweit führend – Die vergessene Stärke des Standorts D”)
Schwäbische Zeitung: Nischenfächer gehören zu Volluniversitäten dazu. Der Rechnungshof Baden-Württemberg hat im Sommer das Land aufgefordert, auch im Wissenschaftsbereich genau hinzuschauen, für welche Fächer Geld ausgegeben wird. Gemeint waren damit Nischenfächer, die nicht viele Studenten anziehen. Die Universität Tübingen reagierte nun auf den Rechnungshof und stellte klar, dass auch Fächer wie Ägyptologie für eine Volluniversität, in der interdisziplinär gearbeitet wird, wichtig sind. (“Nischenfächer: Forscher kontern Rechnungshof-Kritik”)
DLF: Forschung an seltenen Krankheiten in Gefahr. Die Forschung zu seltenen Erkrankungen könnte unter Kürzungen im Bundeshaushalt leiden. Dies könnte Patientenregister und klinische Netzwerke gefährden, die Voraussetzung für die Entwicklung von Therapien sind. Von den seltenen Krankheiten sind in Deutschland mit bis zu vier Millionen Menschen nicht wenige betroffen. (“Forschung an seltenen Erkrankungen fürchtet Förderstopp”)
Heise: Starlink-Satelliten bedrohen die Forschung. Allein 6.400 Satelliten hat Starlink in die Umlaufbahn geschossen, und SpaceX ist nur eines von vielen Unternehmen, die im Satellitengeschäft aktiv sind. Bis 2030 könnten 100.000 Satelliten die Erde umkreisen. Vor allem die starke Kommunikationssignale sendenden Starlink-Satelliten wirken sich schon heute auf die Forschung mit Radioteleskopen aus. (“Wissenschaftler: Neue Starlink-Satelliten bedrohen astronomische Forschung”)
Vox: Das Problem der Wissenschaft mit ihrem Kurzzeitgedächtnis. Vor allem junge Wissenschaftler verlassen immer schneller ihre Projektgruppen. Die von ihnen geleistete Arbeit kann dabei in Vergessenheit geraten. Eine langfristigere Finanzierung, die Wissenschaftler auch an ihren Einrichtungen hält, könnte Abhilfe schaffen. (“Science has a short-term memory problem”)
Nature: Die USA und China wollen weiterhin wissenschaftlich kooperieren. Seit 1979 kooperieren die USA und China im wissenschaftlichen Bereich. Allerdings hat sich das Verhältnis zwischen den beiden Staaten in den vergangenen Jahren stark verschlechtert. Die Zusammenarbeit könnte nun fortgesetzt werden, allerdings vor allem in den Bereichen Klimawandel, öffentliche Gesundheit und Nahrungsmittelsicherheit. (“US and China inch towards renewing science-cooperation pact – despite tensions”)
Süddeutsche Zeitung: Forschung mit Datenspende unterstützen. Durch die Nutzung von Apps und Wearables sammeln Menschen mehr Daten über sich selbst als je zuvor. Dies kann ihnen nicht nur persönlich helfen, sondern auch der Forschung von großem Nutzen sein. Während der Corona-Pandemie haben Datenspenden wertvolle Erkenntnisse geliefert. Jetzt unterstützen sie Wissenschaftler dabei, die Schlafgewohnheiten besser zu verstehen. (“Wie Daten von Fitnesstrackern und anderen Wearables die Forschung voranbringen können”)

Hochschule war vor allem im wissenschaftlichen Bereich traditionell schon immer ein Ort größerer Freiheit bezüglich der Wahl von Arbeitszeit und -ort. In jüngerer Vergangenheit ist diese Freiheit auch auf den Verwaltungsbereich ausgeweitet worden. Im Zuge der Corona-Pandemie erlassene Regelungen zum mobilen Arbeiten wurden vielerorts in feste Dienstvereinbarungen überführt. Parallel dazu hielten neue Arbeitsweisen Einzug an den Hochschulen.
Die räumliche Distanz erforderte eine veränderte Art von Arbeit, aber auch von Führung, vielfach angelehnt an die Ideen der New Work und damit einhergehend mit mehr Eigenverantwortung und größeren Entscheidungsspielräumen für Beschäftigte.
Auch der Fachkräftemangel und der Kampf um Talente setzt den Hochschulen in ihrer Funktion als Arbeitgeber zu. Sie stehen einerseits in Konkurrenz untereinander, sehen sich aber auch im Wettbewerb mit der Wirtschaft, die häufig mit besseren Gehältern und besserer Arbeitsausstattung locken kann. Denn die Spielräume in der Entlohnung Beschäftigter sind an den Hochschulen durch die Tarifbindung eng gesteckt, die Ressourcen zur Gestaltung im baulichen Bereich sind limitiert.
Zusätzlich sind Entscheidungswege an Hochschulen andere. Wo das Prinzip der Freiheit von Forschung und Lehre gilt, sind Top-Down-Maßnahmen, wie sie in vielen Wirtschaftsunternehmen angewendet werden, angesichts anderer Machtverhältnisse nur schwerlich umsetzbar. Fläche ist nach wie vor vielfach Bestandteil von Berufungsverhandlungen, nach dem Grundsatz “je mehr (Repräsentations-)Fläche, desto mehr Prestige”.
Die aus der Klima- und Energiekrise abgeleiteten Handlungsnotwendigkeiten üben zusätzlich Druck auf die Hochschulen aus. Dies betrifft auch den Umgang mit Flächen und Räumen, gehen diese doch einher mit Flächenverbrauch und massiven CO2-Emissionen in Erstellung und Bewirtschaftung.
Bund und Länder sind in diesem Punkt in jüngerer Zeit aktiv geworden und haben Vorgaben zur effizienten Raumnutzung erlassen, die in vielen Bundesländern auch die Hochschulen betreffen (wenn hier vorerst auch nur im Neubau). Weil sich Homeoffice etabliert hat, wird in diesem Zusammenhang eine Reduzierung von Büroarbeitsplätzen in öffentlichen Gebäuden, und damit auch in Hochschulen, angestrebt.
Die Bundesländer setzen diese Einsparbemühungen derzeit unterschiedlich um. An den Hochschulen ist bisher im Wesentlichen die Hochschulverwaltung betroffen. Die Quote der Beschäftigten, für die vor Ort ein Arbeitsplatz vorgehalten werden soll, schwankt zwischen 70 und 90 Prozent. Dies führt in der Konsequenz zur Notwendigkeit einer Einführung von Desk-Sharing, da nicht mehr für alle beschäftigten Personen zeitgleich Plätze zur Verfügung stehen.
Hier ist gutes Change-Management gefragt, denn der persönliche Arbeitsplatz ist für viele Beschäftigte identitätsstiftend und in den meisten Fällen war bisher eine dauerhafte Belegung trotz Homeoffice weiterhin möglich. Dabei bewegt man sich im Bürobereich nach wie vor überwiegend in tradierten Raumstrukturen. Klassische Einzel-, Doppel- oder Mehrpersonenbüros werden in der Regel ergänzt durch Besprechungsräume und Teeküchen. Dies entspricht dem Bild eines Büros mit überwiegend Vollzeit anwesend Beschäftigten
Vernetzung und informelle Gespräche finden in diesem Setting bei zufälligen Begegnungen auf den Fluren, an der Kaffeemaschine oder beim gemeinsamen Mittagessen statt. Wenn viele Beschäftigte nur zeitweise und anlassbezogen vor Ort sind, sind solche tradierten Raumstrukturen aber nicht mehr sinnvoll.
Einem Vernetzungsgedanken stehen sie sogar diametral entgegen. Auch die Art und Weise, wie gearbeitet wird, beeinflusst den Raumbedarf. Die Anteile an Kommunikation, Kollaboration und Stillarbeit variieren im Verlauf der individuellen Tätigkeit, wie auch zwischen den verschiedenen Positionen.
Entsprechend liegt es nahe, räumliche Angebote zu schaffen, die den Bedarfen der Beschäftigten in besserer Art und Weise und in unterschiedlichen Phasen eines Arbeitsprozesses entsprechen und ihre Arbeit bestmöglich unterstützen. Dies erfordert ein Überdenken und Anpassen der tradierten Raumstrukturen, um förderlichere Büroarbeitsumgebungen einhergehend mit Flächenoptimierung realisieren zu können.
Auf diese Aspekte ist dabei zu achten:
Die Vorgaben der Länder zur Flächensuffizienz, die Veränderungen und Anpassungen notwendig machen, stellen eine günstige Gelegenheit dar, bisherige Strukturen und Raumnutzungskonzepte zu reflektieren und nach realisierbaren Verbesserungen zu suchen. Im Idealfall erreichen Hochschulen so eine höhere Zufriedenheit der Mitarbeitenden mit ihrer Büroarbeitsumgebung und stellen ihren Flächenbestand zeitgleich attraktiv, zukunftsfähig und nachhaltig auf.
Inka Wertz ist Hochschulplanerin und Projektleiterin am HIS-Institut für Hochschulentwicklung e.V. in Hannover. Im Fokus ihrer Arbeit steht die Anpassung hochschulischer Flächen an die Anforderungen neuen Lehrens, Lernens und Arbeitens. Darum geht es auch in der Online-Veranstaltung “Home. Office. Hochschulbau. Herausforderungen und Chancen” am 30. Oktober.
Der Standpunkt ist Teil einer Table.Briefings-Serie zum Thema Hochschulbau. Um veränderte Raumkonzepte ging es auch in Teil 4 hier. Eine Übersicht über alle bisherigen Beiträge finden Sie hier.
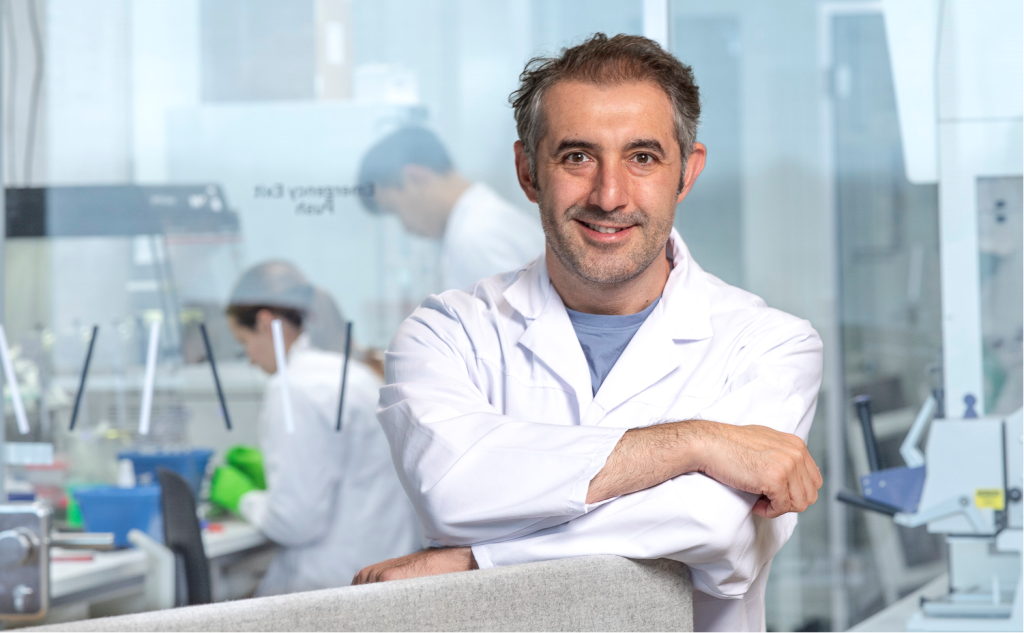
Tierversuche sind die Achillesferse der Wissenschaft: Sie sind gesellschaftlich hoch umstritten, langwierig und teuer. Weltweit suchen Forschende deshalb fieberhaft nach Alternativen – so wie Ali Maximilian Ertürk vom Helmholtz-Zentrum München. Seine Lösungsidee hat Pioniercharakter – und führt ihn im November zum Falling Walls Science Summit in Berlin. Denn er gehört zu den Finalisten des Breakthrough of the Year-Award in der Kategorie Life Sciences.
Um das bahnbrechende Potenzial zu erfassen, ist es vielleicht am einfachsten, sich einen Science-Fiction-Film vorzustellen: Die Technologie dort ist so weit ausgereift, dass ganze Organismen mitsamt ihren biologischen Prozessen und Krankheitsverläufen in virtuellen Umgebungen simuliert werden können. Geforscht wird also etwa nicht direkt an einem Lebewesen, sondern an einer digitalen Simulation, die zuvor mit hochauflösenden Bilddaten erstellt wurde. Auf ihren Screens sehen Forschende, wie und wo sich Krankheiten im Detail auswirken und wie potent neue Arzneimittel sind.

Genau das in der realen Welt irgendwann möglich zu machen, ist Ertürks Ziel. Erreicht er es, könnten nicht nur sehr viele Tierversuche vollständig ersetzt werden. Wissenschaftliche Entdeckungen würden erheblich beschleunigt und die Medikamentenentwicklung revolutioniert. Wie wirken sich Erkrankungen des Gehirns auf das Nervensystem aus? Welche Folgen hat das Rauchen für den ganzen Körper, nicht nur auf die Lunge?
Bei der Suche nach Antworten ist Ertürk mit seinem Team bereits entscheidende Schritte vorangekommen. Ganze Mäusekörper und menschliche Organe können sie im Labor transparent machen und in einer völlig neuen Detailgenauigkeit scannen. Als ihnen das zum ersten Mal gelang, sei das “aufregend” gewesen, sagt Ertürk rückblickend.
So lapidar das auch klingt, die Fachwelt horchte auf. “Einige Forscher bezeichnen seine Pläne als “weit hergeholt”, andere verwenden weniger freundliche Beschreibungen”, schrieb Nature vor einigen Jahren. Er selbst bezeichnete sich damals als “Träumer”. Doch auch das trifft es vielleicht nicht ganz. Der Neurowissenschaftler und Biotechnologe ist eher ein Grenzgänger zwischen wissenschaftlichen Disziplinen, zwischen Forschung, Innovation, Wirtschaft und – ja: Kunst.
1980 in der Türkei geboren und aufgewachsen, studierte Ertürk an der Bilkent University in Ankara. In ein Flugzeug stieg er erstmals als Student. Ein Sommerpraktikum in den USA war der Grund für die erste Fernreise. Ihr sollten viele folgen. Nach der Promotion am Max-Planck-Institut für Neurobiologie in München arbeitete Ertürk als Postdoc im US-amerikanischen Biotech-Unternehmen Genentech in San Francisco.
2019 kehrte er nach Deutschland zurück, wurde Direktor des Instituts für Tissue Engineering and Regenerative Medicine (ITERM) am Münchner Helmholtz-Zentrum und Professor der Ludwig-Maximilians-Universität. Ein Jahr später erhielt er den renommierten ERC Consolidator Grant des europäischen Forschungsrats ERC. Insgesamt 22,5 Millionen Euro an Fördermitteln akquirierte der Wissenschaftler nach eigenen Angaben in den vergangenen sieben Jahren. Er hielt mehr als 100 Vorträge und gründete zwei Firmen: Deep Piction und 1×1 Biotech GmbH.
All das hört sich nach jemandem an, der für Forschung und Entwicklung lebt. Aber Ali Maximilian Ertürk ist, wie gesagt, auch noch Künstler. Seine fotografischen Arbeiten wurden mittlerweile in drei Ausstellungen gezeigt und haben eine Fangemeinde von rund 37.000 Menschen.
Gute Mentoren, freundschaftliche Beziehungen im Team, Kommunikationsstärke, Mut und der Ehrgeiz, sich selbst immer weiter zu verbessern, sind für Ertürk die Faktoren, die für Karrieren in der Wissenschaft entscheidend sind. Und Spaß. Denn: “In der Wissenschaft geht es nicht nur um das Ziel, sondern auch um den spannenden Weg der Entdeckung”, erklärte Ertürk im Falling-Walls-Interview. Christine Prußky
Beim Falling Walls Science Summit 2024, der vom 7. bis 9. November in Berlin stattfindet, ist Ali Maximilian Ertürk unter den Finalisten für den Breakthrough of the Year in der Kategorie Life Sciences. Weitere Porträts der Table.Briefings-Serie “Breakthrough-Minds” finden Sie hier.
Jutta Allmendinger, Professorin an der Humboldt Universität und der Freien Universität Berlin, und Alena Buyx, Professorin für Ethik in der Medizin und Gesundheitstechnologien an der Technischen Universität München, sollen in den Wissenschaftsrat berufen werden. Das haben die Chefinnen und Chefs der Staats- und Senatskanzleien der Länder empfohlen.
Eva-Lotta Brakemeier, Professorin für Klinische Psychologie und Psychotherapie an der Universität Greifswald und Direktorin des Zentrums für Psychologische Psychotherapie (ZPP), ist neue Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Psychologie. Sie tritt die Nachfolge von Stefan Schulz-Hardt an. Seit Anfang 2024 gehört Brakemeier dem Wissenschaftsrat an.
Erin Schuman, US-amerikanische Hirnforscherin, ist mit dem Körber-Preis für die Europäische Wissenschaft ausgezeichnet worden. Die Wegbereiterin der Neurobiologie bekam die mit einer Million Euro dotierte Auszeichnung für die Entdeckung der lokalen Proteinsynthese im Gehirn. Dieser Mechanismus ist die Grundlage für das Lernen und Erinnern. Schuman ist seit 2009 Direktorin am Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt am Main. Neben ihrer Forschung engagiert sie sich für die Erhöhung des Frauenanteils in der Wissenschaft.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an research@table.media!
China.Table. Autonomes Fahren: Welche Technik die USA aus China verbieten wollen. Die USA befürchten, dass autonome Fahrzeuge Daten über US-amerikanische Fahrer und die Infrastruktur des Landes erheben und an China weiterleiten. Das US-Handelsministerium steht kurz davor, einen Vorschlag für neue Regulierungen vorzulegen. Mehr
Europe.Table. Glasfaser: EIB fördert Ausbau in ländlichen Regionen Deutschlands. Die Deutsche Glasfaser erhält ein Darlehen von 350 Millionen Euro von der Europäischen Investment Bank zum Breitbandausbau in ländlichen Gebieten Deutschlands. Aktuell verfügen nur rund 35 Prozent der Haushalte in Deutschland über Glasfaseranschlüsse. Mehr
Security.Table. Konrad-Adenauer-Stiftung “pausiert” langjährige Kooperation mit palästinensischem Umfrageinstitut. Nach Manipulationsvorwürfen von Seiten des israelischen Militärs hat die Konrad-Adenauer-Stiftung die Kooperation mit dem Palästinensischen Zentrum für Politik- und Umfrageforschung (PCPSR) “pausiert”. Die vierte Umfrage zur politischen Haltung und sozialen Situation der Menschen in den palästinensischen Gebieten seit dem 7. Oktober ist dennoch erschienen. Mehr
Europe.Table. Meta kritisiert unklare Gesetzeslage für KI in Europa. In Europa seien klare Regeln für den Umgang mit KI nötig, fordert der Konzern Meta. Bislang bestehe eine große Unsicherheit. Das könne dazu führen, dass Meta nicht alle Produkte in Europa anbietet. Mehr
Berlin.Table. US-Wahlen: Wie Kamala Harris die Frauen für sich gewinnt. Bei den US-Wahlen zeichnet sich ein massiver Gender-Gap ab. Gerade in den Swing States will eine deutliche Mehrheit der Frauen Kamala Harris ihre Stimme geben. Sie hat das Recht auf Abtreibung zum zentralen Bestandteil ihrer Kampagne gemacht und so Donald Trump in die Defensive gedrängt. Mehr

Über das, was Redakteure am Sonntagnachmittag machen, berichten wir im Research.Table normalerweise nicht. Doch da sich der aktuelle Ausflug unter den Titel Scienceseeing stellen lässt und das Ziel auch nicht jede Woche zu erreichen ist, wollen wir einmal eine Ausnahme machen. Es ging nämlich hoch hinaus, sogar bis ins All. Also nicht wortwörtlich, aber schon sehr nah dran. Im Steven F. Udvar-Hazy Center in der Nähe des internationalen Flughafens Dulles – der US-Hauptstadt Washington DC – kann man nämlich so nah an etwas herankommen, das schon einmal im Weltraum war, wie sonst wohl nur selten.
In dem Ausstellungshangar, der zum National Air and Space Museum gehört, steht unter anderem das Space Shuttle “Discovery”. Und zwar nicht irgendeine Nachbildung, sondern exakt das Space Shuttle, das das Teleskop Hubble 1990 in den Weltraum transportiert hat. Man erkennt es besonders gut an den thermischen Kacheln an der Unterseite. Die sind nämlich beim Wiedereintritt in die Atmosphäre ganz schön ramponiert worden. Da fühlt man sich nicht nur angesichts der Maßstäbe dieser Raumfahrt-Legende plötzlich ganz klein am Boden der Smithsonian Institution.
Aber es wären nicht die USA, wenn das hier der einzige Moment wäre, wo man mit offenem Mund in einem Museum steht. Eine Halle weiter – zunächst neben einer Original-Concorde nicht weiter auffällig – ein silbrig glänzendes Exemplar des US-Weltkriegbombers B 29. Natürlich auch: ein Original. Und zwar jenes, mit dem am 6. August 1945 die Atombombe über Hiroshima abgeworfen wurde. Schluck. Der Museumsführer versucht sich an einer kleinen Anekdote: Flugzeug-Kapitän Colonel Paul W. Tibbets, jr. habe vor dem Abflug geahnt, dass die Maschine im Museum landet und daher den Namen seiner Mutter außen ans Cockpit schreiben lassen. Der Schriftzug ist heute noch gut erkennbar: Enola Gay. Drama können die Amerikaner. Tim Gabel
