in der Pandemie war wissenschaftliche Politikberatung so gefragt wie nie. Auch die Klimakrise zeigt die Bedeutung unabhängiger, evidenzbasierter Informationen. In unserer neuen Serie “Politikberatung, quo vadis?” beleuchten wir das Thema von allen Seiten. Wir stellen wesentliche Akteure vor, sammeln Ideen und blicken auf die Szene der Politikberater in anderen Ländern. Die Bestandsaufnahme zum Auftakt zeigt: In Deutschland ist diese besonders unübersichtlich. Das bestätigt auch der Schweizer Experte Caspar Hirschi.
Der Bedarf für unabhängige Expertise zeigt sich auch im Streit um das Renaturierungsgesetz der EU. Mehr als 6.000 Forschende warnen in einem Offenen Brief vor irreführenden Behauptungen. Mehr darüber lesen Sie in den News.
Um bedrohte Natur geht es auch beim Tiefseebergbau. Leonie Düngefeld erläutert die Chancen einer vorsorglichen Pause, wie sie die EU jetzt vorschlägt. Um mehr Initiative geht es hingegen in den gestern veröffentlichten Empfehlungen des Wissenschaftsrats. Wie die breitere Verankerung der Geschlechterforschung erfolgen könnte, hat Markus Weisskopf zusammengefasst.
Wir wünschen Ihnen erkenntnisreiche Lektüre,
Wenn Ihnen der Research.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail weitergeleitet wurde: Hier können Sie sich für den Research.Table kostenlos anmelden.

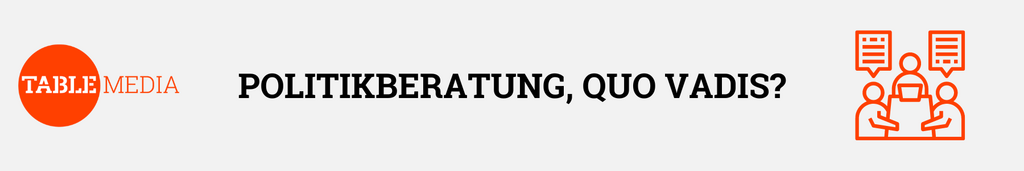
In der Szene der wissenschaftlichen Politikberatung tummeln sich viele Akteure, ihre Zuständigkeiten sind unscharf bis unklar. Das räumen selbst Insider ein. Aus der Außenperspektive ist die Diagnose ähnlich: Das Feld sei in Deutschland besonders unübersichtlich, sagt der Schweizer Historiker Caspar Hirschi, der das hiesige Geschehen intensiv verfolgt, im Gespräch mit Table.Media. “Es gibt eine enorme Vielfalt an Beratungsgremien und Beratungsstrukturen. Zusätzlich verkomplizierend wirkt der Föderalismus mit einem exklusiven Beratungssystem für den Bund und einer Vielzahl für die Länder.” Dies führe zu heftiger Beratungskonkurrenz.
Durch die Krisenkaskaden hat wissenschaftliche Politikberatung an Renommee gewonnen, sagt Historiker Hirschi.”Lange Zeit galt sie eher als Betätigungsfeld für Leute, die nicht mehr wussten, was sie in der Forschung Gutes leisten konnten.” Dabei seien die Aufgaben sehr anspruchsvoll und spezifisch. Bisher jedoch gebe es keine Ausbildungsgänge in Expertise. “Erste Weiterbildungsangebote für Forschende in wissenschaftlicher Politikberatung werden aufgebaut”, sagt Hirschi. In der Schweiz etwa das Franxini-Projekt und das Science-Policy-Interface der ETH Zürich.
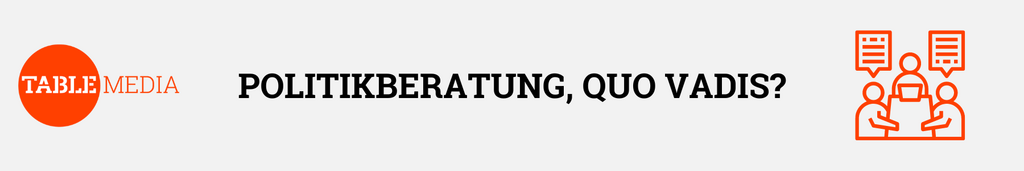
“Der Bedarf für wissenschaftliche Expertise ist stärker denn je”, sagt Chelioti. Die Helmholtz-Gemeinschaft und ihre 18 Zentren förderten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Expertise für und Interesse an Politikberatung haben. Auch in der Helmholtz-Akademie für Führungskräfte sei Politikberatung ein wichtiges Thema. “Wissenschaftliche Politikberatung in Deutschland ist dabei, sich in ihren Strukturen und Zugängen stetig weiter zu professionalisieren”, bestätigt Christian Kobsda, der das Berliner Büro der MPG leitet. Ihn freut es, dass sich Wissenschaftler auch schon in frühen Karrierephasen produktiv in den Dialog einbringen.
Fast alle, die sich mit wissenschaftlicher Politikberatung befassen, wünschen sich besseren Überblick. “Dadurch, dass die Beratung so dezentralisiert ist, ist es auch sehr mühsam, sich zu einzelnen Themen einen Überblick über das Spektrum der Stellungnahmen und Policy Paper zu verschaffen”, sagt Nataliia Sokolovska. Was sie ebenfalls vermisst, sind übergreifende Qualitätsstandards – etwa zur transparenten Kommunikation von Unsicherheiten oder zum unterschiedlichen Umgang mit begutachteten und nicht-begutachteten Studien.”
Hirschi zufolge wäre schon viel gewonnen, sich auf Verfahren zu einigen, mit denen man zu Beginn einer akuten Krise Expertengremien einsetzt. Wenn selbst involvierte Personen die Beratungslandschaft nicht mehr überblicken, komme es zum “Ad-hoc-Ismus”,warnt er. “Man greift zum Telefon, ruft die Leute an, die einem als Erstes in den Sinn kommen, und improvisiert einen Rat oder eine Taskforce zusammen.”
Das ausführliche Gespräch mit Caspar Hirschi finden Sie hier. In Teil 2 der Serie lesen Sie: “Die wichtigsten Konzepte für Politikberatung”.
Weitere Informationen:
Das Franxini-Projekt in der Schweiz
Beitrag in Elephant in the Lab über Internationale Strukturen der Politikberatung
200 Meter unter dem Meeresspiegel beginnt die Tiefsee, das größte Ökosystem des Planeten und Lebensraum von Millionen Arten. Viele von ihnen sind noch nicht erforscht. In Gestein, Krusten und Knollen lagern in 2.000 bis 6.000 Metern Tiefe noch weitere Schätze: Mangan, Eisen und Metalle wie Kobalt, Nickel und Kupfer – Rohstoffe, die von der EU-Kommission als strategisch bedeutsam eingestuft werden, für Digitalisierung, Energie- und Mobilitätswende als auch für eine stärkere Unabhängigkeit von Importen aus Ländern wie China.
Über den möglichen Abbau dieser Rohstoffe in der Tiefsee verhandelt seit Sonntag erneut die Internationale Meeresbodenbehörde (ISA) in Kingston, Jamaika. 2021 hatte der pazifische Inselstaat Nauru, der gemeinsam mit der kanadischen The Metals Company (TMC) die weltweit erste Lizenz für den Abbau von Manganknollen beantragen will, die sogenannte Zwei-Jahres-Klausel des internationalen Seerechts ausgelöst. Die ISA musste demnach innerhalb von zwei Jahren ein Regelwerk vorlegen. Diese Frist ist nun abgelaufen, mit einer Regulierung noch in diesem Jahr ist jedoch nicht zu rechnen.
Die Versammlung der ISA-Mitglieder – 167 Staaten plus die EU – könnte theoretisch ein Moratorium für den Tiefseebergbau implementieren, welches gelten würde, bis die Erforschung der Bergbaufolgen weiter fortgeschritten und die Regeln festgelegt sind. Forschenden zufolge könnte das aber noch Jahrzehnte dauern. Das Moratorium schlägt etwa eine Gruppe um Frankreich und Chile vor. Frankreich fordert ein komplettes Verbot von Tiefseebergbau, die Assemblée Nationale stimmte Anfang des Jahres für ein Verbot in den französischen Gewässern.
Die deutsche Bundesregierung bemüht sich seit vergangenem Jahr um eine “vorsorgliche Pause”. “Tiefseebergbau würde die Meere weiter belasten und Ökosysteme unwiederbringlich zerstören”, erklärte Bundesumweltministerin Steffi Lemke. Deutschland befürworte die weitere Erforschung der Tiefsee, werde aber bis auf Weiteres keine Anträge auf kommerziellen Abbau von Rohstoffen unterstützen, sagte Franziska Brantner, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium.
Dies entspricht auch der Position der EU: Die Kommission hatte sich 2021 in ihrer Agenda für die internationale Meerespolitik für eine vorsorgliche Pause ausgesprochen. Die EU werde sich für ein Verbot des Tiefseebergbaus einsetzen, bis die wissenschaftlichen Lücken geschlossen, schädliche Auswirkungen ausgeschlossen seien und die ISA Regeln für einen wirksamen Schutz der Meeresumwelt entwickelt habe. Dies hatte auch das EU-Parlament gefordert, unter anderem in seinem Initiativbericht für die EU-Rohstoffstrategie.
Immer mehr Mitgliedstaaten schließen sich dieser Position an, zuletzt Irland und Schweden. Jedoch nicht alle: Die norwegische Regierung gab Ende Juni bekannt, ein Gebiet in nationalen Gewässern für Bergbauaktivitäten freizugeben und eine Strategie für den Tiefseebergbau zu entwickeln. Norwegen erhofft sich jedoch die Entwicklung eines neuen Wirtschaftszweigs jenseits der Öl- und Gasindustrie und will “weltweit führend” in einer nachhaltigen und verantwortungsvollen Bewirtschaftung der Bodenschätze am Meeresboden werden. Über den Vorschlag muss zunächst noch das norwegische Parlament abstimmen.
Angesichts der Prognosen für den weltweit massiv steigenden Bedarf an Rohstoffen für die Energie- und Mobilitätswende scheinen die Schätze am Meeresboden auch für weitere Länder vielversprechend. Nach einem Test zur Ausgrabung einer kobaltreichen Kruste auf dem Meeresboden im Jahr 2020 erklärte die japanische Rohstoffagentur JOGMEC, das untersuchte Gebiet in der japanischen Tiefsee enthalte genügend Kobalt, um Japans Bedarf für 88 Jahre zu decken, und genügend Nickel, um den Bedarf für zwölf Jahre zu decken.
Regeln für die Erkundung der Rohstoffvorkommen in den internationalen Tiefseegewässern hat die ISA bereits etabliert. Die weltweit größten Vorkommen an Manganknollen werden in der Clarion-Clipperton-Zone erforscht, einem mit neun Millionen Quadratkilometern in etwa der Fläche Europas entsprechenden Gebiet im Pazifik zwischen Hawaii und Mexiko. Dort hat die ISA bislang 17 Explorationslizenzen erteilt, unter anderem an Deutschland, Frankreich, Belgien, Japan, Russland, China und ein osteuropäisches Konsortium.
Manganknollen werden präziser auch polymetallische Knollen genannt. Neben Mangan, das vor allem in der Stahlproduktion zum Einsatz kommt, enthalten die Knollen Metalle, die für Batterien verwendet werden – vor allem Kupfer, Nickel und Kobalt. Eine Studie des deutschen Öko-Instituts kam kürzlich jedoch zu dem Schluss, dass die Tiefseerohstoffe nicht essenziell für die Energiewende sind.
Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) ist von der deutschen Bundesregierung mit der Exploration in zwei Lizenzgebieten beauftragt: seit 2006 in einem ca. 75.000 Quadratkilometer großen Sektor in der Clarion-Clipperton-Zone, und zudem seit 2015 im Indischen Ozean, wo der mögliche Abbau von Massivsulfiden erkundet wird. Bei der Exploration geht es einerseits darum, die für den Abbau relevanten Rohstoffe auf ihre Beschaffenheit und ihre Verteilung zu untersuchen. 80 Prozent der Gelder, die der BGR für die Manganknollen-Exploration zur Verfügung stehen, investiert sie mittlerweile in die Erforschung der Ökosysteme, die von dem Bergbau betroffen wären, erklärt Annemiek Vink, Meeresbiologin bei der BGR.
Das Argument, die Tiefsee sei noch nicht ausreichend erforscht, sei so nicht richtig, sagt Vink. “Seit dreißig bis vierzig Jahren beschäftigen sich Forscher mit der Tiefsee, es gibt Zehntausende Publikationen, darunter auch viele Hundert zum Thema Tiefseebergbau und dessen mögliche Umweltauswirkungen”. Die Clarion-Clipperton-Zone sei die besterforschte Tiefseezone der Welt. Das Problem sei ein anderes: die Komplexität der Ökosysteme. “Je mehr wir untersuchen, desto mehr finden wir heraus, wie komplex und heterogen der Artenbestand ist“, erklärt sie.
Welche Auswirkungen es in einzelnen Regionen des riesigen potenziellen Abbaugebiets hätte, wenn die Manganknollen aus dem Ökosystem unwiederbringlich entfernt würden, könne man noch nicht sagen. Vor zwei Jahren testeten die Forscher im deutschen Lizenzgebiet bereits einen Kollektor, der die Manganknollen am Meeresboden “erntet”. Nun müsse man prüfen, wie sich das Gebiet erholt, erklärt Vink. “Das sind Fragen, die Zeit brauchen”. Studien wie das von Deutschland geförderte DISCOL-Projekt im Südostpazifik bei Peru zeigen jedoch, dass sich die Ökosysteme auch Jahrzehnte nach dem Abbau von Manganknollen noch nicht erholt haben.
Bei den bis zum 21. Juli andauernden Verhandlungen der ISA in Jamaika steht jetzt eine Frage im Mittelpunkt: Wie geht die Behörde mit möglichen Abbauanträgen um, solange noch keine verbindlichen Regeln gelten? Nauru hat zwar bereits erklärt, mit seinem Antrag auf eine kommerzielle Rohstoffförderung zu warten. Da die Frist abgelaufen ist, können ab sofort jedoch theoretisch auch Anträge weiterer Staaten bei der ISA eingehen.
12. Juli 2023, 18:30 Uhr, Halle (Saale) und Online
Vortrag Die Folgen der Pandemie: Post Covid und ME/CFS, Leopoldina-Vorlesung von Prof. Dr. Carmen Scheibenbogen, Charité Berlin Mehr
18. Juli 2023, Amerikahaus München, Karolinenplatz 3, 80333 München
Diskussion acatech am Dienstag: Rettung oder Risiko? Geoengineering und der Kampf gegen den Klimawandel Mehr
20. Juli, 12:30 Uhr, Online
Lunchtalk Vorstellung von ScicommSupport – der Anlaufstelle für Wissenschaftler bei Angriffen im Rahmen der Wissenschaftskommunikation Mehr
6.-8. September 2023, Magdeburg
Jahrestagung des Bundesverbands Hochschulkommunikation Wissenschaft, Kommunikation, Politik: Wie neutral dürfen wir noch sein? Mehr
11.-13. September 2023, Osnabrück
18. Jahrestagung der Gesellschaft für Hochschulforschung Das Zusammenspiel von Hochschulforschung und Hochschulentwicklung: Empirie, Transfer und Wirkungen Mehr
Ein von mehr als 6.000 Wissenschaftlern unterzeichneter Offener Brief unterstützt das erste große Vorhaben im Rahmen des European Green Deal und mischt sich in den politischen Streit um das Renaturierungsgesetz (Nature Restoration Law, NRL) ein. In der Debatte über das am 12. Juli im EU-Parlament zur Abstimmung anstehende Gesetz, kursieren Falschinformationen, warnen die Forschenden. Untermauert mit 38 Verweisen auf Studien zeigen sie auf, dass die von Gegnern des Gesetzes vorgebrachten Behauptungen nicht nur wissenschaftlicher Evidenz entbehren, sondern dieser sogar widersprechen.
Die konservative EU-Fraktion EVP kritisiert den Gesetzesvorschlag aufgrund der vermeintlich negativen Auswirkungen auf die Landwirtschaft und warnt beispielsweise vor sinkenden Erträgen. Die Forschenden hingegen betonen: Nicht Umweltschutz, sondern der Klimawandel und der Verlust der Biodiversität seien die größten Bedrohungen für die Ernährungssicherheit in Europa.
Das Renaturierungsgesetz schließe wichtige Lücken im Naturschutz, sagte der Erstautor des Offenen Briefes Guy Pe’er. Als Wissenschaftler sehe er sich in der Verantwortung, der Politik vor der Entscheidung die Evidenz aufzuzeigen, erläuterte der Ökologe, der am Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung Halle-Jena-Leipzig und am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig forscht.
Von einem “Feuerwerk der Falschinformation” sprach der Agrarökonom Sebastian Lakner von der Universität Rostock, Mitautor des Briefes. Auch er betonte, dass es um eine sachgerechte Diskussion gehe und darum, die Debatte hin zur Problemlösung zu lenken. Das bisherige Modell mit der vor 20 Jahren erlassenen Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie für den Erhalt natürlicher Lebensräume sowie wildlebender Tiere und Pflanzen habe nicht funktioniert. Es gebe es ein “Vollzugsdefizit”. Von dem mit Berichtspflichten und Monitoring verbundene NRL erhofft er sich mehr Wirkung.
Vier Fünftel der Lebensräume in der EU sind geschädigt und sollen bis 2050 zu großen Teilen wiederhergestellt werden. Mit dem Renaturierungsgesetz will die EU-Kommission die Mitgliedsstaaten dazu verpflichten, Städte zu begrünen, trockengelegte Moore wieder zu vernässen, Meeresökosysteme instand zusetzen, Flüsse und Wälder naturnaher zu gestalten. Auch Äcker und Weiden sollen insekten- und vogelfreundlicher gestaltet und der Rückgang an Bestäubern aufgehalten werden. Für all diese Bereiche schreibt der Gesetzentwurf verbindliche Ziele und Zwischenziele ab 2030 vor. Es ist ein Schlüsselvorhaben des Green Deals, das sowohl im Kampf gegen den Klimawandel als auch gegen das Artensterben helfen soll. abg
Der Wissenschaftsrat setzt sich für die Etablierung institutioneller Strukturen der Geschlechterforschung ein. Das ist Teil der Empfehlungen zu Status und Weiterentwicklung des Forschungsfeldes Geschlechterforschung, die am gestrigen Montag vorgestellt wurden.
Wie die Vorsitzende der Arbeitsgruppe, die Münchner Historikerin Margit Szöllösi-Janze, erläuterte, sind viele Institute und Lehrstühle an den Hochschulen prekär finanziert und ausgestattet. Um Wissen zu sichern, Kooperationen und Austausch anzubahnen und Drittmittelprojekte zu verankern, sei eine langfristige Perspektive erforderlich. Die Geschlechterforschung selbst wird dazu aufgerufen, sich intensiver um die Einwerbung von Verbundforschungsprojekten zu bemühen oder sich an Forschungsverbünden zu beteiligen.
Der Vorsitzende des Wissenschaftsrats Wolfgang Wick betonte ausdrücklich, dass Geschlechterforschung von Gleichstellungspolitik abzugrenzen sei. Weiterhin stehe ein emanzipatorisch-aufklärerisches Ziel dieser Forschung nicht in Widerspruch zum Status als Wissenschaft. Gender- oder Geschlechterforschung decke ein breites Spektrum von der Grundlagen- bis zur anwendungsorientierten Forschung ab. Sie zeichne sich durch eine Vielfalt an Themen, Zugängen und Methoden aus.
Katharina Fegebank, die auf dem Podium das Land Hamburg als Impulsgeber für das Papier vertrat, verwies auf die Intensität der gesellschaftlichen Debatte rund um die Geschlechterforschung. In diesem Zusammenhang empfiehlt der Wissenschaftsrat dem Forschungsfeld, zum einen die Wissenschaftskommunikation zu intensivieren, um die Inhalte der Geschlechterforschung noch besser an eine breite Öffentlichkeit zu vermitteln. Zum anderen sollten die Theorie- und Methodendiskussionen weiter verstärkt werden, auch um auf diese Weise Distanz zu den Akteurs-Perspektiven im Feld zu wahren.
Besorgniserregend seien Diffamierungen und personenbezogene Angriffe auf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, in zunehmendem Maße auch auf Studierende des Forschungsfeldes. Fegebank sagte dazu: “Politik und Wissenschaft müssen einen Weg finden, um Forschende und Studierende zu schützen.” Auf die Nachfrage, wie dies konkret geschehen solle, verwies sie auf Meldeportale, die gestärkt werden sollten, um strafrechtlich relevante Anfeindungen zu melden. Auch die Behörden sollten für “Wissenschaftsfeindlichkeit, die in Angriffe mündet” sensibilisiert werden. Szöllösi-Janze hob die Verantwortung der Hochschulleitungen hervor: Diese müssten sich aktiv für den Schutz der Forschenden engagieren. mw
Mit Blick auf den Hochlauf der Wasserstoff-Wirtschaft in Deutschland befürchten einige Experten aus Politik und Wissenschaft einen Iridium-Engpass. Bei dem seltenen Metall bestünden große Abhängigkeiten von Südafrika, die sich “nicht vermeiden lassen”, steht in einer gemeinsamen Erklärung der EU-Kommission und der europäischen Wasserstoffwirtschaft. Iridium wird zur PEM-Elektrolyse von Wasserstoff verwendet und ist bei dieser Anwendungsart derzeit nicht durch andere Materialien ersetzbar. Auch die Stiftung Wissenschaft und Politik hatte im Herbst 2022 vor einem Iridium-Engpass beim seltenen Metall gewarnt.
Weil derzeit nur bis zu zehn Tonnen Iridium pro Jahr weltweit gefördert werden, der Bedarf aber in ein paar Jahren höher sein könnte, wird dort ein globales Wettrennen um den knappen Rohstoff erwartet. Andere Experten geben allerdings Entwarnung. “Nach dem derzeitigen Stand rennen wir bei Elektrolyseuren nicht in eine Iridium-Sackgasse”, sagt Felix Müller, Rohstoffexperte des Umweltbundesamts (UBA) im Gespräch mit Table.Media. Zwar müsse man Rohstofffragen im Blick behalten – aber die gerade entstehende Wasserstoffindustrie würde ein Iridium-Engpass wohl kaum ausbremsen, meinen auch andere Experten.
Drei Faktoren werden angeführt:
Michael Haendel, Autor des Kapitels zu Wasserstoff in der Studie, sagte Table.Media: “Bei den meisten Anwendungsfällen zur Wasserstoffherstellung können sowohl PEM-Elektrolyseure als auch alkalische Elektrolyseure (AEL) synonym eingesetzt werden. AEL sind dabei meist nicht auf kritische Edelmetalle angewiesen und kommen ohne einen Iridium-Bedarf aus.” Auch die AEL ließen sich mit schwankenden erneuerbaren Energien vereinbaren, so der Experte des Fraunhofer ISI: “Sollte es zu einem Iridium-Mangel kommen, ist davon auszugehen, dass man verstärkt auf andere Wasserstoffelektrolyseur-Technologien setzt.”
Auch Müller vom UBA warnt vor Panik. Man müsse Rohstofffragen bei neuen Technologien natürlich im Blick behalten. Doch “die globalen Wasserstoffszenarien und politischen Pläne sind sehr hochgegriffen”. Es gebe “zahlreiche Hürden” bei der notwendigen Wasserstoff-Infrastruktur und dem Transport des flüchtigen Rohstoffs. “Selbst wenn man diese Hürden überwinden kann, wird es nicht am Iridium scheitern. Dann wird es Second-Best-Lösungen geben und Elektrolyseure zum Einsatz kommen, die kein Iridium benötigen.” nib / tg
Der Vorsitzende der deutsch-chinesischen Parlamentariergruppe Hans-Peter Friedrich (CSU) übt im Gespräch mit Table.Media heftige Kritik an der China-Politik der Ampel-Regierung – noch bevor diese ihre China-Strategie vorgelegt hat. “Faktisch findet derzeit ein De-Coupling statt, egal wie die deutsche Regierung das nennen mag”, sagt der ehemalige Bundesinnenminister. Kooperationsvereinbarungen laufen aus, Staatsbürgschaften werden gedeckelt, die Messeförderung für mittelständische Unternehmen reduziert. “Das sind große Fehler”, sagt Friedrich.
Friedrich erkennt an, dass China ein autoritäres System ist. “Die Kontrolle in China hat in den vergangenen Jahren erkennbar zugenommen”, sagte Friedrich, der Ende Juni zu Besuch in Peking und Shanghai war. Dennoch hält er China als Wirtschaftspartner für unverzichtbar. Derzeit stehe die Sicherheitspolitik zu sehr im Vordergrund. Friedrich sieht darin ein Problem, “weil ein großer Teil unseres Wohlstandes mit China zusammenhängt”. China und Deutschland seien “optimale Partner”.
Die Ampel-Regierung ringt seit Monaten um eine China-Strategie. Grüne und FDP fordern eine härtere Gangart, etwa in Fragen von Menschenrechten und Handel, aber auch angesichts von Pekings Drohungen, Taiwan mit Gewalt einzunehmen. Dem Vernehmen nach ist das Kanzleramt hingegen weiter um gute Beziehungen bemüht. Einig sind sich die Beteiligten, dass es nicht um eine Entkoppelung von China (De-Coupling) gehe, sondern um ein sogenanntes De-Risking, also den Abbau von Risiken. Das ganze Gespräch mit Hans-Peter Friedrich lesen Sie hier. fin

Ohne Innovation wäre dieser Moment nicht möglich: Alex von Frankenberg – Experte für Venture-Capital, Investments und Start-ups – erzählt in einem Videocall von seinem Urlaub in London. Frankenberg ist begeistert, er redet schnell: “London ist eine große Stadt mit einer tollen Verkehrsinfrastruktur.” Zurechtgefunden hat er sich mithilfe von Google Maps, sagt er, und zeigt sich dann erstaunt: “Kaum zu glauben, dass wir irgendwann einmal mit einem Stadtplan in der Hand herumgelaufen sind.” Frankenberg weiß, wovon er spricht; denn Innovation ist sozusagen sein Kerngeschäft.
Gemeinsam mit Guido Schlitzer führt Frankenberg die Geschäfte des High-Tech Gründerfonds (HTGF), der 2005 auf Initiative des Bundeswirtschaftsministeriums ins Leben gerufen wurde. Das Prinzip: Der HTGF investiert in sehr frühen Phasen in Hightech-Start-ups, wenn private Investoren noch zögern – immer dann, wenn Start-up-Ideen ganze Industrien revolutionieren und das Leben der Menschen verbessern können, heißt es auf der Unternehmenswebsite. “Wir haben ambitionierte Ziele, die nicht einfach sind”, sagt Frankenberg. Anfang 2023 hat das Unternehmen mit einem Gesamtvolumen von knapp einer halben Milliarde Euro den größten – mittlerweile vierten – Fonds seiner Geschichte geschlossen. Das Geld stammt größtenteils vom Bundeswirtschaftsministerium und der staatlichen Förderbank KfW. Aber auch 45 private Investoren, darunter Großkonzerne wie Mittelständler, haben sich beteiligt.
Frankenberg hat in Mannheim und Texas studiert, seine Schwerpunkte: Finanzen und IT. Promoviert hat er über die Bildung von Technologiestandards. Seine berufliche Karriere begann er bei Andersen Consulting mit der Entwicklung von komplexen IT-Systemen. Der HTGF-Geschäftsführer sagt über sich selbst, dass er amerikanisch geprägt sei – zurück in die deutsche Heimat brachte er das amerikanische Mindset: Ärmel hochkrempeln und loslegen. “Just do it” lautet Frankenbergs Kürzel in den sozialen Medien. Natürlich könne auch mal etwas daneben gehen, sagt er – “nice try” würden die Amerikaner dann sagen. In Deutschland fehle es aber noch an so einer positiven Grundhaltung.
Wie ein typischer Arbeitstag des HTGF-Geschäftsführers aussieht? Kommunikation nach innen und nach außen ist ein großer Teil seiner Arbeit, berichtet Frankenberg. “Was wollen wir erreichen? Sind wir noch auf dem richtigen Kurs?” – das sind Fragen, die er sich und seinen Mitarbeitenden regelmäßig stellt. Neben dem “big picture” kümmert sich Frankenberg aber auch immer noch um das operative Geschäft, um Verkaufsentscheidungen und Investments.
Verstecken muss sich die deutsche Start-up-Szene auf keinen Fall, glaubt Frankenberg. “Wir sind richtig gut bei der Verbindung von Hardware und Software – im B2B-Bereich also.” Unausgeschöpfte Potenziale gibt es seiner Meinung nach trotzdem: “Wir haben eine sehr niedrige Gründerinnen-Quote, auch das Thema Migration bietet noch viele Chancen.” Insbesondere in diesen Bereichen seien Gründerfonds wie der HTGF hilfreich.
Gründerinnen und Gründern rät der HTGF-Geschäftsführer zu problemlösenden Gründungen, frei nach dem Motto: “Ich erkenne ein relevantes Problem und finde eine Lösung dafür.” Die großen Innovationen, die wirklich die Welt verändern, kämen schließlich von Start-ups, sagt er. Egal, ob es dabei um autonomes Fahren geht oder um Service-Roboter, die uns als gleichwertige Gesprächspartner Gesellschaft leisten – Alex von Frankenberg freut sich auf die Zukunft. Gabriele Voßkühler
Philipp Ahner wurde zum neuen Präsidenten der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover gewählt. Ahner soll die Nachfolge von Susanne Rode-Breymann antreten, deren zweite Amtszeit zum 31. März 2024 endet.
Jakob Edler, geschäftsführender Institutsleiter des Fraunhofer ISI in Karlsruhe, hat zum 1. Juli 2023 den Vorsitz des Fraunhofer-Verbunds Innovationsforschung übernommen. Edler folgt auf Wilhelm Bauer, der Mitglied der Institutsleitung des Fraunhofer IAO in Stuttgart ist und dem Verbund seit dessen Gründung sechs Jahre lang vorstand.
Sylvia Schattauer wurde vom Senat der Technischen Universität Clausthal als neue Präsidentin der Harzer Universität vorgeschlagen. Das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur wird nun über den Vorschlag entscheiden.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!
Europe.Table. Neuseeland nimmt an Horizon Europe teil. Die EU und Neuseeland haben am Sonntag eine enge Zusammenarbeit in der Forschungspolitik vereinbart. Erstmals können damit Forscher aus einem entfernten Land vom EU-Forschungsprogramm Horizon Europe profitieren. Mehr
Berlin.Table. Sozialforscher: “Wir brauchen eine erfolgreiche Gegenerzählung”. Um rechten Ideen etwas entgegenzusetzen, schlägt Cihan Sinanoğlu, Soziologe am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung, anderen Parteien neue gesellschaftliche Erzählungen vor. Als Ansatzpunkt nennt er die klassisch sozialdemokratische Idee der sozialen Mobilität. Mehr
Climate.Table. Befragung: Deutsche wollen schnellere und gerechtere Energiewende. Auch in Zeiten von Ukraine-Krieg und Inflation bleibt der Klimaschutz für die Menschen in Deutschland ein wichtiges Thema. Das zeigen neue Daten des Sozialen Nachhaltigkeitsbarometers, das seit Anfang 2021 die in der Bevölkerung verbreiteten Einstellungen zur Energie- und Verkehrswende misst. Mehr

Wissenschaftliche Politikberatung zu betreiben, ist kein leichtes Unterfangen. Noch dazu ist das Feld der Gremien und Gruppen unübersichtlich, aber immerhin, Überlegungen für Qualitätsstandards laufen. Derweil hat es manch Politiker bereits sehr schwer, mit wissenschaftlichen Ratschlägen überhaupt durchzudringen. So riet Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach am Sonntag – angesichts von Rekordtemperaturen in Deutschland – besonders auf ältere Menschen zu achten, dass diese ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen.
Zugegeben, das sind Hinweise, für die man kein Medizinprofessor sein muss, doch Karl Lauterbach erntete ein gänzlich anderes Echo: “Mir können sie gar nichts befehlen”, empörte sich ein User auf Twitter, es sei doch eine Erfindung von “denen da oben” vor Hitze zu warnen, ein anderer. Mitten in der hitzigen Debatte hieß es gar, Lauterbach habe sich mögliche gesundheitliche Gefahren durch Hitze nur ausgedacht, um Panik zu machen und Angst zu verbreiten.
Die Aufgabe, wichtige wissenschaftliche Fakten gut zu vermitteln, war nie größer – die Gesundheitsgefahr für Skeptiker allerdings auch nicht. Nicola Kuhrt
in der Pandemie war wissenschaftliche Politikberatung so gefragt wie nie. Auch die Klimakrise zeigt die Bedeutung unabhängiger, evidenzbasierter Informationen. In unserer neuen Serie “Politikberatung, quo vadis?” beleuchten wir das Thema von allen Seiten. Wir stellen wesentliche Akteure vor, sammeln Ideen und blicken auf die Szene der Politikberater in anderen Ländern. Die Bestandsaufnahme zum Auftakt zeigt: In Deutschland ist diese besonders unübersichtlich. Das bestätigt auch der Schweizer Experte Caspar Hirschi.
Der Bedarf für unabhängige Expertise zeigt sich auch im Streit um das Renaturierungsgesetz der EU. Mehr als 6.000 Forschende warnen in einem Offenen Brief vor irreführenden Behauptungen. Mehr darüber lesen Sie in den News.
Um bedrohte Natur geht es auch beim Tiefseebergbau. Leonie Düngefeld erläutert die Chancen einer vorsorglichen Pause, wie sie die EU jetzt vorschlägt. Um mehr Initiative geht es hingegen in den gestern veröffentlichten Empfehlungen des Wissenschaftsrats. Wie die breitere Verankerung der Geschlechterforschung erfolgen könnte, hat Markus Weisskopf zusammengefasst.
Wir wünschen Ihnen erkenntnisreiche Lektüre,
Wenn Ihnen der Research.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail weitergeleitet wurde: Hier können Sie sich für den Research.Table kostenlos anmelden.

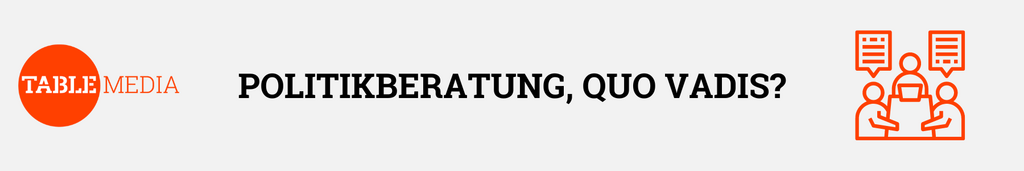
In der Szene der wissenschaftlichen Politikberatung tummeln sich viele Akteure, ihre Zuständigkeiten sind unscharf bis unklar. Das räumen selbst Insider ein. Aus der Außenperspektive ist die Diagnose ähnlich: Das Feld sei in Deutschland besonders unübersichtlich, sagt der Schweizer Historiker Caspar Hirschi, der das hiesige Geschehen intensiv verfolgt, im Gespräch mit Table.Media. “Es gibt eine enorme Vielfalt an Beratungsgremien und Beratungsstrukturen. Zusätzlich verkomplizierend wirkt der Föderalismus mit einem exklusiven Beratungssystem für den Bund und einer Vielzahl für die Länder.” Dies führe zu heftiger Beratungskonkurrenz.
Durch die Krisenkaskaden hat wissenschaftliche Politikberatung an Renommee gewonnen, sagt Historiker Hirschi.”Lange Zeit galt sie eher als Betätigungsfeld für Leute, die nicht mehr wussten, was sie in der Forschung Gutes leisten konnten.” Dabei seien die Aufgaben sehr anspruchsvoll und spezifisch. Bisher jedoch gebe es keine Ausbildungsgänge in Expertise. “Erste Weiterbildungsangebote für Forschende in wissenschaftlicher Politikberatung werden aufgebaut”, sagt Hirschi. In der Schweiz etwa das Franxini-Projekt und das Science-Policy-Interface der ETH Zürich.
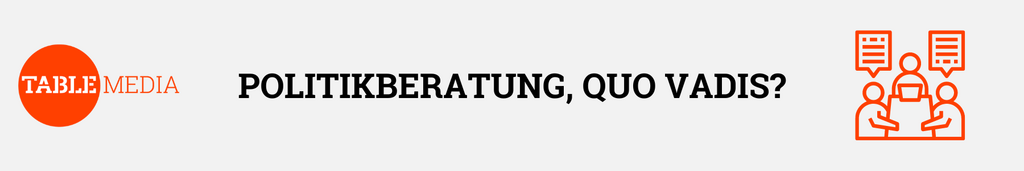
“Der Bedarf für wissenschaftliche Expertise ist stärker denn je”, sagt Chelioti. Die Helmholtz-Gemeinschaft und ihre 18 Zentren förderten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Expertise für und Interesse an Politikberatung haben. Auch in der Helmholtz-Akademie für Führungskräfte sei Politikberatung ein wichtiges Thema. “Wissenschaftliche Politikberatung in Deutschland ist dabei, sich in ihren Strukturen und Zugängen stetig weiter zu professionalisieren”, bestätigt Christian Kobsda, der das Berliner Büro der MPG leitet. Ihn freut es, dass sich Wissenschaftler auch schon in frühen Karrierephasen produktiv in den Dialog einbringen.
Fast alle, die sich mit wissenschaftlicher Politikberatung befassen, wünschen sich besseren Überblick. “Dadurch, dass die Beratung so dezentralisiert ist, ist es auch sehr mühsam, sich zu einzelnen Themen einen Überblick über das Spektrum der Stellungnahmen und Policy Paper zu verschaffen”, sagt Nataliia Sokolovska. Was sie ebenfalls vermisst, sind übergreifende Qualitätsstandards – etwa zur transparenten Kommunikation von Unsicherheiten oder zum unterschiedlichen Umgang mit begutachteten und nicht-begutachteten Studien.”
Hirschi zufolge wäre schon viel gewonnen, sich auf Verfahren zu einigen, mit denen man zu Beginn einer akuten Krise Expertengremien einsetzt. Wenn selbst involvierte Personen die Beratungslandschaft nicht mehr überblicken, komme es zum “Ad-hoc-Ismus”,warnt er. “Man greift zum Telefon, ruft die Leute an, die einem als Erstes in den Sinn kommen, und improvisiert einen Rat oder eine Taskforce zusammen.”
Das ausführliche Gespräch mit Caspar Hirschi finden Sie hier. In Teil 2 der Serie lesen Sie: “Die wichtigsten Konzepte für Politikberatung”.
Weitere Informationen:
Das Franxini-Projekt in der Schweiz
Beitrag in Elephant in the Lab über Internationale Strukturen der Politikberatung
200 Meter unter dem Meeresspiegel beginnt die Tiefsee, das größte Ökosystem des Planeten und Lebensraum von Millionen Arten. Viele von ihnen sind noch nicht erforscht. In Gestein, Krusten und Knollen lagern in 2.000 bis 6.000 Metern Tiefe noch weitere Schätze: Mangan, Eisen und Metalle wie Kobalt, Nickel und Kupfer – Rohstoffe, die von der EU-Kommission als strategisch bedeutsam eingestuft werden, für Digitalisierung, Energie- und Mobilitätswende als auch für eine stärkere Unabhängigkeit von Importen aus Ländern wie China.
Über den möglichen Abbau dieser Rohstoffe in der Tiefsee verhandelt seit Sonntag erneut die Internationale Meeresbodenbehörde (ISA) in Kingston, Jamaika. 2021 hatte der pazifische Inselstaat Nauru, der gemeinsam mit der kanadischen The Metals Company (TMC) die weltweit erste Lizenz für den Abbau von Manganknollen beantragen will, die sogenannte Zwei-Jahres-Klausel des internationalen Seerechts ausgelöst. Die ISA musste demnach innerhalb von zwei Jahren ein Regelwerk vorlegen. Diese Frist ist nun abgelaufen, mit einer Regulierung noch in diesem Jahr ist jedoch nicht zu rechnen.
Die Versammlung der ISA-Mitglieder – 167 Staaten plus die EU – könnte theoretisch ein Moratorium für den Tiefseebergbau implementieren, welches gelten würde, bis die Erforschung der Bergbaufolgen weiter fortgeschritten und die Regeln festgelegt sind. Forschenden zufolge könnte das aber noch Jahrzehnte dauern. Das Moratorium schlägt etwa eine Gruppe um Frankreich und Chile vor. Frankreich fordert ein komplettes Verbot von Tiefseebergbau, die Assemblée Nationale stimmte Anfang des Jahres für ein Verbot in den französischen Gewässern.
Die deutsche Bundesregierung bemüht sich seit vergangenem Jahr um eine “vorsorgliche Pause”. “Tiefseebergbau würde die Meere weiter belasten und Ökosysteme unwiederbringlich zerstören”, erklärte Bundesumweltministerin Steffi Lemke. Deutschland befürworte die weitere Erforschung der Tiefsee, werde aber bis auf Weiteres keine Anträge auf kommerziellen Abbau von Rohstoffen unterstützen, sagte Franziska Brantner, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium.
Dies entspricht auch der Position der EU: Die Kommission hatte sich 2021 in ihrer Agenda für die internationale Meerespolitik für eine vorsorgliche Pause ausgesprochen. Die EU werde sich für ein Verbot des Tiefseebergbaus einsetzen, bis die wissenschaftlichen Lücken geschlossen, schädliche Auswirkungen ausgeschlossen seien und die ISA Regeln für einen wirksamen Schutz der Meeresumwelt entwickelt habe. Dies hatte auch das EU-Parlament gefordert, unter anderem in seinem Initiativbericht für die EU-Rohstoffstrategie.
Immer mehr Mitgliedstaaten schließen sich dieser Position an, zuletzt Irland und Schweden. Jedoch nicht alle: Die norwegische Regierung gab Ende Juni bekannt, ein Gebiet in nationalen Gewässern für Bergbauaktivitäten freizugeben und eine Strategie für den Tiefseebergbau zu entwickeln. Norwegen erhofft sich jedoch die Entwicklung eines neuen Wirtschaftszweigs jenseits der Öl- und Gasindustrie und will “weltweit führend” in einer nachhaltigen und verantwortungsvollen Bewirtschaftung der Bodenschätze am Meeresboden werden. Über den Vorschlag muss zunächst noch das norwegische Parlament abstimmen.
Angesichts der Prognosen für den weltweit massiv steigenden Bedarf an Rohstoffen für die Energie- und Mobilitätswende scheinen die Schätze am Meeresboden auch für weitere Länder vielversprechend. Nach einem Test zur Ausgrabung einer kobaltreichen Kruste auf dem Meeresboden im Jahr 2020 erklärte die japanische Rohstoffagentur JOGMEC, das untersuchte Gebiet in der japanischen Tiefsee enthalte genügend Kobalt, um Japans Bedarf für 88 Jahre zu decken, und genügend Nickel, um den Bedarf für zwölf Jahre zu decken.
Regeln für die Erkundung der Rohstoffvorkommen in den internationalen Tiefseegewässern hat die ISA bereits etabliert. Die weltweit größten Vorkommen an Manganknollen werden in der Clarion-Clipperton-Zone erforscht, einem mit neun Millionen Quadratkilometern in etwa der Fläche Europas entsprechenden Gebiet im Pazifik zwischen Hawaii und Mexiko. Dort hat die ISA bislang 17 Explorationslizenzen erteilt, unter anderem an Deutschland, Frankreich, Belgien, Japan, Russland, China und ein osteuropäisches Konsortium.
Manganknollen werden präziser auch polymetallische Knollen genannt. Neben Mangan, das vor allem in der Stahlproduktion zum Einsatz kommt, enthalten die Knollen Metalle, die für Batterien verwendet werden – vor allem Kupfer, Nickel und Kobalt. Eine Studie des deutschen Öko-Instituts kam kürzlich jedoch zu dem Schluss, dass die Tiefseerohstoffe nicht essenziell für die Energiewende sind.
Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) ist von der deutschen Bundesregierung mit der Exploration in zwei Lizenzgebieten beauftragt: seit 2006 in einem ca. 75.000 Quadratkilometer großen Sektor in der Clarion-Clipperton-Zone, und zudem seit 2015 im Indischen Ozean, wo der mögliche Abbau von Massivsulfiden erkundet wird. Bei der Exploration geht es einerseits darum, die für den Abbau relevanten Rohstoffe auf ihre Beschaffenheit und ihre Verteilung zu untersuchen. 80 Prozent der Gelder, die der BGR für die Manganknollen-Exploration zur Verfügung stehen, investiert sie mittlerweile in die Erforschung der Ökosysteme, die von dem Bergbau betroffen wären, erklärt Annemiek Vink, Meeresbiologin bei der BGR.
Das Argument, die Tiefsee sei noch nicht ausreichend erforscht, sei so nicht richtig, sagt Vink. “Seit dreißig bis vierzig Jahren beschäftigen sich Forscher mit der Tiefsee, es gibt Zehntausende Publikationen, darunter auch viele Hundert zum Thema Tiefseebergbau und dessen mögliche Umweltauswirkungen”. Die Clarion-Clipperton-Zone sei die besterforschte Tiefseezone der Welt. Das Problem sei ein anderes: die Komplexität der Ökosysteme. “Je mehr wir untersuchen, desto mehr finden wir heraus, wie komplex und heterogen der Artenbestand ist“, erklärt sie.
Welche Auswirkungen es in einzelnen Regionen des riesigen potenziellen Abbaugebiets hätte, wenn die Manganknollen aus dem Ökosystem unwiederbringlich entfernt würden, könne man noch nicht sagen. Vor zwei Jahren testeten die Forscher im deutschen Lizenzgebiet bereits einen Kollektor, der die Manganknollen am Meeresboden “erntet”. Nun müsse man prüfen, wie sich das Gebiet erholt, erklärt Vink. “Das sind Fragen, die Zeit brauchen”. Studien wie das von Deutschland geförderte DISCOL-Projekt im Südostpazifik bei Peru zeigen jedoch, dass sich die Ökosysteme auch Jahrzehnte nach dem Abbau von Manganknollen noch nicht erholt haben.
Bei den bis zum 21. Juli andauernden Verhandlungen der ISA in Jamaika steht jetzt eine Frage im Mittelpunkt: Wie geht die Behörde mit möglichen Abbauanträgen um, solange noch keine verbindlichen Regeln gelten? Nauru hat zwar bereits erklärt, mit seinem Antrag auf eine kommerzielle Rohstoffförderung zu warten. Da die Frist abgelaufen ist, können ab sofort jedoch theoretisch auch Anträge weiterer Staaten bei der ISA eingehen.
12. Juli 2023, 18:30 Uhr, Halle (Saale) und Online
Vortrag Die Folgen der Pandemie: Post Covid und ME/CFS, Leopoldina-Vorlesung von Prof. Dr. Carmen Scheibenbogen, Charité Berlin Mehr
18. Juli 2023, Amerikahaus München, Karolinenplatz 3, 80333 München
Diskussion acatech am Dienstag: Rettung oder Risiko? Geoengineering und der Kampf gegen den Klimawandel Mehr
20. Juli, 12:30 Uhr, Online
Lunchtalk Vorstellung von ScicommSupport – der Anlaufstelle für Wissenschaftler bei Angriffen im Rahmen der Wissenschaftskommunikation Mehr
6.-8. September 2023, Magdeburg
Jahrestagung des Bundesverbands Hochschulkommunikation Wissenschaft, Kommunikation, Politik: Wie neutral dürfen wir noch sein? Mehr
11.-13. September 2023, Osnabrück
18. Jahrestagung der Gesellschaft für Hochschulforschung Das Zusammenspiel von Hochschulforschung und Hochschulentwicklung: Empirie, Transfer und Wirkungen Mehr
Ein von mehr als 6.000 Wissenschaftlern unterzeichneter Offener Brief unterstützt das erste große Vorhaben im Rahmen des European Green Deal und mischt sich in den politischen Streit um das Renaturierungsgesetz (Nature Restoration Law, NRL) ein. In der Debatte über das am 12. Juli im EU-Parlament zur Abstimmung anstehende Gesetz, kursieren Falschinformationen, warnen die Forschenden. Untermauert mit 38 Verweisen auf Studien zeigen sie auf, dass die von Gegnern des Gesetzes vorgebrachten Behauptungen nicht nur wissenschaftlicher Evidenz entbehren, sondern dieser sogar widersprechen.
Die konservative EU-Fraktion EVP kritisiert den Gesetzesvorschlag aufgrund der vermeintlich negativen Auswirkungen auf die Landwirtschaft und warnt beispielsweise vor sinkenden Erträgen. Die Forschenden hingegen betonen: Nicht Umweltschutz, sondern der Klimawandel und der Verlust der Biodiversität seien die größten Bedrohungen für die Ernährungssicherheit in Europa.
Das Renaturierungsgesetz schließe wichtige Lücken im Naturschutz, sagte der Erstautor des Offenen Briefes Guy Pe’er. Als Wissenschaftler sehe er sich in der Verantwortung, der Politik vor der Entscheidung die Evidenz aufzuzeigen, erläuterte der Ökologe, der am Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung Halle-Jena-Leipzig und am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig forscht.
Von einem “Feuerwerk der Falschinformation” sprach der Agrarökonom Sebastian Lakner von der Universität Rostock, Mitautor des Briefes. Auch er betonte, dass es um eine sachgerechte Diskussion gehe und darum, die Debatte hin zur Problemlösung zu lenken. Das bisherige Modell mit der vor 20 Jahren erlassenen Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie für den Erhalt natürlicher Lebensräume sowie wildlebender Tiere und Pflanzen habe nicht funktioniert. Es gebe es ein “Vollzugsdefizit”. Von dem mit Berichtspflichten und Monitoring verbundene NRL erhofft er sich mehr Wirkung.
Vier Fünftel der Lebensräume in der EU sind geschädigt und sollen bis 2050 zu großen Teilen wiederhergestellt werden. Mit dem Renaturierungsgesetz will die EU-Kommission die Mitgliedsstaaten dazu verpflichten, Städte zu begrünen, trockengelegte Moore wieder zu vernässen, Meeresökosysteme instand zusetzen, Flüsse und Wälder naturnaher zu gestalten. Auch Äcker und Weiden sollen insekten- und vogelfreundlicher gestaltet und der Rückgang an Bestäubern aufgehalten werden. Für all diese Bereiche schreibt der Gesetzentwurf verbindliche Ziele und Zwischenziele ab 2030 vor. Es ist ein Schlüsselvorhaben des Green Deals, das sowohl im Kampf gegen den Klimawandel als auch gegen das Artensterben helfen soll. abg
Der Wissenschaftsrat setzt sich für die Etablierung institutioneller Strukturen der Geschlechterforschung ein. Das ist Teil der Empfehlungen zu Status und Weiterentwicklung des Forschungsfeldes Geschlechterforschung, die am gestrigen Montag vorgestellt wurden.
Wie die Vorsitzende der Arbeitsgruppe, die Münchner Historikerin Margit Szöllösi-Janze, erläuterte, sind viele Institute und Lehrstühle an den Hochschulen prekär finanziert und ausgestattet. Um Wissen zu sichern, Kooperationen und Austausch anzubahnen und Drittmittelprojekte zu verankern, sei eine langfristige Perspektive erforderlich. Die Geschlechterforschung selbst wird dazu aufgerufen, sich intensiver um die Einwerbung von Verbundforschungsprojekten zu bemühen oder sich an Forschungsverbünden zu beteiligen.
Der Vorsitzende des Wissenschaftsrats Wolfgang Wick betonte ausdrücklich, dass Geschlechterforschung von Gleichstellungspolitik abzugrenzen sei. Weiterhin stehe ein emanzipatorisch-aufklärerisches Ziel dieser Forschung nicht in Widerspruch zum Status als Wissenschaft. Gender- oder Geschlechterforschung decke ein breites Spektrum von der Grundlagen- bis zur anwendungsorientierten Forschung ab. Sie zeichne sich durch eine Vielfalt an Themen, Zugängen und Methoden aus.
Katharina Fegebank, die auf dem Podium das Land Hamburg als Impulsgeber für das Papier vertrat, verwies auf die Intensität der gesellschaftlichen Debatte rund um die Geschlechterforschung. In diesem Zusammenhang empfiehlt der Wissenschaftsrat dem Forschungsfeld, zum einen die Wissenschaftskommunikation zu intensivieren, um die Inhalte der Geschlechterforschung noch besser an eine breite Öffentlichkeit zu vermitteln. Zum anderen sollten die Theorie- und Methodendiskussionen weiter verstärkt werden, auch um auf diese Weise Distanz zu den Akteurs-Perspektiven im Feld zu wahren.
Besorgniserregend seien Diffamierungen und personenbezogene Angriffe auf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, in zunehmendem Maße auch auf Studierende des Forschungsfeldes. Fegebank sagte dazu: “Politik und Wissenschaft müssen einen Weg finden, um Forschende und Studierende zu schützen.” Auf die Nachfrage, wie dies konkret geschehen solle, verwies sie auf Meldeportale, die gestärkt werden sollten, um strafrechtlich relevante Anfeindungen zu melden. Auch die Behörden sollten für “Wissenschaftsfeindlichkeit, die in Angriffe mündet” sensibilisiert werden. Szöllösi-Janze hob die Verantwortung der Hochschulleitungen hervor: Diese müssten sich aktiv für den Schutz der Forschenden engagieren. mw
Mit Blick auf den Hochlauf der Wasserstoff-Wirtschaft in Deutschland befürchten einige Experten aus Politik und Wissenschaft einen Iridium-Engpass. Bei dem seltenen Metall bestünden große Abhängigkeiten von Südafrika, die sich “nicht vermeiden lassen”, steht in einer gemeinsamen Erklärung der EU-Kommission und der europäischen Wasserstoffwirtschaft. Iridium wird zur PEM-Elektrolyse von Wasserstoff verwendet und ist bei dieser Anwendungsart derzeit nicht durch andere Materialien ersetzbar. Auch die Stiftung Wissenschaft und Politik hatte im Herbst 2022 vor einem Iridium-Engpass beim seltenen Metall gewarnt.
Weil derzeit nur bis zu zehn Tonnen Iridium pro Jahr weltweit gefördert werden, der Bedarf aber in ein paar Jahren höher sein könnte, wird dort ein globales Wettrennen um den knappen Rohstoff erwartet. Andere Experten geben allerdings Entwarnung. “Nach dem derzeitigen Stand rennen wir bei Elektrolyseuren nicht in eine Iridium-Sackgasse”, sagt Felix Müller, Rohstoffexperte des Umweltbundesamts (UBA) im Gespräch mit Table.Media. Zwar müsse man Rohstofffragen im Blick behalten – aber die gerade entstehende Wasserstoffindustrie würde ein Iridium-Engpass wohl kaum ausbremsen, meinen auch andere Experten.
Drei Faktoren werden angeführt:
Michael Haendel, Autor des Kapitels zu Wasserstoff in der Studie, sagte Table.Media: “Bei den meisten Anwendungsfällen zur Wasserstoffherstellung können sowohl PEM-Elektrolyseure als auch alkalische Elektrolyseure (AEL) synonym eingesetzt werden. AEL sind dabei meist nicht auf kritische Edelmetalle angewiesen und kommen ohne einen Iridium-Bedarf aus.” Auch die AEL ließen sich mit schwankenden erneuerbaren Energien vereinbaren, so der Experte des Fraunhofer ISI: “Sollte es zu einem Iridium-Mangel kommen, ist davon auszugehen, dass man verstärkt auf andere Wasserstoffelektrolyseur-Technologien setzt.”
Auch Müller vom UBA warnt vor Panik. Man müsse Rohstofffragen bei neuen Technologien natürlich im Blick behalten. Doch “die globalen Wasserstoffszenarien und politischen Pläne sind sehr hochgegriffen”. Es gebe “zahlreiche Hürden” bei der notwendigen Wasserstoff-Infrastruktur und dem Transport des flüchtigen Rohstoffs. “Selbst wenn man diese Hürden überwinden kann, wird es nicht am Iridium scheitern. Dann wird es Second-Best-Lösungen geben und Elektrolyseure zum Einsatz kommen, die kein Iridium benötigen.” nib / tg
Der Vorsitzende der deutsch-chinesischen Parlamentariergruppe Hans-Peter Friedrich (CSU) übt im Gespräch mit Table.Media heftige Kritik an der China-Politik der Ampel-Regierung – noch bevor diese ihre China-Strategie vorgelegt hat. “Faktisch findet derzeit ein De-Coupling statt, egal wie die deutsche Regierung das nennen mag”, sagt der ehemalige Bundesinnenminister. Kooperationsvereinbarungen laufen aus, Staatsbürgschaften werden gedeckelt, die Messeförderung für mittelständische Unternehmen reduziert. “Das sind große Fehler”, sagt Friedrich.
Friedrich erkennt an, dass China ein autoritäres System ist. “Die Kontrolle in China hat in den vergangenen Jahren erkennbar zugenommen”, sagte Friedrich, der Ende Juni zu Besuch in Peking und Shanghai war. Dennoch hält er China als Wirtschaftspartner für unverzichtbar. Derzeit stehe die Sicherheitspolitik zu sehr im Vordergrund. Friedrich sieht darin ein Problem, “weil ein großer Teil unseres Wohlstandes mit China zusammenhängt”. China und Deutschland seien “optimale Partner”.
Die Ampel-Regierung ringt seit Monaten um eine China-Strategie. Grüne und FDP fordern eine härtere Gangart, etwa in Fragen von Menschenrechten und Handel, aber auch angesichts von Pekings Drohungen, Taiwan mit Gewalt einzunehmen. Dem Vernehmen nach ist das Kanzleramt hingegen weiter um gute Beziehungen bemüht. Einig sind sich die Beteiligten, dass es nicht um eine Entkoppelung von China (De-Coupling) gehe, sondern um ein sogenanntes De-Risking, also den Abbau von Risiken. Das ganze Gespräch mit Hans-Peter Friedrich lesen Sie hier. fin

Ohne Innovation wäre dieser Moment nicht möglich: Alex von Frankenberg – Experte für Venture-Capital, Investments und Start-ups – erzählt in einem Videocall von seinem Urlaub in London. Frankenberg ist begeistert, er redet schnell: “London ist eine große Stadt mit einer tollen Verkehrsinfrastruktur.” Zurechtgefunden hat er sich mithilfe von Google Maps, sagt er, und zeigt sich dann erstaunt: “Kaum zu glauben, dass wir irgendwann einmal mit einem Stadtplan in der Hand herumgelaufen sind.” Frankenberg weiß, wovon er spricht; denn Innovation ist sozusagen sein Kerngeschäft.
Gemeinsam mit Guido Schlitzer führt Frankenberg die Geschäfte des High-Tech Gründerfonds (HTGF), der 2005 auf Initiative des Bundeswirtschaftsministeriums ins Leben gerufen wurde. Das Prinzip: Der HTGF investiert in sehr frühen Phasen in Hightech-Start-ups, wenn private Investoren noch zögern – immer dann, wenn Start-up-Ideen ganze Industrien revolutionieren und das Leben der Menschen verbessern können, heißt es auf der Unternehmenswebsite. “Wir haben ambitionierte Ziele, die nicht einfach sind”, sagt Frankenberg. Anfang 2023 hat das Unternehmen mit einem Gesamtvolumen von knapp einer halben Milliarde Euro den größten – mittlerweile vierten – Fonds seiner Geschichte geschlossen. Das Geld stammt größtenteils vom Bundeswirtschaftsministerium und der staatlichen Förderbank KfW. Aber auch 45 private Investoren, darunter Großkonzerne wie Mittelständler, haben sich beteiligt.
Frankenberg hat in Mannheim und Texas studiert, seine Schwerpunkte: Finanzen und IT. Promoviert hat er über die Bildung von Technologiestandards. Seine berufliche Karriere begann er bei Andersen Consulting mit der Entwicklung von komplexen IT-Systemen. Der HTGF-Geschäftsführer sagt über sich selbst, dass er amerikanisch geprägt sei – zurück in die deutsche Heimat brachte er das amerikanische Mindset: Ärmel hochkrempeln und loslegen. “Just do it” lautet Frankenbergs Kürzel in den sozialen Medien. Natürlich könne auch mal etwas daneben gehen, sagt er – “nice try” würden die Amerikaner dann sagen. In Deutschland fehle es aber noch an so einer positiven Grundhaltung.
Wie ein typischer Arbeitstag des HTGF-Geschäftsführers aussieht? Kommunikation nach innen und nach außen ist ein großer Teil seiner Arbeit, berichtet Frankenberg. “Was wollen wir erreichen? Sind wir noch auf dem richtigen Kurs?” – das sind Fragen, die er sich und seinen Mitarbeitenden regelmäßig stellt. Neben dem “big picture” kümmert sich Frankenberg aber auch immer noch um das operative Geschäft, um Verkaufsentscheidungen und Investments.
Verstecken muss sich die deutsche Start-up-Szene auf keinen Fall, glaubt Frankenberg. “Wir sind richtig gut bei der Verbindung von Hardware und Software – im B2B-Bereich also.” Unausgeschöpfte Potenziale gibt es seiner Meinung nach trotzdem: “Wir haben eine sehr niedrige Gründerinnen-Quote, auch das Thema Migration bietet noch viele Chancen.” Insbesondere in diesen Bereichen seien Gründerfonds wie der HTGF hilfreich.
Gründerinnen und Gründern rät der HTGF-Geschäftsführer zu problemlösenden Gründungen, frei nach dem Motto: “Ich erkenne ein relevantes Problem und finde eine Lösung dafür.” Die großen Innovationen, die wirklich die Welt verändern, kämen schließlich von Start-ups, sagt er. Egal, ob es dabei um autonomes Fahren geht oder um Service-Roboter, die uns als gleichwertige Gesprächspartner Gesellschaft leisten – Alex von Frankenberg freut sich auf die Zukunft. Gabriele Voßkühler
Philipp Ahner wurde zum neuen Präsidenten der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover gewählt. Ahner soll die Nachfolge von Susanne Rode-Breymann antreten, deren zweite Amtszeit zum 31. März 2024 endet.
Jakob Edler, geschäftsführender Institutsleiter des Fraunhofer ISI in Karlsruhe, hat zum 1. Juli 2023 den Vorsitz des Fraunhofer-Verbunds Innovationsforschung übernommen. Edler folgt auf Wilhelm Bauer, der Mitglied der Institutsleitung des Fraunhofer IAO in Stuttgart ist und dem Verbund seit dessen Gründung sechs Jahre lang vorstand.
Sylvia Schattauer wurde vom Senat der Technischen Universität Clausthal als neue Präsidentin der Harzer Universität vorgeschlagen. Das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur wird nun über den Vorschlag entscheiden.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!
Europe.Table. Neuseeland nimmt an Horizon Europe teil. Die EU und Neuseeland haben am Sonntag eine enge Zusammenarbeit in der Forschungspolitik vereinbart. Erstmals können damit Forscher aus einem entfernten Land vom EU-Forschungsprogramm Horizon Europe profitieren. Mehr
Berlin.Table. Sozialforscher: “Wir brauchen eine erfolgreiche Gegenerzählung”. Um rechten Ideen etwas entgegenzusetzen, schlägt Cihan Sinanoğlu, Soziologe am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung, anderen Parteien neue gesellschaftliche Erzählungen vor. Als Ansatzpunkt nennt er die klassisch sozialdemokratische Idee der sozialen Mobilität. Mehr
Climate.Table. Befragung: Deutsche wollen schnellere und gerechtere Energiewende. Auch in Zeiten von Ukraine-Krieg und Inflation bleibt der Klimaschutz für die Menschen in Deutschland ein wichtiges Thema. Das zeigen neue Daten des Sozialen Nachhaltigkeitsbarometers, das seit Anfang 2021 die in der Bevölkerung verbreiteten Einstellungen zur Energie- und Verkehrswende misst. Mehr

Wissenschaftliche Politikberatung zu betreiben, ist kein leichtes Unterfangen. Noch dazu ist das Feld der Gremien und Gruppen unübersichtlich, aber immerhin, Überlegungen für Qualitätsstandards laufen. Derweil hat es manch Politiker bereits sehr schwer, mit wissenschaftlichen Ratschlägen überhaupt durchzudringen. So riet Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach am Sonntag – angesichts von Rekordtemperaturen in Deutschland – besonders auf ältere Menschen zu achten, dass diese ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen.
Zugegeben, das sind Hinweise, für die man kein Medizinprofessor sein muss, doch Karl Lauterbach erntete ein gänzlich anderes Echo: “Mir können sie gar nichts befehlen”, empörte sich ein User auf Twitter, es sei doch eine Erfindung von “denen da oben” vor Hitze zu warnen, ein anderer. Mitten in der hitzigen Debatte hieß es gar, Lauterbach habe sich mögliche gesundheitliche Gefahren durch Hitze nur ausgedacht, um Panik zu machen und Angst zu verbreiten.
Die Aufgabe, wichtige wissenschaftliche Fakten gut zu vermitteln, war nie größer – die Gesundheitsgefahr für Skeptiker allerdings auch nicht. Nicola Kuhrt
