die Geschehnisse in Israel dominieren die Nachrichten weiterhin. In der Wissenschaftsgemeinde gab es viele Bekundungen der Anteilnahme und Solidarität. Ausgerechnet von US-amerikanischen Universitäten waren jedoch auch andere Töne zu hören. An der Harvard-University etwa bezeichneten Studierendengruppen “das israelische Regime” als alleinverantwortlich für die Ereignisse. Lange ließ die Uni-Leitung ein klares Statement dazu vermissen. In einem offenen Brief fordern die israelischen Universitätspräsidenten nun die Solidarität der internationalen Community. Über die aktuelle Lage sprach mein Kollege Markus Weisskopf mit der Vizepräsidentin der Tel Aviv University, Milette Shamir.
Vielleicht haben Sie sich schon gefragt, was aus der Serie “Politikberatung, quo vadis?” wurde. Seit Juli haben wir in acht Teilen das Feld der wissenschaftlichen Politikberatung von verschiedenen Seiten beleuchtet. Wir haben Politiker gefragt, was sie sich von der Wissenschaft wünschen und Wissenschaftler gefragt, was ihre Erwartungen an die Politik sind. Wir haben berichtet, wie es in anderen Ländern läuft und die Expertenauswahl thematisiert.
Nach einer kurzen Pause setzen wir die Serie nun fort. Im heutigen neunten Teil stellen wir das Konzept der Politikberatung als Co-Production vor. Der Politikwissenschaftler Andreas Knie vom WZB ist Fürsprecher dieser Methode, die gesellschaftliche Akteure mit einbezieht. Sie könne die Qualität und den Impact von Forschung erhöhen, sagt er. Aber sie würde auch die Reputationsordnung der Wissenschaft radikal verändern.
Eine grundlegende Reform hat das Embryonenschutzgesetz nötig. Seit Jahren ist man sich einig, dass die Forschung mit Embryonen und Stammzellen einen neuen Rechtsrahmen braucht. Doch die Politik war zögerlich. Nun kommt Bewegung in die Debatte, wie unser Autor Rainer Kurlemann berichtet. Auf einer BMBF-Fachkonferenz ging es unter anderem über konkrete Vorschläge für ein Bioethikgesetz.
Gute Lektüre wünscht Ihnen,


Die Präsidenten der israelischen Universitäten kritisieren in einem gemeinsamen offenen Brief die Reaktionen einiger internationaler akademischer Einrichtungen auf den Terrorangriff der Hamas. Gerade die Vorgänge in Harvard, wo Studierendengruppen “das israelische Regime” als alleinverantwortlich für die Ereignisse bezeichneten, riefen in Israel Empörung hervor. Die Unterzeichner des Briefes rufen gemeinsam zu einer klaren Ablehnung und Verurteilung der Gewalt auf und stellen klar, dass die Attacken eben nicht nur “ein weiteres Ereignis” in der Auseinandersetzung zwischen Israelis und Palästinensern seien.
Frau Shamir, die Präsidenten der israelischen Universitäten zeigen sich zumindest teilweise enttäuscht von den Reaktionen der akademischen Welt auf den Terror der Hamas. Waren sich darüber alle einig?
Ja, alle Universitäten haben unterzeichnet. Das bedeutet aber nicht, dass wir von allen Hochschulen weltweit enttäuscht sind, was die Reaktion angeht. Ich denke, das bezieht sich zu einem großen Teil auf die Reaktion einiger Elite-Universitäten in den USA. Das war der Hauptgrund für diese Reaktion. Gerade zu Anfang waren die Reaktionen lauwarm und sehr zurückhaltend. Jetzt sehen wir, in einer zweiten Runde, klarere Statements, die die besondere Situation anerkennen.
Und die deutschen Einrichtungen?
Die Unterstützung, die wir aus Deutschland bekommen haben, ist außergewöhnlich! Wir sehen dort sehr klare Statements der wissenschaftlichen Community. Und wir haben viele Nachrichten mit Unterstützungsangeboten und einfach auch Anteilnahme bekommen. Das wissen wir sehr zu schätzen.
Wie wichtig sind denn diese Statements? Wie wichtig ist diese Unterstützung, auch über die Wahrnehmung an den israelischen Hochschulen hinaus?
Das hat natürlich auch einen Effekt auf die Diskussionen in den sozialen Medien. Dort herrscht ein großer Kampf um die Deutungshoheit. Und wir versuchen, uns auch hier zu engagieren. Beispielsweise organisieren sich unsere internationalen Studierenden in den sozialen Medien, um über die Situation hier zu berichten – gerade in Richtung ihrer Heimatländer. Sie haben dafür eine Taskforce eingerichtet. Das mag einen kleinen Impact haben, aber wir sehen Initiativen wie diese überall im Land.
Welche Aktivitäten gibt es sonst noch an der Tel Aviv University?
Es gibt psychologische und soziale Unterstützung. Wir bieten die Schlafräume, die normalerweise den internationalen Studierenden zur Verfügung stehen, Familien aus dem Süden an. Unsere Students Union ist sehr aktiv und sammelt Hilfsgüter für die betroffenen Gebiete.
Was bedeutet diese Situation für den Lehrbetrieb?
Wir haben den Semesterstart vorerst auf den 5. November verschoben. Hauptgrund dafür ist, dass wir alleine in der TAU mehrere tausend Reservisten unter den Studierenden haben. Und das geht den anderen Universitäten genauso. Internationale Programme laufen aber derzeit schon an. Meine eigene Meinung ist, dass wir trotz allem das Semester bald starten sollten. Am Ende wissen wir nicht, wie lange die Situation andauern wird und letztlich sollten wir auch zurück zu etwas kommen, das sich wie Normalität anfühlt. Auch wenn es eine wirkliche Normalität für lange Zeit hier nicht geben wird.
Wie ist denn die Situation in der Forschung?
Am meisten betrifft uns vermutlich, dass viele internationale Forschende, insbesondere Doktoranden und Postdocs, das Land mittlerweile verlassen haben. Einige können remote arbeiten, aber gerade in den Laboren ist die Arbeit erstmal quasi zum Stillstand gekommen.
Und wie sieht das bei internationalen Kooperationen aus?
Natürlich sind auch die internationalen Forschungskooperationen betroffen. Konferenzen, Workshops, Calls zu gemeinsamen Anträgen, fast alles ist gerade gestoppt und verschoben. Unsere Kollegen hier sind dazu einfach gerade emotional nicht in der Lage. Wir hoffen, dass wir das bald wieder aufnehmen können.
In die Diskussion um die längst überfällige Änderung des Embryonenschutzgesetzes kommt Bewegung. In einer vom BMBF organisierten Fachkonferenz “Humane Embryonen in der medizinischen Forschung: Tabu? Vertretbar? Chance?” haben Experten verschiedener Fachbereiche über zwei Thesenpapiere für einen neuen Rechtsrahmen für die Forschung mit Embryonen und Stammzellen als Empfehlung für die Politik debattiert. Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger unterstrich dabei den Handlungsbedarf: “Embryonenforschung ist wichtig, unsere Gesetze hierzu sind jedoch nicht mehr zeitgemäß”, sagte sie.
Diese Einschätzung teilt auch Rechtswissenschaftler Hans-Georg Dederer von der Universität Passau, Autor eines der beiden sich ergänzenden Thesenpapiere. In Deutschland sei der Rechtsrahmen für eine Forschung, die sich “mit zunehmender Beschleunigung fortentwickelt, seit Jahren praktisch völlig erstarrt”. Dederer warb für einen Wandel von einer “Kultur der Lethargie zu einer Kultur der Dynamik”.
Allerdings betrifft die Neufassung des Gesetzes nicht nur das Wissenschaftsressort. Viele Regelungen im Embryonenschutz behandeln nicht nur Forschungsfragen, sie beeinflussen auch die Möglichkeiten der Reproduktionsmediziner, die Paare mit unerfülltem Kinderwunsch behandeln. Die Zuständigkeit für diese Aspekte liegt beim Gesundheitsministerium. Von dort könnte auch ein Impuls für die Neujustierung des Embryonenschutzgesetzes ausgehen, denn die Ampelkoalition hat bereits im Koalitionsvertrag festgeschrieben, dass sie den bisher verbotenen “elektiven Single Embryo Transfer” (eSET) in der Fortpflanzungsmedizin erlauben will.
Beim eSET werden während der künstlichen Befruchtung mehr Embryonen erzeugt, als auf die Frau übertragen werden. Danach wird ein Embryo ausgewählt und nur der mit den größten Entwicklungschancen in die Gebärmutter eingesetzt. Die ärztlichen Fachgesellschaften fordern die Zulassung seit Jahren, ebenso wie die Leopoldina. Die Akademien hatten schon 2021 gewarnt, dass die geltende Rechtslage die Fortpflanzungsmediziner in Deutschland nicht selten zu einer Behandlung zwinge, die dem heutigen internationalen Stand nicht mehr angemessenen sei und zu unnötigen Risiken für Mutter und Kind führe.
Um eSET ging es bei der BMBF-Tagung nicht, dennoch spielten die Auswirkungen eine große Rolle. Denn sein Einsatz führt fast unweigerlich zu überzähligen Embryonen, die für die Familienplanung der Paare nicht mehr benötigt werden. Sie werden in Kälteschränken konserviert, bis sie entweder von anderen Paaren adoptiert (was selten vorkommt und rechtlich bisher kaum geregelt ist) oder “verworfen”, also aufgetaut, werden und absterben. Solche überzähligen Embryonen gibt es vermutlich schon mit den geltenden Regelungen, doch deren Zahl ist umstritten. Viele Experten schätzen, dass in deutschen Fortpflanzungskliniken etwa 50.000 Stück lagern, andere verweisen darauf, dass die befruchteten Eizellen im Vorkernstadium eingefroren werden, das rechtlich anders bewertet wird, aber biologisch nur einige Minuten vom Embryo entfernt ist.
Hans-Georg Dederer schlägt nun vor, ein Bioethikgesetz als übergreifenden, dynamisierten Rechtsrahmen zu schaffen, das auch die Forschung an und mit Stammzellen und Embryonen behandelt. So könnten die Paare überzählige IVF-Embryos nach ausführlicher Information unentgeltlich der Forschung spenden, die sie dann zur Herstellung von embryonalen Stammzellen nutzen oder an den Embryonen direkt forschen dürfte. Das Gesetz könnte dann die Verwendung pluripotenter menschlicher Stammzellen einheitlich regeln, unabhängig davon, aus welcher Quelle sie stammen.
Auch im anderen Thesenpapier, das der Medizinethiker und Jurist Jochen Taupitz sowie Claudia Wiesemann, Direktorin für Ethik der Medizin an der Uni Göttingen, verfasst haben, heißt es, dass eine gesetzgeberische Entscheidung, Forschung an Embryonen zu hochrangigen Zielen zu erlauben, sofern für sie keine andere Perspektive als Vernichtung oder dauerhafte Kryokonservierung bestehe, nicht nur moralisch, sondern auch verfassungsrechtlich als vertretbar angesehen werde. Hochrangige Forschungsziele gibt es mehrere: Ein besseres Verständnis der Entwicklung des menschlichen Embryos in den ersten Tagen könnte wertvolle Hinweise liefern, warum viele Schwangerschaften mit Fehlgeburten enden und welche Einflüsse das heranwachsende Leben schädigen können. Zudem könnte dieses Wissen die Erfolgsquote der künstlichen Befruchtung verbessern, derzeit führen nur etwa 30 Prozent der Behandlungen zu einer Geburt.
Die Vorschläge der Experten verändern das Konzept des Embryonenschutzes. Sie knüpfen ihn weniger an die bloße Existenz des Embryos als Ergebnis der Verschmelzung von Eizelle und Spermium. Im Vordergrund steht vielmehr die Fähigkeit der Entität, sich prinzipiell aus sich heraus zu einem geborenen Menschen entwickeln zu können. Der Schutzanspruch eines Embryos wächst mit der Entwicklung, beispielsweise mit der Ausbildung der Empfindungsfähigkeit.
Sogenannte Embryoide, also embryoähnliche Zellansammlungen, die mittels Stammzelltechniken im Labor aus gewöhnlichen Körperzellen gezüchtet werden können und lediglich als Modell für die Embryonenforschung dienen, sollen keinen gesetzlichen Schutz erhalten. Dederer schlägt aber vor, dass die Erzeugung dieser Embryoide im Vorfeld beim Robert-Koch-Institut gemeldet werden muss.
In der Diskussion zeichneten sich auch klare Verbote ab. Dazu gehört der Handel mit Embryonen, die Herstellung von Embryonen allein zu Forschungszwecken, das reproduktive Klonen, die gezielte Keimbahnveränderung mit Auswirkungen auf einen geborenen Menschen und die Herbeiführung einer Schwangerschaft durch Verwendung von Embryoiden. Rainer Kurlemann

Die Idee, dass Akteure, die nicht ausschließlich der Academia angehören, gemeinsam Wissen erarbeiten, existiert unter dem Begriff “Co-Production of Knowledge” bereits seit mehr als 20 Jahren. Die österreichische Soziologin und Wissenschaftsforscherin Helga Novotny hat sie in Spiel gebracht. Ihr ging es darum, Expertise zu demokratisieren und die Qualitätskontrolle von Wissen nicht allein der Wissenschaft zu überlassen.
“Das ist auch für die Politikberatung ein guter Ansatz”, sagt der Politikwissenschaftler Andreas Knie vom Wissenschaftszentrum für Sozialforschung Berlin (WZB). Ihn überzeugt Novotnys Argumentation, wonach Wissen nur dann sozial robust ist, wenn es in der Realität stimmt. “Wissenschaft macht ihre Annahmen stets unter Modell- oder Idealbedingungen”, sagt er. Endgültige Wahrheiten oder “den einen richtigen Weg” könne sie nicht aufzeigen. “Wenn Politik, Wissenschaft und gesellschaftliche Akteure gemeinsam an großen gesellschaftlichen Fragen arbeiten, bietet das den Vorteil der doppelten Validierung”, sagt er. Denn wissenschaftliche Ergebnisse würden einerseits in der Forschung, andererseits auch in der Praxis geprüft. Gegebenenfalls wird nachjustiert.
Die Themen für wissenschaftliche Politikberatung als Co-Production können von der Politik gesetzt werden, aber auch eine Initiative aus der Wissenschaft oder Zivilgesellschaft sein. Knie: “Was dann folgt, ist kein geordneter Prozess, sondern ein planloses, ergebnisoffenes und wechselweises Vorgehen. Je intensiver es abläuft, desto fruchtbarer ist die Arbeit.”
Diese Vorteile der Methode nennt er:
Knie hat als Leiter der WZB-Forschungsgruppe “Digitale Mobilität und gesellschaftliche Differenzierung” bereits einige Co-Produktion-Projekte verwirklicht. “Wir haben mit dieser Methode das aktuelle Carsharing- und das Elektromobilitätsgesetz erarbeitet und an Änderungen des Personenbeförderungsgesetzes mitgewirkt.” Auch bei der Umnutzung von KFZ-Stellflächen im Berliner Graefekiez arbeite sein Team gemeinsam mit dem Bezirksamt an einem neuen Planwerk.
Die Idee der Co-Production lasse sich auf viele Felder, Fächer und Fragestellungen anwenden, sagt er. In der Praxis ist diese partizipative Form der wissenschaftlichen Politikberatung jedoch die Ausnahme. Viele hielten sie auch für utopisch.
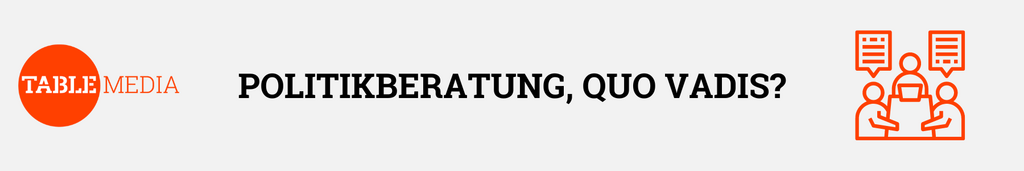
Den Historiker Caspar Hirschi von der Universität St. Gallen/Schweiz stört daran eher die “ökonomistische” Betrachtung. “Das Konzept der Co-Production ist wie jenes der Co-Creation von der Innovationsrhetorik der Managementforschung geprägt”, sagt er. Dahinter stehe die Idee, dass neue Produkte bei Kunden größere Nachfrage und Akzeptanz finden, wenn sie von diesen mitgestaltet werden. “Es wird also ein Begriff von der Wirtschaft auf die Demokratie übertragen. Das finde ich recht heikel.”
Es bleibe unklar, wer in welcher Rolle und mit welchen Kompetenzen Beratung leistet, kritisiert Hirschi, der unter anderem über die Rollen des Kritikers, Experten und Intellektuellen forscht. Ein Problem dabei sei die Fixierung auf ein “Produkt”. Hirschi: “In meinem Verständnis sind Expertise im Allgemeinen und Politikberatung im Besonderen keine Produktionsprozesse im wirtschaftlichen Sinn, sondern vielmehr ein zentraler Teil von politischen Aushandlungsprozessen, die letztlich auf die öffentliche Legitimation der Demokratie ausgerichtet sind.”
Co-Production habe nichts gemein mit wirtschaftlichem Tun, sondern diene der Wissens- und Erkenntnisverbesserung, betont Andreas Knie. Dass die Wissenschaft lieber an der hierarchischen Politikberatung festhält, erklärt er vor allem mit den Beharrungskräften des Systems. “Der Ansatz der Co-Production würde die Reputationsordnung radikal verändern. Er würde sich auf die Bewertung der Qualität von Wissenschaft, auf Karrierewege und auf die Ressourcenzuteilung auswirken.”
Denn bei dieser Form der Erarbeitung von Wissen würden die Ergebnisse auch extern bewertet. “Bislang entscheidet die Wissenschaft ausschließlich selbst, was gute Wissenschaft ist.” Dieses Bewertungsmonopol gewähre die Gesellschaft im Vertrauen darauf, dass nützliche Erkenntnisse erzielt werden. Knie sieht die Zeit gekommen, diesen ungeschriebenen gesellschaftlichen Vertrag zu hinterfragen. “Die Selbstreferenzialität ist zu hoch im deutschen akademischen System. Andere Übersetzungen und Interaktionen sind erforderlich.”
Seine Forderung: “Wir müssen uns mit unseren Ergebnissen systematischer als bisher in einen anderen Referenzbereich begeben: Extended Review statt Peer Rewiew.” Es gelte zu überprüfen, ob das, “was wir uns intern gegenseitig als Wahrheit in die Bücher schreiben, auch extern so funktioniert”. Er ist froh, dass hierzulande allmählich die Debatte darüber in Gang kommt, beispielsweise auch bei Projekten der Volkswagenstiftung. Denn auch international werde vermehrt über Wirksamkeitsmessung und Evaluation diskutiert. Knie: “In den USA und England ist man in dieser Hinsicht schon viel weiter. Dort müssen Forschende laufend Wirksamkeitsnachweise liefern und es wird zum Beispiel nachverfolgt, wo die Absolventen hingehen.”
Vor allem die deutsche Wissenschaft habe zunehmend ein Impact-Problem, sagt der Politologe. “Die Anwendbarkeit von Wissenschaft muss in den Vordergrund rücken.” Und dafür sei die Politik gefragt, die bisher nur kulissenhaft auf Impact und Wirksamkeit achte, während faktisch weiter nach klassischen Kriterien gearbeitet werde. Knie: “Die Wissenschaftspolitik muss sich verstärkt damit befassen, wie sich der Impact der Wissenschaft erhöht, wie man die Co-Production etabliert und auch in die Reputationsordnung hineinbringt. Das kann sie vor allem dadurch bewirken, dass sie finanzielle Anreize schafft.”
Die Serie “Politikberatung, quo vadis?” finden Sie gesammelt hier.
18. Oktober 2023, Berlin
DAAD-Policy Talk Internationale Wissenschaftskooperationen im Kontext einer Nationalen Sicherheitsstrategie Mehr
1.-10. November 2023, Berlin
Wissenschaftsfestival Berlin Science Week Mehr
7.-9. November 2023, Berlin
Konferenz Falling Walls Science Summit 2023 Mehr
15.-17. November 2023, Bielefeld
Konferenz Forum Wissenschaftskommunikation – Kontrovers, aber fair – Impulse für eine neue Debattenkultur Mehr
16. November 2023, Wilhelm Büchner Hochschule, Darmstadt
Tagung WBH Wissenschaftsforum 2023 – “Transformation gestalten” Mehr
In einem Maßgabebeschluss hat der Haushaltsausschuss des Bundestages vergangene Woche ein “Konzept für ein befristetes Programm zum Ausbau wissenschaftlicher Dauerstellen neben der Professur” eingefordert. Damit soll das BMBF wohl an ein Versprechen aus dem Koalitionsvertrag erinnert werden. Dort hatten SPD, Grüne und FDP angekündigt, mit einem Bund-Länder-Programm Best-Practice-Projekte für alternative Karrieren außerhalb der Professur zu fördern.
Im Gespräch mit Table.Media gibt sich Staatssekretär Jens Brandenburg angesichts des Beschlusses gelassen: “Natürlich setzt der Haushaltsausschuss thematische Schwerpunkte, das ist nicht verwunderlich.”
Brandenburg betont, dass das BMBF bereits an einem Konzept für mehr Planbarkeit, Verlässlichkeit und Transparenz von Karrieren in der Wissenschaft arbeite. Der Beschluss aus dem Haushaltsausschuss sei jedoch nochmals ein “wichtiger Impuls”, den man in die weitere Arbeit aufnehmen wolle.
Finanzausschuss-Mitglied Bruno Hönel (Grüne) begründete den Beschluss im Haushaltsausschuss hingegen damit, dass “zum aktuellen Zeitpunkt noch kein Konzept zu Dauerstellen im Mittelbau vorliegt und auch keine Entwicklungen erkennbar sind”. Wiebke Esdar (SPD), ebenfalls Mitglied des Haushaltsausschusses, erwartet vom BMBF das Konzept “zu den Haushaltsberatungen für das Jahr 2025”.
Jens Brandenburg wollte sich noch nicht dazu äußern, wann das Konzept fertig wird. Auch zum aktuellen Stand des WissZeitVG machte er keine genaueren Angaben. Dieses befinde sich nach der Verbändeanhörung derzeit in der Ressortabstimmung. Wann ein Kabinettsbeschluss erfolgen kann, bleibt unklar. mw/nik
Die deutschen Institutes for Advanced Study (IAS) sehen sich als “Innovationsmotoren für die Wissenschaft und als Inkubatoren für Forschungsideen”. Ihre Beiträge zur deutschen Wissenschaftslandschaft, aber auch ihre Bedürfnisse, wollen sie künftig besser sichtbar machen. Auf einem Treffen Anfang Oktober am Hanse-Wissenschaftskolleg in Delmenhorst hat das 2022 gegründete Netzwerk der deutschen IAS, an dem sich bislang 20 der insgesamt 24 IAS aktiv beteiligen, dazu ein entsprechendes Positionspapier verabschiedet.
IAS böten eine “einzigartige Vielfalt” an wissenschaftlichen Förderangeboten, heißt es in dem Papier. Schwerpunkte seien Spitzenforschung und Internationalisierung, Forschende in frühen Karrierestufen, Einzel- und Gruppenforschung sowie in letzter Zeit verstärkt auch Interdisziplinarität.
Durch den Austausch der Fellows über Fächergrenzen hinweg sowie die Vernetzung und Zusammenarbeit zwischen den Disziplinen kämen unterschiedlichste Wissenschaftsbereiche zusammen, es entstünden sonst zu selten vorhandene Experimentierräume. “Denn Innovation entsteht gerade im Zusammenwirken herausragender Forschender mit Zeit für wissenschaftliche Tiefe und Reflexion.”
Durch ihre meist überschaubare Größe und ihre Fähigkeit, Förderinstrumente zügig und flexibel auf neu entstehende Forschungsfelder ausrichten zu können, tragen IAS maßgeblich zu einem agilen und innovativen Wissenschaftsbetrieb bei, betont das Netzwerk.
Um ihren Auftrag als Innovationsmotor und Inkubator weiter erfüllen zu können, bedürfe es größerer programmatischer und finanzieller Autonomie, fordern die IAS. Als Beispiel nennen sie rechtlich festgeschriebene Gestaltungsspielräume und abgestimmte materielle Förderung. Die IAS weisen darauf hin, dass der Wissenschaftsrat dies bereits 2021 in einer Stellungnahme gefordert hat.
“Viele IAS wurden ursprünglich als Teile der Exzellenzinitiative eingerichtet“, sagt Bijan Kafi, Sprecher des Hanse-Wissenschaftskolleg (Institute for Advanced Study) in Delmenhorst. Die Institute suchten daher vorrangig maßgeschneiderte Förderprogramme auch jenseits dieser Initiative. “Bisher fehlen nationale Förderprogramme auch für eventuelle Kooperation von IAS.” Die EU biete einzelne, wenige Möglichkeiten. Kafi: “Unser Interesse ist, Möglichkeiten zur Förderung zur eröffnen, die stabiler sind als die bisherigen, wie es auch der deutsche Wissenschaftsrat gefordert hat.”
Obwohl sie die Forschungspotenziale vieler Universitäten messbar stärkten, erfahre ihre Arbeit jedoch noch zu selten entsprechende Wahrnehmung. An den 24 IAS hierzulande arbeiten insgesamt jährlich etwa 450 Fellows, davon sind fast 60 Prozent international. Hauptgeldgeber sind oft die Länder mit ihren Universitäten und die deutsche Exzellenzinitiative, daneben auch einzelne Stiftungen, in wenigen Einzelfällen auch einzelne Mäzene. abg
Die Gründungskommission der Deutschen Agentur für Transfer und Innovation (Dati) hat ihre Arbeit aufgenommen. 16 Expertinnnen und Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft gehören dem Gremium an. Es hat den Auftrag, Empfehlungen zu inhaltlichen und prozeduralen Aspekten beim Auf- und Ausbau der Dati zu geben. Daneben soll die Kommission auch Vorschläge für den Standort entwickeln. Hier hatten sich offenbar bereits einige Kandidatenstädte aktiv ins Spiel gebracht. Nicht ganz einfach wird vermutlich auch die Aufgabe, Vorschläge für das Leitungspersonal, insbesondere die Geschäftsführung zu entwickeln.
Den Vorsitz der Kommission wird Stefan Groß-Selbeck von der Boston Consulting Group übernehmen. Die weiteren Mitglieder sind:
Die Planung der Agentur hatte sich lange hingezogen und für viel Unmut bei den Beteiligten gesorgt. Unklar war lange, ob Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) Hauptadressaten der Förderung bleiben sollen, oder ob auch andere Organisationen Anträge stellen und Förderung erhalten dürfen. Inzwischen scheint klar, dass die Dati akteursoffen sein wird. Die Pilotförderrichtlinien wurden im Juli veröffentlicht. mw

Deutschland ächzt unter den Lasten der Bürokratie. Auch in der Wissenschaft. Dort ist die Verunsicherung aktuell besonders groß, seit der Bundesrechnungshof im Frühjahr seinen Bericht zu “Ausgewählten Aspekten der Haushalts- und Wirtschaftsprüfung der Fraunhofer-Gesellschaft” veröffentlicht hat. Mit diesem Bericht hat er die größte deutsche Forschungseinrichtung für angewandte Forschung in eine Führungskrise gestürzt, indem er den Finger in die Wunde mangelnder Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der Gesellschaft legte. Der Bericht wirkt jedoch weit über die Fraunhofer-Gesellschaft hinaus. Die gesamte deutsche Wissenschaft ist alarmiert – und verunsichert: Bewirtungen, Jurysitzungen, Klausurtagungen werden vermieden, aus Angst, wegen eines Formfehlers als Nächstes am öffentlichen Pranger zu stehen. Muss diese Überreaktionen sein?
Zunächst: Die Budgets für Reisen, Bewirtungen und Dienstwagen sind aus gutem Grund streng reglementiert. Diejenigen, die mit dem Geld der Steuerzahlerinnen und -zahler bezahlt werden, müssen verantwortungsvoll damit umgehen. Wer gegen die Regeln verstößt, verdient Kritik und muss Abhilfe schaffen. Derzeit aber laufen wir Gefahr, das Kind mit dem Bade auszuschütten und alles bis ins Detail zu regeln, um Missbrauch auszuschließen.
Fünf Prinzipien können der deutschen Wissenschaft helfen, ihre Verantwortung mit Augenmaß wahrzunehmen und Bürokratielasten zu begrenzen. An erster Stelle ist dies Souveränität: Es gilt, den Geist der Regelungen – vom Reisekostenrecht bis zu Bewirtungsregelungen – zu verstehen und souverän damit umzugehen. Nicht für jedes Detail gibt es eine Vorschrift. Es muss zudem immer auch Ausnahmen geben dürfen. Dann aber gilt: Die Umstände müssen dokumentiert, der Ausnahmefall muss begründet werden.
Hinzu kommt Klarheit: Glaubwürdigkeit nach außen gewinnt man nur, wenn es in einer Organisation klare Anleitungen gibt. Wissenschaftsorganisationen und Forschungseinrichtungen brauchen deshalb sogenannte Compliance Management Systeme. Sie benennen die rechtlichen und organisatorischen Vorschriften und organisieren, wie sie zu befolgen sind. Wichtig ist: Solche internen Regelwerke dürfen keine zahnlosen Papiertiger sein, sondern müssen in der Praxis gelebt werden. Dazu gehören Schulungen, auch für diejenigen, die sonst eher als Lehrende wirken, also das wissenschaftliche Personal.
Bei alledem braucht es jedoch Augenmaß. Bürokratielasten aus Angst zu erhöhen, im Detail ja keine Fehler zu machen, ist kontraproduktiv, insbesondere dann, wenn das eigentliche wissenschaftliche Arbeitsziel dabei zweitrangig wird oder gar aus den Augen gerät.
Gefordert sind auch die öffentlichen Geldgeber – und dort braucht es eine gehörige Portion Realismus. Angesichts der inflationsgetriebenen Preisentwicklung müssen sie Kostenobergrenzen, etwa für Dienstreisen, überprüfen und Ermessensspielräume öffnen. Denn Rechnungshöfe können nur das prüfen, was die öffentlichen Geldgeber als Regel verbindlich machen.
Schließlich: Warum nicht miteinander reden? Auch die Prüfbehörden können aufgrund ihres Erfahrungsschatzes fundierten Rat geben, welche Ermessensspielräume angemessen sind, wann Ausnahmeregelungen greifen und wie diese nachzuweisen sind. Mein Fazit: Um die aktuelle Angststarre zu überwinden, empfiehlt sich für Kontrolleure wie Kontrollierte ein schlichtes, aber wirkungsvolles Mittel: Bereitschaft zum offenen Dialog. Ohne Vorbehalte und mit Vertrauensvorschuss.

Doris Weßels ist eine der führenden Forscherinnen in Deutschland auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz. Als Professorin für Wirtschaftsinformatik an der Fachhochschule Kiel forscht sie insbesondere zur Frage, wie wir unser Bildungssystem an die aktuellen Entwicklungen anpassen müssen. Und kann sich – nach langem Wirken in der Nische – seit dem Launch von ChatGPT letzten Dezember kaum vor Medienanfragen retten.
Schock, Kreislaufprobleme, Unruhe. Oder aber: Erleichterung, Freude, Euphorie. Wenn Doris Weßels beschreibt, wie unterschiedlich Menschen bei ihren Workshops auf KI-Tools wie ChatGPT und Co. reagieren, kommt keine körperliche Regung zu kurz. “Ich kann das nachvollziehen. Bei mir war es nicht anders.” Die Veröffentlichung von ChatGPT am 30. November 2022 bezeichnet sie als einschneidendes Erlebnis: “Angesichts dieser spürbaren disruptiven Kraft schwirrten immer mehr Fragen durch meinen Kopf und ich musste mich erst einmal sammeln.” Keine andere IT-Innovation habe sie in 30 Jahren als Wirtschaftsinformatikerin derartig fasziniert und zugleich beunruhigt.
Allein war sie damit nicht: Den anschließenden Ansturm an Medienanfragen beschreibt sie als einen Knoten, der platzte: “Die Presse hat unser Virtuelles KI-Kompetenzzentrum “Schreiben lehren und lernen mit KI” von 0 auf 100 zugeschüttet.” Von Schulen, Hochschulen, Pressevertretern und Verbänden bis zu Vereinen, sei in den ersten Monaten alles dabei gewesen. Weßels ist sich dabei sicher: Wer zum ersten Mal mit ChatGPT herumgespielt hatte, wurde sich schnell der disruptiven Kraft von KI bewusst und stellte sich die Frage, wie der eigene Arbeitsplatz mit Schreibaufgaben zukünftig aussehen würde oder sogar obsolet werden könnte.
Mit Künstlicher Intelligenz kam die gebürtige Oldenburgerin zum ersten Mal in ihrem Mathematik- und Wirtschaftsstudium an der Universität Münster in Kontakt, sowie später im Management eines Softwareunternehmens. Nach zwölf Jahren in der freien Wirtschaft kam sie schließlich 2004 als Professorin für Wirtschaftsinformatik zurück in die Forschung. “Das ist mittlerweile fast 20 Jahre her, aber wegen meiner recht langen Berufstätigkeit in der freien Wirtschaft gelte ich als Exotin unter den Hochschullehrenden“, sagt Weßels lachend.
Auf die Schnittstelle von KI und Bildung wurde sie ab 2018 aufmerksam, als sie die immer größeren Leistungssprünge von KI-Tools für Übersetzungen und Umformulierungen bemerkte. Seit 2021 forscht sie daher in einem Forschungsprojekt zur Nutzung von KI beim akademischen Schreiben aus der Sicht von Studierenden, das durch das Land Schleswig-Holstein gefördert wird. Zusätzlich leistet sie seit September 2022 Aufklärungsarbeit im von ihr mitgegründeten bundesweiten Kompetenzzentrum “Schreiben lehren und lernen mit Künstlicher Intelligenz”. Die größte Herausforderung besteht für sie dabei darin, allen entscheidenden Köpfen des Bildungssystems die disruptive Komplexität von KI zu vermitteln. Die Innovationssprünge der KI zu ignorieren, ist für sie nämlich keine Option. “Natürlich wäre business as usual für alle die einfachste Variante. Aber damit führen wir unseren Bildungsauftrag ad absurdum.”
Als ehemalige Key Account Managerin verfolgt Weßels das Verhalten der Anbieter – in diesem Fall die weltweit führenden Tech-Giganten – und ihre Marketingstrategien besonders aufmerksam. “Manchmal denke ich, es ist wie bei einem Strategiespiel.” Und sie fügt schmunzelnd hinzu, wie gerne sie einmal bei Open AI oder Google in deren Headquarter Mäuschen spielen würde.
Der EU schreibt sie angesichts fehlender europäischer Anbieter derzeit eher eine Zuschauerrolle zu. Was die Erfolgsaussichten des europäischen AI-Acts betrifft, ist Weßels daher skeptisch: “Wir müssen dieser digitalen Disruption eigentlich mit einem radikalen Umbau unserer politischen Systeme für die Regulierung und das permanente Monitoring generativer KI begegnen.” Die Relevanz der Digitalisierung – und hier speziell der KI-Technologien – für die Zukunft unserer Wirtschaft und Gesellschaft in Deutschland rücke zwar immer mehr ins Bewusstsein, werde aber noch nicht mit der notwendigen Priorität behandelt.
In Analogie zu den umfassenden und neuartigen Herausforderungen einer “General Purpose AI” empfiehlt Weßels daher eine ressortübergreifende und interministeriell gebildete neue Organisationseinheit, die ein kontinuierliches Monitoring der Entwicklung generativer KI-Systeme und eine gezielte und zeitnahe Steuerung dieser Entwicklung ermöglicht. Carlos Hanke Barajas
Mai Thi Nguyen-Kim wird Mercator-Professorin an der Universität Duisburg-Essen.
Angelika Altmann-Dieses und Philipp von Ritter zu Groenesteyn sind als Rektorin und Kanzler der Hochschule Mannheim seit dem 1. Oktober im Amt.
Wolfgang Wahlster wurde am 12. Oktober im New Institute in Hamburg in die 2009 vom Manager Magazin initiierte Hall of Fame der deutschen Forschung aufgenommen. Geehrt wurde auch Claudia Felser, Direktorin des Max-Planck-Institut für Chemische Physik fester Stoffe.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!
Europe.Table. AI Act: Dinner der Entscheidung. Die Trilog-Verhandlungen zum AI Act auf technischer Ebene kommen nur schleppend voran. Dragoș Tudorache (Renew), einer der beiden Berichterstatter für den AI Act, hat nun für diesen Montag zu einem Abendessen eingeladen, um die Verhandlungen auf politischer Ebene zu beschleunigen. Mehr
Europe.Table. Glyphosat: Agrarminister müssen sich mit Kommissionsvorschlag befassen. Die EU-Mitgliedstaaten haben sich auf Expertenebene noch nicht über die Zukunft des umstrittenen Herbizids einigen können. In der Abstimmung am Freitag im Ständigen Ausschuss für Pflanzen, Tiere, Lebens- und Futtermittel (SCoPAFF) fand der Vorschlag der Kommission für eine erneute Zulassung keine qualifizierte Mehrheit. Nun müssen sich die Agrarminister der Mitgliedstaaten mit dem Kommissionsvorschlag befassen. Mehr
Agrifood.Table. Studie: Gentechnik macht Hühner gegen Vogelgrippe resistent. Mittels Genom-Editierung können Hühner gegen das Vogelgrippevirus resistent werden. Das ist das Ergebnis einer britischen Studie, die vergangene Woche im Fachjournal “Nature Communications” erschienen ist. Mehr

Zum Abschluss was Süßes: Wir möchten Sie mit Lua bekannt machen, einem Karibischen Nagelmanati-Weibchen. Die Rundschwanzseekuh ist 31 Jahre alt und hat einiges in ihrem Leben durchgemacht. Als Jungtier verwaiste sie und strandete im Nordosten Brasiliens. Doch sie hatte Glück. Sie kam in eine Naturschutzstation, wurde aufgepäppelt und gehörte 1994 zu den ersten Nagelmanati-Individuen, die wieder ausgewildert wurden.
Das Programm wurde gestartet, um die Bestände der einst häufig vorkommenden Art zu sichern. Es war erfolgreich. Und das dürfte auch an Lua liegen. Weil sie ihre Zutraulichkeit zu Menschen nie verloren hat, wurde sie zum Promi unter den Karibischen Nagelmanatis. Flagship-Animal nennt das Forscherteam um Ivan Jarić von der Universität Paris-Saclay in Frankreich und der Tschechischen Akademie der Wissenschaften diese Funktion als Aushängeschild. Damit lasse sich der Naturschutz enorm voranbringen, schreiben die Forscher in einer aktuellen Studie. Einzelne Tiere oder Pflanzen hätten ein enormes Potenzial, das Bewusstsein zu schärfen und die Öffentlichkeit zu mobilisieren.
Ein prominentes und irgendwie auch vermenschlichtes Tier zu sein, hat aber auch Schattenseiten, wie sich an Luas Beispiel zeigt. Gutmütig und zutraulich wie sie ist, hatten bereits viele Menschen von Ausflugsbooten aus Kontakt mit ihr. Und so wurde sie mal mit gebratenem Fisch gefüttert, mal haben Touristen versucht, ihr Bier einzuflößen.
Lua hat überlebt und ihren Beitrag zum Erhalt von Trichechus manatus manatus geleistet. Bei anderen bedrohten Arten kam die Personifizierung zu spät: Lonesome George starb 2012 als letzte Galápagos-Riesenschildkröte der Unterart Pinta-Riesenschildkröte. Und mit Sudan verschied 2018 das letzte Nördliche Breitmaulnashorn-Männchen. Anne Brüning
die Geschehnisse in Israel dominieren die Nachrichten weiterhin. In der Wissenschaftsgemeinde gab es viele Bekundungen der Anteilnahme und Solidarität. Ausgerechnet von US-amerikanischen Universitäten waren jedoch auch andere Töne zu hören. An der Harvard-University etwa bezeichneten Studierendengruppen “das israelische Regime” als alleinverantwortlich für die Ereignisse. Lange ließ die Uni-Leitung ein klares Statement dazu vermissen. In einem offenen Brief fordern die israelischen Universitätspräsidenten nun die Solidarität der internationalen Community. Über die aktuelle Lage sprach mein Kollege Markus Weisskopf mit der Vizepräsidentin der Tel Aviv University, Milette Shamir.
Vielleicht haben Sie sich schon gefragt, was aus der Serie “Politikberatung, quo vadis?” wurde. Seit Juli haben wir in acht Teilen das Feld der wissenschaftlichen Politikberatung von verschiedenen Seiten beleuchtet. Wir haben Politiker gefragt, was sie sich von der Wissenschaft wünschen und Wissenschaftler gefragt, was ihre Erwartungen an die Politik sind. Wir haben berichtet, wie es in anderen Ländern läuft und die Expertenauswahl thematisiert.
Nach einer kurzen Pause setzen wir die Serie nun fort. Im heutigen neunten Teil stellen wir das Konzept der Politikberatung als Co-Production vor. Der Politikwissenschaftler Andreas Knie vom WZB ist Fürsprecher dieser Methode, die gesellschaftliche Akteure mit einbezieht. Sie könne die Qualität und den Impact von Forschung erhöhen, sagt er. Aber sie würde auch die Reputationsordnung der Wissenschaft radikal verändern.
Eine grundlegende Reform hat das Embryonenschutzgesetz nötig. Seit Jahren ist man sich einig, dass die Forschung mit Embryonen und Stammzellen einen neuen Rechtsrahmen braucht. Doch die Politik war zögerlich. Nun kommt Bewegung in die Debatte, wie unser Autor Rainer Kurlemann berichtet. Auf einer BMBF-Fachkonferenz ging es unter anderem über konkrete Vorschläge für ein Bioethikgesetz.
Gute Lektüre wünscht Ihnen,


Die Präsidenten der israelischen Universitäten kritisieren in einem gemeinsamen offenen Brief die Reaktionen einiger internationaler akademischer Einrichtungen auf den Terrorangriff der Hamas. Gerade die Vorgänge in Harvard, wo Studierendengruppen “das israelische Regime” als alleinverantwortlich für die Ereignisse bezeichneten, riefen in Israel Empörung hervor. Die Unterzeichner des Briefes rufen gemeinsam zu einer klaren Ablehnung und Verurteilung der Gewalt auf und stellen klar, dass die Attacken eben nicht nur “ein weiteres Ereignis” in der Auseinandersetzung zwischen Israelis und Palästinensern seien.
Frau Shamir, die Präsidenten der israelischen Universitäten zeigen sich zumindest teilweise enttäuscht von den Reaktionen der akademischen Welt auf den Terror der Hamas. Waren sich darüber alle einig?
Ja, alle Universitäten haben unterzeichnet. Das bedeutet aber nicht, dass wir von allen Hochschulen weltweit enttäuscht sind, was die Reaktion angeht. Ich denke, das bezieht sich zu einem großen Teil auf die Reaktion einiger Elite-Universitäten in den USA. Das war der Hauptgrund für diese Reaktion. Gerade zu Anfang waren die Reaktionen lauwarm und sehr zurückhaltend. Jetzt sehen wir, in einer zweiten Runde, klarere Statements, die die besondere Situation anerkennen.
Und die deutschen Einrichtungen?
Die Unterstützung, die wir aus Deutschland bekommen haben, ist außergewöhnlich! Wir sehen dort sehr klare Statements der wissenschaftlichen Community. Und wir haben viele Nachrichten mit Unterstützungsangeboten und einfach auch Anteilnahme bekommen. Das wissen wir sehr zu schätzen.
Wie wichtig sind denn diese Statements? Wie wichtig ist diese Unterstützung, auch über die Wahrnehmung an den israelischen Hochschulen hinaus?
Das hat natürlich auch einen Effekt auf die Diskussionen in den sozialen Medien. Dort herrscht ein großer Kampf um die Deutungshoheit. Und wir versuchen, uns auch hier zu engagieren. Beispielsweise organisieren sich unsere internationalen Studierenden in den sozialen Medien, um über die Situation hier zu berichten – gerade in Richtung ihrer Heimatländer. Sie haben dafür eine Taskforce eingerichtet. Das mag einen kleinen Impact haben, aber wir sehen Initiativen wie diese überall im Land.
Welche Aktivitäten gibt es sonst noch an der Tel Aviv University?
Es gibt psychologische und soziale Unterstützung. Wir bieten die Schlafräume, die normalerweise den internationalen Studierenden zur Verfügung stehen, Familien aus dem Süden an. Unsere Students Union ist sehr aktiv und sammelt Hilfsgüter für die betroffenen Gebiete.
Was bedeutet diese Situation für den Lehrbetrieb?
Wir haben den Semesterstart vorerst auf den 5. November verschoben. Hauptgrund dafür ist, dass wir alleine in der TAU mehrere tausend Reservisten unter den Studierenden haben. Und das geht den anderen Universitäten genauso. Internationale Programme laufen aber derzeit schon an. Meine eigene Meinung ist, dass wir trotz allem das Semester bald starten sollten. Am Ende wissen wir nicht, wie lange die Situation andauern wird und letztlich sollten wir auch zurück zu etwas kommen, das sich wie Normalität anfühlt. Auch wenn es eine wirkliche Normalität für lange Zeit hier nicht geben wird.
Wie ist denn die Situation in der Forschung?
Am meisten betrifft uns vermutlich, dass viele internationale Forschende, insbesondere Doktoranden und Postdocs, das Land mittlerweile verlassen haben. Einige können remote arbeiten, aber gerade in den Laboren ist die Arbeit erstmal quasi zum Stillstand gekommen.
Und wie sieht das bei internationalen Kooperationen aus?
Natürlich sind auch die internationalen Forschungskooperationen betroffen. Konferenzen, Workshops, Calls zu gemeinsamen Anträgen, fast alles ist gerade gestoppt und verschoben. Unsere Kollegen hier sind dazu einfach gerade emotional nicht in der Lage. Wir hoffen, dass wir das bald wieder aufnehmen können.
In die Diskussion um die längst überfällige Änderung des Embryonenschutzgesetzes kommt Bewegung. In einer vom BMBF organisierten Fachkonferenz “Humane Embryonen in der medizinischen Forschung: Tabu? Vertretbar? Chance?” haben Experten verschiedener Fachbereiche über zwei Thesenpapiere für einen neuen Rechtsrahmen für die Forschung mit Embryonen und Stammzellen als Empfehlung für die Politik debattiert. Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger unterstrich dabei den Handlungsbedarf: “Embryonenforschung ist wichtig, unsere Gesetze hierzu sind jedoch nicht mehr zeitgemäß”, sagte sie.
Diese Einschätzung teilt auch Rechtswissenschaftler Hans-Georg Dederer von der Universität Passau, Autor eines der beiden sich ergänzenden Thesenpapiere. In Deutschland sei der Rechtsrahmen für eine Forschung, die sich “mit zunehmender Beschleunigung fortentwickelt, seit Jahren praktisch völlig erstarrt”. Dederer warb für einen Wandel von einer “Kultur der Lethargie zu einer Kultur der Dynamik”.
Allerdings betrifft die Neufassung des Gesetzes nicht nur das Wissenschaftsressort. Viele Regelungen im Embryonenschutz behandeln nicht nur Forschungsfragen, sie beeinflussen auch die Möglichkeiten der Reproduktionsmediziner, die Paare mit unerfülltem Kinderwunsch behandeln. Die Zuständigkeit für diese Aspekte liegt beim Gesundheitsministerium. Von dort könnte auch ein Impuls für die Neujustierung des Embryonenschutzgesetzes ausgehen, denn die Ampelkoalition hat bereits im Koalitionsvertrag festgeschrieben, dass sie den bisher verbotenen “elektiven Single Embryo Transfer” (eSET) in der Fortpflanzungsmedizin erlauben will.
Beim eSET werden während der künstlichen Befruchtung mehr Embryonen erzeugt, als auf die Frau übertragen werden. Danach wird ein Embryo ausgewählt und nur der mit den größten Entwicklungschancen in die Gebärmutter eingesetzt. Die ärztlichen Fachgesellschaften fordern die Zulassung seit Jahren, ebenso wie die Leopoldina. Die Akademien hatten schon 2021 gewarnt, dass die geltende Rechtslage die Fortpflanzungsmediziner in Deutschland nicht selten zu einer Behandlung zwinge, die dem heutigen internationalen Stand nicht mehr angemessenen sei und zu unnötigen Risiken für Mutter und Kind führe.
Um eSET ging es bei der BMBF-Tagung nicht, dennoch spielten die Auswirkungen eine große Rolle. Denn sein Einsatz führt fast unweigerlich zu überzähligen Embryonen, die für die Familienplanung der Paare nicht mehr benötigt werden. Sie werden in Kälteschränken konserviert, bis sie entweder von anderen Paaren adoptiert (was selten vorkommt und rechtlich bisher kaum geregelt ist) oder “verworfen”, also aufgetaut, werden und absterben. Solche überzähligen Embryonen gibt es vermutlich schon mit den geltenden Regelungen, doch deren Zahl ist umstritten. Viele Experten schätzen, dass in deutschen Fortpflanzungskliniken etwa 50.000 Stück lagern, andere verweisen darauf, dass die befruchteten Eizellen im Vorkernstadium eingefroren werden, das rechtlich anders bewertet wird, aber biologisch nur einige Minuten vom Embryo entfernt ist.
Hans-Georg Dederer schlägt nun vor, ein Bioethikgesetz als übergreifenden, dynamisierten Rechtsrahmen zu schaffen, das auch die Forschung an und mit Stammzellen und Embryonen behandelt. So könnten die Paare überzählige IVF-Embryos nach ausführlicher Information unentgeltlich der Forschung spenden, die sie dann zur Herstellung von embryonalen Stammzellen nutzen oder an den Embryonen direkt forschen dürfte. Das Gesetz könnte dann die Verwendung pluripotenter menschlicher Stammzellen einheitlich regeln, unabhängig davon, aus welcher Quelle sie stammen.
Auch im anderen Thesenpapier, das der Medizinethiker und Jurist Jochen Taupitz sowie Claudia Wiesemann, Direktorin für Ethik der Medizin an der Uni Göttingen, verfasst haben, heißt es, dass eine gesetzgeberische Entscheidung, Forschung an Embryonen zu hochrangigen Zielen zu erlauben, sofern für sie keine andere Perspektive als Vernichtung oder dauerhafte Kryokonservierung bestehe, nicht nur moralisch, sondern auch verfassungsrechtlich als vertretbar angesehen werde. Hochrangige Forschungsziele gibt es mehrere: Ein besseres Verständnis der Entwicklung des menschlichen Embryos in den ersten Tagen könnte wertvolle Hinweise liefern, warum viele Schwangerschaften mit Fehlgeburten enden und welche Einflüsse das heranwachsende Leben schädigen können. Zudem könnte dieses Wissen die Erfolgsquote der künstlichen Befruchtung verbessern, derzeit führen nur etwa 30 Prozent der Behandlungen zu einer Geburt.
Die Vorschläge der Experten verändern das Konzept des Embryonenschutzes. Sie knüpfen ihn weniger an die bloße Existenz des Embryos als Ergebnis der Verschmelzung von Eizelle und Spermium. Im Vordergrund steht vielmehr die Fähigkeit der Entität, sich prinzipiell aus sich heraus zu einem geborenen Menschen entwickeln zu können. Der Schutzanspruch eines Embryos wächst mit der Entwicklung, beispielsweise mit der Ausbildung der Empfindungsfähigkeit.
Sogenannte Embryoide, also embryoähnliche Zellansammlungen, die mittels Stammzelltechniken im Labor aus gewöhnlichen Körperzellen gezüchtet werden können und lediglich als Modell für die Embryonenforschung dienen, sollen keinen gesetzlichen Schutz erhalten. Dederer schlägt aber vor, dass die Erzeugung dieser Embryoide im Vorfeld beim Robert-Koch-Institut gemeldet werden muss.
In der Diskussion zeichneten sich auch klare Verbote ab. Dazu gehört der Handel mit Embryonen, die Herstellung von Embryonen allein zu Forschungszwecken, das reproduktive Klonen, die gezielte Keimbahnveränderung mit Auswirkungen auf einen geborenen Menschen und die Herbeiführung einer Schwangerschaft durch Verwendung von Embryoiden. Rainer Kurlemann

Die Idee, dass Akteure, die nicht ausschließlich der Academia angehören, gemeinsam Wissen erarbeiten, existiert unter dem Begriff “Co-Production of Knowledge” bereits seit mehr als 20 Jahren. Die österreichische Soziologin und Wissenschaftsforscherin Helga Novotny hat sie in Spiel gebracht. Ihr ging es darum, Expertise zu demokratisieren und die Qualitätskontrolle von Wissen nicht allein der Wissenschaft zu überlassen.
“Das ist auch für die Politikberatung ein guter Ansatz”, sagt der Politikwissenschaftler Andreas Knie vom Wissenschaftszentrum für Sozialforschung Berlin (WZB). Ihn überzeugt Novotnys Argumentation, wonach Wissen nur dann sozial robust ist, wenn es in der Realität stimmt. “Wissenschaft macht ihre Annahmen stets unter Modell- oder Idealbedingungen”, sagt er. Endgültige Wahrheiten oder “den einen richtigen Weg” könne sie nicht aufzeigen. “Wenn Politik, Wissenschaft und gesellschaftliche Akteure gemeinsam an großen gesellschaftlichen Fragen arbeiten, bietet das den Vorteil der doppelten Validierung”, sagt er. Denn wissenschaftliche Ergebnisse würden einerseits in der Forschung, andererseits auch in der Praxis geprüft. Gegebenenfalls wird nachjustiert.
Die Themen für wissenschaftliche Politikberatung als Co-Production können von der Politik gesetzt werden, aber auch eine Initiative aus der Wissenschaft oder Zivilgesellschaft sein. Knie: “Was dann folgt, ist kein geordneter Prozess, sondern ein planloses, ergebnisoffenes und wechselweises Vorgehen. Je intensiver es abläuft, desto fruchtbarer ist die Arbeit.”
Diese Vorteile der Methode nennt er:
Knie hat als Leiter der WZB-Forschungsgruppe “Digitale Mobilität und gesellschaftliche Differenzierung” bereits einige Co-Produktion-Projekte verwirklicht. “Wir haben mit dieser Methode das aktuelle Carsharing- und das Elektromobilitätsgesetz erarbeitet und an Änderungen des Personenbeförderungsgesetzes mitgewirkt.” Auch bei der Umnutzung von KFZ-Stellflächen im Berliner Graefekiez arbeite sein Team gemeinsam mit dem Bezirksamt an einem neuen Planwerk.
Die Idee der Co-Production lasse sich auf viele Felder, Fächer und Fragestellungen anwenden, sagt er. In der Praxis ist diese partizipative Form der wissenschaftlichen Politikberatung jedoch die Ausnahme. Viele hielten sie auch für utopisch.
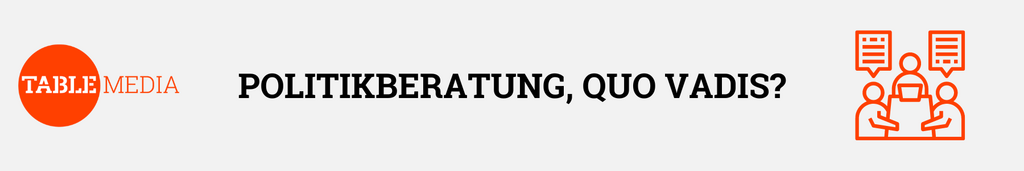
Den Historiker Caspar Hirschi von der Universität St. Gallen/Schweiz stört daran eher die “ökonomistische” Betrachtung. “Das Konzept der Co-Production ist wie jenes der Co-Creation von der Innovationsrhetorik der Managementforschung geprägt”, sagt er. Dahinter stehe die Idee, dass neue Produkte bei Kunden größere Nachfrage und Akzeptanz finden, wenn sie von diesen mitgestaltet werden. “Es wird also ein Begriff von der Wirtschaft auf die Demokratie übertragen. Das finde ich recht heikel.”
Es bleibe unklar, wer in welcher Rolle und mit welchen Kompetenzen Beratung leistet, kritisiert Hirschi, der unter anderem über die Rollen des Kritikers, Experten und Intellektuellen forscht. Ein Problem dabei sei die Fixierung auf ein “Produkt”. Hirschi: “In meinem Verständnis sind Expertise im Allgemeinen und Politikberatung im Besonderen keine Produktionsprozesse im wirtschaftlichen Sinn, sondern vielmehr ein zentraler Teil von politischen Aushandlungsprozessen, die letztlich auf die öffentliche Legitimation der Demokratie ausgerichtet sind.”
Co-Production habe nichts gemein mit wirtschaftlichem Tun, sondern diene der Wissens- und Erkenntnisverbesserung, betont Andreas Knie. Dass die Wissenschaft lieber an der hierarchischen Politikberatung festhält, erklärt er vor allem mit den Beharrungskräften des Systems. “Der Ansatz der Co-Production würde die Reputationsordnung radikal verändern. Er würde sich auf die Bewertung der Qualität von Wissenschaft, auf Karrierewege und auf die Ressourcenzuteilung auswirken.”
Denn bei dieser Form der Erarbeitung von Wissen würden die Ergebnisse auch extern bewertet. “Bislang entscheidet die Wissenschaft ausschließlich selbst, was gute Wissenschaft ist.” Dieses Bewertungsmonopol gewähre die Gesellschaft im Vertrauen darauf, dass nützliche Erkenntnisse erzielt werden. Knie sieht die Zeit gekommen, diesen ungeschriebenen gesellschaftlichen Vertrag zu hinterfragen. “Die Selbstreferenzialität ist zu hoch im deutschen akademischen System. Andere Übersetzungen und Interaktionen sind erforderlich.”
Seine Forderung: “Wir müssen uns mit unseren Ergebnissen systematischer als bisher in einen anderen Referenzbereich begeben: Extended Review statt Peer Rewiew.” Es gelte zu überprüfen, ob das, “was wir uns intern gegenseitig als Wahrheit in die Bücher schreiben, auch extern so funktioniert”. Er ist froh, dass hierzulande allmählich die Debatte darüber in Gang kommt, beispielsweise auch bei Projekten der Volkswagenstiftung. Denn auch international werde vermehrt über Wirksamkeitsmessung und Evaluation diskutiert. Knie: “In den USA und England ist man in dieser Hinsicht schon viel weiter. Dort müssen Forschende laufend Wirksamkeitsnachweise liefern und es wird zum Beispiel nachverfolgt, wo die Absolventen hingehen.”
Vor allem die deutsche Wissenschaft habe zunehmend ein Impact-Problem, sagt der Politologe. “Die Anwendbarkeit von Wissenschaft muss in den Vordergrund rücken.” Und dafür sei die Politik gefragt, die bisher nur kulissenhaft auf Impact und Wirksamkeit achte, während faktisch weiter nach klassischen Kriterien gearbeitet werde. Knie: “Die Wissenschaftspolitik muss sich verstärkt damit befassen, wie sich der Impact der Wissenschaft erhöht, wie man die Co-Production etabliert und auch in die Reputationsordnung hineinbringt. Das kann sie vor allem dadurch bewirken, dass sie finanzielle Anreize schafft.”
Die Serie “Politikberatung, quo vadis?” finden Sie gesammelt hier.
18. Oktober 2023, Berlin
DAAD-Policy Talk Internationale Wissenschaftskooperationen im Kontext einer Nationalen Sicherheitsstrategie Mehr
1.-10. November 2023, Berlin
Wissenschaftsfestival Berlin Science Week Mehr
7.-9. November 2023, Berlin
Konferenz Falling Walls Science Summit 2023 Mehr
15.-17. November 2023, Bielefeld
Konferenz Forum Wissenschaftskommunikation – Kontrovers, aber fair – Impulse für eine neue Debattenkultur Mehr
16. November 2023, Wilhelm Büchner Hochschule, Darmstadt
Tagung WBH Wissenschaftsforum 2023 – “Transformation gestalten” Mehr
In einem Maßgabebeschluss hat der Haushaltsausschuss des Bundestages vergangene Woche ein “Konzept für ein befristetes Programm zum Ausbau wissenschaftlicher Dauerstellen neben der Professur” eingefordert. Damit soll das BMBF wohl an ein Versprechen aus dem Koalitionsvertrag erinnert werden. Dort hatten SPD, Grüne und FDP angekündigt, mit einem Bund-Länder-Programm Best-Practice-Projekte für alternative Karrieren außerhalb der Professur zu fördern.
Im Gespräch mit Table.Media gibt sich Staatssekretär Jens Brandenburg angesichts des Beschlusses gelassen: “Natürlich setzt der Haushaltsausschuss thematische Schwerpunkte, das ist nicht verwunderlich.”
Brandenburg betont, dass das BMBF bereits an einem Konzept für mehr Planbarkeit, Verlässlichkeit und Transparenz von Karrieren in der Wissenschaft arbeite. Der Beschluss aus dem Haushaltsausschuss sei jedoch nochmals ein “wichtiger Impuls”, den man in die weitere Arbeit aufnehmen wolle.
Finanzausschuss-Mitglied Bruno Hönel (Grüne) begründete den Beschluss im Haushaltsausschuss hingegen damit, dass “zum aktuellen Zeitpunkt noch kein Konzept zu Dauerstellen im Mittelbau vorliegt und auch keine Entwicklungen erkennbar sind”. Wiebke Esdar (SPD), ebenfalls Mitglied des Haushaltsausschusses, erwartet vom BMBF das Konzept “zu den Haushaltsberatungen für das Jahr 2025”.
Jens Brandenburg wollte sich noch nicht dazu äußern, wann das Konzept fertig wird. Auch zum aktuellen Stand des WissZeitVG machte er keine genaueren Angaben. Dieses befinde sich nach der Verbändeanhörung derzeit in der Ressortabstimmung. Wann ein Kabinettsbeschluss erfolgen kann, bleibt unklar. mw/nik
Die deutschen Institutes for Advanced Study (IAS) sehen sich als “Innovationsmotoren für die Wissenschaft und als Inkubatoren für Forschungsideen”. Ihre Beiträge zur deutschen Wissenschaftslandschaft, aber auch ihre Bedürfnisse, wollen sie künftig besser sichtbar machen. Auf einem Treffen Anfang Oktober am Hanse-Wissenschaftskolleg in Delmenhorst hat das 2022 gegründete Netzwerk der deutschen IAS, an dem sich bislang 20 der insgesamt 24 IAS aktiv beteiligen, dazu ein entsprechendes Positionspapier verabschiedet.
IAS böten eine “einzigartige Vielfalt” an wissenschaftlichen Förderangeboten, heißt es in dem Papier. Schwerpunkte seien Spitzenforschung und Internationalisierung, Forschende in frühen Karrierestufen, Einzel- und Gruppenforschung sowie in letzter Zeit verstärkt auch Interdisziplinarität.
Durch den Austausch der Fellows über Fächergrenzen hinweg sowie die Vernetzung und Zusammenarbeit zwischen den Disziplinen kämen unterschiedlichste Wissenschaftsbereiche zusammen, es entstünden sonst zu selten vorhandene Experimentierräume. “Denn Innovation entsteht gerade im Zusammenwirken herausragender Forschender mit Zeit für wissenschaftliche Tiefe und Reflexion.”
Durch ihre meist überschaubare Größe und ihre Fähigkeit, Förderinstrumente zügig und flexibel auf neu entstehende Forschungsfelder ausrichten zu können, tragen IAS maßgeblich zu einem agilen und innovativen Wissenschaftsbetrieb bei, betont das Netzwerk.
Um ihren Auftrag als Innovationsmotor und Inkubator weiter erfüllen zu können, bedürfe es größerer programmatischer und finanzieller Autonomie, fordern die IAS. Als Beispiel nennen sie rechtlich festgeschriebene Gestaltungsspielräume und abgestimmte materielle Förderung. Die IAS weisen darauf hin, dass der Wissenschaftsrat dies bereits 2021 in einer Stellungnahme gefordert hat.
“Viele IAS wurden ursprünglich als Teile der Exzellenzinitiative eingerichtet“, sagt Bijan Kafi, Sprecher des Hanse-Wissenschaftskolleg (Institute for Advanced Study) in Delmenhorst. Die Institute suchten daher vorrangig maßgeschneiderte Förderprogramme auch jenseits dieser Initiative. “Bisher fehlen nationale Förderprogramme auch für eventuelle Kooperation von IAS.” Die EU biete einzelne, wenige Möglichkeiten. Kafi: “Unser Interesse ist, Möglichkeiten zur Förderung zur eröffnen, die stabiler sind als die bisherigen, wie es auch der deutsche Wissenschaftsrat gefordert hat.”
Obwohl sie die Forschungspotenziale vieler Universitäten messbar stärkten, erfahre ihre Arbeit jedoch noch zu selten entsprechende Wahrnehmung. An den 24 IAS hierzulande arbeiten insgesamt jährlich etwa 450 Fellows, davon sind fast 60 Prozent international. Hauptgeldgeber sind oft die Länder mit ihren Universitäten und die deutsche Exzellenzinitiative, daneben auch einzelne Stiftungen, in wenigen Einzelfällen auch einzelne Mäzene. abg
Die Gründungskommission der Deutschen Agentur für Transfer und Innovation (Dati) hat ihre Arbeit aufgenommen. 16 Expertinnnen und Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft gehören dem Gremium an. Es hat den Auftrag, Empfehlungen zu inhaltlichen und prozeduralen Aspekten beim Auf- und Ausbau der Dati zu geben. Daneben soll die Kommission auch Vorschläge für den Standort entwickeln. Hier hatten sich offenbar bereits einige Kandidatenstädte aktiv ins Spiel gebracht. Nicht ganz einfach wird vermutlich auch die Aufgabe, Vorschläge für das Leitungspersonal, insbesondere die Geschäftsführung zu entwickeln.
Den Vorsitz der Kommission wird Stefan Groß-Selbeck von der Boston Consulting Group übernehmen. Die weiteren Mitglieder sind:
Die Planung der Agentur hatte sich lange hingezogen und für viel Unmut bei den Beteiligten gesorgt. Unklar war lange, ob Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) Hauptadressaten der Förderung bleiben sollen, oder ob auch andere Organisationen Anträge stellen und Förderung erhalten dürfen. Inzwischen scheint klar, dass die Dati akteursoffen sein wird. Die Pilotförderrichtlinien wurden im Juli veröffentlicht. mw

Deutschland ächzt unter den Lasten der Bürokratie. Auch in der Wissenschaft. Dort ist die Verunsicherung aktuell besonders groß, seit der Bundesrechnungshof im Frühjahr seinen Bericht zu “Ausgewählten Aspekten der Haushalts- und Wirtschaftsprüfung der Fraunhofer-Gesellschaft” veröffentlicht hat. Mit diesem Bericht hat er die größte deutsche Forschungseinrichtung für angewandte Forschung in eine Führungskrise gestürzt, indem er den Finger in die Wunde mangelnder Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der Gesellschaft legte. Der Bericht wirkt jedoch weit über die Fraunhofer-Gesellschaft hinaus. Die gesamte deutsche Wissenschaft ist alarmiert – und verunsichert: Bewirtungen, Jurysitzungen, Klausurtagungen werden vermieden, aus Angst, wegen eines Formfehlers als Nächstes am öffentlichen Pranger zu stehen. Muss diese Überreaktionen sein?
Zunächst: Die Budgets für Reisen, Bewirtungen und Dienstwagen sind aus gutem Grund streng reglementiert. Diejenigen, die mit dem Geld der Steuerzahlerinnen und -zahler bezahlt werden, müssen verantwortungsvoll damit umgehen. Wer gegen die Regeln verstößt, verdient Kritik und muss Abhilfe schaffen. Derzeit aber laufen wir Gefahr, das Kind mit dem Bade auszuschütten und alles bis ins Detail zu regeln, um Missbrauch auszuschließen.
Fünf Prinzipien können der deutschen Wissenschaft helfen, ihre Verantwortung mit Augenmaß wahrzunehmen und Bürokratielasten zu begrenzen. An erster Stelle ist dies Souveränität: Es gilt, den Geist der Regelungen – vom Reisekostenrecht bis zu Bewirtungsregelungen – zu verstehen und souverän damit umzugehen. Nicht für jedes Detail gibt es eine Vorschrift. Es muss zudem immer auch Ausnahmen geben dürfen. Dann aber gilt: Die Umstände müssen dokumentiert, der Ausnahmefall muss begründet werden.
Hinzu kommt Klarheit: Glaubwürdigkeit nach außen gewinnt man nur, wenn es in einer Organisation klare Anleitungen gibt. Wissenschaftsorganisationen und Forschungseinrichtungen brauchen deshalb sogenannte Compliance Management Systeme. Sie benennen die rechtlichen und organisatorischen Vorschriften und organisieren, wie sie zu befolgen sind. Wichtig ist: Solche internen Regelwerke dürfen keine zahnlosen Papiertiger sein, sondern müssen in der Praxis gelebt werden. Dazu gehören Schulungen, auch für diejenigen, die sonst eher als Lehrende wirken, also das wissenschaftliche Personal.
Bei alledem braucht es jedoch Augenmaß. Bürokratielasten aus Angst zu erhöhen, im Detail ja keine Fehler zu machen, ist kontraproduktiv, insbesondere dann, wenn das eigentliche wissenschaftliche Arbeitsziel dabei zweitrangig wird oder gar aus den Augen gerät.
Gefordert sind auch die öffentlichen Geldgeber – und dort braucht es eine gehörige Portion Realismus. Angesichts der inflationsgetriebenen Preisentwicklung müssen sie Kostenobergrenzen, etwa für Dienstreisen, überprüfen und Ermessensspielräume öffnen. Denn Rechnungshöfe können nur das prüfen, was die öffentlichen Geldgeber als Regel verbindlich machen.
Schließlich: Warum nicht miteinander reden? Auch die Prüfbehörden können aufgrund ihres Erfahrungsschatzes fundierten Rat geben, welche Ermessensspielräume angemessen sind, wann Ausnahmeregelungen greifen und wie diese nachzuweisen sind. Mein Fazit: Um die aktuelle Angststarre zu überwinden, empfiehlt sich für Kontrolleure wie Kontrollierte ein schlichtes, aber wirkungsvolles Mittel: Bereitschaft zum offenen Dialog. Ohne Vorbehalte und mit Vertrauensvorschuss.

Doris Weßels ist eine der führenden Forscherinnen in Deutschland auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz. Als Professorin für Wirtschaftsinformatik an der Fachhochschule Kiel forscht sie insbesondere zur Frage, wie wir unser Bildungssystem an die aktuellen Entwicklungen anpassen müssen. Und kann sich – nach langem Wirken in der Nische – seit dem Launch von ChatGPT letzten Dezember kaum vor Medienanfragen retten.
Schock, Kreislaufprobleme, Unruhe. Oder aber: Erleichterung, Freude, Euphorie. Wenn Doris Weßels beschreibt, wie unterschiedlich Menschen bei ihren Workshops auf KI-Tools wie ChatGPT und Co. reagieren, kommt keine körperliche Regung zu kurz. “Ich kann das nachvollziehen. Bei mir war es nicht anders.” Die Veröffentlichung von ChatGPT am 30. November 2022 bezeichnet sie als einschneidendes Erlebnis: “Angesichts dieser spürbaren disruptiven Kraft schwirrten immer mehr Fragen durch meinen Kopf und ich musste mich erst einmal sammeln.” Keine andere IT-Innovation habe sie in 30 Jahren als Wirtschaftsinformatikerin derartig fasziniert und zugleich beunruhigt.
Allein war sie damit nicht: Den anschließenden Ansturm an Medienanfragen beschreibt sie als einen Knoten, der platzte: “Die Presse hat unser Virtuelles KI-Kompetenzzentrum “Schreiben lehren und lernen mit KI” von 0 auf 100 zugeschüttet.” Von Schulen, Hochschulen, Pressevertretern und Verbänden bis zu Vereinen, sei in den ersten Monaten alles dabei gewesen. Weßels ist sich dabei sicher: Wer zum ersten Mal mit ChatGPT herumgespielt hatte, wurde sich schnell der disruptiven Kraft von KI bewusst und stellte sich die Frage, wie der eigene Arbeitsplatz mit Schreibaufgaben zukünftig aussehen würde oder sogar obsolet werden könnte.
Mit Künstlicher Intelligenz kam die gebürtige Oldenburgerin zum ersten Mal in ihrem Mathematik- und Wirtschaftsstudium an der Universität Münster in Kontakt, sowie später im Management eines Softwareunternehmens. Nach zwölf Jahren in der freien Wirtschaft kam sie schließlich 2004 als Professorin für Wirtschaftsinformatik zurück in die Forschung. “Das ist mittlerweile fast 20 Jahre her, aber wegen meiner recht langen Berufstätigkeit in der freien Wirtschaft gelte ich als Exotin unter den Hochschullehrenden“, sagt Weßels lachend.
Auf die Schnittstelle von KI und Bildung wurde sie ab 2018 aufmerksam, als sie die immer größeren Leistungssprünge von KI-Tools für Übersetzungen und Umformulierungen bemerkte. Seit 2021 forscht sie daher in einem Forschungsprojekt zur Nutzung von KI beim akademischen Schreiben aus der Sicht von Studierenden, das durch das Land Schleswig-Holstein gefördert wird. Zusätzlich leistet sie seit September 2022 Aufklärungsarbeit im von ihr mitgegründeten bundesweiten Kompetenzzentrum “Schreiben lehren und lernen mit Künstlicher Intelligenz”. Die größte Herausforderung besteht für sie dabei darin, allen entscheidenden Köpfen des Bildungssystems die disruptive Komplexität von KI zu vermitteln. Die Innovationssprünge der KI zu ignorieren, ist für sie nämlich keine Option. “Natürlich wäre business as usual für alle die einfachste Variante. Aber damit führen wir unseren Bildungsauftrag ad absurdum.”
Als ehemalige Key Account Managerin verfolgt Weßels das Verhalten der Anbieter – in diesem Fall die weltweit führenden Tech-Giganten – und ihre Marketingstrategien besonders aufmerksam. “Manchmal denke ich, es ist wie bei einem Strategiespiel.” Und sie fügt schmunzelnd hinzu, wie gerne sie einmal bei Open AI oder Google in deren Headquarter Mäuschen spielen würde.
Der EU schreibt sie angesichts fehlender europäischer Anbieter derzeit eher eine Zuschauerrolle zu. Was die Erfolgsaussichten des europäischen AI-Acts betrifft, ist Weßels daher skeptisch: “Wir müssen dieser digitalen Disruption eigentlich mit einem radikalen Umbau unserer politischen Systeme für die Regulierung und das permanente Monitoring generativer KI begegnen.” Die Relevanz der Digitalisierung – und hier speziell der KI-Technologien – für die Zukunft unserer Wirtschaft und Gesellschaft in Deutschland rücke zwar immer mehr ins Bewusstsein, werde aber noch nicht mit der notwendigen Priorität behandelt.
In Analogie zu den umfassenden und neuartigen Herausforderungen einer “General Purpose AI” empfiehlt Weßels daher eine ressortübergreifende und interministeriell gebildete neue Organisationseinheit, die ein kontinuierliches Monitoring der Entwicklung generativer KI-Systeme und eine gezielte und zeitnahe Steuerung dieser Entwicklung ermöglicht. Carlos Hanke Barajas
Mai Thi Nguyen-Kim wird Mercator-Professorin an der Universität Duisburg-Essen.
Angelika Altmann-Dieses und Philipp von Ritter zu Groenesteyn sind als Rektorin und Kanzler der Hochschule Mannheim seit dem 1. Oktober im Amt.
Wolfgang Wahlster wurde am 12. Oktober im New Institute in Hamburg in die 2009 vom Manager Magazin initiierte Hall of Fame der deutschen Forschung aufgenommen. Geehrt wurde auch Claudia Felser, Direktorin des Max-Planck-Institut für Chemische Physik fester Stoffe.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!
Europe.Table. AI Act: Dinner der Entscheidung. Die Trilog-Verhandlungen zum AI Act auf technischer Ebene kommen nur schleppend voran. Dragoș Tudorache (Renew), einer der beiden Berichterstatter für den AI Act, hat nun für diesen Montag zu einem Abendessen eingeladen, um die Verhandlungen auf politischer Ebene zu beschleunigen. Mehr
Europe.Table. Glyphosat: Agrarminister müssen sich mit Kommissionsvorschlag befassen. Die EU-Mitgliedstaaten haben sich auf Expertenebene noch nicht über die Zukunft des umstrittenen Herbizids einigen können. In der Abstimmung am Freitag im Ständigen Ausschuss für Pflanzen, Tiere, Lebens- und Futtermittel (SCoPAFF) fand der Vorschlag der Kommission für eine erneute Zulassung keine qualifizierte Mehrheit. Nun müssen sich die Agrarminister der Mitgliedstaaten mit dem Kommissionsvorschlag befassen. Mehr
Agrifood.Table. Studie: Gentechnik macht Hühner gegen Vogelgrippe resistent. Mittels Genom-Editierung können Hühner gegen das Vogelgrippevirus resistent werden. Das ist das Ergebnis einer britischen Studie, die vergangene Woche im Fachjournal “Nature Communications” erschienen ist. Mehr

Zum Abschluss was Süßes: Wir möchten Sie mit Lua bekannt machen, einem Karibischen Nagelmanati-Weibchen. Die Rundschwanzseekuh ist 31 Jahre alt und hat einiges in ihrem Leben durchgemacht. Als Jungtier verwaiste sie und strandete im Nordosten Brasiliens. Doch sie hatte Glück. Sie kam in eine Naturschutzstation, wurde aufgepäppelt und gehörte 1994 zu den ersten Nagelmanati-Individuen, die wieder ausgewildert wurden.
Das Programm wurde gestartet, um die Bestände der einst häufig vorkommenden Art zu sichern. Es war erfolgreich. Und das dürfte auch an Lua liegen. Weil sie ihre Zutraulichkeit zu Menschen nie verloren hat, wurde sie zum Promi unter den Karibischen Nagelmanatis. Flagship-Animal nennt das Forscherteam um Ivan Jarić von der Universität Paris-Saclay in Frankreich und der Tschechischen Akademie der Wissenschaften diese Funktion als Aushängeschild. Damit lasse sich der Naturschutz enorm voranbringen, schreiben die Forscher in einer aktuellen Studie. Einzelne Tiere oder Pflanzen hätten ein enormes Potenzial, das Bewusstsein zu schärfen und die Öffentlichkeit zu mobilisieren.
Ein prominentes und irgendwie auch vermenschlichtes Tier zu sein, hat aber auch Schattenseiten, wie sich an Luas Beispiel zeigt. Gutmütig und zutraulich wie sie ist, hatten bereits viele Menschen von Ausflugsbooten aus Kontakt mit ihr. Und so wurde sie mal mit gebratenem Fisch gefüttert, mal haben Touristen versucht, ihr Bier einzuflößen.
Lua hat überlebt und ihren Beitrag zum Erhalt von Trichechus manatus manatus geleistet. Bei anderen bedrohten Arten kam die Personifizierung zu spät: Lonesome George starb 2012 als letzte Galápagos-Riesenschildkröte der Unterart Pinta-Riesenschildkröte. Und mit Sudan verschied 2018 das letzte Nördliche Breitmaulnashorn-Männchen. Anne Brüning
