trotz entspannender Wanderungen in den Bergen, trotz Hawaii-Pizza-Posting: Wer dachte, Jens Brandenburg, Verhandlungsführer des BMBF in Sachen WissZeitVG, wäre nach der Sommerpause milde gestimmt und würde die Vorschläge der Koalitionspartner – vor allem die der SPD zur Befristungsdauer in der Postdoc-Phase, aufnehmen -, der irrt: In Detailfragen sei man gesprächsbereit, erklärt der Parlamentarische Staatssekretär. Das Maß an Kreativität sei allerdings irgendwann ausgeschöpft. “Der Grundkonflikt lässt sich vermutlich auch durch weitere Gespräche nicht auflösen.” Tim Gabel hat die Details.
Anne Brüning hat sich für unsere Serie “Politikberatung, quo vadis?” beherzt in die Tiefen wissenschaftlicher Beratungskonzepte eingegraben. Sie hat mit Experten in Politik und Wissenschaft gesprochen, Kritikpunkte und Wünsche eingesammelt und schnell gelernt: In der Szene der wissenschaftlichen Politikberatung agieren viele Akteure, ihre Zuständigkeiten sind unscharf bis unklar. Ähnlich wenig Übersicht herrscht bei den vielen intensiv recherchierten Gutachten und Stellungnahmen, die für Entscheidungsträger oder Verwaltungsmitarbeitende erstellt werden. Politikwissenschaftlerin Nataliia Sokolovska vom Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) in Berlin will mit dem Repod-Projekt Abhilfe und eine Datenbank für Policy Paper schaffen.
Das Bundeswirtschaftsministerium hat der Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen (AiF) die administrative Zuständigkeit für die industrielle Gemeinschaftsforschung (IGF) entzogen – die AiF hatte die Projektträgerschaft fast 70 Jahre inne. In der Wissenschaftscommunity gibt es Bedauern, aber auch Verständnis für die Entscheidung des BMWK. Auch die durch den Bundesrechnungshof einmal angenommene Möglichkeit von Interessenkonflikten könnte den Schritt beeinflusst haben. Was plant AiF-Geschaftsführer Michael Klein jetzt? Markus Weißkopf hat mit ihm gesprochen.
Ich wünsche Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre,
Wenn Ihnen der Research.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail weitergeleitet wurde: Hier können Sie sich für den Research.Table kostenlos anmelden.

Beim Wandern hat sich der Parlamentarische Staatssekretär Jens Brandenburg von einem konflikt- und arbeitsreichen ersten Halbjahr erholt. Der Bildungsexperte der FDP hatte in diesem Jahr vor allem mit der Novellierung des WissZeitVG zu kämpfen. Sein Eckpunktepapier, an einem Freitag im Februar veröffentlicht, zog das BMBF nach einem Proteststurm in den sozialen Netzwerken umgehend zurück.
Bis kurz vor der Sommerpause wurde es weiterentwickelt und als Referentenentwurf des BMBF wieder veröffentlicht. Diesem Entwurf fehlt aber die Unterstützung der Grünen und der SPD – trotz etlicher Stakeholder-Dialoge und Berichterstatter-Gespräche in diesem und dem Vorjahr. “Im aktuellen Referentenentwurf ist auch in der Koalition fast alles geeint, bis auf einen Aspekt, nämlich die Befristungsdauer in der Postdoc-Phase“, betont Jens Brandenburg im Gespräch mit Table.Media. Das sei auch in der Wissenschaft selbst ein sehr kontroverser Punkt.
Ihm ist wichtig, dass nicht der Eindruck entsteht, man habe geredet und geredet und dabei sei nichts herausgekommen. Wenn man die Novellierung des WissZeitVG mit den allermeisten Gesetzgebungsverfahren in der Regierung vergleiche, sagt Brandenburg, sei schon in einem sehr frühen Stadium eine breite Einigkeit erzielt worden.
Brandenburg sagt, dass es rückblickend ein politisches Risiko gewesen sei, das Verfahren zu den Eckpunkten nochmal zu öffnen, aber die richtige Entscheidung. Auch wenn es vielen nicht gefallen habe, der Sache habe es gutgetan.
Inhaltlich zeigt sich Brandenburg auch nach den Sommerferien unbeeindruckt von den Vorschlägen der Koalitionspartner. Vor allem die SPD hatte in den Verhandlungen zum Referentenentwurf auf eine Tarifautonomie bei der Höchstbefristungsdauer in der Postdoc-Phase gedrängt, um auch die Gewerkschaften hinter das Koalitionspapier zu bringen. Im Interview mit Table.Media hatte Carolin Wagner (SPD) berichtet, dass die Ministerin in den letzten Verhandlungen offen dafür war, allerdings nur für einen Höchstbefristungs-Korridor von drei bis sechs Jahren. Die Gespräche scheiterten.
Im Referentenentwurf des BMBF sind nun vier Jahre festgeschrieben. “Wir halten eine Reduzierung der Qualifizierungsbefristung in der Postdoc-Phase auf maximal zwei Jahre für nicht verantwortbar”, sagt Brandenburg. “Es gibt enorme Unterschiede zwischen den Fachkulturen. In vielen Gesprächen vor allem an naturwissenschaftlichen Einrichtungen hat mir auch die Arbeitnehmerseite klar signalisiert, dass ihre Forschung damit unmöglich wäre.” Man sei als Ministerium vor allem für diejenigen verantwortlich, die täglich im Wissenschaftssystem arbeiten.
Dass man bei Detailfragen weiter gesprächsbereit ist, bestätigt Brandenburg. Wie konkrete Maßnahmen aussehen könnten, die dann doch noch eine Einigung mit SPD und Grünen herbeiführen würden, dazu verweist Brandenburg allerdings auf die vertraulichen Berichterstatter-Gespräche und das parlamentarische Verfahren, das jetzt nach der Sommerpause ansteht. Das Maß an Kreativität sei allerdings auch irgendwann ausgeschöpft, sagt der Staatssekretär. “Der Grundkonflikt lässt sich vermutlich auch durch weitere Gespräche nicht auflösen.”
Weitere wichtige Vorschläge zum Kulturwandel im Wissenschaftssystem ließen sich zudem nur teilweise oder gar nicht mit dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz umsetzen. “Dieses Gesetz kann nicht alles regeln, es ist nur einer von vielen Bausteinen für ein modernes Wissenschaftssystem”, sagt Brandenburg. Gespräche zu weiterführenden Ideen und Maßnahmen jenseits des WissZeitVG wolle der Bund im Wissenschaftsrat, unter anderem gemeinsam mit den Ländern, führen.
Für die Zeit des parlamentarischen Verfahrens wünscht sich der Parlamentarische Staatssekretär eine andere Debattenkultur. Er verstehe, dass das Interesse bei den Beschäftigten im Wissenschaftsbetrieb sehr hoch sei, weil die Arbeitsbedingungen viele sehr direkt beträfen. “Das ist ein hochemotionales Thema, das auch polarisiert.” Es gebe in der Diskussion aber die Tendenz, dass vieles aus dem Kontext gerissen und falsch dargestellt werde.
Ganz extrem sehe man das an der Plattform X (ehemals Twitter): “Meine Erfahrung ist, dass dieselben Akteure, wenn man sie persönlich trifft, plötzlich vieles differenzierter und lösungsorientierter sehen als das, was sie mit ein paar Klicks in den Orbit der sozialen Netzwerke senden.” Gerade im akademischen Umfeld und in Hochschulen werde Debattenkultur großgeschrieben, das merke man auf X aber nicht immer. “Wir müssen auch die Stimmen wahrnehmen, die sich woanders und leiser äußern.”
So unübersichtlich wie die Zahl und Zuständigkeiten der Akteure der wissenschaftlichen Politikberatung sind auch ihre Produkte: Schriftstücke, die für politische Entscheidungsträger oder Verwaltungsmitarbeitende erstellt werden. Wer aktuell zum Beispiel nach Expertise zum Thema Wasserstoff sucht, wird auf diversen Websites fündig – vom Sachverständigenrat für Umweltfragen über Leopoldina und Acatech bis zu Agora Energiewende und dem Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft.
Bei anderen gesellschaftlich relevanten Themen, bei denen politische Entscheidungen anstehen, ist die Lage ähnlich. “Insgesamt fehlt es an Überblick über Beratungsdokumente. Das macht die Suche danach mühsam und zeitaufwendig. Sie sind nicht gezielt recherchierbar”, sagt die Politikwissenschaftlerin Nataliia Sokolovska, die am Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) in Berlin das Forschungsprogramm Wissen und Gesellschaft leitet.
In einem Konsortium mit drei Leibniz-Instituten (Medienforschung/HBI, Raumbezogene Sozialforschung/IRS und Wirtschaftsforschung/RWI) und geleitet vom ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft arbeitet sie daran mit, die Situation zu verbessern. Die Forscherinnen und Forscher bauen das Repositorium für wissenschaftliche Politik- und Gesellschaftsberatung, kurz Repod, auf. Das im Februar mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) gestartete Projekt will bis Ende 2023 eine Informations- und Beratungsinfrastruktur für Politik und Gesellschaft schaffen, die den Wissenstransfer aus der Forschung deutlich einfacher macht. Vorgesehen ist, Repod dauerhaft am ZBW anzusiedeln und weiterzuentwickeln, das auf forschungsbasierte Informationsstruktur für die Wirtschaftswissenschaften spezialisiert ist.
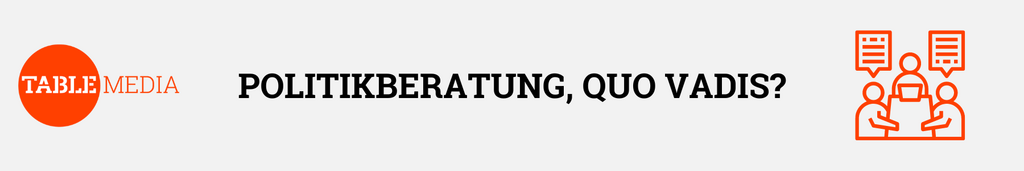
Das Repod-Team macht sich nicht nur an die technische Umsetzung, sondern untersucht auch die Entstehungsprozesse, Qualitätskriterien und Nutzungsbedingungen von Beratungsdokumenten. “Letztlich geht es darum, die Kommunikation zwischen Forschung, Politik und Verwaltung zu optimieren“, sagt Sokolovska. Ihr Forschungsthema in dem Projekt sind die Qualitätsrichtlinien und -anforderungen. Dafür hat sie zusammen mit Kollegen Vertreter aller zukünftigen Nutzergruppen interviewt – also Forschende aus Universitäten und außeruniversitären Forschungseinrichtungen sowie Mitarbeiter aus Ministerien, Beratungseinrichtungen und der öffentlichen Verwaltung. Diese Gespräche dienten dazu, die Erwartungen an solch eine Infrastruktur zu erfassen sowie Qualitätsanforderungen zu formulieren, auf deren Basis die Dokumente in Zukunft ins Repositorium eingestellt werden. Das Ziel: “Wir erarbeiten zentrale Leitlinien für die Qualitätssicherung.”
Auch wenn die Daten noch nicht final analysiert sind, zeichnen sich bereits wichtige Qualitätsaspekte für Beratungsdokumente ab:
Das Repositorium soll nicht nur Akteuren in Politik und Verwaltung besseren Überblick über Beratungsdokumente verschaffen. Auch für Journalisten könnte es hilfreich sein, dadurch Experten und Expertisen zu bestimmten Themen zu finden. “Ein großer Vorteil ist, dass Repod die Perspektivenvielfalt stärkt”, sagt Sokolovska. Der derzeit fehlende Überblick über alle Forschungsteams, die Expertise zu bestimmten Themen produzieren, begünstige Voreingenommenheit und Instrumentalisierung.
Allumfassend kann Repod jedoch nicht sein, denn Dokumente sind nur ein Teil der Kommunikation zwischen Forschenden und politischen Entscheidungsträgern. “Zum einen werden vermutlich nicht alle relevanten Ergebnisse in solchen Beratungsdokumenten veröffentlicht. Zum anderen spielt in der wissenschaftlichen Politikberatung auch der persönliche Kontakt eine große Rolle”, sagt Sokolovska.
Wie viele Dokumente mit Berichten, Gutachten, Empfehlungen, Positionspapiere, Impulse, Risikoanalysen und Guidelines in der ersten Stufe bei Repod abzurufen sein werden, ist derzeit noch unklar. Nataliia Sokolovska hofft, dass es eines Tages so viele sein werden, dass auch Meta-Studien möglich sind. “Man könnte zu bestimmten Themen dann untersuchen, wie sich die Expertise im Verlauf der Zeit entwickelt hat.”
Falls die Repod-Idee sich bewährt, könnte sie auch für andere Länder beispielgebend sein. “Wir haben uns im Vorfeld intensiv umgetan, aber so gut wie keine Best-Practice-Beispiele gefunden”, sagt die HIIG-Forscherin. In einer Reihe von Ländern gibt es Initiativen, die innovative Formate und Ressourcen für wissenschaftliche Politikberatung entwickeln. “Dahinter steht aber keine Infrastruktur, wie wir sie aufbauen.”
Auf EU-Ebene gibt es die Plattform Knowledge4Policy (K4P). Sie verwaltet und veröffentlicht wissenschaftliche Erkenntnisse, die für die Politik relevant sind. Anders als bei Repod findet jedoch eine Art Aufbereitung mit dem gleichen Ziel statt: Das Wissen wird in einer Form zusammengefasst, die politische Entscheidungsträger verstehen und nutzen können. Zurzeit tragen 20 Dienste, die Knowledge Services, unter Leitung des Joint Research Centre Wissen zu bestimmten Themen bei, etwa zum European Green Deal oder zur Digitalisierung.
In Teil 8 beleuchten wir die Rolle des Experten. Die Serie “Politikberatung, quo vadis?” finden Sie gesammelt hier.

Was erforschen Sie im Zusammenhang mit KI?
Zusammen mit meinem Team verfolge ich das Ziel, KI-Systeme zu entwickeln, die auch in gigantischen Datenmengen die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen erkennen und gänzlich neue Zusammenhänge erschließen. Dies setzt ein im Vergleich zu heutigen KI-Modellen noch tieferes Verständnis des Menschen und eine noch umfassendere Kenntnis der Welt voraus.
Welche Herausforderungen gibt es dabei?
Aktuelle Systeme wie ChatGPT können zunächst nur recht kurze Texte untersuchen und sind nicht ohne Weiteres in der Lage, eine große Datensammlung zu analysieren. Das aber sollte KI in Zukunft können und darüber hinaus in der Lage sein, diverse Datenformen auswerten zu können, darunter Bilder und Videos in Büchern, sozialen Medien oder auf YouTube. Mit dieser Zielvorstellung entwickeln wir Verfahren, die Verbindungen zwischen ganz unterschiedlichen Arten von Daten aufdecken. Eine weitere große Herausforderung ist der Umgang mit ganz kleinen Datenquellen. Zum Trainieren von KI benötigen wir heutzutage Unmengen an Daten. Wie aber gehen wir vor, wenn für ein konkretes Thema oder für eine bestimmte Sprache nur sehr wenig da ist? Wie also schaffen wir es, aus wenigen Daten viel zu machen? Das sind Fragen, die uns tagtäglich beschäftigen.
Welche Anwendungen sehen Sie für Ihre Forschung?
Es gibt sehr viel neues Potenzial. Wir arbeiten zum Beispiel gerade daran, Unternehmensdatenbanken in Sprachmodelle einzubinden und zu durchforsten, damit Unternehmen einfacher von den aktuellen Entwicklungen in der KI profitieren können. Ähnliches gilt für Angehörige kleiner Sprachgemeinschaften, beispielsweise in Afrika oder auf Papua-Neuguinea, denen wir den Zugang zu Sprachmodellen eröffnen möchten.

Was sind die größten Chancen von KI?
Sie kann viele Prozesse vereinfachen und beschleunigen. In Zukunft müssen wir nicht mehr Stunden damit verbringen, Informationen aus verschiedenen Quellen für eine Powerpoint-Präsentation zusammenzusuchen oder das Layout abzustimmen. Medizinern wird KI künftig ermöglichen, Bilder aus dem Körperinneren besser zu deuten und die aktuelle Fachliteratur effektiver auszuwerten. Dabei brauchen wir keine umständlichen Befehlsketten, sondern können sprachlich um Unterstützung bitten. Schon sehr bald wird es selbstverständlich sein, dass wir mit den meisten elektronischen Geräten sprechen. Gerade Menschen mit Behinderung können enorm von dieser Entwicklung profitieren. Die KI kann Blinden sagen, wie es in ihrer Umgebung aussieht, was gerade passiert oder wo sie ein Getränk kaufen können.
Ist die KI-Entwicklung kontrollierbar? Und welchen Weg empfehlen Sie?
Die Dinge einfach laufen zu lassen, halte ich für falsch. Schließlich gibt es Situationen, in denen der Einsatz von KI bedeutende Risiken birgt. Über weite Strecken haben wir es aber in der Hand, was wir KI machen lassen und was nicht. Deshalb bin ich grundsätzlich ein Befürworter des europäischen AI Act mit seiner differenzierten Betrachtung verschiedener Anwendungsszenarien. Wichtig ist aber auch, dass bei der Umsetzung eine ausgewogene Balance gefunden wird. KI sollte dort reguliert werden, wo es besonders sinnvoll ist, ohne dabei die Einführung von KI massiv zu behindern. Hier müssen wir uns agile Lösungen ausdenken. Für Unternehmen, die große Sprachmodelle einsetzen – und das werden bald alle tun – wäre es schlimm, wenn sie etwa nach jedem neuen Trainingsvorgang erneut mit übermäßiger Bürokratie konfrontiert würden.
Welche negativen Auswirkungen Künstlicher Intelligenz sind zu befürchten?
Es ist gut möglich, dass wir demnächst ein längeres Telefonat führen und nicht merken, dass der Gesprächspartner eine KI ist, die sich Stimmproben und persönliche Informationen aus dem Netz beschafft hat. Da lassen sich sehr perfide Enkeltrick-Varianten oder auch großflächige Desinformationskampagnen ausdenken. Besorgniserregend ist auch eine mögliche Kriegsführung durch KI. Hier geht es nicht um Terminator-Fantasien, sondern beispielsweise um die Idee, dass Drohnen, die heute oft unpräzise ferngesteuert werden, in Zukunft KI-gesteuert entscheiden, wann welche konkreten Ziele angegriffen werden.
Wo wird KI in zehn oder 20 Jahren selbstverständlich sein?
Ich lege mich da ungerne fest. Vor zehn Jahren hat niemand ChatGPT vorhergesehen, auch nicht diejenigen, die die zugrundeliegenden Algorithmen erfunden haben. In der Forschung haben wir derartig mächtige Systeme lange als ferne Vision angesehen. Auf einmal ging aber alles sehr viel schneller als gedacht. Recht bald wird KI komplette Medieninhalte generieren können, ganze Sendungen aus Archivmaterial zum Beispiel oder vollständige Bücher mit guter Story. Wir arbeiten daran, KI objektiver und transparenter zu machen. Diese Aufgabe wird uns in einer Welt, in der immer komplexere Prozesse von KI betrieben werden, zunehmend beschäftigen.
Gerard de Melo ist Professor am Hasso-Plattner-Institut und an der Universität Potsdam, wo er das Fachgebiet Artificial Intelligence and Intelligent Systems leitet. Zuvor war er viele Jahre im Ausland, etwa als Assistant Professor an der Rutgers University in den USA und an der Tsinghua-Universität in China.
Die Texte der Table.Media-Serie “Der globale Wettlauf um Künstliche Intelligenz” finden Sie hier.
29. August bis 1. September 2023, Universität Hamburg
Tagung OR 2023: Decision Support & Choice-Based Analytics for a Disruptive World Mehr
4./5. September 2023, Haus der Unternehmer, Duisburg
Tagung Science for Society? Arbeits- und Organisationsformen der Zukunft Mehr
6. September 2023, Allianz Forum, Pariser Platz 6, Berlin
Preisverleihung Unipreneurs: Die besten Professorinnen und Professoren für Startups Mehr
11.-13. September 2023, Osnabrück
18. Jahrestagung der Gesellschaft für Hochschulforschung Das Zusammenspiel von Hochschulforschung und Hochschulentwicklung: Empirie, Transfer und Wirkungen Mehr
27.-29. September 2023, Freie Universität Berlin
Gemeinsame Konferenz der Berliner Hochschulen Open-Access-Tage 2023 “Visionen gestalten” Mehr
28. September 2023, 18-21.30 Uhr, Medizinhistorisches Museum Berlin
Diskussionsveranstaltung der Arbeitsgruppe “Hochschulen als MINT-Innovationsmotor” im Nationalen MINT Forum Any other subject: Wie die Erweiterung des MINT-Begriffs neue Zielgruppen erschließt Mehr
1.-10. November 2023, Berlin
Wissenschaftsfestival Berlin Science Week Mehr
7.-9. November 2023, Berlin
Konferenz Falling Walls Science Summit 2023 Mehr
16. November 2023, Wilhelm Büchner Hochschule, Darmstadt
Tagung WBH Wissenschaftsforum 2023 – “Transformation gestalten” Mehr
Nach fast 70 Jahren verliert die Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen (AiF) die Zuständigkeit für die Industrielle Gemeinschaftsforschung (IGF). Das teilte Hauptgeschäftsführer Bruno Michael Klein vergangenen Donnerstag den AiF-Mitgliedern in einem Schreiben mit, das Table.Media vorliegt. Knapp 200 Millionen Euro beträgt das Budget dieser Forschungsförderung des Bundeswirtschaftsministeriums für den Mittelstand dieses Jahr.
Das BMWK hatte die Projektträgerschaft europaweit ausgeschrieben, nachdem der Bundesrechnungshof 2015 einen “systembedingten Interessenkonflikt” bei der AiF festgestellt hatte. Der vermutliche neue Projektträger, das DLR, wollte die Entscheidung gegenüber Table.Media nicht offiziell bestätigen. Bereits zum ersten September soll der Wechsel beginnen und dann mit einer Übergangsphase zum Ende des Jahres vollzogen sein.
In der IGF können Unternehmen gemeinsame Probleme durch gemeinsame Forschungsaktivitäten lösen. Dadurch wird gleichgelagerter Forschungsbedarf vorwettbewerblich gebündelt und Risiko verteilt. Anträge stellen durften bisher lediglich AiF-Mitglieder. Das eng geknüpfte Netzwerk innerhalb des AiF-Kosmos ist Vor- und Nachteil zugleich. Durch die jahrzehntelange Arbeit bestehen ein großes Know-how, aber eben auch viele Abhängigkeiten. Diese waren dem BMWK wohl ein Dorn im Auge. Der Bundesrechnungshof stellte jedenfalls fest, dass das Wirtschaftsministerium seiner Fachaufsicht nicht nachkommen könne.
“Hart und traurig” sei die Entscheidung des BMWK, fortan nicht mehr mit der AiF als Projektträger für die IGF weiterarbeiten zu wollen, sagte eine Sprecherin der AiF Table.Media. Bis zuletzt hatten Hauptgeschäftsführer Bruno Michael Klein und seine Mitarbeiter gekämpft und gehofft, dass die AiF sich gegen die Mitbewerber um eine Projektträgerschaft für die IGF durchsetzen kann.
In der Szene hingegen war die Überraschung hingegen nicht sonderlich groß. Viele hatten mit dieser Entscheidung gerechnet. Die meisten bedauern es, dass die AiF – mit der viele Forschungseinrichtungen und Unternehmen verbunden sind – die Projektträgerschaft verliert. Allerdings gibt es auch Verständnis für die Entscheidung des BMWK, wieder mehr eigene Gestaltungsmacht zurückzugewinnen und neue Impulse zu setzen. So seien zum Beispiel die in den Forschungsgemeinschaften abgebildeten Branchen doch sehr traditionell. Zukunftsgerichtete Technologien und Industrien fänden dort kaum Platz und Sichtbarkeit. Und letztlich sei es am Ende ziemlich egal, wer Projektträger ist, “wichtig ist, dass die Förderlinie bleibt”, heißt es aus der Community.
Doch es gibt auch einige Bedenken. Ramona Fels von der Johannes Rau-Forschungsgemeinschaft nennt insbesondere drei Punkte:
Zur Entscheidung des Bundeswirtschaftsministeriums, der Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen (AiF) die administrative Zuständigkeit für die industrielle Gemeinschaftsforschung (IGF) zu entziehen, hat Table.Media mit AiF-Hauptgeschäftsführer Michael Klein gesprochen.
Wie überrascht waren Sie von der Entscheidung?
Wir haben das nicht erwartet, insbesondere auch, weil uns die Nachricht erst wenige Tage vor dem offiziellen Beginn der neuen IGF-Projektträgerschaft am 1. September erreichte. Die Erwartung des Netzwerkes der AiF ist, dass eine reibungslose, effiziente und bruchfreie Übergabe erfolgt und das Programm in gewohnter Effizienz und etablierten Strukturen weiterläuft. Entscheidend ist, dass die AiF-Forschungsvereinigungen als Garant des Erfolges keine negativen Auswirkungen haben, denn diese würden unmittelbar das Programm und damit den Standort schädigen. Dafür werden wir uns als AiF konstruktiv und kraftvoll einsetzen und stehen dem DLR PT und BMWK zur Verfügung.
Welche organisatorischen Konsequenzen hat diese Entscheidung für die AiF?
Für die AiF und IGF ist diese Entscheidung hart und traurig – insbesondere für die rund 50 Kolleginnen und Kollegen, die bisher das Programm umgesetzt und begleitet haben und nun ihre Arbeitsplätze verlieren werden.
Wie sehen die Pläne für die Zukunft der AiF aus?
Die Neuorientierung für die Zukunft der AiF erarbeiteten wir bereits seit einem Jahr. Dazu haben wir eine externe Evaluation der Arbeit und Wirkung der AiF angestoßen. Eine externe Jury mit Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Forschung und Politik hat in ihrem Abschlussbericht betont, dass die AiF eine wichtige Koordinationsleistung für den Forschungsbedarf des Mittelstandes erbringt. Mit unserem Potenzial von 135.000 Unternehmen und 1.200 Forschungseinrichtungen im Rücken werden wir mit dem Wechsel vom professionellen Verwalten des Programms IGF zum aktiven Gestalten des Umfeldes der mittelständischen Gemeinschaftsforschung unser Engagement auf ein neues Niveau heben. Um die Wirksamkeit des “Netzwerks der Netzwerke AiF” weiter zu erhöhen, wird es ihre Forschungs- und Transferallianzen zu Themen wie Energiewende, Leichtbau oder Wasserstoff stärken, die Vernetzung ihrer Forschungsvereinigungen untereinander forcieren und das AiF-InnovatorsNet ausbauen.
Verfügt die AiF über genügend Mittel, um diese Pläne anzugehen, etwa für das InnovatorsNet?
Die Arbeit der AiF finanziert sich nicht nur aus Beiträgen der Mitglieder, sondern auch aus Drittmitteln – diese wollen wir steigern. So ist unser InnovatorsNet ein Angebot der 100-prozentigen Tochter der AiF, der AiF FTK GmbH. Sie hat es entwickelt und baut es ständig aus – immer orientiert an den Bedürfnissen der beteiligten Unternehmen, Forschungseinrichtungen und anderen Partnern. mw
Um das forschungspolitische Engagement im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) zu verstärken, hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) einen KI-Aktionsplan erarbeitet. Ministerin Bettina Stark-Watzinger stellte das Vorhaben am Mittwoch bei einem Pressetermin vor. Bislang ist nur die Executive Summary des Plans veröffentlicht. Das gesamte, etwa 20 Seiten umfassende Dokument kündigte sie für September an. Zunächst soll es in der nächsten Woche bei der Klausurtagung des Bundeskabinetts in Meseberg diskutiert werden.
Der Aktionsplan benennt elf Bereiche, in denen laut Bettina Stark-Watzinger dringender Handlungsbedarf besteht. Dazu zählt, die Forschungsbasis weiter zu stärken, die KI-Infrastruktur zielgerichtet auszubauen und eine KI-Kompetenzoffensive zu forcieren. Außerdem sollen europäische und internationale Kooperationen weiter gestärkt werden und – mit Blick auf den AI Act der EU – eine “passfähige, agile und innovationsfreundliche Regulierung” beschlossen werden.
Zu den neuen Impulsen, die das BMBF geben will, gehören die Stärkung der KI-Fachkräftebasis, der Ausbau der Recheninfrastrukturen sowie verbesserte Zugänge zu Daten, etwa für das Forschungsdatengesetz. Weil KI auch in der Verwaltung helfen könne, sei im BMBF noch in diesem Jahr geplant “pilothaft die Nutzung von generativer KI” zu starten.
Stark-Watzinger bezeichnete den KI-Aktionsplan als Update des Beitrags ihres Ministeriums zur KI-Strategie der Bundesregierung, die im November 2018 von der vorigen Regierung beschlossen wurde. Als Ko-Federführer gehe das BMBF zudem in Vorleistung für die Weiterentwicklung der Strategie. Ergänzend zu den 50 laufenden Maßnahmen im Bereich KI, mit denen das Ministerium Forschung, Kompetenzentwicklung, Aufbau von Infrastrukturen und Transfer in die Anwendung fördert, kündigte Stark-Watzinger mindestens 20 neue Initiativen an. Etwa für den Ausbau der Supercomputing-Infrastruktur und für ein Forschungsnetz im Bereich neurobiologisch inspirierter KI. “In dieser Legislaturperiode investieren wir über 1,6 Milliarden Euro in die Umsetzung des Aktionsplans, allein im kommenden Jahr fast 500 Millionen Euro”, sagte Stark-Watzinger. Damit setze man eine klare Priorität im Haushalt.
Woher nimmt das BMBF in Zeiten schrumpfender Budgets das Geld? Die 1,6 Milliarden Euro stelle das BMBF “aus den Mitteln bereit, die entweder im BMBF-Haushalt der Jahre 2022-2023 oder in der Finanzplanung des BMBF gemäß Regierungsentwurf zum Haushalt 2024 etatisiert sind”, erläutert eine Sprecherin auf Anfrage. “Davon sind durch den KI-Aktionsplan nun 600 Millionen Euro zusätzlich aus dem BMBF-Haushalt für KI vorgesehen.”
Der Branchenverband Bitkom reagierte indes skeptisch auf die Ankündigungen aus dem BMBF. “Wir haben bereits 2018 eine KI-Strategie beschlossen und waren damit unter den Vorreitern in Europa und weltweit – aber an der Umsetzung hat es gehapert“, sagt Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder. Das liege auch daran, dass “die Politik zwar auf der einen Seite KI fördert, auf der anderen Seite aber auch behindert”. So müssten insbesondere die in Deutschland sehr restriktiven Regeln für die Verwendung nicht sensibler Daten geändert werden. abg
Die Texte der Table.Media-Serie “Der globale Wettlauf um Künstliche Intelligenz” finden Sie hier.
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft setzt mit Blick auf die zweite Förderphase der Nationalen Dateninfrastruktur (NFDI) auf eine “Konsolidierung” der bestehenden 26 NFDI-Konsortien. Das geht aus einem Eckpunktepapier des DFG-Expertengremiums hervor, das den Auswahl-, Begutachtungs- und Bewertungsprozess für die Förderanträge beschreibt. Konsolidierung sei notwendig, “um auf lange Sicht sowohl den fortlaufenden Betrieb als auch die bedarfsorientierte Weiterentwicklung sicherzustellen und dadurch die Fähigkeit der Konsortien zur Innovation zu erhalten”, teilte die DFG dazu mit.
Zur NFDI gehören 26 Konsortien und der Verbund von Konsortien, Base4NFDI, der als eigenes Konsortium Basisdienste für den gesamten Verein entwickelt. Die Konsortien wurden in einem von der DFG gesteuerten Verfahren ausgewählt. Die Konsortien decken vielfältige Wissenschaftsdisziplinen ab: von Kultur- über Sozial-, Geistes- und Ingenieurwissenschaften bis hin zu Lebens- und Naturwissenschaften. Die NFDI-Konsortien sind in drei Förderrunden an den Start gegangen. Die erste Runde wird seit Oktober 2020 gefördert, die zweite Runde seit Oktober 2021 und die dritte Runde seit März 2023.
Das Eckpunktepapier verweist auf die teils erhebliche Unterschiedlichkeit der Konsortien, nicht nur in Bezug auf adressierte Communitys, Zusammensetzung und Arbeitsschwerpunkte, sondern auch hinsichtlich des jeweiligen Reifegrads der Konsortien und ihrer Zielgruppen im Forschungsdatenmanagement. Bei zukünftigen Anträgen in der zweiten Förderphase sollen die Konsortien zu jedem Antrag und Bericht daher ein Datenblatt einreichen, um den quantitativen Fortschritt und damit den erreichten Stand der Konsolidierung nachvollziehbar zu machen.
Im Gespräch mit Table.Media sagte der Direktor des NFDI, York Sure-Vetter, der NFDI-Prozess sei für alle Neuland “und daher bin ich sehr froh, über die Klarheit zur zweiten Förderphase, die das DFG-Expertengremium nun geschaffen hat.” Die Konsortien der NFDI würden sich als Teile eines langfristig angelegten Infrastrukturprojekts sehen. “Deshalb begrüße ich auch die Anregung der DFG für eine Konsolidierung in dem Sinne, dass die guten Ideen, die von Anfang an da waren, nun konsequent weiterentwickelt werden, dass dabei Anpassungsbedarfe kontinuierlich einfließen können und dass eine langfristige Betriebsperspektive ausgearbeitet wird.”
Zudem sei auch die vorher verabredete Zahl von etwa 30 Konsortien mit den bestehenden 26 und der Basisinitiative nahezu erreicht worden. Die Befürchtung, dass mit einer Konsolidierung eine Reduzierung der Anzahl von Konsortien impliziert werden soll, habe er nicht, sagte Sure-Vetter. “Die Konsortien und die Basisdienstinitiative sind im Plan und werden darüber hinaus von dem DFG-Expertengremium und ab nächstem Jahr auch vom Wissenschaftsrat evaluiert.”
Zwischen den Konsortien gebe es zudem auf mehreren Ebenen einen Austausch und Schnittstellen. “Das ist sicher auch unter dem Begriff Konsolidierung zu verstehen. Genau da, wo bereits zielgerichtete Angebote in Konsortien existieren, die sich für eine Wissenschaftsgemeinschaft bewährt haben, besteht die Chance, dass diese auf andere Wissenschaftsbereiche übertragen werden.” Dadurch könnte man größere Strukturen schaffen, die der gesamten deutschen Wissenschaft zugutekommen werden, sagte Sure-Vetter. tg
Geothermie im industriellen Maßstab soll künftig als erneuerbare Energie zu Deutschlands Klimazielen beitragen. Mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger und Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder machen sich gleich drei Spitzenpolitiker am heutigen Donnerstag auf den Weg ins bayerische Geretsried. Die kanadische Firma Eavor Technologies will dort zeigen, dass sie mit dem sogenannten Eavor-Loop wirtschaftlich Erdwärme nutzen kann.
“Gerade bei der Wärmeversorgung brauchen wir neue Energiequellen, um uns von fossilen Energieträgern lösen zu können”, sagte Forschungsministerin Stark-Watzinger Table.Media. Eine große Chance sei hierbei die Tiefengeothermie. Das Projekt Eavor Loop eröffne zusätzliche technologische Optionen und könne Tiefengeothermie in noch mehr Regionen Deutschlands ermöglichen.
Die in Geretsried eingesetzte Technologie verzichtet im Gegensatz zur hydrothermalen Geothermie darauf, heißes Thermalwasser zu entnehmen. Hier leitet man in ein geschlossenes System Wasser, das sich dann in heißem Gestein erhitzt und wieder an die Oberfläche kommt. Der Eavor-Loop ähnelt damit in der Funktionsweise einem unterirdischen Wärmetauscher.
Dieser Ansatz hat mehrere Vorteile:
Ingo Sass vom Geoforschungszentrum Potsdam begrüßt die Pilotanlage, die mit 91,6 Millionen Euro vom Innovationsfonds der Europäischen Union gefördert wird. Die eingesetzte Technologie sei durchaus interessant und bringe verschiedene Vorteile, wie das entfallende Fündigkeitsrisiko mit Blick auf Thermalwasser. Jedoch sei noch offen, ob eine derartige Anlage am Ende wirtschaftlich betrieben werden kann. Es sei weniger effizient, Wasser in einem Rohr zu erhitzen, als direkt heißes Thermalwasser zu fördern. Die Folge: “Man braucht mit diesem Ansatz mehr Bohrungen – und die kosten Geld.” mw
Nature – Want to speed up scientific progress? First understand how science policy works. Vorschläge, wie sich Wissenschaftler forschungspolitischem Denken annähern können, liefert ein von fünf US-Wissenschaftlern verfasster Kommentar. Sie schlagen zum einen vor, in der Regierung mitzuarbeiten, um zu verstehen, wie Politik funktioniert. Zum anderen sollten Akademiker nach Möglichkeiten suchen, mit Thinktanks zusammenzuarbeiten. Denn die sind erfahren in der Vermittlung zwischen Wissenschaft und Politik. Der dritte Vorschlag ist, sich dafür einzusetzen, dass anwendungsorientierte Forschung auch als wissenschaftlich wertvoll anerkannt wird. Mehr
Spiegel – Wann begann das Leben im Hamsterrad? Der Soziologe Max Weber machte den Protestantismus calvinistischer und puritanischer Prägung dafür verantwortlich, dass Arbeit zum Lebensinhalt wurde. Gegen diese These gab es schon früh Einwände. Weber hatte seine These dagegen geschickt imprägniert. Mehr
Ars Technica – A jargon-free explanation of how AI large language models work. Wie ChatGPT und andere große Sprachmodelle funktionieren, ist nicht leicht zu verstehen. Der Journalist Timothy B. Lee und der Sprachmodell-Forscher Sean Trott erklären, dass Vektoren für Wörter stehen, wie diese in Wort-Vorhersagen umgewandelt werden und wie Sprachmodelle trainiert werden. Mehr
Zeit Online. Kernfusion – Zu utopisch, um wahr zu sein? Die Kernfusion könnte alle Energieprobleme lösen – deshalb brauche sie mehr Förderung, sagt die Physikerin Sabine Hossenfelder im Streitgespräch. Sie hält es für möglich, dass das Feld nun schnell voranschreite. Forschungspolitiker Kai Gehring (Grüne) hingegen warnt vor falschen Versprechen. Die Kernfusion werde für das Ziel der Klimaneutralität bis 2045 keine Rolle mehr spielen. Daher solle sich der Staat besser auf den Ausbau der erneuerbaren Energien konzentrieren. Mehr
Peter Strasser wurde zum Mitglied der Europäischen Wissenschaftsakademie Academia Europaea gewählt, einer paneuropäischen Gesellschaft, die sich der Förderung der Wissenschaft in den Bereichen Geisteswissenschaften, Literatur, Recht und Naturwissenschaften widmet. Strasser leitet an der Technischen Universität Berlin das Fachgebiet Technische Chemie/ Elektrokatalyse – Materialien.
Sean Jones wird stellvertretender Direktor für Wissenschaft und Technologie am Argonne National Laboratory des US-Energieministeriums. Der Materialwissenschaftler ist seit 2020 Leiter der Direktion für mathematische und physikalische Wissenschaften der National Science Foundation der USA.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!
Bildung.Table: Gütesiegel digitale Bildung. Österreich zeichnet regelmäßig Lernapps mit einem Gütesiegel aus. In Deutschland fehlt eine übersichtliche Bewertung nach einheitlichen Qualitätsstandards – allen Versprechungen zum Trotz. Mehr
Bildung.Table: Nordländer prägen Bildungsziele der SPD. Auf der Suche nach einer neuen Bildungspolitik sind SPD-Parteichefin Saskia Esken und ihr wichtigster Landespolitiker, Ties Rabe, vier Tage durch Finnland und Norwegen gereist. Für den Ausbau des Ganztags in Deutschland sahen sie Vorbildliches – bei der Digitalisierung hingegen wachsende Selbstzweifel. Mehr
Agrifood.Table. Agri-PV: Politisch gewünscht, praktisch mit Herausforderungen konfrontiert. Mit dem Solarpaket 1 hat die Bundesregierung die Weichen für den Ausbau von Photovoltaikanlagen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen gestellt. Doch damit der Agri-PV der gewünschte Durchbruch gelingt, muss noch an einigen Stellen geschraubt werden. Mehr
Europe.Table. Kreislaufwirtschaft: EU bringt Aktionsplan voran. Produktdesign, Reparatur, Wiederverwendung – die EU nimmt im aktuellen Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft alle Phasen im Lebenszyklus eines Produkts in den Blick. Für beinahe alle Produkte gibt es in Zukunft strengere Vorgaben. Eine Übersicht über die Gesetzesvorhaben. Mehr
ESG.Table. Chipfabriken: Milliarden-Subventionen ohne Nachhaltigkeitsgarantie? Der Halbleiterindustrie wurden in den vergangenen Monaten in Deutschland Fördermittel in Höhe von 20 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Ein gehöriger Teil davon stammt aus dem Klima- und Transformationsfonds. Ob im Gegenzug konkrete Klima- und Nachhaltigkeitsziele mit den Unternehmen vereinbart wurden, ist fraglich. Mehr
Am Beispiel der Chipfabriken in Magdeburg und Dresden habe ich zuletzt die dramatischen Konsequenzen des Mint-Fachkräftemangels bei Hightech-Standortentscheidungen für Deutschland deutlich gemacht. Doch das ist doch nur die Spitze des Eisberges. Deutschlands Mint-Talentquellen verarmen und wir werden zudem (immer noch) kein Land für qualifizierte Mint-Einwanderung.
Daten des Statistischen Bundesamts zufolge wählten im Studienjahr 2021 rund 307.000 Studierende im ersten Fachsemester ein Mint-Fach. Das waren 6,5 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Zahl der Anfänger in Maschinenbau und Elektrotechnik hat sich in den letzten zehn Jahren bis Studienbeginn 2021/2022 halbiert. Es gibt inzwischen Hochschulen, die 30 bis 40 Prozent weniger Studienanfänger im Mint-Bereich haben.
Gleichzeitig sinkt der Anteil derjenigen, die sich im ersten Fachsemester für Mint-Fächer entscheiden: 2021 lag er bei 37,7 Prozent. Im Jahr 2015 hatte er noch 40,5 Prozent betragen. Das anteilige Stück am Kuchen ist also ebenso geschrumpft wie der Kuchen selbst.
Über die Studienabbruchs- und Wechselquoten von circa 50 Prozent in Mathematik, Informatik, Elektrotechnik, Physik und Chemie habe ich noch gar nicht gesprochen. Darunter die international Studierenden, deren Abbruchquoten zum Teil absolute zehn Prozent höher liegen.
Dies alles hat drastische Konsequenzen für Arbeitsmarkt und Fachkräftelücke. Im Mai 2023 betrug die Mint-Fachkräftelücke laut Mint-Frühjahrsreport 2023 des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) fast 310.000. Das ist nahe am historischen Höchststand und größer als die Lücke der Mint-Facharbeiter und die der Spezialisten, der Meister und Techniker.
Bei einer Betrachtung nach Bundesländern (Quelle: Studie Jobvalley / Universität Maastricht) haben nur die Stadtstaaten Hamburg und Berlin sowie Bayern und Baden-Württemberg einen positiven Migrationssaldo. Alle anderen Bundesländer verlieren Ingenieure. Die ostdeutschen Bundesländer haben einen negativen Migrationssaldo in 2022 von minus 29 Prozent (Sachsen) bis hin zu einer Abnahme von 66 Prozent (Thüringen) und sogar 70 Prozent in Sachsen-Anhalt. Aber auch Niedersachsen (minus 37 Prozent) oder Rheinland-Pfalz (minus 54 Prozent) gehören zu den ganz großen Verlierern.
Vor dem Hintergrund, dass wir neben dem allemal demografisch bedingten Ersatzbedarf zusätzlich Hunderttausende Fachkräfte sowohl für die Energiewende als auch für die digitale Transformation benötigen, ist dies eine Katastrophe.
Noch schlimmer ist, dass das Elend schon sehr früh, bei der Bildung unserer jungen und jüngsten Generation beginnt. Ein Viertel (25,4 Prozent) der getesteten Kinder in Deutschland erreicht nicht den international festgelegten Mindeststandard beim Lesen (Kompetenzstufe III), der zum Lernen, gerade auch dem Mint-Lernen nötig wäre. Nur rund ein Drittel des Leistungsabfalls erklärt sich durch die veränderte Zusammensetzung der Schülerschaft.
“Wichtig ist auch, dass nicht die ausländische Herkunft maßgeblich ist. Der soziale Status – Buchbesitz, Bildungsabschluss und Berufsstatus der Eltern – und die zu Hause gesprochene Sprache erklären die Leistungsunterschiede”, erläutert Nele McElvany, Leiterin der internationalen Studie (vorherige Quelle). Zudem sind die Pisawerte in Mathematik und Naturwissenschaften wieder auf den Wert von 2003 zurückgefallen, also fast wieder auf dem Wert des Pisa Schocks 2000.
Zusammen mit dem damaligen Arbeitgeber-Präsidenten Dieter Hundt habe ich 2008 die eher operative Nationale Initiative Mint Zukunft e.V. (später als gemeinsame BDA/BDI- Initiative) und 2012 mit dem damaligen acatech-Präsidenten Henning Kagermann das policy- und strategiebasierte Nationale Mint Forum gegründet. 2022 hielt ich eine Dinnerspeech zum zehnjährigen Bestehen. Es war eine Brandrede zum Jubiläum.
Das Mint-Desaster war nicht erst absehbar, sondern schon voll im Gange. Ich forderte eine Bündelung der großen und finanzstarken Mint-Organisationen in einem nationalen Kraftakt: mit wenig Egoismus und Eitelkeit. Denn natürlich will in der deutschen privaten Förderszene jede Organisation mit ihren eigenen Spezialitäten strategisch hervorstechen und Reputation erwerben. Doch die Situation ist so schlimm, dass wir uns im Interesse der Sicherung einer umfassenden Mint-Bildung und des Technologiestandorts Deutschland auf ganz bodenständige Basics der Förderung verständigen müssen.
Es geht jetzt nicht mehr um das extravaganteste schulische Hightech Multimedia-Labor der XY-Stiftung, nicht mehr um abgehobene Mint-Diversity-Konferenzen in der Berliner Blase. Es geht jetzt nicht mehr um die Girls Days, deren Impact nie jemand richtig evaluiert hat, auch nicht um das nächste Policy Paper, das gebetsmühlenartig den alten, breitgetretenen Käse nach weiblichen Mint-Rollenvorbildern proklamiert. Die Ressourcen und gerade auch die finanziellen Ressourcen gehören gebündelt. Eine Milliarde von privaten Geldgebern mit Matching von zwei zusätzlichen Lindner-Milliarden – das wäre ein Wort!
Dafür bräuchte es eine klare gemeinsame Idee der privaten Geldgeber, einen Plan, der sowohl Qualitätssicherung als auch einen zügigen Mittelabfluss garantiert.
Innovating Innovation: Wer nicht erfolglos weiter so wie bisher wursteln will und damit nur “Mehr des Gleichen” macht, dem gebe ich folgende vier innovative Stellhebel mit auf den Weg:
trotz entspannender Wanderungen in den Bergen, trotz Hawaii-Pizza-Posting: Wer dachte, Jens Brandenburg, Verhandlungsführer des BMBF in Sachen WissZeitVG, wäre nach der Sommerpause milde gestimmt und würde die Vorschläge der Koalitionspartner – vor allem die der SPD zur Befristungsdauer in der Postdoc-Phase, aufnehmen -, der irrt: In Detailfragen sei man gesprächsbereit, erklärt der Parlamentarische Staatssekretär. Das Maß an Kreativität sei allerdings irgendwann ausgeschöpft. “Der Grundkonflikt lässt sich vermutlich auch durch weitere Gespräche nicht auflösen.” Tim Gabel hat die Details.
Anne Brüning hat sich für unsere Serie “Politikberatung, quo vadis?” beherzt in die Tiefen wissenschaftlicher Beratungskonzepte eingegraben. Sie hat mit Experten in Politik und Wissenschaft gesprochen, Kritikpunkte und Wünsche eingesammelt und schnell gelernt: In der Szene der wissenschaftlichen Politikberatung agieren viele Akteure, ihre Zuständigkeiten sind unscharf bis unklar. Ähnlich wenig Übersicht herrscht bei den vielen intensiv recherchierten Gutachten und Stellungnahmen, die für Entscheidungsträger oder Verwaltungsmitarbeitende erstellt werden. Politikwissenschaftlerin Nataliia Sokolovska vom Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) in Berlin will mit dem Repod-Projekt Abhilfe und eine Datenbank für Policy Paper schaffen.
Das Bundeswirtschaftsministerium hat der Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen (AiF) die administrative Zuständigkeit für die industrielle Gemeinschaftsforschung (IGF) entzogen – die AiF hatte die Projektträgerschaft fast 70 Jahre inne. In der Wissenschaftscommunity gibt es Bedauern, aber auch Verständnis für die Entscheidung des BMWK. Auch die durch den Bundesrechnungshof einmal angenommene Möglichkeit von Interessenkonflikten könnte den Schritt beeinflusst haben. Was plant AiF-Geschaftsführer Michael Klein jetzt? Markus Weißkopf hat mit ihm gesprochen.
Ich wünsche Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre,
Wenn Ihnen der Research.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail weitergeleitet wurde: Hier können Sie sich für den Research.Table kostenlos anmelden.

Beim Wandern hat sich der Parlamentarische Staatssekretär Jens Brandenburg von einem konflikt- und arbeitsreichen ersten Halbjahr erholt. Der Bildungsexperte der FDP hatte in diesem Jahr vor allem mit der Novellierung des WissZeitVG zu kämpfen. Sein Eckpunktepapier, an einem Freitag im Februar veröffentlicht, zog das BMBF nach einem Proteststurm in den sozialen Netzwerken umgehend zurück.
Bis kurz vor der Sommerpause wurde es weiterentwickelt und als Referentenentwurf des BMBF wieder veröffentlicht. Diesem Entwurf fehlt aber die Unterstützung der Grünen und der SPD – trotz etlicher Stakeholder-Dialoge und Berichterstatter-Gespräche in diesem und dem Vorjahr. “Im aktuellen Referentenentwurf ist auch in der Koalition fast alles geeint, bis auf einen Aspekt, nämlich die Befristungsdauer in der Postdoc-Phase“, betont Jens Brandenburg im Gespräch mit Table.Media. Das sei auch in der Wissenschaft selbst ein sehr kontroverser Punkt.
Ihm ist wichtig, dass nicht der Eindruck entsteht, man habe geredet und geredet und dabei sei nichts herausgekommen. Wenn man die Novellierung des WissZeitVG mit den allermeisten Gesetzgebungsverfahren in der Regierung vergleiche, sagt Brandenburg, sei schon in einem sehr frühen Stadium eine breite Einigkeit erzielt worden.
Brandenburg sagt, dass es rückblickend ein politisches Risiko gewesen sei, das Verfahren zu den Eckpunkten nochmal zu öffnen, aber die richtige Entscheidung. Auch wenn es vielen nicht gefallen habe, der Sache habe es gutgetan.
Inhaltlich zeigt sich Brandenburg auch nach den Sommerferien unbeeindruckt von den Vorschlägen der Koalitionspartner. Vor allem die SPD hatte in den Verhandlungen zum Referentenentwurf auf eine Tarifautonomie bei der Höchstbefristungsdauer in der Postdoc-Phase gedrängt, um auch die Gewerkschaften hinter das Koalitionspapier zu bringen. Im Interview mit Table.Media hatte Carolin Wagner (SPD) berichtet, dass die Ministerin in den letzten Verhandlungen offen dafür war, allerdings nur für einen Höchstbefristungs-Korridor von drei bis sechs Jahren. Die Gespräche scheiterten.
Im Referentenentwurf des BMBF sind nun vier Jahre festgeschrieben. “Wir halten eine Reduzierung der Qualifizierungsbefristung in der Postdoc-Phase auf maximal zwei Jahre für nicht verantwortbar”, sagt Brandenburg. “Es gibt enorme Unterschiede zwischen den Fachkulturen. In vielen Gesprächen vor allem an naturwissenschaftlichen Einrichtungen hat mir auch die Arbeitnehmerseite klar signalisiert, dass ihre Forschung damit unmöglich wäre.” Man sei als Ministerium vor allem für diejenigen verantwortlich, die täglich im Wissenschaftssystem arbeiten.
Dass man bei Detailfragen weiter gesprächsbereit ist, bestätigt Brandenburg. Wie konkrete Maßnahmen aussehen könnten, die dann doch noch eine Einigung mit SPD und Grünen herbeiführen würden, dazu verweist Brandenburg allerdings auf die vertraulichen Berichterstatter-Gespräche und das parlamentarische Verfahren, das jetzt nach der Sommerpause ansteht. Das Maß an Kreativität sei allerdings auch irgendwann ausgeschöpft, sagt der Staatssekretär. “Der Grundkonflikt lässt sich vermutlich auch durch weitere Gespräche nicht auflösen.”
Weitere wichtige Vorschläge zum Kulturwandel im Wissenschaftssystem ließen sich zudem nur teilweise oder gar nicht mit dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz umsetzen. “Dieses Gesetz kann nicht alles regeln, es ist nur einer von vielen Bausteinen für ein modernes Wissenschaftssystem”, sagt Brandenburg. Gespräche zu weiterführenden Ideen und Maßnahmen jenseits des WissZeitVG wolle der Bund im Wissenschaftsrat, unter anderem gemeinsam mit den Ländern, führen.
Für die Zeit des parlamentarischen Verfahrens wünscht sich der Parlamentarische Staatssekretär eine andere Debattenkultur. Er verstehe, dass das Interesse bei den Beschäftigten im Wissenschaftsbetrieb sehr hoch sei, weil die Arbeitsbedingungen viele sehr direkt beträfen. “Das ist ein hochemotionales Thema, das auch polarisiert.” Es gebe in der Diskussion aber die Tendenz, dass vieles aus dem Kontext gerissen und falsch dargestellt werde.
Ganz extrem sehe man das an der Plattform X (ehemals Twitter): “Meine Erfahrung ist, dass dieselben Akteure, wenn man sie persönlich trifft, plötzlich vieles differenzierter und lösungsorientierter sehen als das, was sie mit ein paar Klicks in den Orbit der sozialen Netzwerke senden.” Gerade im akademischen Umfeld und in Hochschulen werde Debattenkultur großgeschrieben, das merke man auf X aber nicht immer. “Wir müssen auch die Stimmen wahrnehmen, die sich woanders und leiser äußern.”
So unübersichtlich wie die Zahl und Zuständigkeiten der Akteure der wissenschaftlichen Politikberatung sind auch ihre Produkte: Schriftstücke, die für politische Entscheidungsträger oder Verwaltungsmitarbeitende erstellt werden. Wer aktuell zum Beispiel nach Expertise zum Thema Wasserstoff sucht, wird auf diversen Websites fündig – vom Sachverständigenrat für Umweltfragen über Leopoldina und Acatech bis zu Agora Energiewende und dem Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft.
Bei anderen gesellschaftlich relevanten Themen, bei denen politische Entscheidungen anstehen, ist die Lage ähnlich. “Insgesamt fehlt es an Überblick über Beratungsdokumente. Das macht die Suche danach mühsam und zeitaufwendig. Sie sind nicht gezielt recherchierbar”, sagt die Politikwissenschaftlerin Nataliia Sokolovska, die am Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) in Berlin das Forschungsprogramm Wissen und Gesellschaft leitet.
In einem Konsortium mit drei Leibniz-Instituten (Medienforschung/HBI, Raumbezogene Sozialforschung/IRS und Wirtschaftsforschung/RWI) und geleitet vom ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft arbeitet sie daran mit, die Situation zu verbessern. Die Forscherinnen und Forscher bauen das Repositorium für wissenschaftliche Politik- und Gesellschaftsberatung, kurz Repod, auf. Das im Februar mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) gestartete Projekt will bis Ende 2023 eine Informations- und Beratungsinfrastruktur für Politik und Gesellschaft schaffen, die den Wissenstransfer aus der Forschung deutlich einfacher macht. Vorgesehen ist, Repod dauerhaft am ZBW anzusiedeln und weiterzuentwickeln, das auf forschungsbasierte Informationsstruktur für die Wirtschaftswissenschaften spezialisiert ist.
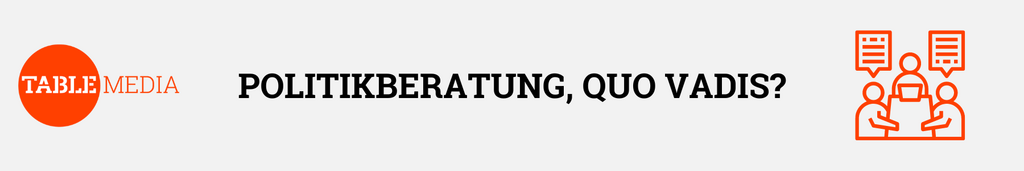
Das Repod-Team macht sich nicht nur an die technische Umsetzung, sondern untersucht auch die Entstehungsprozesse, Qualitätskriterien und Nutzungsbedingungen von Beratungsdokumenten. “Letztlich geht es darum, die Kommunikation zwischen Forschung, Politik und Verwaltung zu optimieren“, sagt Sokolovska. Ihr Forschungsthema in dem Projekt sind die Qualitätsrichtlinien und -anforderungen. Dafür hat sie zusammen mit Kollegen Vertreter aller zukünftigen Nutzergruppen interviewt – also Forschende aus Universitäten und außeruniversitären Forschungseinrichtungen sowie Mitarbeiter aus Ministerien, Beratungseinrichtungen und der öffentlichen Verwaltung. Diese Gespräche dienten dazu, die Erwartungen an solch eine Infrastruktur zu erfassen sowie Qualitätsanforderungen zu formulieren, auf deren Basis die Dokumente in Zukunft ins Repositorium eingestellt werden. Das Ziel: “Wir erarbeiten zentrale Leitlinien für die Qualitätssicherung.”
Auch wenn die Daten noch nicht final analysiert sind, zeichnen sich bereits wichtige Qualitätsaspekte für Beratungsdokumente ab:
Das Repositorium soll nicht nur Akteuren in Politik und Verwaltung besseren Überblick über Beratungsdokumente verschaffen. Auch für Journalisten könnte es hilfreich sein, dadurch Experten und Expertisen zu bestimmten Themen zu finden. “Ein großer Vorteil ist, dass Repod die Perspektivenvielfalt stärkt”, sagt Sokolovska. Der derzeit fehlende Überblick über alle Forschungsteams, die Expertise zu bestimmten Themen produzieren, begünstige Voreingenommenheit und Instrumentalisierung.
Allumfassend kann Repod jedoch nicht sein, denn Dokumente sind nur ein Teil der Kommunikation zwischen Forschenden und politischen Entscheidungsträgern. “Zum einen werden vermutlich nicht alle relevanten Ergebnisse in solchen Beratungsdokumenten veröffentlicht. Zum anderen spielt in der wissenschaftlichen Politikberatung auch der persönliche Kontakt eine große Rolle”, sagt Sokolovska.
Wie viele Dokumente mit Berichten, Gutachten, Empfehlungen, Positionspapiere, Impulse, Risikoanalysen und Guidelines in der ersten Stufe bei Repod abzurufen sein werden, ist derzeit noch unklar. Nataliia Sokolovska hofft, dass es eines Tages so viele sein werden, dass auch Meta-Studien möglich sind. “Man könnte zu bestimmten Themen dann untersuchen, wie sich die Expertise im Verlauf der Zeit entwickelt hat.”
Falls die Repod-Idee sich bewährt, könnte sie auch für andere Länder beispielgebend sein. “Wir haben uns im Vorfeld intensiv umgetan, aber so gut wie keine Best-Practice-Beispiele gefunden”, sagt die HIIG-Forscherin. In einer Reihe von Ländern gibt es Initiativen, die innovative Formate und Ressourcen für wissenschaftliche Politikberatung entwickeln. “Dahinter steht aber keine Infrastruktur, wie wir sie aufbauen.”
Auf EU-Ebene gibt es die Plattform Knowledge4Policy (K4P). Sie verwaltet und veröffentlicht wissenschaftliche Erkenntnisse, die für die Politik relevant sind. Anders als bei Repod findet jedoch eine Art Aufbereitung mit dem gleichen Ziel statt: Das Wissen wird in einer Form zusammengefasst, die politische Entscheidungsträger verstehen und nutzen können. Zurzeit tragen 20 Dienste, die Knowledge Services, unter Leitung des Joint Research Centre Wissen zu bestimmten Themen bei, etwa zum European Green Deal oder zur Digitalisierung.
In Teil 8 beleuchten wir die Rolle des Experten. Die Serie “Politikberatung, quo vadis?” finden Sie gesammelt hier.

Was erforschen Sie im Zusammenhang mit KI?
Zusammen mit meinem Team verfolge ich das Ziel, KI-Systeme zu entwickeln, die auch in gigantischen Datenmengen die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen erkennen und gänzlich neue Zusammenhänge erschließen. Dies setzt ein im Vergleich zu heutigen KI-Modellen noch tieferes Verständnis des Menschen und eine noch umfassendere Kenntnis der Welt voraus.
Welche Herausforderungen gibt es dabei?
Aktuelle Systeme wie ChatGPT können zunächst nur recht kurze Texte untersuchen und sind nicht ohne Weiteres in der Lage, eine große Datensammlung zu analysieren. Das aber sollte KI in Zukunft können und darüber hinaus in der Lage sein, diverse Datenformen auswerten zu können, darunter Bilder und Videos in Büchern, sozialen Medien oder auf YouTube. Mit dieser Zielvorstellung entwickeln wir Verfahren, die Verbindungen zwischen ganz unterschiedlichen Arten von Daten aufdecken. Eine weitere große Herausforderung ist der Umgang mit ganz kleinen Datenquellen. Zum Trainieren von KI benötigen wir heutzutage Unmengen an Daten. Wie aber gehen wir vor, wenn für ein konkretes Thema oder für eine bestimmte Sprache nur sehr wenig da ist? Wie also schaffen wir es, aus wenigen Daten viel zu machen? Das sind Fragen, die uns tagtäglich beschäftigen.
Welche Anwendungen sehen Sie für Ihre Forschung?
Es gibt sehr viel neues Potenzial. Wir arbeiten zum Beispiel gerade daran, Unternehmensdatenbanken in Sprachmodelle einzubinden und zu durchforsten, damit Unternehmen einfacher von den aktuellen Entwicklungen in der KI profitieren können. Ähnliches gilt für Angehörige kleiner Sprachgemeinschaften, beispielsweise in Afrika oder auf Papua-Neuguinea, denen wir den Zugang zu Sprachmodellen eröffnen möchten.

Was sind die größten Chancen von KI?
Sie kann viele Prozesse vereinfachen und beschleunigen. In Zukunft müssen wir nicht mehr Stunden damit verbringen, Informationen aus verschiedenen Quellen für eine Powerpoint-Präsentation zusammenzusuchen oder das Layout abzustimmen. Medizinern wird KI künftig ermöglichen, Bilder aus dem Körperinneren besser zu deuten und die aktuelle Fachliteratur effektiver auszuwerten. Dabei brauchen wir keine umständlichen Befehlsketten, sondern können sprachlich um Unterstützung bitten. Schon sehr bald wird es selbstverständlich sein, dass wir mit den meisten elektronischen Geräten sprechen. Gerade Menschen mit Behinderung können enorm von dieser Entwicklung profitieren. Die KI kann Blinden sagen, wie es in ihrer Umgebung aussieht, was gerade passiert oder wo sie ein Getränk kaufen können.
Ist die KI-Entwicklung kontrollierbar? Und welchen Weg empfehlen Sie?
Die Dinge einfach laufen zu lassen, halte ich für falsch. Schließlich gibt es Situationen, in denen der Einsatz von KI bedeutende Risiken birgt. Über weite Strecken haben wir es aber in der Hand, was wir KI machen lassen und was nicht. Deshalb bin ich grundsätzlich ein Befürworter des europäischen AI Act mit seiner differenzierten Betrachtung verschiedener Anwendungsszenarien. Wichtig ist aber auch, dass bei der Umsetzung eine ausgewogene Balance gefunden wird. KI sollte dort reguliert werden, wo es besonders sinnvoll ist, ohne dabei die Einführung von KI massiv zu behindern. Hier müssen wir uns agile Lösungen ausdenken. Für Unternehmen, die große Sprachmodelle einsetzen – und das werden bald alle tun – wäre es schlimm, wenn sie etwa nach jedem neuen Trainingsvorgang erneut mit übermäßiger Bürokratie konfrontiert würden.
Welche negativen Auswirkungen Künstlicher Intelligenz sind zu befürchten?
Es ist gut möglich, dass wir demnächst ein längeres Telefonat führen und nicht merken, dass der Gesprächspartner eine KI ist, die sich Stimmproben und persönliche Informationen aus dem Netz beschafft hat. Da lassen sich sehr perfide Enkeltrick-Varianten oder auch großflächige Desinformationskampagnen ausdenken. Besorgniserregend ist auch eine mögliche Kriegsführung durch KI. Hier geht es nicht um Terminator-Fantasien, sondern beispielsweise um die Idee, dass Drohnen, die heute oft unpräzise ferngesteuert werden, in Zukunft KI-gesteuert entscheiden, wann welche konkreten Ziele angegriffen werden.
Wo wird KI in zehn oder 20 Jahren selbstverständlich sein?
Ich lege mich da ungerne fest. Vor zehn Jahren hat niemand ChatGPT vorhergesehen, auch nicht diejenigen, die die zugrundeliegenden Algorithmen erfunden haben. In der Forschung haben wir derartig mächtige Systeme lange als ferne Vision angesehen. Auf einmal ging aber alles sehr viel schneller als gedacht. Recht bald wird KI komplette Medieninhalte generieren können, ganze Sendungen aus Archivmaterial zum Beispiel oder vollständige Bücher mit guter Story. Wir arbeiten daran, KI objektiver und transparenter zu machen. Diese Aufgabe wird uns in einer Welt, in der immer komplexere Prozesse von KI betrieben werden, zunehmend beschäftigen.
Gerard de Melo ist Professor am Hasso-Plattner-Institut und an der Universität Potsdam, wo er das Fachgebiet Artificial Intelligence and Intelligent Systems leitet. Zuvor war er viele Jahre im Ausland, etwa als Assistant Professor an der Rutgers University in den USA und an der Tsinghua-Universität in China.
Die Texte der Table.Media-Serie “Der globale Wettlauf um Künstliche Intelligenz” finden Sie hier.
29. August bis 1. September 2023, Universität Hamburg
Tagung OR 2023: Decision Support & Choice-Based Analytics for a Disruptive World Mehr
4./5. September 2023, Haus der Unternehmer, Duisburg
Tagung Science for Society? Arbeits- und Organisationsformen der Zukunft Mehr
6. September 2023, Allianz Forum, Pariser Platz 6, Berlin
Preisverleihung Unipreneurs: Die besten Professorinnen und Professoren für Startups Mehr
11.-13. September 2023, Osnabrück
18. Jahrestagung der Gesellschaft für Hochschulforschung Das Zusammenspiel von Hochschulforschung und Hochschulentwicklung: Empirie, Transfer und Wirkungen Mehr
27.-29. September 2023, Freie Universität Berlin
Gemeinsame Konferenz der Berliner Hochschulen Open-Access-Tage 2023 “Visionen gestalten” Mehr
28. September 2023, 18-21.30 Uhr, Medizinhistorisches Museum Berlin
Diskussionsveranstaltung der Arbeitsgruppe “Hochschulen als MINT-Innovationsmotor” im Nationalen MINT Forum Any other subject: Wie die Erweiterung des MINT-Begriffs neue Zielgruppen erschließt Mehr
1.-10. November 2023, Berlin
Wissenschaftsfestival Berlin Science Week Mehr
7.-9. November 2023, Berlin
Konferenz Falling Walls Science Summit 2023 Mehr
16. November 2023, Wilhelm Büchner Hochschule, Darmstadt
Tagung WBH Wissenschaftsforum 2023 – “Transformation gestalten” Mehr
Nach fast 70 Jahren verliert die Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen (AiF) die Zuständigkeit für die Industrielle Gemeinschaftsforschung (IGF). Das teilte Hauptgeschäftsführer Bruno Michael Klein vergangenen Donnerstag den AiF-Mitgliedern in einem Schreiben mit, das Table.Media vorliegt. Knapp 200 Millionen Euro beträgt das Budget dieser Forschungsförderung des Bundeswirtschaftsministeriums für den Mittelstand dieses Jahr.
Das BMWK hatte die Projektträgerschaft europaweit ausgeschrieben, nachdem der Bundesrechnungshof 2015 einen “systembedingten Interessenkonflikt” bei der AiF festgestellt hatte. Der vermutliche neue Projektträger, das DLR, wollte die Entscheidung gegenüber Table.Media nicht offiziell bestätigen. Bereits zum ersten September soll der Wechsel beginnen und dann mit einer Übergangsphase zum Ende des Jahres vollzogen sein.
In der IGF können Unternehmen gemeinsame Probleme durch gemeinsame Forschungsaktivitäten lösen. Dadurch wird gleichgelagerter Forschungsbedarf vorwettbewerblich gebündelt und Risiko verteilt. Anträge stellen durften bisher lediglich AiF-Mitglieder. Das eng geknüpfte Netzwerk innerhalb des AiF-Kosmos ist Vor- und Nachteil zugleich. Durch die jahrzehntelange Arbeit bestehen ein großes Know-how, aber eben auch viele Abhängigkeiten. Diese waren dem BMWK wohl ein Dorn im Auge. Der Bundesrechnungshof stellte jedenfalls fest, dass das Wirtschaftsministerium seiner Fachaufsicht nicht nachkommen könne.
“Hart und traurig” sei die Entscheidung des BMWK, fortan nicht mehr mit der AiF als Projektträger für die IGF weiterarbeiten zu wollen, sagte eine Sprecherin der AiF Table.Media. Bis zuletzt hatten Hauptgeschäftsführer Bruno Michael Klein und seine Mitarbeiter gekämpft und gehofft, dass die AiF sich gegen die Mitbewerber um eine Projektträgerschaft für die IGF durchsetzen kann.
In der Szene hingegen war die Überraschung hingegen nicht sonderlich groß. Viele hatten mit dieser Entscheidung gerechnet. Die meisten bedauern es, dass die AiF – mit der viele Forschungseinrichtungen und Unternehmen verbunden sind – die Projektträgerschaft verliert. Allerdings gibt es auch Verständnis für die Entscheidung des BMWK, wieder mehr eigene Gestaltungsmacht zurückzugewinnen und neue Impulse zu setzen. So seien zum Beispiel die in den Forschungsgemeinschaften abgebildeten Branchen doch sehr traditionell. Zukunftsgerichtete Technologien und Industrien fänden dort kaum Platz und Sichtbarkeit. Und letztlich sei es am Ende ziemlich egal, wer Projektträger ist, “wichtig ist, dass die Förderlinie bleibt”, heißt es aus der Community.
Doch es gibt auch einige Bedenken. Ramona Fels von der Johannes Rau-Forschungsgemeinschaft nennt insbesondere drei Punkte:
Zur Entscheidung des Bundeswirtschaftsministeriums, der Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen (AiF) die administrative Zuständigkeit für die industrielle Gemeinschaftsforschung (IGF) zu entziehen, hat Table.Media mit AiF-Hauptgeschäftsführer Michael Klein gesprochen.
Wie überrascht waren Sie von der Entscheidung?
Wir haben das nicht erwartet, insbesondere auch, weil uns die Nachricht erst wenige Tage vor dem offiziellen Beginn der neuen IGF-Projektträgerschaft am 1. September erreichte. Die Erwartung des Netzwerkes der AiF ist, dass eine reibungslose, effiziente und bruchfreie Übergabe erfolgt und das Programm in gewohnter Effizienz und etablierten Strukturen weiterläuft. Entscheidend ist, dass die AiF-Forschungsvereinigungen als Garant des Erfolges keine negativen Auswirkungen haben, denn diese würden unmittelbar das Programm und damit den Standort schädigen. Dafür werden wir uns als AiF konstruktiv und kraftvoll einsetzen und stehen dem DLR PT und BMWK zur Verfügung.
Welche organisatorischen Konsequenzen hat diese Entscheidung für die AiF?
Für die AiF und IGF ist diese Entscheidung hart und traurig – insbesondere für die rund 50 Kolleginnen und Kollegen, die bisher das Programm umgesetzt und begleitet haben und nun ihre Arbeitsplätze verlieren werden.
Wie sehen die Pläne für die Zukunft der AiF aus?
Die Neuorientierung für die Zukunft der AiF erarbeiteten wir bereits seit einem Jahr. Dazu haben wir eine externe Evaluation der Arbeit und Wirkung der AiF angestoßen. Eine externe Jury mit Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Forschung und Politik hat in ihrem Abschlussbericht betont, dass die AiF eine wichtige Koordinationsleistung für den Forschungsbedarf des Mittelstandes erbringt. Mit unserem Potenzial von 135.000 Unternehmen und 1.200 Forschungseinrichtungen im Rücken werden wir mit dem Wechsel vom professionellen Verwalten des Programms IGF zum aktiven Gestalten des Umfeldes der mittelständischen Gemeinschaftsforschung unser Engagement auf ein neues Niveau heben. Um die Wirksamkeit des “Netzwerks der Netzwerke AiF” weiter zu erhöhen, wird es ihre Forschungs- und Transferallianzen zu Themen wie Energiewende, Leichtbau oder Wasserstoff stärken, die Vernetzung ihrer Forschungsvereinigungen untereinander forcieren und das AiF-InnovatorsNet ausbauen.
Verfügt die AiF über genügend Mittel, um diese Pläne anzugehen, etwa für das InnovatorsNet?
Die Arbeit der AiF finanziert sich nicht nur aus Beiträgen der Mitglieder, sondern auch aus Drittmitteln – diese wollen wir steigern. So ist unser InnovatorsNet ein Angebot der 100-prozentigen Tochter der AiF, der AiF FTK GmbH. Sie hat es entwickelt und baut es ständig aus – immer orientiert an den Bedürfnissen der beteiligten Unternehmen, Forschungseinrichtungen und anderen Partnern. mw
Um das forschungspolitische Engagement im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) zu verstärken, hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) einen KI-Aktionsplan erarbeitet. Ministerin Bettina Stark-Watzinger stellte das Vorhaben am Mittwoch bei einem Pressetermin vor. Bislang ist nur die Executive Summary des Plans veröffentlicht. Das gesamte, etwa 20 Seiten umfassende Dokument kündigte sie für September an. Zunächst soll es in der nächsten Woche bei der Klausurtagung des Bundeskabinetts in Meseberg diskutiert werden.
Der Aktionsplan benennt elf Bereiche, in denen laut Bettina Stark-Watzinger dringender Handlungsbedarf besteht. Dazu zählt, die Forschungsbasis weiter zu stärken, die KI-Infrastruktur zielgerichtet auszubauen und eine KI-Kompetenzoffensive zu forcieren. Außerdem sollen europäische und internationale Kooperationen weiter gestärkt werden und – mit Blick auf den AI Act der EU – eine “passfähige, agile und innovationsfreundliche Regulierung” beschlossen werden.
Zu den neuen Impulsen, die das BMBF geben will, gehören die Stärkung der KI-Fachkräftebasis, der Ausbau der Recheninfrastrukturen sowie verbesserte Zugänge zu Daten, etwa für das Forschungsdatengesetz. Weil KI auch in der Verwaltung helfen könne, sei im BMBF noch in diesem Jahr geplant “pilothaft die Nutzung von generativer KI” zu starten.
Stark-Watzinger bezeichnete den KI-Aktionsplan als Update des Beitrags ihres Ministeriums zur KI-Strategie der Bundesregierung, die im November 2018 von der vorigen Regierung beschlossen wurde. Als Ko-Federführer gehe das BMBF zudem in Vorleistung für die Weiterentwicklung der Strategie. Ergänzend zu den 50 laufenden Maßnahmen im Bereich KI, mit denen das Ministerium Forschung, Kompetenzentwicklung, Aufbau von Infrastrukturen und Transfer in die Anwendung fördert, kündigte Stark-Watzinger mindestens 20 neue Initiativen an. Etwa für den Ausbau der Supercomputing-Infrastruktur und für ein Forschungsnetz im Bereich neurobiologisch inspirierter KI. “In dieser Legislaturperiode investieren wir über 1,6 Milliarden Euro in die Umsetzung des Aktionsplans, allein im kommenden Jahr fast 500 Millionen Euro”, sagte Stark-Watzinger. Damit setze man eine klare Priorität im Haushalt.
Woher nimmt das BMBF in Zeiten schrumpfender Budgets das Geld? Die 1,6 Milliarden Euro stelle das BMBF “aus den Mitteln bereit, die entweder im BMBF-Haushalt der Jahre 2022-2023 oder in der Finanzplanung des BMBF gemäß Regierungsentwurf zum Haushalt 2024 etatisiert sind”, erläutert eine Sprecherin auf Anfrage. “Davon sind durch den KI-Aktionsplan nun 600 Millionen Euro zusätzlich aus dem BMBF-Haushalt für KI vorgesehen.”
Der Branchenverband Bitkom reagierte indes skeptisch auf die Ankündigungen aus dem BMBF. “Wir haben bereits 2018 eine KI-Strategie beschlossen und waren damit unter den Vorreitern in Europa und weltweit – aber an der Umsetzung hat es gehapert“, sagt Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder. Das liege auch daran, dass “die Politik zwar auf der einen Seite KI fördert, auf der anderen Seite aber auch behindert”. So müssten insbesondere die in Deutschland sehr restriktiven Regeln für die Verwendung nicht sensibler Daten geändert werden. abg
Die Texte der Table.Media-Serie “Der globale Wettlauf um Künstliche Intelligenz” finden Sie hier.
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft setzt mit Blick auf die zweite Förderphase der Nationalen Dateninfrastruktur (NFDI) auf eine “Konsolidierung” der bestehenden 26 NFDI-Konsortien. Das geht aus einem Eckpunktepapier des DFG-Expertengremiums hervor, das den Auswahl-, Begutachtungs- und Bewertungsprozess für die Förderanträge beschreibt. Konsolidierung sei notwendig, “um auf lange Sicht sowohl den fortlaufenden Betrieb als auch die bedarfsorientierte Weiterentwicklung sicherzustellen und dadurch die Fähigkeit der Konsortien zur Innovation zu erhalten”, teilte die DFG dazu mit.
Zur NFDI gehören 26 Konsortien und der Verbund von Konsortien, Base4NFDI, der als eigenes Konsortium Basisdienste für den gesamten Verein entwickelt. Die Konsortien wurden in einem von der DFG gesteuerten Verfahren ausgewählt. Die Konsortien decken vielfältige Wissenschaftsdisziplinen ab: von Kultur- über Sozial-, Geistes- und Ingenieurwissenschaften bis hin zu Lebens- und Naturwissenschaften. Die NFDI-Konsortien sind in drei Förderrunden an den Start gegangen. Die erste Runde wird seit Oktober 2020 gefördert, die zweite Runde seit Oktober 2021 und die dritte Runde seit März 2023.
Das Eckpunktepapier verweist auf die teils erhebliche Unterschiedlichkeit der Konsortien, nicht nur in Bezug auf adressierte Communitys, Zusammensetzung und Arbeitsschwerpunkte, sondern auch hinsichtlich des jeweiligen Reifegrads der Konsortien und ihrer Zielgruppen im Forschungsdatenmanagement. Bei zukünftigen Anträgen in der zweiten Förderphase sollen die Konsortien zu jedem Antrag und Bericht daher ein Datenblatt einreichen, um den quantitativen Fortschritt und damit den erreichten Stand der Konsolidierung nachvollziehbar zu machen.
Im Gespräch mit Table.Media sagte der Direktor des NFDI, York Sure-Vetter, der NFDI-Prozess sei für alle Neuland “und daher bin ich sehr froh, über die Klarheit zur zweiten Förderphase, die das DFG-Expertengremium nun geschaffen hat.” Die Konsortien der NFDI würden sich als Teile eines langfristig angelegten Infrastrukturprojekts sehen. “Deshalb begrüße ich auch die Anregung der DFG für eine Konsolidierung in dem Sinne, dass die guten Ideen, die von Anfang an da waren, nun konsequent weiterentwickelt werden, dass dabei Anpassungsbedarfe kontinuierlich einfließen können und dass eine langfristige Betriebsperspektive ausgearbeitet wird.”
Zudem sei auch die vorher verabredete Zahl von etwa 30 Konsortien mit den bestehenden 26 und der Basisinitiative nahezu erreicht worden. Die Befürchtung, dass mit einer Konsolidierung eine Reduzierung der Anzahl von Konsortien impliziert werden soll, habe er nicht, sagte Sure-Vetter. “Die Konsortien und die Basisdienstinitiative sind im Plan und werden darüber hinaus von dem DFG-Expertengremium und ab nächstem Jahr auch vom Wissenschaftsrat evaluiert.”
Zwischen den Konsortien gebe es zudem auf mehreren Ebenen einen Austausch und Schnittstellen. “Das ist sicher auch unter dem Begriff Konsolidierung zu verstehen. Genau da, wo bereits zielgerichtete Angebote in Konsortien existieren, die sich für eine Wissenschaftsgemeinschaft bewährt haben, besteht die Chance, dass diese auf andere Wissenschaftsbereiche übertragen werden.” Dadurch könnte man größere Strukturen schaffen, die der gesamten deutschen Wissenschaft zugutekommen werden, sagte Sure-Vetter. tg
Geothermie im industriellen Maßstab soll künftig als erneuerbare Energie zu Deutschlands Klimazielen beitragen. Mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger und Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder machen sich gleich drei Spitzenpolitiker am heutigen Donnerstag auf den Weg ins bayerische Geretsried. Die kanadische Firma Eavor Technologies will dort zeigen, dass sie mit dem sogenannten Eavor-Loop wirtschaftlich Erdwärme nutzen kann.
“Gerade bei der Wärmeversorgung brauchen wir neue Energiequellen, um uns von fossilen Energieträgern lösen zu können”, sagte Forschungsministerin Stark-Watzinger Table.Media. Eine große Chance sei hierbei die Tiefengeothermie. Das Projekt Eavor Loop eröffne zusätzliche technologische Optionen und könne Tiefengeothermie in noch mehr Regionen Deutschlands ermöglichen.
Die in Geretsried eingesetzte Technologie verzichtet im Gegensatz zur hydrothermalen Geothermie darauf, heißes Thermalwasser zu entnehmen. Hier leitet man in ein geschlossenes System Wasser, das sich dann in heißem Gestein erhitzt und wieder an die Oberfläche kommt. Der Eavor-Loop ähnelt damit in der Funktionsweise einem unterirdischen Wärmetauscher.
Dieser Ansatz hat mehrere Vorteile:
Ingo Sass vom Geoforschungszentrum Potsdam begrüßt die Pilotanlage, die mit 91,6 Millionen Euro vom Innovationsfonds der Europäischen Union gefördert wird. Die eingesetzte Technologie sei durchaus interessant und bringe verschiedene Vorteile, wie das entfallende Fündigkeitsrisiko mit Blick auf Thermalwasser. Jedoch sei noch offen, ob eine derartige Anlage am Ende wirtschaftlich betrieben werden kann. Es sei weniger effizient, Wasser in einem Rohr zu erhitzen, als direkt heißes Thermalwasser zu fördern. Die Folge: “Man braucht mit diesem Ansatz mehr Bohrungen – und die kosten Geld.” mw
Nature – Want to speed up scientific progress? First understand how science policy works. Vorschläge, wie sich Wissenschaftler forschungspolitischem Denken annähern können, liefert ein von fünf US-Wissenschaftlern verfasster Kommentar. Sie schlagen zum einen vor, in der Regierung mitzuarbeiten, um zu verstehen, wie Politik funktioniert. Zum anderen sollten Akademiker nach Möglichkeiten suchen, mit Thinktanks zusammenzuarbeiten. Denn die sind erfahren in der Vermittlung zwischen Wissenschaft und Politik. Der dritte Vorschlag ist, sich dafür einzusetzen, dass anwendungsorientierte Forschung auch als wissenschaftlich wertvoll anerkannt wird. Mehr
Spiegel – Wann begann das Leben im Hamsterrad? Der Soziologe Max Weber machte den Protestantismus calvinistischer und puritanischer Prägung dafür verantwortlich, dass Arbeit zum Lebensinhalt wurde. Gegen diese These gab es schon früh Einwände. Weber hatte seine These dagegen geschickt imprägniert. Mehr
Ars Technica – A jargon-free explanation of how AI large language models work. Wie ChatGPT und andere große Sprachmodelle funktionieren, ist nicht leicht zu verstehen. Der Journalist Timothy B. Lee und der Sprachmodell-Forscher Sean Trott erklären, dass Vektoren für Wörter stehen, wie diese in Wort-Vorhersagen umgewandelt werden und wie Sprachmodelle trainiert werden. Mehr
Zeit Online. Kernfusion – Zu utopisch, um wahr zu sein? Die Kernfusion könnte alle Energieprobleme lösen – deshalb brauche sie mehr Förderung, sagt die Physikerin Sabine Hossenfelder im Streitgespräch. Sie hält es für möglich, dass das Feld nun schnell voranschreite. Forschungspolitiker Kai Gehring (Grüne) hingegen warnt vor falschen Versprechen. Die Kernfusion werde für das Ziel der Klimaneutralität bis 2045 keine Rolle mehr spielen. Daher solle sich der Staat besser auf den Ausbau der erneuerbaren Energien konzentrieren. Mehr
Peter Strasser wurde zum Mitglied der Europäischen Wissenschaftsakademie Academia Europaea gewählt, einer paneuropäischen Gesellschaft, die sich der Förderung der Wissenschaft in den Bereichen Geisteswissenschaften, Literatur, Recht und Naturwissenschaften widmet. Strasser leitet an der Technischen Universität Berlin das Fachgebiet Technische Chemie/ Elektrokatalyse – Materialien.
Sean Jones wird stellvertretender Direktor für Wissenschaft und Technologie am Argonne National Laboratory des US-Energieministeriums. Der Materialwissenschaftler ist seit 2020 Leiter der Direktion für mathematische und physikalische Wissenschaften der National Science Foundation der USA.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!
Bildung.Table: Gütesiegel digitale Bildung. Österreich zeichnet regelmäßig Lernapps mit einem Gütesiegel aus. In Deutschland fehlt eine übersichtliche Bewertung nach einheitlichen Qualitätsstandards – allen Versprechungen zum Trotz. Mehr
Bildung.Table: Nordländer prägen Bildungsziele der SPD. Auf der Suche nach einer neuen Bildungspolitik sind SPD-Parteichefin Saskia Esken und ihr wichtigster Landespolitiker, Ties Rabe, vier Tage durch Finnland und Norwegen gereist. Für den Ausbau des Ganztags in Deutschland sahen sie Vorbildliches – bei der Digitalisierung hingegen wachsende Selbstzweifel. Mehr
Agrifood.Table. Agri-PV: Politisch gewünscht, praktisch mit Herausforderungen konfrontiert. Mit dem Solarpaket 1 hat die Bundesregierung die Weichen für den Ausbau von Photovoltaikanlagen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen gestellt. Doch damit der Agri-PV der gewünschte Durchbruch gelingt, muss noch an einigen Stellen geschraubt werden. Mehr
Europe.Table. Kreislaufwirtschaft: EU bringt Aktionsplan voran. Produktdesign, Reparatur, Wiederverwendung – die EU nimmt im aktuellen Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft alle Phasen im Lebenszyklus eines Produkts in den Blick. Für beinahe alle Produkte gibt es in Zukunft strengere Vorgaben. Eine Übersicht über die Gesetzesvorhaben. Mehr
ESG.Table. Chipfabriken: Milliarden-Subventionen ohne Nachhaltigkeitsgarantie? Der Halbleiterindustrie wurden in den vergangenen Monaten in Deutschland Fördermittel in Höhe von 20 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Ein gehöriger Teil davon stammt aus dem Klima- und Transformationsfonds. Ob im Gegenzug konkrete Klima- und Nachhaltigkeitsziele mit den Unternehmen vereinbart wurden, ist fraglich. Mehr
Am Beispiel der Chipfabriken in Magdeburg und Dresden habe ich zuletzt die dramatischen Konsequenzen des Mint-Fachkräftemangels bei Hightech-Standortentscheidungen für Deutschland deutlich gemacht. Doch das ist doch nur die Spitze des Eisberges. Deutschlands Mint-Talentquellen verarmen und wir werden zudem (immer noch) kein Land für qualifizierte Mint-Einwanderung.
Daten des Statistischen Bundesamts zufolge wählten im Studienjahr 2021 rund 307.000 Studierende im ersten Fachsemester ein Mint-Fach. Das waren 6,5 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Zahl der Anfänger in Maschinenbau und Elektrotechnik hat sich in den letzten zehn Jahren bis Studienbeginn 2021/2022 halbiert. Es gibt inzwischen Hochschulen, die 30 bis 40 Prozent weniger Studienanfänger im Mint-Bereich haben.
Gleichzeitig sinkt der Anteil derjenigen, die sich im ersten Fachsemester für Mint-Fächer entscheiden: 2021 lag er bei 37,7 Prozent. Im Jahr 2015 hatte er noch 40,5 Prozent betragen. Das anteilige Stück am Kuchen ist also ebenso geschrumpft wie der Kuchen selbst.
Über die Studienabbruchs- und Wechselquoten von circa 50 Prozent in Mathematik, Informatik, Elektrotechnik, Physik und Chemie habe ich noch gar nicht gesprochen. Darunter die international Studierenden, deren Abbruchquoten zum Teil absolute zehn Prozent höher liegen.
Dies alles hat drastische Konsequenzen für Arbeitsmarkt und Fachkräftelücke. Im Mai 2023 betrug die Mint-Fachkräftelücke laut Mint-Frühjahrsreport 2023 des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) fast 310.000. Das ist nahe am historischen Höchststand und größer als die Lücke der Mint-Facharbeiter und die der Spezialisten, der Meister und Techniker.
Bei einer Betrachtung nach Bundesländern (Quelle: Studie Jobvalley / Universität Maastricht) haben nur die Stadtstaaten Hamburg und Berlin sowie Bayern und Baden-Württemberg einen positiven Migrationssaldo. Alle anderen Bundesländer verlieren Ingenieure. Die ostdeutschen Bundesländer haben einen negativen Migrationssaldo in 2022 von minus 29 Prozent (Sachsen) bis hin zu einer Abnahme von 66 Prozent (Thüringen) und sogar 70 Prozent in Sachsen-Anhalt. Aber auch Niedersachsen (minus 37 Prozent) oder Rheinland-Pfalz (minus 54 Prozent) gehören zu den ganz großen Verlierern.
Vor dem Hintergrund, dass wir neben dem allemal demografisch bedingten Ersatzbedarf zusätzlich Hunderttausende Fachkräfte sowohl für die Energiewende als auch für die digitale Transformation benötigen, ist dies eine Katastrophe.
Noch schlimmer ist, dass das Elend schon sehr früh, bei der Bildung unserer jungen und jüngsten Generation beginnt. Ein Viertel (25,4 Prozent) der getesteten Kinder in Deutschland erreicht nicht den international festgelegten Mindeststandard beim Lesen (Kompetenzstufe III), der zum Lernen, gerade auch dem Mint-Lernen nötig wäre. Nur rund ein Drittel des Leistungsabfalls erklärt sich durch die veränderte Zusammensetzung der Schülerschaft.
“Wichtig ist auch, dass nicht die ausländische Herkunft maßgeblich ist. Der soziale Status – Buchbesitz, Bildungsabschluss und Berufsstatus der Eltern – und die zu Hause gesprochene Sprache erklären die Leistungsunterschiede”, erläutert Nele McElvany, Leiterin der internationalen Studie (vorherige Quelle). Zudem sind die Pisawerte in Mathematik und Naturwissenschaften wieder auf den Wert von 2003 zurückgefallen, also fast wieder auf dem Wert des Pisa Schocks 2000.
Zusammen mit dem damaligen Arbeitgeber-Präsidenten Dieter Hundt habe ich 2008 die eher operative Nationale Initiative Mint Zukunft e.V. (später als gemeinsame BDA/BDI- Initiative) und 2012 mit dem damaligen acatech-Präsidenten Henning Kagermann das policy- und strategiebasierte Nationale Mint Forum gegründet. 2022 hielt ich eine Dinnerspeech zum zehnjährigen Bestehen. Es war eine Brandrede zum Jubiläum.
Das Mint-Desaster war nicht erst absehbar, sondern schon voll im Gange. Ich forderte eine Bündelung der großen und finanzstarken Mint-Organisationen in einem nationalen Kraftakt: mit wenig Egoismus und Eitelkeit. Denn natürlich will in der deutschen privaten Förderszene jede Organisation mit ihren eigenen Spezialitäten strategisch hervorstechen und Reputation erwerben. Doch die Situation ist so schlimm, dass wir uns im Interesse der Sicherung einer umfassenden Mint-Bildung und des Technologiestandorts Deutschland auf ganz bodenständige Basics der Förderung verständigen müssen.
Es geht jetzt nicht mehr um das extravaganteste schulische Hightech Multimedia-Labor der XY-Stiftung, nicht mehr um abgehobene Mint-Diversity-Konferenzen in der Berliner Blase. Es geht jetzt nicht mehr um die Girls Days, deren Impact nie jemand richtig evaluiert hat, auch nicht um das nächste Policy Paper, das gebetsmühlenartig den alten, breitgetretenen Käse nach weiblichen Mint-Rollenvorbildern proklamiert. Die Ressourcen und gerade auch die finanziellen Ressourcen gehören gebündelt. Eine Milliarde von privaten Geldgebern mit Matching von zwei zusätzlichen Lindner-Milliarden – das wäre ein Wort!
Dafür bräuchte es eine klare gemeinsame Idee der privaten Geldgeber, einen Plan, der sowohl Qualitätssicherung als auch einen zügigen Mittelabfluss garantiert.
Innovating Innovation: Wer nicht erfolglos weiter so wie bisher wursteln will und damit nur “Mehr des Gleichen” macht, dem gebe ich folgende vier innovative Stellhebel mit auf den Weg:
