dass in Deutschland mehr passieren muss, um Gründungen in und aus der Wissenschaft anzuschieben, ist unbestritten. Es braucht mehr Engagement der Hochschulen und der Wirtschaft, auch das ist lange bekannt. Doch dass sich auch im Bereich der Ausbildung der Studierenden einiges ändern muss, damit es künftig mehr Tech-Unternehmer gibt, diesen Hinweis hört man nicht so oft.
“Deutschland ist im Bereich Entrepreneurial Education maximal durchschnittlich“, sagt Heike Hölzner, Professorin für Entrepreneurship und Mittelstandsmanagement an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. “Wir müssen weg vom Vorlesungsmodell, hin zu einem Projektstudium.” Was sie genau meint und welches die wichtigsten Bedingungen für ein Gelingen sind, berichtet unser Autor Ralf Nestler.
Die National Science Foundation (NSF) gibt in den kommenden fünf Jahren 67 Millionen US-Dollar für den Aufbau eines nationalen Zentrums für Sicherheit in der Forschung aus – das Secure-Center. Der wissenschaftliche Leiter Mark Haselkorn von der University of Washington in Seattle beschreibt im Gespräch, welche Aufgaben das neue Zentrum erfüllen wird. Wie sich die neue Institution auf die Forschungsbeziehungen mit internationalen Partnern – unter anderem Deutschland – auswirkt, hat unser Kollege Richard L. Hudson ihn gefragt.
Immerhin eine Sommerlektüre gibt es von Bettina Stark-Watzinger. Sie hat den Forschungsorganisationen ein Diskussionspapier gesandt. Technologieoffenheit wird darin als Lösung diverser Probleme präsentiert. Meine Kollegin Anne Brüning hat es für Sie zusammengefasst.
Kommen Sie gut in den Tag,

An Hochschulen und Forschungseinrichtungen entstehen viele Ideen, die zu marktfähigen Produkten werden können. Doch oft scheuen Forscherinnen und Forscher vor einer Gründung zurück. Politik und Wirtschaft versuchen das zu ändern, beispielsweise mit dem “Leuchtturmwettbewerb Start-up Factories”. Damit fördert das BMWK den Aufbau von hochschulnahen, privatrechtlich organisierten und unternehmerisch geführten Gründerzentren.
Das Potenzial ist jedoch längst nicht ausgeschöpft. Es beginnt mit der Ausbildung, in der die Grundlagen des Unternehmertums nicht adäquat vermittelt werden. Außerdem mangelt es teils am Engagement der Hochschulen. Und auch die Verbindungen zur Wirtschaft könnten besser sein.
Die Zurückhaltung sei keine Frage der Mentalität, sagt Helmut Schönenberger, Vizepräsident für Entrepreneurship der TU München und Geschäftsführer des Gründer- und Innovationszentrums UnternehmerTUM GmbH. “Wenn es genügend Menschen gibt, die sich dieser Mission stellen, funktioniert es auch.” Er meint Gründer ebenso wie Fachleute in der Akademia, in Behörden und der Wirtschaft. “Wenn jedes Bundesland so etwas wie UnternehmerTUM hätte, wäre Deutschland gründungsintensiver als Amerika.”
UnternehmerTUM gilt weithin als Vorbild. Das Zentrum verbindet “die universitäre Welt mit der Wirtschaftswelt”, unterstützt Gründende und Start-ups in allen Phasen – von ersten Beratungen bis zum Wachstum. Pro Jahr werden rund 50 Unternehmen ausgegründet, die ihrerseits rund zwei Milliarden Euro Risikokapital anziehen. Schönenberger: “Das ist das Doppelte des Budgets unserer Universität.”
Für den Erfolg brauche es Hochschulen, die sich neben Forschung und Lehre auch in der dritten Mission engagieren: Gründung und Innovation. Schönenberger hält es für erforderlich, dass Hochschulen “wenigstens ein Prozent ihrer Ressourcen dafür hergeben, um einigermaßen mitspielen zu können”. Eine Uni wie die TUM mit 10.000 Mitarbeitern und 50.000 Studierenden käme also auf 100 Mitarbeiter für die dritte Mission. Bei UnternehmerTUM seien es inzwischen 500 Personen, also fünf Prozent. “Das ist ein Wert, mit dem wir weltweit ganz vorne mitspielen, mit Stanford, der Tsinghua University in China oder der National University of Singapore.” Er bemisst das an der Anzahl wachstumsstarker Unternehmen, die diese Standorte hervorbringen.
Neben den Unis ist eine starke Wirtschaft in der Region vonnöten. UnternehmerTUM in München wird unter anderem von der BMW-Erbin Susanne Klatten unterstützt. Dass nicht jeder Hochschulstandort über eine derart engagierte und finanzkräftige Wirtschaft verfügt wie die bayerische Metropole, sieht auch Schönenberger. Er glaubt dennoch, dass das Konzept an vielen weiteren Orten funktionieren würde.
Belege gibt es etliche, darunter die Life Science Factory in Göttingen. Sie “zeigt beispielhaft, wie es uns gelingen kann, in ganz Deutschland innovative Leuchttürme der Vernetzung von Wirtschaft, Wissenschaft und Start-ups zu bauen”, lobte Wirtschaftsminister Robert Habeck bei einem Besuch im April. Seit zwei Jahren stehen 3.200 Quadratmeter Labor- und Arbeitsflächen für Start-ups der Bio- und Medizintechnologie bereit.
Bisher sind alle Gründer vorangekommen, keiner musste aufgeben, sagt Irina Reimer, Venture Director der Life Science Factory. Bau und Ausstattung habe das Land Niedersachsen bezahlt. Der Betrieb werde über Mieten finanziert, den Rest übernehme der Laborzulieferer Sartorius AG. Dessen CEO Joachim Kreuzburg, maßgeblicher Treiber der Factory, will “den Standort attraktiver machen und Fachkräfte hier halten”. Und neue hinzugewinnen, denn nur eine Hälfte der Start-ups kommt aus Göttingen, der Rest aus dem übrigen Bundesgebiet.
Die Factory gehört zum Sartorius-Quartier und entstand nach US-Vorbild. Unter dem Motto “Bilden – Gründen – Wohnen” ist dort alles versammelt, was Forscher der Lebenswissenschaften benötigen: ein Gesundheitscampus der örtlichen Hochschulen, Hotel, Smart Apartments, eine Kindertagesstätte sowie Miet- und Eigentumswohnungen.
Die Life Science Factory baut derzeit in München einen zweiten Standort auf. Am Helmholtz Pioneer Campus, der Biomedizin, Ingenieurwissenschaften und Digitalisierung zusammenbringt, bieten die Göttinger ihren Service aus Mietlaboren, Beratung und Networking für Start-ups an. “München verfügt über ein sehr gutes Ökosystem für Gründer”, sagt Reimer. “Mit dem Helmholtz-Zentrum München haben wir zudem einen starken Partner für unser Programm.”
Die beste Idee indes nützt wenig, wenn den Tech-Gründern unternehmerische Grundlagen fehlen. “Deutschland ist im Bereich Entrepreneurial Education maximal durchschnittlich”, sagt Heike Hölzner, Professorin für Entrepreneurship und Mittelstandsmanagement an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. Sie beruft sich dabei auf den Global Entrepreneurship Monitor.
Noch dazu habe eine Studie kürzlich gezeigt, dass Studierende seltener gründen wollen, wenn sie zuvor Entrepreneurship-Lehrveranstaltungen besucht haben. “Das ist bitter und wird vor allem so erklärt, dass die Studierenden dann gelernt haben, was alles auf sie zukommen wird. Herausforderungen, die sie vorher nicht kannten und die abschrecken.”
Es brauche andere Lehrformate, sagt Hölzner. “Wir müssen weg vom Vorlesungsmodell, hin zu einem Projektstudium.” Lehrende seien in diesem Umfeld nicht mehr die Allwissenden. Stattdessen seien sie als Mentoren, Coaches und Lernbegleiter gefragt. Und: “Lerngruppen müssen kleiner werden und sollten unbedingt interdisziplinär sein.” Sonst entstünden keine echten Durchbrüche.
Was Hochschulen und Forschungseinrichtungen Hölzners Ansicht nach tun sollten, um die Gründungskompetenz zu stärken:
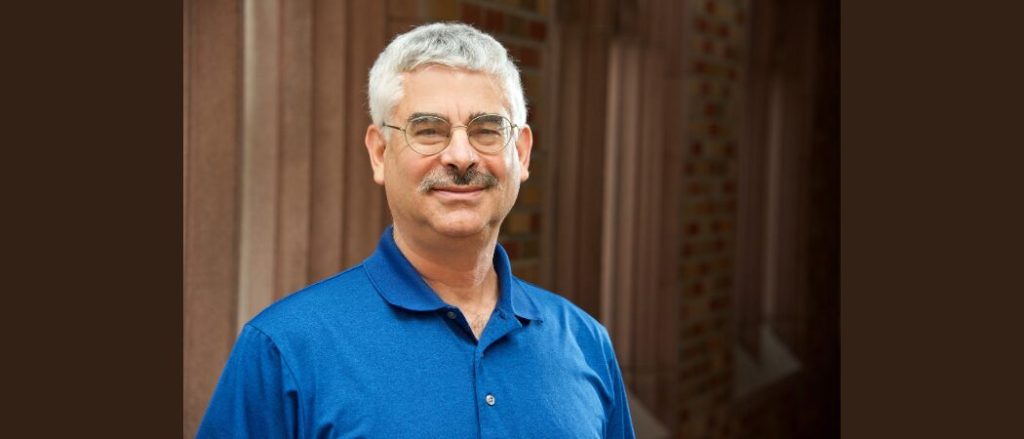
Ende Juli hatte die US-amerikanische National Science Foundation (NSF) angekündigt, Fördergelder in Höhe von 67 Millionen US-Dollar für die Einrichtung eines Zentrums für Forschungssicherheit auszugeben. Man setzt in den Vereinigten Staaten auf die Zusammenarbeit zwischen Forschenden, Regierung und Verwaltung und zeigt sich offen für die Zusammenarbeit mit Partnerländern. “Wir werden erarbeiten, was die Gemeinschaft will und braucht, um die Sicherheit in ihren Einrichtungen zu verbessern”, sagt Mark Haselkorn, Professor an der University of Washington und wissenschaftlicher Leiter des neuen Secure-Centers.
Anstatt einfach nur Sicherheitsmaßnahmen vorzuschreiben, erklärt Haselkorn, werde die Botschaft des neuen, von der National Science Foundation (NSF) unterstützten Secure-Zentrums an die Forscher lauten: “Lasst uns die Probleme definieren, lasst uns die Lösungen entwerfen, und gemeinsam werden wir sie in die Tat umsetzen. Das ist ein radikal anderer Ansatz.” Das Zentrum werde auch dafür sorgen, dass die Sicherheit nicht auf Kosten der internationalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit gehe.
Jetzt, da die Niederlande, Großbritannien, Kanada, Deutschland und andere Länder eigene akademische Sicherheitszentren einrichten, müssen wir bei Secure internationale Akteure in diese Bemühungen einbeziehen, sagt er. Ob Haselkorn und seine Kollegen eine Zusammenarbeit auf breiter Front in der normalerweise protektiv-verschlossenen Welt der Sicherheit verwirklichen können, ist die Frage, die es zu beantworten gilt.
Der Fünfjahresvertrag zur Förderung des Secure-Centers beginnt offiziell am 1. September, mit einem Startkapital von rund zehn Millionen US-Dollar. Die erste Aufgabe bestehe laut Haselkorn darin, die Verwaltungsstrukturen aufzubauen und Personal einzustellen. Er rechnet mit einer Stammbelegschaft von etwa 50 Mitarbeitern, zu denen viele weitere Beteiligte aus verschiedenen Beratungs-, Planungs- und Expertenausschüssen dazuzurechnen sind. Bis September 2025 sollen die ersten Online-Dienste betriebsbereit und nutzbar sein.
Haselkorns akademische Spezialisierung ist die Entwicklung virtueller Umgebungen, die es großen, komplexen Gruppen ermöglicht, effektiv zusammenzuarbeiten – wie aktuell etwa bei einem Projekt zur Verbesserung der Koordination zwischen verschiedenen US-amerikanischen Transportbehörden und -unternehmen. Seine Co-Leitung ist Sonia Savelli, eine Spezialistin für Design und Kognitionswissenschaft, die ebenfalls an der University of Washington in Seattle arbeitet.
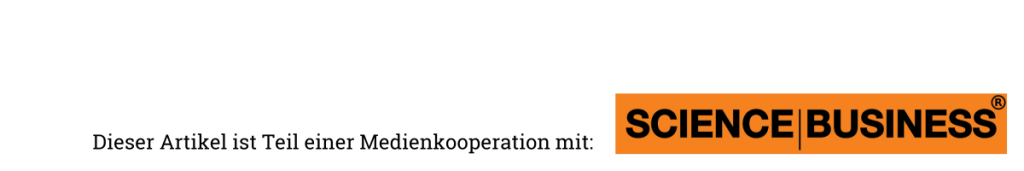
Das Begleitprojekt Secure Analytics wird von Kevin Gamache von Texas A&M und Glenn Tiffert von der Hoover Institution in Stanford geleitet. Laut Haselkorn ist ein klares Ziel des Projekts, dass die NSF die Forschungsgemeinschaft in die Lage versetzen will, eigene Sicherheitslösungen zu entwickeln. “Es gibt uns die Verantwortung für das Problem”, sagt er. Und jede Menge Arbeit: “Uns ist schon vor dem Start am 1. September schwindelig von all dem, was es zu erledigen gibt.”
Im Rahmen eines NSF-Finanzierungsabkommens über 50 Millionen Dollar und fünf Jahre organisieren Haselkorn und seine Co-Direktorin Lynette Arias von der University of Washington ein nationales Projekt zur Information, Schulung und Beratung der US-Forschungsgemeinschaft in Sicherheitsfragen.
Fünf regionale Zentren in Boston, Seattle, San Antonio (und College Station) sowie Columbia sollen innerhalb von drei Monaten nach Projektbeginn startbereit sein. Sie werden an der Entwicklung eines Online-Systems beziehungsweise einer “virtuellen Umgebung” arbeiten, in der Sicherheitsinformationen, Tools, Schulungsmodule und Warnmeldungen aktuell bereitgestellt werden. Ziel ist es, Hochschuleinrichtungen, gemeinnützige Forschungsorganisationen und kleine bis mittelgroße Unternehmen bei ihren Bemühungen zu unterstützen, die sich ständig erweiternden Regierungsrichtlinien zur Sicherheit in der Forschung einzuhalten.
Die restlichen 17 Millionen Dollar, werden an der zweitgrößten Universität des Landes, der Texas A&M (Agricultural and Mechanical) University, für ein Projekt zur Sicherheits- und Datenanalyse eingesetzt.
In der Ausschreibung zum Secure Center skizzierte die NSF im letzten Jahr dessen Funktion als “Clearingstelle für Informationen”. Sie soll Forschungsorganisationen und -institute unterstützen, die versuchen, “unzulässige oder illegale Bemühungen ausländischer Einrichtungen” zu erkennen, die darauf abzielen, “Forschungsergebnisse oder -erkenntnisse zu erlangen”. Das Zentrum für Forschungssicherheit soll Tools und Best Practices zur Risikobewertung entwickeln, außerdem Informationen und Berichte über Sicherheitsbedrohungen zur Verfügung stellen und Sicherheitsschulungen und Unterstützung für Forschende anbieten. Schließlich soll das Center auch dabei helfen, Daten und Analysen über, wie es im Original heißt: “bad actors” zu sammeln.
Was genau das alles bedeutet, soll in den kommenden Monaten mit den Secure-Partnern und der breiteren US-Forschungsgemeinschaft ausgearbeitet werden. Haselkorn nennt mögliche Beispiele:
Viele Forscher, vor allem in Europa, sind der Meinung, dass zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen in den USA der wissenschaftlichen Zusammenarbeit schaden werden. Mark Haselkorn sagt, das Zentrum werde sich bemühen, dies zu vermeiden. Zunächst wolle er mit den für die Forschungssicherheit zuständigen Stellen in den verbündeten Ländern sprechen. Es gebe bereits Regierungsbemühungen unter den führenden Volkswirtschaften der G7 und ihren Förderorganisationen hinsichtlich der Koordination und des Austauschs von Sicherheitsinformationen.
Ein Risiko für internationale Kooperationen sei überbordende Bürokratie. Wenn Forschende sicherheitsrelevante Informationen einmal für alle Länder und Forschungsförderer zur Verfügung stellen müssten, sei der Arbeitsaufwand beherrschbar. Wenn derartige Arbeitsschritte jedoch immer wieder und in verschiedenen Formaten wiederholt werden müssten, sei die Gefahr hoch, dass “die Leute es sein lassen, weil sie das Gefühl haben, dass es sich nicht lohnt.” Man müsste vom Start weg optimale Prozesse und Tools aufsetzen. Richard L. Hudson
12./13. September 2024, FU Berlin
Jahrestagung des Netzwerks Wissenschaftsmanagement Für Freiheit in Krisenzeiten. Perspektiven aus dem Wissenschaftsmanagement Mehr
19. September 2024, ab 11 Uhr, Körber-Stiftung, Hamburg
Hamburg Science Summit 2024 “Europe’s Path Towards Tech Sovereignty” Mehr
24. September 2024, 10:30 bis 16:15 Uhr, Haus der Commerzbank, Pariser Platz 1, 10117 Berlin
Forum Hochschulräte Starke Marken, klarer Kern: Strategische Schwerpunktsetzung und Markenbildung bei Hochschulen Mehr
25. September 2024, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU)
Jahreskolloquium des Bayerischen Wissenschaftsforums Transformationskompetenz in Wissenschaft und Hochschule Mehr
26. September 2024, 12:00 bis 13:00 Uhr, Webinar
CHE talk feat. DAAD KIWi Connect Transfer und Internationalisierung – Warum ist es sinnvoll, beides gemeinsam zu denken und was braucht es hierzu? Mehr
26./27. September 2024, Leopoldina, Jägerberg 1, 06108 Halle (Saale) und Online
Jahresversammlung 2024 der Leopoldina Ursprung und Beginn des Lebens Mehr
3. /4. Oktober 2024, Universität Helsinki, Finnland
2024 EUA FUNDING FORUM Sense & sustainability: future paths for university finances Mehr
8. /9. Oktober 2024 an der TU Berlin
bundesweite Tagung zu Machtmissbrauch an Hochschulen “Our UNIverse: Empowered to speak up” Mehr
10. Oktober 2024 an der TUM School of Management, München
Konferenz AI@WORK – How AI is changing leadership, work and collaboration Mehr
23. bis 25. Oktober 2024 am ETH AI Center in Zürich, Schweiz
Jahrestagung der Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft (GMW) und CampusSource Agilität und KI in Hochschulen Mehr
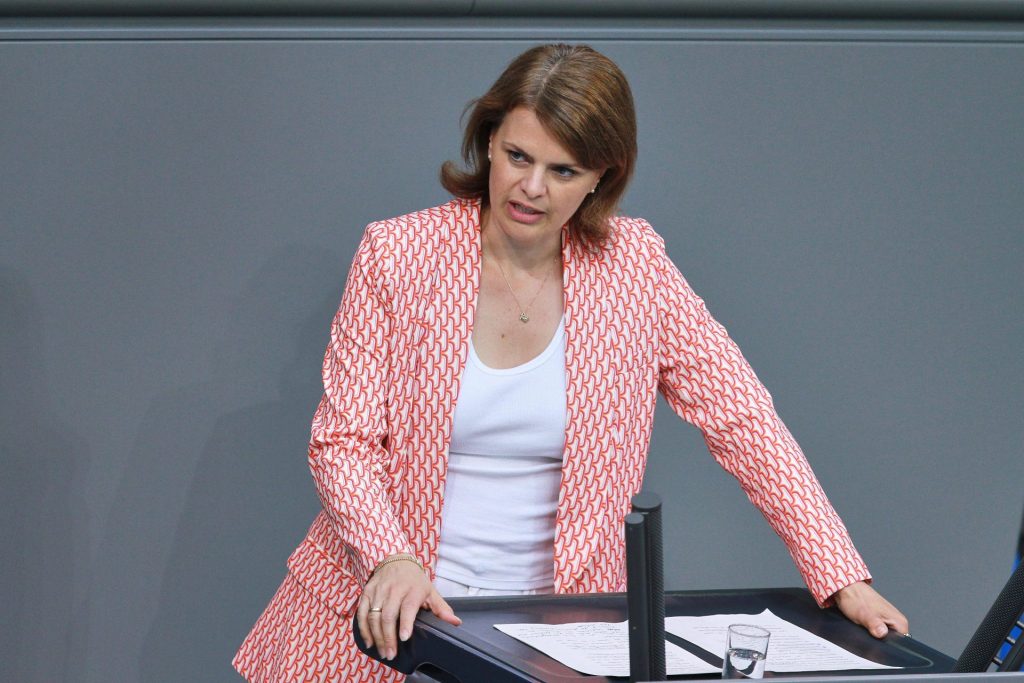
Die forschungspolitische Sprecherin der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Katrin Staffler, kritisiert eine mögliche Mittelkürzung um 5 Millionen Euro für die Wissenschaftskommunikation im geplanten Bundeshaushalt 2025. “Es ist sehr enttäuschend, dass das BMBF keine Anstalten macht, die berechtigten Sorgen aus der Community zu zerstreuen”, sagt Staffler. “Wir wissen weiterhin nur, dass um fünf Millionen Euro gekürzt werden wird, aber es ist immer noch nicht vollständig klar, welche Projekte es im entsprechenden Titel genau sind.”
Auf die Anfrage Stafflers an das BMBF, wo denn im Bereich Wissenschaftskommunikation im Jahr 2025 gekürzt werden wird, hat das BMBF am 26. Juli geantwortet, dass die geplante Absenkung im Haushaltstitel 3003 / 541 01 “Wissenschaftskommunikation, Partizipation, Soziale Innovationen” gegenüber dem Jahr 2024 nur zu einem Teil Maßnahmen der Wissenschaftskommunikation betreffe.
Im Vergleich zur Vorgängerregierung habe der Haushaltstitel weiterhin einen deutlichen Aufwuchs erfahren. Der Titelansatz lag im Jahr 2021 bei 20 Millionen Euro, für das Jahr 2025 sei ein Titelansatz von 23,75 Millionen Euro vorgesehen, antwortet der Parlamentarische Staatssekretär Jens Brandenburg für das BMBF.
Nach aktuellem Planungsstand könne die interaktive Diskussionsreihe mit zehn Veranstaltungen “Wissenschaft kontrovers”, betrieben durch “Wissenschaft im Dialog” (Fördervolumen im Jahr 2024: 127.855,88 Euro) nicht weiter betrieben werden. Zentrale Veranstaltungen der Wissenschaftsjahre wie die Auftakt- und Abschlussveranstaltungen würden auch im Jahr 2025 umgesetzt, ebenso die geplante Abschluss-Convention des Strategieprozesses #FactoryWisskomm im April 2025.
Die genannte Kürzung der Veranstaltungsreihe “Wissenschaft kontrovers” sei wohl kaum allein für die Gesamtkürzungssumme von fünf Millionen EUR verantwortlich, kritisiert Staffler. Die schwammige Antwort des BMBF auf ihre konkrete Frage zeige, dass das BMBF offenbar nicht in der Lage sei, zu priorisieren. Dies “zwingt die Betroffenen damit in eine vollkommen unnötige Planungsunsicherheit“. Am Ende führe dies nur dazu, dass sich das BMBF weiter von der Wissenschafts-Community entferne.
Auf Anfrage von Table.Briefings zu den Kürzungen im Bereich der Wisskomm erklärte das BMBF bereits am 16. Juli, dass Wissenschaftskommunikation eine Querschnittsaufgabe sei, “die nicht allein durch den Titel für Wissenschaftskommunikation abgebildet ist”. Die Forderungen aus dem Koalitionsantrag bei aktuellen Förderentscheidungen würden zudem besonders berücksichtigt. tg
Bettina Stark-Watzinger möchte offenbar eine “Offensive für Technologieoffenheit” anregen. Wie die FAS am Wochenende berichtete, hat das BMBF ein “Impulspapier mit Vorschlägen zur Stärkung der Innovationskräfte, des Wachstumspotentials und der Wissenschaftsfreiheit” an die führenden Forschungsinstitutionen im Land verschickt.
Das sieben Seiten umfassende Papier, das auch Table.Briefings vorliegt, preist Technologieoffenheit als Weg zu mehr Wohlstand, zur Stärkung der Wissenschaftsfreiheit sowie der strategischen Unabhängigkeit. Darüber hinaus enthält es einige konkrete Vorschläge. Sie seien als “erster Impuls” zu verstehen und könnten “im Zuge des angestrebten Diskussionsprozesses weiterentwickelt und ergänzt werden”. Die wichtigsten Vorschläge:
Darüber hinaus finden sich in dem Papier bekannte FDP-Themen. So preist es synthetische Kraftstoffe als “unverzichtbaren Beitrag zu bezahlbarer individueller Mobilität und zur Dekarbonisierung des Verkehrs” an, fordert eine bürokratiearme Umsetzung des AI Acts und den Abbau von Berichtspflichten für Unternehmen.
Die adressierten Forschungsorganisationen haben sich zu dem BMBF-Vorstoß noch nicht positioniert. “Wir begrüßen die Absicht des BMBF, eine punktuelle Reform der Rahmenbedingungen des deutschen Innovationsökosystems in Angriff zu nehmen, und sehen dies als große Chance für den Forschungsstandort Deutschland”, teilte die Helmholtz-Gemeinschaft auf Anfrage von Table.Briefings mit. Man bringe sich als aktiver Gesprächspartner in diese Debatte ein. “Da der Konsultationsprozess zwischen dem BMBF und der Allianz der Wissenschaftsorganisationen aktuell läuft, können wir uns inhaltlich zu einzelnen Punkten noch nicht äußern.” Gerne nehme man zu einem späteren Zeitpunkt Stellung. abg
Die Mehrzahl der Mitgliedstaaten im Rat sieht es kritisch, dass die ungarische EU-Ratspräsidentschaft die Gespräche zur Deregulierung neuer Gentechniken (NGT) in weiten Teilen neu aufrollen will. Das geht aus internen Dokumenten hervor, die Table.Briefings vorliegen. Demnach stellten sich bei einem kürzlichen Treffen auf Arbeitsebene 15 Länder gegen dieses Vorgehen, darunter Frankreich, Spanien, Italien und Tschechien. Sie finden: Aspekte, zu denen schon mehrheitsfähige Lösungen gefunden wurden, sollten nicht noch einmal neu diskutiert werden. Fortschritte würden sonst verschenkt. Ähnlich sieht es die Europäische Kommission. Sie fürchtet, durch Verzögerungen bei dem Dossier könnte die EU ins Hintertreffen geraten, während immer mehr Drittstaaten NGT zulassen.
Ungarn hält dagegen, dass die Gespräche im Rat in eine Sackgasse geraten seien. Nur noch die Patentierbarkeit gentechnisch veränderter Pflanzen als offene Frage zu diskutieren, wie es die Belgier zuletzt getan hatten, führe nicht weiter. Österreich, Bulgarien, Kroatien, Rumänien, die Slowakei und Slowenien teilen diese Sichtweise. An der Patentfrage, die weiter ungelöst bleibt, will Budapest erst einmal gar nicht weiterarbeiten. Die Ratsarbeitsgruppe zu genetischen Ressourcen, die derzeit die Gespräche führt, sei hierfür nicht das richtige Forum.
Die Zurückstellung der Patentfrage und die gespaltenen Mehrheitsverhältnisse im Rat deuten darauf hin, dass eine Einigung unter der ungarischen Ratspräsidentschaft unwahrscheinlich ist. Diese hatte sich das für ihre sechsmonatige Amtszeit auch nicht explizit vorgenommen. Derweil kann sich die Bundesregierung weiter kaum in die Gespräche einbringen, weil die Ampel zum Thema gespalten bleibt. jd

Seit verschiedene empirische Studien einen Gender Pay Gap auch für Professorinnen und Professoren an deutschen Hochschulen nachweisen, der zudem in den letzten Jahren nahezu stabil geblieben ist, sorgt das Thema zurecht für erhebliche Unruhe im Wissenschaftssystem. So kommt der 2022 veröffentlichte Gender Report aus NRW zu dem Schluss, dass in Vollzeit tätige Professorinnen im Durchschnitt circa 514 Euro brutto pro Monat weniger als ihre männlichen Kollegen verdienen. Wobei der Unterschied dann noch größer wird, wenn allein die W3 Besoldung betrachtet wird.
Auch wenn dieser Durchschnittswert um statistisch nachvollziehbare Faktoren bereinigt wird, wie Berufserfahrung und Qualifikation, berufliche Position, Disziplin und andere mögliche Einflussfaktoren, bleibt unter dem Strich ein über die Statistik nicht nachvollziehbarer und nicht erklärbarer Verdienstunterschied von circa 261 Euro brutto pro Monat. Die Differenz, die dieser sogenannte bereinigte Gender Pay Gap zutage fördert, ist demnach allein der Zugehörigkeit zu einem Geschlecht geschuldet.
Darüber, dass diese Einkommensschere unter einer Gerechtigkeitsperspektive keinesfalls tolerierbar ist, sind sich die Verantwortlichen in Politik und Hochschulleitungen weitgehend einig. So haben 41 Hochschulen des Landes NRW 2022 eine gemeinsame Erklärung zum Abbau des Gender Pay Gap bei Professorinnen unterzeichnet. Aber, ob überhaupt und wenn ja, welche weiterführende Maßnahmen von Hochschulen zu ergreifen sind, um dieser Ungleichheit entgegenzuwirken, darüber gibt es dann doch, teilweise sehr heftige Debatten.
Eine genauere Betrachtung dazu, wie der Einkommensunterschied zustande kommt, kann Aufschluss darüber geben, ob und welche Maßnahmen zum Abbau dieser Diskriminierung von Wissenschaftlerinnen beitragen können.
Die leistungsbezogenen Gehaltsbestandteile, die bei Berufungen gewährt werden, sind zentrale Stellschraube beim Abbau des Gender Pay Gap, wie die Studien zum Gender Pay Gap in NRW, Niedersachsen oder Hamburg zeigen. Diese Leistungsbezüge, die zusätzlich zu den gesetzlich festgelegten Grundgehältern gewährt werden, werden individuell zwischen den Hochschulleitungen und den Neuberufenen ausgehandelt.
Immer wieder werden als Begründung für geschlechterdifferente Ergebnisse dieser Berufungsverhandlungen nicht nur von Hochschulleitungen, das mangelnde Geschick und das fehlende Durchsetzungsvermögen von Wissenschaftlerinnen angeführt. So würden Wissenschaftlerinnen “schlechter” im Sinne von weniger “hartnäckig”, weniger “informiert” und in der Folge weniger “erfolgreich” verhandeln als ihre Kollegen. Bereits diese Aussagen sind ein Indiz dafür, dass es geschlechterbezogene Unterschiede in den Verhandlungen gibt.
Nicht selten ist dann der Umkehrschluss, dass die Abschaffung solcher Differenzen vor allem in der Verantwortung der Wissenschaftlerinnen liegt und sie sich auf die Berufungsverhandlungen intensiver vorbereiten müssen. Weiterführende Maßnahmen von Seiten der Hochschulen, so wird weiter argumentiert, könnten eher kontraproduktiv sein, weil auch Wissenschaftlerinnen lernen müssten, sich gegen Widerstände durchzusetzen.
Kaum berücksichtigt wird in diesen Argumentationsfiguren, dass Hochschulleitungen mehr oder weniger unbewusst dazu neigen, für Wissenschaftler ein höheres Gehalt als gerecht anzusehen als für Wissenschaftlerinnen – und dies bei den gleichen berufsrelevanten Qualifikationen und Erfahrungen. Was als relevante Leistung anerkannt wird, ist gerade in solchen individuellen Berufungsverhandlungen breit interpretierbar und aus anderen Studien ist ebenfalls bekannt, dass, selbst wenn Wissenschaftlerinnen dasselbe leisten wie ihre Kollegen, es ihnen nicht gleichermaßen zuerkannt wird.
Darüber hinaus entscheiden auch leistungsunabhängige Faktoren über das Gehalt: Beispielsweise fallen die Gehälter in den männlich dominierten Fächern durchschnittlich höher aus – unabhängig von der individuellen Leistung. Gänzlich unberücksichtigt bleibt die Leistung, Beruf und Familie in einem so wenig familienfreundlichen System wie der Wissenschaft erfolgreich vereinbart zu haben, was eigentlich nahelegen würde, dass Professorinnen mit Kindern einen Leistungszuschlag erhalten. All diese geschlechterbezogenen Verzerrungen sind nach wie vor tief in Berufungsverfahren verankert und müssen ganz gezielt und sehr bewusst etwa durch die Schaffung entsprechender Reflexion und Transparenz durchbrochen werden.
Ein Grundsatzurteil des Bundesarbeitsgerichts in Erfurt zur Lohngleichheit von 2023 zwischen den Geschlechtern lässt aufhorchen, da es gerade auf solche Verhandlungssituationen zutrifft, wie sie typischerweise bei Berufungen vorliegen. Dieses Urteil besagt, dass auch dann, wenn Bewerber durch ‘Verhandlungsgeschick’ höhere Gehaltsforderungen durchsetzen, eine Bewerberin bei ihrem neuen Job nicht schlechter bezahlt werden dürfe. Eine ungleiche Bezahlung weise sonst auf eine geschlechtsbasierte Diskriminierung hin, die gesetzlich untersagt ist.
Liegt in diesem Urteil nicht auch eine deutliche Aufforderung an das Wissenschaftssystem zu reagieren und etwa die Aushandlungssituation in Berufungsverhandlungen zur Gewährung von Leistungsbezügen eingehend zu überprüfen, um sie diskriminierungsfrei zu gestalten und zu halten?
Der Gender Pay Gap kann, darüber besteht für mich kein Zweifel, lediglich durch ein Bündel von abgestimmten Maßnahmen allmählich geschlossen werden. Die Entwicklung und die Durchführung dieser Maßnahmen setzt nun aber nicht nur den Willen und der Bereitschaft der Hochschulleitungen voraus, sondern benötigt zudem einen breiten Konsens der Beschäftigten in den Hochschulen darüber, dass es diesen Diskriminierungstatbestand gibt und dass er durch entsprechende Maßnahmen abgebaut werden muss.
Von Seiten der Hochschulleitungen gilt es zunächst einmal schlicht anzuerkennen, dass auch Berufungsverhandlungen mehr oder weniger bewusst durch einen Gender Bias beeinflusst werden. Davon kann sich niemand freisprechen. Wir wissen aus verschiedenen Studien aber zugleich, dass dieser Diskriminierungseffekt geringer wird, wenn Rektorinnen beziehungsweise Präsidentinnen diese Berufungsverhandlungen führen, was wiederum ein Plädoyer dafür ist, den Anteil an weiblichen Hochschulleitungen zu erhöhen.
Leticia Carvalho aus Brasilien wird neue Generalsekretärin der Internationalen Meeresbodenbehörde. Die Staatenversammlung wählte sie zur Nachfolgerin von Michael Lodge (GBR), der die Behörde seit 2016 geführt hat. Carvalho wird ihr Amt zu Beginn des kommenden Jahres antreten. Ihre Aufgabe wird es sein, die Verhandlungen der 170 Vertragsparteien, insbesondere zur Schaffung eines Rechtsrahmens für möglichen zukünftigen Tiefseebergbau, zu unterstützen.
Eveline Dürr, Ethnologin, sowie die Leukämiespezialistin Irmela Jeremias werden von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) im Rahmen des Reinhart-Koselleck-Programms gefördert. Die beiden Forscherinnen der Ludwig-Maximilians-Universität München bekommen für ihre Projekte jeweils 1,25 Millionen Euro. Dürrs Forschung widmet sich unter anderem Mensch-Umweltbeziehungen, ethnologischer Stadtforschung und der Frage kultureller Identitäten. Jeremias sucht neue Angriffsziele zur Bekämpfung von aggressiven Leukämien.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an research@table.media!
Europe.Table. AI Act: Warum Unternehmen ungeduldig auf Normen für KI warten. Der AI Act stellt eine europäische Harmonisierungsregelung für die Produktkonformität dar. Er folgt damit der Formel des New Legislative Framework. Das bedeutet, dass jetzt neben dem Gesetz noch Normen für KI nötig sind. Mehr
Bildung.Table. Frauen in MINT-Berufen: Wie sich ihr Anteil erhöhen lässt. Die MINT-Branche leidet nicht nur unter Fachkräftemangel, auch der Anteil an Frauen ist weiterhin niedrig. Das muss sich dringend ändern, fordert Marie Pötter, Geschäftsführerin eines IT-Unternehmens. Sie setzt auf Mentorenprogramme und mehr Praxiseinblicke schon in der Schulzeit. Mehr
Africa.Table. Fachkräftemangel: Warum Deutschland so wenig Arbeitskräfte aus Afrika will. Nur wenige Fachkräfte aus Afrika wollen nach Deutschland kommen. Die Ursache liegt in der deutschen Entwicklungspolitik. Auch sich hartnäckig haltende Vorurteile spielen eine Rolle. Mehr
Climate.Table. SBTI: Deshalb sind Carbon Credits ein Risiko für die Transformation. Im Streit um die Zulassung von CO₂-Kompensationen für Unternehmen legt die “Science Based Targets Initiative” jetzt eine Bewertung vor: Die Credits sind demnach ein Risiko für den grünen Umbau. Dahinter schwelt ein Streit zwischen der EU und der USA über die Klimafinanzierung. Mehr
dass in Deutschland mehr passieren muss, um Gründungen in und aus der Wissenschaft anzuschieben, ist unbestritten. Es braucht mehr Engagement der Hochschulen und der Wirtschaft, auch das ist lange bekannt. Doch dass sich auch im Bereich der Ausbildung der Studierenden einiges ändern muss, damit es künftig mehr Tech-Unternehmer gibt, diesen Hinweis hört man nicht so oft.
“Deutschland ist im Bereich Entrepreneurial Education maximal durchschnittlich“, sagt Heike Hölzner, Professorin für Entrepreneurship und Mittelstandsmanagement an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. “Wir müssen weg vom Vorlesungsmodell, hin zu einem Projektstudium.” Was sie genau meint und welches die wichtigsten Bedingungen für ein Gelingen sind, berichtet unser Autor Ralf Nestler.
Die National Science Foundation (NSF) gibt in den kommenden fünf Jahren 67 Millionen US-Dollar für den Aufbau eines nationalen Zentrums für Sicherheit in der Forschung aus – das Secure-Center. Der wissenschaftliche Leiter Mark Haselkorn von der University of Washington in Seattle beschreibt im Gespräch, welche Aufgaben das neue Zentrum erfüllen wird. Wie sich die neue Institution auf die Forschungsbeziehungen mit internationalen Partnern – unter anderem Deutschland – auswirkt, hat unser Kollege Richard L. Hudson ihn gefragt.
Immerhin eine Sommerlektüre gibt es von Bettina Stark-Watzinger. Sie hat den Forschungsorganisationen ein Diskussionspapier gesandt. Technologieoffenheit wird darin als Lösung diverser Probleme präsentiert. Meine Kollegin Anne Brüning hat es für Sie zusammengefasst.
Kommen Sie gut in den Tag,

An Hochschulen und Forschungseinrichtungen entstehen viele Ideen, die zu marktfähigen Produkten werden können. Doch oft scheuen Forscherinnen und Forscher vor einer Gründung zurück. Politik und Wirtschaft versuchen das zu ändern, beispielsweise mit dem “Leuchtturmwettbewerb Start-up Factories”. Damit fördert das BMWK den Aufbau von hochschulnahen, privatrechtlich organisierten und unternehmerisch geführten Gründerzentren.
Das Potenzial ist jedoch längst nicht ausgeschöpft. Es beginnt mit der Ausbildung, in der die Grundlagen des Unternehmertums nicht adäquat vermittelt werden. Außerdem mangelt es teils am Engagement der Hochschulen. Und auch die Verbindungen zur Wirtschaft könnten besser sein.
Die Zurückhaltung sei keine Frage der Mentalität, sagt Helmut Schönenberger, Vizepräsident für Entrepreneurship der TU München und Geschäftsführer des Gründer- und Innovationszentrums UnternehmerTUM GmbH. “Wenn es genügend Menschen gibt, die sich dieser Mission stellen, funktioniert es auch.” Er meint Gründer ebenso wie Fachleute in der Akademia, in Behörden und der Wirtschaft. “Wenn jedes Bundesland so etwas wie UnternehmerTUM hätte, wäre Deutschland gründungsintensiver als Amerika.”
UnternehmerTUM gilt weithin als Vorbild. Das Zentrum verbindet “die universitäre Welt mit der Wirtschaftswelt”, unterstützt Gründende und Start-ups in allen Phasen – von ersten Beratungen bis zum Wachstum. Pro Jahr werden rund 50 Unternehmen ausgegründet, die ihrerseits rund zwei Milliarden Euro Risikokapital anziehen. Schönenberger: “Das ist das Doppelte des Budgets unserer Universität.”
Für den Erfolg brauche es Hochschulen, die sich neben Forschung und Lehre auch in der dritten Mission engagieren: Gründung und Innovation. Schönenberger hält es für erforderlich, dass Hochschulen “wenigstens ein Prozent ihrer Ressourcen dafür hergeben, um einigermaßen mitspielen zu können”. Eine Uni wie die TUM mit 10.000 Mitarbeitern und 50.000 Studierenden käme also auf 100 Mitarbeiter für die dritte Mission. Bei UnternehmerTUM seien es inzwischen 500 Personen, also fünf Prozent. “Das ist ein Wert, mit dem wir weltweit ganz vorne mitspielen, mit Stanford, der Tsinghua University in China oder der National University of Singapore.” Er bemisst das an der Anzahl wachstumsstarker Unternehmen, die diese Standorte hervorbringen.
Neben den Unis ist eine starke Wirtschaft in der Region vonnöten. UnternehmerTUM in München wird unter anderem von der BMW-Erbin Susanne Klatten unterstützt. Dass nicht jeder Hochschulstandort über eine derart engagierte und finanzkräftige Wirtschaft verfügt wie die bayerische Metropole, sieht auch Schönenberger. Er glaubt dennoch, dass das Konzept an vielen weiteren Orten funktionieren würde.
Belege gibt es etliche, darunter die Life Science Factory in Göttingen. Sie “zeigt beispielhaft, wie es uns gelingen kann, in ganz Deutschland innovative Leuchttürme der Vernetzung von Wirtschaft, Wissenschaft und Start-ups zu bauen”, lobte Wirtschaftsminister Robert Habeck bei einem Besuch im April. Seit zwei Jahren stehen 3.200 Quadratmeter Labor- und Arbeitsflächen für Start-ups der Bio- und Medizintechnologie bereit.
Bisher sind alle Gründer vorangekommen, keiner musste aufgeben, sagt Irina Reimer, Venture Director der Life Science Factory. Bau und Ausstattung habe das Land Niedersachsen bezahlt. Der Betrieb werde über Mieten finanziert, den Rest übernehme der Laborzulieferer Sartorius AG. Dessen CEO Joachim Kreuzburg, maßgeblicher Treiber der Factory, will “den Standort attraktiver machen und Fachkräfte hier halten”. Und neue hinzugewinnen, denn nur eine Hälfte der Start-ups kommt aus Göttingen, der Rest aus dem übrigen Bundesgebiet.
Die Factory gehört zum Sartorius-Quartier und entstand nach US-Vorbild. Unter dem Motto “Bilden – Gründen – Wohnen” ist dort alles versammelt, was Forscher der Lebenswissenschaften benötigen: ein Gesundheitscampus der örtlichen Hochschulen, Hotel, Smart Apartments, eine Kindertagesstätte sowie Miet- und Eigentumswohnungen.
Die Life Science Factory baut derzeit in München einen zweiten Standort auf. Am Helmholtz Pioneer Campus, der Biomedizin, Ingenieurwissenschaften und Digitalisierung zusammenbringt, bieten die Göttinger ihren Service aus Mietlaboren, Beratung und Networking für Start-ups an. “München verfügt über ein sehr gutes Ökosystem für Gründer”, sagt Reimer. “Mit dem Helmholtz-Zentrum München haben wir zudem einen starken Partner für unser Programm.”
Die beste Idee indes nützt wenig, wenn den Tech-Gründern unternehmerische Grundlagen fehlen. “Deutschland ist im Bereich Entrepreneurial Education maximal durchschnittlich”, sagt Heike Hölzner, Professorin für Entrepreneurship und Mittelstandsmanagement an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. Sie beruft sich dabei auf den Global Entrepreneurship Monitor.
Noch dazu habe eine Studie kürzlich gezeigt, dass Studierende seltener gründen wollen, wenn sie zuvor Entrepreneurship-Lehrveranstaltungen besucht haben. “Das ist bitter und wird vor allem so erklärt, dass die Studierenden dann gelernt haben, was alles auf sie zukommen wird. Herausforderungen, die sie vorher nicht kannten und die abschrecken.”
Es brauche andere Lehrformate, sagt Hölzner. “Wir müssen weg vom Vorlesungsmodell, hin zu einem Projektstudium.” Lehrende seien in diesem Umfeld nicht mehr die Allwissenden. Stattdessen seien sie als Mentoren, Coaches und Lernbegleiter gefragt. Und: “Lerngruppen müssen kleiner werden und sollten unbedingt interdisziplinär sein.” Sonst entstünden keine echten Durchbrüche.
Was Hochschulen und Forschungseinrichtungen Hölzners Ansicht nach tun sollten, um die Gründungskompetenz zu stärken:
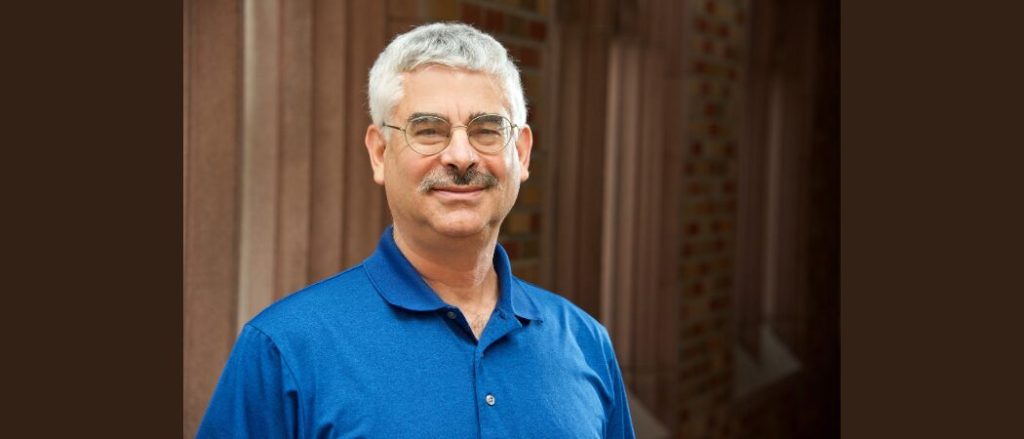
Ende Juli hatte die US-amerikanische National Science Foundation (NSF) angekündigt, Fördergelder in Höhe von 67 Millionen US-Dollar für die Einrichtung eines Zentrums für Forschungssicherheit auszugeben. Man setzt in den Vereinigten Staaten auf die Zusammenarbeit zwischen Forschenden, Regierung und Verwaltung und zeigt sich offen für die Zusammenarbeit mit Partnerländern. “Wir werden erarbeiten, was die Gemeinschaft will und braucht, um die Sicherheit in ihren Einrichtungen zu verbessern”, sagt Mark Haselkorn, Professor an der University of Washington und wissenschaftlicher Leiter des neuen Secure-Centers.
Anstatt einfach nur Sicherheitsmaßnahmen vorzuschreiben, erklärt Haselkorn, werde die Botschaft des neuen, von der National Science Foundation (NSF) unterstützten Secure-Zentrums an die Forscher lauten: “Lasst uns die Probleme definieren, lasst uns die Lösungen entwerfen, und gemeinsam werden wir sie in die Tat umsetzen. Das ist ein radikal anderer Ansatz.” Das Zentrum werde auch dafür sorgen, dass die Sicherheit nicht auf Kosten der internationalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit gehe.
Jetzt, da die Niederlande, Großbritannien, Kanada, Deutschland und andere Länder eigene akademische Sicherheitszentren einrichten, müssen wir bei Secure internationale Akteure in diese Bemühungen einbeziehen, sagt er. Ob Haselkorn und seine Kollegen eine Zusammenarbeit auf breiter Front in der normalerweise protektiv-verschlossenen Welt der Sicherheit verwirklichen können, ist die Frage, die es zu beantworten gilt.
Der Fünfjahresvertrag zur Förderung des Secure-Centers beginnt offiziell am 1. September, mit einem Startkapital von rund zehn Millionen US-Dollar. Die erste Aufgabe bestehe laut Haselkorn darin, die Verwaltungsstrukturen aufzubauen und Personal einzustellen. Er rechnet mit einer Stammbelegschaft von etwa 50 Mitarbeitern, zu denen viele weitere Beteiligte aus verschiedenen Beratungs-, Planungs- und Expertenausschüssen dazuzurechnen sind. Bis September 2025 sollen die ersten Online-Dienste betriebsbereit und nutzbar sein.
Haselkorns akademische Spezialisierung ist die Entwicklung virtueller Umgebungen, die es großen, komplexen Gruppen ermöglicht, effektiv zusammenzuarbeiten – wie aktuell etwa bei einem Projekt zur Verbesserung der Koordination zwischen verschiedenen US-amerikanischen Transportbehörden und -unternehmen. Seine Co-Leitung ist Sonia Savelli, eine Spezialistin für Design und Kognitionswissenschaft, die ebenfalls an der University of Washington in Seattle arbeitet.
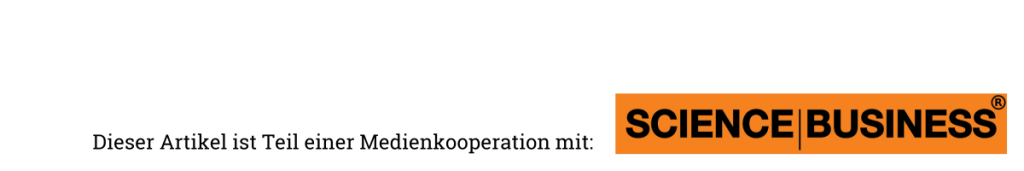
Das Begleitprojekt Secure Analytics wird von Kevin Gamache von Texas A&M und Glenn Tiffert von der Hoover Institution in Stanford geleitet. Laut Haselkorn ist ein klares Ziel des Projekts, dass die NSF die Forschungsgemeinschaft in die Lage versetzen will, eigene Sicherheitslösungen zu entwickeln. “Es gibt uns die Verantwortung für das Problem”, sagt er. Und jede Menge Arbeit: “Uns ist schon vor dem Start am 1. September schwindelig von all dem, was es zu erledigen gibt.”
Im Rahmen eines NSF-Finanzierungsabkommens über 50 Millionen Dollar und fünf Jahre organisieren Haselkorn und seine Co-Direktorin Lynette Arias von der University of Washington ein nationales Projekt zur Information, Schulung und Beratung der US-Forschungsgemeinschaft in Sicherheitsfragen.
Fünf regionale Zentren in Boston, Seattle, San Antonio (und College Station) sowie Columbia sollen innerhalb von drei Monaten nach Projektbeginn startbereit sein. Sie werden an der Entwicklung eines Online-Systems beziehungsweise einer “virtuellen Umgebung” arbeiten, in der Sicherheitsinformationen, Tools, Schulungsmodule und Warnmeldungen aktuell bereitgestellt werden. Ziel ist es, Hochschuleinrichtungen, gemeinnützige Forschungsorganisationen und kleine bis mittelgroße Unternehmen bei ihren Bemühungen zu unterstützen, die sich ständig erweiternden Regierungsrichtlinien zur Sicherheit in der Forschung einzuhalten.
Die restlichen 17 Millionen Dollar, werden an der zweitgrößten Universität des Landes, der Texas A&M (Agricultural and Mechanical) University, für ein Projekt zur Sicherheits- und Datenanalyse eingesetzt.
In der Ausschreibung zum Secure Center skizzierte die NSF im letzten Jahr dessen Funktion als “Clearingstelle für Informationen”. Sie soll Forschungsorganisationen und -institute unterstützen, die versuchen, “unzulässige oder illegale Bemühungen ausländischer Einrichtungen” zu erkennen, die darauf abzielen, “Forschungsergebnisse oder -erkenntnisse zu erlangen”. Das Zentrum für Forschungssicherheit soll Tools und Best Practices zur Risikobewertung entwickeln, außerdem Informationen und Berichte über Sicherheitsbedrohungen zur Verfügung stellen und Sicherheitsschulungen und Unterstützung für Forschende anbieten. Schließlich soll das Center auch dabei helfen, Daten und Analysen über, wie es im Original heißt: “bad actors” zu sammeln.
Was genau das alles bedeutet, soll in den kommenden Monaten mit den Secure-Partnern und der breiteren US-Forschungsgemeinschaft ausgearbeitet werden. Haselkorn nennt mögliche Beispiele:
Viele Forscher, vor allem in Europa, sind der Meinung, dass zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen in den USA der wissenschaftlichen Zusammenarbeit schaden werden. Mark Haselkorn sagt, das Zentrum werde sich bemühen, dies zu vermeiden. Zunächst wolle er mit den für die Forschungssicherheit zuständigen Stellen in den verbündeten Ländern sprechen. Es gebe bereits Regierungsbemühungen unter den führenden Volkswirtschaften der G7 und ihren Förderorganisationen hinsichtlich der Koordination und des Austauschs von Sicherheitsinformationen.
Ein Risiko für internationale Kooperationen sei überbordende Bürokratie. Wenn Forschende sicherheitsrelevante Informationen einmal für alle Länder und Forschungsförderer zur Verfügung stellen müssten, sei der Arbeitsaufwand beherrschbar. Wenn derartige Arbeitsschritte jedoch immer wieder und in verschiedenen Formaten wiederholt werden müssten, sei die Gefahr hoch, dass “die Leute es sein lassen, weil sie das Gefühl haben, dass es sich nicht lohnt.” Man müsste vom Start weg optimale Prozesse und Tools aufsetzen. Richard L. Hudson
12./13. September 2024, FU Berlin
Jahrestagung des Netzwerks Wissenschaftsmanagement Für Freiheit in Krisenzeiten. Perspektiven aus dem Wissenschaftsmanagement Mehr
19. September 2024, ab 11 Uhr, Körber-Stiftung, Hamburg
Hamburg Science Summit 2024 “Europe’s Path Towards Tech Sovereignty” Mehr
24. September 2024, 10:30 bis 16:15 Uhr, Haus der Commerzbank, Pariser Platz 1, 10117 Berlin
Forum Hochschulräte Starke Marken, klarer Kern: Strategische Schwerpunktsetzung und Markenbildung bei Hochschulen Mehr
25. September 2024, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU)
Jahreskolloquium des Bayerischen Wissenschaftsforums Transformationskompetenz in Wissenschaft und Hochschule Mehr
26. September 2024, 12:00 bis 13:00 Uhr, Webinar
CHE talk feat. DAAD KIWi Connect Transfer und Internationalisierung – Warum ist es sinnvoll, beides gemeinsam zu denken und was braucht es hierzu? Mehr
26./27. September 2024, Leopoldina, Jägerberg 1, 06108 Halle (Saale) und Online
Jahresversammlung 2024 der Leopoldina Ursprung und Beginn des Lebens Mehr
3. /4. Oktober 2024, Universität Helsinki, Finnland
2024 EUA FUNDING FORUM Sense & sustainability: future paths for university finances Mehr
8. /9. Oktober 2024 an der TU Berlin
bundesweite Tagung zu Machtmissbrauch an Hochschulen “Our UNIverse: Empowered to speak up” Mehr
10. Oktober 2024 an der TUM School of Management, München
Konferenz AI@WORK – How AI is changing leadership, work and collaboration Mehr
23. bis 25. Oktober 2024 am ETH AI Center in Zürich, Schweiz
Jahrestagung der Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft (GMW) und CampusSource Agilität und KI in Hochschulen Mehr
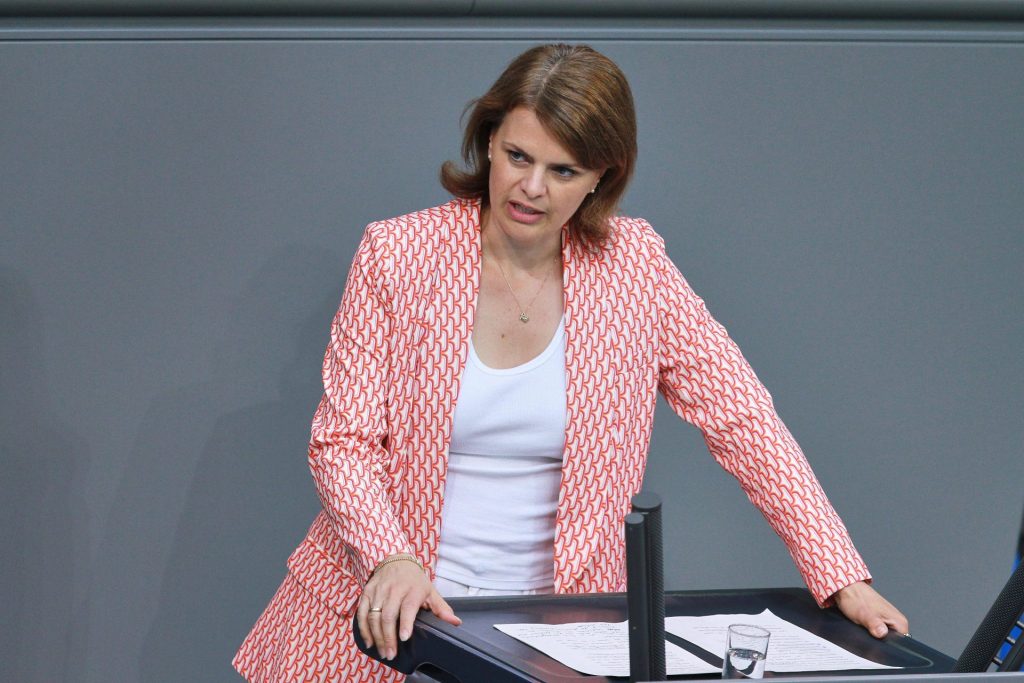
Die forschungspolitische Sprecherin der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Katrin Staffler, kritisiert eine mögliche Mittelkürzung um 5 Millionen Euro für die Wissenschaftskommunikation im geplanten Bundeshaushalt 2025. “Es ist sehr enttäuschend, dass das BMBF keine Anstalten macht, die berechtigten Sorgen aus der Community zu zerstreuen”, sagt Staffler. “Wir wissen weiterhin nur, dass um fünf Millionen Euro gekürzt werden wird, aber es ist immer noch nicht vollständig klar, welche Projekte es im entsprechenden Titel genau sind.”
Auf die Anfrage Stafflers an das BMBF, wo denn im Bereich Wissenschaftskommunikation im Jahr 2025 gekürzt werden wird, hat das BMBF am 26. Juli geantwortet, dass die geplante Absenkung im Haushaltstitel 3003 / 541 01 “Wissenschaftskommunikation, Partizipation, Soziale Innovationen” gegenüber dem Jahr 2024 nur zu einem Teil Maßnahmen der Wissenschaftskommunikation betreffe.
Im Vergleich zur Vorgängerregierung habe der Haushaltstitel weiterhin einen deutlichen Aufwuchs erfahren. Der Titelansatz lag im Jahr 2021 bei 20 Millionen Euro, für das Jahr 2025 sei ein Titelansatz von 23,75 Millionen Euro vorgesehen, antwortet der Parlamentarische Staatssekretär Jens Brandenburg für das BMBF.
Nach aktuellem Planungsstand könne die interaktive Diskussionsreihe mit zehn Veranstaltungen “Wissenschaft kontrovers”, betrieben durch “Wissenschaft im Dialog” (Fördervolumen im Jahr 2024: 127.855,88 Euro) nicht weiter betrieben werden. Zentrale Veranstaltungen der Wissenschaftsjahre wie die Auftakt- und Abschlussveranstaltungen würden auch im Jahr 2025 umgesetzt, ebenso die geplante Abschluss-Convention des Strategieprozesses #FactoryWisskomm im April 2025.
Die genannte Kürzung der Veranstaltungsreihe “Wissenschaft kontrovers” sei wohl kaum allein für die Gesamtkürzungssumme von fünf Millionen EUR verantwortlich, kritisiert Staffler. Die schwammige Antwort des BMBF auf ihre konkrete Frage zeige, dass das BMBF offenbar nicht in der Lage sei, zu priorisieren. Dies “zwingt die Betroffenen damit in eine vollkommen unnötige Planungsunsicherheit“. Am Ende führe dies nur dazu, dass sich das BMBF weiter von der Wissenschafts-Community entferne.
Auf Anfrage von Table.Briefings zu den Kürzungen im Bereich der Wisskomm erklärte das BMBF bereits am 16. Juli, dass Wissenschaftskommunikation eine Querschnittsaufgabe sei, “die nicht allein durch den Titel für Wissenschaftskommunikation abgebildet ist”. Die Forderungen aus dem Koalitionsantrag bei aktuellen Förderentscheidungen würden zudem besonders berücksichtigt. tg
Bettina Stark-Watzinger möchte offenbar eine “Offensive für Technologieoffenheit” anregen. Wie die FAS am Wochenende berichtete, hat das BMBF ein “Impulspapier mit Vorschlägen zur Stärkung der Innovationskräfte, des Wachstumspotentials und der Wissenschaftsfreiheit” an die führenden Forschungsinstitutionen im Land verschickt.
Das sieben Seiten umfassende Papier, das auch Table.Briefings vorliegt, preist Technologieoffenheit als Weg zu mehr Wohlstand, zur Stärkung der Wissenschaftsfreiheit sowie der strategischen Unabhängigkeit. Darüber hinaus enthält es einige konkrete Vorschläge. Sie seien als “erster Impuls” zu verstehen und könnten “im Zuge des angestrebten Diskussionsprozesses weiterentwickelt und ergänzt werden”. Die wichtigsten Vorschläge:
Darüber hinaus finden sich in dem Papier bekannte FDP-Themen. So preist es synthetische Kraftstoffe als “unverzichtbaren Beitrag zu bezahlbarer individueller Mobilität und zur Dekarbonisierung des Verkehrs” an, fordert eine bürokratiearme Umsetzung des AI Acts und den Abbau von Berichtspflichten für Unternehmen.
Die adressierten Forschungsorganisationen haben sich zu dem BMBF-Vorstoß noch nicht positioniert. “Wir begrüßen die Absicht des BMBF, eine punktuelle Reform der Rahmenbedingungen des deutschen Innovationsökosystems in Angriff zu nehmen, und sehen dies als große Chance für den Forschungsstandort Deutschland”, teilte die Helmholtz-Gemeinschaft auf Anfrage von Table.Briefings mit. Man bringe sich als aktiver Gesprächspartner in diese Debatte ein. “Da der Konsultationsprozess zwischen dem BMBF und der Allianz der Wissenschaftsorganisationen aktuell läuft, können wir uns inhaltlich zu einzelnen Punkten noch nicht äußern.” Gerne nehme man zu einem späteren Zeitpunkt Stellung. abg
Die Mehrzahl der Mitgliedstaaten im Rat sieht es kritisch, dass die ungarische EU-Ratspräsidentschaft die Gespräche zur Deregulierung neuer Gentechniken (NGT) in weiten Teilen neu aufrollen will. Das geht aus internen Dokumenten hervor, die Table.Briefings vorliegen. Demnach stellten sich bei einem kürzlichen Treffen auf Arbeitsebene 15 Länder gegen dieses Vorgehen, darunter Frankreich, Spanien, Italien und Tschechien. Sie finden: Aspekte, zu denen schon mehrheitsfähige Lösungen gefunden wurden, sollten nicht noch einmal neu diskutiert werden. Fortschritte würden sonst verschenkt. Ähnlich sieht es die Europäische Kommission. Sie fürchtet, durch Verzögerungen bei dem Dossier könnte die EU ins Hintertreffen geraten, während immer mehr Drittstaaten NGT zulassen.
Ungarn hält dagegen, dass die Gespräche im Rat in eine Sackgasse geraten seien. Nur noch die Patentierbarkeit gentechnisch veränderter Pflanzen als offene Frage zu diskutieren, wie es die Belgier zuletzt getan hatten, führe nicht weiter. Österreich, Bulgarien, Kroatien, Rumänien, die Slowakei und Slowenien teilen diese Sichtweise. An der Patentfrage, die weiter ungelöst bleibt, will Budapest erst einmal gar nicht weiterarbeiten. Die Ratsarbeitsgruppe zu genetischen Ressourcen, die derzeit die Gespräche führt, sei hierfür nicht das richtige Forum.
Die Zurückstellung der Patentfrage und die gespaltenen Mehrheitsverhältnisse im Rat deuten darauf hin, dass eine Einigung unter der ungarischen Ratspräsidentschaft unwahrscheinlich ist. Diese hatte sich das für ihre sechsmonatige Amtszeit auch nicht explizit vorgenommen. Derweil kann sich die Bundesregierung weiter kaum in die Gespräche einbringen, weil die Ampel zum Thema gespalten bleibt. jd

Seit verschiedene empirische Studien einen Gender Pay Gap auch für Professorinnen und Professoren an deutschen Hochschulen nachweisen, der zudem in den letzten Jahren nahezu stabil geblieben ist, sorgt das Thema zurecht für erhebliche Unruhe im Wissenschaftssystem. So kommt der 2022 veröffentlichte Gender Report aus NRW zu dem Schluss, dass in Vollzeit tätige Professorinnen im Durchschnitt circa 514 Euro brutto pro Monat weniger als ihre männlichen Kollegen verdienen. Wobei der Unterschied dann noch größer wird, wenn allein die W3 Besoldung betrachtet wird.
Auch wenn dieser Durchschnittswert um statistisch nachvollziehbare Faktoren bereinigt wird, wie Berufserfahrung und Qualifikation, berufliche Position, Disziplin und andere mögliche Einflussfaktoren, bleibt unter dem Strich ein über die Statistik nicht nachvollziehbarer und nicht erklärbarer Verdienstunterschied von circa 261 Euro brutto pro Monat. Die Differenz, die dieser sogenannte bereinigte Gender Pay Gap zutage fördert, ist demnach allein der Zugehörigkeit zu einem Geschlecht geschuldet.
Darüber, dass diese Einkommensschere unter einer Gerechtigkeitsperspektive keinesfalls tolerierbar ist, sind sich die Verantwortlichen in Politik und Hochschulleitungen weitgehend einig. So haben 41 Hochschulen des Landes NRW 2022 eine gemeinsame Erklärung zum Abbau des Gender Pay Gap bei Professorinnen unterzeichnet. Aber, ob überhaupt und wenn ja, welche weiterführende Maßnahmen von Hochschulen zu ergreifen sind, um dieser Ungleichheit entgegenzuwirken, darüber gibt es dann doch, teilweise sehr heftige Debatten.
Eine genauere Betrachtung dazu, wie der Einkommensunterschied zustande kommt, kann Aufschluss darüber geben, ob und welche Maßnahmen zum Abbau dieser Diskriminierung von Wissenschaftlerinnen beitragen können.
Die leistungsbezogenen Gehaltsbestandteile, die bei Berufungen gewährt werden, sind zentrale Stellschraube beim Abbau des Gender Pay Gap, wie die Studien zum Gender Pay Gap in NRW, Niedersachsen oder Hamburg zeigen. Diese Leistungsbezüge, die zusätzlich zu den gesetzlich festgelegten Grundgehältern gewährt werden, werden individuell zwischen den Hochschulleitungen und den Neuberufenen ausgehandelt.
Immer wieder werden als Begründung für geschlechterdifferente Ergebnisse dieser Berufungsverhandlungen nicht nur von Hochschulleitungen, das mangelnde Geschick und das fehlende Durchsetzungsvermögen von Wissenschaftlerinnen angeführt. So würden Wissenschaftlerinnen “schlechter” im Sinne von weniger “hartnäckig”, weniger “informiert” und in der Folge weniger “erfolgreich” verhandeln als ihre Kollegen. Bereits diese Aussagen sind ein Indiz dafür, dass es geschlechterbezogene Unterschiede in den Verhandlungen gibt.
Nicht selten ist dann der Umkehrschluss, dass die Abschaffung solcher Differenzen vor allem in der Verantwortung der Wissenschaftlerinnen liegt und sie sich auf die Berufungsverhandlungen intensiver vorbereiten müssen. Weiterführende Maßnahmen von Seiten der Hochschulen, so wird weiter argumentiert, könnten eher kontraproduktiv sein, weil auch Wissenschaftlerinnen lernen müssten, sich gegen Widerstände durchzusetzen.
Kaum berücksichtigt wird in diesen Argumentationsfiguren, dass Hochschulleitungen mehr oder weniger unbewusst dazu neigen, für Wissenschaftler ein höheres Gehalt als gerecht anzusehen als für Wissenschaftlerinnen – und dies bei den gleichen berufsrelevanten Qualifikationen und Erfahrungen. Was als relevante Leistung anerkannt wird, ist gerade in solchen individuellen Berufungsverhandlungen breit interpretierbar und aus anderen Studien ist ebenfalls bekannt, dass, selbst wenn Wissenschaftlerinnen dasselbe leisten wie ihre Kollegen, es ihnen nicht gleichermaßen zuerkannt wird.
Darüber hinaus entscheiden auch leistungsunabhängige Faktoren über das Gehalt: Beispielsweise fallen die Gehälter in den männlich dominierten Fächern durchschnittlich höher aus – unabhängig von der individuellen Leistung. Gänzlich unberücksichtigt bleibt die Leistung, Beruf und Familie in einem so wenig familienfreundlichen System wie der Wissenschaft erfolgreich vereinbart zu haben, was eigentlich nahelegen würde, dass Professorinnen mit Kindern einen Leistungszuschlag erhalten. All diese geschlechterbezogenen Verzerrungen sind nach wie vor tief in Berufungsverfahren verankert und müssen ganz gezielt und sehr bewusst etwa durch die Schaffung entsprechender Reflexion und Transparenz durchbrochen werden.
Ein Grundsatzurteil des Bundesarbeitsgerichts in Erfurt zur Lohngleichheit von 2023 zwischen den Geschlechtern lässt aufhorchen, da es gerade auf solche Verhandlungssituationen zutrifft, wie sie typischerweise bei Berufungen vorliegen. Dieses Urteil besagt, dass auch dann, wenn Bewerber durch ‘Verhandlungsgeschick’ höhere Gehaltsforderungen durchsetzen, eine Bewerberin bei ihrem neuen Job nicht schlechter bezahlt werden dürfe. Eine ungleiche Bezahlung weise sonst auf eine geschlechtsbasierte Diskriminierung hin, die gesetzlich untersagt ist.
Liegt in diesem Urteil nicht auch eine deutliche Aufforderung an das Wissenschaftssystem zu reagieren und etwa die Aushandlungssituation in Berufungsverhandlungen zur Gewährung von Leistungsbezügen eingehend zu überprüfen, um sie diskriminierungsfrei zu gestalten und zu halten?
Der Gender Pay Gap kann, darüber besteht für mich kein Zweifel, lediglich durch ein Bündel von abgestimmten Maßnahmen allmählich geschlossen werden. Die Entwicklung und die Durchführung dieser Maßnahmen setzt nun aber nicht nur den Willen und der Bereitschaft der Hochschulleitungen voraus, sondern benötigt zudem einen breiten Konsens der Beschäftigten in den Hochschulen darüber, dass es diesen Diskriminierungstatbestand gibt und dass er durch entsprechende Maßnahmen abgebaut werden muss.
Von Seiten der Hochschulleitungen gilt es zunächst einmal schlicht anzuerkennen, dass auch Berufungsverhandlungen mehr oder weniger bewusst durch einen Gender Bias beeinflusst werden. Davon kann sich niemand freisprechen. Wir wissen aus verschiedenen Studien aber zugleich, dass dieser Diskriminierungseffekt geringer wird, wenn Rektorinnen beziehungsweise Präsidentinnen diese Berufungsverhandlungen führen, was wiederum ein Plädoyer dafür ist, den Anteil an weiblichen Hochschulleitungen zu erhöhen.
Leticia Carvalho aus Brasilien wird neue Generalsekretärin der Internationalen Meeresbodenbehörde. Die Staatenversammlung wählte sie zur Nachfolgerin von Michael Lodge (GBR), der die Behörde seit 2016 geführt hat. Carvalho wird ihr Amt zu Beginn des kommenden Jahres antreten. Ihre Aufgabe wird es sein, die Verhandlungen der 170 Vertragsparteien, insbesondere zur Schaffung eines Rechtsrahmens für möglichen zukünftigen Tiefseebergbau, zu unterstützen.
Eveline Dürr, Ethnologin, sowie die Leukämiespezialistin Irmela Jeremias werden von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) im Rahmen des Reinhart-Koselleck-Programms gefördert. Die beiden Forscherinnen der Ludwig-Maximilians-Universität München bekommen für ihre Projekte jeweils 1,25 Millionen Euro. Dürrs Forschung widmet sich unter anderem Mensch-Umweltbeziehungen, ethnologischer Stadtforschung und der Frage kultureller Identitäten. Jeremias sucht neue Angriffsziele zur Bekämpfung von aggressiven Leukämien.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an research@table.media!
Europe.Table. AI Act: Warum Unternehmen ungeduldig auf Normen für KI warten. Der AI Act stellt eine europäische Harmonisierungsregelung für die Produktkonformität dar. Er folgt damit der Formel des New Legislative Framework. Das bedeutet, dass jetzt neben dem Gesetz noch Normen für KI nötig sind. Mehr
Bildung.Table. Frauen in MINT-Berufen: Wie sich ihr Anteil erhöhen lässt. Die MINT-Branche leidet nicht nur unter Fachkräftemangel, auch der Anteil an Frauen ist weiterhin niedrig. Das muss sich dringend ändern, fordert Marie Pötter, Geschäftsführerin eines IT-Unternehmens. Sie setzt auf Mentorenprogramme und mehr Praxiseinblicke schon in der Schulzeit. Mehr
Africa.Table. Fachkräftemangel: Warum Deutschland so wenig Arbeitskräfte aus Afrika will. Nur wenige Fachkräfte aus Afrika wollen nach Deutschland kommen. Die Ursache liegt in der deutschen Entwicklungspolitik. Auch sich hartnäckig haltende Vorurteile spielen eine Rolle. Mehr
Climate.Table. SBTI: Deshalb sind Carbon Credits ein Risiko für die Transformation. Im Streit um die Zulassung von CO₂-Kompensationen für Unternehmen legt die “Science Based Targets Initiative” jetzt eine Bewertung vor: Die Credits sind demnach ein Risiko für den grünen Umbau. Dahinter schwelt ein Streit zwischen der EU und der USA über die Klimafinanzierung. Mehr
