in den heutigen Beratungen zum Haushalt steht der Etat des BMBF auf der Tagesordnung. Wichtiges Thema: die Zukunft der Batterieforschung in Deutschland. Wie mein Kollege Markus Weisskopf berichtete, könnte es für den Forschungszweig doch schlimmer kommen als gedacht. Nachdem für 2025 noch 118 Millionen Euro Förderung im Klima- und Transformationsfonds (KTF) verankert sind, ist danach anscheinend Schluss mit der Bundesförderung. Das bedeutet, dass das BMBF nur noch bestehende Projekte bis zum Ende der Projektlaufzeit finanzieren, aber keine neuen mehr anstoßen kann.
Kurz vor der Haushaltsdebatte wird diese Planung jetzt auch koalitionsintern heftig kritisiert. Der SPD-Forschungspolitiker Holger Becker hält “diese Vorgehensweise für mutlos und den völlig falschen Ansatz”. Auch die Opposition meldet sich lautstark zu Wort. Gibt es noch Hoffnung für die Batterieforschung?
In unserer Serie “Breakthrough-Minds” stellen wir heute die Chemikerin Inge Katrin Herrmann vor. Der Professorin an der Uni Zürich gelingt regelmäßig, ihr Wissen effektiv in Produkte und Patente zu transferieren. Schon als Studentin entwickelte die Schweizerin ein magnetbasiertes Verfahren zur Blutreinigung. Später erfand sie ein effektives Wund-Verschluss-Verfahren per Lasertechnologie und ein Implantat aus Hydrogel, das Frauen mit Endometriose hilft – zugleich kann es als Verhütungsmittel eingesetzt werden.
Von Anfang an arbeitete Herrmann dabei an der Schnittstelle von Chemie, Materialwissenschaft, Ingenieurwesen und Medizin. Die Kommunikation über Disziplinen hinweg sei natürlich anspruchsvoll und kostet Zeit und Energie, sagt sie. Doch die Vielfalt ihrer Teams und die intensiven Gespräche mit Menschen aus komplett anderen Branchen sei ein Schlüssel für ihren Erfolg. “Die Komfortzone ist nicht der Ort, an dem Magie passiert”, sagt Herrmann.
Ich wünsche Ihnen einen zauberhaften Start in den Tag,


Es ist die Forderung nach einem großen Wurf: Der Bericht des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten und EZB-Präsidenten Mario Draghi drängt auf eine Verdoppelung des EU-Forschungs- und Innovationsbudgets auf 200 Milliarden Euro für das nächste siebenjährige Rahmenprogramm von 2028 bis 2034. Gleichzeitig wird in dem Papier konstatiert, dass das derzeitige Programm Horizont Europa für viele Antragsteller zu schwierig zu handhaben sei. Öffentlich-private Partnerschaften seien bislang ineffizient organisiert und bei einem der wichtigsten Geldgeber für innovative Unternehmen, dem Europäischen Innovationsrat (EIC), seien ebenfalls weitreichende Änderungen erforderlich.
Würden alle Änderungen des Draghi-Berichts umgesetzt, würde das einer kleinen Revolution in der EU-Forschungspolitik gleichkommen. Die Bedeutung des Berichts ergibt sich einerseits aus dem Renommee des Autors und andererseits aus dem Zeitpunkt, zu dem das neue Europäische Parlament und die neue Kommission in diesem Herbst ihre Arbeit aufnehmen. Sie könnten eine umfassende Überarbeitung der EU-Politik für die Industrie und die Wettbewerbsfähigkeit angehen. Angesichts der ausgabenfreundlichen Botschaften des Papiers ist es nicht überraschend, dass viele aus der FuE-Lobby mit Lob auf den Bericht reagierten – auf die Kritikpunkte des Berichts gab es jedoch kaum unmittelbare Reaktionen.
Draghi verweist auf das seit langem bestehende Problem, dass es Europa nicht gelingt, Innovationen in kommerzielle Produkte umzusetzen, während viele der innovativsten Start-ups aufgrund der regulatorischen Hürden in der EU lieber Risikokapital und Wachstumsmöglichkeiten in den USA suchen. “Europa muss ein Ort werden, an dem die Innovation floriert, insbesondere im Bereich der digitalen Technologie. Ein schwacher Technologiesektor […] wird uns nicht nur der Wachstumschancen der kommenden KI-Revolution berauben, sondern auch die Innovation in unseren traditionellen Sektoren behindern”, sagte er vor Journalisten bei einem Briefing zum Bericht.
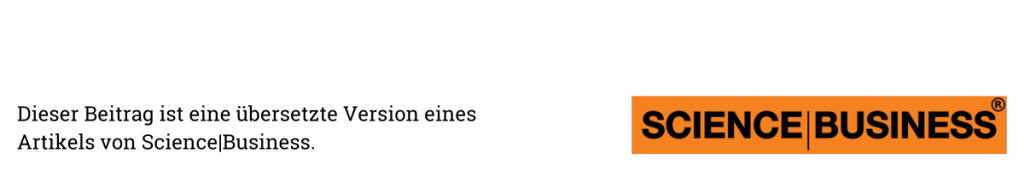
Der Bericht befürwortet eine deutliche Erhöhung der EU-F&I-Ausgaben – vorausgesetzt allerdings, die Programme werden strukturell geändert: “Unter der Bedingung, dass Reformen durchgeführt werden, sollte das Budget des neuen Rahmenprogramms auf 200 Milliarden Euro für die sieben Jahre ab 2028 verdoppelt werden”, heißt es in dem Papier. Zudem sieht der Bericht das Pathfinder-Programm des Europäischen Innovationsrats, das bahnbrechende Innovationen auf niedrigem technologischen Niveau unterstützt, zu schlecht ausgestattet. Das Budget von 250 Millionen Euro für 2024, sei viel weniger als bei ähnlichen Agenturen etwa in den USA. Zudem sei es meist von EU-Beamten und nicht von Spitzenwissenschaftlern und Innovationsexperten geleitet.
Das nächste EU-Forschungsrahmenprogramm sollte sich, laut dem Bericht, auf eine geringere Anzahl von Prioritäten konzentrieren, wobei ein größerer Anteil des Budgets für Sprunginnovationen verwendet werden sollte. Um dies zu überwachen, empfiehlt der Bericht eine Reform des EIC nach dem Vorbild der US-amerikanischen Advanced Research Project Agencies (ARPAs), die risikoreiche Projekte unterstützen. Auch das Antragsverfahren sollte schneller und weniger bürokratisch sein, und das Programm sollte von Projektmanagern verwaltet werden.
Ein Teil des EU-Innovationsproblems liegt dem Draghi-Bericht zufolge in der Aufsplitterung der öffentlichen Ausgaben für Forschung und Innovation auf die einzelnen Mitgliedstaaten, wobei nur ein Zehntel der Gesamtausgaben in Brüssel über EU-weite Programme verwaltet wird. Draghi fordert die Schaffung einer “Forschungs- und Innovationsunion”, um eine besser koordinierte F&I-Strategie zu ermöglichen, obwohl unklar ist, was dies bedeuten würde.
Zwei Jahrzehnte, nachdem die EU den Mitgliedstaaten das Ziel gesetzt hat, die öffentlichen und privaten FuE-Ausgaben auf mindestens 3 Prozent des BIP zu erhöhen, liegt der EU-Durchschnitt immer noch bei 2,2 Prozent. Draghi fordert die EU auf, ihr Engagement für dieses Ziel “innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens” zu bekräftigen. Auf die Frage, ob die Mitgliedsstaaten das 3-Prozent-Ziel verfehlt hätten, sagte Draghi: “Wir haben verkündet, dass Innovation im Mittelpunkt unseres Handelns steht, und dann haben wir im Grunde alles getan, was wir konnten, um sie auf einem niedrigen Niveau zu halten.”
Zu den Innovationshemmnissen in Europa gehört die “mittelfristige Technologiefalle” – eine Wirtschaft, die sich auf reife Sektoren, insbesondere die Automobilindustrie, stützt und durch geringe Innovation und niedrige Produktivität gekennzeichnet ist. In den USA war das Bild in den frühen 2000er Jahren ähnlich, aber heute kommen die Top-Investoren in Forschung und Entwicklung in den USA nicht aus der Automobilindustrie, sondern aus dem Technologiesektor. Im Ergebnis hätten EU-Unternehmen im Jahr 2021 im Verhältnis zum BIP etwa halb so viel für Forschung und Entwicklung ausgeben wie US-Unternehmen.
Auch im Bereich Grundlagenforschung droht die EU, laut dem Draghi-Bericht, den Anschluss zu verlieren. Nur drei Institutionen in der EU tauchen unter den Top-50 der Einrichtungen auf, die die meisten Publikationen in den führenden wissenschaftlichen Fachzeitschriften unterbringen. Im Vergleich dazu finden sich in der Rangliste 15 chinesische Einrichtungen und 21 aus den USA. Zudem gebe es keine führenden Innovationscluster, die die Kommerzialisierung von Sprunginnovationen vorantreibe.
Der Bericht empfiehlt, die Unterstützung für die Grundlagenforschung durch den Europäischen Forschungsrat (ERC) zu verdoppeln und ein “auf Exzellenz basierendes, stark wettbewerbsorientiertes ‘ERC for Institutions’-Programm” einzuführen, um akademischen Einrichtungen mehr Mittel zur Verfügung zu stellen, und einen “EU-Lehrstuhl” einzurichten, um Spitzenwissenschaftler zu halten, indem sie als europäische Beamte eingestellt werden.
Draghi möchte zudem den Transfer ankurbeln, indem er auf ein “neues Konzept für eine faire und transparente Aufteilung der Lizenzgebühren” zwischen Forschern und ihren Einrichtungen drängt, das Einheitspatent in allen EU-Mitgliedstaaten einführt und es Unternehmen ermöglicht, den EU-weiten Status eines “innovativen europäischen Unternehmens” anzunehmen. Dem Bericht zufolge hindert ein fragmentierter Binnenmarkt innovative Unternehmen daran, sich in Europa zu vergrößern.
Während der Pressekonferenz warf Draghi der EU vor, den Technologiesektor mit komplexen Gesetzen wie dem AI Act und der General Data Protection Regulation (GDPR) zu stark zu regulieren. Diese sollen die US-Tech-Giganten regulieren, behindern aber letztlich kleine EU-Firmen, die es sich nicht leisten können, Personal einzustellen, um die Vorschriften zu erfüllen. “Wir bringen unsere kleinen Unternehmen um”, sagte er.
Draghis Bericht ist der zweite einflussreiche Bericht in den letzten Monaten, der sich mit den wichtigsten Herausforderungen in Bezug auf Wettbewerbsfähigkeit und Innovation befasst. Im April veröffentlichte ein anderer ehemaliger italienischer Ministerpräsident, Enrico Letta, seine Empfehlungen für die Zukunft des EU-Binnenmarktes, darunter die Schaffung einer “fünften Freiheit”, die dem freien Verkehr von Forschung, Innovation, Wissen und Bildung gewidmet ist. Martin Greenacre and Eleonora Francica

Die zweite Befragung Bettina Stark-Watzingers zur Fördermittelaffäre im Forschungsausschuss hat diese nicht zu einem Ende führen können. Für die Koalitionspartner der FDP stellte sich nach dem Treffen am Dienstagmorgen die Frage, wie lange sie die immer noch ungeklärte Situation um mögliche fördermittelrechtliche Prüfungen kritischer Wissenschaftler durch das BMBF noch mittragen wollen.
“Nach dieser Ausschusssitzung sind wir als Parlament eigentlich genauso schlau wie vorher”, kritisiert Oliver Kaczmarek (SPD) überraschend deutlich. Der Obmann im Forschungsausschuss moniert erneut eine unzureichende Transparenz seitens der BMBF-Spitze: Offene Fragen, die sich aus vorgelegten und nicht vorgelegten Unterlagen ergeben haben, seien durch die Ministerin nicht ausgeräumt worden.
Dabei gehe es doch um die wichtigste Währung für eine belastbare Wissenschaftspolitik, nämlich die Glaubwürdigkeit im Umgang mit der Wissenschaftsfreiheit und den Ausschluss der politischen Einflussnahme darauf. “Umso weniger kann ich verstehen, dass dem Ausschuss weiterhin nicht alle Akten und Chats zur Verfügung gestellt werden. Das lässt leider weiterhin viel Raum für Spekulationen.”
Bettina Stark-Watzinger hatte zu Beginn der Sitzung ein knappes Statement vorgetragen, in dem sie erneut erklärte, von den umstrittenen Prüfaufträgen nicht gewusst zu haben. Sie wiederholte frühere Aussagen wie “Ich habe den betreffenden Auftrag, förderrechtliche Konsequenzen prüfen zu lassen, nicht erteilt und auch nicht gewollt”. Dabei übte sie auch Kritik: Während der Ausschuss sich erneut mit längst aufgeklärten und wiederholt erörterten Sachverhalten beschäftige, drehe sich “die Welt um uns herum weiter”, erklärte Stark-Watzinger. Und verwies auf offene Fragen zum Thema Antisemitismus auch an den Hochschulen.
Nicht nur die SPD, auch die CDU-Opposition zeigt sich enttäuscht vom Sitzungsverlauf. “Die Ministerin hat durch ihren Auftritt weiter viel Vertrauen verspielt”, sagt Thomas Jarzombek. Auf wesentliche Fragen gab es keine Antworten. So stehe etwa die Frage im Raum, ob die Ministerin ein System der Schattenkommunikation in ihrem Haus aufgebaut hat. Außerdem wollten Jarzombek und seine Parteikollegen Stephan Albani und Ingeborg Grässle wissen:
Bettina Stark-Watzinger sprach von “falschen Behauptungen” durch Jarzombek, wie von “Unterstellungen und Spekulationen” durch “interessierte Kreise”. Ria Schröder (FDP) sprang ihrer Parteikollegin bei. “Auch heute haben Sie wieder versucht, möglichst viel Dreck zu werfen in der Hoffnung, dass etwas hängenbleibt”, erklärt sie in Richtung Jarzombeks. “Sie gerieren sich wie ein Staatsanwalt, aber haben gar keinen Wahrheitsanspruch.”
Am Ende von vier Fragerunden wirkten alle Beteiligten ernüchtert. Während Bettina Stark-Watzinger bis zum Schluss immer wieder auf ihr Eingangsstatement verwies, oder auf die Verschwiegenheitspflicht der frühzeitig entlassenen Staatssekretärin Döring, wiederholten die Abgeordneten ebenso gebetsmühlenartig, dass die Ministerin doch bitte endlich auf ihre Fragen antworten solle. Selbst die Abgeordnete der Linken verwies zweimal auf die Fragen Jarzombeks und bat um Beantwortung.
Gewöhnungsbedürftig wirkt eine Aussage Anja Reinalters nach Ende der Sitzung. Die Ministerin habe den Abgeordneten in der Befragung ihr Wort geben und “garantiert, dass in Bezug auf die Fördermittelaffäre nichts Weiteres veranlasst wurde, was Zweifel am Umgang mit der Wissenschaftsfreiheit im BMBF aufkommen lassen könnte”, erklärte die forschungspolitische Sprecherin der Grünen. Diese Versicherung sei für die Grünen nun die Grundlage, gemeinsam nach vorne zu schauen. “Wir haben uns als Koalition noch viel vorgenommen, was wir wissenschafts- und bildungspolitisch erreichen wollen.”
Für einen Koalitionspartner ist die Fördermittelaffäre damit offenbar beendet. Nicht nur die ungeklärten Fragen vieler Politiker, die weiter bestehende Kritik an der Ministerin aus der Wissenschafts-Community und nicht zuletzt der Blick auf noch diverse laufende Gerichtsverfahren lassen annehmen, dass in der Sache noch lange kein Abschluss gefunden ist. Tatsächlich hat das BMBF eine Anfrage der Plattform FragDenStaat auf Akten-Einsicht abgelehnt. Die Aktivisten der Plattform für Informationsfreiheit werden jetzt auf Herausgabe der Wire-Nachrichten aus der BMBF-Chat-Gruppe klagen, wie sie Table.Briefings am Dienstag bestätigen.
Auch erste Forderungen nach weiteren Schritten werden laut. “Die Ministerin hält Akten unter Verschluss und hat der im Zuge der Affäre entlassenen Staatssekretärin Sabine Döring einen Maulkorb verpasst”, sagte Andreas Keller, stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Es sei Zeit, einen Untersuchungsausschuss zur Fördergeldaffäre einzurichten.
12. September 2024, 18:00 Uhr, Table.Briefings, Wöhlertstr. 12-13, 10115 Berlin
Salon des Berlin Institute for Scholarly Publishing BISP Salon I: The Changing Geography of Global Research Mehr
12./13. September 2024, FU Berlin
Jahrestagung des Netzwerks Wissenschaftsmanagement Für Freiheit in Krisenzeiten. Perspektiven aus dem Wissenschaftsmanagement Mehr
12. – 15. September 2024, Potsdam
133. Versammlung der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Wissenschaft für unser Leben von morgen Mehr
18. September 2024, Alte Münze, Berlin
InnoNation Festival Scaling Solutions Mehr
19. September 2024, ab 11 Uhr, Körber-Stiftung, Hamburg
Hamburg Science Summit 2024 “Europe’s Path Towards Tech Sovereignty” Mehr
19.-21. September 2024, Bauhaus-Universität Weimar
66. Jahrestagung der Kanzlerinnen und Kanzler der deutschen Universitäten Hochschulbau trotz/t Krisen Mehr
24. September 2024, 10:30 bis 16:15 Uhr, Haus der Commerzbank, Pariser Platz 1, 10117 Berlin
Forum Hochschulräte Starke Marken, klarer Kern: Strategische Schwerpunktsetzung und Markenbildung bei Hochschulen Mehr
25. September 2024, 8:00 bis 9:15 Uhr im BASECAMP, Mittelstraße 51-53, 10117 Berlin
Frühstücks-Austausch: Gipfel für Forschung und Innovation Follow-up Innovationen in Europa – Katalysatoren, Kompetenzen und Kooperationen am Beispiel von KI: Gespräch über Umsetzungsschritte für mehr Geschwindigkeit bei Innovation und Forschung Zur Anmeldung
25. September 2024, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU)
Jahreskolloquium des Bayerischen Wissenschaftsforums Transformationskompetenz in Wissenschaft und Hochschule Mehr
26. September 2024, 12:00 bis 13:00 Uhr, Webinar
CHE talk feat. DAAD KIWi Connect Transfer und Internationalisierung – Warum ist es sinnvoll, beides gemeinsam zu denken und was braucht es hierzu? Mehr
26./27. September 2024, Leopoldina, Jägerberg 1, 06108 Halle (Saale) und Online
Jahresversammlung 2024 der Leopoldina Ursprung und Beginn des Lebens Mehr
1. Oktober 2024, 19 Uhr, Bricks Club Berlin
Gesprächsreihe der Wübben Stiftung Wissenschaft in Kooperation mit der Jungen Akademie Christopher Degelmann: Fake News und Fleischkonsum in der Antike Mehr
3. /4. Oktober 2024, Universität Helsinki, Finnland
2024 EUA FUNDING FORUM Sense & sustainability: future paths for university finances Mehr
8. /9. Oktober 2024 an der TU Berlin
bundesweite Tagung zu Machtmissbrauch an Hochschulen “Our UNIverse: Empowered to speak up” Mehr
10. Oktober 2024 an der TUM School of Management, München
Konferenz AI@WORK – How AI is changing leadership, work and collaboration Mehr
11. Oktober 2024 an der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste, Düsseldorf
DHV-Symposium 2024 “Die ‘Große Transformation’ – ein Jahrhundertprojekt zwischen Realität und Utopie” Mehr
23. bis 25. Oktober 2024 am ETH AI Center in Zürich, Schweiz
Jahrestagung der Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft (GMW) und CampusSource Agilität und KI in Hochschulen Mehr
4. November 2024, 17 Uhr, Allgemeiner Fakultätentag e.V., Karlsruhe
Online-Podiumsdiskussion “Denken, Sprechen, Schreiben. Wie wichtig ist die Sprachkompetenz für das wissenschaftliche Arbeiten?” Mehr
7.-9. November 2024, Berlin
Konferenz Falling Walls Science Summit 2024 Mehr
Aus forschungspolitischer Perspektive findet mit der Debatte über den BMBF-Etat am heutigen Donnerstag der Höhepunkt der Haushaltswoche statt. Ein Streitobjekt: Die massiven Streichungen bei der Förderung der Batterieforschung. Diese war bisher mit 156 Millionen Euro jährlich im KTF verankert, dazu kamen rund 50 Millionen Euro direkt aus dem BMBF-Etat für die Forschungsfertigung Batteriezelle (FFB) in Münster. Nach ersten Kürzungen im laufenden Haushaltsjahr sollen ab 2025 keine neuen Förderungen mehr über den KTF erfolgen. Lediglich bereits laufende Projekte werden bis zum Projektende noch ausfinanziert.
Diese Pläne werden nun, kurz vor der Haushaltsdebatte, auch koalitionsintern heftig kritisiert. Der SPD-Forschungspolitiker Holger Becker hält “diese Vorgehensweise für mutlos und den völlig falschen Ansatz.” Die Batterietechnologie sei ein Kernelement für die kommenden Generationen an Kraftfahrzeugen. Man müsse Forschung und Entwicklung in diesem Bereich sogar ausbauen, wenn diese Schlüsselindustrie in Deutschland erhalten werden solle.
Für langjährige Forschungsthemen, denen im Anschluss üblicherweise erhebliche privatwirtschaftliche Investitionen folgen, sei Planbarkeit und Verlässlichkeit der Förderinstrumente essenziell. “Solche Fördermittel kurzfristig zur Disposition zu stellen, um Haushaltslöcher zu stopfen, ist für eine industrielle Standortentwicklung völlig kontraproduktiv”, sagte der Jenaer Politiker. Er hoffe, dass sich in den Haushaltsberatungen hier noch Spielraum ergebe.
Auch von der Opposition kommt deutliche Kritik: “Die Kürzungen bei der Batterieforschung zeugen von der inhaltlichen Teilnahmslosigkeit der Ministerin, die sich nur für ihre wenigen Steckenpferde – SPRIND und Kernfusion – zu interessieren scheint”, sagte die Linken-Forschungspolitikerin Petra Sitte auf Anfrage von Table.Briefings. Die Batterieforschung sei ganz wesentlicher Baustein im Hinblick auf die unumgängliche energetische Transformation der Gesellschaft. Kürzungen seien in diesem Bereich völlig fehl am Platze. In unterschiedliche Forschungsansätze zur Energiespeicherung sollte mindestens auf dem bisherigen Niveau investiert werden.
CDU-Forschungspolitiker Thomas Jarzombek lenkt den Blick auf die Folgen für die Fachkräfte in dem Bereich: “In den von den Kürzungen betroffenen Forschungseinrichtungen findet die Ausbildung von dringend benötigten Fachkräften statt.” Diesen Nachwuchsfachkräftepool würde die Regierungskoalition absehbar austrocknen. Der entstehende Schaden ließe sich nur noch sehr schwer beheben. Wer einmal gehe, komme selten wieder. “Die Folge ist, dass Talente Deutschland verlassen werden und damit die wichtige Kompetenz für uns verloren geht.”
Nicht nur bei der Batterieforschung, unter anderem auch beim Thema Wissenschaftskommunikation gibt es noch Diskussionsbedarf in der Ampel. Nach dem Auftakt im Bundestag werden die Gespräche im Haushaltsausschuss bis zur Bereinigungssitzung im November fortgeführt. mw
Intelligente Scheinwerfer, eine bildgebende KI und Energiespar-Chips sind die drei Projekte, die ins Rennen um den Deutschen Zukunftspreis 2024 gehen. Drei Forscherteams stellten im Deutschen Museum in München ihre für den Preis nominierten Entwicklungen vor, die bereits marktfähig sind. Die ausgewählten Forschenden kommen aus Bayern, Berlin sowie Nordrhein-Westfalen und Sachsen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verleiht den mit 250.000 Euro dotierten Preis am 27. November in Berlin.
Angesichts der Wahlergebnisse in Sachsen und Thüringen haben die Hochschulen in beiden Bundesländern für Weltoffenheit und gegen die Normalisierung von Rassismus plädiert. Sie seien stolz darauf, “dass an unseren Hochschulen Menschen aus aller Welt und mit den unterschiedlichsten Hintergründen studieren und arbeiten”, teilen die Landesrektorenkonferenz Sachsen, die Thüringer Landespräsidentenkonferenz und die Hochschulrektorenkonferenz in einer Erklärung mit. Dafür sei ein Umfeld erforderlich, “das den grundgesetzlich verbrieften Schutz vor Diskriminierung sicherstellt“.
Weiter heißt es: Alle Parteien und Bürgerinnen und Bürger seien dazu aufgerufen, sich dafür einzusetzen, dass Wissenschaftsfeindlichkeit, Einschränkungen der Wissenschaftsfreiheit, Rassismus, Intoleranz oder auf Ausgrenzung fußende Ideen oder Feindbilder nicht normalisiert werden. “Wir setzen uns weiterhin dafür ein, den Zusammenhalt in der Gesellschaft und das Vertrauen in die freiheitliche Demokratie zu stärken.”
In beiden Bundesländern hatte die AfD bei den Landtagswahlen am 1. September über 30 Prozent geholt. In Thüringen landete sie als stärkste Kraft vor der CDU, in Sachsen knapp hinter der Union. Das Bündnis Sahra Wagenknecht kam in beiden Ländern auf Rang drei. Den Namen von einzelnen Parteien nannten die Hochschulvertreter, die parteipolitisch neutral sein sollen, in ihrer Erklärung nicht. In der Erklärung pochten die Vertreter außerdem auf die Wahrung der Hochschulautonomie und der Wissenschaftsfreiheit. Nur so entfalte Wissenschaft ihr Potenzial für die Gesellschaft. “Weltoffenheit ist hierfür ein wichtiger Faktor. Nur eine Hochschule, die international denkt und handelt, ist zukunfts- und wettbewerbsfähig.”
Im Interview mit Table.Briefings hatte sich auch der Vorsitzende des Forschungsausschusses, Kai Gehring (Grüne), zuletzt besorgt über die Wahlergebnisse in den Bundesländern gezeigt. “Autoritarismus ist Gift für Wissenschaftsfreiheit und Innovationskraft. Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Akademien machen Bundesländer hochinnovativ, wettbewerbsfähig und sichern unser internationales Renommee”. Gleiches gelte für internationale Talente, die jetzt schon in Sachsen und Thüringen leben, arbeiten und forschen – und solche, die angesichts der AfD- und BSW-Erfolge diese Wissenschaftsstandorte künftig meiden könnten.
Auf die Frage, was die Politik tun könnte, um die progressiven Kräfte zu stärken, antwortete Gehring, dass eine sorgfältige Analyse folgen und auch wissenschaftliche Expertise zu der Entwicklung beleuchtet werden müsse. Die Ergebnisse seien kein Jugendproblem allein. “Gleichwohl sind die Zahlen bei Erstwählerinnen und -wählern besonders alarmierend. Das Verheerende ist, dass sowohl AfD als auch BSW gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse infrage stellen und Forschende mit Ideologievorwürfen überziehen”, sagte der Forschungspolitiker. Die AfD wolle missliebigen Forschungsfeldern die finanzielle Grundlage entziehen. Es brauche daher jetzt eine große Bildungs- und Demokratieoffensive. tg, nik (mit dpa)
Vergangene Woche wurde die jüngste Runde der Starting Grants des Europäischen Forschungsrates (ERC) bekannt gegeben. 494 Forscherinnen und Forscher erhielten Fördermittel, um ihre Ideen weiterzuentwickeln. Dies ist das 17. Jahr seit Einführung der Starting Grants, für die im Laufe der Jahre insgesamt 9,3 Milliarden Euro bereitgestellt wurden.
Die Erfolgsquote lag in diesem Jahr mit 14,2 Prozent etwas niedriger als im Vorjahr, als 14,8 Prozent der eingereichten Anträge gefördert wurden. Im Vergleich zu den Vorjahren ist sie jedoch in beiden Jahren gestiegen: Die durchschnittliche Erfolgsquote seit Beginn des Programms lag bei 11,3 Prozent, wobei 60.630 Anträge evaluiert und 6.868 für eine Förderung ausgewählt wurden.
Deutschland ist seit Beginn des Programms Spitzenreiter bei der Anzahl der beteiligten Gasteinrichtungen und der Gesamtfördersumme. Seit 2008 sind insgesamt 1,6 Milliarden Euro an ERC Starting Grants nach Deutschland geflossen, insgesamt wurden 1.095 Grants vergeben. Das Vereinigte Königreich liegt in diesem mehrjährigen Ranking an zweiter Stelle, was die Reputation des Landes vor dem Brexit widerspiegelt. Seit dem Brexit ist die Beteiligung Großbritanniens stark zurückgegangen.
Zum ersten Mal seit dem Brexit sind Forschende aus dem Vereinigten Königreich wieder uneingeschränkt antragsberechtigt. ERC-Präsidentin Maria Leptin sagte: “Ich freue mich ganz besonders, die britischen Forschenden wieder im ERC begrüßen zu können. Wir haben sie in den vergangenen Jahren schmerzlich vermisst. Mit fünfzig Grants, die an Forscher im Vereinigten Königreich vergeben werden, ist dieser Zustrom gut für die gesamte Forschungsgemeinschaft”.
Die “Starting Grants” richten sich an Forscherinnen und Forscher, deren Promotion zwei bis sieben Jahre zurückliegt. Mit einer Fördersumme von bis zu 1,5 Millionen Euro über einen Zeitraum von fünf Jahren pro Nachwuchswissenschaftlerin oder Nachwuchswissenschaftler können diese eine eigene Forschungsgruppe aufbauen. Der ERC schätzt, dass durch die neue Förderrunde über 3.000 Arbeitsplätze entstehen werden. mw
CHEManager: Forschungszulage steigt. Die chemisch-pharmazeutische Industrie profitiert von der Forschungszulage, wie eine Ende 2023 veröffentlichte Studie des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung zeigt. Mit über 1.500 Anträgen liegt die Branche auf Platz 4 der Antragsteller, hinter dem Maschinenbau (4.507 Anträge), der IT-Branche (4.270 Anträge) und der Elektro- und Messtechnik (1.733 Anträge). Einen zusätzlichen Schub soll die Forschungszulage nun durch das Wachstumschancengesetz erhalten. Seit dem 28. März dieses Jahres steigen die maximal möglichen jährlich zu beantragenden F&E-Kosten auf 10 Millionen Euro. Zudem werden KMU großzügiger gefördert: mit 35 % der projektbezogenen Personalkosten sowie 24,5 % der F&E-Auftragskosten, im Vergleich zu 25 % und 15 % in den Jahren zuvor. Dadurch erhöht sich für diese Unternehmen die maximale Zulage pro Jahr von einer Million Euro auf 3,5 Millionen Euro. (“Die Forschungszulage kommt an”)
Welt: Die Studierfähigkeit der Studenten. In den Schwanengesang des Niedergangs des Abiturs und der mangelnden Studierfähigkeit mag Ulrich Bartosch, der Präsident der Universität Passau, nicht einstimmen. Bartosch will genau hinschauen, wo die Probleme liegen, hütet sich vor Pauschalurteilen und blickt auch auf die Lebenswirklichkeit von Schülern. (“Das Problem mit der Studierfähigkeit von Studenten in Deutschland”)
FAZ: Hass auf den Westen. Mit Protest gegen die israelische Politik haben die seit dem 7. Oktober massiv zugenommenen antisemitischen Demonstrationen an den amerikanischen Universitäten nicht viel zu tun. Ihr Ziel ist es, das Hochschulsystem und den Westen zu vernichten. (“Ihr Ziel ist die Zerstörung der universitären Struktur”)
Forschung & Lehre: Wissenschaftsverlage tracken Daten. Wissenschaftsverlage tracken die Daten von Universitäten und Forschern und nutzen sie für ihre wirtschaftlichen Zwecke. Die Betroffenen haben nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten, einzusehen, ob und wie lange ihre Verhaltensdatenprofile gespeichert oder an andere Interessenten weitergeleitet werden. Zum einen sind die meisten Tracker bereits in den Medienbereitstellungsdiensten der Verlage integriert, zum anderen werden die Daten automatisiert an Dritte weitergeleitet. Datentracking ist auch in den Wissenschaften innerhalb weniger Jahre zu einer Routine der Verlage geworden und verstärkt die Machtasymmetrie zwischen Verlagen und Wissenschaften zusätzlich, anstatt sie abzubauen. (“Machtasymmetrie zwischen Verlagen und Wissenschaften”)
Tagesanzeiger: Roche eröffnet neues Forschungszentrum. Der Pharmakonzern Roche hat in Basel ein hochmodernes Forschungszentrum eröffnet, das als das fortschrittlichste weltweit gilt. Im neuen Zentrum für Forschung und frühe Entwicklung sind 1800 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tätig. Das Forschungszentrum umfasst vier Hochhäuser. (“Erste Einblicke in Roches neues Forschungs¬zentrum”)
Göttinger Tageblatt: Senat der Uni Göttingen will Präsident Tolan abwählen. Der Senat der Georg-August-Universität Göttingen will Uni-Präsident Professor Metin Tolan abwählen. Doch das ist nicht ganz so einfach. In jedem Fall muss die Arbeitsfähigkeit der Hochschule gewahrt bleiben und das Land kann im Zweifelsfall sogar einen Kommissar bestellen. (“Wie kann ein Uni-Präsident abgewählt werden – und wie ginge es dann weiter?”)

Fast alle wissen, dass sich an den deutschen Hochschulen Finanzierungsnöte ausbreiten. Fast alle sehen, dass sich der Wettbewerb um Projektfinanzierung überhitzt hat. Damit liegt es nahe, Fördermittel in die Grundfinanzierung zurückzuverlagern. Wie das gelingen kann, ist jedoch höchst umstritten.
Thorsten Wilhelmy hat die Exzellenzstrategie in diese Debatte gebracht; zugunsten besserer Breitenförderung solle das Programm eine Runde pausieren. Wilhelmy nennt auch unsere Initiative “Grundfinanzierung statt Projektwettbewerb”, in der wir ein lernendes Manifest zum Thema entwickeln. Er teilt jedoch nicht unsere Lösungsidee. Die heutigen Projektmittel wieder direkt in die Hochschulhaushalte zu leiten, erscheint ihm nicht machbar – die Landeshaushalte drohten das Geld nur zu schlucken, und eine Bundes-Grundfinanzierung verlange zu große rechtliche Umbauten. Stattdessen nimmt er den Vorschlag des Wissenschaftsrats auf, die Overhead-Pauschalen für Projekte zu erhöhen.
Diese Idee droht den Wettbewerb allerdings bloß andersartig anzuheizen. Ich möchte hier ausführen, dass nur eine wirkliche Wende zur Grundfinanzierung sinnvolle Exzellenz-Korrekturen verspricht. Da die politische Situation in den Ländern nicht einfacher wird, könnte sie auch zur Sicherung realer Wissenschaftsfreiheit beitragen.
Auf Wilhelmys Text haben an dieser Stelle Annette Schavan und Georg Schütte reagiert. Auch Edelgard Bulmahn wurde zum Thema befragt, geht auf die neueren Debatten jedoch kaum ein. Die anderen beiden teilen die verbreitete Problemsicht: Für Schavan sind die Hochschulfinanzen “angesichts sinkender Grundfinanzierung durch die Länder und […] wachsender Drittmittel durch den Bund fragil” geworden, und Schütte kennzeichnet die Gesamtlage als “überhitzt”. Die Lösungsvorschläge differieren jedoch gewaltig.
Annette Schavan empfiehlt keine Reformen – besonders nicht bei der Exzellenzstrategie. Der Exzellenztitel habe deutsche Standorte international viel bekannter gemacht; zudem habe das Programm Neuerungen wie den Europäischen Forschungsrat “inspiriert”. Zu klären bleibt, ob man nicht auch preiswerter sichtbar werden kann und wozu es noch weitere Einrichtungen braucht, die viele Anträge anlocken, um wenige Vorzeigeforschung zu fördern.
Schavan weist aber zu Recht darauf hin, dass auch Wilhelmys Vorschlag die Logik der Kurzfristigkeit fortsetzt: Sonderforschungsbereiche sind nicht nachhaltiger als Exzellenzcluster. Und erhöhte Pauschalen würden das Projektgeschäft zunächst attraktiver machen, bevor vielleicht einige ganz aufgeben. Gute Vorschläge sind im gegebenen Rahmen nicht zu erkennen.
Ein anderer Ansatz bestünde darin, die Projektfinanzierung zur inhaltlichen Steuerung zu nutzen. Georg Schütte argumentiert dafür, die Wissenschaft so auf Probleme der Zeit auszurichten. Auch Bulmahn scheint den Ansatz zu teilen, wenn sie für “Forschungscluster” zu “Klimawandel […], Global Health und KI” wirbt. Die Exzellenzstrategie ist allerdings nicht spezifisch auf diese Themen ausgerichtet. Zugleich wird Forschung nicht unbedingt besser, wenn Ministerien und Stifter sie in großen Programmlinien fördern. Die politischen Vorgaben werden oft als bloße Fördergelegenheit gesehen.
Schütte selbst nennt abgesehen von “Schlüsseltechnologien” ausgerechnet Probleme, die gar keine Spitzenforschung brauchen: “Wir müssen fragen, wer die Lehrkräfte ausbilden soll, die unseren Kindern zukunftsorientiertes Fachwissen vermitteln und sie zu mündigen Staatsbürgerinnen und -bürgern bilden. Und wo und wie wir Vorsorge treffen für das Unbekannte […], wie das System also resilienter wird.” Alles das ist sicher nötig – aber am besten durch Lehre und Forschung in der Breite zu leisten.
Verlässliche Grundfinanzierung könnte auch Spitzenforschung ermöglichen. Viel mehr als dauerhaft beschäftigtes wissenschaftliches Personal, das Zeitressourcen für Forschung hat, bei Interesse Kooperationen eingeht und bei Gelegenheit Sachmittel beantragen kann, ist dafür nicht nötig.
Auch Edelgard Bulmahn schlägt eine Grundfinanzierungsbeteiligung des Bundes vor. Sie hat allerdings schon zu ihrer Zeit als Ministerin gezeigt, dass man mit viel Geld auch viel Unheil anrichten kann, namentlich eine projektgetriebene Explosion prekärer Beschäftigung. Die genauere Ausführung der Alternativen überlasse ich unserem lernenden Manifest, in dem wir das Genre Projekt als freiwillige Kooperation neu zu definieren vorschlagen. Konkrete Vorschläge dazu konnten wir bei zwei Diskussionen im Frühjahr einholen, und spätestens, wenn wir das Papier im Oktober abschließend mit Vertreter*innen der demokratischen Parteien diskutieren, stehen Änderungen und Konkretisierungen an.
Statt dem vorzugreifen, will ich zwei eigene Überlegungen zur Umwidmung der Exzellenzmittel in die Debatte bringen und eine neue Initiative zur Exzellenzstrategie ankündigen:
Schließlich will ich eine weitere Initiative erwähnen, die verschiedenen Positionen zur Exzellenzstrategie Raum bietet. Das Netzwerk Nachhaltige Wissenschaft, in dem sich reforminteressierte Profs organisieren, hat gerade einen Brief mit kritischen Fragen zur Exzellenzstrategie an die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz, die Deutsche Forschungsgemeinschaft und den Wissenschaftsrat geschickt. Hier geht es nicht nur um das Ob, sondern auch um das Wie der Auswahl und Förderung. Wir werden den Brief im Oktober veröffentlichen – mit oder ohne Antworten.
Zur Person: Tilman Reitz ist seit 2015 Professor für Wissenssoziologie und Gesellschaftstheorie an der Universität Jena. Er engagiert sich im Netzwerk für Gute Arbeit in der Wissenschaft (NGAWiss) und im Netzwerk Nachhaltige Wissenschaft. An der Initiative Grundfinanzierung statt Projektwettbewerb beteiligen sich neben NGAWiss auch DGB, GEW, Verdi, die Deutsche Gesellschaft Juniorprofessur und der Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.
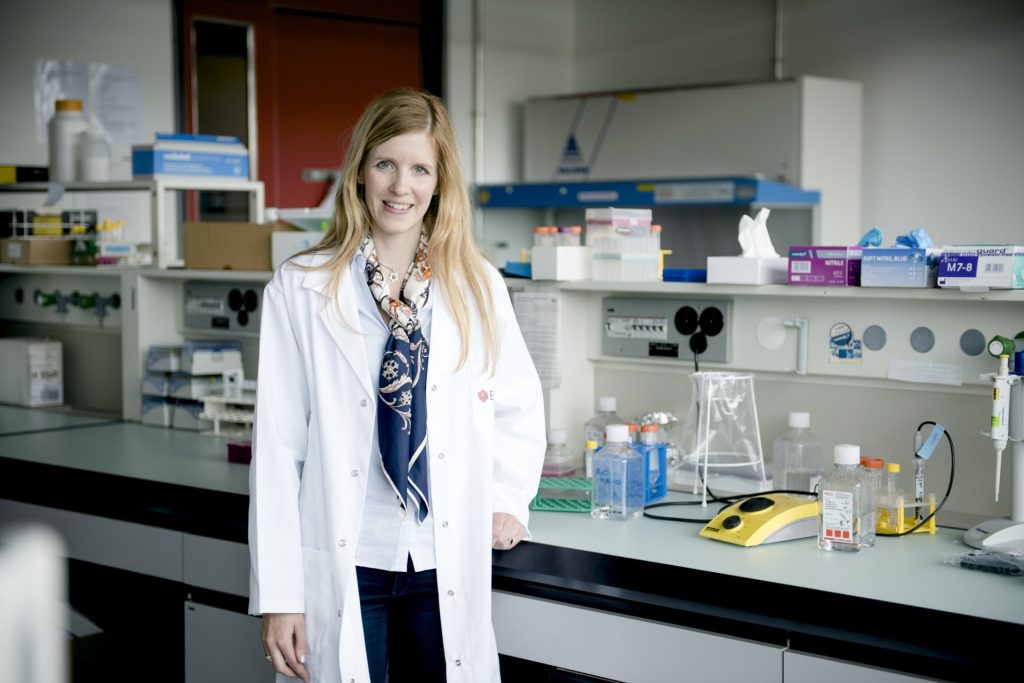
Die Wissenschaftsgeschichte ist voller Anekdoten über Geistesblitze. Manche Forscher hatten einen in der Badewanne (Archimedes zum Prinzip des Auftriebs), andere unter einem Baum (Newton, Stichwort Schwerkraft) und wieder andere in der Tram (Einstein und die Relativitätstheorie). Chirurgie-Kongresse waren bisher eher nicht als Orte der Inspiration bekannt. Zu Unrecht: Die Chemikerin Inge Herrmann, beim diesjährigen Falling Walls Science Summit nominiert für den Women’s Impact Award, kommt nämlich genau auf solchen Fachtagungen zu neuen Forschungsideen.
“Wenn ich da in den Weiterbildungen sitze, fallen mir beim Zuhören viele neue Probleme auf, für die ich eine Lösung zu finden suche”, sagte Herrmann kürzlich dem St. Galler Tagblatt. Gäbe es einen Preis für Unterstatement in der Medizinforschung, könnte Herrmann mit dem Satz gleich noch eine Auszeichnung gewinnen. Denn tatsächlich sucht die Schweizer Professorin nicht einfach nur nach Lösungen, zusammen mit ihrem Team findet sie diese auch – und das fast schon am Fließband.

In diesem Sommer etwa erfand das Team Herrmann ein Implantat aus Hydrogel, das Frauen mit Endometriose hilft und zugleich als Verhütungsmittel eingesetzt werden kann. Weltweit leiden etwa 190 Millionen Frauen an der schmerzhaften Krankheit, in Deutschland sollen es allein zwei Millionen sein. Bei ihnen gelangt während der Menstruation Blut über die Eileiter in die Bauchhöhle. Das Blut transportiert Zellen der Gebärmutterschleimhaut, die wiederum Entzündungen provozieren. Mit dem Hydrogel könnten die Eileiter blockiert und die Entstehung und Ausbreitung von Endometriose verhindert werden.
Auch wenn es bis zur Marktreife noch dauern wird, das Patent ist angemeldet. Im Juli berichteten Medien international über die Entdeckung und das Team dahinter. In der Wissenschaft war Inge Herrmanns Team zu dem Zeitpunkt längst bekannt. Anfang 2024 machte es mit einer Lasertechnologie zum Verschluss offener Wunden von sich Reden. Davor erfand es ein Darmpflaster, das Alarmsignale aussendet, wenn dies durchlässig zu werden droht.
Herrmann arbeitet bevorzugt dort, wo andere aufhören: an der Schnittstelle zwischen Chemie, Materialwissenschaft, Ingenieurswesen und Medizin. Dort erobert sie Neuland für die Wissenschaft. Die Schlüssel dorthin sind für sie Vielfalt im Team und intensive Gespräche mit Menschen aus komplett anderen Branchen – das kann auch am Tisch mit Freunden beim Essen sein.
Die Kommunikation über Disziplinen und Branchen hinweg ist natürlich anspruchsvoll, sie kostet Zeit und Energie. “Die Komfortzone ist nicht der Ort, an dem Magie passiert”, lautet Herrmanns Motto. Ihr Engagement für die Wissenschaft zeigt sich auch in ihrem Lebenslauf: Geboren 1985, studierte sie ab 2003 Chemieingenieurwesen an der ETH Zürich und der TU Delft, um schon sechs Jahre später in ihrer Doktorarbeit ein magnetbasiertes Verfahren zur Blutreinigung zu präsentieren, das später in Harvard weiterentwickelt wurde.
Nach Forschungsstationen in den USA (University of Illinois, Chicago) und UK (Imperial College London) kam sie 2015 zurück in die Schweiz. Mittlerweile ist Herrmann nicht nur Professorin an der Uni Zürich und Dozentin an der ETH Zürich. Sie leitet zudem ein Team am Materialwissenschaftslabor der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa). Und – seit September 2023 – ist sie nun auch Chefin des Ingenuity Lab an der Uniklinik Balgrist in Zürich. Das Lab will Materialinnovationen in die Klinik bringen.
Vier Hüte auf einem Kopf – wie geht das? Herrmanns Antwort ist verblüffend einfach: So lasse sie Promovierenden und Postdocs möglichst viel Freiraum und unterstütze nur dort, wo es nötig sei. Start-ups überlässt sie lieber den Forschenden im Team. Und auch bei Publikationen steht ihr Name eben längst nicht immer an erster Stelle. Erstautor der Endometriose-Studie zum Beispiel ist Alexandre Anthis. Christine Prußky
Beim Falling Walls Science Summit in Berlin wird am 9. November verkündet, wer den Women’s Impact Award erhält. Inge Katrin Herrmann ist eine von drei Nominierten. Weitere Porträts der Table.Briefings-Serie “Breakthrough-Minds” zum Falling Walls Science Summit 2024 lesen Sie hier.
Cano Costard, Challenge Officer der Bundesagentur für Sprunginnovationen SPRIND, gehört zu den Gewinnern der ersten MSA Challenge Awards der University of Chicago. Er wird für die Entwicklung eines Advance Market Commitment für antivirale Breitbandmedikamente ausgezeichnet. Mit dem Gewinn des Wettbewerbs ist ein Preisgeld in Höhe von 290.000 US-Dollar für SPRIND verbunden.
Hendrik Dietz, Biophysiker an der TU München, ist mit der Otto-Meyerhof-Medaille des Max-Planck-Instituts für medizinische Forschung in Heidelberg ausgezeichnet worden. Ihm ist es gelungen, physikalische Prinzipien nanoskopischer, molekularer Bausteine in medizinisch relevante Anwendungen zu bringen. Die Medaille wird seit 2021 in Gedenken an den Nobelpreisträger Otto Meyerhof verliehen.
Michael N. Hall vom Biozentrum der Universität Basel, der Kriminologe John Braithwaite von der Australian National University, die Wissenschaftshistorikerin Lorraine Daston, Direktorin am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, und der amerikanische Chemiker Omar Yaghi von der University of California Berkeley sind die Preisträger des Balzan-Preises 2024. Die Preise werden in diesem Jahr für Forschungsgebiete von der Rechtswissenschaft bis zur Wissenschaftsgeschichte und von der Biologie des Alterns bis zu innovativen Materialien vergeben. Sie sind mit je 750.000 Franken dotiert. Erwartet wird, dass die Preisträgerinnen und Preisträger die Hälfte des Preisgeldes für die Finanzierung von Forschungsprojekten verwenden, an denen eine neue Generation von Nachwuchsforschenden beteiligt ist.
Andrea Hänger, Vizepräsidentin des Bundesarchivs in Koblenz, wurde von der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern (GWK) als neues Mitglied in den Rat für Informationsinfrastrukturen (RfII) berufen. Dieser berät Bund, Länder und Wissenschaftseinrichtungen bei der Weiterentwicklung wissenschaftlicher Informationsinfrastrukturen und zu verwandten Themen des digitalen Wandels in der Wissenschaft.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an research@table.media!
China.Table. Tech-Krieg: So schnell holt China bei den Chip-Fähigkeiten auf. China beschleunigt den Ausbau seiner Mikroprozessor-Fähigkeiten trotz westlicher Sanktionen. Es geschehen zwar keine Wunder, doch die “De-Amerikanisierung” kommt dank massiver Investitionen voran. Der Fokus liegt auf der Produktion großer Mengen ausreichend guter Chips. Mehr
Europe.Table. Industriepolitik: Was der BDI fordert, um den Standort Deutschland zu sichern. Der BDI sieht einen Investitionsbedarf von 1,4 Billionen Euro bis 2030, um den Industriestandort Deutschland zu retten. Eine Studie sieht sonst rund 20 Prozent der deutschen Industrie gefährdet. Mehr
Bildung.Table. BIBB-Präsident: Warum es Kritik am Verfahren der Neubesetzung gibt. Der aktuelle BIBB-Präsident, Friedrich Hubert Esser, tritt nach über einem Jahrzehnt im Juni 2025 ab. Jetzt muss sein Nachfolger gefunden werden. Arbeitgeber und Arbeitnehmer hätten sich dabei mehr Beteiligung gewünscht, als das BMBF sie jetzt vorsieht. Mehr
Europe.Table. EU-Batterieverordnung: VDA-Präsidentin Müller wirft Regierung Untätigkeit vor. VDA-Präsidentin Hildegard Müller kritisiert die Bundesregierung massiv im Zusammenhang mit einem Rechtsakt zur EU-Batterieverordnung. Wenn dieser nicht korrigiert werde, drohe deutschen Unternehmen ein massiver Standort- und Wettbewerbsnachteil. Mehr
Climate.Table. Investitionen: So viele Milliarden brauchen die deutschen Klimaziele. Etwa 340 Milliarden Euro mehr als bisher geplant müsste der Staat in Deutschland investieren, um seine Klimaziele zu erreichen, hat eine Studie errechnet. Und das ginge sogar teilweise mit einer Schuldenbremse. Das Thema soll vor der Bundestagswahl debattiert werden. Mehr

Für eine forschungspolitische Meldung hat es nicht gereicht: Das TV-Duell zur US-Präsidentschaft zwischen Kamala Harris und Donald Trump war (nicht nur) aus Sicht der Wissenschaft ernüchternd. Im Wahlkampf der Weltmacht USA wird darüber gesprochen, ob Migranten aus Haiti Haustiere essen oder Demokraten geborene Babys exekutieren, aber kaum ein Wort über die zukünftigen Linien der Forschungs- und Innovationspolitik, über Fachkräfte oder die Ausbildung des Nachwuchses. Wenn’s nicht so gefährlich wäre, man müsste laut lachen.
Frei nach der Watzlawickschen Theorie: Man kann nicht nicht über Wissenschaft kommunizieren, wollten wir das Duell aber trotzdem nicht unerwähnt lassen und damit hat die USA es zumindest in unser Dessert geschafft. So richtig ernst nehmen kann man es ja auch alles nicht mehr. Während man bei Trump nicht zwischen den Zeilen lesen muss, um zu verstehen, wie wenig er auf wissenschaftliche Faktentreue und Erkenntnisgewinn setzt, hatte Kamala Harris zumindest einige innovationspolitische Ziele durchblitzen lassen.
“Das bedeutet, [… ] dass wir uns auf die Beziehungen mit unseren Verbündeten konzentrieren, dass wir uns auf Investitionen in amerikanische Technologie konzentrieren, damit wir das Rennen bei der künstlichen Intelligenz und Quantencomputing gewinnen, und dass wir uns darauf konzentrieren, was wir tun müssen, um Amerikas Arbeitskräfte zu unterstützen”, sagte Harris kämpferisch. “Unsere Politik gegenüber China sollte darauf ausgerichtet sein, dass die Vereinigten Staaten von Amerika den Wettbewerb des 21. Jahrhundert gewinnen.”
Wie zukunftsgewandt die Auffassung beider Kandidaten ist, weiterhin Erdgas-Fracking erlauben zu wollen, sei mit Blick auf das globale Rennen um moderne Klimatechnologien dahingestellt. Wenn es noch Beweise brauchte, dass Deutschland Harris ganz feste die Daumen drücken sollte, liefert sie Trump, als er Ungarns Viktor Orbán den starken Mann Europas nannte und Germany gleich zweimal abkanzelte. Biden habe Deutschland erlaubt, die Nord-Stream-Pipeline zu bauen und Europa damit abhängiger von Russland gemacht (darüber lässt sich immerhin streiten).
Außerdem habe Deutschland versucht, erneuerbare Energien auszubauen und weniger fossile Brennstoffe zu nutzen, sei aber damit gescheitert. “Innerhalb eines Jahres wurde wieder mit dem Bau normaler Kraftwerke begonnen”, fabulierte Trump. Bleibt (nicht nur) aus forschungspolitischer Perspektive zu hoffen, dass Trump mit dem Ansinnen einer zweiten Amtszeit scheitert und in den USA dann bald wieder normale Politik gemacht wird. Oder um es mit den Worten von Kamala Harris zu sagen: “It’s time to turn the page”. Tim Gabel
in den heutigen Beratungen zum Haushalt steht der Etat des BMBF auf der Tagesordnung. Wichtiges Thema: die Zukunft der Batterieforschung in Deutschland. Wie mein Kollege Markus Weisskopf berichtete, könnte es für den Forschungszweig doch schlimmer kommen als gedacht. Nachdem für 2025 noch 118 Millionen Euro Förderung im Klima- und Transformationsfonds (KTF) verankert sind, ist danach anscheinend Schluss mit der Bundesförderung. Das bedeutet, dass das BMBF nur noch bestehende Projekte bis zum Ende der Projektlaufzeit finanzieren, aber keine neuen mehr anstoßen kann.
Kurz vor der Haushaltsdebatte wird diese Planung jetzt auch koalitionsintern heftig kritisiert. Der SPD-Forschungspolitiker Holger Becker hält “diese Vorgehensweise für mutlos und den völlig falschen Ansatz”. Auch die Opposition meldet sich lautstark zu Wort. Gibt es noch Hoffnung für die Batterieforschung?
In unserer Serie “Breakthrough-Minds” stellen wir heute die Chemikerin Inge Katrin Herrmann vor. Der Professorin an der Uni Zürich gelingt regelmäßig, ihr Wissen effektiv in Produkte und Patente zu transferieren. Schon als Studentin entwickelte die Schweizerin ein magnetbasiertes Verfahren zur Blutreinigung. Später erfand sie ein effektives Wund-Verschluss-Verfahren per Lasertechnologie und ein Implantat aus Hydrogel, das Frauen mit Endometriose hilft – zugleich kann es als Verhütungsmittel eingesetzt werden.
Von Anfang an arbeitete Herrmann dabei an der Schnittstelle von Chemie, Materialwissenschaft, Ingenieurwesen und Medizin. Die Kommunikation über Disziplinen hinweg sei natürlich anspruchsvoll und kostet Zeit und Energie, sagt sie. Doch die Vielfalt ihrer Teams und die intensiven Gespräche mit Menschen aus komplett anderen Branchen sei ein Schlüssel für ihren Erfolg. “Die Komfortzone ist nicht der Ort, an dem Magie passiert”, sagt Herrmann.
Ich wünsche Ihnen einen zauberhaften Start in den Tag,


Es ist die Forderung nach einem großen Wurf: Der Bericht des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten und EZB-Präsidenten Mario Draghi drängt auf eine Verdoppelung des EU-Forschungs- und Innovationsbudgets auf 200 Milliarden Euro für das nächste siebenjährige Rahmenprogramm von 2028 bis 2034. Gleichzeitig wird in dem Papier konstatiert, dass das derzeitige Programm Horizont Europa für viele Antragsteller zu schwierig zu handhaben sei. Öffentlich-private Partnerschaften seien bislang ineffizient organisiert und bei einem der wichtigsten Geldgeber für innovative Unternehmen, dem Europäischen Innovationsrat (EIC), seien ebenfalls weitreichende Änderungen erforderlich.
Würden alle Änderungen des Draghi-Berichts umgesetzt, würde das einer kleinen Revolution in der EU-Forschungspolitik gleichkommen. Die Bedeutung des Berichts ergibt sich einerseits aus dem Renommee des Autors und andererseits aus dem Zeitpunkt, zu dem das neue Europäische Parlament und die neue Kommission in diesem Herbst ihre Arbeit aufnehmen. Sie könnten eine umfassende Überarbeitung der EU-Politik für die Industrie und die Wettbewerbsfähigkeit angehen. Angesichts der ausgabenfreundlichen Botschaften des Papiers ist es nicht überraschend, dass viele aus der FuE-Lobby mit Lob auf den Bericht reagierten – auf die Kritikpunkte des Berichts gab es jedoch kaum unmittelbare Reaktionen.
Draghi verweist auf das seit langem bestehende Problem, dass es Europa nicht gelingt, Innovationen in kommerzielle Produkte umzusetzen, während viele der innovativsten Start-ups aufgrund der regulatorischen Hürden in der EU lieber Risikokapital und Wachstumsmöglichkeiten in den USA suchen. “Europa muss ein Ort werden, an dem die Innovation floriert, insbesondere im Bereich der digitalen Technologie. Ein schwacher Technologiesektor […] wird uns nicht nur der Wachstumschancen der kommenden KI-Revolution berauben, sondern auch die Innovation in unseren traditionellen Sektoren behindern”, sagte er vor Journalisten bei einem Briefing zum Bericht.
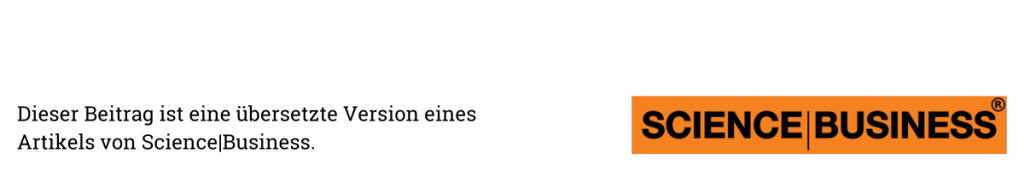
Der Bericht befürwortet eine deutliche Erhöhung der EU-F&I-Ausgaben – vorausgesetzt allerdings, die Programme werden strukturell geändert: “Unter der Bedingung, dass Reformen durchgeführt werden, sollte das Budget des neuen Rahmenprogramms auf 200 Milliarden Euro für die sieben Jahre ab 2028 verdoppelt werden”, heißt es in dem Papier. Zudem sieht der Bericht das Pathfinder-Programm des Europäischen Innovationsrats, das bahnbrechende Innovationen auf niedrigem technologischen Niveau unterstützt, zu schlecht ausgestattet. Das Budget von 250 Millionen Euro für 2024, sei viel weniger als bei ähnlichen Agenturen etwa in den USA. Zudem sei es meist von EU-Beamten und nicht von Spitzenwissenschaftlern und Innovationsexperten geleitet.
Das nächste EU-Forschungsrahmenprogramm sollte sich, laut dem Bericht, auf eine geringere Anzahl von Prioritäten konzentrieren, wobei ein größerer Anteil des Budgets für Sprunginnovationen verwendet werden sollte. Um dies zu überwachen, empfiehlt der Bericht eine Reform des EIC nach dem Vorbild der US-amerikanischen Advanced Research Project Agencies (ARPAs), die risikoreiche Projekte unterstützen. Auch das Antragsverfahren sollte schneller und weniger bürokratisch sein, und das Programm sollte von Projektmanagern verwaltet werden.
Ein Teil des EU-Innovationsproblems liegt dem Draghi-Bericht zufolge in der Aufsplitterung der öffentlichen Ausgaben für Forschung und Innovation auf die einzelnen Mitgliedstaaten, wobei nur ein Zehntel der Gesamtausgaben in Brüssel über EU-weite Programme verwaltet wird. Draghi fordert die Schaffung einer “Forschungs- und Innovationsunion”, um eine besser koordinierte F&I-Strategie zu ermöglichen, obwohl unklar ist, was dies bedeuten würde.
Zwei Jahrzehnte, nachdem die EU den Mitgliedstaaten das Ziel gesetzt hat, die öffentlichen und privaten FuE-Ausgaben auf mindestens 3 Prozent des BIP zu erhöhen, liegt der EU-Durchschnitt immer noch bei 2,2 Prozent. Draghi fordert die EU auf, ihr Engagement für dieses Ziel “innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens” zu bekräftigen. Auf die Frage, ob die Mitgliedsstaaten das 3-Prozent-Ziel verfehlt hätten, sagte Draghi: “Wir haben verkündet, dass Innovation im Mittelpunkt unseres Handelns steht, und dann haben wir im Grunde alles getan, was wir konnten, um sie auf einem niedrigen Niveau zu halten.”
Zu den Innovationshemmnissen in Europa gehört die “mittelfristige Technologiefalle” – eine Wirtschaft, die sich auf reife Sektoren, insbesondere die Automobilindustrie, stützt und durch geringe Innovation und niedrige Produktivität gekennzeichnet ist. In den USA war das Bild in den frühen 2000er Jahren ähnlich, aber heute kommen die Top-Investoren in Forschung und Entwicklung in den USA nicht aus der Automobilindustrie, sondern aus dem Technologiesektor. Im Ergebnis hätten EU-Unternehmen im Jahr 2021 im Verhältnis zum BIP etwa halb so viel für Forschung und Entwicklung ausgeben wie US-Unternehmen.
Auch im Bereich Grundlagenforschung droht die EU, laut dem Draghi-Bericht, den Anschluss zu verlieren. Nur drei Institutionen in der EU tauchen unter den Top-50 der Einrichtungen auf, die die meisten Publikationen in den führenden wissenschaftlichen Fachzeitschriften unterbringen. Im Vergleich dazu finden sich in der Rangliste 15 chinesische Einrichtungen und 21 aus den USA. Zudem gebe es keine führenden Innovationscluster, die die Kommerzialisierung von Sprunginnovationen vorantreibe.
Der Bericht empfiehlt, die Unterstützung für die Grundlagenforschung durch den Europäischen Forschungsrat (ERC) zu verdoppeln und ein “auf Exzellenz basierendes, stark wettbewerbsorientiertes ‘ERC for Institutions’-Programm” einzuführen, um akademischen Einrichtungen mehr Mittel zur Verfügung zu stellen, und einen “EU-Lehrstuhl” einzurichten, um Spitzenwissenschaftler zu halten, indem sie als europäische Beamte eingestellt werden.
Draghi möchte zudem den Transfer ankurbeln, indem er auf ein “neues Konzept für eine faire und transparente Aufteilung der Lizenzgebühren” zwischen Forschern und ihren Einrichtungen drängt, das Einheitspatent in allen EU-Mitgliedstaaten einführt und es Unternehmen ermöglicht, den EU-weiten Status eines “innovativen europäischen Unternehmens” anzunehmen. Dem Bericht zufolge hindert ein fragmentierter Binnenmarkt innovative Unternehmen daran, sich in Europa zu vergrößern.
Während der Pressekonferenz warf Draghi der EU vor, den Technologiesektor mit komplexen Gesetzen wie dem AI Act und der General Data Protection Regulation (GDPR) zu stark zu regulieren. Diese sollen die US-Tech-Giganten regulieren, behindern aber letztlich kleine EU-Firmen, die es sich nicht leisten können, Personal einzustellen, um die Vorschriften zu erfüllen. “Wir bringen unsere kleinen Unternehmen um”, sagte er.
Draghis Bericht ist der zweite einflussreiche Bericht in den letzten Monaten, der sich mit den wichtigsten Herausforderungen in Bezug auf Wettbewerbsfähigkeit und Innovation befasst. Im April veröffentlichte ein anderer ehemaliger italienischer Ministerpräsident, Enrico Letta, seine Empfehlungen für die Zukunft des EU-Binnenmarktes, darunter die Schaffung einer “fünften Freiheit”, die dem freien Verkehr von Forschung, Innovation, Wissen und Bildung gewidmet ist. Martin Greenacre and Eleonora Francica

Die zweite Befragung Bettina Stark-Watzingers zur Fördermittelaffäre im Forschungsausschuss hat diese nicht zu einem Ende führen können. Für die Koalitionspartner der FDP stellte sich nach dem Treffen am Dienstagmorgen die Frage, wie lange sie die immer noch ungeklärte Situation um mögliche fördermittelrechtliche Prüfungen kritischer Wissenschaftler durch das BMBF noch mittragen wollen.
“Nach dieser Ausschusssitzung sind wir als Parlament eigentlich genauso schlau wie vorher”, kritisiert Oliver Kaczmarek (SPD) überraschend deutlich. Der Obmann im Forschungsausschuss moniert erneut eine unzureichende Transparenz seitens der BMBF-Spitze: Offene Fragen, die sich aus vorgelegten und nicht vorgelegten Unterlagen ergeben haben, seien durch die Ministerin nicht ausgeräumt worden.
Dabei gehe es doch um die wichtigste Währung für eine belastbare Wissenschaftspolitik, nämlich die Glaubwürdigkeit im Umgang mit der Wissenschaftsfreiheit und den Ausschluss der politischen Einflussnahme darauf. “Umso weniger kann ich verstehen, dass dem Ausschuss weiterhin nicht alle Akten und Chats zur Verfügung gestellt werden. Das lässt leider weiterhin viel Raum für Spekulationen.”
Bettina Stark-Watzinger hatte zu Beginn der Sitzung ein knappes Statement vorgetragen, in dem sie erneut erklärte, von den umstrittenen Prüfaufträgen nicht gewusst zu haben. Sie wiederholte frühere Aussagen wie “Ich habe den betreffenden Auftrag, förderrechtliche Konsequenzen prüfen zu lassen, nicht erteilt und auch nicht gewollt”. Dabei übte sie auch Kritik: Während der Ausschuss sich erneut mit längst aufgeklärten und wiederholt erörterten Sachverhalten beschäftige, drehe sich “die Welt um uns herum weiter”, erklärte Stark-Watzinger. Und verwies auf offene Fragen zum Thema Antisemitismus auch an den Hochschulen.
Nicht nur die SPD, auch die CDU-Opposition zeigt sich enttäuscht vom Sitzungsverlauf. “Die Ministerin hat durch ihren Auftritt weiter viel Vertrauen verspielt”, sagt Thomas Jarzombek. Auf wesentliche Fragen gab es keine Antworten. So stehe etwa die Frage im Raum, ob die Ministerin ein System der Schattenkommunikation in ihrem Haus aufgebaut hat. Außerdem wollten Jarzombek und seine Parteikollegen Stephan Albani und Ingeborg Grässle wissen:
Bettina Stark-Watzinger sprach von “falschen Behauptungen” durch Jarzombek, wie von “Unterstellungen und Spekulationen” durch “interessierte Kreise”. Ria Schröder (FDP) sprang ihrer Parteikollegin bei. “Auch heute haben Sie wieder versucht, möglichst viel Dreck zu werfen in der Hoffnung, dass etwas hängenbleibt”, erklärt sie in Richtung Jarzombeks. “Sie gerieren sich wie ein Staatsanwalt, aber haben gar keinen Wahrheitsanspruch.”
Am Ende von vier Fragerunden wirkten alle Beteiligten ernüchtert. Während Bettina Stark-Watzinger bis zum Schluss immer wieder auf ihr Eingangsstatement verwies, oder auf die Verschwiegenheitspflicht der frühzeitig entlassenen Staatssekretärin Döring, wiederholten die Abgeordneten ebenso gebetsmühlenartig, dass die Ministerin doch bitte endlich auf ihre Fragen antworten solle. Selbst die Abgeordnete der Linken verwies zweimal auf die Fragen Jarzombeks und bat um Beantwortung.
Gewöhnungsbedürftig wirkt eine Aussage Anja Reinalters nach Ende der Sitzung. Die Ministerin habe den Abgeordneten in der Befragung ihr Wort geben und “garantiert, dass in Bezug auf die Fördermittelaffäre nichts Weiteres veranlasst wurde, was Zweifel am Umgang mit der Wissenschaftsfreiheit im BMBF aufkommen lassen könnte”, erklärte die forschungspolitische Sprecherin der Grünen. Diese Versicherung sei für die Grünen nun die Grundlage, gemeinsam nach vorne zu schauen. “Wir haben uns als Koalition noch viel vorgenommen, was wir wissenschafts- und bildungspolitisch erreichen wollen.”
Für einen Koalitionspartner ist die Fördermittelaffäre damit offenbar beendet. Nicht nur die ungeklärten Fragen vieler Politiker, die weiter bestehende Kritik an der Ministerin aus der Wissenschafts-Community und nicht zuletzt der Blick auf noch diverse laufende Gerichtsverfahren lassen annehmen, dass in der Sache noch lange kein Abschluss gefunden ist. Tatsächlich hat das BMBF eine Anfrage der Plattform FragDenStaat auf Akten-Einsicht abgelehnt. Die Aktivisten der Plattform für Informationsfreiheit werden jetzt auf Herausgabe der Wire-Nachrichten aus der BMBF-Chat-Gruppe klagen, wie sie Table.Briefings am Dienstag bestätigen.
Auch erste Forderungen nach weiteren Schritten werden laut. “Die Ministerin hält Akten unter Verschluss und hat der im Zuge der Affäre entlassenen Staatssekretärin Sabine Döring einen Maulkorb verpasst”, sagte Andreas Keller, stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Es sei Zeit, einen Untersuchungsausschuss zur Fördergeldaffäre einzurichten.
12. September 2024, 18:00 Uhr, Table.Briefings, Wöhlertstr. 12-13, 10115 Berlin
Salon des Berlin Institute for Scholarly Publishing BISP Salon I: The Changing Geography of Global Research Mehr
12./13. September 2024, FU Berlin
Jahrestagung des Netzwerks Wissenschaftsmanagement Für Freiheit in Krisenzeiten. Perspektiven aus dem Wissenschaftsmanagement Mehr
12. – 15. September 2024, Potsdam
133. Versammlung der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte Wissenschaft für unser Leben von morgen Mehr
18. September 2024, Alte Münze, Berlin
InnoNation Festival Scaling Solutions Mehr
19. September 2024, ab 11 Uhr, Körber-Stiftung, Hamburg
Hamburg Science Summit 2024 “Europe’s Path Towards Tech Sovereignty” Mehr
19.-21. September 2024, Bauhaus-Universität Weimar
66. Jahrestagung der Kanzlerinnen und Kanzler der deutschen Universitäten Hochschulbau trotz/t Krisen Mehr
24. September 2024, 10:30 bis 16:15 Uhr, Haus der Commerzbank, Pariser Platz 1, 10117 Berlin
Forum Hochschulräte Starke Marken, klarer Kern: Strategische Schwerpunktsetzung und Markenbildung bei Hochschulen Mehr
25. September 2024, 8:00 bis 9:15 Uhr im BASECAMP, Mittelstraße 51-53, 10117 Berlin
Frühstücks-Austausch: Gipfel für Forschung und Innovation Follow-up Innovationen in Europa – Katalysatoren, Kompetenzen und Kooperationen am Beispiel von KI: Gespräch über Umsetzungsschritte für mehr Geschwindigkeit bei Innovation und Forschung Zur Anmeldung
25. September 2024, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU)
Jahreskolloquium des Bayerischen Wissenschaftsforums Transformationskompetenz in Wissenschaft und Hochschule Mehr
26. September 2024, 12:00 bis 13:00 Uhr, Webinar
CHE talk feat. DAAD KIWi Connect Transfer und Internationalisierung – Warum ist es sinnvoll, beides gemeinsam zu denken und was braucht es hierzu? Mehr
26./27. September 2024, Leopoldina, Jägerberg 1, 06108 Halle (Saale) und Online
Jahresversammlung 2024 der Leopoldina Ursprung und Beginn des Lebens Mehr
1. Oktober 2024, 19 Uhr, Bricks Club Berlin
Gesprächsreihe der Wübben Stiftung Wissenschaft in Kooperation mit der Jungen Akademie Christopher Degelmann: Fake News und Fleischkonsum in der Antike Mehr
3. /4. Oktober 2024, Universität Helsinki, Finnland
2024 EUA FUNDING FORUM Sense & sustainability: future paths for university finances Mehr
8. /9. Oktober 2024 an der TU Berlin
bundesweite Tagung zu Machtmissbrauch an Hochschulen “Our UNIverse: Empowered to speak up” Mehr
10. Oktober 2024 an der TUM School of Management, München
Konferenz AI@WORK – How AI is changing leadership, work and collaboration Mehr
11. Oktober 2024 an der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste, Düsseldorf
DHV-Symposium 2024 “Die ‘Große Transformation’ – ein Jahrhundertprojekt zwischen Realität und Utopie” Mehr
23. bis 25. Oktober 2024 am ETH AI Center in Zürich, Schweiz
Jahrestagung der Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft (GMW) und CampusSource Agilität und KI in Hochschulen Mehr
4. November 2024, 17 Uhr, Allgemeiner Fakultätentag e.V., Karlsruhe
Online-Podiumsdiskussion “Denken, Sprechen, Schreiben. Wie wichtig ist die Sprachkompetenz für das wissenschaftliche Arbeiten?” Mehr
7.-9. November 2024, Berlin
Konferenz Falling Walls Science Summit 2024 Mehr
Aus forschungspolitischer Perspektive findet mit der Debatte über den BMBF-Etat am heutigen Donnerstag der Höhepunkt der Haushaltswoche statt. Ein Streitobjekt: Die massiven Streichungen bei der Förderung der Batterieforschung. Diese war bisher mit 156 Millionen Euro jährlich im KTF verankert, dazu kamen rund 50 Millionen Euro direkt aus dem BMBF-Etat für die Forschungsfertigung Batteriezelle (FFB) in Münster. Nach ersten Kürzungen im laufenden Haushaltsjahr sollen ab 2025 keine neuen Förderungen mehr über den KTF erfolgen. Lediglich bereits laufende Projekte werden bis zum Projektende noch ausfinanziert.
Diese Pläne werden nun, kurz vor der Haushaltsdebatte, auch koalitionsintern heftig kritisiert. Der SPD-Forschungspolitiker Holger Becker hält “diese Vorgehensweise für mutlos und den völlig falschen Ansatz.” Die Batterietechnologie sei ein Kernelement für die kommenden Generationen an Kraftfahrzeugen. Man müsse Forschung und Entwicklung in diesem Bereich sogar ausbauen, wenn diese Schlüsselindustrie in Deutschland erhalten werden solle.
Für langjährige Forschungsthemen, denen im Anschluss üblicherweise erhebliche privatwirtschaftliche Investitionen folgen, sei Planbarkeit und Verlässlichkeit der Förderinstrumente essenziell. “Solche Fördermittel kurzfristig zur Disposition zu stellen, um Haushaltslöcher zu stopfen, ist für eine industrielle Standortentwicklung völlig kontraproduktiv”, sagte der Jenaer Politiker. Er hoffe, dass sich in den Haushaltsberatungen hier noch Spielraum ergebe.
Auch von der Opposition kommt deutliche Kritik: “Die Kürzungen bei der Batterieforschung zeugen von der inhaltlichen Teilnahmslosigkeit der Ministerin, die sich nur für ihre wenigen Steckenpferde – SPRIND und Kernfusion – zu interessieren scheint”, sagte die Linken-Forschungspolitikerin Petra Sitte auf Anfrage von Table.Briefings. Die Batterieforschung sei ganz wesentlicher Baustein im Hinblick auf die unumgängliche energetische Transformation der Gesellschaft. Kürzungen seien in diesem Bereich völlig fehl am Platze. In unterschiedliche Forschungsansätze zur Energiespeicherung sollte mindestens auf dem bisherigen Niveau investiert werden.
CDU-Forschungspolitiker Thomas Jarzombek lenkt den Blick auf die Folgen für die Fachkräfte in dem Bereich: “In den von den Kürzungen betroffenen Forschungseinrichtungen findet die Ausbildung von dringend benötigten Fachkräften statt.” Diesen Nachwuchsfachkräftepool würde die Regierungskoalition absehbar austrocknen. Der entstehende Schaden ließe sich nur noch sehr schwer beheben. Wer einmal gehe, komme selten wieder. “Die Folge ist, dass Talente Deutschland verlassen werden und damit die wichtige Kompetenz für uns verloren geht.”
Nicht nur bei der Batterieforschung, unter anderem auch beim Thema Wissenschaftskommunikation gibt es noch Diskussionsbedarf in der Ampel. Nach dem Auftakt im Bundestag werden die Gespräche im Haushaltsausschuss bis zur Bereinigungssitzung im November fortgeführt. mw
Intelligente Scheinwerfer, eine bildgebende KI und Energiespar-Chips sind die drei Projekte, die ins Rennen um den Deutschen Zukunftspreis 2024 gehen. Drei Forscherteams stellten im Deutschen Museum in München ihre für den Preis nominierten Entwicklungen vor, die bereits marktfähig sind. Die ausgewählten Forschenden kommen aus Bayern, Berlin sowie Nordrhein-Westfalen und Sachsen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verleiht den mit 250.000 Euro dotierten Preis am 27. November in Berlin.
Angesichts der Wahlergebnisse in Sachsen und Thüringen haben die Hochschulen in beiden Bundesländern für Weltoffenheit und gegen die Normalisierung von Rassismus plädiert. Sie seien stolz darauf, “dass an unseren Hochschulen Menschen aus aller Welt und mit den unterschiedlichsten Hintergründen studieren und arbeiten”, teilen die Landesrektorenkonferenz Sachsen, die Thüringer Landespräsidentenkonferenz und die Hochschulrektorenkonferenz in einer Erklärung mit. Dafür sei ein Umfeld erforderlich, “das den grundgesetzlich verbrieften Schutz vor Diskriminierung sicherstellt“.
Weiter heißt es: Alle Parteien und Bürgerinnen und Bürger seien dazu aufgerufen, sich dafür einzusetzen, dass Wissenschaftsfeindlichkeit, Einschränkungen der Wissenschaftsfreiheit, Rassismus, Intoleranz oder auf Ausgrenzung fußende Ideen oder Feindbilder nicht normalisiert werden. “Wir setzen uns weiterhin dafür ein, den Zusammenhalt in der Gesellschaft und das Vertrauen in die freiheitliche Demokratie zu stärken.”
In beiden Bundesländern hatte die AfD bei den Landtagswahlen am 1. September über 30 Prozent geholt. In Thüringen landete sie als stärkste Kraft vor der CDU, in Sachsen knapp hinter der Union. Das Bündnis Sahra Wagenknecht kam in beiden Ländern auf Rang drei. Den Namen von einzelnen Parteien nannten die Hochschulvertreter, die parteipolitisch neutral sein sollen, in ihrer Erklärung nicht. In der Erklärung pochten die Vertreter außerdem auf die Wahrung der Hochschulautonomie und der Wissenschaftsfreiheit. Nur so entfalte Wissenschaft ihr Potenzial für die Gesellschaft. “Weltoffenheit ist hierfür ein wichtiger Faktor. Nur eine Hochschule, die international denkt und handelt, ist zukunfts- und wettbewerbsfähig.”
Im Interview mit Table.Briefings hatte sich auch der Vorsitzende des Forschungsausschusses, Kai Gehring (Grüne), zuletzt besorgt über die Wahlergebnisse in den Bundesländern gezeigt. “Autoritarismus ist Gift für Wissenschaftsfreiheit und Innovationskraft. Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Akademien machen Bundesländer hochinnovativ, wettbewerbsfähig und sichern unser internationales Renommee”. Gleiches gelte für internationale Talente, die jetzt schon in Sachsen und Thüringen leben, arbeiten und forschen – und solche, die angesichts der AfD- und BSW-Erfolge diese Wissenschaftsstandorte künftig meiden könnten.
Auf die Frage, was die Politik tun könnte, um die progressiven Kräfte zu stärken, antwortete Gehring, dass eine sorgfältige Analyse folgen und auch wissenschaftliche Expertise zu der Entwicklung beleuchtet werden müsse. Die Ergebnisse seien kein Jugendproblem allein. “Gleichwohl sind die Zahlen bei Erstwählerinnen und -wählern besonders alarmierend. Das Verheerende ist, dass sowohl AfD als auch BSW gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse infrage stellen und Forschende mit Ideologievorwürfen überziehen”, sagte der Forschungspolitiker. Die AfD wolle missliebigen Forschungsfeldern die finanzielle Grundlage entziehen. Es brauche daher jetzt eine große Bildungs- und Demokratieoffensive. tg, nik (mit dpa)
Vergangene Woche wurde die jüngste Runde der Starting Grants des Europäischen Forschungsrates (ERC) bekannt gegeben. 494 Forscherinnen und Forscher erhielten Fördermittel, um ihre Ideen weiterzuentwickeln. Dies ist das 17. Jahr seit Einführung der Starting Grants, für die im Laufe der Jahre insgesamt 9,3 Milliarden Euro bereitgestellt wurden.
Die Erfolgsquote lag in diesem Jahr mit 14,2 Prozent etwas niedriger als im Vorjahr, als 14,8 Prozent der eingereichten Anträge gefördert wurden. Im Vergleich zu den Vorjahren ist sie jedoch in beiden Jahren gestiegen: Die durchschnittliche Erfolgsquote seit Beginn des Programms lag bei 11,3 Prozent, wobei 60.630 Anträge evaluiert und 6.868 für eine Förderung ausgewählt wurden.
Deutschland ist seit Beginn des Programms Spitzenreiter bei der Anzahl der beteiligten Gasteinrichtungen und der Gesamtfördersumme. Seit 2008 sind insgesamt 1,6 Milliarden Euro an ERC Starting Grants nach Deutschland geflossen, insgesamt wurden 1.095 Grants vergeben. Das Vereinigte Königreich liegt in diesem mehrjährigen Ranking an zweiter Stelle, was die Reputation des Landes vor dem Brexit widerspiegelt. Seit dem Brexit ist die Beteiligung Großbritanniens stark zurückgegangen.
Zum ersten Mal seit dem Brexit sind Forschende aus dem Vereinigten Königreich wieder uneingeschränkt antragsberechtigt. ERC-Präsidentin Maria Leptin sagte: “Ich freue mich ganz besonders, die britischen Forschenden wieder im ERC begrüßen zu können. Wir haben sie in den vergangenen Jahren schmerzlich vermisst. Mit fünfzig Grants, die an Forscher im Vereinigten Königreich vergeben werden, ist dieser Zustrom gut für die gesamte Forschungsgemeinschaft”.
Die “Starting Grants” richten sich an Forscherinnen und Forscher, deren Promotion zwei bis sieben Jahre zurückliegt. Mit einer Fördersumme von bis zu 1,5 Millionen Euro über einen Zeitraum von fünf Jahren pro Nachwuchswissenschaftlerin oder Nachwuchswissenschaftler können diese eine eigene Forschungsgruppe aufbauen. Der ERC schätzt, dass durch die neue Förderrunde über 3.000 Arbeitsplätze entstehen werden. mw
CHEManager: Forschungszulage steigt. Die chemisch-pharmazeutische Industrie profitiert von der Forschungszulage, wie eine Ende 2023 veröffentlichte Studie des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung zeigt. Mit über 1.500 Anträgen liegt die Branche auf Platz 4 der Antragsteller, hinter dem Maschinenbau (4.507 Anträge), der IT-Branche (4.270 Anträge) und der Elektro- und Messtechnik (1.733 Anträge). Einen zusätzlichen Schub soll die Forschungszulage nun durch das Wachstumschancengesetz erhalten. Seit dem 28. März dieses Jahres steigen die maximal möglichen jährlich zu beantragenden F&E-Kosten auf 10 Millionen Euro. Zudem werden KMU großzügiger gefördert: mit 35 % der projektbezogenen Personalkosten sowie 24,5 % der F&E-Auftragskosten, im Vergleich zu 25 % und 15 % in den Jahren zuvor. Dadurch erhöht sich für diese Unternehmen die maximale Zulage pro Jahr von einer Million Euro auf 3,5 Millionen Euro. (“Die Forschungszulage kommt an”)
Welt: Die Studierfähigkeit der Studenten. In den Schwanengesang des Niedergangs des Abiturs und der mangelnden Studierfähigkeit mag Ulrich Bartosch, der Präsident der Universität Passau, nicht einstimmen. Bartosch will genau hinschauen, wo die Probleme liegen, hütet sich vor Pauschalurteilen und blickt auch auf die Lebenswirklichkeit von Schülern. (“Das Problem mit der Studierfähigkeit von Studenten in Deutschland”)
FAZ: Hass auf den Westen. Mit Protest gegen die israelische Politik haben die seit dem 7. Oktober massiv zugenommenen antisemitischen Demonstrationen an den amerikanischen Universitäten nicht viel zu tun. Ihr Ziel ist es, das Hochschulsystem und den Westen zu vernichten. (“Ihr Ziel ist die Zerstörung der universitären Struktur”)
Forschung & Lehre: Wissenschaftsverlage tracken Daten. Wissenschaftsverlage tracken die Daten von Universitäten und Forschern und nutzen sie für ihre wirtschaftlichen Zwecke. Die Betroffenen haben nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten, einzusehen, ob und wie lange ihre Verhaltensdatenprofile gespeichert oder an andere Interessenten weitergeleitet werden. Zum einen sind die meisten Tracker bereits in den Medienbereitstellungsdiensten der Verlage integriert, zum anderen werden die Daten automatisiert an Dritte weitergeleitet. Datentracking ist auch in den Wissenschaften innerhalb weniger Jahre zu einer Routine der Verlage geworden und verstärkt die Machtasymmetrie zwischen Verlagen und Wissenschaften zusätzlich, anstatt sie abzubauen. (“Machtasymmetrie zwischen Verlagen und Wissenschaften”)
Tagesanzeiger: Roche eröffnet neues Forschungszentrum. Der Pharmakonzern Roche hat in Basel ein hochmodernes Forschungszentrum eröffnet, das als das fortschrittlichste weltweit gilt. Im neuen Zentrum für Forschung und frühe Entwicklung sind 1800 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tätig. Das Forschungszentrum umfasst vier Hochhäuser. (“Erste Einblicke in Roches neues Forschungs¬zentrum”)
Göttinger Tageblatt: Senat der Uni Göttingen will Präsident Tolan abwählen. Der Senat der Georg-August-Universität Göttingen will Uni-Präsident Professor Metin Tolan abwählen. Doch das ist nicht ganz so einfach. In jedem Fall muss die Arbeitsfähigkeit der Hochschule gewahrt bleiben und das Land kann im Zweifelsfall sogar einen Kommissar bestellen. (“Wie kann ein Uni-Präsident abgewählt werden – und wie ginge es dann weiter?”)

Fast alle wissen, dass sich an den deutschen Hochschulen Finanzierungsnöte ausbreiten. Fast alle sehen, dass sich der Wettbewerb um Projektfinanzierung überhitzt hat. Damit liegt es nahe, Fördermittel in die Grundfinanzierung zurückzuverlagern. Wie das gelingen kann, ist jedoch höchst umstritten.
Thorsten Wilhelmy hat die Exzellenzstrategie in diese Debatte gebracht; zugunsten besserer Breitenförderung solle das Programm eine Runde pausieren. Wilhelmy nennt auch unsere Initiative “Grundfinanzierung statt Projektwettbewerb”, in der wir ein lernendes Manifest zum Thema entwickeln. Er teilt jedoch nicht unsere Lösungsidee. Die heutigen Projektmittel wieder direkt in die Hochschulhaushalte zu leiten, erscheint ihm nicht machbar – die Landeshaushalte drohten das Geld nur zu schlucken, und eine Bundes-Grundfinanzierung verlange zu große rechtliche Umbauten. Stattdessen nimmt er den Vorschlag des Wissenschaftsrats auf, die Overhead-Pauschalen für Projekte zu erhöhen.
Diese Idee droht den Wettbewerb allerdings bloß andersartig anzuheizen. Ich möchte hier ausführen, dass nur eine wirkliche Wende zur Grundfinanzierung sinnvolle Exzellenz-Korrekturen verspricht. Da die politische Situation in den Ländern nicht einfacher wird, könnte sie auch zur Sicherung realer Wissenschaftsfreiheit beitragen.
Auf Wilhelmys Text haben an dieser Stelle Annette Schavan und Georg Schütte reagiert. Auch Edelgard Bulmahn wurde zum Thema befragt, geht auf die neueren Debatten jedoch kaum ein. Die anderen beiden teilen die verbreitete Problemsicht: Für Schavan sind die Hochschulfinanzen “angesichts sinkender Grundfinanzierung durch die Länder und […] wachsender Drittmittel durch den Bund fragil” geworden, und Schütte kennzeichnet die Gesamtlage als “überhitzt”. Die Lösungsvorschläge differieren jedoch gewaltig.
Annette Schavan empfiehlt keine Reformen – besonders nicht bei der Exzellenzstrategie. Der Exzellenztitel habe deutsche Standorte international viel bekannter gemacht; zudem habe das Programm Neuerungen wie den Europäischen Forschungsrat “inspiriert”. Zu klären bleibt, ob man nicht auch preiswerter sichtbar werden kann und wozu es noch weitere Einrichtungen braucht, die viele Anträge anlocken, um wenige Vorzeigeforschung zu fördern.
Schavan weist aber zu Recht darauf hin, dass auch Wilhelmys Vorschlag die Logik der Kurzfristigkeit fortsetzt: Sonderforschungsbereiche sind nicht nachhaltiger als Exzellenzcluster. Und erhöhte Pauschalen würden das Projektgeschäft zunächst attraktiver machen, bevor vielleicht einige ganz aufgeben. Gute Vorschläge sind im gegebenen Rahmen nicht zu erkennen.
Ein anderer Ansatz bestünde darin, die Projektfinanzierung zur inhaltlichen Steuerung zu nutzen. Georg Schütte argumentiert dafür, die Wissenschaft so auf Probleme der Zeit auszurichten. Auch Bulmahn scheint den Ansatz zu teilen, wenn sie für “Forschungscluster” zu “Klimawandel […], Global Health und KI” wirbt. Die Exzellenzstrategie ist allerdings nicht spezifisch auf diese Themen ausgerichtet. Zugleich wird Forschung nicht unbedingt besser, wenn Ministerien und Stifter sie in großen Programmlinien fördern. Die politischen Vorgaben werden oft als bloße Fördergelegenheit gesehen.
Schütte selbst nennt abgesehen von “Schlüsseltechnologien” ausgerechnet Probleme, die gar keine Spitzenforschung brauchen: “Wir müssen fragen, wer die Lehrkräfte ausbilden soll, die unseren Kindern zukunftsorientiertes Fachwissen vermitteln und sie zu mündigen Staatsbürgerinnen und -bürgern bilden. Und wo und wie wir Vorsorge treffen für das Unbekannte […], wie das System also resilienter wird.” Alles das ist sicher nötig – aber am besten durch Lehre und Forschung in der Breite zu leisten.
Verlässliche Grundfinanzierung könnte auch Spitzenforschung ermöglichen. Viel mehr als dauerhaft beschäftigtes wissenschaftliches Personal, das Zeitressourcen für Forschung hat, bei Interesse Kooperationen eingeht und bei Gelegenheit Sachmittel beantragen kann, ist dafür nicht nötig.
Auch Edelgard Bulmahn schlägt eine Grundfinanzierungsbeteiligung des Bundes vor. Sie hat allerdings schon zu ihrer Zeit als Ministerin gezeigt, dass man mit viel Geld auch viel Unheil anrichten kann, namentlich eine projektgetriebene Explosion prekärer Beschäftigung. Die genauere Ausführung der Alternativen überlasse ich unserem lernenden Manifest, in dem wir das Genre Projekt als freiwillige Kooperation neu zu definieren vorschlagen. Konkrete Vorschläge dazu konnten wir bei zwei Diskussionen im Frühjahr einholen, und spätestens, wenn wir das Papier im Oktober abschließend mit Vertreter*innen der demokratischen Parteien diskutieren, stehen Änderungen und Konkretisierungen an.
Statt dem vorzugreifen, will ich zwei eigene Überlegungen zur Umwidmung der Exzellenzmittel in die Debatte bringen und eine neue Initiative zur Exzellenzstrategie ankündigen:
Schließlich will ich eine weitere Initiative erwähnen, die verschiedenen Positionen zur Exzellenzstrategie Raum bietet. Das Netzwerk Nachhaltige Wissenschaft, in dem sich reforminteressierte Profs organisieren, hat gerade einen Brief mit kritischen Fragen zur Exzellenzstrategie an die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz, die Deutsche Forschungsgemeinschaft und den Wissenschaftsrat geschickt. Hier geht es nicht nur um das Ob, sondern auch um das Wie der Auswahl und Förderung. Wir werden den Brief im Oktober veröffentlichen – mit oder ohne Antworten.
Zur Person: Tilman Reitz ist seit 2015 Professor für Wissenssoziologie und Gesellschaftstheorie an der Universität Jena. Er engagiert sich im Netzwerk für Gute Arbeit in der Wissenschaft (NGAWiss) und im Netzwerk Nachhaltige Wissenschaft. An der Initiative Grundfinanzierung statt Projektwettbewerb beteiligen sich neben NGAWiss auch DGB, GEW, Verdi, die Deutsche Gesellschaft Juniorprofessur und der Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.
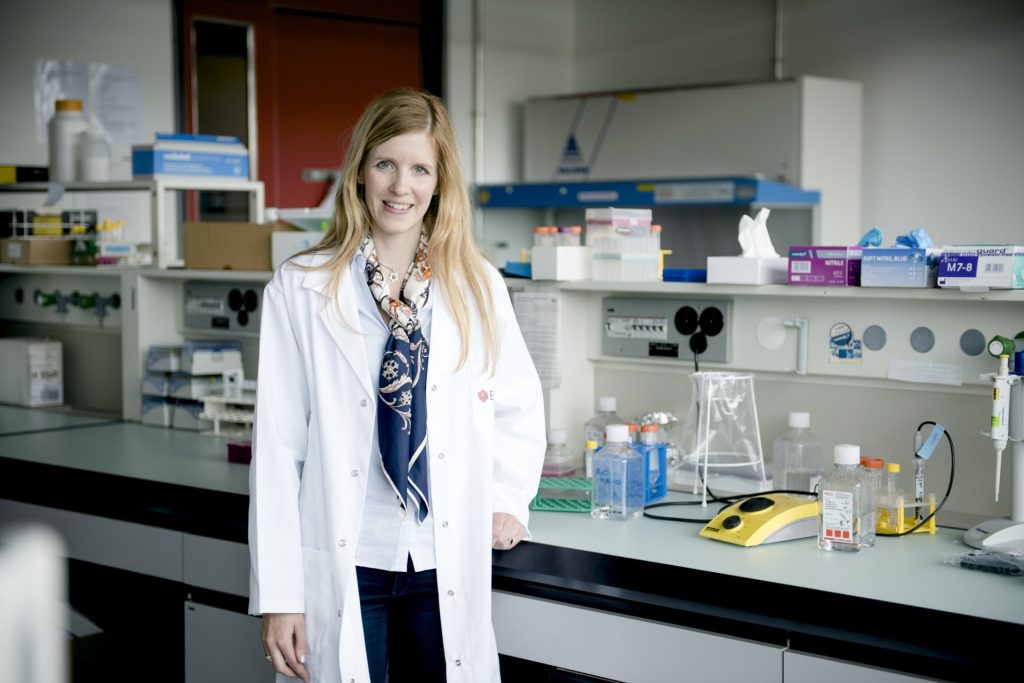
Die Wissenschaftsgeschichte ist voller Anekdoten über Geistesblitze. Manche Forscher hatten einen in der Badewanne (Archimedes zum Prinzip des Auftriebs), andere unter einem Baum (Newton, Stichwort Schwerkraft) und wieder andere in der Tram (Einstein und die Relativitätstheorie). Chirurgie-Kongresse waren bisher eher nicht als Orte der Inspiration bekannt. Zu Unrecht: Die Chemikerin Inge Herrmann, beim diesjährigen Falling Walls Science Summit nominiert für den Women’s Impact Award, kommt nämlich genau auf solchen Fachtagungen zu neuen Forschungsideen.
“Wenn ich da in den Weiterbildungen sitze, fallen mir beim Zuhören viele neue Probleme auf, für die ich eine Lösung zu finden suche”, sagte Herrmann kürzlich dem St. Galler Tagblatt. Gäbe es einen Preis für Unterstatement in der Medizinforschung, könnte Herrmann mit dem Satz gleich noch eine Auszeichnung gewinnen. Denn tatsächlich sucht die Schweizer Professorin nicht einfach nur nach Lösungen, zusammen mit ihrem Team findet sie diese auch – und das fast schon am Fließband.

In diesem Sommer etwa erfand das Team Herrmann ein Implantat aus Hydrogel, das Frauen mit Endometriose hilft und zugleich als Verhütungsmittel eingesetzt werden kann. Weltweit leiden etwa 190 Millionen Frauen an der schmerzhaften Krankheit, in Deutschland sollen es allein zwei Millionen sein. Bei ihnen gelangt während der Menstruation Blut über die Eileiter in die Bauchhöhle. Das Blut transportiert Zellen der Gebärmutterschleimhaut, die wiederum Entzündungen provozieren. Mit dem Hydrogel könnten die Eileiter blockiert und die Entstehung und Ausbreitung von Endometriose verhindert werden.
Auch wenn es bis zur Marktreife noch dauern wird, das Patent ist angemeldet. Im Juli berichteten Medien international über die Entdeckung und das Team dahinter. In der Wissenschaft war Inge Herrmanns Team zu dem Zeitpunkt längst bekannt. Anfang 2024 machte es mit einer Lasertechnologie zum Verschluss offener Wunden von sich Reden. Davor erfand es ein Darmpflaster, das Alarmsignale aussendet, wenn dies durchlässig zu werden droht.
Herrmann arbeitet bevorzugt dort, wo andere aufhören: an der Schnittstelle zwischen Chemie, Materialwissenschaft, Ingenieurswesen und Medizin. Dort erobert sie Neuland für die Wissenschaft. Die Schlüssel dorthin sind für sie Vielfalt im Team und intensive Gespräche mit Menschen aus komplett anderen Branchen – das kann auch am Tisch mit Freunden beim Essen sein.
Die Kommunikation über Disziplinen und Branchen hinweg ist natürlich anspruchsvoll, sie kostet Zeit und Energie. “Die Komfortzone ist nicht der Ort, an dem Magie passiert”, lautet Herrmanns Motto. Ihr Engagement für die Wissenschaft zeigt sich auch in ihrem Lebenslauf: Geboren 1985, studierte sie ab 2003 Chemieingenieurwesen an der ETH Zürich und der TU Delft, um schon sechs Jahre später in ihrer Doktorarbeit ein magnetbasiertes Verfahren zur Blutreinigung zu präsentieren, das später in Harvard weiterentwickelt wurde.
Nach Forschungsstationen in den USA (University of Illinois, Chicago) und UK (Imperial College London) kam sie 2015 zurück in die Schweiz. Mittlerweile ist Herrmann nicht nur Professorin an der Uni Zürich und Dozentin an der ETH Zürich. Sie leitet zudem ein Team am Materialwissenschaftslabor der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa). Und – seit September 2023 – ist sie nun auch Chefin des Ingenuity Lab an der Uniklinik Balgrist in Zürich. Das Lab will Materialinnovationen in die Klinik bringen.
Vier Hüte auf einem Kopf – wie geht das? Herrmanns Antwort ist verblüffend einfach: So lasse sie Promovierenden und Postdocs möglichst viel Freiraum und unterstütze nur dort, wo es nötig sei. Start-ups überlässt sie lieber den Forschenden im Team. Und auch bei Publikationen steht ihr Name eben längst nicht immer an erster Stelle. Erstautor der Endometriose-Studie zum Beispiel ist Alexandre Anthis. Christine Prußky
Beim Falling Walls Science Summit in Berlin wird am 9. November verkündet, wer den Women’s Impact Award erhält. Inge Katrin Herrmann ist eine von drei Nominierten. Weitere Porträts der Table.Briefings-Serie “Breakthrough-Minds” zum Falling Walls Science Summit 2024 lesen Sie hier.
Cano Costard, Challenge Officer der Bundesagentur für Sprunginnovationen SPRIND, gehört zu den Gewinnern der ersten MSA Challenge Awards der University of Chicago. Er wird für die Entwicklung eines Advance Market Commitment für antivirale Breitbandmedikamente ausgezeichnet. Mit dem Gewinn des Wettbewerbs ist ein Preisgeld in Höhe von 290.000 US-Dollar für SPRIND verbunden.
Hendrik Dietz, Biophysiker an der TU München, ist mit der Otto-Meyerhof-Medaille des Max-Planck-Instituts für medizinische Forschung in Heidelberg ausgezeichnet worden. Ihm ist es gelungen, physikalische Prinzipien nanoskopischer, molekularer Bausteine in medizinisch relevante Anwendungen zu bringen. Die Medaille wird seit 2021 in Gedenken an den Nobelpreisträger Otto Meyerhof verliehen.
Michael N. Hall vom Biozentrum der Universität Basel, der Kriminologe John Braithwaite von der Australian National University, die Wissenschaftshistorikerin Lorraine Daston, Direktorin am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, und der amerikanische Chemiker Omar Yaghi von der University of California Berkeley sind die Preisträger des Balzan-Preises 2024. Die Preise werden in diesem Jahr für Forschungsgebiete von der Rechtswissenschaft bis zur Wissenschaftsgeschichte und von der Biologie des Alterns bis zu innovativen Materialien vergeben. Sie sind mit je 750.000 Franken dotiert. Erwartet wird, dass die Preisträgerinnen und Preisträger die Hälfte des Preisgeldes für die Finanzierung von Forschungsprojekten verwenden, an denen eine neue Generation von Nachwuchsforschenden beteiligt ist.
Andrea Hänger, Vizepräsidentin des Bundesarchivs in Koblenz, wurde von der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern (GWK) als neues Mitglied in den Rat für Informationsinfrastrukturen (RfII) berufen. Dieser berät Bund, Länder und Wissenschaftseinrichtungen bei der Weiterentwicklung wissenschaftlicher Informationsinfrastrukturen und zu verwandten Themen des digitalen Wandels in der Wissenschaft.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an research@table.media!
China.Table. Tech-Krieg: So schnell holt China bei den Chip-Fähigkeiten auf. China beschleunigt den Ausbau seiner Mikroprozessor-Fähigkeiten trotz westlicher Sanktionen. Es geschehen zwar keine Wunder, doch die “De-Amerikanisierung” kommt dank massiver Investitionen voran. Der Fokus liegt auf der Produktion großer Mengen ausreichend guter Chips. Mehr
Europe.Table. Industriepolitik: Was der BDI fordert, um den Standort Deutschland zu sichern. Der BDI sieht einen Investitionsbedarf von 1,4 Billionen Euro bis 2030, um den Industriestandort Deutschland zu retten. Eine Studie sieht sonst rund 20 Prozent der deutschen Industrie gefährdet. Mehr
Bildung.Table. BIBB-Präsident: Warum es Kritik am Verfahren der Neubesetzung gibt. Der aktuelle BIBB-Präsident, Friedrich Hubert Esser, tritt nach über einem Jahrzehnt im Juni 2025 ab. Jetzt muss sein Nachfolger gefunden werden. Arbeitgeber und Arbeitnehmer hätten sich dabei mehr Beteiligung gewünscht, als das BMBF sie jetzt vorsieht. Mehr
Europe.Table. EU-Batterieverordnung: VDA-Präsidentin Müller wirft Regierung Untätigkeit vor. VDA-Präsidentin Hildegard Müller kritisiert die Bundesregierung massiv im Zusammenhang mit einem Rechtsakt zur EU-Batterieverordnung. Wenn dieser nicht korrigiert werde, drohe deutschen Unternehmen ein massiver Standort- und Wettbewerbsnachteil. Mehr
Climate.Table. Investitionen: So viele Milliarden brauchen die deutschen Klimaziele. Etwa 340 Milliarden Euro mehr als bisher geplant müsste der Staat in Deutschland investieren, um seine Klimaziele zu erreichen, hat eine Studie errechnet. Und das ginge sogar teilweise mit einer Schuldenbremse. Das Thema soll vor der Bundestagswahl debattiert werden. Mehr

Für eine forschungspolitische Meldung hat es nicht gereicht: Das TV-Duell zur US-Präsidentschaft zwischen Kamala Harris und Donald Trump war (nicht nur) aus Sicht der Wissenschaft ernüchternd. Im Wahlkampf der Weltmacht USA wird darüber gesprochen, ob Migranten aus Haiti Haustiere essen oder Demokraten geborene Babys exekutieren, aber kaum ein Wort über die zukünftigen Linien der Forschungs- und Innovationspolitik, über Fachkräfte oder die Ausbildung des Nachwuchses. Wenn’s nicht so gefährlich wäre, man müsste laut lachen.
Frei nach der Watzlawickschen Theorie: Man kann nicht nicht über Wissenschaft kommunizieren, wollten wir das Duell aber trotzdem nicht unerwähnt lassen und damit hat die USA es zumindest in unser Dessert geschafft. So richtig ernst nehmen kann man es ja auch alles nicht mehr. Während man bei Trump nicht zwischen den Zeilen lesen muss, um zu verstehen, wie wenig er auf wissenschaftliche Faktentreue und Erkenntnisgewinn setzt, hatte Kamala Harris zumindest einige innovationspolitische Ziele durchblitzen lassen.
“Das bedeutet, [… ] dass wir uns auf die Beziehungen mit unseren Verbündeten konzentrieren, dass wir uns auf Investitionen in amerikanische Technologie konzentrieren, damit wir das Rennen bei der künstlichen Intelligenz und Quantencomputing gewinnen, und dass wir uns darauf konzentrieren, was wir tun müssen, um Amerikas Arbeitskräfte zu unterstützen”, sagte Harris kämpferisch. “Unsere Politik gegenüber China sollte darauf ausgerichtet sein, dass die Vereinigten Staaten von Amerika den Wettbewerb des 21. Jahrhundert gewinnen.”
Wie zukunftsgewandt die Auffassung beider Kandidaten ist, weiterhin Erdgas-Fracking erlauben zu wollen, sei mit Blick auf das globale Rennen um moderne Klimatechnologien dahingestellt. Wenn es noch Beweise brauchte, dass Deutschland Harris ganz feste die Daumen drücken sollte, liefert sie Trump, als er Ungarns Viktor Orbán den starken Mann Europas nannte und Germany gleich zweimal abkanzelte. Biden habe Deutschland erlaubt, die Nord-Stream-Pipeline zu bauen und Europa damit abhängiger von Russland gemacht (darüber lässt sich immerhin streiten).
Außerdem habe Deutschland versucht, erneuerbare Energien auszubauen und weniger fossile Brennstoffe zu nutzen, sei aber damit gescheitert. “Innerhalb eines Jahres wurde wieder mit dem Bau normaler Kraftwerke begonnen”, fabulierte Trump. Bleibt (nicht nur) aus forschungspolitischer Perspektive zu hoffen, dass Trump mit dem Ansinnen einer zweiten Amtszeit scheitert und in den USA dann bald wieder normale Politik gemacht wird. Oder um es mit den Worten von Kamala Harris zu sagen: “It’s time to turn the page”. Tim Gabel
