die Schnittmengen sowie die wechselseitigen Einflüsse von Wissenschaft und Politik zeigen sich in diesen Tagen – egal wohin man blickt. Ein mutmachendes Beispiel ist die zweitägige Konferenz “Science for Future”, die heute in Berlin-Adlershof beginnt. Sie wird gemeinsam von der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina und der Chinesischen Akademie der Wissenschaften veranstaltet und es soll um die Umstellung der Energiesysteme in Richtung CO2-Neutralität gehen.
Während mit Blick auf die Forschungsbeziehungen zwischen Deutschland und China derzeit eher über De-Risking statt über Kooperation debattiert wird, treffen sich also die Wissenschaftsspitzen beider Länder. Welche gemeinsamen Ziele es noch gibt und welche wissenschaftsdiplomatischen Bemühungen dahinterstecken, hat mein Kollege Tim Gabel aufgeschrieben.
Außerdem hat er erkundet, wie viel Science Diplomacy wohl nach den Präsidentschaftswahlen im Umgang mit den USA gefragt sein wird. “Es ist im Interesse beider Länder, die Wissenschaftsbeziehungen mit voller Kraft fortzuführen, auch wenn uns die politische Richtung einer neuen Regierung nicht zusagen sollte”, hat ihm Christian Strowa, Leiter der DAAD-Außenstelle Nordamerika in New York, gesagt. Was von den Demokraten respektive Republikanern im Detail zu erwarten ist, lesen Sie im Interview.
Wie vernichtend sich Krieg und ein autoritäres Regime auf Wissenschaftsbeziehungen auswirken können, zeigt sich am Beispiel Russlands. Seit Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine ruhen die institutionellen Wissenschaftskooperationen zwischen Deutschland und Russland. Persönliche Kontakte sind noch möglich, doch auch auf dieser Ebene schaltet die russische Regierung kritische Stimmen stumm.
Ein Beispiel ist die Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, die von Moskau jüngst als “extremistische Organisation” eingestuft wurde. Dagegen protestiert nun die Hochschulrektorenkonferenz – und warnt zugleich vor möglichen Gefahren für Mitglieder der Fachgesellschaft und für ihre Kooperationspartner, wie Sie in den News lesen können.
Bleiben Sie zuversichtlich und kommen Sie gut in den Tag!


Anders als deutsche Ministerinnen und Minister haben Politiker mit Ministerrang in der Volksrepublik China ein begrenztes Reisekontingent. So ist es auch bei Hou Jianguo, Präsident der Chinesischen Akademie der Wissenschaften (CAS) und Mitglied des chinesischen Zentralkomitees. Das führt dazu, dass der diplomatische Austausch im Ausland oft auf wenige Tage begrenzt ist und in dieser Zeit ein geballtes Programm absolviert wird.
So auch in dieser Woche: Zum ersten Mal in Nach-Pandemie-Zeiten treffen sich die Spitzen der chinesischen und deutschen Wissenschaft, amtierende und ehemalige Präsidenten und Chefs der Wissenschaftsorganisationen. Bereits am gestrigen Montag haben die Max-Planck-Gesellschaft (MPG) und die CAS das 50-jährige Jubiläum ihrer “Kooperation und Netzwerkbildung” im Harnack-Haus in Berlin begangen. Am heutigen Dienstag und am Mittwoch veranstalten Leopoldina und CAS gemeinsam die zweite Science for Future-Konferenz in Berlin-Adlershof.
Die Beziehung der beiden Länder ist so angespannt wie lange nicht. Die Bundesregierung hat in ihrer China-Strategie zwar ausdrücklich zu Protokoll gegeben, dass man kein De-Coupling wünscht, wohl aber das De-Risking hervorgehoben. Mit markigen Worten hatte Bettina Stark-Watzinger vor einem Jahr vor den Risiken von Forschungskooperationen gewarnt. In Interviews sagte die Forschungsministerin, dass hinter jedem chinesischen Wissenschaftler die Kommunistische Partei stehen könnte.
Aus der Wissenschaftscommunity gab es Kritik an den oft als populistisch und pauschal wahrgenommenen Äußerungen Stark-Watzingers. Namhafte Wissenschaftsmanager wie MPG-Präsident Patrick Cramer und die DFG-Präsidentin Katja Becker betonten anschließend die Bedeutung der Beziehungen und die Verantwortung und Autonomie des Wissenschaftssystems in dieser Frage. Gemeinsamer Forschung in risikoarmen Bereichen solle nichts im Wege stehen, so der Tenor.
In anderen Feldern müssten Risiken wie Spionage, die Nähe zur Militärforschung und Einschränkungen der Wissenschaftsfreiheit allerdings klar benannt und erkannt werden, um nicht naiv zu handeln.
Wie genau man diesen schmalen Grat auf diplomatischer Arbeitsebene beschreitet, damit ist von deutscher Seite unter anderem Ruth Narmann betraut, die bei der Leopoldina die Abteilung für Internationale Beziehungen leitet. 2018 hätten sich die beiden ehemaligen Akademiepräsidenten Chunli Bai und Jörg Hacker bei einem Delegationstreffen darauf verständigt, im Bereich der Grundlagenforschung enger zusammenzuarbeiten, berichtet Narmann im Gespräch mit Table.Briefings.
“In China wird das Thema Grundlagenforschung zwar immer wichtiger, es wurde und wird aber öffentlich noch nicht so wahrgenommen. Und zugleich kommen in Deutschland auch immer mal wieder die Debatten über die Relevanz von Grundlagenforschung auf, auch wenn wir hierzulande verglichen mit anderen Ländern noch eine komfortable Situation haben”, sagt die Sinologin. So sei die Idee entstanden, sich bei der künftigen Zusammenarbeit darauf zu fokussieren. Bei der Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft steht das Thema naturgemäß im Vordergrund.
Ziel der Akademien-Kooperation sei es gewesen, ein Netzwerk mit renommierten Forschenden und gestandenen und “unantastbaren” Nobelpreisträgern auf beiden Seiten zu nutzen und in einem zweijährigen Rhythmus Konferenzen unter dem Titel “Science for Future” zu veranstalten: “Wir sehen unsere Arbeit mit China ja nicht nur als internationale Zusammenarbeit in der Wissenschaft, sondern durchaus auch als Science Diplomacy. So ist der Austausch und die aktive Beteiligung junger Wissenschaftler ein Teil der Initiative, was in der Wissenschaftskultur Chinas aktuell noch weniger ausgeprägt ist als bei uns”, erklärt Narmann.
Im Hinblick darauf sei die erste Science for Future-Konferenz in Peking mit dem Titel “All Starts with Basic Research” im Jahr 2019 ein voller Erfolg gewesen. Dann sei die Coronavirus-Pandemie dazwischengekommen. Den Kontakt habe man aber gehalten und im vergangenen Jahr sei eine Präsidentendelegation der Leopoldina in China gewesen. Dort wurde die Fortsetzung der Konferenzreihe in diesem Jahr beschlossen, also genau zu jener Zeit, als die Debatte über Forschungskooperationen mit China hierzulande ihren Höhepunkt erreichte.
Auf die Frage, ob die Debatte über De-Risking für die Konferenz und den Austausch mit der CAS von Bedeutung sei, antwortet Ruth Narmann mit einem klaren “Jein”. Der Nein-Part ihrer Antwort beziehe sich darauf, dass die beiden Akademien ja nicht gemeinsam forschen würden. Anders als die CAS betreibt die Leopoldina keine eigene Forschung. Der Ja-Part beziehe sich auf die gesellschafts- und forschungspolitische Bedeutung: “Es ist auch ein Signal an die Öffentlichkeit: Wir brauchen die Kooperation, wir kommen an China nicht vorbei.”
Selbstverständlich bekomme die chinesische Seite die Debatte in Deutschland mit, sagt Narmann. “Es ist ein Thema, auf das wir in unseren bilateralen Gesprächen immer wieder angesprochen werden. Genau wie die deutsche Seite die Punkte anspreche, die wir kritisch sehen, etwa Meinungs- und Forschungsfreiheit oder die Dual-Use-Thematik.” Das Prinzip sei miteinander, statt übereinander zu reden und die Beziehungen proaktiv zu gestalten.
“Wir vergessen oft, dass wir viele chinesische Forschende in Deutschland haben, die teilweise hochrangige Positionen im deutschen Forschungssystem innehaben. Da sollte man schon einen Moment nachdenken, ob man alle Wissenschaftler aus China pauschal als Geheimnisverräter bezeichnet”, sagt Narmann. Seit 2005 befasse sie sich in ihrer Arbeit als Wissenschaftsmanagerin mit dem deutsch-chinesischen Austausch. China sei zunächst als Entwicklungsland wahrgenommen worden, anschließend sei eine China-Euphorie ausgebrochen, die sich jetzt ins Gegenteil verkehre.
Es gebe Themen, “da können wir allein nicht weiterarbeiten, da brauchen wir die Zusammenarbeit”. In Teilen sei die Forschung besser als in Deutschland und das System leistungsfähiger. Dies gelte zum Teil auch für den Bereich Energie- und Klimaforschung, der auch von globaler Relevanz sei. Schnell hätten sich die beiden Akademien deshalb auf ein Thema für die zweite Science for Future-Konferenz einigen können: “On the path to Carbon Neutrality”.
In einer gemeinsamen Berlin Declaration soll am heutigen Dienstag eine gemeinsame Willensbekundung zur Umstellung der Energiesysteme in Richtung CO₂-Neutralität unterschrieben werden. Darin soll sich auch die Absicht finden, die Wissenschaft bei der Entwicklung neuer Technologien zu unterstützen, internationale Kooperationen zu dem Thema zu fördern und schließlich auch die Anwendung dieser Technologien zu forcieren.

Herr Strowa, was bislang im US-Wahlkampf kaum eine Rolle spielt, sind die Themen Hochschulen, Forschung und Wissenschaft. Oder haben Sie einen anderen Eindruck?
Tatsächlich sind diese Themen in den öffentlichen Debatten nicht so präsent. Anders sieht das aus, wenn Sie an die Hochschulen gehen. Dort ist man sehr daran interessiert, was die Wahl für internationale Kooperationen oder die Forschungsförderung bedeutet. Aber für die Durchschnittsfamilie, die hier für eine Packung Milch im Supermarkt inzwischen über acht Dollar zahlt, sind solche Themen nicht zentral. Da geht es um die Wirtschaft, um Inflation und affordability, insbesondere von republikanischer Seite gerne verknüpft mit dem Thema Immigration. Innenpolitisch sind die Studiengebühren am Rande ein Thema. Die Demokraten wollen Hochschulbildung zugänglicher und erschwinglicher machen und zum Beispiel schon länger mit Gebührenerlassen für Entlastung sorgen. Die Republikaner entgegnen, es sei ungerecht, wenn einige Studierende entschuldet würden, während andere ihre Kredite abbezahlen mussten.
Gibt es im Bereich Forschungspolitik aus Ihrer Sicht Überschneidungen zwischen den Wahlprogrammen?
Parteiübergreifendes Ziel ist es, den eigenen Markt zu stärken. Das gilt durchaus auch für die Bereiche Bildung und Innovation, nur die Ansätze sind unterschiedlich: eine stärkere Regulierungsaufsicht auf republikanischer Seite, mehr staatliche Unterstützung auf demokratischer. Beide Parteien wollen das eigene Wissenschaftssystem so kompetitiv und stark wie möglich halten, was immer auch wirtschaftliche Implikationen hat. Man setzt auf die eigene Innovationsstärke, ist sich aber bewusst, dass man für die eigene Wettbewerbsfähigkeit auch den internationalen Austausch braucht. Das war auch unter der ersten Trump-Regierung nicht anders. Auch damals hat man sich nicht gänzlich abgeschottet.
Apropos Abschottung: Experten warnen davor, dass der globale Innovationsmotor ins Stocken gerät, wenn das Verhältnis zwischen China und den USA sich weiter verschlechtert. Was würde ein Präsident Trump für die Beziehung bedeuten?
Das US-Wissenschaftssystem ist weniger stark von staatlichen Fördermitteln abhängig als das deutsche. Die Hochschulen sind hier deutlich autonomer und steuern ihre Forschungskooperationen eigenständiger. Es wird also – egal welche Partei das Rennen macht – auch weiter Kooperationen geben. Ein Knackpunkt könnte die Visavergabe sein. Unter der ersten Trump-Präsidentschaft wurde diese wesentlich restriktiver gehandhabt. Es ist auch denkbar, dass bei einer Wiederwahl Trumps im Bereich der US-Beteiligung an internationalen Forschungsprojekten gekürzt wird.
Was ist mit Blick auf China von einer möglichen demokratischen Präsidentin Kamala Harris zu erwarten?
Man setzt die Hoffnung in die Demokraten, dass sie in Sachen Diplomatie auch Science Diplomacy etwas besser navigieren können. Über Harris’ Running Mate Tim Walz ist bekannt, dass er einer der ersten amerikanischen Lehrkräfte im Rahmen der World-Teach-Initiative der Harvard University in China gewesen ist und dort gelehrt hat. Er hat die Vizepräsidentendebatte genutzt, um positiv von seinen Auslandserfahrungen und dem Mehrwert von internationalem Austausch zu sprechen. Während Trump in seiner ganzen Rhetorik anti-China ist, er bezeichnet das Coronavirus zum Beispiel immer noch als “China-Virus”. Den Demokraten traut man eher zu, einen Mittelweg in den Beziehungen zu finden. Aber auch hierzulande spielt das Thema Forschungssicherheit eine zentrale Rolle, und zwar parteiübergreifend, wenn auch mit unterschiedlichen Ansätzen.
In Deutschland wird intensiv darüber diskutiert, wie man sich auf eine zweite Präsidentschaft von Donald Trump einstellen kann. Welche Rolle spielt dabei die viel beschworene Science Diplomacy?
Es geht darum, bestehende Netzwerke zu pflegen und auch unabhängig von der regierenden Partei aufzuzeigen, dass die wissenschaftlichen Beziehungen zu den USA einen gegenseitigen Mehrwert haben. Es ist im Interesse beider Länder, die Wissenschaftsbeziehungen mit voller Kraft fortzuführen, auch wenn uns die politische Richtung einer neuen Regierung nicht zusagen sollte. Es wird darum gehen, gemeinsame Themen zu identifizieren, an denen man noch intensiver zusammenarbeiten kann und dafür Partner zu suchen. Im Bereich Klimaforschung beispielsweise gibt es viele Anknüpfungspunkte auf Ebene der Bundesstaaten, sodass das föderale System der USA auf beiden Seiten viele Türen öffnen oder offenhalten kann.
Welche konkreten Folgen könnte die Wahl für die deutsch-amerikanische Beziehung im Bereich Wissenschaft haben?
Es gibt Stimmen, die sagen, dass der amtierende Präsident Joe Biden der letzte wahre Transatlantiker ist. Je nach Besetzung des Kongresses könnten die USA eine sehr viel selektivere Außenwissenschaftspolitik führen, nicht nur mit Blick auf China. Der Fokus der USA schwenkt stärker in Richtung Indopazifik, auch im Wissenschaftsbereich. Aber auch da haben wir als Bundesrepublik Deutschland eine Menge bewährte Expertise und Kontakte und es gibt viele Themen, die zukünftig multi-lateral bearbeitet werden müssen. Gleichzeitig ist es wichtig, das eigene Licht nicht unter den Scheffel zu stellen. Nicht zufällig wurden bei den WTZ-Verhandlungen in Berlin erst im Mai einige neue Impulse gesetzt, etwa ein neues Memorandum of Understanding zur Quantenforschung. Das ist nicht alles hinfällig, nur weil es einen neuen Präsidenten oder eine neue Präsidentin gibt. Gerade im Bereich Wissenschaft sind die deutsch-amerikanischen Partnerschaften über Jahrzehnte gewachsen und von großer Kontinuität geprägt.
In welchen Forschungsbereichen werden die USA, abhängig oder unabhängig vom Wahlergebnis, Schwerpunkte setzen?
Das ist auch abhängig von der Zusammensetzung des Kongresses. Die Demokraten setzen tendenziell stärker auf die Grundlagenforschung und Klimaschutz, dabei geht es auch ums Framing: Eigentlich leistet der Inflation Reduction Act beispielsweise einen enormen Schub für saubere Energie und Klimaschutz. Ein Programm mit Klimaschutz im Namen wäre derzeit ein hard sell, aber auch die Republikaner wollen die Inflation bekämpfen. Darüber hinaus gibt es parteiübergreifend bei KI und der Quanten- und Fusionsforschung, Halbleiter und Mikroelektronik starke Verbindungen nach Europa und natürlich auch beim gemeinsamen Thema Forschungssicherheit. Es geht den US-Amerikanern darum, mit like minded partners an Zukunftsthemen zu arbeiten, die auch einen Vorsprung zum Beispiel gegenüber China und Russland versprechen. Auch die militärische Forschung könnte in den USA eine noch größere Rolle einnehmen, insbesondere unter Trump.
Welche Auswirkungen wird die Wahl auf Ihre eigene Arbeit haben. Sie stehen persönlich gerade am Start. Wie planen Sie für die nächste Zeit?
Wir planen nicht Programm A, wenn die Demokraten gewinnen und Programm B, wenn die Republikaner gewinnen. Unser Grundprinzip ist, bestehende Strukturen und den Austausch zu verdichten und stärken. Wir wollen den gegenseitigen Mehrwert deutlich machen und eine Art Interpretationshilfe leisten – in beide Richtungen. Durch unser Netzwerk können wir ein zeitgemäßes, modernes Deutschlandbild an und in die US-Universitäten tragen, und zwar nicht nur an den Küsten, sondern bis ins amerikanische Heartland. Es geht dabei auch darum, Entwicklungen in Deutschland hier vor Ort besser einzuordnen. Zum Beispiel das Erstarken der AfD. In umgekehrter Richtung wird es ebenfalls wichtiger werden, Entwicklungen in den USA einzuordnen zu helfen. Ganz konkret werden im akademischen Austausch hybride Programme mit beidseitigen Kurzaufenthalten und Online-Phasen immer wichtiger. Und: persönliche Kontakte, Besuchsprogramme und Delegationsreisen sind zentral, auch und gerade nach der Wahl.
Christian Strowa hat Anglistik, Psychologie und Medienwissenschaften studiert und leitet seit September 2024 die DAAD-Außenstelle Nordamerika in New York. Davor leitete er in der DAAD-Zentrale in Bonn den Bereich “Wissen und Netzwerk” und war unter anderem für das Kompetenzzentrum Internationale Wissenschaftskooperationen (KIWi) verantwortlich.


Jutta Allmendinger – ehemalige Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB)
Jutta Allmendinger ist eine der bekanntesten Wissenschaftlerinnen hierzulande. Die ehemalige Präsidentin des WZB (2007 bis 2024) beteiligte sich in den vergangenen beiden Jahrzehnten mit Expertise, aber auch meinungsstark an unzähligen gesellschaftlichen Debatten. Schwerpunkte ihrer international anerkannten Forschung umfassen die Soziologie des Arbeitsmarktes, die Bildungssoziologie, soziale Ungleichheit und Sozialpolitik. Wer glaubt, dass es ruhig um Allmendinger wird, weil ihre Nachfolgerin Nicola Fuchs-Schündeln inzwischen übernommen hat, der dürfte sich täuschen. Allmendinger hat unter anderem im Juni den Vorsitz der Wissenschaftlichen Kommission Niedersachsen übernommen und wird dem neuen Ethikrat der Bundesregierung angehören.

Ralph Caspers – Moderator des WDR-Youtube-Kanals Quarks Dimension Ralph
Um die Vermittlung von Wissen und Wissenschaft vor allem an ein junges und junggebliebenes Publikum hat sich Ralph Caspers sehr verdient gemacht. Der Moderator und Autor aus Köln ist vor allem durch die Moderation der “Sendung mit der Maus” und der KIKA-Sendung “Wissen macht Ah!” bekannt, die er über 20 Jahre moderierte. Seit 2010 steht er bei “Quarks” und “Frag doch mal die Maus” als “Mausexperte” vor der Kamera und betreibt mit “Quarks Dimension Ralph” seinen eigenen Youtube-Kanal. Nebenbei ist er Autor mehrerer Kinderbücher. Für seine Leistungen wurde Caspers bereits mehrfach ausgezeichnet. Er erhielt 2010 den Erich-Kästner-Preis, 2012 den Grimme-Preis und 2019 das Bundesverdienstkreuz.

Mai Thi Nguyen-Kim – Moderatorin der ZDF-Show MAITHINK X
Nachdem die promovierte Chemikerin 2014 verschiedene Science Slams gewonnen hatte, wagte sie sich an die Videoproduktion. Ihr Video “Trust me I’m a Scientist”, das 2016 den Fast Forward Science-Award gewann, kann bereits als Reaktion auf die Zunahme von Fake News und das Aufkommen des Trumpismus gesehen werden. Nach dem Abschluss ihrer Promotion 2017 widmete sie sich vollständig der Wissenschaftskommunikation und dem Wissenschaftsjournalismus. Sie moderierte Quarks beim WDR und publizierte Web-Videos auf den Kanälen MaiLab und später MAITHINK X. Ein Millionenpublikum erreichte Nguyen-Kim mit ihren Videos zur Corona-Pandemie. Seit 2021 hat sie ihre eigene Show bei ZDFneo. Die gebürtige Heppenheimerin sitzt im Senat der Max-Planck-Gesellschaft.

Thomas Sattelberger – ehemaliger Parlamentarischer Staatssekretär im BMBF
“Endlich normaler Bürger!” So beschreibt sich Thomas Sattelberger selbst auf der Plattform X. Auch wenn er im Mai 2022 sein Amt als Parlamentarischer Staatssekretär im BMBF aus privaten und gesundheitlichen Gründen niederlegte, stimmt diese Aussage nicht ganz. Der Manager, frühere Leiter Personalentwicklung bei der Lufthansa und Personalvorstand und Arbeitsdirektor bei der Telekom meldet sich weiterhin meinungsstark im politischen Betrieb zu Wort – nicht nur mit seinen Kolumnen im Research.Table. Er tritt für Diversity Management, mehr MINT und mehr Frauen in der Führung ein. Das langjährige FDP-Mitglied provoziert gern – und das nicht erst jetzt: In jungen Jahren war Sattelberger mit Joschka Fischer in der Außerparlamentarischen Opposition (APO) aktiv – für eine “sozialistische Weltrevolution”.
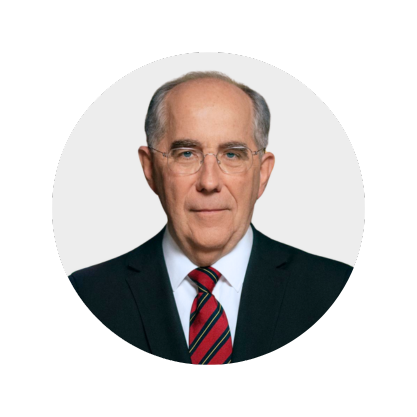
Reinhard Pöllath – Rechtsanwalt und Mitgründer der Max-Planck-Förderstiftung
Der gebürtige Oberfranke und Sohn einer Schreinerfamilie entschied sich für ein Jurastudium und absolvierte an der Harvard Law School seinen Master. 1997 gründete er die Kanzlei P+P Pöllath + Partners. Pöllath ist Honorarprofessor am Institut für Steuerrecht der Universität Münster und Vorstandssprecher der Max-Planck-Förderstiftung, die er 2006 gemeinsam mit Stefan von Holtzbrinck gegründet hat. Darüber hinaus engagiert er sich in der Beiersdorf-Unna-Stiftung und ist Mitglied des Kuratoriums der Stiftung Lindauer Nobelpreisträgertreffen. Anlässlich seines 60. Geburtstags erreichte die Max-Planck-Gesellschaft bei der International Astronomical Union, dass der Asteroid 7448 nach Reinhard Pöllath benannt wurde. Der Himmelskörper wurde am Tag vor Pöllaths Geburt entdeckt.

Max Voegler – Vice President for Global Strategic Networks – DACH bei Elsevier
Der Historiker, der für das Unternehmen Elsevier strategische Netzwerke gestaltet, beschreibt sein Verhältnis zur Wissenschaft wie folgt: “Ich liebe das Wissenschaftssystem mit seiner ungeheuren Vielfalt an Disziplinen und Themen.” Als Vice President for Global Strategic Networks für Elsevier DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) ist er also genau richtig. Voegler ist ein Netzwerkexperte, der sich selbst als deutsch-amerikanisches Hybridmodell bezeichnet. Schon als Kind lebte er einige Jahre lang in den USA, seine Doktorarbeit in europäischer Geschichte schrieb er in New York, wo er später Leiter des DFG-Büros wurde. Ein ausführliches Porträt lesen Sie hier.

Amrei Bahr – Juniorprofessorin an der Universität Stuttgart
Amrei Bahr fühlte sich angesprochen, als sich das BMBF im Jahr 2021 in einem Video an der Erklärung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG) probierte. Die dortige Darstellung, nach der das WissZeitVG verhindere, dass eine Generation alle Stellen in der Wissenschaft verstopfe, löste heftige Kritik beim wissenschaftlichen Nachwuchs aus. Die Wortführenden Amrei Bahr, Sebastian Kubon und Kristin Eichhorn gründeten die Beschäftigten-Initiative #IchBinHanna – benannt nach der fiktiven Protagonistin des BMBF-Imagefilms. Die über soziale Netzwerke organisierte Graswurzelbewegung wurde zu einer unüberhörbaren Stimme in der Debatte um die Novellierung des Gesetzes in dieser Legislaturperiode – und Amrei Bahr zu ihrem Gesicht.

Johannes Vogel – Generaldirektor des Museums für Naturkunde Berlin
Er fällt auf durch seinen Dalí-Schnurrbart und seine zumeist mit botanischen Motiven versehenen Krawatten. Im Gespräch mit Table.Briefings trug er sogar rote Manschettenknöpfe in Tomatenform. Der Botaniker, seit 2012 Direktor des Berliner Museums für Naturkunde – Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung, macht ebenfalls als Wissenschaftler, Visionär und durch sein gesellschaftspolitisches Engagement von sich reden. Er hat das Museum auch zu einem Ort der politischen Debatte gemacht. Wenn es um den Einsatz für unsere rechtsstaatliche Demokratie und um die Aufrechterhaltung unserer natürlichen Lebensgrundlagen gehe, müsse man politisch sein, sagt er. Bevor er nach Berlin kam, war Vogel am Natural History Museum in London. Verheiratet ist er mit Sarah Darwin, der Ur-Ur-Enkelin von Charles Darwin.

Stefan Brandt – Direktor des Futuriums
Seit 2017 ist er Direktor des Futuriums, das direkt neben dem Berliner Gebäude des BMBF gelegen ist. In dem Ausstellungs-, Veranstaltungs- und Experimentierforum geht es um Zukunftsszenarien und ihre aktive Gestaltung. Aktuell kann sich der Kulturmanager über Besucherrekorde freuen. Zuletzt schloss sich auch die DFG dem Kreis der Gesellschafter an, zu denen bereits die Wissenschaftsorganisationen MPG, Helmholtz und Leibniz gehören. “Wir werden wahrgenommen als eine Einrichtung, die für niemanden Werbung macht, weder für die Bundesregierung noch für Unternehmen oder andere Akteure”, sagte er im Gespräch mit Table.Briefings. Brandt stammt aus Weimar, ist promovierter Musikwissenschaftler und war vor seinem Wechsel nach Berlin Geschäftsführer und Vorstand der Hamburger Kunsthalle.

Hasso Plattner – Mitbegründer von SAP und Mäzen
Seit sich der Mitbegründer des IT-Unternehmens SAP aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen hat, engagiert er sich als Mäzen. Er hat viel ermöglicht, im Kulturbereich etwa den Wiederaufbau des Potsdamer Palais Barberini. In der Wissenschaft hat er sich als Stifter und Gründer des Hasso-Plattner-Instituts für Softwaresystemtechnik (HPI) an der Universität Potsdam hervorgetan, das Informatiker ausbildet. Gesellschafter ist die Hasso Plattner Foundation, die den Betrieb vollständig finanziert. Plattner hat in Karlsruhe Nachrichtentechnik studiert, seine ersten beruflichen Schritte machte er 1968 bei IBM in Deutschland, bereits vier Jahre später gründete er mit seinen Kollegen Claus Wellenreuther, Hans-Werner Hector, Klaus Tschira und Dietmar Hopp die Firma SAP.
29.-30. Oktober 2024, Berlin Adlershof Science City
Konferenz Science for Future: On the Path to Carbon Neutrality Mehr
30. Oktober – 1. November 2024, Heidelberg
Konferenz Wissenswerte Mehr
2. November 2024, Humboldt-Universität zu Berlin
Berlin Science Week, Live-Podcast “Fragile Freiheit” Mehr
4. November 2024, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung
Diskussion Bedrohte Wissenschaft: Ungeliebte Wahrheit Mehr
4. November 2024, TU Berlin
Diskussion “Resiliente Universität. Internationale Kooperation in Zeiten der Krise” Mehr
7.-9. November 2024, Berlin
Konferenz Falling Walls Science Summit 2024 Mehr
8. November 2024, Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, Berlin
Diskussion Bedrohte Wissenschaft: Politische Einflussnahme Mehr
11.-12. Dezember, Berlin
Forum Wissenschaftskommunikation Wissenschaftskommunikation für eine starke Demokratie und offene Gesellschaft Mehr
Im Juli ist die Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde (DGO) vom russischen Justizministerium als “extremistische Organisation” eingeordnet worden. Dieser Schritt wurde bereits von verschiedenen Stiftungen und Verbänden kritisiert, nun äußert sich dazu auch die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) mit warnenden Worten. Mit der Einstufung sei ein neuer Tiefpunkt in den aktuell ohnehin stark eingeschränkten russisch-deutschen Wissenschaftsbeziehungen erreicht, teilte die HRK am Montag mit.
Nun drohten potenziell jedem nach Russland reisenden DGO-Mitglied willkürliche Kriminalisierung und strafrechtliche Verfolgung. Zudem könne jeder, auch private Austausch von DGO-Mitgliedern mit russischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern deren Sicherheit gefährden.
“Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ruhen die institutionellen Wissenschaftskooperationen zwischen Deutschland und Russland. Das ist schmerzhaft, aber richtig”, sagte HRK-Präsident Walter Rosenthal. Persönliche Kontakte blieben grundsätzlich möglich – auch um die Reste einer wertegebundenen, liberalen Wissenschaft und Zivilgesellschaft in Russland zu unterstützen. “Dagegen richten sich offenbar verstärkt Maßnahmen des russischen Regimes.”
Nach russischem Recht erfülle die bloße Mitgliedschaft in und die Zusammenarbeit mit der DGO nunmehr Straftatbestände, die mit Haftstrafen von bis zu zwölf Jahren geahndet werden können. Angesichts der gravierenden Folgen, die daraus für Mitglieder der Fachgesellschaft und ihre Kooperationspartner erwachsen, hat die HRK ihre Mitglieder gebeten, alle Hochschulangehörigen entsprechend zu sensibilisieren, um sie vor möglichen Gefahren und Repressalien zu schützen.
Die Bemühungen, die DGO mundtot zu machen, ziehen sich bereits länger hin. Im Februar war sie von russischer Seite bereits zur “unerwünschten Organisation” erklärt worden – was vor allem für russische Staatsangehörige bei einer Zusammenarbeit oder der Teilnahme an Veranstaltungen drastische Strafen bedeutet.
Der deutsche Botschafter in Moskau, Alexander Graf Lambsdorff, hat in der vergangenen Woche beim russischen Außenministerium erneut gegen die völlig ungerechtfertigte Einstufung der DGO protestiert. Er forderte Russland auf, das so schnell wie möglich rückgängig zu machen. In einer Verbalnote habe die deutsche Seite Lambsdorff zufolge deutlich gemacht, dass die DGO seit vielen Jahrzehnten eine der wichtigsten Organisationen der Osteuropakunde sei. abg
Bayerische Kleinstsatelliten sollen in Zukunft aus dem Weltraum hochauflösende Fotos des Freistaats liefern. Bereits Ende 2025 bis Anfang 2026 sollen die ersten fünf Satelliten im Auftrag der Vermessungsverwaltung zu einer Probemission ins All starten, um dann in einer Umlaufbahn von 460 Kilometern über der Erde ihre Arbeit aufzunehmen. Die Satelliten sind nur 37 mal 23 mal 10 Zentimeter groß und wiegen nur zehn Kilogramm.
“Mit einer eigenen Erdbeobachtungsmission wollen wir demnächst ins All starten und uns maßgeschneiderte Geodaten direkt aus dem Weltraum holen”, sagte der bayerische Finanz- und Heimatminister Albert Füracker (CSU). Die gesamte Prozesskette des Forschungsprojekts bleibe in bayerischer Hand – von der Datenaufnahme im All über die Verarbeitung am Boden bis zur Bereitstellung für alle Bürgerinnen und Bürger. “Dies ist ein entscheidender Vorteil gegenüber kommerziellen Anbietern und ein wichtiger Beitrag zur digitalen Souveränität des Freistaats.”
“Die gewonnenen Satellitendaten werden sich ideal für Auswertungen bei Hochwasserprognosen, Klimaveränderungen oder in der Land- und Forstwirtschaft eignen”, sagte Füracker. Durch ein KI-unterstütztes Datenauswertungs- und Managementsystem würden die Daten aus dem All effizient gespeichert, analysiert und visualisiert. “Damit ermöglichen wir eine zeitnahe und zielgerichtete Weiterleitung der Informationen an relevante Stellen innerhalb und außerhalb der Staatsverwaltung.”
Konkret handelt es sich um mit einer Multispektralkamera ausgestattete Kleinstsatelliten, die in Kooperation mit dem Zentrum für Telematik und der S4 Smart Small Satellite Systems GmbH entwickelt wurden. Diese sollen alle drei Tage Bilder des Freistaats liefern. Unterstützt wird das Projekt von der Technischen Universität München bei der Entwicklung der Auswertealgorithmen. Nach einem umfassenden Probebetrieb soll in einem zweiten Schritt über den Ausbau der Mission zur Erfassung ganz Bayerns entschieden werden. Mit der Mission werde Bayern auch als industrieller Raumfahrtstandort gefördert und gleichzeitig die bayerische Wirtschaft gestärkt, so Füracker. tg mit dpa
Mehr als 80 US-Nobelpreisträger haben sich in einem offenen Brief für die Demokratin Kamala Harris als Präsidentin ausgesprochen. “Das ist die folgenschwerste Präsidentschaftswahl seit langem, vielleicht jemals, für die Zukunft der Wissenschaft und der Vereinigten Staaten”, heißt es in dem Brief, den unter anderem die New York Times veröffentlichte.
“Wir Unterzeichner unterstützen Harris mit Nachdruck.” Harris verstehe, dass das Wachstum der Lebenserwartung und des Lebensstandards der vergangenen Jahrzehnte in den USA zu großen Teilen auf Fortschritte bei Wissenschaft und Technologie zurückgehe, heißt es weiter. Zudem verstehe sie die zentrale Rolle, die Einwanderer bei diesen Fortschritten gespielt hätten. Unter Trump wären diese Fortschritte in Gefahr.
Initiator des Briefes ist Joseph Stiglitz, Wirtschaftswissenschaftler an der Columbia University. Er erhielt 2001 den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften. Im Gespräch mit der New York Times sagte Stiglitz, dass ihn die “enormen Kürzungen der Wissenschaftsbudgets”, die Trump schon während seiner ersten Präsidentschaft vorgeschlagen hatte, sowie die “wissenschaftsfeindliche” und “universitätsfeindliche” Haltung des ehemaligen Präsidenten zu der Initiative motiviert hätten.
“Ich hoffe, es ist ein Weckruf für die Menschen”, sagte Stiglitz. Die Wahl habe tiefgreifenden Einfluss auf die wissenschafts- und technologiepolitische Agenda. tg
FAZ: KI-Einsatz regeln und nicht verbieten. Generative KI gehört an Hochschulen längst zum Alltag. Verbieten kann und sollte man sie nicht. Was aber geschaffen werden sollte, sind Regelwerke und ein Verhaltenskodex für den Umgang mit KI-Systemen. (“Ein Regelwerk für den KI-Gebrauch”)
NZZ: Arbeiten über Designer-Babys. Der chinesische Biophysiker He Jiankui designte mit dem Gentechnikverfahren Crispr vor sechs Jahren zwei Kinder. He, der dafür ins Gefängnis kam, will nun die bei diesem Verfahren gesammelten wissenschaftlichen Daten veröffentlichen. Bedingung ist allerdings, dass dies in einer renommierten wissenschaftlichen Publikation geschieht. (“Wie sind die ersten Designer-Babys entstanden? Jetzt will der verantwortliche Forscher endlich seine Studien veröffentlichen”)
Tagesspiegel: Weniger Studierende in den Ingenieurwissenschaften. In den letzten zehn Jahren ist die Zahl der Erstsemester in den Ingenieurwissenschaften und der Informatik laut Zahlen des Centrum für Hochschulentwicklung um 11.000 auf knapp 110.000 gesunken. Besonders betroffen von dieser Entwicklung sind die Elektrotechnik und der Maschinenbau. (“Weniger Erstsemester in Mint-Fächern: Experten warnen vor Verschärfung des Fachkräftemangels”)
Stern: Gesichtserkennungssoftware bei Prüfungen erlaubt. Nach einem Urteil des Landgerichts Erfurt ist der Einsatz von Gesichtserkennungssoftware bei Online-Prüfungen legal. Gegen den Einsatz der Software während einer Prüfung in der Pandemie hatte die Gesellschaft für Freiheitsrechte geklagt. (“Gesichtserkennung bei Onlineprüfungen an Universität Erfurt rechtens”)
Nürnberger Nachrichten: Kein Chip-Forschungszentrum in Franken. Die Pläne für ein gemeinsames Chip-Forschungszentrum von Wolfspeed und dem Autozulieferer ZF wurden gestoppt. Es sollte auf eine Fabrik für Leistungshalbleiter im Saarland ausgerichtet sein, deren Bau sich ebenfalls verzögert. (“Projekt gestoppt: Franken bekommt wohl doch kein neues Forschungszentrum für Mikrochips”)
Guardian: Weniger schwarze Studierende an US-Unis. Seit der Oberste Gerichtshof der USA die Förderung von Minderheiten verboten hat, ist die Zahl der Studienanfänger farbiger Herkunft zurückgegangen. Als Reaktion haben mehrere Universitäten den Legacy-Status bei der Zulassung nicht mehr zu berücksichtigen, der Studienanfänger mit Alumni in der Familie bevorzugte. (“US universities are struggling to increase diversity. Are legacy admissions part of the problem?”)
Welt: Ivy-League-Unis sind ihr Geld nicht mehr wert. Der Vormarsch der Künstlichen Intelligenz, Antisemitismus, Kulturkämpfe und immer mehr gut bezahlte Berufe, für die man keinen Hochschulabschluss benötigt, bereiten den US-Eliteunis zunehmend Probleme. Die mit hohen Kosten verbundenen Abschlüsse der Ivy-League-Unis lohnen sich immer weniger. (“Wie Amerikas Elite-Universitäten an Wert verlieren”)

Der Sanierungsstau an deutschen Hochschulen wird derzeit auf 74 Milliarden Euro geschätzt. Diese Summe lässt sich nicht aus den laufenden Landeshaushalten finanzieren. Vor dem Hintergrund der Schuldenbremse wird derzeit vermehrt als Lösung die Gründung privatrechtlich organisierter öffentlicher Infrastrukturgesellschaften diskutiert, um hierüber die Aufnahme von Krediten trotz Schuldenbremse zu ermöglichen und damit den Sanierungsstau an Hochschulen abzubauen.
Dabei ist jedoch zu bedenken: Selbst wenn es sich hier um ein rechtskonformes Konstrukt handelt, so werden in der Realität die Landeshaushalte dennoch in gleicher Höhe finanziell belastet wie bei einer eigenen Kreditaufnahme durch das Land. Denn auf der Ausgabenseite müssen Tilgungsraten für Kredite durch Mieten im Landeshaushalt ersetzt werden.
Das Modell von Infrastrukturgesellschaften zum Hochschulbau gibt es bereits in zwei Bundesländern (Nordrhein-Westfalen und Hamburg). In Hamburg sind aktuell nur einzelne Hochschulgebäude Teil des Modells. Die landeseigenen Infrastrukturgesellschaften Sprinkenhof GmbH sowie GMH errichten Neubauten und treten für diese als Vermieter gegenüber den Hochschulen beziehungsweise der Wissenschaftsbehörde auf. Die Mieten sind im Landeshaushalt im Wissenschaftsressort veranschlagt. Langfristig ist die Übernahme aller Hochschulliegenschaften durch die beiden Gesellschaften geplant.
In NRW existiert ein Sondervermögen, das kreditfähig ist und vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB) verwaltet wird. Das Sondervermögen enthält den Großteil aller Landesliegenschaften, also auch die Hochschulliegenschaften. Der BLB tritt somit als Vermieter auf. Hier werden ebenfalls die Mieten im Landeshaushalt im Wissenschaftsressort veranschlagt. Allerdings wird die Kreditaufnahme für das Sondervermögen vermutlich der Schuldenbremse unterliegen.
Schwer nachweisbar ist zudem, dass in diesen Bundesländern der Bestandserhalt beziehungsweise der Abbau des Sanierungsstaus im Hochschulbereich durch das Modell schneller beziehungsweise überhaupt erreicht werden kann. Die Situation stellt sich nach wie vor ähnlich wie in den anderen Bundesländern dar.
Ein erfolgreicher Weg zum Abbau des Sanierungsstaus bedarf grundsätzlicher Änderungen in der Herangehensweise. Das betrifft zum einen die Bedarfsermittlung und zum anderen die Haushaltspraxis. Der Umstand, dass erstellte Gebäude regelmäßige Reinvestitionen bedürfen, um dauerhaft genutzt werden zu können, ist in der Vergangenheit sowohl bei Bauentscheidungen als auch den anschließenden Haushaltsplanungen tendenziell unberücksichtigt geblieben.
Unmittelbar nach jeder Maßnahme, Neuerstellung oder Sanierung beginnt theoretisch der Wertverlust, der sich nach einer gewissen Zeit auch als realer Substanzverlust darstellt. Einem Wertverlust muss immer eine entsprechende Reinvestition in der Haushaltsplanung gegenüberstehen. Diese Vorgehensweise findet in der Kameralistik der Landeshaushalte und dem Bundeshaushalt jedoch keine Anwendung. Dadurch entsteht ein Teufelskreis, der zu immer wieder neuen, scheinbar überraschend erforderlichen Kreditaufnahmen führt.
Doch auch in der Kameralistik ist es möglich, entsprechende Budgets für den Bestandserhalt, der den investiven Bereich tangiert, im Landeshaushalt vorzuhalten. Ein Beispiel dafür ist Baden-Württemberg, wo ein jährliches Budget von 1 Milliarde Euro für Investitionen zum Bestandserhalt aller landeseigenen Gebäude (inklusive Hochschulgebäude) in den Haushalt eingestellt ist.
Damit die Kreditaufnahmen der privatrechtlich organisierten öffentlichen Infrastrukturgesellschaften nicht der Schuldenbremse unterliegen, müssen weitere Bedingungen erfüllt sein – die jedoch zu organisatorischen Herausforderungen führen. So müssen die Infrastrukturgesellschaften die Eigentümer- und Bauherrenaufgaben sowie einen Großteil der Gebäudemanagementaufgaben für die von ihnen erstellten Gebäude übernehmen, um als Vermieter, dem Mieten aus dem Landeshaushalt zugewiesen werden, auftreten zu können.
Um dieses Modell insbesondere mit Blick auf den Bestandserhalt umzusetzen, wäre eine Übertragung aller Hochschulliegenschaften auf die Infrastrukturgesellschaft erforderlich. Alle derzeit bestehenden Aufgaben zur Infrastruktur in den Hochschulen und Landesbaubetrieben würden diesen damit entzogen werden. Bei sukzessiver Übertragung hingegen kommt es über einen langen Zeitraum zu Parallelstrukturen und überschneidenden Zuständigkeiten zwischen den Infrastrukturgesellschaften, Landesbaubetrieben und den Hochschulen in Bezug auf den Gebäudebetrieb und das Gebäudemanagement. Zudem würde es den berechtigten Bestrebungen der Hochschulen zur Vereinfachung und Beschleunigung der Bauprozesse durch Reduzierung der an Bauprozessen Beteiligten zuwiderlaufen.
Darüber hinaus würde dieses Modell den Bestrebungen der Länder entgegenstehen, den Hochschulen, die aktuell auch den größten Teil der Gebäudemanagementaufgaben wahrnehmen, verstärkt die Bauherrenfunktion zu übertragen. Die Übertragung der Bauherrenfunktion wird ebenfalls als Lösung des Abbaus des Sanierungsstaus angesehen.
Ein zentrales Problem, das durch die Gründung neuer Infrastrukturgesellschaften tendenziell verstärkt wird, stellen zudem die begrenzten Personalkapazitäten unter anderem in den Landesbaubetrieben dar – ein weiterer Grund für die Übertragung der Bauherrenfunktion auf die Hochschulen. Der Erfolg der Gründung zusätzlicher Infrastrukturgesellschaften zu den bestehenden Einrichtungen erscheint angesichts des aktuellen Personalmangels fraglich und würde zu einer Verschärfung der Personalsituation bei Landesbetrieben und Hochschulen führen.
Zwar kann die Gründung von Infrastrukturgesellschaften eine Option sein, Kredite trotz Schuldenbremse aufzunehmen und dadurch dem System dringend benötigtes Geld für den Abbau des Sanierungsstaus zuzuführen. Entscheidend aus Sicht von HIS-HE ist aber, dass eine ganzheitliche Betrachtung des Immobilienbestands von Hochschulen erfolgt, eine realistische Kostenbetrachtung vorgenommen wird, die von Beginn an nicht nur Kosten für den Bau beziehungsweise die Sanierung sowie den Betrieb, sondern vor allem auch Reinvestitionskosten berücksichtigt und entsprechende Mittel in die Haushaltsplanungen Eingang finden.
Jana Stibbe ist beim HIS-Institut für Hochschulentwicklung (HIS-HE) in Hannover Expertin für Organisation im Hochschulbau, Grit Würmseer ist Geschäftsführende Vorständin.
Die bisherigen Beiträge der Table.Briefings-Serie zum Hochschulbau finden Sie hier.

Eines Tages, so hatte ihr Lehrer vorhergesagt, werde sie Mathematikprofessorin sein. Das war in den 1990er-Jahren, und ganz daneben lag er mit seiner Prognose nicht. Denn Lena Maier-Hein wurde Informatikprofessorin, blieb also der Welt der Zahlen treu. Allerdings auf weniger theoretische Weise als ihr Lehrer es vermutet hatte.
Heute leitet die 44-Jährige am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) die Abteilung Intelligente Medizinische Systeme und ist als Professorin sowohl an der Medizinischen Fakultät als auch an der Fakultät für Mathematik und Informatik der Universität Heidelberg tätig. “Das Analytische liegt mir”, sagt Maier-Hein, “und es begeistert mich, neue Konzepte in Diagnostik- und Therapiemöglichkeiten umzuwandeln.” Wie sie dabei vorgeht, berichtet sie am 9. November beim Falling Walls Science Summit in Berlin.

Im Fokus steht bei ihr die Chirurgie. “In der Krebschirurgie beispielsweise fehlt es bislang an Methoden, mit denen Chirurginnen und Chirurgen während einer Operation Funktion und Zustand von Geweben beurteilen können”, sagt die Informatikerin. Diesen Mangel beheben könnten künftig neuartige spektrale Bildgebungsverfahren, die ihr interdisziplinäres Team mit besonderen Kameras und Künstlicher Intelligenz kombiniert. Lena Maier-Hein: “So wird es möglich, in Echtzeit und ohne Strahlenbelastung in den menschlichen Körper hineinzusehen – und dabei für das menschliche Auge unsichtbare Informationen sichtbar machen.”
Damit Chirurgen und Patienten möglichst schnell von dem neuen Verfahren profitieren können, arbeitet Maier-Hein eng mit wissenschaftlichen, klinischen und industriellen Partnern zusammen. Für ihre hervorragende Transferarbeit erhielt sie am 22. Oktober den Landesforschungspreis Baden-Württemberg für Spitzenleistungen in der angewandten Forschung.
Maier-Hein habe enorme Fortschritte an der Schnittstelle von Künstlicher Intelligenz und chirurgischer Bildgebung erzielt, was die Effektivität und Sicherheit operativer Eingriffe deutlich erhöhe, heißt es in der Preisbegründung. Zudem habe sie gänzlich neue Forschungsfelder mit höchster Relevanz für medizinische Forschung und direkte klinische Anwendungen eröffnet.
Bereits als Studentin an der Universität Karlsruhe und am Imperial College in London wurde die gebürtige Hamburgerin mehrfach ausgezeichnet. 2013, da hatte sie gerade mal ein Jahr lang eine Juniorgruppe am DKFZ geleitet, erhielt sie den Heinz Maier-Leibnitz Preis der DFG. 2016 kam der Emil-Salzer Preis des DKFZ dazu, 2017 der Preis der Berlin-Brandenburgischen Akademie und in diesem Jahr der Deutsche Krebspreis 2024. Beim Europäischen Forschungsrat ERC errang sie zwei der höchsten Trophäen: 2014 den ERC Starting Grant, 2021 einen ERC Consolidator Grant.
Mit Mitte 40 hat Lena Maier-Hein viel erreicht – auch wenn sie in ihren Dreißigern als junge Mutter weniger arbeiten und schlafen konnte als viele ihrer Peers. Über diese Jahre und wie sie es schafft, Forschung und Familie unter einen Hut zu bekommen, davon erzählt sie in einem DKFZ-Imagefilm zusammen mit ihrem Mann, dem Informatikprofessor und Chef der DKFZ-Abteilung Medizinische Bildverarbeitung, Klaus Maier-Hein.
Ein durchorganisierter Alltag, die Kita am DKFZ und patente Großeltern, die auf die Kinder aufpassen, wenn die Eltern auf Konferenzen sind – mit Disziplin und viel Unterstützung haben es die Maier-Heins geschafft, zwei anspruchsvolle Karrieren mit Elternschaft zu verbinden. “Genau das wollten wir”, sagt er, “so haben wir es beide beschlossen.”
Im Team arbeiten Lena und Klaus Maier-Hein immer wieder auch in der Forschung. Aktuell engagieren sich beide im Human Radiome Project. Das weltweit einzigartige, federführend am DKFZ angesiedelte Projekt soll die radiologische Diagnostik und darauf aufbauende Therapien entscheidend voranbringen. Es geht darum, Auffälligkeiten zu entdecken, die dem menschlichen Auge entgehen – nicht nur im gerade untersuchten Organ, sondern auch im umgebenden Gewebe. Derzeit entsteht eine Art ChatGPT für Mediziner, ein radiologisches Basismodell für ganz unterschiedliche Anwendungen. Grundlagenforschung für die Praxis – das Credo Lena Maier-Heins kennt viele Variationen. Lilo Berg
“Breaking the Wall of Surgical Imaging” lautet der Titel von Lena Maier-Heins Vortrag am 9. November um 14.25 Uhr beim Falling Walls Science Summit in Berlin. Das Programm des Summit finden Sie hier, weitere Porträts der Table.Briefings-Reihe “Breakthrough-Minds” lesen Sie hier.
Wencke Gwozdz, Professorin für Versorgungs- und Verbrauchsforschung, wird Vizepräsidentin für Forschung und Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Sie folgt dem Veterinärmediziner Martin Kramer nach, Amtsantritt ist am 22. November.
Thomas Lemke ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender des Universitätsklinikums Carl Gustav Carus Dresden. Er folgt auf Gernot Brunner. Lemke ist seit mehreren Jahren Mitglied des Aufsichtsrates und Vorsitzender des Finanzausschusses des Klinikums. Janko Haft übernimmt das Amt des Kaufmännischen Vorstands. Er war zuletzt Direktor für Logistik, Infrastruktur und Versorgung am Klinikum. Neuer Medizinischer Vorstand ist Uwe Platzbecker.
Alexandra Nonnenmacher, seit 2019 Prorektorin für Bildung, Studium und Lehre an der Universität Siegen, wurde vom Senat der Hochschule Worms zur neuen Präsidentin gewählt. Mit der Soziologin schließt die Hochschule Worms ihre derzeitige Lücke im Präsidium. Zu Jahresbeginn waren bereits drei Professoren aus den drei Fachbereichen heraus ins Hochschulpräsidium gewechselt.
Horst Seehofer, ehemaliger bayerischer Ministerpräsident und Bundesminister a.D., wird Stiftungsratsvorsitzender der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU). Er löst Peter Beer ab, der dem Gremium seit 2018 vorstand. Die Stiftung kümmert sich insbesondere um die Vermögens- und Wirtschaftsverwaltung der Universität.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an research@table.media!
Bildung.Table. Digitalpakt II: Warum die Lehrerfortbildung das Vorhaben gefährdet. Sollen sich Lehrkräfte 30 Stunden im Jahr fortbilden müssen? Darüber sind sich Bund und Länder uneins. Ein viel größeres Problem ist das fehlende Monitoring. Mehr
Climate.Table. Atlantikströmung: Warum Forschende eindringlich vor ihrem Kollaps warnen. Der Weltklimarat habe das Risiko unterschätzt, der Zusammenbruch der wichtigen Meeresströmung könnte die menschlichen Lebensgrundlagen in Europa und darüber hinaus bedrohen. Renommierte Klimaforschende fordern die nordeuropäischen Länder deshalb dringend zum Handeln auf. Mehr
Europe.Table. “Starre Schuldengrenzen gefährden den Handlungsspielraum künftiger Generationen”. Im Streit um die deutsche Schuldenbremse verweist Finanzminister Christian Lindner gern auf die strengen EU-Fiskalregeln. Aber damit mache er es sich zu leicht, schreibt Marina Guldimann von Fiscal Future im Standpunkt. Deutschlands Problem sei eine wachstumsfeindliche Sparpolitik. Mehr
ESG.Table. Lieferketten: “Das Gesetz ist ein echter Wettbewerbsvorteil”. Die Wissenschaftlerin Lisa Fröhlich setzt einen Kontrapunkt in der aktuellen Diskussion um das Lieferkettengesetz. Es mache Unternehmen resilienter und spare ihnen sogar Geld, sagt die Gründerin des Ispira Thinktank für Nachhaltige Lieferketten im Interview. Mehr
die Schnittmengen sowie die wechselseitigen Einflüsse von Wissenschaft und Politik zeigen sich in diesen Tagen – egal wohin man blickt. Ein mutmachendes Beispiel ist die zweitägige Konferenz “Science for Future”, die heute in Berlin-Adlershof beginnt. Sie wird gemeinsam von der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina und der Chinesischen Akademie der Wissenschaften veranstaltet und es soll um die Umstellung der Energiesysteme in Richtung CO2-Neutralität gehen.
Während mit Blick auf die Forschungsbeziehungen zwischen Deutschland und China derzeit eher über De-Risking statt über Kooperation debattiert wird, treffen sich also die Wissenschaftsspitzen beider Länder. Welche gemeinsamen Ziele es noch gibt und welche wissenschaftsdiplomatischen Bemühungen dahinterstecken, hat mein Kollege Tim Gabel aufgeschrieben.
Außerdem hat er erkundet, wie viel Science Diplomacy wohl nach den Präsidentschaftswahlen im Umgang mit den USA gefragt sein wird. “Es ist im Interesse beider Länder, die Wissenschaftsbeziehungen mit voller Kraft fortzuführen, auch wenn uns die politische Richtung einer neuen Regierung nicht zusagen sollte”, hat ihm Christian Strowa, Leiter der DAAD-Außenstelle Nordamerika in New York, gesagt. Was von den Demokraten respektive Republikanern im Detail zu erwarten ist, lesen Sie im Interview.
Wie vernichtend sich Krieg und ein autoritäres Regime auf Wissenschaftsbeziehungen auswirken können, zeigt sich am Beispiel Russlands. Seit Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine ruhen die institutionellen Wissenschaftskooperationen zwischen Deutschland und Russland. Persönliche Kontakte sind noch möglich, doch auch auf dieser Ebene schaltet die russische Regierung kritische Stimmen stumm.
Ein Beispiel ist die Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, die von Moskau jüngst als “extremistische Organisation” eingestuft wurde. Dagegen protestiert nun die Hochschulrektorenkonferenz – und warnt zugleich vor möglichen Gefahren für Mitglieder der Fachgesellschaft und für ihre Kooperationspartner, wie Sie in den News lesen können.
Bleiben Sie zuversichtlich und kommen Sie gut in den Tag!


Anders als deutsche Ministerinnen und Minister haben Politiker mit Ministerrang in der Volksrepublik China ein begrenztes Reisekontingent. So ist es auch bei Hou Jianguo, Präsident der Chinesischen Akademie der Wissenschaften (CAS) und Mitglied des chinesischen Zentralkomitees. Das führt dazu, dass der diplomatische Austausch im Ausland oft auf wenige Tage begrenzt ist und in dieser Zeit ein geballtes Programm absolviert wird.
So auch in dieser Woche: Zum ersten Mal in Nach-Pandemie-Zeiten treffen sich die Spitzen der chinesischen und deutschen Wissenschaft, amtierende und ehemalige Präsidenten und Chefs der Wissenschaftsorganisationen. Bereits am gestrigen Montag haben die Max-Planck-Gesellschaft (MPG) und die CAS das 50-jährige Jubiläum ihrer “Kooperation und Netzwerkbildung” im Harnack-Haus in Berlin begangen. Am heutigen Dienstag und am Mittwoch veranstalten Leopoldina und CAS gemeinsam die zweite Science for Future-Konferenz in Berlin-Adlershof.
Die Beziehung der beiden Länder ist so angespannt wie lange nicht. Die Bundesregierung hat in ihrer China-Strategie zwar ausdrücklich zu Protokoll gegeben, dass man kein De-Coupling wünscht, wohl aber das De-Risking hervorgehoben. Mit markigen Worten hatte Bettina Stark-Watzinger vor einem Jahr vor den Risiken von Forschungskooperationen gewarnt. In Interviews sagte die Forschungsministerin, dass hinter jedem chinesischen Wissenschaftler die Kommunistische Partei stehen könnte.
Aus der Wissenschaftscommunity gab es Kritik an den oft als populistisch und pauschal wahrgenommenen Äußerungen Stark-Watzingers. Namhafte Wissenschaftsmanager wie MPG-Präsident Patrick Cramer und die DFG-Präsidentin Katja Becker betonten anschließend die Bedeutung der Beziehungen und die Verantwortung und Autonomie des Wissenschaftssystems in dieser Frage. Gemeinsamer Forschung in risikoarmen Bereichen solle nichts im Wege stehen, so der Tenor.
In anderen Feldern müssten Risiken wie Spionage, die Nähe zur Militärforschung und Einschränkungen der Wissenschaftsfreiheit allerdings klar benannt und erkannt werden, um nicht naiv zu handeln.
Wie genau man diesen schmalen Grat auf diplomatischer Arbeitsebene beschreitet, damit ist von deutscher Seite unter anderem Ruth Narmann betraut, die bei der Leopoldina die Abteilung für Internationale Beziehungen leitet. 2018 hätten sich die beiden ehemaligen Akademiepräsidenten Chunli Bai und Jörg Hacker bei einem Delegationstreffen darauf verständigt, im Bereich der Grundlagenforschung enger zusammenzuarbeiten, berichtet Narmann im Gespräch mit Table.Briefings.
“In China wird das Thema Grundlagenforschung zwar immer wichtiger, es wurde und wird aber öffentlich noch nicht so wahrgenommen. Und zugleich kommen in Deutschland auch immer mal wieder die Debatten über die Relevanz von Grundlagenforschung auf, auch wenn wir hierzulande verglichen mit anderen Ländern noch eine komfortable Situation haben”, sagt die Sinologin. So sei die Idee entstanden, sich bei der künftigen Zusammenarbeit darauf zu fokussieren. Bei der Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft steht das Thema naturgemäß im Vordergrund.
Ziel der Akademien-Kooperation sei es gewesen, ein Netzwerk mit renommierten Forschenden und gestandenen und “unantastbaren” Nobelpreisträgern auf beiden Seiten zu nutzen und in einem zweijährigen Rhythmus Konferenzen unter dem Titel “Science for Future” zu veranstalten: “Wir sehen unsere Arbeit mit China ja nicht nur als internationale Zusammenarbeit in der Wissenschaft, sondern durchaus auch als Science Diplomacy. So ist der Austausch und die aktive Beteiligung junger Wissenschaftler ein Teil der Initiative, was in der Wissenschaftskultur Chinas aktuell noch weniger ausgeprägt ist als bei uns”, erklärt Narmann.
Im Hinblick darauf sei die erste Science for Future-Konferenz in Peking mit dem Titel “All Starts with Basic Research” im Jahr 2019 ein voller Erfolg gewesen. Dann sei die Coronavirus-Pandemie dazwischengekommen. Den Kontakt habe man aber gehalten und im vergangenen Jahr sei eine Präsidentendelegation der Leopoldina in China gewesen. Dort wurde die Fortsetzung der Konferenzreihe in diesem Jahr beschlossen, also genau zu jener Zeit, als die Debatte über Forschungskooperationen mit China hierzulande ihren Höhepunkt erreichte.
Auf die Frage, ob die Debatte über De-Risking für die Konferenz und den Austausch mit der CAS von Bedeutung sei, antwortet Ruth Narmann mit einem klaren “Jein”. Der Nein-Part ihrer Antwort beziehe sich darauf, dass die beiden Akademien ja nicht gemeinsam forschen würden. Anders als die CAS betreibt die Leopoldina keine eigene Forschung. Der Ja-Part beziehe sich auf die gesellschafts- und forschungspolitische Bedeutung: “Es ist auch ein Signal an die Öffentlichkeit: Wir brauchen die Kooperation, wir kommen an China nicht vorbei.”
Selbstverständlich bekomme die chinesische Seite die Debatte in Deutschland mit, sagt Narmann. “Es ist ein Thema, auf das wir in unseren bilateralen Gesprächen immer wieder angesprochen werden. Genau wie die deutsche Seite die Punkte anspreche, die wir kritisch sehen, etwa Meinungs- und Forschungsfreiheit oder die Dual-Use-Thematik.” Das Prinzip sei miteinander, statt übereinander zu reden und die Beziehungen proaktiv zu gestalten.
“Wir vergessen oft, dass wir viele chinesische Forschende in Deutschland haben, die teilweise hochrangige Positionen im deutschen Forschungssystem innehaben. Da sollte man schon einen Moment nachdenken, ob man alle Wissenschaftler aus China pauschal als Geheimnisverräter bezeichnet”, sagt Narmann. Seit 2005 befasse sie sich in ihrer Arbeit als Wissenschaftsmanagerin mit dem deutsch-chinesischen Austausch. China sei zunächst als Entwicklungsland wahrgenommen worden, anschließend sei eine China-Euphorie ausgebrochen, die sich jetzt ins Gegenteil verkehre.
Es gebe Themen, “da können wir allein nicht weiterarbeiten, da brauchen wir die Zusammenarbeit”. In Teilen sei die Forschung besser als in Deutschland und das System leistungsfähiger. Dies gelte zum Teil auch für den Bereich Energie- und Klimaforschung, der auch von globaler Relevanz sei. Schnell hätten sich die beiden Akademien deshalb auf ein Thema für die zweite Science for Future-Konferenz einigen können: “On the path to Carbon Neutrality”.
In einer gemeinsamen Berlin Declaration soll am heutigen Dienstag eine gemeinsame Willensbekundung zur Umstellung der Energiesysteme in Richtung CO₂-Neutralität unterschrieben werden. Darin soll sich auch die Absicht finden, die Wissenschaft bei der Entwicklung neuer Technologien zu unterstützen, internationale Kooperationen zu dem Thema zu fördern und schließlich auch die Anwendung dieser Technologien zu forcieren.

Herr Strowa, was bislang im US-Wahlkampf kaum eine Rolle spielt, sind die Themen Hochschulen, Forschung und Wissenschaft. Oder haben Sie einen anderen Eindruck?
Tatsächlich sind diese Themen in den öffentlichen Debatten nicht so präsent. Anders sieht das aus, wenn Sie an die Hochschulen gehen. Dort ist man sehr daran interessiert, was die Wahl für internationale Kooperationen oder die Forschungsförderung bedeutet. Aber für die Durchschnittsfamilie, die hier für eine Packung Milch im Supermarkt inzwischen über acht Dollar zahlt, sind solche Themen nicht zentral. Da geht es um die Wirtschaft, um Inflation und affordability, insbesondere von republikanischer Seite gerne verknüpft mit dem Thema Immigration. Innenpolitisch sind die Studiengebühren am Rande ein Thema. Die Demokraten wollen Hochschulbildung zugänglicher und erschwinglicher machen und zum Beispiel schon länger mit Gebührenerlassen für Entlastung sorgen. Die Republikaner entgegnen, es sei ungerecht, wenn einige Studierende entschuldet würden, während andere ihre Kredite abbezahlen mussten.
Gibt es im Bereich Forschungspolitik aus Ihrer Sicht Überschneidungen zwischen den Wahlprogrammen?
Parteiübergreifendes Ziel ist es, den eigenen Markt zu stärken. Das gilt durchaus auch für die Bereiche Bildung und Innovation, nur die Ansätze sind unterschiedlich: eine stärkere Regulierungsaufsicht auf republikanischer Seite, mehr staatliche Unterstützung auf demokratischer. Beide Parteien wollen das eigene Wissenschaftssystem so kompetitiv und stark wie möglich halten, was immer auch wirtschaftliche Implikationen hat. Man setzt auf die eigene Innovationsstärke, ist sich aber bewusst, dass man für die eigene Wettbewerbsfähigkeit auch den internationalen Austausch braucht. Das war auch unter der ersten Trump-Regierung nicht anders. Auch damals hat man sich nicht gänzlich abgeschottet.
Apropos Abschottung: Experten warnen davor, dass der globale Innovationsmotor ins Stocken gerät, wenn das Verhältnis zwischen China und den USA sich weiter verschlechtert. Was würde ein Präsident Trump für die Beziehung bedeuten?
Das US-Wissenschaftssystem ist weniger stark von staatlichen Fördermitteln abhängig als das deutsche. Die Hochschulen sind hier deutlich autonomer und steuern ihre Forschungskooperationen eigenständiger. Es wird also – egal welche Partei das Rennen macht – auch weiter Kooperationen geben. Ein Knackpunkt könnte die Visavergabe sein. Unter der ersten Trump-Präsidentschaft wurde diese wesentlich restriktiver gehandhabt. Es ist auch denkbar, dass bei einer Wiederwahl Trumps im Bereich der US-Beteiligung an internationalen Forschungsprojekten gekürzt wird.
Was ist mit Blick auf China von einer möglichen demokratischen Präsidentin Kamala Harris zu erwarten?
Man setzt die Hoffnung in die Demokraten, dass sie in Sachen Diplomatie auch Science Diplomacy etwas besser navigieren können. Über Harris’ Running Mate Tim Walz ist bekannt, dass er einer der ersten amerikanischen Lehrkräfte im Rahmen der World-Teach-Initiative der Harvard University in China gewesen ist und dort gelehrt hat. Er hat die Vizepräsidentendebatte genutzt, um positiv von seinen Auslandserfahrungen und dem Mehrwert von internationalem Austausch zu sprechen. Während Trump in seiner ganzen Rhetorik anti-China ist, er bezeichnet das Coronavirus zum Beispiel immer noch als “China-Virus”. Den Demokraten traut man eher zu, einen Mittelweg in den Beziehungen zu finden. Aber auch hierzulande spielt das Thema Forschungssicherheit eine zentrale Rolle, und zwar parteiübergreifend, wenn auch mit unterschiedlichen Ansätzen.
In Deutschland wird intensiv darüber diskutiert, wie man sich auf eine zweite Präsidentschaft von Donald Trump einstellen kann. Welche Rolle spielt dabei die viel beschworene Science Diplomacy?
Es geht darum, bestehende Netzwerke zu pflegen und auch unabhängig von der regierenden Partei aufzuzeigen, dass die wissenschaftlichen Beziehungen zu den USA einen gegenseitigen Mehrwert haben. Es ist im Interesse beider Länder, die Wissenschaftsbeziehungen mit voller Kraft fortzuführen, auch wenn uns die politische Richtung einer neuen Regierung nicht zusagen sollte. Es wird darum gehen, gemeinsame Themen zu identifizieren, an denen man noch intensiver zusammenarbeiten kann und dafür Partner zu suchen. Im Bereich Klimaforschung beispielsweise gibt es viele Anknüpfungspunkte auf Ebene der Bundesstaaten, sodass das föderale System der USA auf beiden Seiten viele Türen öffnen oder offenhalten kann.
Welche konkreten Folgen könnte die Wahl für die deutsch-amerikanische Beziehung im Bereich Wissenschaft haben?
Es gibt Stimmen, die sagen, dass der amtierende Präsident Joe Biden der letzte wahre Transatlantiker ist. Je nach Besetzung des Kongresses könnten die USA eine sehr viel selektivere Außenwissenschaftspolitik führen, nicht nur mit Blick auf China. Der Fokus der USA schwenkt stärker in Richtung Indopazifik, auch im Wissenschaftsbereich. Aber auch da haben wir als Bundesrepublik Deutschland eine Menge bewährte Expertise und Kontakte und es gibt viele Themen, die zukünftig multi-lateral bearbeitet werden müssen. Gleichzeitig ist es wichtig, das eigene Licht nicht unter den Scheffel zu stellen. Nicht zufällig wurden bei den WTZ-Verhandlungen in Berlin erst im Mai einige neue Impulse gesetzt, etwa ein neues Memorandum of Understanding zur Quantenforschung. Das ist nicht alles hinfällig, nur weil es einen neuen Präsidenten oder eine neue Präsidentin gibt. Gerade im Bereich Wissenschaft sind die deutsch-amerikanischen Partnerschaften über Jahrzehnte gewachsen und von großer Kontinuität geprägt.
In welchen Forschungsbereichen werden die USA, abhängig oder unabhängig vom Wahlergebnis, Schwerpunkte setzen?
Das ist auch abhängig von der Zusammensetzung des Kongresses. Die Demokraten setzen tendenziell stärker auf die Grundlagenforschung und Klimaschutz, dabei geht es auch ums Framing: Eigentlich leistet der Inflation Reduction Act beispielsweise einen enormen Schub für saubere Energie und Klimaschutz. Ein Programm mit Klimaschutz im Namen wäre derzeit ein hard sell, aber auch die Republikaner wollen die Inflation bekämpfen. Darüber hinaus gibt es parteiübergreifend bei KI und der Quanten- und Fusionsforschung, Halbleiter und Mikroelektronik starke Verbindungen nach Europa und natürlich auch beim gemeinsamen Thema Forschungssicherheit. Es geht den US-Amerikanern darum, mit like minded partners an Zukunftsthemen zu arbeiten, die auch einen Vorsprung zum Beispiel gegenüber China und Russland versprechen. Auch die militärische Forschung könnte in den USA eine noch größere Rolle einnehmen, insbesondere unter Trump.
Welche Auswirkungen wird die Wahl auf Ihre eigene Arbeit haben. Sie stehen persönlich gerade am Start. Wie planen Sie für die nächste Zeit?
Wir planen nicht Programm A, wenn die Demokraten gewinnen und Programm B, wenn die Republikaner gewinnen. Unser Grundprinzip ist, bestehende Strukturen und den Austausch zu verdichten und stärken. Wir wollen den gegenseitigen Mehrwert deutlich machen und eine Art Interpretationshilfe leisten – in beide Richtungen. Durch unser Netzwerk können wir ein zeitgemäßes, modernes Deutschlandbild an und in die US-Universitäten tragen, und zwar nicht nur an den Küsten, sondern bis ins amerikanische Heartland. Es geht dabei auch darum, Entwicklungen in Deutschland hier vor Ort besser einzuordnen. Zum Beispiel das Erstarken der AfD. In umgekehrter Richtung wird es ebenfalls wichtiger werden, Entwicklungen in den USA einzuordnen zu helfen. Ganz konkret werden im akademischen Austausch hybride Programme mit beidseitigen Kurzaufenthalten und Online-Phasen immer wichtiger. Und: persönliche Kontakte, Besuchsprogramme und Delegationsreisen sind zentral, auch und gerade nach der Wahl.
Christian Strowa hat Anglistik, Psychologie und Medienwissenschaften studiert und leitet seit September 2024 die DAAD-Außenstelle Nordamerika in New York. Davor leitete er in der DAAD-Zentrale in Bonn den Bereich “Wissen und Netzwerk” und war unter anderem für das Kompetenzzentrum Internationale Wissenschaftskooperationen (KIWi) verantwortlich.


Jutta Allmendinger – ehemalige Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB)
Jutta Allmendinger ist eine der bekanntesten Wissenschaftlerinnen hierzulande. Die ehemalige Präsidentin des WZB (2007 bis 2024) beteiligte sich in den vergangenen beiden Jahrzehnten mit Expertise, aber auch meinungsstark an unzähligen gesellschaftlichen Debatten. Schwerpunkte ihrer international anerkannten Forschung umfassen die Soziologie des Arbeitsmarktes, die Bildungssoziologie, soziale Ungleichheit und Sozialpolitik. Wer glaubt, dass es ruhig um Allmendinger wird, weil ihre Nachfolgerin Nicola Fuchs-Schündeln inzwischen übernommen hat, der dürfte sich täuschen. Allmendinger hat unter anderem im Juni den Vorsitz der Wissenschaftlichen Kommission Niedersachsen übernommen und wird dem neuen Ethikrat der Bundesregierung angehören.

Ralph Caspers – Moderator des WDR-Youtube-Kanals Quarks Dimension Ralph
Um die Vermittlung von Wissen und Wissenschaft vor allem an ein junges und junggebliebenes Publikum hat sich Ralph Caspers sehr verdient gemacht. Der Moderator und Autor aus Köln ist vor allem durch die Moderation der “Sendung mit der Maus” und der KIKA-Sendung “Wissen macht Ah!” bekannt, die er über 20 Jahre moderierte. Seit 2010 steht er bei “Quarks” und “Frag doch mal die Maus” als “Mausexperte” vor der Kamera und betreibt mit “Quarks Dimension Ralph” seinen eigenen Youtube-Kanal. Nebenbei ist er Autor mehrerer Kinderbücher. Für seine Leistungen wurde Caspers bereits mehrfach ausgezeichnet. Er erhielt 2010 den Erich-Kästner-Preis, 2012 den Grimme-Preis und 2019 das Bundesverdienstkreuz.

Mai Thi Nguyen-Kim – Moderatorin der ZDF-Show MAITHINK X
Nachdem die promovierte Chemikerin 2014 verschiedene Science Slams gewonnen hatte, wagte sie sich an die Videoproduktion. Ihr Video “Trust me I’m a Scientist”, das 2016 den Fast Forward Science-Award gewann, kann bereits als Reaktion auf die Zunahme von Fake News und das Aufkommen des Trumpismus gesehen werden. Nach dem Abschluss ihrer Promotion 2017 widmete sie sich vollständig der Wissenschaftskommunikation und dem Wissenschaftsjournalismus. Sie moderierte Quarks beim WDR und publizierte Web-Videos auf den Kanälen MaiLab und später MAITHINK X. Ein Millionenpublikum erreichte Nguyen-Kim mit ihren Videos zur Corona-Pandemie. Seit 2021 hat sie ihre eigene Show bei ZDFneo. Die gebürtige Heppenheimerin sitzt im Senat der Max-Planck-Gesellschaft.

Thomas Sattelberger – ehemaliger Parlamentarischer Staatssekretär im BMBF
“Endlich normaler Bürger!” So beschreibt sich Thomas Sattelberger selbst auf der Plattform X. Auch wenn er im Mai 2022 sein Amt als Parlamentarischer Staatssekretär im BMBF aus privaten und gesundheitlichen Gründen niederlegte, stimmt diese Aussage nicht ganz. Der Manager, frühere Leiter Personalentwicklung bei der Lufthansa und Personalvorstand und Arbeitsdirektor bei der Telekom meldet sich weiterhin meinungsstark im politischen Betrieb zu Wort – nicht nur mit seinen Kolumnen im Research.Table. Er tritt für Diversity Management, mehr MINT und mehr Frauen in der Führung ein. Das langjährige FDP-Mitglied provoziert gern – und das nicht erst jetzt: In jungen Jahren war Sattelberger mit Joschka Fischer in der Außerparlamentarischen Opposition (APO) aktiv – für eine “sozialistische Weltrevolution”.
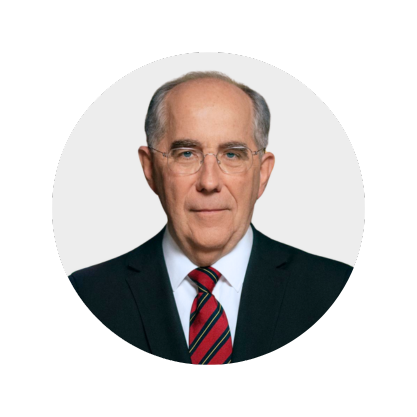
Reinhard Pöllath – Rechtsanwalt und Mitgründer der Max-Planck-Förderstiftung
Der gebürtige Oberfranke und Sohn einer Schreinerfamilie entschied sich für ein Jurastudium und absolvierte an der Harvard Law School seinen Master. 1997 gründete er die Kanzlei P+P Pöllath + Partners. Pöllath ist Honorarprofessor am Institut für Steuerrecht der Universität Münster und Vorstandssprecher der Max-Planck-Förderstiftung, die er 2006 gemeinsam mit Stefan von Holtzbrinck gegründet hat. Darüber hinaus engagiert er sich in der Beiersdorf-Unna-Stiftung und ist Mitglied des Kuratoriums der Stiftung Lindauer Nobelpreisträgertreffen. Anlässlich seines 60. Geburtstags erreichte die Max-Planck-Gesellschaft bei der International Astronomical Union, dass der Asteroid 7448 nach Reinhard Pöllath benannt wurde. Der Himmelskörper wurde am Tag vor Pöllaths Geburt entdeckt.

Max Voegler – Vice President for Global Strategic Networks – DACH bei Elsevier
Der Historiker, der für das Unternehmen Elsevier strategische Netzwerke gestaltet, beschreibt sein Verhältnis zur Wissenschaft wie folgt: “Ich liebe das Wissenschaftssystem mit seiner ungeheuren Vielfalt an Disziplinen und Themen.” Als Vice President for Global Strategic Networks für Elsevier DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) ist er also genau richtig. Voegler ist ein Netzwerkexperte, der sich selbst als deutsch-amerikanisches Hybridmodell bezeichnet. Schon als Kind lebte er einige Jahre lang in den USA, seine Doktorarbeit in europäischer Geschichte schrieb er in New York, wo er später Leiter des DFG-Büros wurde. Ein ausführliches Porträt lesen Sie hier.

Amrei Bahr – Juniorprofessorin an der Universität Stuttgart
Amrei Bahr fühlte sich angesprochen, als sich das BMBF im Jahr 2021 in einem Video an der Erklärung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG) probierte. Die dortige Darstellung, nach der das WissZeitVG verhindere, dass eine Generation alle Stellen in der Wissenschaft verstopfe, löste heftige Kritik beim wissenschaftlichen Nachwuchs aus. Die Wortführenden Amrei Bahr, Sebastian Kubon und Kristin Eichhorn gründeten die Beschäftigten-Initiative #IchBinHanna – benannt nach der fiktiven Protagonistin des BMBF-Imagefilms. Die über soziale Netzwerke organisierte Graswurzelbewegung wurde zu einer unüberhörbaren Stimme in der Debatte um die Novellierung des Gesetzes in dieser Legislaturperiode – und Amrei Bahr zu ihrem Gesicht.

Johannes Vogel – Generaldirektor des Museums für Naturkunde Berlin
Er fällt auf durch seinen Dalí-Schnurrbart und seine zumeist mit botanischen Motiven versehenen Krawatten. Im Gespräch mit Table.Briefings trug er sogar rote Manschettenknöpfe in Tomatenform. Der Botaniker, seit 2012 Direktor des Berliner Museums für Naturkunde – Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung, macht ebenfalls als Wissenschaftler, Visionär und durch sein gesellschaftspolitisches Engagement von sich reden. Er hat das Museum auch zu einem Ort der politischen Debatte gemacht. Wenn es um den Einsatz für unsere rechtsstaatliche Demokratie und um die Aufrechterhaltung unserer natürlichen Lebensgrundlagen gehe, müsse man politisch sein, sagt er. Bevor er nach Berlin kam, war Vogel am Natural History Museum in London. Verheiratet ist er mit Sarah Darwin, der Ur-Ur-Enkelin von Charles Darwin.

Stefan Brandt – Direktor des Futuriums
Seit 2017 ist er Direktor des Futuriums, das direkt neben dem Berliner Gebäude des BMBF gelegen ist. In dem Ausstellungs-, Veranstaltungs- und Experimentierforum geht es um Zukunftsszenarien und ihre aktive Gestaltung. Aktuell kann sich der Kulturmanager über Besucherrekorde freuen. Zuletzt schloss sich auch die DFG dem Kreis der Gesellschafter an, zu denen bereits die Wissenschaftsorganisationen MPG, Helmholtz und Leibniz gehören. “Wir werden wahrgenommen als eine Einrichtung, die für niemanden Werbung macht, weder für die Bundesregierung noch für Unternehmen oder andere Akteure”, sagte er im Gespräch mit Table.Briefings. Brandt stammt aus Weimar, ist promovierter Musikwissenschaftler und war vor seinem Wechsel nach Berlin Geschäftsführer und Vorstand der Hamburger Kunsthalle.

Hasso Plattner – Mitbegründer von SAP und Mäzen
Seit sich der Mitbegründer des IT-Unternehmens SAP aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen hat, engagiert er sich als Mäzen. Er hat viel ermöglicht, im Kulturbereich etwa den Wiederaufbau des Potsdamer Palais Barberini. In der Wissenschaft hat er sich als Stifter und Gründer des Hasso-Plattner-Instituts für Softwaresystemtechnik (HPI) an der Universität Potsdam hervorgetan, das Informatiker ausbildet. Gesellschafter ist die Hasso Plattner Foundation, die den Betrieb vollständig finanziert. Plattner hat in Karlsruhe Nachrichtentechnik studiert, seine ersten beruflichen Schritte machte er 1968 bei IBM in Deutschland, bereits vier Jahre später gründete er mit seinen Kollegen Claus Wellenreuther, Hans-Werner Hector, Klaus Tschira und Dietmar Hopp die Firma SAP.
29.-30. Oktober 2024, Berlin Adlershof Science City
Konferenz Science for Future: On the Path to Carbon Neutrality Mehr
30. Oktober – 1. November 2024, Heidelberg
Konferenz Wissenswerte Mehr
2. November 2024, Humboldt-Universität zu Berlin
Berlin Science Week, Live-Podcast “Fragile Freiheit” Mehr
4. November 2024, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung
Diskussion Bedrohte Wissenschaft: Ungeliebte Wahrheit Mehr
4. November 2024, TU Berlin
Diskussion “Resiliente Universität. Internationale Kooperation in Zeiten der Krise” Mehr
7.-9. November 2024, Berlin
Konferenz Falling Walls Science Summit 2024 Mehr
8. November 2024, Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, Berlin
Diskussion Bedrohte Wissenschaft: Politische Einflussnahme Mehr
11.-12. Dezember, Berlin
Forum Wissenschaftskommunikation Wissenschaftskommunikation für eine starke Demokratie und offene Gesellschaft Mehr
Im Juli ist die Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde (DGO) vom russischen Justizministerium als “extremistische Organisation” eingeordnet worden. Dieser Schritt wurde bereits von verschiedenen Stiftungen und Verbänden kritisiert, nun äußert sich dazu auch die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) mit warnenden Worten. Mit der Einstufung sei ein neuer Tiefpunkt in den aktuell ohnehin stark eingeschränkten russisch-deutschen Wissenschaftsbeziehungen erreicht, teilte die HRK am Montag mit.
Nun drohten potenziell jedem nach Russland reisenden DGO-Mitglied willkürliche Kriminalisierung und strafrechtliche Verfolgung. Zudem könne jeder, auch private Austausch von DGO-Mitgliedern mit russischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern deren Sicherheit gefährden.
“Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ruhen die institutionellen Wissenschaftskooperationen zwischen Deutschland und Russland. Das ist schmerzhaft, aber richtig”, sagte HRK-Präsident Walter Rosenthal. Persönliche Kontakte blieben grundsätzlich möglich – auch um die Reste einer wertegebundenen, liberalen Wissenschaft und Zivilgesellschaft in Russland zu unterstützen. “Dagegen richten sich offenbar verstärkt Maßnahmen des russischen Regimes.”
Nach russischem Recht erfülle die bloße Mitgliedschaft in und die Zusammenarbeit mit der DGO nunmehr Straftatbestände, die mit Haftstrafen von bis zu zwölf Jahren geahndet werden können. Angesichts der gravierenden Folgen, die daraus für Mitglieder der Fachgesellschaft und ihre Kooperationspartner erwachsen, hat die HRK ihre Mitglieder gebeten, alle Hochschulangehörigen entsprechend zu sensibilisieren, um sie vor möglichen Gefahren und Repressalien zu schützen.
Die Bemühungen, die DGO mundtot zu machen, ziehen sich bereits länger hin. Im Februar war sie von russischer Seite bereits zur “unerwünschten Organisation” erklärt worden – was vor allem für russische Staatsangehörige bei einer Zusammenarbeit oder der Teilnahme an Veranstaltungen drastische Strafen bedeutet.
Der deutsche Botschafter in Moskau, Alexander Graf Lambsdorff, hat in der vergangenen Woche beim russischen Außenministerium erneut gegen die völlig ungerechtfertigte Einstufung der DGO protestiert. Er forderte Russland auf, das so schnell wie möglich rückgängig zu machen. In einer Verbalnote habe die deutsche Seite Lambsdorff zufolge deutlich gemacht, dass die DGO seit vielen Jahrzehnten eine der wichtigsten Organisationen der Osteuropakunde sei. abg
Bayerische Kleinstsatelliten sollen in Zukunft aus dem Weltraum hochauflösende Fotos des Freistaats liefern. Bereits Ende 2025 bis Anfang 2026 sollen die ersten fünf Satelliten im Auftrag der Vermessungsverwaltung zu einer Probemission ins All starten, um dann in einer Umlaufbahn von 460 Kilometern über der Erde ihre Arbeit aufzunehmen. Die Satelliten sind nur 37 mal 23 mal 10 Zentimeter groß und wiegen nur zehn Kilogramm.
“Mit einer eigenen Erdbeobachtungsmission wollen wir demnächst ins All starten und uns maßgeschneiderte Geodaten direkt aus dem Weltraum holen”, sagte der bayerische Finanz- und Heimatminister Albert Füracker (CSU). Die gesamte Prozesskette des Forschungsprojekts bleibe in bayerischer Hand – von der Datenaufnahme im All über die Verarbeitung am Boden bis zur Bereitstellung für alle Bürgerinnen und Bürger. “Dies ist ein entscheidender Vorteil gegenüber kommerziellen Anbietern und ein wichtiger Beitrag zur digitalen Souveränität des Freistaats.”
“Die gewonnenen Satellitendaten werden sich ideal für Auswertungen bei Hochwasserprognosen, Klimaveränderungen oder in der Land- und Forstwirtschaft eignen”, sagte Füracker. Durch ein KI-unterstütztes Datenauswertungs- und Managementsystem würden die Daten aus dem All effizient gespeichert, analysiert und visualisiert. “Damit ermöglichen wir eine zeitnahe und zielgerichtete Weiterleitung der Informationen an relevante Stellen innerhalb und außerhalb der Staatsverwaltung.”
Konkret handelt es sich um mit einer Multispektralkamera ausgestattete Kleinstsatelliten, die in Kooperation mit dem Zentrum für Telematik und der S4 Smart Small Satellite Systems GmbH entwickelt wurden. Diese sollen alle drei Tage Bilder des Freistaats liefern. Unterstützt wird das Projekt von der Technischen Universität München bei der Entwicklung der Auswertealgorithmen. Nach einem umfassenden Probebetrieb soll in einem zweiten Schritt über den Ausbau der Mission zur Erfassung ganz Bayerns entschieden werden. Mit der Mission werde Bayern auch als industrieller Raumfahrtstandort gefördert und gleichzeitig die bayerische Wirtschaft gestärkt, so Füracker. tg mit dpa
Mehr als 80 US-Nobelpreisträger haben sich in einem offenen Brief für die Demokratin Kamala Harris als Präsidentin ausgesprochen. “Das ist die folgenschwerste Präsidentschaftswahl seit langem, vielleicht jemals, für die Zukunft der Wissenschaft und der Vereinigten Staaten”, heißt es in dem Brief, den unter anderem die New York Times veröffentlichte.
“Wir Unterzeichner unterstützen Harris mit Nachdruck.” Harris verstehe, dass das Wachstum der Lebenserwartung und des Lebensstandards der vergangenen Jahrzehnte in den USA zu großen Teilen auf Fortschritte bei Wissenschaft und Technologie zurückgehe, heißt es weiter. Zudem verstehe sie die zentrale Rolle, die Einwanderer bei diesen Fortschritten gespielt hätten. Unter Trump wären diese Fortschritte in Gefahr.
Initiator des Briefes ist Joseph Stiglitz, Wirtschaftswissenschaftler an der Columbia University. Er erhielt 2001 den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften. Im Gespräch mit der New York Times sagte Stiglitz, dass ihn die “enormen Kürzungen der Wissenschaftsbudgets”, die Trump schon während seiner ersten Präsidentschaft vorgeschlagen hatte, sowie die “wissenschaftsfeindliche” und “universitätsfeindliche” Haltung des ehemaligen Präsidenten zu der Initiative motiviert hätten.
“Ich hoffe, es ist ein Weckruf für die Menschen”, sagte Stiglitz. Die Wahl habe tiefgreifenden Einfluss auf die wissenschafts- und technologiepolitische Agenda. tg
FAZ: KI-Einsatz regeln und nicht verbieten. Generative KI gehört an Hochschulen längst zum Alltag. Verbieten kann und sollte man sie nicht. Was aber geschaffen werden sollte, sind Regelwerke und ein Verhaltenskodex für den Umgang mit KI-Systemen. (“Ein Regelwerk für den KI-Gebrauch”)
NZZ: Arbeiten über Designer-Babys. Der chinesische Biophysiker He Jiankui designte mit dem Gentechnikverfahren Crispr vor sechs Jahren zwei Kinder. He, der dafür ins Gefängnis kam, will nun die bei diesem Verfahren gesammelten wissenschaftlichen Daten veröffentlichen. Bedingung ist allerdings, dass dies in einer renommierten wissenschaftlichen Publikation geschieht. (“Wie sind die ersten Designer-Babys entstanden? Jetzt will der verantwortliche Forscher endlich seine Studien veröffentlichen”)
Tagesspiegel: Weniger Studierende in den Ingenieurwissenschaften. In den letzten zehn Jahren ist die Zahl der Erstsemester in den Ingenieurwissenschaften und der Informatik laut Zahlen des Centrum für Hochschulentwicklung um 11.000 auf knapp 110.000 gesunken. Besonders betroffen von dieser Entwicklung sind die Elektrotechnik und der Maschinenbau. (“Weniger Erstsemester in Mint-Fächern: Experten warnen vor Verschärfung des Fachkräftemangels”)
Stern: Gesichtserkennungssoftware bei Prüfungen erlaubt. Nach einem Urteil des Landgerichts Erfurt ist der Einsatz von Gesichtserkennungssoftware bei Online-Prüfungen legal. Gegen den Einsatz der Software während einer Prüfung in der Pandemie hatte die Gesellschaft für Freiheitsrechte geklagt. (“Gesichtserkennung bei Onlineprüfungen an Universität Erfurt rechtens”)
Nürnberger Nachrichten: Kein Chip-Forschungszentrum in Franken. Die Pläne für ein gemeinsames Chip-Forschungszentrum von Wolfspeed und dem Autozulieferer ZF wurden gestoppt. Es sollte auf eine Fabrik für Leistungshalbleiter im Saarland ausgerichtet sein, deren Bau sich ebenfalls verzögert. (“Projekt gestoppt: Franken bekommt wohl doch kein neues Forschungszentrum für Mikrochips”)
Guardian: Weniger schwarze Studierende an US-Unis. Seit der Oberste Gerichtshof der USA die Förderung von Minderheiten verboten hat, ist die Zahl der Studienanfänger farbiger Herkunft zurückgegangen. Als Reaktion haben mehrere Universitäten den Legacy-Status bei der Zulassung nicht mehr zu berücksichtigen, der Studienanfänger mit Alumni in der Familie bevorzugte. (“US universities are struggling to increase diversity. Are legacy admissions part of the problem?”)
Welt: Ivy-League-Unis sind ihr Geld nicht mehr wert. Der Vormarsch der Künstlichen Intelligenz, Antisemitismus, Kulturkämpfe und immer mehr gut bezahlte Berufe, für die man keinen Hochschulabschluss benötigt, bereiten den US-Eliteunis zunehmend Probleme. Die mit hohen Kosten verbundenen Abschlüsse der Ivy-League-Unis lohnen sich immer weniger. (“Wie Amerikas Elite-Universitäten an Wert verlieren”)

Der Sanierungsstau an deutschen Hochschulen wird derzeit auf 74 Milliarden Euro geschätzt. Diese Summe lässt sich nicht aus den laufenden Landeshaushalten finanzieren. Vor dem Hintergrund der Schuldenbremse wird derzeit vermehrt als Lösung die Gründung privatrechtlich organisierter öffentlicher Infrastrukturgesellschaften diskutiert, um hierüber die Aufnahme von Krediten trotz Schuldenbremse zu ermöglichen und damit den Sanierungsstau an Hochschulen abzubauen.
Dabei ist jedoch zu bedenken: Selbst wenn es sich hier um ein rechtskonformes Konstrukt handelt, so werden in der Realität die Landeshaushalte dennoch in gleicher Höhe finanziell belastet wie bei einer eigenen Kreditaufnahme durch das Land. Denn auf der Ausgabenseite müssen Tilgungsraten für Kredite durch Mieten im Landeshaushalt ersetzt werden.
Das Modell von Infrastrukturgesellschaften zum Hochschulbau gibt es bereits in zwei Bundesländern (Nordrhein-Westfalen und Hamburg). In Hamburg sind aktuell nur einzelne Hochschulgebäude Teil des Modells. Die landeseigenen Infrastrukturgesellschaften Sprinkenhof GmbH sowie GMH errichten Neubauten und treten für diese als Vermieter gegenüber den Hochschulen beziehungsweise der Wissenschaftsbehörde auf. Die Mieten sind im Landeshaushalt im Wissenschaftsressort veranschlagt. Langfristig ist die Übernahme aller Hochschulliegenschaften durch die beiden Gesellschaften geplant.
In NRW existiert ein Sondervermögen, das kreditfähig ist und vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB) verwaltet wird. Das Sondervermögen enthält den Großteil aller Landesliegenschaften, also auch die Hochschulliegenschaften. Der BLB tritt somit als Vermieter auf. Hier werden ebenfalls die Mieten im Landeshaushalt im Wissenschaftsressort veranschlagt. Allerdings wird die Kreditaufnahme für das Sondervermögen vermutlich der Schuldenbremse unterliegen.
Schwer nachweisbar ist zudem, dass in diesen Bundesländern der Bestandserhalt beziehungsweise der Abbau des Sanierungsstaus im Hochschulbereich durch das Modell schneller beziehungsweise überhaupt erreicht werden kann. Die Situation stellt sich nach wie vor ähnlich wie in den anderen Bundesländern dar.
Ein erfolgreicher Weg zum Abbau des Sanierungsstaus bedarf grundsätzlicher Änderungen in der Herangehensweise. Das betrifft zum einen die Bedarfsermittlung und zum anderen die Haushaltspraxis. Der Umstand, dass erstellte Gebäude regelmäßige Reinvestitionen bedürfen, um dauerhaft genutzt werden zu können, ist in der Vergangenheit sowohl bei Bauentscheidungen als auch den anschließenden Haushaltsplanungen tendenziell unberücksichtigt geblieben.
Unmittelbar nach jeder Maßnahme, Neuerstellung oder Sanierung beginnt theoretisch der Wertverlust, der sich nach einer gewissen Zeit auch als realer Substanzverlust darstellt. Einem Wertverlust muss immer eine entsprechende Reinvestition in der Haushaltsplanung gegenüberstehen. Diese Vorgehensweise findet in der Kameralistik der Landeshaushalte und dem Bundeshaushalt jedoch keine Anwendung. Dadurch entsteht ein Teufelskreis, der zu immer wieder neuen, scheinbar überraschend erforderlichen Kreditaufnahmen führt.
Doch auch in der Kameralistik ist es möglich, entsprechende Budgets für den Bestandserhalt, der den investiven Bereich tangiert, im Landeshaushalt vorzuhalten. Ein Beispiel dafür ist Baden-Württemberg, wo ein jährliches Budget von 1 Milliarde Euro für Investitionen zum Bestandserhalt aller landeseigenen Gebäude (inklusive Hochschulgebäude) in den Haushalt eingestellt ist.
Damit die Kreditaufnahmen der privatrechtlich organisierten öffentlichen Infrastrukturgesellschaften nicht der Schuldenbremse unterliegen, müssen weitere Bedingungen erfüllt sein – die jedoch zu organisatorischen Herausforderungen führen. So müssen die Infrastrukturgesellschaften die Eigentümer- und Bauherrenaufgaben sowie einen Großteil der Gebäudemanagementaufgaben für die von ihnen erstellten Gebäude übernehmen, um als Vermieter, dem Mieten aus dem Landeshaushalt zugewiesen werden, auftreten zu können.
Um dieses Modell insbesondere mit Blick auf den Bestandserhalt umzusetzen, wäre eine Übertragung aller Hochschulliegenschaften auf die Infrastrukturgesellschaft erforderlich. Alle derzeit bestehenden Aufgaben zur Infrastruktur in den Hochschulen und Landesbaubetrieben würden diesen damit entzogen werden. Bei sukzessiver Übertragung hingegen kommt es über einen langen Zeitraum zu Parallelstrukturen und überschneidenden Zuständigkeiten zwischen den Infrastrukturgesellschaften, Landesbaubetrieben und den Hochschulen in Bezug auf den Gebäudebetrieb und das Gebäudemanagement. Zudem würde es den berechtigten Bestrebungen der Hochschulen zur Vereinfachung und Beschleunigung der Bauprozesse durch Reduzierung der an Bauprozessen Beteiligten zuwiderlaufen.
Darüber hinaus würde dieses Modell den Bestrebungen der Länder entgegenstehen, den Hochschulen, die aktuell auch den größten Teil der Gebäudemanagementaufgaben wahrnehmen, verstärkt die Bauherrenfunktion zu übertragen. Die Übertragung der Bauherrenfunktion wird ebenfalls als Lösung des Abbaus des Sanierungsstaus angesehen.
Ein zentrales Problem, das durch die Gründung neuer Infrastrukturgesellschaften tendenziell verstärkt wird, stellen zudem die begrenzten Personalkapazitäten unter anderem in den Landesbaubetrieben dar – ein weiterer Grund für die Übertragung der Bauherrenfunktion auf die Hochschulen. Der Erfolg der Gründung zusätzlicher Infrastrukturgesellschaften zu den bestehenden Einrichtungen erscheint angesichts des aktuellen Personalmangels fraglich und würde zu einer Verschärfung der Personalsituation bei Landesbetrieben und Hochschulen führen.
Zwar kann die Gründung von Infrastrukturgesellschaften eine Option sein, Kredite trotz Schuldenbremse aufzunehmen und dadurch dem System dringend benötigtes Geld für den Abbau des Sanierungsstaus zuzuführen. Entscheidend aus Sicht von HIS-HE ist aber, dass eine ganzheitliche Betrachtung des Immobilienbestands von Hochschulen erfolgt, eine realistische Kostenbetrachtung vorgenommen wird, die von Beginn an nicht nur Kosten für den Bau beziehungsweise die Sanierung sowie den Betrieb, sondern vor allem auch Reinvestitionskosten berücksichtigt und entsprechende Mittel in die Haushaltsplanungen Eingang finden.
Jana Stibbe ist beim HIS-Institut für Hochschulentwicklung (HIS-HE) in Hannover Expertin für Organisation im Hochschulbau, Grit Würmseer ist Geschäftsführende Vorständin.
Die bisherigen Beiträge der Table.Briefings-Serie zum Hochschulbau finden Sie hier.

Eines Tages, so hatte ihr Lehrer vorhergesagt, werde sie Mathematikprofessorin sein. Das war in den 1990er-Jahren, und ganz daneben lag er mit seiner Prognose nicht. Denn Lena Maier-Hein wurde Informatikprofessorin, blieb also der Welt der Zahlen treu. Allerdings auf weniger theoretische Weise als ihr Lehrer es vermutet hatte.
Heute leitet die 44-Jährige am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) die Abteilung Intelligente Medizinische Systeme und ist als Professorin sowohl an der Medizinischen Fakultät als auch an der Fakultät für Mathematik und Informatik der Universität Heidelberg tätig. “Das Analytische liegt mir”, sagt Maier-Hein, “und es begeistert mich, neue Konzepte in Diagnostik- und Therapiemöglichkeiten umzuwandeln.” Wie sie dabei vorgeht, berichtet sie am 9. November beim Falling Walls Science Summit in Berlin.

Im Fokus steht bei ihr die Chirurgie. “In der Krebschirurgie beispielsweise fehlt es bislang an Methoden, mit denen Chirurginnen und Chirurgen während einer Operation Funktion und Zustand von Geweben beurteilen können”, sagt die Informatikerin. Diesen Mangel beheben könnten künftig neuartige spektrale Bildgebungsverfahren, die ihr interdisziplinäres Team mit besonderen Kameras und Künstlicher Intelligenz kombiniert. Lena Maier-Hein: “So wird es möglich, in Echtzeit und ohne Strahlenbelastung in den menschlichen Körper hineinzusehen – und dabei für das menschliche Auge unsichtbare Informationen sichtbar machen.”
Damit Chirurgen und Patienten möglichst schnell von dem neuen Verfahren profitieren können, arbeitet Maier-Hein eng mit wissenschaftlichen, klinischen und industriellen Partnern zusammen. Für ihre hervorragende Transferarbeit erhielt sie am 22. Oktober den Landesforschungspreis Baden-Württemberg für Spitzenleistungen in der angewandten Forschung.
Maier-Hein habe enorme Fortschritte an der Schnittstelle von Künstlicher Intelligenz und chirurgischer Bildgebung erzielt, was die Effektivität und Sicherheit operativer Eingriffe deutlich erhöhe, heißt es in der Preisbegründung. Zudem habe sie gänzlich neue Forschungsfelder mit höchster Relevanz für medizinische Forschung und direkte klinische Anwendungen eröffnet.
Bereits als Studentin an der Universität Karlsruhe und am Imperial College in London wurde die gebürtige Hamburgerin mehrfach ausgezeichnet. 2013, da hatte sie gerade mal ein Jahr lang eine Juniorgruppe am DKFZ geleitet, erhielt sie den Heinz Maier-Leibnitz Preis der DFG. 2016 kam der Emil-Salzer Preis des DKFZ dazu, 2017 der Preis der Berlin-Brandenburgischen Akademie und in diesem Jahr der Deutsche Krebspreis 2024. Beim Europäischen Forschungsrat ERC errang sie zwei der höchsten Trophäen: 2014 den ERC Starting Grant, 2021 einen ERC Consolidator Grant.
Mit Mitte 40 hat Lena Maier-Hein viel erreicht – auch wenn sie in ihren Dreißigern als junge Mutter weniger arbeiten und schlafen konnte als viele ihrer Peers. Über diese Jahre und wie sie es schafft, Forschung und Familie unter einen Hut zu bekommen, davon erzählt sie in einem DKFZ-Imagefilm zusammen mit ihrem Mann, dem Informatikprofessor und Chef der DKFZ-Abteilung Medizinische Bildverarbeitung, Klaus Maier-Hein.
Ein durchorganisierter Alltag, die Kita am DKFZ und patente Großeltern, die auf die Kinder aufpassen, wenn die Eltern auf Konferenzen sind – mit Disziplin und viel Unterstützung haben es die Maier-Heins geschafft, zwei anspruchsvolle Karrieren mit Elternschaft zu verbinden. “Genau das wollten wir”, sagt er, “so haben wir es beide beschlossen.”
Im Team arbeiten Lena und Klaus Maier-Hein immer wieder auch in der Forschung. Aktuell engagieren sich beide im Human Radiome Project. Das weltweit einzigartige, federführend am DKFZ angesiedelte Projekt soll die radiologische Diagnostik und darauf aufbauende Therapien entscheidend voranbringen. Es geht darum, Auffälligkeiten zu entdecken, die dem menschlichen Auge entgehen – nicht nur im gerade untersuchten Organ, sondern auch im umgebenden Gewebe. Derzeit entsteht eine Art ChatGPT für Mediziner, ein radiologisches Basismodell für ganz unterschiedliche Anwendungen. Grundlagenforschung für die Praxis – das Credo Lena Maier-Heins kennt viele Variationen. Lilo Berg
“Breaking the Wall of Surgical Imaging” lautet der Titel von Lena Maier-Heins Vortrag am 9. November um 14.25 Uhr beim Falling Walls Science Summit in Berlin. Das Programm des Summit finden Sie hier, weitere Porträts der Table.Briefings-Reihe “Breakthrough-Minds” lesen Sie hier.
Wencke Gwozdz, Professorin für Versorgungs- und Verbrauchsforschung, wird Vizepräsidentin für Forschung und Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Sie folgt dem Veterinärmediziner Martin Kramer nach, Amtsantritt ist am 22. November.
Thomas Lemke ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender des Universitätsklinikums Carl Gustav Carus Dresden. Er folgt auf Gernot Brunner. Lemke ist seit mehreren Jahren Mitglied des Aufsichtsrates und Vorsitzender des Finanzausschusses des Klinikums. Janko Haft übernimmt das Amt des Kaufmännischen Vorstands. Er war zuletzt Direktor für Logistik, Infrastruktur und Versorgung am Klinikum. Neuer Medizinischer Vorstand ist Uwe Platzbecker.
Alexandra Nonnenmacher, seit 2019 Prorektorin für Bildung, Studium und Lehre an der Universität Siegen, wurde vom Senat der Hochschule Worms zur neuen Präsidentin gewählt. Mit der Soziologin schließt die Hochschule Worms ihre derzeitige Lücke im Präsidium. Zu Jahresbeginn waren bereits drei Professoren aus den drei Fachbereichen heraus ins Hochschulpräsidium gewechselt.
Horst Seehofer, ehemaliger bayerischer Ministerpräsident und Bundesminister a.D., wird Stiftungsratsvorsitzender der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU). Er löst Peter Beer ab, der dem Gremium seit 2018 vorstand. Die Stiftung kümmert sich insbesondere um die Vermögens- und Wirtschaftsverwaltung der Universität.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an research@table.media!
Bildung.Table. Digitalpakt II: Warum die Lehrerfortbildung das Vorhaben gefährdet. Sollen sich Lehrkräfte 30 Stunden im Jahr fortbilden müssen? Darüber sind sich Bund und Länder uneins. Ein viel größeres Problem ist das fehlende Monitoring. Mehr
Climate.Table. Atlantikströmung: Warum Forschende eindringlich vor ihrem Kollaps warnen. Der Weltklimarat habe das Risiko unterschätzt, der Zusammenbruch der wichtigen Meeresströmung könnte die menschlichen Lebensgrundlagen in Europa und darüber hinaus bedrohen. Renommierte Klimaforschende fordern die nordeuropäischen Länder deshalb dringend zum Handeln auf. Mehr
Europe.Table. “Starre Schuldengrenzen gefährden den Handlungsspielraum künftiger Generationen”. Im Streit um die deutsche Schuldenbremse verweist Finanzminister Christian Lindner gern auf die strengen EU-Fiskalregeln. Aber damit mache er es sich zu leicht, schreibt Marina Guldimann von Fiscal Future im Standpunkt. Deutschlands Problem sei eine wachstumsfeindliche Sparpolitik. Mehr
ESG.Table. Lieferketten: “Das Gesetz ist ein echter Wettbewerbsvorteil”. Die Wissenschaftlerin Lisa Fröhlich setzt einen Kontrapunkt in der aktuellen Diskussion um das Lieferkettengesetz. Es mache Unternehmen resilienter und spare ihnen sogar Geld, sagt die Gründerin des Ispira Thinktank für Nachhaltige Lieferketten im Interview. Mehr
